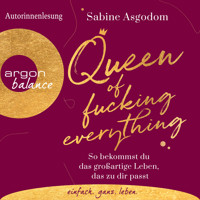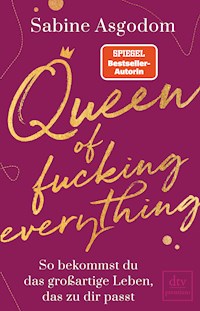Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GU Audiobook
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Lebenshilfe Inspiration
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch lässt Sabine Asgodom uns teilhaben an den wichtigsten Erkenntnissen, die sie im Lauf ihres bewegten Lebens für sich gewonnen hat und die die Kraft haben, auch unseren Blick auf das Leben grundlegend zu ändern. Sie tut dies in 70 teils vergnüglichen, teils dramatischen Geschichten, ehrlich und offen aus einer reflektierten Biographie erzählt. Und zu erzählen hat sie viel: Aus einem unglücklichen niedersächsischen Dorfmädchen wurde eine glückliche Frau, Mutter, Großmutter. Sie erzählt von einschneidenden Kindheitserlebnissen, ihrem Weg ins Ungewisse, von der Befreiung aus einer toxischen Beziehung, ihrem Scheitern, ihren Enttäuschungen und ihren Schritten in die Freiheit, die sie bei all dem immer gesucht hat.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
© Printausgabe: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
Gräfe und Unzer ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, www.gu.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektleitung: Nikola Teusianu
Lektorat: Ulrike Auras
Umschlaggestaltung: Katja Wohnrath, ki 36 Editorial Design, München
eBook-Herstellung: Maria Prochaska
ISBN 978-3-8338-9115-1
1. Auflage 2023
Bildnachweis
Coverabbildung: Quirin Leppert
Illustrationen: Mary Melbarde
Syndication: www.seasons.agency
GuU 8-9115 07_2023_01
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de
www.facebook.com/gu.verlag
Wichtiger Hinweis
Die Gedanken, Methoden und Anregungen in diesem Buch stellen die Meinung bzw. Erfahrung der Verfasserin dar. Sie wurden von der Autorin nach bestem Wissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Sie bieten jedoch keinen Ersatz für persönlichen kompetenten medizinischen Rat. Jede Leserin, jeder Leser ist für das eigene Tun und Lassen auch weiterhin selbst verantwortlich. Weder Autorin noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen praktischen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
EINLEITUNG
»Sie haben gut reden, Frau Asgodom. Ihnen ist es ja immer gut gegangen.« Der Mann, der mir gegenübersteht, ist richtig aufgebracht. »Wie kommen Sie darauf?«, frage ich zurück und runzle die Stirn.
»Sie sind ja immer fröhlich«, kontert er.
Ich stutze kurz, schau ihm in die Augen und sage: »Können Sie sich vorstellen, dass ich fröhlich bin, weil ich in meinem Leben schon durch tiefe, dunkle Täler gegangen bin?«
Nein, das konnte er nicht.
Aber du kannst es dir vielleicht vorstellen. Du weißt vielleicht, dass dieses wunderschöne Leben tatsächlich oft ungerecht und unverständlich ist und uns wie in einer Wäscheschleuder durcheinanderwirbelt. Da diskutieren Menschen hochphilosophisch, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ich habe in meinem Leben schon öfter festgestellt, dass so ein Glas einfach auch mal umfällt oder kaputtgeht. Und dann habe ich eine Runde geheult, gejammert, gezetert und mich drangemacht, die Scherben zusammenzufegen. Von meinen Erfahrungen mit diesem beknackten Leben möchte ich dir berichten. Aber auch davon, wie wir immer wieder die Sicht auf die wunderschöne Seite richten können.
Du merkst sicher schon, dieses Buch ist kein gewöhnlicher Ratgeber. Eigentlich ist es gar keiner. Die Welt erstickt in Regeln: Tu dies, tu das und das lass sein! Das Leben ist aber viel zu bunt für Binsenweisheiten. In diesem Buch bekommst du keine Ratschläge, die so tun, als würden sie für alle gelten. Dieses Buch folgt dem Coachingansatz, nach dem ich seit 30 Jahren arbeite: Ich möchte dich mit meinen Geschichten zum Nachdenken bringen, gebe dir ein paar Impulse und vertraue darauf, dass du auf deine eigenen Lösungen kommst.
Deswegen bietet dir dieses Buch teils vergnügliche, teils dramatische Geschichten aus meinem Leben, ehrlich und offen aus einer reflektierenden Perspektive heraus erzählt. Ich erzähle so schonungslos wie in keinem Buch zuvor, von meinen krassen Kindheitserlebnissen, meinem Weg ins Ungewisse, von der Befreiung aus einer toxischen Beziehung, meinem Scheitern, meinen Enttäuschungen und meinen Freiheitsschritten – immer das Ziel eines glücklichen Lebens vor Augen. »Ein Wunder, dass aus mir überhaupt etwas geworden ist«, denke ich manchmal und lasse dich an meiner Entwicklung teilhaben.
Herausgekommen sind 70 Aha-Momente, die dich überraschen und unterhalten sollen. Die Zahl 70 ist kein Zufall. Wenn dieses Buch erscheint, werde ich meinen 70. Geburtstag feiern, am 7.7.2023 – die Quersumme der Jahreszahl ergibt übrigens auch 7, habe ich beim Schreiben bemerkt. Ich habe die Zahl sieben immer gemocht. Ich denke, sie ist meine Glückszahl – nicht beim Roulette, sondern ein glückliches Omen für mein Leben. Und ich gebe dir gern etwas von meinem Glück ab.
Du bekommst also 70 Geschichten in sieben Kapiteln. Manchmal wirst du vielleicht Mitgefühl mit mir spüren, manchmal wirst du staunen oder den Kopf über mich schütteln, und hoffentlich kannst du oft mit mir lachen. Denn du weißt ja: Wer tiefe, dunkle Täler hinter sich gebracht hat, kann fröhlich sein.
Am Ende jeder Geschichte findest du Anregungen, wie du meine Erkenntnisse auf dein Leben übertragen und in deinem Handeln umsetzen kannst – wenn du magst. Ich möchte dir Mut machen, dieses verwirrende Leben anzunehmen, wie es ist. Und alles dafür zu tun, dass es wunderschön wird.
Oder wie mein Mann Siegfried zu sagen pflegte: »Nein, nicht alles wird gut. Alles ist gut.« Er, den ich leider an die Demenz verloren habe, war jeden Tag, an dem ich geschrieben habe, in meinen Gedanken. Er war und ist meine Muse.
Deine Sabine Asgodom
Vertrauen & Selbstbestimmung
SCHREIBEN IST LEBEN
Als ich neulich, erschöpft nach einem langen Schreibtag, in meinem Schaukelstuhl saß, Paolo Conte hörte und zu müde war, um ins Bett zu gehen, kam mir urplötzlich dieser Gedanke: Bücher schreiben zu können, ist das Geschenk des Lebens an mich.
Ein Geschenk, weil ich für mein Leben gern schreibe. Schon als Elfjährige habe ich Geschichten geschrieben, die ich in der Klasse vorlesen durfte. Mit 13 wurde mein erstes Gedicht in meiner Heimatzeitung veröffentlicht. Gedanken zu formulieren und aufzuschreiben, war und ist mein größtes Talent. Was für eine Gnade, meine Stärke leben zu dürfen. Und sogar einen Beruf daraus machen zu können.
Und das Geschenk ist noch viel bedeutsamer: Schreiben hat mir das Leben gerettet. Im Schreiben habe ich meine Gefühle äußern können, über die zu sprechen ich mich meistens nicht getraut habe. Schon mit 15 habe ich tieftraurige Gedichte geschrieben, von Einsamkeit, tiefer Verlorenheit und Verzweiflung über die verlogene Familie, in der ich lebte. Die nach außen ganz wunderbar erschien, deren Inneres aber von Angst und Strafe geprägt war. Ich bin sicher nicht die Einzige, die dachte, in die falsche Familie geboren worden zu sein. Vielleicht doch vertauscht? Konnte bei mir nicht sein, ich war eine Hausgeburt. Ich fühlte mich trotzdem immer so fremd. Ich wollte nicht so sein wie sie, so werden wie sie. Das durfte ich jedoch nicht aussprechen – aber schreiben.
Ich war vielleicht 16, da passte mich eines Tages meine Mutter ab, als ich aus der Schule kam. Sie fragte mich ganz direkt: »Sag mal, hast du Selbstmordgedanken?« Ich erschrak, versperrte mein Herz mit allen Schlössern und fragte sie – äußerlich ganz gelassen –, wie sie denn darauf käme. Sie erzählte, dass sie zufällig meine Gedichte gefunden hätte (sie hatte also heimlich in meinem Zimmer herumgestöbert). Als ich verneinte, sagte sie knapp: »Dann ist es ja gut.« Und ließ mich stehen. Sie hat nie mit mir über die Gedichte und über die Gefühle, die ich darin verriet, gesprochen.
Diese Gedichte haben mir die Umarmungen gegeben, die ich als Kind so bitterlich vermisst habe. Jede Zeile hat mir ihr Ohr geliehen, während die Ohren bei meinen Eltern verschlossen waren. Und die Texte waren die Schwestern, die ich nie gehabt hatte, aber so sehr gebraucht hätte. Erst als Erwachsene habe ich erfahren, dass ein Jahr, nachdem ich auf die Welt gekommen war, meine Mutter eine Totgeburt hatte, Susanne hätte das kleine Mädchen heißen sollen. So lange wurde nie darüber gesprochen. Heute denke ich: Jedes Buch von mir ist diese Schwester. Die mir zuhört und versteht, was mich bedrückt. Die mich liebevoll umarmt und tröstet.
Dieses Buch hier ist nun meine jüngste Schwester, und die Jüngsten habe ich immer am liebsten. Weil sie sich mir zuwenden, sich mir anvertrauen, sich mit mir verbünden und sich auf mich verlassen. Und ich mich auf sie.
Und auch die Menschen, die meine Bücher lieben, sich von ihnen angesprochen fühlen, die spüren, was ich meine, sind meine Schwestern. Sie sind meine Schwestern, die ich lieb habe und deren Gesellschaft mich erfreut. Indem ich versuche, sie zum Lachen zu bringen und zum Nachdenken, zu Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit, zum Innehalten und zum Handeln.
Auch meine Zuhörerinnen bei Vorträgen sind meine Schwestern, mit denen ich in Resonanz trete, denen ich mich verbunden fühle, mit denen ich in einem inneren Dialog bin, obwohl ich auf der Bühne einen Monolog führe. Auch Männer können zu meinen Schwestern gehören. Männer, die offen sind für den Austausch von Gefühlen und Gedanken, ganz ohne Angst. Die sich eins fühlen mit mir im Wunsch nach Verstanden- und Gehalten-Werden.
Das größte Geschenk meiner ganzen Kindheit und Jugend war die kleine Reiseschreibmaschine, die ich meinem Vater abtrotzen hatte können. Sie war die Vermittlerin zwischen mir und der Welt, auch wenn das kleine »e« hakte und ich mir beim Wechseln des Farbbands die Finger verschmierte. Was mein Mund nicht aussprechen durfte oder konnte, haben meine Finger für mich übernommen. Ungefiltert konnten die Gedanken in die Tasten fließen, ohne die Korrektur durch mein ausgeprägtes rationales Denken. Manchmal bin ich aus der Schreibtrance aufgetaucht und habe Sätze gelesen, von denen ich nicht geglaubt habe, dass meine Hände sie getippt haben.
Ich konnte durch das Schreiben meine Angst bändigen, meine tiefe Einsamkeit überwinden, meine Bedürfnisse formulieren. Jede Phase des Nachdenkens, Recherchierens und natürlich das Schreiben selbst war ein Stück Selbsttherapie für mich. Lange bevor meine Leserinnen davon profitieren konnten.
Schreiben ist Überleben. Schreiben ist mein Leben.
WER SCHREIBT, DER BLEIBT
Trau dich, zu schreiben. Über dich, deine Erfahrungen, deine Beobachtungen, deine Gefühle. Die therapeutische Kraft des Schreibens ist längst wissenschaftlich erwiesen. Sich etwas von der Seele zu schreiben, tut gut.
Versuche möglichst, mit der Hand zu schreiben. Neuere Studien haben gezeigt, dass wir tiefer an unsere Gefühle kommen, wenn wir die Buchstaben mit einem Stift auf Papier formen und nicht nur gleichförmig auf eine Tastatur tippen.
SPRING DOCH!
Ich stehe auf dem Schwebebalken, mein Vater sagt: »Spring runter.« Ich schaue auf die dünne blaue Matte, die auf dem Boden liegt, und schüttle den Kopf. Ich habe Angst. Mein Vater reicht mir eine Hand und wiederholt jetzt schon energischer: »Komm, das ist gar nicht hoch, jetzt spring doch!« Ich nehme die Hand nicht und springe auch nicht. Irgendwann hebt er mich ärgerlich vom Gerät.
Ich habe mir oft überlegt, warum ich mich an diese Situation bis heute erinnere. Es war beim Turnunterricht in der Schule mit der Klasse meines Vaters, bei dem ich als kleines Kind oft dabei sein durfte. Ich sehe mich als Fünfjährige auf dem Schwebebalken und ich sehe ihn, ärgerlich auf mich einredend. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum ich nicht gesprungen bin. Und irgendwann wurde mir klar: Ich hatte kein Vertrauen zu ihm. Die Angst überwog.
Wenn ich Kinder auf dem Spielplatz sehe, wie sie vom Kletterturm vor Freude quietschend in die Arme ihres Vaters oder ihrer Mutter springen, freue ich mich. Gleichzeitig gibt es mir immer einen kleinen Stich ins Herz. Ich habe meinem eigenen Vater nie vertrauen können.
Vielleicht lag es daran, dass er mich nachts, als ich gerade zwei war und weinend vor dem Elternbett stand, allein im Dunkeln zurück in mein Bett schickte, durch den langen, finsteren Flur. Mutti hat mir davon erzählt, als ich schon erwachsen war. Irgendwann habe ich sie gefragt: »Warum hast du das zugelassen?«
»Ich habe mich nicht getraut, ihm zu widersprechen.«
Und da wundere ich mich, dass ich ein Problem mit Vertrauen habe?
Zu einem Mann, einem angesehenen Pädagogen, der zu den Honoratioren im Dorf, ja im ganzen Landkreis gehörte. Einem Mann, der auf der anderen Seite seine Familie mit seinem Jähzorn, seiner Wut dominierte. Der uns Kinder, vor allem meine Brüder, zur Strafe regelmäßig verprügelte? Wie oft musste ich vor Angst zitternd zuschauen, wenn er einen meiner Brüder mit wutverzerrtem Gesicht aufforderte, vom Moped, das vorm Haus stand, den Lederriemen vom Gepäckträger zu holen. Und der Delinquent wusste, dass er damit gleich geschlagen wurde. Ich erschauere heute noch vor dem Sadismus. Dann hieß es Hose runter, umdrehen. Klatsch, klatsch, klatsch. Für mich war das Zuschauen genauso schlimm, als würde ich die Tracht Prügel selbst erleiden. Und jedes Mal dachte ich, jetzt schlägt er meinen Bruder tot.
Meine Mutter hatte weniger Kraft, aber dafür nicht weniger Wut in sich. Sie griff gern zum Holzkochlöffel oder zum Teppichklopfer. Einmal zerbrach sie einen Kochlöffel auf dem Rücken des Übeltäters, mein Bruder Klaus hatte im Garten Erdbeeren genascht. Und das war streng verboten. Die brauchte sie zum Marmeladekochen. Wenn sie selbst nicht zum Verhauen aufgelegt war, stieß sie Drohungen aus wie: »Warte, bis Vati nach Hause kommt.« Und sie hat uns wirklich jedes Mal verpfiffen.
Eine weitere Strafe war, uns in den Keller zu sperren. Meine Brüder ohne Licht, mich als Kleinste wenigstens mit einer funzeligen Lampe an. Und da unten mussten wir dann, auf der untersten Treppenstufe sitzend, über unser Fehlverhalten nachdenken. Ich werde niemals den Geruch dieses Kellers, Baujahr 1908, loswerden – nach feuchtem Lehm, fauligen Kartoffeln und Kohle. Wie soll da Vertrauen wachsen?
Später, als ich ins Gymnasium ging, hatte ich mehr Angst vor dem Lehrer zu Hause als vor denen in der Schule. Wenn er mich abends Französischvokabeln oder mathematische Formeln abfragte, habe ich innerlich geschlottert vor Angst, und mein Hirn war leer. Enttäuschung stand in seinem Gesicht. Versager!
Überhaupt Enttäuschung. Unsere Eltern machten uns unermüdlich klar, welche Enttäuschung wir Kinder für sie waren. Erst hatte der Krieg ihnen alles genommen, so die Litanei, und dann hatten sie ihre Träume und ihr Leben für uns geopfert. Sie redeten uns ein, wir seien schuld, dass es in der Familie so viel Streit gab. Der perfideste Moment, an den ich mich erinnere: Mein Vater gab mir eine heftige Backpfeife, warum, weiß ich nicht mehr. Und dann sagte er: »Du bist schuld, dass ich mich jetzt so schlecht fühle, weil ich dich bestrafen musste.«
Wundert es irgendjemanden, dass Schuld lange ein Thema bei mir war? »Ich will nicht schuld sein, wenn …«, hörte ich mich abwehren. »Ich bin schuld, dass er nicht mehr anruft«, hörte ich mich Freundinnen vorweinen. Lange Jahre fühlte ich mich ja sogar schuldig am Tod meines Vaters. Wenn ich nicht nach München gegangen wäre, während er sich von einer Lungenkrebs-OP erholte, wäre er bestimmt nicht gestorben. Es hat mich viele Therapiestunden gekostet, dieses Schuldgefühl loszuwerden.
Je mehr ich mich mit Psychologie und Pädagogik beschäftigt habe, umso klarer wurde mir, dass dieses wunderbare »Urvertrauen«, von dem alle redeten, ein Fremdwort in meinem Leben war. Die gute Nachricht: An Selbstvertrauen habe ich im Laufe der Jahre gewonnen. Ich habe als Journalistin so viele Chancen gehabt, mit klugen Menschen zu reden, zu lesen, Neues zu erfahren. Ich habe in Teams gearbeitet, die mich geschätzt und gestärkt haben. Ich habe den Mut entwickelt, trotz aller Selbstzweifel Herausforderungen anzunehmen, schwierige Situationen zu meistern, Lösungen zu finden. Irgendwann habe ich mich getraut, einfach ins kalte Wasser zu springen. Dadurch fand ich Vertrauen in mich selbst.
Aber anderen Menschen einen Vertrauensvorschuss zu geben, fiel mir lange schwer. Mich auf andere verlassen? Lieber mache ich es selbst. Vertrauen, dass es jemand gut mit mir meint? Na, warten wir’s ab, ich bleib mal ein bisschen auf Distanz. Einen Fehler machen dürfen? Bloß nicht, dann wirst du ausgestoßen.
Warum lebte ich dann so lange mit einem Mann zusammen, dem ich nicht vertrauen konnte, der mich von Anfang an, wie sich bald herausstellte, belog und betrog? Eine befreundete Therapeutin sagte mal: »Das war ein bekanntes Muster, du kanntest es nicht anders, als dass du belogen und enttäuscht wirst. Damit konntest du umgehen.« Als ich mich aus dieser toxischen Situation endlich gelöst hatte, legte ich den Schalter radikal um. Völlig überzogen reagierte ich ab sofort privat auf Vertrauensbruch. Wer mich verarscht hatte, bekam keine Chance mehr. Wer mein Vertrauen missbrauchte, den katapultierte ich zurück in die Steinzeit. Freundschaften beendete ich gnadenlos, wenn ich mich betrogen fühlte. O ja, ich konnte übelnehmen! Und jedes Mal wisperte wieder die alte Stimme in meinem Kopf: »Siehste, vertraue niemandem!«
Das änderte sich erst, als ich mit 54 Siegfried kennenlernte, meinen zweiten Mann. Der mochte sicher viele Fehler haben, aber mir gegenüber war er der loyalste Mensch, den man sich vorstellen kann. Er stand immer hinter mir, und manchmal vor mir, wenn er glaubte, mich verteidigen zu müssen. Er war mein weißer Ritter. Mein Unterstützer. Und er war mein Meister. Ich lernte von ihm alles über Positive Psychologie, also die Erkenntnisse, was Menschen froh und gesund macht. Er war Psychologe und Experte für diese moderne Richtung der Wissenschaft. Dazu gehört ja, gute Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Er schaffte es, dass wir ehrlich reden konnten, keine Spielchen spielten. Sagten, was wir dachten und fühlten.
Bei unserem ersten romantischen Spaziergang, als er mich zärtlich um die Hüfte fasste, sagte er: »Na, wir sollten auch ein bisschen abnehmen.« Mir blieb kurz die Luft weg. Der traut sich was, dachte ich. Einer der Sätze, die mir noch besser gefallen haben, war: »Du darfst ungerecht sein.« – Ich doch nicht. – »Doch. Und du darfst es sein.« Siegfried gab mir die Erlaubnis, ich zu sein. Die hatte mir bis dahin niemand, nicht einmal ich selbst, gegeben. Und er tat mir gut.
Das neu gewonnene Selbstvertrauen half mir, anderen diesen Vertrauensvorschuss zu geben. Im Coaching weiß ich, dass ich keine Lösung für meine Klienten finden muss. Ich vertraue stattdessen darauf, dass wir im Gespräch verschlossene Türen öffnen können, dass die Menschen ihre eigenen Lösungen finden. Ich vertraue auf den Augenblick, dass passiert, was passieren soll. Ich vertraue auf der Bühne darauf, dass schon die richtigen Sätze aus meinem Mund kommen werden, ohne auswendig gelernt werden zu müssen. Ich liebe spontane Einfälle, auch wenn sie schräg sind. Ich wage es einfach. Und ernte dafür so viel Liebe von meinem Publikum.
Vertrauen schafft Liebe. Was für eine wunderbare Erkenntnis.
BOTSCHAFTEN AUS DER KINDHEIT HINTERFRAGEN
Vertrauen entsteht, Misstrauen auch. Das heißt, ob wir uns selbst und anderen ver- oder misstrauen, liegt an unseren Kindheitserfahrungen. Wenn auch du ein Vertrauensproblem hast, überleg, welche Botschaften du aus deiner Kindheit dazu mitbekommen hast, und beantworte dir folgende Fragen:
Wie haben sie mein bisheriges Leben beeinflusst?
Nützen oder schaden sie mir?
Was möchte ich ändern?
Wer kann mich dabei unterstützen?
FLIIIIIIEEEEEEEG!
»Ich liebe Skispringen!« Wir sitzen mit Bilen, ihrem Mann Martin und den drei Enkeln beim Kaffeetrinken. Gerade habe ich mir jedes Springen der Vier-Schanzen-Tournee angesehen. Die Neunjährige schaut mich skeptisch an und sagt dann kopfschüttelnd: »Oma, du kannst doch überhaupt nicht Ski fahren.«
Vor Lachen schütte ich fast den Kaffee über die Tischdecke. »Ja, da hast du völlig recht. Ich meinte, ich schaue total gern Skispringen im Fernsehen!« Skispringen kennen die Kinder nicht. Sie schauen auch so gut wie nie Fernsehen, aber bei Netflix, Sky oder Amazon kennen sie sich aus.
Als ich Kind war, saß ich im Winter jeden Sonntag mit der Familie vor dem Fernsehapparat und habe Skispringen geschaut. Vielleicht ist diese Erinnerung an (seltenen) Familienfrieden und Gemütlichkeit ein Teil meiner Faszination. Zwischen erstem und zweitem Durchgang wurde schnell der Kaffeetisch gedeckt, der Rührkuchen aufgeschnitten, die Sahne geschlagen. Und dann ging die Spannung weiter, vor allem wenn Helmut Recknagel, der deutsche Skisprungstar der 1960er-Jahre, an der Reihe war.
Noch mehr als Nostalgie ist es aber der Mut der Springer, sich von einer riesigen Schanze in die Tiefe zu stürzen, der mich ungemein begeistert. Habe ich schon erzählt, dass ich ein gewaltiger Schisser bin, wenn es darum geht, irgendwo runterzuspringen?
Mein aktueller Liebling ist Markus Eisenbichler, sein Gesichtsausdruck nach jedem Sprung ist wie ein Erfolgs-Barometer. Von »Jawoll, ich bin der König der Lüfte!« bis »Ach, ich habe keine Lust mehr. Wer will meine Ski haben?« Und manchmal auch ehrliche Freude: »Aber wenigstens ist mein Freund, der Karl Geiger, vorne.«
Warum gerade Skispringen (noch lieber Skifliegen, da fliegen sie doppelt so weit)? In dieser Sportart spielen alle Gefühle, die auch mich täglich durcheinanderwirbeln können, eine Rolle: Angst, Erwartungen, Selbstzweifel, Freude, Enttäuschung, Hoffnung, Geduld, Motivation, Ehrgeiz oder Demut. Dazu kommt das Ertragen des Schicksals: Dreht der Wind von Aufwind auf Rückenwind? Bekomme ich eine Riesenchance oder werden alle meine Hoffnungen zerstört?
Ich bewundere die Resilienz der Springer (wie sowieso aller Sportler, die sich dem Wettkampf stellen). Es können ja nur drei Gewinner aufs »Treppchen«, wie es so schön heißt. Wenn also 50 springen, müssen 47 damit rechnen, nicht zu den Gewinnern zu zählen. Und trotzdem geben sie ihr Bestes, jede Woche wieder, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und sie freuen sich, wenn sie unter den Top Ten oder den Top 20 oder nicht der Letzte oder so weit wie noch nie oder überhaupt heil heruntergekommen sind.
Mich ermutigt das Zuschauen jedes Mal, mich den Böen des Schicksals zu stellen. Mal habe ich Glück mit hilfreichem Rückenwind, mal kommt eine scharfe Brise von vorn und stoppt mich. (Beim Skispringen ist es übrigens anders als im richtigen Leben: Rückenwind ist schlecht, weil er nach unten drückt, Gegenwind bedeutet Aufwind und erhöht die Chance auf einen weiten Sprung.) Mal stehe ich ganz oben auf dem Stockerl (wie die Österreicher sagen) und könnte platzen vor Stolz. Und mal bin ich froh, mit heilen Knochen davongekommen zu sein. Ich bewundere die souveräne Haltung der Sportler, in Sieg und Niederlage, wie sie die Ergebnisse ihrer Bemühungen annehmen können und sofort für den nächsten Versuch bereit sind.
Alle Welt spricht heute von Resilienz im Beruf, der Seminarmarkt ist voller entsprechender Angebote. Mir reicht es Skispringen zu sehen, und ich begreife, wie man nach einer Niederlage sehr schnell wieder Hoffnung schöpfen und aktiv werden kann. Wer verloren hat, legt sich nicht eine Woche ins Bett und heult, sondern er trainiert noch mehr, er verbessert seine Kondition, er feilt an der Technik. Er probiert aus, wie er seinen Körper noch besser wie ein Adler ausbreiten kann.
Sie macht es übrigens auch. Ähnlich wie im Berufsleben haben sich Frauen längst den Luftraum über dem Schnee erobert. Eine dreifache Weltmeisterin wie Katharina Althaus stürzt sich mit der gleichen Waghalsigkeit die Schanze hinunter wie die männlichen Kollegen. Bis vor 20 Jahren noch undenkbar. »Viel zu gefährlich«, hatten Männer gewarnt, die es selbst schon mehrmals geschmissen hatte. Und heute fliegen die besten Frauen leicht an der schwächeren Hälfte der Männer vorbei.
Weltmeisterin wird man nicht mit Vermeidungsstrategien. Sondern durch die Bereitschaft, immer wieder etwas zu riskieren, und ja, auch immer wieder zu scheitern. In einem Interview nach einem verpatzten Sprung hörte ich Katharina Althaus neulich sagen: »Heute war nicht ganz so mein Tag. Nächste Woche greife ich wieder an.« Ja. Das nennt man Resilienz. Übrigens: Vier Wochen später wurde Katharina Althaus Weltmeisterin.
RESILIENZ TRAINIEREN
Hast du das Gefühl, du möchtest an deiner Resilienz arbeiten, also an deiner Fähigkeit, mit Niederlagen oder Störungen umzugehen? Diese Gedanken können dir helfen, deine innere Stärke zu entwickeln und deine Akzeptanzfähigkeit zu trainieren:
Manchmal erreichst du dein gesetztes Ziel nicht. Vergeude deine Energie aber nicht mit Grübeln oder Selbstkasteiung.
Versöhn dich mit dir und deinen Schwächen.
Festige die Überzeugung, dass das Leben viel Gutes für dich bereithält.
Konzentriere dich auf deine Stärken und setze sie mutig ein.
Schreibe jeden Abend auf, was dir gut gelungen ist.
Lerne dazu, wenn du Bedarf hast, oder frage andere um Rat.
Beherzige folgende Weisheit: Gib mir Gelassenheit, wenn ich Dinge nicht verändern kann. Und Mut, Dinge zu verändern, die ich verändern kann. Und hilf mir, das eine vom anderen zu unterscheiden.
GRIESSBREI UND KLOPPE
»Du warst ein Jahr alt. Du hast im Hochstühlchen mit uns und deinen drei Brüdern am Küchentisch gesessen. Für dich hatte ich Grießbrei gekocht. Wir haben Krautsalat gegessen. Du wolltest unbedingt auch Krautsalat. Als ich dir einen Löffel Grießbrei hingehalten habe, hast du dich trotzig nach hinten geworfen. Ich hab’ dich aus deinem Stühlchen gezogen, dir einen Klapps auf den Hintern gegeben, dich im Schlafzimmer ins Bettchen gelegt und die Tür zugemacht. Als ich wieder in die Küche gekommen bin, haben meine vier Männer mich nicht angeschaut. Plötzlich hat Klaus gesagt: ›Und wenn ich mal Mutter bin, und du bist Kind, dann haue ich dich noch viel mehr.‹.«
Meine Mutter lachte jedes Mal fröhlich, wenn sie diese Geschichte zum Besten gab. Gerne auch vor Freunden oder Kollegen von mir, um zu beweisen, wie eigensinnig Sabinchen immer schon gewesen ist. Haha.
Die ersten Jahre habe ich tatsächlich immer noch höflich mitgelacht. »Tja, so war das damals«, strahlte meine Mutter und blickte Zustimmung heischend in die Runde, ohne die betretenen Gesichter zu bemerken. Als ich selber Kinder hatte, mich mit Erziehung beschäftigte, auch mit der sogenannten Schwarzen Pädagogik, wurde mir klar, wie brutal diese Geschichte war. Und ich habe ihr nie mehr erlaubt, sie zu erzählen, wenn ich dabei war.
Harmloser war die Geschichte, die sie von mir als Vierjähriger erzählte: Meine Oma soll mich auf dem Arm gehalten und mir ihre Kette gezeigt haben.
»Schau mal, was für eine schöne Kette die Oma hat.«
»Nicht schön«, soll ich gesagt haben.
»Aber die ist ganz wertvoll.«
Ich hätte nur den Kopf geschüttelt und wiederholt: »Nicht schön!«
Ich glaube, dass beide Storys stimmen. Denn der Eigensinn oder meinetwegen auch Trotz, zieht sich durch mein Leben. Vielleicht ist das die Erklärung dafür, warum ich in München Journalistin geworden bin. Meine Eltern hätten es viel lieber gehabt, wenn ich an der Pädagogischen Hochschule in Hannover auf Lehramt studiert hätte. Sie waren beide selbst Lehrer. Dann hätte ich doch schön zu Hause wohnen bleiben und täglich fahren können (Horrorvorstellung für mich).
Ich wollte da schon Journalistin werden und wenigstens in Göttingen Deutsch und Geschichte studieren (da hätte ich nur am Wochenende heimfahren müssen). Als allerdings die Berufsberaterin am Ende der 12. Klasse erwähnte, da gäbe es so eine Schule in München, die Journalisten ausbilde, aber da hätte ich eh keine Chance, weil die nur 30 Absolventen aufnähmen, war mein Trotz geweckt. Sie gab mir widerstrebend die Adresse, ich habe mich sofort beworben und wurde genommen!
Mein Eigensinn erklärt vielleicht auch, warum ich meine eigene Coachausbildung entwickelt habe. Ich bin zufällig zum Coaching gekommen: Ob ich auch Einzelgespräche anbiete, haben mich vor circa 30 Jahren Seminarteilnehmerinnen gefragt. Na klar, warum nicht? Ich war intelligent, konnte gut zuhören und habe als Journalistin gelernt, die richtigen Fragen zu stellen. Also habe ich Einzelgespräche angeboten, in denen ich vor allem Frauen half, berufliche Lösungen zu finden. Nach und nach habe ich Methoden entwickelt, wie Klientinnen und auch Klienten schneller zu den für sie richtigen Schritten gelangen.
Kurz nach den ersten Einzelgesprächen habe ich als Journalistin an einem Psychologenkongress in Berlin teilgenommen und dort das erste Mal den Begriff Coaching gehört. Ich habe an einem Workshop zum Thema Coaching teilgenommen und festgestellt: Genau so mache ich das auch. Dann habe ich die beiden einzigen Bücher über Coaching durchgearbeitet, die es damals auf dem deutschen Markt gab, und fühlte mich abermals bestätigt. Von da an nannte ich mich Coach (was im Übrigen bis heute kein geschützter Begriff ist).
Als ich angefangen habe zu coachen, Anfang der 1990er-Jahre, habe ich mich schon nach Ausbildungsmöglichkeiten umgesehen. Damals gab es nur zwei: Die eine war mir total unsympathisch, weil ich sie als manipulativ empfand. Die andere war mir zu starr, dort wurden feste Fragen vorgegeben, erste, zweite, dritte. Das gefiel mir überhaupt nicht. Ich habe lieber meine eigene Fragemethode weiterentwickelt. So wurde ich zur Coach-Pionierin mit meinem »Lösungsorientierten Kurzcoaching« (LOKC). Dabei geht es um Orientierung und Lösungen und das in kurzer Zeit. Zwei Stunden dauern die Coachings in der Regel.
20 Jahre später ging es um die Frage, einem Coachingverband beizutreten. Die nahmen aber niemanden ohne Ausbildung. Na, dann halt nicht. Konventionen waren mir schon immer ziemlich piepegal. Ich habe meine Methode ausgebaut und mithilfe von Siegfrieds psychologischem Wissen didaktisch auf ein sicheres Fundament gestellt. 2012 habe ich ein Buch mit meinen Tools dazu veröffentlicht: »So coache ich«. Und 2013 haben wir unsere eigene Coachausbildung angeboten, von Anfang an mit großer Resonanz. Mehr als 200 Coaches habe ich inzwischen nach meiner LOKC-Methode ausgebildet.
Und da juchzt mein Pionierinnenherz: Als Teilnehmerin auf dem Kongress eines großen Coachingverbands habe ich vor Kurzem erfahren, wie viele andere »etablierte Ausbildungen« ganz ohne Scheu mit meinen Tools und meinen YouTube-Video-Beispielen arbeiten. Ich nehme das mal als Anerkennung.
EIGENE WEGE GEHEN
Ohne eine große Portion Eigensinn wäre ich nicht das geworden, was ich heute bin, und ich wäre vermutlich nicht so glücklich, wie ich bin. Wäre ich dem Wunsch meiner Eltern gefolgt oder hätte mich beim Coaching nach dem gerichtet, was offiziell angesagt war, dann hätte ich keine Bücher geschrieben, keine eigene Methode entwickelt … Vermutlich lohnt es sich auch für dich, eigensinnig eigene Wege zu gehen. Dazu ein paar Tipps:
Glaub nicht alles, was du hörst, und tu nicht alles, was man von dir verlangt.
Lass dich nicht abschrecken, wenn du eine gute Idee hast.
Und denk an Mahatma Gandhi, der einst geschrieben hat: »Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.«
DER HUND, DER NICHT REDEN WOLLTE
Flocki schaut mich neugierig an, legt den Kopf schief. Flocki ist der Hund meiner Nachbarin Frau Weiß. Frau Weiß ist eigentlich die Wirtin vom Gasthaus neben der kleinen Kirche in meinem Dorf. Das ist da, wo Vati nach der Kirche immer mit anderen Männern aus dem Dorf zum Frühschoppen abbiegt, während Mutti mit uns Kindern nach Hause geht, um den Sonntagsbraten vorzubereiten. Also, diese Frau Weiß, die ich nur mit Kittelschürze kenne, hat einen Garten gegenüber vom alten Schulhaus, in dem wir als Lehrerfamilie wohnen. Sie baut dort Kohl an und Kartoffeln. Und sie hat drei Reihen Erdbeeren, von denen ich naschen darf, wenn sie schön reif sind.
Ich gehe oft über die Straße, die eher ein Feldweg ist, zu Frau Weiß in den Garten, meistens, um mit Flocki zu spielen. Flocki ist ein Spitz, er ist wirklich weiß wie eine Schneeflocke und genauso rund. Der kleine Hund mag mich. Ganz geduldig sitzt er mit mir zwischen den Erdbeeren, während ich gerade mal wieder versuche, ihm das Sprechen beizubringen. »Flocki, sag doch mal Sabine!« Flocki schaut aufmerksam auf meinen erhobenen Zeigefinger. Aber er sagt nichts. Ich versuche es immer wieder: »Flocki, sag doch mal Sa-bi-ne!« Aber der Hund lernt das einfach nicht.
Ich bin erst vier Jahre alt, aber die Szene ist verbürgt. Frau Weiß hat sie Mutti erzählt, und Mutti hat die Geschichte zig Mal zur Erheiterung auf Familientreffen oder wenn Besuch da war zum Besten gegeben. Das war zu Zeiten, als oft Besuch kam – einfach so, ohne Verabredung oder telefonische Absprache. Der Besuch stand einfach vor der Tür, wurde hereingelassen, es gab Kaffee oder Bier und man hatte es schön. »Unser Bienchen«, pflegte Mutti dann zu sagen. »Die wird auch mal Lehrerin.«
Irgendwann ist mir ein Licht aufgegangen, wie ich wohl auf die Idee gekommen bin, dem Hund das Sprechen beizubringen: Wir hatten zu der Zeit einen Wellensittich, sein Name war Pitter. Also, eigentlich war es Muttis Wellensittich, er war ihr Gesprächspartner, wenn sie allein zu Hause war. Stundenlang muss sie mit ihm geübt haben, bis er wirklich etwas sagen konnte. Auch Pitter wurde bei Besuch vorgeführt. Dann saß er auf Muttis Finger, wippte aufgeregt mit seinem Schwanz und schnarrte los: »Wolfgang, Dieter, Klaus, Sabine haben eine frohe Mine.« Oder: »Mutti, das Wasser kocht.« Und Pitter konnte wie ein Schiedsrichter pfeifen, sodass wir bei Fußballspielen im Fernsehen nicht wussten, wer gepfiffen hat. Das war immer sehr lustig.
Ich hatte wohl mit der Logik der Vierjährigen daraus geschlossen: Wenn der blöde Vogel sprechen lernen konnte, dann würde es mein Freund Flocki ja locker hinkriegen. Nein, ich wurde nicht Lehrerin. Aber Flocki ist nicht schuld daran. Ich arbeite einfach lieber mit Menschen, die freiwillig zu mir kommen.
Mein Bruder Dieter hatte übrigens ein Jahr lang eine Schildkröte, die konnte gar nichts außer fressen und schlafen. Aber von der habe ich nichts gelernt. Ganz anders bei Pitter und Flocki. Ich finde die Erinnerung an die beiden so passend für meinen heutigen Beruf, sei es im Coaching oder bei der Ausbildung von Rednern und Rednerinnen: Ein Vogel kann keinen Ball fangen und ein Hund kann nicht reden. Pitter konnte pfeifen und Flocki bellen. Genauso unterschiedlich sind Menschen. Eine Lösung für A muss nicht auch gut für B sein. A darf auf der Bühne ganz anders wirken als B, wenn sie einen Vortrag hält. Und vor allem muss niemand es so machen wie ich.
Meine Lieblingserkenntnis aus der Psychologie, die schon 1952 erforscht wurde, heißt deshalb auch:
In gewisser Weise ist jeder Mensch wie alle anderen Menschen. Wir müssen alle atmen, essen, trinken, schlafen, sterben.
In gewisser Weise ist jeder Mensch wie einige andere Menschen. Manche fahren Motorrad, andere nicht. Manche lesen Bücher, andere nicht.
Und in gewisser Weise ist jeder Mensch wie kein anderer Mensch. Das heißt, wir müssen gar nicht sein wie die anderen. Es lebe der Individualismus! Es gilt allerdings auch der Umkehrschluss: Die anderen dürfen anders sein als wir. Und das finden wir manchmal etwas anstrengend.
ERKENNE DAS TIER IN DIR
Vielleicht haben ja auch in deinem Leben bestimmte Tiere eine Rolle gespielt und du kannst Erkenntnisse für dich daraus ziehen. Du kannst aber auch auf andere Art mithilfe von Tieren deine Persönlichkeit einkreisen.
Überleg doch mal für dich: Welches Tier bist du? Bist du ein Flocki, ein Pitter oder die Schildkröte? Oder ein Löwe oder eine Ameise oder ein Pferd oder ein Känguru oder …
Welches Tier ist dein Partner/deine Partnerin und dein Chef/deine Chefin?
Was für Tiere sind deine Eltern, deine Kinder?
Welche Erkenntnisse ziehst du aus deinem ganz persönlichen Tierpark über dich und deine Beziehungen?
LEBE WILD UND UNERSÄTTLICH
»Ja, so ein Volldepp!« Ich starre auf den Bildschirm mit der Mail, die gerade gekommen ist, und schimpfe laut vor mich hin. »Hör mal, Bilen!« Meine Tochter schaut von ihrem Computer auf. »Da hat einer auf den Bericht heute in der Süddeutschen über meine Coach-Auszeichnung reagiert. Weißt du, was der Dödel schreibt?« Sie will’s hören.
Ich lese vor: »Sehr geehrte Frau Asgodom, ich habe in der heutigen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung von Ihnen gelesen. Meines Wissens nach sind Sie Journalistin. Wie kommen Sie dazu, sich als Coach zu gerieren? Siegfried Brockert, Diplom-Psychologe.« Mein Ärger steigt. »Ja, was will denn der Blödmann?!«
Ich will die Mail gerade löschen, als Bilen sagt: »Warte mal, Mami, der Name kommt mir bekannt vor. Brockert, Brockert … Na klar, du hast ein Buch von ihm in der Literaturliste in deinem neuen Buch.«
»Wieso?«
»Du hattest mich doch gebeten, die Liste in ›Lebe wild und unersättlich‹ mit Literatur zum Thema zu ergänzen. Und da habe ich das Buch reingetan, das ist gar nicht schlecht. Hier: ›Brockert, Siegfried, Der einfache Weg ins Glück. Du sollst dich lieben‹.«
»Können wir das noch rausschmeißen?«
»Nein, die Fahne ist schon abgesegnet. Das Buch erscheint doch schon in acht Wochen.«
Ich schreibe dem Herrn Diplom-Psychologen sofort: »Wieso pampen Sie mich so an? Und ich promote sogar noch ihr Buch!«