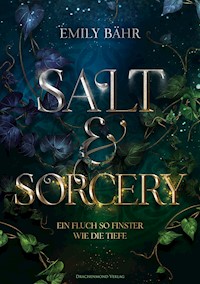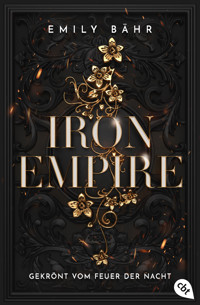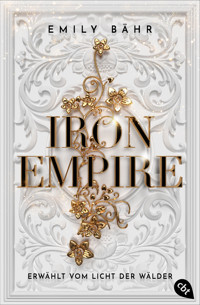10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die A-Curse-so-Divine-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Milliarde Universen und ausgerechnet du findest mich …
Als Ligeia in den Tiefen ihrer zerfallenen Welt einen Gott erweckt, wittert sie ihre Chance: Ihr Leben lang sucht sie nach einem Weg, ihr Land von dem Fluch der immerwährenden Nacht zu befreien. Apsinthion könnte ihr diesen Wunsch erfüllen, doch neben seinen Erinnerungen hat er auch seine göttlichen Kräfte verloren. Um diese zurückzuerlangen, schreiben sich die beiden an der Akademie der alten Kunst ein, wo sämtliches Wissen der Vergangenheit aufbewahrt wird. Lange hat Ligeia darauf gewartet, in ihre Heimat zurückzukehren, aus der sie nach dem Tod ihres Vaters verbannt wurde. Jedoch ist ihr Zuhause längst nicht mehr dasselbe und hält für sie nichts als Feindseligkeit bereit. Als kurz darauf ihr einziger Vertrauter verschwindet, ahnt sie, dass sie einen großen Fehler begangen hat und ihr Schicksal enger mit dem des herablassenden Gottes verwoben ist, als ihr lieb ist …
Der grandiose Auftakt der neuen Romantasy-Trilogie von Emily Bähr vereint Starcrossed Lovers, Fake Dating und Forced Proximity mit einem faszinierendem Academy-Setting in einer verfluchten Welt, in der die Nacht niemals endet.
Alle Bände der Reihe:
A Curse so Divine – Die Nacht, die uns verschlingt (Band 1)
A Curse so Divine – Der Wunsch, der uns zerreißt (Band 2) erscheint im Herbst 2025
A Curse so Divine – Der Fluch, der uns befreit (Band 3) erscheint im Frühjahr 2026
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Emily Bähr
A Curse so Divine
Die Nacht, die uns verschlingt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2025 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Coverkonzeption: Emily Bähr
unter Verwendung mehrerer Motive von © cgtrader (behsam); turbosquid (TopspoT3d, AAArtek); Shutterstock.com (merrymuuu, Murhena, Triff, Cyrustr, Ohishiapply)
FK · Herstellung: AnG
Satz und Reproduktion: GGP Media GmbH, Pößneck
E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-32535-0V002
www.cbj-verlag.de
For JordanA billion universesand it had to be you.
Liebe*r Leser*in,
bitte beachte, dass dieses Buch bestimmte Themen behandelt, die ungewollte Reaktionen auslösen können. Deshalb findest du hinten eine Content Note, in der diese Aspekte aufgelistet werden.
Hinweis: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte, daher entscheide für dich selbst, ob du sie lesen möchtest.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen!
Emily und das cbj-Team
Am Ende des Buchesfindet ihr außerdem ein Glossar mit allen wichtigen Begriffen aus der Welt von »A Curse so Divine«.
Prolog A Girl and Her Wish
Wenn ich könnte, würde ich mir wünschen, dass die Nacht endet. Ich würde mir wünschen, dass die Sonne zurückkehrt und den Fluch, der auf unserer Welt lastet, bricht. Aber Wünsche sind leichtsinnig, gefährlich, tödlich. Nur aufgehalten hat mich das nie.
Als ich noch ein Kind war, habe ich mich immer am ersten Tag des Winters in den botanischen Garten der Akademie geschlichen. In seinem Zentrum befindet sich ein uralter Silberdorn, der laut meinem Vater schon existiert hat, bevor die Stadt Aethra überhaupt erbaut worden war. Es war verboten, den Zaun, der ihn umgab zu überqueren, doch ich war entschlossen. Heimlich schnitt ich mir einen kleinen Ast ab und schmuggelte ihn in mein Zimmer. Dort stellte ich ihn in eine Vase mit Wasser direkt ans Fenster und wartete.
Der Legende nach durfte man sich etwas wünschen, wenn der karge Zweig zum Frühlingsbeginn zwei Monate später erblühte. Ein Wunsch, den ich dazu nutzen wollte, um die ewige Nacht, die über unserem Land herrscht, zu beenden. Doch so sehr ich auch hoffte, so sehr ich den Silberdorn hegte und pflegte, er formte nie auch nur eine einzige Knospe.
Das klägliche Licht meiner Lampe reichte ebenso wenig wie der schwache blutrote Schein unserer Sonne, der vor Jahrhunderten den Tag ersetzt hatte. Papa sagte, es wäre der Mond, der sich wie ein Schild vor sie geschoben hat, aber in meinem Kopf hatten die Götter selbst sie in Farbe getränkt und ihrer Kraft beraubt.
So hatten sie uns nicht nur unsere Lebensgrundlage genommen, sondern auch alles zerstört, was wir je gekannt hatten.
Und wenn man den Geschichten trauen darf, dann all das nur wegen eines Wunsches. Ein Wunsch, der unser Land ins Verderben gestürzt hatte.
Nur ein einziger Wunsch …
Meine Hoffnung darauf, dass der Silberdorn irgendwann doch erblühte, starb gemeinsam mit meinem Vater. Unerwartet und niederschmetternd. Ein Verlust, der mir den Boden unter den Füßen wegriss, mein Herz mit seiner schieren Last zu zerquetschen schien und mich völlig allein auf dieser Welt zurückließ.
Mit einem Seufzen blickte ich mich in dem Raum um, der sein Arbeitszimmer gewesen war. Gestern, nur einen Tag, nachdem wir ihn den Sternen übergeben hatten, hatte der Dekan der Academia Artis Antiquae mir aufgetragen, die Kammer hinter dem Vorlesungssaal zu räumen und sämtliche Forschungsunterlagen einem Kollegen zu hinterlassen. Die wenigen privaten Habseligkeiten, darunter seine Kohlezeichnungen, sollte ich nach Hause nehmen. Kein Platz für Sentimentalitäten an der Akademie, obwohl mein Vater ihr den Großteil seines Lebens gewidmet hatte.
Die Kammer mit dem schmalen Fenster zur Bucht hinaus war jetzt so leer wie mein Inneres. Nur ein verwaistes Bücherregal, ein Schreibtisch und zwei Stühle waren geblieben. Selbst der Duft nach grünem Tee, der hier immer in der Luft gehangen hatte, war verflogen und nichts erinnerte mehr an den Raum, in dem ich meine Kindheit verbracht hatte. Zwischen Schriftrollen und Büchern hatte mein Vater mir lesen und rechnen beigebracht, bevor er mich schließlich sogar in die Magie der Alten Kunst eingeführt hatte. Etwas, das mich jetzt hoffentlich vor dem Schlimmsten bewahren konnte.
Ich biss die Zähne zusammen und klammerte mich unwillkürlich fester an den Briefumschlag, den ich mit mir herumtrug. Eigentlich war ich schon gestern mit dem Ausräumen fertig gewesen, aber ich hatte den Wächtern am Tor gegenüber behauptet, ich bräuchte noch ein paar Stunden länger. Eine Lüge. Ich war aus einem anderen Grund hier. Einer, der mich die letzten Nächte wach und außer Atem gehalten hatte: die Frage, wie es ohne meinen Vater mit mir weiterging.
Obwohl ich die Antwort genauso sehr fürchtete wie die Gesetze unserer Stadt, gelang es mir mit Mühe, dem Büro den Rücken zuzukehren – vorübergehend, wie mir eine hoffnungsvolle Stimme einreden wollte, doch so richtig daran glauben konnte ich nicht. Die Ungewissheit hatte einen Angsthasen aus mir gemacht.
Auf der großen Treppe des Atriums spürte ich die Blicke der Dozenten, Forscher und Studenten auf mir und fühlte mich an meine ersten Tage an der Akademie zurückversetzt. Es gab keine Regel, die Angestellten verbot, ihre Kinder mitzunehmen, aber als vierjähriges Mädchen war ich in dieser von Männern beherrschten Institution aufgefallen. Erst mit der Zeit hatte ich gelernt, unsichtbar zu werden. Die anderen hatten sich an meine Anwesenheit gewöhnt, die Tuschelei hatte nachgelassen, aber jetzt war alles wieder da. Die ganze Akademie wusste, was mit meinem Vater passiert war, und ich könnte wetten, dass sich einige dieselbe Frage stellten wie ich: Was jetzt?
Ich hielt meinen Blick auf die ferne, kristallene Decke gerichtet, um niemandem ins Gesicht sehen zu müssen, während meine Füße nach all den Jahren von allein den Weg zum Eingang fanden. Aus Quarz wurde Himmel, ein diesiges, dunkles Rot, an dem ich trotz der im Zenit stehenden Sonne die Sterne erahnen konnte. Die weißen Mauern des Atriums bildeten einen scharfen Kontrast zum Halbdunkel des Tages und ich fragte mich unwillkürlich, ob ich die Akademie heute wohl zum letzten Mal sehen würde.
Je weiter ich mich dem Fakultätsturm näherte, desto weniger Menschen begegneten mir. Studenten verirrten sich nie in diesen Bereich der Akademie und selbst von den Professoren hatten nur die höhergestellten ein Büro hier. Ich betrat den Viadukt und folgte diesem zu meinem Ziel. Hinter dem riesigen Messingtor lag ein Vorraum, in dem mir zwei Centurions mit Speeren den Weg versperrten.
Nachdem ich fast mein ganzes Leben in diesen Hallen verbracht hatte und mit der Alten Kunst vertraut war, sollten mir diese mit ihrer Statur an Menschen erinnernde Konstrukte keine Furcht einjagen, doch heute taten sie es. Ich konnte die mächtige Magie, die durch ihre metallischen Körper pulsierte und sie am Leben hielt, sogar sehen. Ein leichtes Flirren in der Luft. Glühendes Licht, das aus den Spalten zwischen ihren Bauteilen hervorsickerte.
Mühevoll schluckte ich meine Angst herunter und hob das Kinn. »Ich möchte zu Dekan Aurelius.«
Die beiden Wächter starrten mich aus blau leuchtenden Augen an. Bisher war es niemandem gelungen, ein Konstrukt zu erschaffen, das unsere Sprache beherrschte, allerdings konnten sie rudimentäre Anweisungen verstehen und ausführen. Für die Umstände war das ein kleines Wunder. Verglich man unsere heutige Magie und Technologie jedoch mit der, die unsere Vorfahren gehabt haben mussten, erschienen selbst die mächtigen Centurions wie Spielzeuge.
Nach kurzer Pause traten die beiden zur Seite, um mich durchzulassen. Offenbar hatten sie erkannt, dass ich keine Bedrohung darstellte, sodass ich nicht weiter mein trauriges und übermüdetes Spiegelbild in ihren funkelnden Speeren betrachten musste.
Als ich nähertrat, öffnete sich die riesige Pforte aus Stein, die ins Herz des Traktes führte. Dahinter stand der Dekan. Ein feines, mitleidiges Lächeln lag auf seinen Lippen. Dasselbe wie schon während der Beisetzung meines Vaters. Ich spürte ein Stechen in der Brust, verzog jedoch keine Miene. Jetzt mehr denn je musste ich meine Gefühle unter Kontrolle behalten. Ich musste ernst und besonnen bleiben, um ihm zu beweisen, dass ich würdig war, an der Akademie der Alten Kunst zu studieren.
»Ligeia«, begrüßte er mich und legte beinahe väterlich die Hand auf meine Schulter. »Wie schön, dass du noch einmal vorbeischaust.«
Noch einmal. Das klang so, als würde der Dekan nicht damit rechnen, mich nach heute je wieder zu Gesicht zu bekommen.
»Ich wollte mit Ihnen reden. Wenn es nicht ungünstig ist.«
»Oh nein, natürlich nicht. Komm in mein Büro.« Seine Hand wanderte hinab zwischen meine Schulterblätter und er führte mich durch eine an den Korridor angrenzende Tür. Der Raum dahinter war kein Vergleich zu dem schlichten Arbeitszimmer, das meinem Vater gehört hatte. Auf sechs Säulen thronte eine riesige Kuppel, in der sich ein magischer Sternenhimmel befand. Er wirkte täuschend echt und plastisch, kosmischer Nebel waberte zwischen funkelnden Himmelskörpern umher und verschleierte einen Teil des schwebenden Modells unseres Sonnensystems. Der Schreibtisch darunter war ausladend und geradezu beunruhigend penibel aufgeräumt. Dokumente waren ordentlich gestapelt, edle Füllfederhalter nach Größe in einer speziellen Halterung sortiert.
Auf Aurelius’ Aufforderung hin setzte ich mich auf einen Stuhl davor, während er in seinen ledernen Drehsessel fiel. Noch immer lag derselbe mitleidige Ausdruck auf seinem Gesicht, der mein Unwohlsein nur verstärkte. Ich wünschte, er würde mich nicht so ansehen, als könnte ein falscher Atemzug mich zerbrechen. Dazu brauchte es schon deutlich mehr – daran hatte auch der Tod meines Vaters nichts geändert.
»Nun«, sprach er sanft. »Worüber wolltest du mit mir sprechen?«
Nervös strich ich mir durch die Haare. Vor ein paar Jahren hatte ich begonnen, sie kurz zu tragen, um weniger aufzufallen. Doch obwohl ich drahtig gebaut war und meine kleinen Brüste leicht unter einem Pullover verstecken konnte, verriet mich die hohe, weiche Stimme, in der jetzt ein leichtes Zittern mitschwang.
»Mein Vater wollte, dass ich Ihnen diesen Brief übergebe.«
Der Dekan runzelte die Stirn, als ich ihm den Umschlag zuschob. »Ein Erbstück?«
»Eine Nachricht. Sicherlich hätte er gern länger unter uns verweilt, aber er war stets für alle Eventualitäten gerüstet.« Zumindest war das die beste Erklärung, die ich für den Brief hatte. Papa war plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Dass er trotzdem auf diese Situation vorbereitet gewesen war und mir ein Testament und ein Empfehlungsschreiben für die Akademie hinterlassen hatte, lag an seiner ständigen Sorge vor dem Unerwarteten, die ihn seit dem Verlust meiner Mutter geplagt hatte.
Aurelius entnahm nickend den Brief. Mit wachsender Nervosität sah ich dabei zu, wie sein Blick über die Zeilen huschte, und für eine Weile herrschte bleierne Stille im Raum. Der Dekan ließ sich die Zeit, das Schreiben ein zweites und drittes Mal zu lesen, ohne dass sich seine Miene auch nur im Geringsten veränderte.
Als er mich schließlich anschaute, waren seine braunen Augen zu ausdruckslos, um seine Gedanken zu verraten. Ein grauer Vollbart verbarg seine Lippen.
»Dein Vater spricht wirklich sehr wohlwollend von dir«, bemerkte er.
»Er hat immer davon geträumt, dass ich in seine Fußstapfen trete und Forscherin an der Akademie werde.«
»Das sieht man. Aber ist das denn auch dein Traum?«
Irritiert zog ich die Brauen zusammen. »Natürlich. Ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, eines Tages die Alte Kunst zu studieren.«
»Bist du dir sicher? Ein junges Mädchen wie du wird wohl kaum davon träumen, ihre Tage zwischen staubigen Büchern und rostigem Metall zu fristen.«
»Das stört mich nicht«, beteuerte ich. »Auch wenn ich mir wünschen würde, eines Tages in der Feldforschung zu arbeiten.«
Jetzt lachte der Dekan. Sein Hohn jagte mir einen Schauer über den Rücken. »Was willst du denn unter der Erde, Kind?«
»Ich bin siebzehn«, informierte ich ihn und gab mein Bestes, dabei nicht trotzig oder belehrend zu klingen. »Und damit alt genug, mich an der Akademie einzuschreiben. Sie können nicht leugnen, dass ich die besten Voraussetzungen dafür besitze – noch dazu eine Empfehlung eines Alumnus, die Ihnen Professor Octavius Lucius sicher ebenfalls bestätigen würde.«
Mir war nicht wohl bei dem Gedanken Octavius mitreinzuziehen, aber als enger Freund meines Vaters wusste er, dass ich das nötige Vorwissen und Talent besaß, um an der Academia zu studieren. Mehr als das sogar.
»Es tut mir leid, Ligeia«, sagte Aurelius mit einem gequälten Seufzen, »aber von deiner Leistung abgesehen glaube ich nicht, dass die Akademie ein geeigneter Ort für jemanden wie dich ist.«
»Wieso?«
»Nun, weil du eine junge Frau bist. Und damit eine Ablenkung für die ganzen Studenten. Nicht auszumalen, was in ihren Köpfen vor sich geht. Du würdest dich hier sicher nicht wohlfühlen.«
Ich verkrampfte die Hände ineinander, spürte, wie die Wut in mir brodelte, und schaffte es dennoch, ruhig und besonnen zu klingen. »Mit Verlaub, Dekan, ich gehe schon seit Jahren regelmäßig in der Akademie ein und aus. Sowohl die Dozenten als auch die Studenten kennen mich. Und davon abgesehen, kann ich gut auf mich aufpassen.«
»Aber wo würdest du schlafen? Ich kann dich schlecht zu ihnen ins Wohnheim lassen.«
»Mein Vater hat mir unsere Wohnung vererbt. Sie ist nicht riesig, aber zu Fuß braucht man nur zehn Minuten bis zur Akademie. Ich könnte dort wohnen, mich selbst versorgen und …«
Ich bemerkte meinen Fehler zu spät.
»Allein?«, bohrte der Dekan scharf nach.
Widerwillig nickte ich. Es hatte keinen Zweck, die Realität zu leugnen und spontan einen Onkel zu erfinden, bei dem ich ab sofort leben würde, bis ich einen Partner gefunden hatte.
»Dann ist unser Gespräch hiermit beendet.« Der Dekan richtete sich auf. Ich tat es ihm gleich, stemmte meine Hände auf die Tischplatte und lehnte mich zu ihm hinüber. Er war kleiner als ich, was die Tatsache, dass er mich wie ein Kind behandelte, noch unverschämter machte.
»Das können Sie nicht machen. Ich habe alles, alles, was ich brauche. Die Empfehlung meines Vaters …«
»Ist nicht von Bedeutung, solange kein Mann für dich bürgt. Du kennst das Gesetz.«
»Aber ich muss an der Akademie studieren. Ich habe Talent, Erfahrung, ich bin mir sicher, dass ich eine wertvolle Ergänzung sein kann. Ich kann etwas erreichen!«
»Überschätz deinen Wert nicht, junge Dame«, knurrte der Dekan. »Wir bekommen jedes Semester Dutzende Bewerbungen und sämtliche dieser Männer besitzen die gleichen, wenn nicht sogar bessere Qualifikationen als du.«
»Das bezweifele ich.« Ich war so wütend, dass ich den Punkt erreicht hatte, an dem der klägliche Rest meiner Fassade fiel. Ich verlor nicht nur die Kontrolle über meine Worte, sondern auch über meinen Körper und die knisternde Energie in meiner Brust. Sofort breitete sie sich von dort bis zu meinen Fingerspitzen aus. Das magische Mal an meinem Schlüsselbein brannte wie Feuer.
Unter mir begann der Tisch zu wackeln, als die Magie in ihn hineinfloss. Doch dabei blieb es nicht. Die Energie schien aus meinen Poren zu treten, lud die Luft auf, den Raum und alles, was sich darin befand. Die Füller in ihren Halterungen begannen zu zittern, das Sonnensystem über mir drehte sich so schnell, dass die Sterne zu einem Strudel aus Licht verschwammen. Selbst die beiden Centurions an der Tür erwachten zum Leben. Ihre Gelenke quietschten laut, als sie sich aus ihrer Starre lösten und die gewaltigen Arme und Beine bewegten. Aus dem Augenwinkel könnte ich sie beinahe für riesige, breit gebaute Menschen halten, die in blickdichten Metallrüstungen steckten und ihre Speere bedrohlich auf den Dekan richteten.
»Genug!«, donnerte er und der Zauber brach so plötzlich, wie er gekommen war.
Ich blinzelte ungläubig. Mein Verstand weigerte sich, zu verarbeiten, was eben geschehen war. Was ich ausgelöst hatte. Schon wieder. Verdammt. Wie hatte das nur passieren können? Wie? Dabei setzte ich doch sonst immer alles daran, die Kontrolle zu behalten.
Zorn funkelte in den Augen des Dekans, und was die letzten Tage nur eine Ahnung gewesen war, wurde mit einem Mal bittere Gewissheit. Er musste es nicht sagen. Musste mir nicht vorhalten, dass ich als ach so emotionsgesteuerte Frau ein Risiko darstellte. Musste mir keine schriftliche Bestätigung geben, dass meine Bewerbung an der Academia Artis Antiquae hiermit abgelehnt war. Sein Blick verriet mir alles, was ich wissen musste.
Stolz hob ich das Kinn und nahm das Empfehlungsschreiben zurück. Obwohl ich dafür keine Verwendung mehr hatte, würde ich dieses Erinnerungsstück an meinen Vater nicht hergeben. Mir war ohnehin schon zu wenig von ihm geblieben.
»Lass mich dir einen Rat geben, Ligeia.« Plötzlich wieder in sanftem Tonfall kam der Dekan um den Schreibtisch herum. Wohlwollend legte er mir die Hand auf die Schulter, doch mir entging sein Zögern nicht. Dass meine Machtdemonstration offenbar Eindruck geschunden hatte, war allerdings nur ein schwacher Trost. »Zu deiner eigenen Sicherheit vergiss, was dir dein Vater über die Alte Kunst beigebracht hat. Unser Wissen ist gefährlich – vor allem in den Händen jener, die keine Kontrolle besitzen. Also halt dich davon fern, verlass unverzüglich die Stadt und sieh es als Entgegenkommen deinem verstorbenen Vater gegenüber, dass ich diesen Vorfall und deine Umstände nicht der Stadtgarde melde.«
Ich starrte ihn an, hatte keine Worte mehr. Meine Wut war verraucht und hatte blanker Resignation das Feld überlassen. Ich hatte es geahnt. Ich hatte es verdammt noch mal geahnt, aber nun traf mich die Gewissheit wie eine Faust in die Magengrube.
Es gab für mich keine Zukunft. Nicht in der letzten Stadt Aethra und erst recht nicht an der Akademie. Alles, worauf ich mich ein Leben lang vorbereitet hatte, war in unerreichbare Ferne gerückt. Ich hatte nichts mehr. Nur noch meine Erinnerungen. Und wenn es nach dem Dekan ging, war es höchste Zeit, diese ebenfalls gehen zu lassen.
I Can’t Hurt Me Now
Drei Jahre später
In den Tiefen dieser Welt lauert der Tod, sagten sich die Leute und ahnten dabei nicht, was sonst noch dort schlummerte. Es stimmte, die Dunkelheit der Höhlen und Ruinen unter unseren Füßen barg Gefahren, aber auch so viel mehr. Einen Schatz, der wertvoller war als jeder Diamant, kostbarer als die Krone auf dem Haupt des Hohekönigs von Magaea: unsere Vergangenheit. Mit ihrem Wissen und vielleicht einer Antwort auf die Frage, wie wir diese kaputte Welt retten konnten. Die Suche danach hatte ich mir in den Jahren seit meiner Abreise aus Aethra zur Aufgabe gemacht und ich würde nicht aufgeben, bis ich eine Möglichkeit fand, den Fluch der ewigen Nacht zu brechen.
Als ich noch in der Letzten Stadt gelebt hatte, war es mir schwergefallen, allein an der Farbe des Himmels die Uhrzeit festzumachen. Der Tag hatte stets gleich ausgesehen. Egal wie hoch oder tief die Sonne am Himmel stand, alles war in Rot getränkt gewesen. Doch in den Ländereien Magaeas hatte ich gelernt, die feinen Nuancen zu unterscheiden. Die frühen Morgenstunden waren zarter und manchmal sogar rosa, der Mittag ein kräftiges Zinnoberrot, wohingegen der Abend einen fast schon kupfernen Schimmer besaß.
Hier draußen war die Luft kälter als in den Gassen der Letzten Stadt. Die Landschaft war karg und die wenige Vegetation bestand aus Sträuchern und Bäumen, die ebenso widerstandsfähig waren, wie die Menschen, die die Steppe zu ihrer Heimat gemacht hatten. Manche zogen allein, als Paar oder in kleinen Gruppen durch das Land, während sich andere zu Kommunen und Dörfern zusammengeschlossen hatten. Ein hartes Leben verglichen mit dem Komfort und der Sicherheit Aethras, aber ein freies. Eines, in dem mich kein Dekan davon abhielt, in die Tiefen hinabzusteigen und den Beruf auszuüben, den er mir hatte verwehren wollen.
Die Nacht brach bereits herein, als ich die Mispel erreichte, ein schiefes, mehrstöckiges Fachwerkhaus am Rand eines Dorfes, das mit seiner rot gestrichenen Fassade idyllisch eingebettet zwischen grasbewachsenen Hügeln lag. Obwohl ich meine Zeit am liebsten unterwegs verbrachte, wurde mein Herz leichter und die Anspannung der letzten Wochen fiel von mir ab. Es war wie nach Hause kommen.
Wie schon so viele Male zuvor ignorierte ich den hell erleuchteten Haupteingang, durch den um diese Zeit die ersten Gäste das Etablissement betraten, und steuerte auf eine unscheinbare Tür auf der Rückseite zu. Warme Luft empfing mich und der Geruch schwerer Parfüms, der in den roten Teppichen, Vorhängen und selbst in den Tapeten haftete. Mich überkam ein wohliger Schauer, der mich erleichtert aufseufzen ließ. Ich war zurück. Und ich konnte es kaum erwarten, in einem heißen Bad zu versinken.
Ich ließ die schweren Stiefel im Eingangsbereich stehen und schlich auf Zehenspitzen in Richtung Treppe. Während die Bereiche für die Kundschaft ausladend groß und opulent gestaltet waren, waren die Hinterzimmer der Mispel eher schlicht gehalten, eng und fast schon düster. Es gab eine Küche im Erdgeschoss, zwei Badezimmer, ein Büro und einen gemeinsamen Schlafsaal oben unter dem Dach.
Eigentlich hatte ich meine Ankunft bewusst etwas hinausgezögert, weil für die allermeisten Bewohnerinnen gerade die Schicht begann und ich ein wenig meine Ruhe haben wollte, doch offenbar hatte Aurora mich aus der Ferne gerochen. Kaum war ich auf Höhe der geöffneten Küchentür, stoppte mich der Klang ihrer Stimme.
»Der Eingang für Kundschaft ist vorne.«
Ich verdrehte die Augen und blieb stehen. »Ich bin keine Gästin.«
»Dann hör auf, hier so rumzuschleichen, als wärst du auf der Suche nach dem Klo falsch abgebogen.« Obwohl sie versuchte, ihre Stimme streng klingen zu lassen, hörte ich das Lächeln aus ihren Worten heraus.
Als ich mich der Küche zuwandte, bestätigte sich dies. Aurora lehnte mit verschränkten Armen am Ofen, während Valentina, ihre Freundin, ächzend einen riesigen Teigklumpen knetete. Mir war klar, dass sie mich nicht ziehen lassen würde, ohne sicherzugehen, dass es mir gut ging, weshalb ich entschied, dass mein Bad noch eine Stunde warten konnte. Mindestens genauso nötig hatte ich nämlich etwas zu essen.
»Arbeitest du heute nicht?«, fragte ich Aurora, während ich den schweren Rucksack von den Schultern gleiten ließ. Augenblicklich konnte ich spüren, wie meine Wirbelsäule sich aufrichtete.
»Nein. Die Kälte hält die Gäste fern, also haben Valentina und ich uns freigenommen, um stattdessen mal wieder überall Ordnung zu machen.«
»Ihr kommt doch klar, oder?«, wollte ich besorgt wissen.
»Oh ja. Die Saison lief gut, und solange du nicht ausziehst, brauchen wir uns ums Essen keine Sorgen zu machen.«
Ich nickte erleichtert. Die Mispel lag wenige Stunden von Aethra entfernt und lockte dadurch nicht nur Kundschaft vom Land, sondern auch häufiger aus der Stadt an, wo Sexarbeit verboten war. Nachdem ich mein altes Leben abrupt hatte hinter mir lassen müssen, hatte Aurora mir Unterschlupf geboten. Zunächst kostenlos, dann, sobald ich mich eingewöhnt hatte, hatte ich begonnen, im Gegenzug hier zu arbeiten. Doch schnell hatte ich realisiert, dass ich nicht einfach vergessen konnte, wie es der Dekan von mir verlangt hatte. Seither machte ich das, was ich schon immer hatte tun wollen: Ich erkundete die Ruinen unserer Vorfahren im Untergrund auf der Suche nach Artefakten und Konstrukten, die ich wieder instand setzte und weiterverkaufte. Die Mispel diente mir dabei als Rückzugsort, an dem ich die Winter verbrachte und meine Kräfte sammelte, bevor ich mich auf die nächste Reise begab. Im Gegenzug bezahlte ich Aurora Miete und versuchte mit meiner Magie das Leben der Bewohnerinnen des Etablissements ein wenig leichter zu machen.
Ich ließ meinen Kopf im Nacken kreisen, bevor ich in die Mitte des Raumes trat. Über einem Tisch hing ein opulentes Lampenkonstrukt, das ich vor einigen Monaten mitgebracht hatte. Nach und nach erlosch die Magie darin, doch eine Berührung reichte, um den Zauber zu erneuern. Zusammen mit der Lampe erhellte sich der ganze Raum.
»Bin ich froh, dass du wieder da bist«, sagte Aurora erleichtert. »Es wurde immer dunkler die letzten Tage. Ich hatte schon Angst, dass Valentina sich beim Kochen versehentlich die Hand abschneidet.«
»Wird nicht passieren«, warf diese knapp ein. Ihr einziger Beitrag zu diesem Gespräch, und ich glaubte ihr sofort. So richtig sicher wusste niemand, woher Valentina kam, nur, dass sie eine begnadete Tänzerin war und eine Koordinationsfähigkeit besaß, von der ich nur träumen konnte. Unter den Arbeiterinnen in der Mispel herrschte das Gerücht, sie hätte als Akrobatin für einen Wanderzirkus gearbeitet, Aurora war sich sicher, dass sie aus einem der Nachbarländer stammte.
Während Valentina nur dann etwas sagte, wenn sie wirklich wollte, schaffte es Aurora kaum, eine Minute still zu bleiben. Sie war zwischen Tänzerinnen, rauschenden Festen und Freiern in der Mispel aufgewachsen. Normalerweise wechselte die Belegschaft mit den Jahreszeiten, doch Aurora hatte nie den Drang verspürt, mehr von der Welt zu sehen und das Etablissement schließlich übernommen. Allerdings hielt sie dies nicht davon ab, jede noch so kleine Anekdote aus mir herauszuquetschen, sobald ich nach Hause zurückkehrte.
Sie drückte mich auf einen der Stühle und stellte kommentarlos eine Tasse Schwarztee vor mir ab, in den sie einen Schuss Milch und zur Feier des Tages sogar einen Teelöffel Honig mischte. Ein Luxus, den sie normalerweise für besondere Anlässe aufsparte. Anschließend ließ sie sich gegenüber von mir nieder und musterte mich aus schmalen, schwarzbraunen Augen, die dieselbe Farbe wie ihre Haut hatten. Ihre dunklen Locken hatte sie zu winzigen Zöpfchen geflochten, von denen sie sich eines spielerisch um die Hand wickelte.
»Und?«, fragte sie. »Wie wars?«
Ich unterdrückte ein Stöhnen. Es war nicht so, dass ich nicht gern über meine Reisen sprach, doch die Frage ›Wie wars?‹ war so unspezifisch, dass ich augenblicklich vergaß, was ich alles erlebt hatte.
»Gut? Ich weiß, du kriegst sofort das Gefühl dabei gewesen zu sein, so lebhaft wie ich erzähle. Aber ich hab dieses Mal echt nicht viel zu berichten.«
»Hast du niemand Interessanten getroffen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Es wird Winter.« Und der brachte eine Kälte mit, die selbst viele Nomaden zur Sesshaftigkeit zwang.
»Wie du das immer machst. Du warst fast einen Monat weg. Ich wäre vor Einsamkeit gestorben.«
»So schlimm ist das nicht.« Und überhaupt war ich es gewohnt. Ich hatte quasi mein ganzes Leben allein verbracht. Ob ich nun zwischen Büchern saß oder in verlassenen Höhlen herumkletterte, mir wurde nicht langweilig. Und ich hatte auch nie das Gefühl, mir würde etwas fehlen. »Aber wenn du willst, kannst du nächstes Mal gern mitkommen.«
Aurora verzog das Gesicht. »Vergiss es. Ohne mich würde hier nichts laufen.« Im Hintergrund stieß Valentina amüsiert Luft aus. »Das hab ich gehört!«
»Keine Sorge. Das würde ich dir auch nicht zumuten wollen«, erklärte ich zwinkernd.
Ein verschmitztes Lächeln huschte über Auroras volle Lippen. »Wie großzügig von dir. Willst du eigentlich etwas essen?«
»Bin schon dabei«, verkündete Valentina, noch ehe ich antworten konnte, und mir fiel auf, dass sie den Teig mittlerweile ruhen ließ und stattdessen einen Suppentopf auf den Tonherd gestellt hatte.
»Danke«, sagte ich. »Ihr habe keine Ahnung, wie sehr ich mich auf eine richtige Mahlzeit freue.«
»Es wurde auch langsam Zeit, dass du nach Hause kommst, ich hatte schon Sorge, dass du in irgendein Loch gefallen bist. Wir müssen dich mal wieder ein paar Tage durchfüttern.«
Ich konnte nicht verhindern, dass meine Gesichtszüge für einen Moment entgleisten, was Aurora nicht entging.
»Es sei denn, du hast andere Pläne?«
Angespannt presste ich die Lippen zusammen. Ich hatte gehofft, dieses Gespräch eine Weile hinauszögern zu können – zumindest bis ich mir die richtigen Worte zurechtgelegt hatte, um ihr zu erklären, dass ich nicht lange bleiben wollte. Doch jetzt, wo Aurora ahnte, dass etwas im Busch war, würde ich nicht so leicht davonkommen.
»Ich breche morgen wieder auf.«
»Was, morgen schon?«, stieß sie aus und selbst Valentinas graue Augen weiteten sich kurz, als sie eine dampfende Schüssel Eintopf vor mir abstellte. Sofort wandte sie sich ab, um sich wieder dem Teig zu widmen, doch Aurora starrte mich weiter schockiert an.
»Ja.«
»Aber das ist zu früh. Du brauchst doch eine Pause.«
»Es geht schon, wirklich«, beteuerte ich und schob mir einen Löffel voll Eintopf in den Mund. Dankbar kaute ich auf den würzigen Gemüsestücken rum und genoss das Gefühl der warmen Brühe im Rachen. Nach Wochen in der Wildnis hatte ich es so satt, mich von Pflanzen und Beeren zu ernähren, doch meinen Aufenthalt in der Mispel zu verlängern, kam nicht infrage.
»Und was ist mit dem Wetter? Der Winter …«
»Ist noch nicht da«, unterbrach ich sie sanft. »Es wird kälter, aber mir bleiben ein paar Wochen, bis es zu kalt wird. Genau deshalb will ich so schnell wie möglich wieder los.«
Und nicht nur der Frost war eine Gefahr, sondern auch Niederschlag. Zunehmende Regenfälle im Gebirge machten meine Arbeit geradezu unmöglich. Die Tiefen waren ohnehin schon tückisch, aber eine Sturzflut wollte nicht einmal ich riskieren.
»Trotzdem ist es gefährlich.« Aurora verschränkte die Arme vor der Brust. »Deine geliebten Ruinen laufen schon nicht davon.«
»Aurora, bitte … ich muss.« Zögernd legte ich den Löffel ab und sah ihr in die Augen, unsicher, ob ich ihr die Wahrheit über mein geplantes Reiseziel erzählen sollte. Mir entging nicht, dass auch Valentina ihre Bewegungen verlangsamt hatte, um nicht zu viel Lärm zu verursachen. Sie spürte meine Anspannung. »Die letzten Ausflüge waren nicht annähernd so gewinnbringend wie erhofft.«
»Du weißt, dass du hier jederzeit wieder arbeiten kannst. Egal, ob mit den Kunden oder hinten bei Val.«
»Ich weiß.« Und ich konnte mir Schlimmeres vorstellen. Nachdem ich in der Mispel gelandet und auf die Füße gekommen war, hatte ich ein halbes Jahr hier gearbeitet. Die Frauen hatten mich gut aufgenommen und mir so vieles über das Leben außerhalb der Stadt beigebracht, dass ich ewig in ihrer Schuld stehen würde. Trotzdem sah ich meine Zukunft nicht in diesem Etablissement. Auch nicht als Untermieterin. Und das wusste Aurora ebenfalls. »Aber das meine ich nicht.«
»Du glaubst doch nicht etwa immer noch, dass du da unten die Welt retten kannst.«
Wenn sie es so sagte, klang es umso lächerlicher. Und obwohl ein kindischer, naiver Teil von mir daran glaubte, war mir klar, dass es arrogant war, zu denken, ausgerechnet ich könnte die Sonne zurückbringen. Als würde sich dort unten in den Tiefen ein unentdecktes Konstrukt verbergen, das mithilfe von Magie den Mond in seine ursprüngliche Position bringen könnte. Nein, das wäre zu einfach, das war mir bewusst. Genauso wie mir bewusst war, dass ich zu Aurora nicht hundertprozentig ehrlich war. Ebenso wenig wie zu mir selbst.
Als sie mich zum ersten Mal danach gefragt hatte, was genau mich zu unserer Vergangenheit zog, hatte ich ihr die Antwort gegeben, an die mein jüngeres Ich geglaubt hatte: Weltrettung. Einen Weg, den Fluch zu brechen. Aber insgeheim hatte ich mir eingestehen müssen, dass sich meine Motive inzwischen geändert hatten. Ich hatte zu viel gesehen und erlebt, um mit völliger Überzeugung auf eine Lösung zu hoffen. Stattdessen wollte ich mich beweisen. Mir selbst gegenüber. Meinem Vater. Und der Akademie, die mir meine Zukunft verwehrt hatte.
Aber zwischen »Weltrettung« und Aurora zu gestehen, wie verletzt mein Stolz war, seit ich aus Aethra geworfen worden war, entschied ich mich lieber für die Version, die mich weniger egoistisch wirken ließ.
»Ich habe ein paar Forscher getroffen. Letzte Woche«, sagte ich schließlich. »Und eines ihrer Gespräche belauscht.«
»Und?«
»Sie bestätigen das, was ich schon vermutet habe. Die meisten Ruinen im Zentrum Magaeas sind mittlerweile erschlossen. Viel gibt es dort nicht mehr zu holen. Deshalb will ich es dieses Jahr noch woanders probieren. Nur noch eine einzige Expedition, es sollte nicht lange dauern.«
Auroras Miene wurde finster und sie überging geflissentlich meinen letzten Satz, den ich zur Beschwichtigung angehängt hatte. »Und woanders heißt?«
»In den Bergen«, antwortete ich unverbindlich.
»In den Bergen. Ist das alles?«
Ich atmete tief durch und starrte an die Decke. Die schmalen Holzbalken knarzten leise, als sich jemand im Stockwerk über uns bewegte.
»Ligeia.«
»Ich will zum Oyranos«, gestand ich schließlich. »Und die Ruinen darunter erforschen.«
Eine Weile herrschte Totenstille. Selbst Valentina hatte von ihrem Teig abgelassen und fixierte mit verschränkten Armen einen Punkt hinter mir an der Wand. Dann erhob Aurora erneut die Stimme.
»Was ich davon halte, brauche ich dir sicher nicht zu sagen.«
»Nein. Ich weiß, dass es nicht ungefährlich ist.«
»Und verboten!«, stieß sie aus. »Hast du mir nicht selbst erzählt, dass der König höchstpersönlich veranlasst hat, dass sich niemand dem Berg nähern darf?«
»Hat er. Aber ich will mich dort trotzdem umsehen. Mit ziemlicher Sicherheit stoße ich eh auf eine Sackgasse. Dann hab ich wenigstens meine Antwort.«
»Und wenn nicht? Wenn die Gegend verboten ist, dann sicher nicht ohne Grund. Unter dem Berg könnte sonst was lauern. Fallen, Konstrukte, ein gefährliches Labyrinth, aus dem du nie wieder herausfindest.«
»Nichts, was ich nicht schon erlebt hätte«, erwiderte ich selbstbewusst. Ich hatte bereits so manch knappe Situation gemeistert. Seit über zwei Jahren streifte ich durch die Tiefen. Ich war weitergekommen, als die Akademie es mir je zugetraut hätte. Und ich wusste, wie ich mich in der bleiernen Finsternis zurechtfand. Der Oyranos machte mir keine Angst.
»Du meinst das wirklich ernst«, sagte Aurora ungläubig und die Furcht in ihrer Stimme traf mich härter als erwartet. Vielleicht, weil ich seit dem Tod meines Vaters nie das Gefühl gehabt hatte, dass ich jemandem viel bedeutete. Doch wenn Aurora mich so ansah, fühlte es sich beinahe so an.
»Mir wird schon nichts passieren.« Ich streckte mich über den Tisch, um kurz die Hand auf ihre zu legen. »Wie gesagt: Es ist am wahrscheinlichsten, dass der Eingang komplett versiegelt ist. Und wenn nicht, finde ich da unten vielleicht eine Antwort. Oder ein Konstrukt, das euch die Hausarbeit abnimmt.«
»Das wäre doch mal was!«, sagte Valentina in dem schwachen Versuch, die Situation aufzulockern. »Meinst du nicht, Aurora?«
Die Angesprochene seufzte. »Zu wissen, dass Ligeia in Sicherheit ist, wäre mir lieber als eine Haushaltshilfe.«
»Und das werde ich sein. Die Tiefen sind lange nicht so gefährlich, wie die Leute behaupten. Und sobald ich zurück bin, wirst du mich für den Rest des Winters nicht mehr los.«
»Du lässt es klingen wie eine Drohung … aber schön. Ich hab längst aufgegeben, mich gegen deinen Dickkopf durchsetzen zu wollen. Wann brichst du auf?«
»Gleich morgen früh.«
II The God in the Deep
Von der Mispel bis ins Gebirge waren es knapp vier Tagesmärsche, doch bereits wenige Stunden von der Bucht entfernt, an der Aethra lag, begann das Gelände hügeliger zu werden, bis sich irgendwann die Götterberge vor mir erhoben. Steile, schneebedeckte Gipfel ragten bis weit hinauf in den Himmel und glühten im Licht der permanenten Sonnenfinsternis hellrot. Der Anblick hatte etwas Bedrohliches, doch ich war in erster Linie dankbar, weil das gute Wetter mir die Reise um einiges erleichterte.
Mit jedem Tag, den ich weiter ins Gebirge vordrang, begegnete mir weniger Zivilisation. Zunächst verschwanden die kleinen Dörfer, dann die vereinzelten Häuser und schließlich die Zelte. Nicht eine Karawane oder auch nur einen einsamen Wanderer verschlug es so weit nach Nordwesten. Nicht einmal die Forscher der Akademie. Vielleicht war ich auf der richtigen Spur.
Ich orientierte mich an den Silhouetten der Berge, bis ich schließlich auf die Überreste einer alten Straße stieß. Einzelne, in den Boden eingelassene Pflastersteine deuteten darauf hin, dass diese Gegend vor einigen Jahrhunderten wesentlich belebter gewesen war, als die wenigen Vögel, die in den kargen Sträuchern hausten, verhießen. Vielleicht hatte es in den Bergen sogar eine Stadt gegeben – möglich war es, aber sicher wusste das niemand. Mit der Sonne hatte unsere Welt auch den Großteil ihrer Infrastruktur verloren. Ein gewaltiges Erdbeben hatte ganze Landstriche verwüstet, Städte zu Staub verwandelt und ihre Überreste unter die Erde verbannt. Lediglich Aethra war unversehrt geblieben.
Zu meiner Überraschung führte die Straße direkt auf den Oyranos zu und je länger ich ihr folgte, desto steiler wurde sie, während der Berg umso einschüchternder in die Höhe ragte. Früher hatten die Menschen im Land der drei Königreiche geglaubt, dass man vom Gipfel aus mit den Göttern sprechen konnte, doch selbst wenn das stimmte, käme heute sicher niemand mehr auf die Idee, es zu versuchen. Die Götter hatten gezeigt, was sie von uns hielten, und wir Menschen hatten erkannt, dass wir ohne sie zurechtkommen mussten.
Langsam wuchs meine Nervosität und ich warf einen besorgten Blick zum Himmel. Der Nachmittag war gerade erst angebrochen und ich hatte längst den Fuß des Oyranos erreicht. Ich würde der Straße noch ein wenig folgen, bevor ich mich auf die Suche nach einem Eingang zum Untergrund machte, doch dann wusste ich nicht weiter. Ich hatte genügend Kraft übrig, jedoch keine Ahnung, was mich in den Höhlen unter dem Berg erwartete. Wer wusste schon, wie weit sich das Netzwerk aus Tunneln unter meinen Füßen erstreckte? Es konnte nur ein paar Stunden dauern, bis ich alles erkundet hatte – oder ganze Tage – und die Aussicht darauf, in der Tiefe zu übernachten, schreckte mich auch nach Jahren noch ab.
Ob ich … Ein lautes Geräusch riss mich aus den Gedanken und versetzte mich sofort in Alarmbereitschaft. Eilig zückte ich meinen Dolch und sah mich um. In der unmittelbaren Umgebung war nichts zu sehen, doch die karge Landschaft und die hohen Felswände konnten das Echo über Kilometer tragen. Mit rasendem Puls schloss ich die Augen und hörte genauer hin.
Es klang wie ein Scheppern. Metall auf Metall gemischt mit dem dumpfen Klang schwerer Schritte. Ein Centurion, dämmerte es mir. Geistesgegenwärtig duckte ich mich, während ich versuchte, das Geräusch zu verorten. Es schien vom Berg zu kommen. Aber was trieb ein Konstrukt hier oben?
Vorsichtig schlich ich von den Überresten der Straße weg und ging in einem seichten Graben daneben in Deckung. Die wenigen Sträucher und kläglichen Bäume, die dort wuchsen, würden mir keinen Sichtschutz bieten, aber es war alles, was ich hatte. Eigentlich Grund genug, sofort kehrtzumachen, doch meine Neugier trieb mich weiter den Berg hinauf.
Schon bald wurde der Lärm lauter und die Straße mündete plötzlich in einer breiten und überraschend intakten Treppe, die zu einer Art Plateau führte. Mit gezücktem Dolch betrat ich die Stufen und machte mich dabei so klein, dass ich förmlich an dem glatten weißen Stein klebte. Die Jahre hatten an einigen Stellen Moos sprießen lassen, doch ansonsten erinnerte mich das Material an den schneeweißen Quarz, in den die letzte Stadt Aethra gehauen war.
Was war das für ein Ort?
Darum bemüht, kein Geräusch von mir zu geben und meinen Atem ruhig zu halten, kroch ich die Stufen empor, bis ich fast ihr Ende erreichte. Von dort lugte ich vorsichtig über den Rand des Plateaus. Vor mir lag ein weitläufiger Platz, der in den Hang des Berges hineingemeißelt war. Moos bedeckte fleckenweise das Mosaik aus Steinfliesen, in das ein goldener Stern mit dreizehn Zacken eingelassen war. Dahinter befanden sich eine riesige, steinerne Pforte und vor ihr der Ursprung des Lärms.
Mein Herz machte einen Satz. Ich hatte mich nicht getäuscht, hier oben war ein Konstrukt, ein Centurion. Und was für einer. Der Wächter erinnerte an eine wandelnde Rüstung und überragte mich um das Doppelte. Am Ende beider Arme befanden sich scharfe Äxte, deren Anblick allein mich in die Flucht treiben sollte, doch die Faszination hielt mich gefangen.
Ich musterte den Centurion weiter. Aus den winzigen Lücken zwischen den einzelnen Gliedern sickerte hellblaues Licht, eine Magie, die so mächtig war, dass ich sie sogar über die Entfernung hinweg spürte. Es musste ein ganzes Dutzend Meister der Alten Kunst brauchen, um diese Maschine in Betrieb zu nehmen. Nur, warum war sie hier? Was bewachte ein bis an die Zähne bewaffnetes Konstrukt auf diesem Berg?
Ich musste vorsichtig sein. Sollte wegrennen. Aber stattdessen streifte mein Blick erneut die Pforte. Bei genauerer Betrachtung entdeckte ich ein Muster im Stein. Feine Linien, die dort hineingemeißelt worden waren, mich an Inschriften in anderen Ruinen erinnerten und keinen Zweifel daran ließen, dass nicht wir den Eingang zu dieser Höhle versiegelt hatten, sondern unsere Vorfahren, als wollten sie uns aussperren.
Oder etwas einsperren.
Der Gedanke verursachte mir Gänsehaut, doch gleichzeitig schürte er meine Neugier so weit, dass ich sämtliche Vernunft ignorierte. Es gab nur diesen einen Centurion und ja, er mochte groß und gefährlich aussehen, aber er war auch allein. Nichts und niemand hielt ihm den Rücken frei. Wenn ich nur irgendwie an seinen Rumpf käme, wo die Magie in einem Dymion gespeichert war, dann könnte ich ihn vielleicht außer Kraft setzen …
Ich legte den Rucksack ab, atmete tief ein und tastete auf dem Boden nach einem losen Stein. Dabei ignorierte ich die warnende Stimme meines Vaters in meinem Kopf. Wie so oft. Er war nicht mehr hier. Er konnte nicht mehr auf mich aufpassen. Nur noch ich selbst. Und ich würde zurechtkommen. Mit einem einzigen Konstrukt wurde ich fertig, egal wie furchteinflößend es wirkte.
Ich holte aus und warf den Stein über das Plateau, so weit ich konnte. In der Stille der Berge hörte ich, wie er von den Fliesen abprallte und einige Meter weiter hüpfte, wo er schlitternd liegen blieb. Ich duckte mich tiefer auf die Stufen, hielt den Atem an und wartete.
Ich hörte, dass sich der Centurion wieder in Bewegung setzte. Das Scheppern des Metalls schien sich ein Stück zu entfernen. Meine Chance. Möglichst geräuschlos schlüpfte ich aus der Deckung und betrat das Plateau. Mein Plan hatte funktioniert, denn die Maschine lief zielstrebig in Richtung des Steins. Hastig schlich ich ihr hinterher, doch bei ihren riesigen Schritten, hatte ich Mühe die Distanz zu überbrücken. Als ich die Mitte des im Boden eingelassenen Sterns erreicht hatte, kam mir der Gedanke, dass ich einen gewaltigen Fehler beging. Doch wenn ich jetzt umdrehte, würde mich das nur noch mehr in Gefahr bringen.
Mittlerweile hatte das Konstrukt angehalten und musterte den unscheinbaren Stein auf dem Boden. Ich hatte immer noch nicht genug zu ihm aufgeschlossen, um es schnell zu überwältigen, aber jetzt gab es nur den Weg nach vorne. Ich beschleunigte meine Schritte, achtete nicht mehr darauf, mich leise fortzubewegen, und biss die Zähne zusammen, als es seinen Kopf zu mir umdrehte. Sofort färbten sich die leuchtenden blauen Augenhöhlen rot.
Sein Schöpfer hatte ihm Hörner verpasst, wodurch der Centurion wie ein wütender Stier wirkte. Er lief auf mich zu, die Äxte hoch über dem Haupt erhoben.
Mist. Mist. Mist.
Trotz seiner gewaltigen Größe war er verdammt schnell. Zu schnell. Ich musste mich auf das besinnen, was ich in den vergangenen Jahren gelernt hatte und die Maschine irgendwie ausspielen.
Mutig rannte ich ihr entgegen und wich in letzter Sekunde einem Axthieb aus. Ich spürte den scharfen Luftzug an meiner Wange. Geistesgegenwärtig sprang ich zur Seite, als die zweite Waffe mit voller Wucht in das Steinmosaik krachte. Unter mir bebte die Erde, sodass ich kurz das Gleichgewicht verlor.
Ich stolperte, fiel und schaffte es gerade so, mich abzurollen, ehe schon der nächste Hieb auf mich niederging. Dieser erwischte meinen Mantel, der laut riss. Allein die Beine des Centurions überragten mich, doch durch das Ausweichmanöver hatte ich mich in eine günstige Position gebracht. Ich schlug meinen Dolch in die Innenseite seines rechten Knies. Schmerzen würde er dadurch zwar keine haben, doch die Klinge würde seine Bewegungen behindern und mir wertvolle Zeit verschaffen, an seiner Rückseite hinaufzuklettern.
Unter meinen Händen erzitterte das Metall, als die Bewegungen des Konstrukts immer wilder wurden, und ich hatte Mühe, Halt zu finden. Nur ein Stück höher und ich hatte es geschafft. Ich spürte die Magie ganz deutlich unter dem Rückenpanzer und schob meinen Arm, ohne zu zögern, in eine Lücke zwischen zwei Metallringen, die den Brustkorb bildeten.
Als ich den glühenden Kristall in seinem Inneren, den Dymion, umschloss, jagte knisternde Magie durch mich hindurch, mächtiger als alles, was ich je erlebt hatte. Ich konzentrierte mich auf den Fluss, auf das schmerzhafte Prickeln, das er auf meiner Haut hinterließ und versuchte, ihn meinem Willen zu beugen, ihn dazu zu zwingen, von dem Konstrukt abzulassen und stattdessen in meinen Körper zu wandern.
Nach außen hin dauerte der Vorgang nur ein paar Sekunden, doch für mich fühlte sich der Umgang mit Magie jedes Mal so an, als würde die Zeit an Bedeutung verlieren. Als würde ich keine Augenblicke mit ihr ringen, sondern ganze Jahrhunderte.
Schließlich gab der Zauber nach, breitete sich von meiner Hand nach und nach in meinem ganzen Körper aus und hinterließ nichts als beißenden Schmerz. Ich kniff die Augen zusammen, als ein Schrei aus meiner Kehle drang. Es war zu viel. Viel zu viel. Mehr Magie als ich je zuvor gebändigt hatte. Und sie würde mich verschlingen.
Der stärkste Schmerz sammelte sich über meinem Schlüsselbein, dort, wo das Mal saß, das mich eigentlich daran erinnern sollte, die Macht der Alten Kunst zu respektieren. Nicht mit ihr zu spielen und vor allem keine unnötigen Risiken einzugehen. Es fühlte sich an, als würde jemand einen weiß glühenden Dolch in meine Brust rammen, der sich bis tief hinein in mein Herz bohrte.
Ich sah Sterne. Einen ganzen Kosmos gefüttert von den Schmerzexplosionen in meinem Körper, die mich schier um den Verstand brachten.
Dann endlich ließen sie nach. Der magische Strom wurde schwächer ebenso wie die Regungen des Konstrukts, bis es schließlich in sich zusammenfiel. Kraftlos rutschte ich daran herunter und rollte auf den Rücken.
Vor meinem Auge tanzten bunte Lichter über den roten Himmel. Mein Atem ging schwer, und allein den Brustkorb zu heben und zu senken, kostete mich alle Energie, die ich noch besaß. Am liebsten würde ich liegen bleiben und einschlafen, doch trotz aller Schmerzen erinnerte ich mich daran, weshalb ich hierhergekommen war. Und dass ich mich möglicherweise weiterhin in Gefahr befand.
Obwohl mein ganzer Körper zitterte, richtete ich mich auf und sah mich um. Ich hatte Angst, dass der Tumult des Kampfes weitere Sicherheitsmaßnahmen aktiviert hatte, doch bis auf meine lauten Atemzüge war es vollkommen still im Gebirge. Ich war allein – fürs Erste.
Routiniert tastete ich mich ab, um sicherzugehen, dass ich auch wirklich unverletzt war, und atmete erleichtert aus. Bis auf den zerrissenen Mantel war nichts passiert. Na also.
Probeweise tippte ich mit den Füßen gegen die leblosen Überreste des Konstrukts, das jetzt ohne die Magie wie ein wahllos zusammengewürfelter Haufen Schrott wirkte. Könnte ich es wieder instand setzen, wäre es zweifelsohne ein wertvoller Reisebegleiter, doch ich war nicht so arrogant zu glauben, ich könnte allein so viel Magie aufbringen, wie ich seinem Körper eben entzogen hatte.
Plötzlich entdeckte ich eine Gravur auf der Innenseite dessen, was einmal sein Brustpanzer gewesen war. Sie war verhältnismäßig klein, aber deutlich im Metall zu sehen. Eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz biss, mit der Sonne in ihrer Mitte. Das Insigne des Hohekönigs.
Ich erschauderte vor Unbehagen. Wieso ließ der König diesen Eingang von einem derart gewaltigen Konstrukt bewachen? Doch sicher nicht nur, um neugierige Abenteuer abzuschrecken. Höchste Zeit, es herauszufinden.
Ich holte eilig meinen Rucksack und lief mit einem letzten sorgsamen Blick über das Plateau zu der steinernen Tür. Mein Puls ging immer noch viel zu schnell und mein Körper war voller Adrenalin, aber ich wollte nicht länger als nötig hier verweilen und riskieren, entdeckt zu werden. Entschlossen legte ich die Hand auf das Gestein und ließ Magie aus meinem Körper herausfließen, wie ich es schon in anderen Ruinen getan hatte. Manche Konstrukte und Vorrichtungen waren noch immer intakt – so wie auch diese.
Augenblicklich leuchteten die Runen hellblau auf. Wie flüssiges Licht breitete sich die Energie von meiner Hand aus, bis die ganze Tür aktiviert war. Dann begann der Stein laut zu knirschen und die massiven Platten schwangen nach innen auf, als hätten sie meine Ankunft erwartet. Warmer Wind strömte mir entgegen und brachte den vertrauten Geruch der Tiefe mit sich. Staub, Feuchtigkeit und Metall. Es war, als würde der Berg atmen.
Ich prüfte den Sitz meines Rucksacks, dann betrat ich die Höhle. Kaum hatte ich die Schwelle passiert, schloss sich die Pforte hinter mir von allein. In meiner Tasche kramte ich bereits nach der Laterne, da geschah etwas, das ich bisher noch bei keiner Expedition erlebt hatte: Die Magie, mit der ich die Tür geöffnet hatte, verebbte nicht, sondern breitete sich entlang der Wände aus.
Auch hier waren Runen in den Stein gemeißelt. Komplexe, ineinander verschlungene Zeichen, deren Bedeutung mit der Alten Welt verloren gegangen war. Vage erinnerten mich die Formen an unsere heutigen Buchstaben, doch nicht genug, als dass ich ihnen irgendeine Bedeutung entlocken konnte, geschweige denn verstand, wieso sie mir den Weg leuchteten.
Ging ich ein paar Schritte nach vorne, wanderte der Schein mit mir. Hielt ich an, so tat er es ebenfalls. Wie ein Kometenschauer folgte das Licht meinen Bewegungen, sodass sich um mich herum eine Blase aus blauem Licht bildete, während sich der Tunnel einige Meter vor und hinter mir in bleierne Schwärze verlor. Ich ignorierte das mulmige Gefühl in der Magengrube, das mir dieser seltsame Ort bereitete, und marschierte los.
Schon bald fiel das Gelände ab. Die Luft wurde wärmer, abgestandener, weshalb ich schließlich eine Kerze aus meinem Rucksack holte und sie anzündete. Ihr schwacher Schein spendete kaum Licht, doch dazu war sie nicht da. Stattdessen nutzte ich sie, um sicherzugehen, dass mir nicht unbemerkt die Luft ausging, während ich tiefer ins Herz der Erde vordrang.
Dieser Tunnel war anders als alles, was ich je gesehen hatte. Normalerweise glichen die Gänge, die ich erkundete, eher schmalen Röhren, durch die ich stellenweise auf allen vieren hindurchkriechen musste. Nur an wenigen Stellen fanden sich die verfallenen Überreste unserer Vergangenheit, verrostete Konstrukte oder Inschriften wie diese, aber hier unter dem Oyranos fühlte ich mich, als würde ich durch die Zeit reisen. Das meiste war in einwandfreiem Zustand. Nur hin und wieder hatten sich kleine Brocken aus dem Stein gelöst oder das Grundwasser Risse in die Wände gebrochen. Als hätte die Zerstörung unserer Welt niemals stattgefunden.
Außerdem war dieser Pfad geradezu unnatürlich linear. Hin und wieder machte er zwar eine Biegung, doch nie stieß ich auf eine Abzweigung. Der Schacht führte einfach weiter nach unten, mal steiler, mal flacher, bis er irgendwann – ich hatte bereits jegliches Zeitgefühl verloren – abflachte.
Feiner Nebel sammelte sich auf dem Boden und deutete darauf hin, dass ich am Grund der Höhle angekommen sein musste. In dichten weißen Schwaben waberte er um meine Beine und glühte sacht im Licht der Magie, die mich den ganzen Weg begleitet hatte.
Wenige Minuten später öffnete sich der Tunnel zu einem Raum und unter den üblichen Geruch der Tiefe mischte sich ein weiterer Duft, den ich nicht zuordnen konnte. Seltsamerweise erinnerte er mich an ein Parfüm, süß und schwer, irgendwie auch blumig wie Veilchen. So etwas hatte ich noch in keiner Höhle erlebt, weshalb ich probeweise die Kerze erst über meinen Kopf und dann nach unten hielt. Die Flamme zuckte leicht, aber sie blieb. Ich konnte beruhigt atmen.
Etwas zuversichtlicher trat ich in den Raum und sah dabei zu, wie das magische Licht hereinströmte. Fast schon zielstrebig flutete es die umliegenden Wände und wanderte an ihnen hinauf zu einer kuppelförmigen Decke mit einer Öffnung in der Mitte, gut zwanzig Meter über mir. Die Runen waren so seltsam angeordnet, dass sie mich an den künstlichen Sternenhimmel in der Akademie erinnerten. Ehrfürchtig ließ ich den Blick über die Punkte und Linien wanderten, die den Raum in ein schwaches, bläuliches Glühen hüllten.
Gänsehaut bildete sich auf meinen Armen, weil ich die Macht, die in diesem Ort schlummerte, bis auf die Knochen spürte.
Dann entdeckte ich ihn. In der Mitte des Raums direkt unter der Öffnung befand sich eine Art Podest und darauf lag ein Mann. Auf eine Mumie war ich bisher bei keinem meiner Abenteuer gestoßen, doch schon an der Akademie hatte ich Geschichten von ihnen gehört. Anscheinend hatten unsere Vorfahren eine Technologie beherrscht, um Tote für die Ewigkeit zu konservieren.
Fasziniert näherte ich mich der Mitte des Raumes und bemerkte, dass das Licht intensiver wurde, als wollte die Magie mich ermutigen, weiterzugehen. Ich sah zuerst nach oben, um herauszufinden, was sich hinter der Öffnung verbarg. Ich musste ein paarmal blinzeln, doch dann erkannte ich am Ende eines langen Schachtes ein winzig kleines Stück des Nachthimmels.
War ich schon den halben Tag hier unten? So lange war mir der Abstieg nicht vorgekommen. Nachdenklich versuchte ich, auszumachen, welche Sterne ich dort oben sah, doch ich entdeckte nur eine Handvoll, deren Konstellation ich nicht zuordnen konnte. Dazu war die Öffnung zu klein.
Als ich die Mumie erreichte und ihr meine volle Aufmerksamkeit widmete, erschauderte ich. Obwohl das blaue Licht die Haut des Mannes fahl wirken ließ, war sie kein bisschen eingefallen, wodurch er aus der Nähe noch lebendiger erschien. Er wirkte nicht viel älter als ich. Sein Haar fiel ihm in nachtschwarzen Strähnen in das ovale Gesicht und schimmerte leicht. Sein markantes Kinn war glatt rasiert und er trug vier silberne Ringe und drei schlichte Anstecker an seinem linken Ohr. Eine antike Tunika gab den Blick auf seine glatte Brust frei, ebenso wie seine breiten Schultern und muskulösen Arme. Er sah geradezu übernatürlich schön aus. Fast schade, dass er seit Jahrhunderten tot war. Und das war er doch?
Unbehagen machte sich in mir breit. Er wirkte zu lebendig. Beunruhigend lebendig. Angespannt fixierte ich seinen Oberkörper, versuchte, nur das kleinste Heben und Senken seiner Brust auszumachen. Irgendetwas, das auf eine Atmung hindeuten könnte. Aber da war nichts. Da war nichts.
Oder?
Ich musste vollkommen den Verstand verloren haben, diese Möglichkeit überhaupt in Betracht zu ziehen, aber der Gedanke, dass der Mann noch leben könnte, ließ mich nicht los. Die Vorstellung allein machte mich nervös und ohne, dass ich es verhindern konnte, übernahm mein Körper die Kontrolle. Vorsichtig beugte ich mich hinunter, so weit, bis mein Ohr an seiner Brust lag.
Ich erwartete Kälte, ein Schaudern, als ich ihn berührte, doch nichts. Seine Haut war beinahe warm und der schwere Duft haftete wie ein Parfüm an seiner Kleidung. Ich schloss die Augen und lauschte angestrengt, aber ich konnte nur fühlen. Fühlen, wie mehr Magie den Raum erfüllte, wie sie sich wie Ranken von den Wänden ausbreitete und in meinen Körper kroch. Spüren, wie sich ihr vertrautes Prickeln in mein Herz stahl.
Dann hörte ich seinen Puls.
Vor Schreck ließ ich die Kerze fallen. Ertappt fuhr ich auf und starrte noch immer über ihn gebeugt in sein Gesicht, dessen Züge sich jetzt regten. Der Mann presste die Augen fester zusammen, runzelte die Stirn, so, als wäre er aus langem Schlaf erwacht. Abgelenkt davon und von den feinen Schatten, die seine dichten Wimpern auf seine Haut malten, bemerkte ich zu spät, dass auch der Rest seines Körpers sich bewegte. Seine Hand landete auf meiner Wange und wanderte von dort zu meinem Hinterkopf, wobei sie ein angenehmes Kribbeln auf meiner Haut hinterließ, mächtiger und berauschender als jede Magie.
Mit den Fingern fuhr der Mann durch mein Haar, ein zartes Lächeln streifte sein schönes Gesicht.
»Dio …« Seine Stimme war nur ein Hauch, ein tiefes Raunen, gleichermaßen sanft und belegt. Zwei Silben eines Wortes und obwohl ich keine Ahnung hatte, was oder wen er damit meinte, fiel es mir beunruhigend leicht, zu glauben, dass sie mir galten. Genauso wie dieses Lächeln. Und die Hitze, die seine Berührung durch meinen Körper branden ließ.
Noch immer schlaftrunken richtete er sich auf und lehnte sich mir mit schiefgelegtem Kopf entgegen, als wollte er … mich küssen. Kaum merklich verstärkte er den Druck auf meinen Hinterkopf. Ich spürte bereits, wie sein Atem mein Gesicht streifte, und ein Teil von mir wollte es zulassen. Wollte, dass der Fremde mich küsste. Wollte diesen bizarren Moment auskosten, nur, um zu sehen, was passierte. Um herauszufinden, wie es sich anfühlte.
Aber endlich kämpfte sich die Vernunft ihren Weg zurück in mein Bewusstsein. Geistesgegenwärtig zückte ich den Dolch und hielt dem Fremden die Klinge an die Kehle, kurz bevor seine Lippen meine berührten. Überraschenderweise wich er nicht einmal zurück, sondern zog nur die geraden Brauen zusammen.
»Keine falsche Bewegung«, zischte ich.
Er öffnete die Augen und für einen winzigen Moment stand Schock in seinem Blick, den er jedoch sofort mit einem spöttischen Grinsen überspielte.
»Kennen wir uns?«
»Nein.«
»Hätte mich auch überrascht. An so ein hinreißendes Lächeln würde ich mich erinnern.« Ein schlechter Scherz, denn meine Mundwinkel zeigten vertikal nach unten. Bedrohlich drückte ich die Klinge fester gegen seinen Hals, was ihn nicht im Geringsten zu beeindrucken schien. »Komisch. Normalerweise kenne ich die Namen der Frauen, die mich küssen wollen. Deiner muss mir entfallen sein.«
»Ich wollte dich nicht küssen.«
»Ach ja?« Er schaute vielsagend nach unten auf meine Hand, die ich, ohne es bemerkt zu haben, in den Stoff seiner Tunika gekrallt hatte. Sofort ließ ich davon ab, ein Fehler, der dem Fremden nicht entging. Binnen eines Wimpernschlags verschwand das Grinsen aus seinem Gesicht. Sein Gegenangriff folgte rasch und unerwartet, sodass mein Kopf kaum hinterherkam. In einem Moment raubte ein Hieb in den Bauch mir den Atem. Im nächsten war ich diejenige, die auf dem steinernen Podest lag, den Blick zur Öffnung in der Decke gerichtet und die kalte Klinge meines eigenen Dolches unterm Kinn.
Ich versuchte, mich von ihm loszureißen, doch der Fremde drückte mich mit seinem ganzen Gewicht nach unten. Sein Griff war stählern.
»Zeit, die Formalitäten aus dem Weg zu räumen, findest du nicht?«, raunte er mir bedrohlich zu. »Wer bist du, wo sind wir und was hast du mit mir gemacht?«
Das Funkeln in seinen Augen erinnerte an ein Raubtier. Keine Ahnung, wie ich ihn vor wenigen Minuten noch hatte anziehend finden können. Erneut setzte ich mich zur Wehr und ignorierte dabei den Dolch. Von einer Toten würde er keine Antworten bekommen.
»Lass mich los, dann verrate ich dir vielleicht meinen Namen«, knurrte ich.
»Nachdem du mich mit einem Messer bedroht hast? Ich glaube nicht. Also, wer …«
Ich rammte ihm mit aller Kraft mein Knie in die Seite, was ihm ein schmerzerfülltes Stöhnen entlockte, jedoch nicht reichte, um mich aus seinem Griff zu befreien. Für einen Toten war er verdammt stark.
»Hast du dich langsam beruhigt? Oder wie lange willst du dich noch zur Wehr setzen, bis du erkennst, dass du einem Gott nicht gewachsen bist.«
Einem Gott? Der Kerl war offenbar arrogant genug, sich für einen zu halten. Lächerlich. Dennoch hielt ich still und konzentrierte mich stattdessen auf meine Magie. Zwischen meiner Hand und dem Dolch lag immer noch die des Mannes, aber wenn ich mich anstrengte, schaffte ich es vielleicht …
»Zaubertricks werden dir nichts nützen«, warnte er mich.
»Ach ja?« Ich spürte, wie die Klinge an meinem Hals zu glühen begann. Etwas, das dem Fremden sicher ebenfalls nicht entging. Er musste die Hitze spüren, die sich durch das Metall fraß, und tatsächlich regte sich etwas in seiner Miene. Überraschung blitzte darin auf. Unglaube. Doch bevor ich seine Hand verbrennen konnte, warf er den Dolch energisch weg. Genau das hatte ich mir erhofft. Ohne die Waffe hatte er weniger Gewalt über mich, obwohl ich zugegebenermaßen keine Ahnung hatte, wie ich es mit seiner Muskelkraft aufnehmen sollte.
»Du beherrschst also Magie«, säuselte er. »Schön. Aber die wird dir nichts nützen, Sterbliche.« In Ermangelung einer Waffe ging er dazu über, meinen Hals mit seinen riesigen Händen zu umschließen. Er drückte nicht fest zu, gerade genug, um mir vor Augen zu führen, dass er noch immer die Oberhand hatte, doch dann geschah etwas Seltsames.
Ein beißender Schmerz, schlimmer noch als beim Kampf mit dem Centurion bohrte sich in meine Haut, direkt an die Stelle, wo das magische Mal saß. Es brannte fürchterlich, Tränen stiegen mir in die Augen und ein spitzer Schrei verließ meine Kehle. Und ich war nicht die Einzige, die es fühlte. Urplötzlich ließ der Fremde von mir ab, stolperte sogar ein paar Schritte rückwärts und starrte fassungslos auf seine unverletzte Handfläche, die eben noch auf dem Mal gelegen hatte.
»Was war das?!«
Ohne auf die Frage einzugehen, nutzte ich die Ablenkung, um mich trotz des Schmerzes von dem steinernen Podest hinunterzurollen und mich auf den Dolch zu stürzen. Sobald meine Finger den Schaft umschlossen, ließ ich Magie erneut fließen, bis die Klinge genauso glühte wie die Runen an den Wänden. Dieses Mal würde ich nicht zögern. Eine falsche Bewegung und es war mir egal, wer oder was der Mann behauptete zu sein.
Ich marschierte mit gezücktem Messer auf ihn zu und drängte ihn an eine Wand. Er wirkte noch immer vollkommen überrascht von dem, was gerade passiert war, und hob beschwichtigend die Hände. Ein Taktikwechsel, auf den ich nicht reinfallen würde.
»Ich stelle die Fragen«, informierte ich ihn drohend.
»Was war das eben?«
»Hast du mir nicht zugehört? Ich stelle die Fragen.«
Er verdrehte die Augen und ich konnte ihm förmlich ansehen, dass eine weitere Erwiderung auf seiner Zunge lag, doch zu meiner Überraschung verzichtete er darauf.
»Schön. Dann stell sie.«
»Was machst du hier unten?«
»Denkst du, ich hätte dich dasselbe gefragt, wenn ich die Antwort wüsste? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, geschweige denn, was du mit ›hier unten‹ meinst.«
War das sein Ernst? Oder hielt er mich zum Narren? Eindringlich starrte ich ihn an, konnte jedoch keine Lüge aus seinen dunklen Augen herauslesen. Wenigstens war dieses selbstgefällige Grinsen fürs Erste von seinen Zügen verschwunden.
»Du weißt also nicht, wie du hier gelandet bist?«, bohrte ich nach.
»Hätte ich einen Grund, es dir zu verschweigen?«