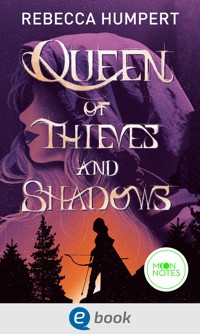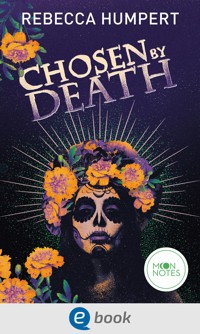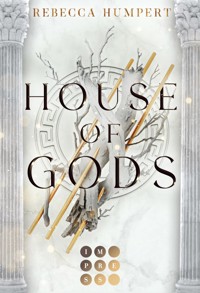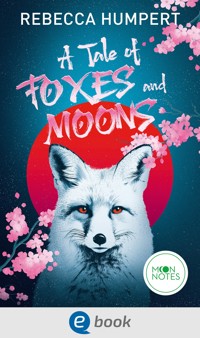
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Medizinstudentin Aiko führt alles andere als ein normales Leben – denn es ist nicht ihr erstes. Aiko ist die Reinkarnation der Fuchsgöttin Inari. Als solche wird ihre Seele so lange wiedergeboren, wie sie einen Naturgeist, einen Kodama, an ihrer Seite hat. Als Aikos Naturgeist getötet wird, muss sie in den Wäldern einen neuen Begleiter suchen. Dabei begegnet sie Chiaki, ihrem Rivalen aus der Universität. Auch dieser hütet ein Geheimnis: Er ist die Reinkarnation des Mondgottes Tsukuyomi und verlor ebenfalls seinen Kodama. Sein und Aikos Schicksal sind unweigerlich miteinander verbunden, denn jedes von Aikos vergangenen Leben endete durch Tsukuyomis Hand. Ein Schicksal, das dieses Mal endgültig sein wird, wenn sie nicht zusammenarbeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Nicht einmal der Tod kann sie voneinander trennen
Die Medizinstudentin Aiko führt alles andere als ein normales Leben – denn es ist nicht ihr erstes. Aiko ist die Reinkarnation der Fuchsgöttin Inari. Als solche wird ihre Seele so lange wiedergeboren, wie sie einen Naturgeist, einen Kodama, an ihrer Seite hat. Als Aikos Naturgeist getötet wird, muss sie in den Wäldern einen neuen Begleiter suchen. Dabei begegnet sie Chiaki, ihrem Rivalen aus der Universität. Auch dieser hütet ein Geheimnis: Er ist die Reinkarnation des Mondgottes Tsukuyomi und verlor ebenfalls seinen Kodama. Sein und Aikos Schicksal sind unweigerlich miteinander verbunden, denn jedes von Aikos vergangenen Leben endete durch Tsukuyomis Hand. Ein Schicksal, das dieses Mal endgültig sein wird, wenn sie nicht zusammenarbeiten.
Kapitel 1
Eigentlich studierte ich Medizin, um Leben zu retten. Aber in letzter Zeit wurde ich immer öfter eine Zeugin des Todes.
So wie heute.
Wenn ein Kodama, ein Baumgeist des Waldes, starb, schien die Natur um ihn zu weinen. Der Himmel, der sich über seinem Zuhause erstreckte, verwandelte sich mit den letzten mühsamen Atemzügen des Geistes in das hoffnungsloseste, dunkelste Grau. Und die Scheinzypressen um ihn herum stimmten mit dem Rascheln ihrer immergrünen Blätter Klagelieder an.
Wortlos lauschte ich dem Geräusch, während meine Hände auf dem schneeweißen, etwa fußballgroßen und schwach leuchtenden Körper des reglosen Baumgeistes verharrten, vor dem ich kniete. Auch Geisterwesen verfügten über einen Herzschlag, ein sanftes Pulsieren unter ihrer leuchtenden Haut. Aber bei diesem Kodama war der Herzschlag beinahe vollkommen verstummt. Und egal, was ich versuchte, ich konnte ihn nicht retten. Diese Erkenntnis schnitt sich wie eine scharfkantige Scherbe in mein Herz, hinterließ dort eine blutige Wunde, die hässlich verheilen würde.
Zitternd holte ich Luft, dann zog ich die Hände fort und verneigte mich vor dem im Sterben liegenden Naturgeist.
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Yuki zu dem Kodama strich. Meine Katze stupste erst ihr schwarzes Köpfchen und dann eine ihrer weißen Pfoten gegen seinen Körper. Als sich der Baumgeist nicht rührte und sein Leuchten mit jeder Sekunde schwächer wurde, stieß Yuki ein klägliches Miauen aus.
Wieder einmal fragte ich mich, ob der Tod eines Geistes für Tiere noch schmerzhafter war als für mich.
Als der abendliche Wind auffrischte und mir mein langes schwarzes Haar ins Gesicht blies, sah ich auf. Mein Blick glitt den mächtigen Ahornbaum hinauf, unter den ich den sterbenden Kodama gebettet hatte. Mehrere Tage hatte es gedauert, bis ich im bergigen Wald um das Dörfchen Hinohara jenen Baum gefunden hatte, in dem der Geist einst geboren worden war. Und der mit seinem baldigen Tod nun ebenfalls im Sterben lag. Er würde niemals wieder feuerrote Blätter tragen.
»Du hast alles getan, was du tun konntest«, flüsterte jemand mit heller, klarer Stimme hinter mir. »Jetzt lass ihn gehen, Aiko.«
Ich starrte den sterbenden Baumgeist noch einen Augenblick lang an, dann wandte ich mich um.
Vor mir kniete Adachi, den ich jedoch seit jeher nur Ojīchan nannte, obwohl er nicht wirklich mein Großvater war. Aber manchmal wünschte ich, er wäre es. Das traurige Lächeln, das auf den schmalen Lippen des alten Mannes lag, war mir leider viel zu vertraut. Sein langer, gepflegter Bart reichte beinahe bis auf die Erde, die noch hart vom Winterfrost war, und zahllose Falten erzählten von einem langen Leben. Der Großteil seines grauen Haares lag unter dem traditionellen schwarzen Eboshi-Hut verborgen, der ihn als Kannushi, einen Priester eines Shintō-Schreins, markierte. Wie gewohnt trug er eine weiße Robe, deren lange Ärmel seine Hände fast vollständig bedeckten, und eine ebenfalls helle weite Hakama-Hose.
Zögerlich erwiderte ich Ojīchans Lächeln, auch wenn mir nicht danach zumute war. Der menschliche Körper war für mich anfangs ein Fremder gewesen, aber im Laufe meines fast beendeten Studiums war er zu einem Vertrauten geworden, zu einem Freund, den ich in- und auswendig kannte. Doch Kodama waren alles andere als menschlich. Ich wurde aus ihren Verletzungen nicht schlau. Oder besser gesagt, ich fand keine Verletzungen. Wenn ich sie berührte, spürte ich nur, wie sie schwächer wurden, wie ihre Lebenskraft aus unerfindlichen Gründen immer weiter schwand. Bis irgendwann auch ihr Licht erlosch. Und egal, was ich versuchte, ich konnte sie nicht retten. Das hinderte mich jedoch nicht daran, mir die Schuld zu geben und ein schlechtes Gewissen zu haben.
»Kodama sollten nicht sterben«, sagte ich leise. Sie existierten seit Anbeginn der Zeit. Natürlich waren sie durch das Vordringen der Menschen in die Natur insgesamt schwächer geworden, doch eigentlich sollten sie niemals so schwach werden wie in den letzten Wochen. Eigentlich sollten sie für alle Zeit fortbestehen.
Eigentlich sollten sie unsterblich sein.
»Sollten sie nicht«, stimmte mir der Priester zu. »Aber du kannst ihr Schicksal nicht ändern. Niemand kann das.«
Ehe ich etwas erwidern konnte, schwebten auf einmal zahllose Kodama zwischen den Bäumen hindurch und umringten den Ahornbaum, unter dem Ojīchan und ich knieten. Tränen brannten in meinen Augenwinkeln, als ich die Baumgeister dabei beobachtete, wie sie Abschied von ihrem Bruder nahmen.
Dann erlosch das Licht des sterbenden Kodamas vollends.
Ojīchan und ich verharrten einige Minuten vor dem toten Baumgeist, unsere Köpfe respektvoll gesenkt. Schließlich erhoben wir uns und gingen gemeinsam zwischen den Bäumen hindurch in Richtung des Schreins der Kodama, während die Abenddämmerung immer weiter voranschritt. Seit Jahren begleitete ich Ojīchan stets zurück zum Schrein, bevor ich wieder nach Hinohara aufbrach, um von dort den Bus nach Tōkyō zu nehmen. Es war eine Tradition, die ich mir bewahrt hatte.
Ähnlich verhielt es sich mit dem einzigen Kodama, der dicht neben mir durch die Luft schwebte und mich auf dem Rückweg begleitete.
»Hey, Keiko«, flüsterte ich meinem Baumgeist zu. Ich schenkte ihr ein schwaches Lächeln und berührte sanft ihre leuchtende Haut, die bei weiblichen Kodama leicht grünlich war. Obwohl Keiko nicht hier im Wald lebte, sondern bei mir in der winzigen Wohnung im Herzen Tōkyōs, war auch ihr anzumerken, dass sie mit dem Verlust ihres Bruders zu kämpfen hatte. Wenn Kodama traurig waren, war ihr Leuchten nicht so intensiv wie sonst. Es versetzte mir einen Stich, sie so sehen zu müssen. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, um ihr ihre Schmerzen zu nehmen, aber das stand nicht in meiner Macht.
»Ah, du hast eine neue Freundin?«, fragte Ojīchan plötzlich. Er deutete auf meine Katze, die uns durch das Dickicht folgte.
Ich nickte, während ich mit der lilafarbenen Strähne spielte, die aus meinem schwarzen Haar hervorstach. Mühevoll zwang ich mich, die Kodama aus meinen Gedanken zu verbannen. Wenigstens für einen kurzen Moment.
»Ihr Name ist Yuki. Wir waren bei meiner Tierärztin und … Nicht, Ojīchan. Sie wird zickig, wenn man sie hochheben will.« Aber es war bereits zu spät. Der Priester war stehen geblieben, hatte Yuki gepackt und an seine Brust gedrückt. Die Begeisterung meiner Katze hielt sich verständlicherweise in Grenzen. Sie fauchte sichtlich empört, wurde aber mit einem Mal ruhiger, als Ojīchan sie zwischen den Ohren kraulte. So schnell hätte sie mir garantiert nicht verziehen, wenn ich sie mir derart grob geschnappt hätte.
Der Priester lächelte Yuki an. »Wie alt bist du denn?«
»Meine Tierärztin schätzt sie auf drei oder vier Monate«, antwortete ich. »Ich habe sie vor ein paar Wochen am Bahnhof in Shibuya gefunden. Sie hat im Müll herumgewühlt und jämmerlich geschrien. Ihr Zustand war miserabel.« Ich hob die rechte Hand und zeigte ihm die Kratzspuren, die meinen Handrücken zierten. »Sie ist eine kleine Kämpferin, meine Yuki.«
»Anscheinend kommt sie ganz nach ihrer Besitzerin«, bemerkte Ojīchan.
Diesmal konnte ich mir ein kurzes Lachen nicht verkneifen. »Ich würde mich nicht als Kämpferin bezeichnen.«
Er kraulte Yuki unterm Kinn, was sie mit einem extrem lauten Schnurren quittierte. Mich hatte sie noch nie angeschnurrt. »Aber das bist du, Aiko. Du kämpfst seit Tausenden von Jahren den immer gleichen Kampf. Die meisten anderen würden daran zerbrechen.«
Seine Worte ließen mich innehalten. Er hatte recht mit dem immer gleichen Kampf. Doch bei einer Sache irrte er sich.
Ich warf einen letzten Blick über die Schulter, dorthin, wo nun der tote Kodama ruhte und bald von der nächtlichen Finsternis verschluckt werden würde.
Die meisten anderen würden daran zerbrechen.
Ojīchan konnte nicht ahnen, dass ich schon vor vielen Leben zerbrochen war.
Kapitel 2
»Was sagst du, Yuki?«, fragte Ojīchan, als wir uns dem Schreingelände näherten. Meine Katze war mittlerweile auf seine Schulter geklettert und rieb unentwegt ihr Köpfchen an seiner Wange.
Auch das hatte sie bei mir noch nie gemacht.
Verräterin.
»Ah, du möchtest wissen, worum es sich bei diesen leuchtenden Kugeln handelt, die auf dem Boden herumtollen und in der Luft schweben? Eine sehr gute Frage.« Ojīchan wandte sich an mich. »Ich habe immer gewusst, dass Katzen Kodama sehen können«, fügte er flüsternd hinzu. »Vielleicht können sie sogar die Geisterwelt betreten und Seelen hinübergeleiten. Yuki-chan, warst du schon einmal in der Geisterwelt? Nein? Aber du würdest gerne hin, oder?«
Ich stieß ein ungläubiges Lachen aus. »Es wäre mir neu, dass du mit Katzen reden kannst, Großväterchen.«
Ojīchan sah mich sichtlich empört an. »Natürlich kann ich mit ihnen reden. Ich verstehe alle Tiere.« Als hätte ich ihn zutiefst beleidigt, fokussierte er seine Aufmerksamkeit wieder auf meine Katze.
»Was? Nein, du kannst die leuchtenden Kugeln nicht fressen. Glaub mir, sie würden dir garantiert nicht schmecken. Probier lieber Sake. Sake schmeckt so viel besser.«
Ich hob beide Brauen. »Sie hat nicht mal miaut. Und untersteh dich, meiner Katze deinen ekligen Reiswein anzudrehen.«
»Wir kommunizieren in Gedanken«, erklärte er, ein stolzes Lächeln auf den Lippen. »So wie du und Keiko. Und mein Sake ist nicht eklig.«
»Aha.« Mental machte ich mir eine Notiz, dass ich Yuki das nächste Mal nicht mit zum Schrein bringen würde. In den letzten Wochen hatte ich aufgrund ihrer Reaktionen Keiko gegenüber bereits bemerkt, dass Yuki Kodama sehen konnte. Ojīchan hingegen konnte keine Geisterwesen sehen, denn für gewöhnliche Menschen waren sie unsichtbar. Zumindest konnte er die Anwesenheit von Naturgeistern spüren. Dank der Jahrzehnte, die er schon im Shintō-Schrein inmitten der Wälder Hinoharas lebte, hatte er eine tiefgehende Verbindung zu allem Übernatürlichen entwickelt.
»Die leuchtenden Kugeln sind Kodama«, erklärte Ojīchan meiner Katze nun. »Das sind Baumgeister, die seit Anbeginn der Zeit existieren. Seit die Natur atmet, gibt es auch Geister. Aber du musst wissen, dass die Welt früher eine andere war, kleine Yuki. Eine bessere. Einst gab es viel mehr Kodama als heute. Damals sind sie nicht gestorben, heute tun sie es viel zu oft.« Ojīchan deutete auf einen verkümmerten, abgestorbenen Ahornbaum. »Denn sie sind immer ein Spiegel der Natur. Und leider geht es dieser seit Langem nicht mehr so gut wie damals.« Im Vorbeigehen berührte er die Stämme der Ahornbäume und Scheinzypressen, die den Großteil des Waldes ausmachten.
Ich tat es ihm gleich, während mir jeder tote Baum einen schmerzhaften Stich versetzte. Denn sie waren eine Erinnerung an all die Baumgeister, die bereits den Tod gefunden hatten.
»Kodama sind die Beschützer der Wälder«, fügte Ojīchan nach einer Weile hinzu, in der wir schweigend weitergegangen waren. »Und sie sorgen dafür, dass deine Aiko so ist, wie sie ist. Baumgeister sind nämlich auch Wächter von Seelen. Von göttlichen See–«
»Okay, das reicht, Großväterchen.« Ich blieb abrupt stehen und wollte Yuki von seiner Schulter nehmen, aber sie fauchte mich an. »Du musst meiner Katze nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen.«
Ojīchan hielt ebenfalls inne. Er drehte den Kopf zur Seite und musterte Yuki mit hochgezogenen Brauen. Als er mich schließlich wieder ansah, war sein Blick ungewöhnlich ernst. »Yuki-chan spürt, dass du eine alte Seele besitzt«, murmelte er.
Verwirrt starrte ich meine Katze an. Ihre wachsamen grünen Augen waren auf mich gerichtet, ihr Köpfchen leicht schief gelegt. »Tut sie das?«
Ojīchan schenkte mir ein Lächeln. »Das spürt jeder, der dir in die Augen sieht, Aiko.« Damit setzte er seinen Weg fort, während das letzte Sonnenlicht durch die Baumkronen drang und Lichtflecke auf die Erde malte, die allmählich aus dem Winterschlaf erwachte.
Hastig folgte ich dem Priester, bis der Wald lichter wurde und zwischen den Bäumen ein hölzerner orangefarbener Torbogen mit zwei Querbalken auftauchte, der etwa doppelt so hoch war wie ich.
»Das hier ist ein Torii«, erklärte Ojīchan meiner Katze und deutete auf den Torbogen. »Er markiert den Übergang vom Alltäglichen zum Heiligen, zum Zuhause der Kodama. Du und ich dürfen das Torii nicht mittig durchschreiten, sondern müssen uns entweder etwas rechts oder links halten. Der mittlere Weg ist den Kodama und Göttern vorbehalten. Und siehst du die Treppe, die hinter dem Torii beginnt? Keine Sorge, du musst sie nicht selbst hochlaufen, das werde ich für dich übernehmen.«
Ojīchan und ich stiegen die Stufen hinauf und betraten anschließend den breiten, steinernen Weg, der zum Hauptheiligtum führte. Das Schreingelände, das etwa so groß war wie ein halbes Fußballfeld, wurde von einem hohen, ebenfalls hölzernen Zaun umschlossen, an den sich kahle Ahornbäume schmiegten. Kodama schwebten über den Weg und tummelten sich in der Luft.
Augenblicklich ergriff eine tiefe Ruhe von mir Besitz. Das tat sie immer, wenn ich hier war. Ich mochte in Tōkyō leben, aber dieser Schrein war der Ort, an dem ich mich wirklich lebendig fühlte. An dem ich sein durfte, wer ich war. Selbst wenn ich mich nicht um die Kodama kümmern würde, würde ich jeden Tag nach Hinohara kommen, um diese Stille zu genießen.
Ich räusperte mich geräuschvoll, als Ojīchan Anstalten machte, an dem Brunnen, der zu unserer Linken neben dem Weg stand, vorbeizugehen.
»Oh, fast vergessen. Danke, Aiko.«
Ich hatte in diesem Leben zwar noch nicht viele Priester getroffen, aber ich war mir ziemlich sicher, dass Ojīchan der Einzige war, der regelmäßig vergaß, Hände und Mund am traditionellen steinernen Brunnen, dem Chōzuya, zu reinigen, wie es die Regeln aller Schreine vorschrieben.
Mit einer bereitliegenden Bambuskelle schöpfte ich Wasser aus dem Brunnen, trat einen Schritt zurück und übergoss meine linke Hand damit, dann meine rechte, und schließlich goss ich noch einmal etwas Wasser in meine linke Hand. Dieses führte ich vorsichtig an meine Lippen und wusch mir damit den Mund aus. Danach reinigte ich mir ein letztes Mal die linke Hand, ehe ich mich wieder dem Hauptweg zuwandte.
»Ganz wichtig, Yuki-chan, du darfst das Wasser nicht schlucken, du musst es ausspucken. Und nicht in den Brunnen, damit verunreinigst du ihn. Du – Yuki-chan, nein!«
Als ich mich umdrehte und eine wild strampelnde Katze im Brunnen entdeckte, verschluckte ich mich an meinem eigenen Wasser.
Ojīchan sah mich so anklagend an, als wäre das meine Schuld. »Aiko, deine Katze hat unser heiliges Brunnenwasser verseucht.«
»Auf einmal ist sie wieder meine Katze?« Hastig fischte ich eine fauchende Yuki aus dem Becken.
Zum Dank zerkratzte sie mir meine Hände.
»Du hasst mich, schon verstanden. Das musst du mir nicht immer wieder von Neuem zeigen«, brummte ich, während ich meinen weißen Schal abnahm und Yuki unter Protest damit trocken rieb. Als ich fertig war, schüttelte sie sich, warf mir einen verächtlichen Blick zu und stolzierte zurück zu Ojīchan, der sie erneut auf seine Schulter setzte. Ich würde dieses Tier wohl nie verstehen.
Trotz der Katzenhaare, die nun an meinem Schal hafteten, wickelte ich ihn wieder um meinen Hals, dann folgte ich den beiden den Hauptweg entlang.
»Siehst du die Laternen, Yuki-chan?« Ojīchan deutete auf die etwa kniehohen steinernen Laternen, die den Weg auf beiden Seiten säumten. »Das sind Tōrō. Wenn es dunkel wird, entzünde ich sie. Kodama lieben diese Laternen. Und das hier«, der Priester nickte zu einer kleinen hölzernen Bühne, die zu unserer Linken neben dem Weg stand, »ist eine Kagura-Bühne. Normalerweise finden auf solchen Bühnen die traditionellen Kagura-Tänze statt. Sie … was soll das heißen, du weißt nicht, was ein Kagura-Tanz ist?«
Ojīchan warf mir schon wieder einen empörten Blick zu. »Langsam bekomme ich das Gefühl, dass du Yuki überhaupt nichts von unserem Schrein erzählt hast, Aiko.«
Ehe ich auch nur die Möglichkeit hatte, etwas zu entgegnen, fuhr der Priester fort: »Angeblich wurde die Sonnengöttin Amaterasu einst mit einem Kagura-Tanz aus einer Höhle herausgelockt, in der sie sich vor den Menschen versteckt hielt. Als sie schließlich herauskam, wurde den Menschen das Tageslicht geschenkt.«
Ich hatte so einen Tanz einmal in einem Schrein in Kyōto erlebt. Und sosehr ich wünschte, diese Bühne würde auch hier benutzt werden, wusste ich, dass das nicht möglich war. Denn dieser Ort war alles, nur kein gewöhnliches Heiligtum. Es war das Zuhause der Kodama, und zu ihrem Schutz war der Schrein so tief im Wald versteckt, dass sich kaum Besucher hierherverirrten.
Ich schüttelte die Gedanken ab und beobachtete, wie Ojīchan mitsamt Yuki erneut vom Hauptweg abdriftete und mit ihr zu einem hölzernen, etwa einen Meter langen und einen Meter breiten Gitter trat. Dieses befand sich direkt neben der Kagura-Bühne und war in die Erde gerammt.
Ojīchan schien meiner Katze wirklich jede Einzelheit eines Shintō-Schreins genaustens erklären zu wollen.
Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, während ich die beiden beobachtete, meine Hände in den Taschen meines gelben Parkas vergraben. Keiko schwebte rechts von mir, direkt neben meinem Ohr. Auf meiner verletzlichen Seite. Ihre Nähe wärmte meine Wange und ließ mich ruhiger atmen.
»Siehst du, Yuki-chan? Das hier sind sogenannte Ema.« Ojīchan deutete auf die kleinen Holztäfelchen, die mit einfachen roten Schnüren an dem Gitter befestigt waren. »Auf ihnen kannst du Wünsche an das Schicksal schreiben und es bitten, diese zu erfüllen.«
Yuki schlug mit einer Pfote nach einer Holztafel.
»Vorsicht. Du kannst mir deinen Wunsch verraten, und ich schreibe ihn später für dich auf, in Ordnung?« Ojīchan streckte Yuki sein Ohr entgegen und tat so, als würde er ihrem Schnurren angestrengt lauschen. »Du willst tonnenweise Sushi? Da können die Ema bestimmt etwas machen, keine Sorge.«
Obwohl mir die beiden erneut ein Lächeln entlockten, verursachte die Nähe der Ema ein mulmiges Gefühl in meiner Magengegend. Heutzutage erfüllten diese schlichten Holztäfelchen keine Wünsche mehr. Früher hatten sie das jedoch getan. Und sie waren für den verhängnisvollsten Wunsch verantwortlich, der je gesprochen worden war. Vor Tausenden von Jahren, von den Göttern selbst. Seitdem war das laut Ojīchan nie wieder geschehen.
Trotzdem hatte auch ich einst einen Wunsch auf ein Holztäfelchen geschrieben und an diesem Gitter aufgehängt. Damals, als ich noch an die Macht der Ema geglaubt hatte. Natürlich hatte sich mein Wunsch nie erfüllt.
Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf Ojīchan, der endlich mit seinen Erklärungen fertig war. Innerlich atmete ich auf, ehe wir weitergingen.
Am Ende des Hauptweges führte eine schmale Brücke über einen Bach, der die aus Holz erbaute Gebetshalle umschloss. Mit ihrem zinnoberroten, geschwungenen Dach glich sie dem Hauptheiligtum, das sich hinter dieser Halle befand und über eine weitere Brücke erreicht werden konnte. Doch die Gebetshalle war um einiges kleiner als das Heiligtum hinter ihr. Vor ihrem Eingang hing eine bronzefarbene, etwa kopfgroße Glocke.
»Siehst du die Glocke?«, fragte Ojīchan meine Katze. »Wenn du zu einer Gottheit beten möchtest, musst du erst ein paar Yen in die Holzkiste neben dem Eingang werfen und die Glocke läuten. Danach verneigst du dich zweimal und klatschst zweimal in die Pfötchen, dann darfst du zu den Göttern beten und dich ein letztes Mal verneigen.« Der Priester nahm Yukis Vorderpfoten von seiner Schulter und klatschte mit ihnen. »Genau so. Sehr gut!« Er tätschelte ihren Kopf. »Ich sehe schon, kleine Yuki, du wirst sehr bald zum Shintoismus konvertieren.«
Ich trat zu den beiden und beugte mich zu Ojīchan hinunter, der etwa einen halben Kopf kleiner war als ich. »Mal ganz unter uns«, raunte ich ihm zu. »Wie viel Sake hattest du heute schon?«
Empört sah er mich an. »Ich bin nicht betrunken!«
»Wenn du das sagst.« Ich wollte ihm Yuki von der Schulter nehmen, aber sie schien ihren neuen Lieblingsmenschen gefunden zu haben und fauchte mich an.
»Es wird schon dunkel«, sagte ich. »Yuki und ich sollten uns langsam auf den Heimweg machen.«
»Aber ich habe ihr das Wichtigste noch gar nicht gezeigt«, widersprach Ojīchan.
Gespielt frustriert warf ich beide Hände in die Luft. »Du wirst für meine ersten grauen Haare verantwortlich sein, Großväterchen.«
Ich wusste nicht, ob er mich überhaupt gehört hatte, denn schon verließ er mit Yuki erneut den Hauptweg und ging zu den kniehohen, aus Stein gehauenen Schreinen, die sich vor der Brücke links und rechts des Weges tummelten. Vor jedem dieser Schreine befand sich ein kleines orangefarbenes Torii. Weiße Schalen standen bereit, um den Gottheiten Opfergaben darzubringen. Und an den geschwungenen Dächern der Schreine war jeweils eine winzige Glocke angebracht, die man läuten konnte.
»Das sind Hokora«, erläuterte Ojīchan. »Warst du schon einmal auf einer Landstraße, Yuki-chan? Oder auf einem Feldweg? Vielleicht hast du dort dann auch solche Hokora gesehen.«
Vor jedem kleinen Schrein blieb der Priester stehen, um Yuki viel zu ausschweifend zu erklären, für welche Gottheit er einst errichtet worden war.
»Diese beiden hier«, er deutete auf zwei Schreine, die besonders eng beieinanderstanden, »sind die Schreine der Urgottheiten, Izanagi und Izanami. Einst wollte Izanagi seine Geliebte Izanami nach ihrem Tod aus Yomi, dem Land der ewigen Dunkelheit, zurückholen, aber er scheiterte.« Auf einmal war da eine Schwere in Ojīchans Blick, die mir fremd war. »Aus den Tränen, die Izanagi um seine Geliebte vergoss, wurden viele andere Gottheiten geboren.« Er trat zu den nächsten Schreinen, und Yuki bekam weitere göttliche Legenden zu hören. Mittlerweile war ich nur noch mit halbem Ohr bei der Sache. Ich kannte diese ganzen Geschichten zur Genüge. Mehr als mir lieb war.
»Und das hier ist der Schrein deiner Besitzerin«, vertraute Ojīchan Yuki an, als er am letzten Hokora angelangt war. »Du musst nämlich wissen, dass sie noch einen anderen Namen besitzt. Einen Namen, der älter ist als dieser Wald. Suzuki Aiko ist der Name ihres momentanen menschlichen Körpers. Aber ihre göttliche Seele trägt einen anderen Na–«
»Okay, das reicht«, unterbrach ich ihn hastig. Ich versuchte, mich zwischen ihn und den Schrein zu drängen, doch er schob mich mühelos beiseite. Trotz seines gebrechlichen Aussehens war er überraschend stark.
Ojīchan bedachte mich mit einem schiefen Lächeln. »Schämst du dich für das hier?«, fragte er mich, dann ging er in die Knie und setzte sich vor den Schrein, der der Fuchs- und Fruchtbarkeitsgöttin Inari gewidmet war.
Er war nichts im Vergleich zu dem berühmten, auf einem Hügel in Kyōto errichteten Schrein zu Ehren Inaris mit seinen Alleen aus Tausenden von roten Toriis. Aber er war trotzdem wunderschön, insbesondere dank der winzigen schneeweißen Fuchsstatuen mit den typischen roten Lätzchen, die links und rechts des Schreins aufgebaut waren und ihn bewachten.
»Inari«, flüsterte Ojīchan auf einmal.
Es dauerte einen Moment, bis ich realisierte, dass er mit mir gesprochen hatte. Ich sah ihn an. »Du sollst mich doch nicht so nennen.«
Der Priester lächelte. »Ich muss dich so nennen. Ich muss derjenige sein, der dich daran hindert, deinen wahren Namen zu vergessen. Außer mir tut es sonst niemand. Am wenigsten du selbst.«
Halt suchend schmiegte ich meine Wange an Keiko. Wenn ich ehrlich war, kam mir der Name Inari fremd vor. Ich besaß schon lange keine besondere Verbindung mehr zu Füchsen, zu Fruchtbarkeit. Ich war nicht mehr die Inari von einst, sondern nur ihre tausendste Reinkarnation.
»Yuki ist verwirrt«, verkündete Ojīchan. »Sie sagt, dass sie nicht wusste, dass Gottheiten so übel riechen wie du.« Ehe ich etwas erwidern konnte, wandte er sich erneut an meine Katze. »Früher hatte Inari eine andere Gestalt. Eine göttliche Gestalt, die bestimmt besser gerochen hat. Aber weißt du, Yuki-chan, Götter sind eigenartige Wesen. Menschen halten sie für etwas Übernatürliches, das frei von menschlichen Sorgen, Ängsten und Lasten ist. Doch die Götter hatten schon immer eine große Angst. Welche Angst ist das, Inari?«
Für einen kurzen Moment schloss ich die Augen. »Angst, vergessen zu werden«, antwortete ich schließlich. »Angst, nicht ewig zu bestehen.«
»So ist es. Und nichts kann für immer bestehen, wenn es nicht aufgeschrieben und durch Worte verewigt wird.« Ojīchan berührte die Glocke, die vor meinem Schrein hing. »Viele glauben, dass alle Götter unsterblich sind, aber das waren sie nie. Genauso wenig wie Naturgeister. Die meisten Gottheiten sind mit einem überaus langen Leben gesegnet, doch nicht mit Unsterblichkeit. Und die Götter wollten das ändern. Gemeinsam überlisteten sie den mächtigsten und einzigen unsterblichen Gott, den Chaosgott, und stahlen sein Blut, um ebenfalls unsterblich zu werden. Mit diesem schrieben sie ihre Geschichten auf Holztäfelchen, denn durch die Magie des Blutes wurden ihre Geschichten ewig und sie somit unsterblich.« Ojīchan räusperte sich, ehe er fortfuhr.
»Aber der Chaosgott erfuhr von dem Plan der anderen Götter. Und er schwor sich, Rache zu nehmen. Da er nicht nur Gedanken lesen und manipulieren, sondern auch in die Zukunft sehen konnte, wusste er vor allen Göttern, wie diese eines Tages zugrunde gehen würden, woran sie zerbrechen würden. Deshalb zerstörte er die Holztafeln der Gottheiten und beschriftete mit seinem Blut neue Ema-Tafeln. Auf diesen nannte er jedoch nur die Art und Weise, wie die Gottheiten, die ihn hintergangen hatten, ihr Ende finden würden. Seither sind ihre Seelen zwar unsterblich wie die des Chaosgottes und werden immer wieder in menschlichen Wirtinnen und Wirten wiedergeboren, aber die göttlichen Seelen sind fortan dazu verdammt, ihren Tod unendlich oft zu durchleben. Denn jeder Reinkarnationszyklus endet mit dem in göttlichem Blut geschriebenen Tod. Kannst du mir noch folgen, Yuki-chan?« Ojīchan kraulte meine Katze hinter den Ohren, während der abendliche Wind auffrischte.
Fröstelnd schlang ich die Arme um mich. Die Worte des Priesters gruben Erinnerungen aus, die sich wie scharfe Klingen in meine Brust bohrten. Am liebsten würde ich ihn bitten, aufzuhören, aber ich tat es nicht. Er würde ohnehin nicht aufgeben. Stattdessen ließ ich meine Hände sinken und zupfte nun an einem der Perlenarmbänder herum, die ich am linken Handgelenk trug.
»Im Moment ihres Todes benötigt eine göttliche Reinkarnation einen Kodama an ihrer Seite, der ihre Seele einfängt und in die Geisterwelt geleitet, sonst endet der Reinkarnationszyklus der Gottheit, und die Seele verrottet in Yomi«, fuhr Ojīchan fort. »Von dort aus kann die göttliche Seele erneut in einem menschlichen Neugeborenen wiedergeboren werden. Doch mit jeder Reinkarnation verlieren die Seelen etwas von ihrer Göttlichkeit, ihrem ursprünglichen Selbst.« Er nickte zu mir. »Inari konnte sich einst in einen Fuchs verwandeln. Mittlerweile kann sie nicht einmal mehr mit Füchsen sprechen.«
Nun wollte ich doch einschreiten, aber der Priester hob eine Hand. »Ich bin gleich fertig. Also, wo waren wir? Ach ja. Der Chaosgott, der übrigens als einziger Gott keinen Namen besaß, versteckte die Holztafeln, sodass die anderen Götter den Schicksalsfluch nicht brechen konnten.« Er machte eine bedeutungsschwere Pause. »Die Götter wollten auf ewig leben. Nun müssen sie aufgrund ihres Verrats am Chaosgott und ihrer Gier nach Unsterblichkeit auf ewig leiden.«
Meine Katze stieß ein Miauen aus.
»Es ist in der Tat grausam«, sagte Ojīchan, seine Stimme leiser als zuvor. Er stupste einen Finger gegen Yukis Näschen. »Aber das Schicksal hat nie behauptet, etwas anderes zu sein, kleine Yuki.«
Ich zupfte so heftig an meinem Armband, dass es riss. Die türkisfarbenen Perlen ergossen sich über die Erde, und ein paar landeten in der Opferschale eines nahen Schreins. Hastig wollte ich die Perlen aus dem Gefäß herausfischen, aber als ich mich vor den Schrein kniete, hielt ich verblüfft inne. Normalerweise waren die Opferschalen immer leer, weil es keine Besucher gab, die zu den Göttern beten könnten. Doch diese Schale war nicht leer. Jemand hatte dort eine Handvoll zartgrüner Mochi hineingelegt.
Jemand hatte dem Mondgott Tsukuyomi ein Opfer dargebracht.
»Er war hier«, sagte Ojīchan plötzlich. Als ich einen Blick über die Schulter warf, sah ich, dass seine Aufmerksamkeit ebenfalls auf den Schrein des Mondgottes gerichtet war.
»Wer?«, fragte ich verwirrt. Aber insgeheim hatte ich eine Vermutung. Eine Vermutung, von der ich inständig hoffte, dass sie sich als falsch herausstellen würde.
»Du weißt genau, wen ich meine, Inari.«
Er war hier.
Diese drei kleinen Worte hallten in meinen Gedanken wider, gruben sich in meinen Verstand. Für einen kurzen Moment schloss ich die Augen. Mein Atem beschleunigte sich, und mein Herz pochte schmerzhaft fordernd gegen meinen Brustkorb. Natürlich wusste ich, wen Ojīchan meinte. Es war vielmehr so, dass ich es nicht wahrhaben wollte. Dass ich wünschte, ich hätte mich verhört. »Der Mondgott?«, fragte ich schließlich. »Tsukuyomis Reinkarnation war hier? Und hat sich selbst eine Opfergabe dargebracht?«
»So ist es. Siehst du, Yuki? Ich habe dir doch gerade gesagt, dass Inari alles andere als – autsch.«
Diesmal überprüfte ich nicht, was Yuki angestellt hatte. Meine gesamte Aufmerksamkeit galt dem Schrein jenes Gottes, den ich mehr als alles andere hasste. Den ich in jedem meiner Leben gehasst hatte.
Als ich spürte, wie etwas an meinen Beinen vorbeistrich, entdeckte ich Yuki, die anscheinend genug von Ojīchans Schulter hatte. Ich hob sie hoch, stand auf und presste sie an meine Brust. Das Risiko, gekratzt zu werden, ging ich im Moment nur zu gerne ein. Das würde mich wenigstens ein wenig ablenken.
»Wer ist es?«, fragte ich. Meine Stimme war erstaunlich fest und ruhig. In keinerlei Weise spiegelte sie den Aufruhr in meinem Inneren wider. In keinerlei Weise offenbarte sie, wie viel Angst ich gerade hatte.
Als Yuki empört miaute, bemerkte ich, dass ich mich zu fest in ihr schwarzes Fell krallte. Hastig ließ ich sie los und setzte sie zu meinen Füßen ab. Ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen, stolzierte sie zwischen den Schreinen davon. Mein Kodama folgte ihr. Wenn es um meine Katze ging, hatte Keiko einen Beschützerinstinkt entwickelt.
»Wer ist Tsukuyomis Reinkarnation?«, hakte ich nach, als Ojīchan noch immer schwieg. »Wie heißt er? Wie alt ist er? Bin ich ihm schon einmal begegnet?«
Anstatt mir eine Antwort zu geben, trat der Priester zum Schrein des Mondgottes, bückte sich und griff nach einem Mochi. Er biss hinein und kaute genüsslich auf dem klebrigen Reiskuchen herum. »Hm.« Er leckte sich die Lippen. »Köstlich.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich weiß ganz genau, dass du meine Frage gehört hast, Großväterchen. Wer ist seine Reinkarnation?«
»Das wirst du selbst herausfinden, wenn die Zeit reif ist, Inari«, entgegnete er mir mit vollem Mund. »In der Zwischenzeit solltest du eines von diesen Mochi probieren. Sie sind wirklich vorzüglich. Ein Schluck Sake dazu, und du vergisst all deine Sorgen.«
»Du weißt, wie unheimlich wichtig es für mich ist, Tsukuyomis Reinkarnation zu kennen.«
»Mhm«, erwiderte er nur.
Ich wartete darauf, dass er fortfuhr, doch er kaute einfach seelenruhig weiter, ohne ein Wort von sich zu geben.
»Du verrätst es mir trotzdem nicht, oder?« Ich seufzte und fürchtete für einen kurzen Moment, dass es jemand sein könnte, der mir nahestand. Aber diese Sorge verwarf ich gleich wieder. Wenn sich Reinkarnationen berührten, erkannten sie die Seele des jeweils anderen, weil göttliche Seelen durch den Schicksalsfluch miteinander verbunden waren. Weil mir das bisher noch mit niemandem passiert war, hoffte ich, dass ich Tsukuyomis Reinkarnation nicht kannte.
Endlich löste Ojīchan seine Aufmerksamkeit von dem Reiskuchen.
»Inari.« In seinem langen Bart klebten hier und da Mochi-Reste. »Sieh mich an.«
»Ich sehe dich an.«
Er schüttelte den Kopf, sein gewohntes, leicht mystisches Lächeln auf den Lippen. »Sieh mich richtig an.« Sanft berührte er meine Stirn. Ich zuckte kurz zusammen, weil sein Finger ungewöhnlich kalt war. »Zeig mir, was gerade in dir vorgeht. Verschließ deine Gefühle nicht vor mir.«
Ich blinzelte. »Du sprichst in Rätseln, Großväterchen.«
»Da!« Ojīchan strahlte. »Verwirrung. Sehr gut. Was hast du noch?«
Mein Blick glitt zurück zu Tsukuyomis Schrein. Unzählige Male war ich schon an ihm vorbeigelaufen, hatte ihm keinerlei Beachtung geschenkt. Aber jetzt konnte ich meine Aufmerksamkeit nicht von ihm lösen.
»Angst«, gab ich schließlich zu. Und mit jeder Sekunde, die verstrich, verwurzelte sich diese Angst tiefer in meinem Herzen.
Eine Weile herrschte bedrückendes Schweigen zwischen uns, bis Ojīchan ein tiefes Seufzen ausstieß. Ich sah ihn wieder an. »Du weißt, dass ich dir diese Angst nicht nehmen kann, Inari.« Traurigkeit flocht sich in sein Lächeln, in seine klare Stimme. »Auch nicht durch einen Namen.«
»Ich weiß«, antwortete ich leise.
Der Priester musterte mich, seine Augen wachsamer denn je. Ich wusste nicht, wie er es schaffte, aber seine Präsenz hatte stets eine beruhigende Wirkung auf mich, ähnlich wie die der Kodama. Er konnte die Angst nicht zum Schweigen bringen, doch er hielt sie im Zaum. Das tat er, seitdem ich vor knapp fünfzehn Jahren zum ersten Mal vor dem Torii seines Schreins aufgetaucht war, mit unzähligen Fragen auf den Lippen.
»Das Schicksal ist der einzige Gegner, den man nicht besiegen kann«, sagte Ojīchan schließlich. »Wenn ich dir verraten würde, wer er ist, würde ich dir damit nur einen Grund mehr zur Sorge geben. Was geschehen muss, wird geschehen. Gräme dich nicht wegen Dingen, die du ohnehin nicht ändern kannst. Wegen des Endes einer Geschichte, das schon längst geschrieben wurde.«
Ich wünschte, es wäre so leicht. Wünschte, ich könnte mein Schicksal einfach verdrängen. Oder noch besser, vergessen.
Aber zu vergessen, war ein Privileg, das mir nicht zustand.
Ein letztes Mal streifte mein Blick den schlichten Schrein des Mondgottes.
Den Schrein meines einstigen und künftigen Mörders.
Kapitel 3
Ich wachte schweißgebadet auf, einen Schrei auf den Lippen.
Mein Herz schlug so heftig gegen meinen Brustkorb, dass es schmerzte, und ein unkontrolliertes Zittern hielt meinen Körper gefangen. Schwer atmend starrte ich an die Decke meines Zimmers, während die Bilder meines Albtraums noch immer klar und deutlich in meinem Kopf herumschwirrten. Ich presste die Augen zusammen, wollte, dass die schreiende, auf Knien flehende Frau aus meinen Gedanken verschwand. Aber sie tat es nicht.
Das tat sie nie.
Als Kind hatte ich geglaubt, dass es ganz gewöhnliche Albträume waren. Doch als sie nicht hatten enden wollen und ich in ihnen immer wieder den Schrein in Hinohara gesehen hatte, war ich eines Tages gemeinsam mit meiner Mutter dorthin gegangen und hatte Ojīchan angetroffen. Damals hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Kodama gesehen und Keiko kennengelernt.
Das war vor fünfzehn Jahren gewesen.
Seitdem wusste ich, was wirklich hinter meinen Träumen steckte. Es waren Erinnerungen von Inaris vorherigen Reinkarnationen. Ich konnte mich nicht bewusst an meine Leben vor diesem hier erinnern. Alles, was ich von ihnen wusste, waren die Bruchstücke, die mir meine Träume offenbarten. Und diese Bruchstücke hatten eines gemeinsam: Sie ließen mich die Todestage meiner früheren Leben noch einmal durchleiden, ließen mich ihre Todesangst erneut spüren. Eine Angst, die jedes Mal mit Erinnerungen an den Mondgott verknüpft war.
Ich zwang mich, gleichmäßig Luft zu holen, dann tastete ich nach Yuki. Als ich ihr warmes Fell nicht fand, öffnete ich die Augen und setzte mich auf. Im dämmrigen Licht, das durch den Türspalt fiel, suchte ich mein kleines, spärlich möbliertes Zimmer nach meiner Katze ab. Keiko schwebte über meinem schmalen Schreibtisch, auf dem sich Uni- und Romantasy-Bücher stapelten. Und dort entdeckte ich auch Yuki.
Schlafend. Auf Keikos Kopf.
Trotz allem stahl sich ein Lächeln auf meine Lippen. Keiko war wirklich vernarrt in Yuki. Anders konnte ich mir nicht erklären, warum der Kodama nie von der Seite meiner Katze wich. Und andersherum war es mittlerweile ähnlich. Zumindest versuchte Yuki nicht mehr, meinen Baumgeist zu fressen. Gleichzeitig sorgte Keikos Anblick dafür, dass ich an jenen Kodama erinnert wurde, der vor wenigen Tagen aus unerklärlichen Gründen gestorben war. Und an all das andere, was im Schrein geschehen war. All das, was ich entdeckt hatte. Ein kleiner Teil von mir wünschte, ich hätte nichts davon erfahren. Würde nicht wissen, dass sich Tsukuyomis Reinkarnation irgendwo in meiner Stadt herumtrieb.
Seufzend ließ ich mich zurück in meine Kissen fallen und versuchte, vor meinem morgigen Uni-Tag noch etwas Schlaf zu finden, aber ich scheiterte kläglich. Schließlich kroch ich aus dem Bett, tastete auf meinem Nachttisch nach meinem lilafarbenen Hörgerät und setzte es ein. Auch wenn ich nicht vorhatte, mit irgendjemandem zu reden, fühlte ich mich so sicherer, weniger verletzlich. Und verletzlich war das Letzte, was ich nach einem Albtraum wie diesem sein wollte.
So lautlos wie möglich schlich ich zu Keiko und Yuki hinüber und deckte die beiden mit meinem beigefarbenen Taylor-Swift-Cardigan zu. Zum Dank fuhr Yuki im Schlaf die Krallen aus und erwischte mich fast an der Hand.
»Hab dich auch lieb«, brummte ich und wandte mich ab.
Als ich am Fenster vorbeiging, blinkten mir die nächtlichen Lichter Tōkyōs entgegen. Es gab viele Dinge, die ich an meiner Stadt nicht mochte. Die Nächte waren jedoch keines davon. Für einen kurzen Moment verharrte ich vor der Scheibe und sah hinaus in die Dunkelheit. Die Wohnung, die ich mir mit meiner Tante und meinem Vater teilte, lag im vierten Stock eines Hochhauses, das nach dem Zweiten Weltkrieg erbaut worden war. Wenn ich könnte, würde ich nächtelang am Fenster sitzen und einfach nur hinausschauen. Würde mir ausmalen, wer all diese Menschen dort draußen waren, wer sich hinter den Lichtklecksen verbarg. Was sie ausmachte. Welche Träume und Ängste sie hatten.
Vielleicht würde ich irgendwann dafür Zeit finden.
Schließlich trat ich vom Fenster zurück und schlüpfte durch die Tür. Mein Zimmer befand sich am Ende eines engen Flurs. Links waren die Zimmer meiner Tante, meines Vaters und das Bad untergebracht, rechts unsere Wohnküche, unter deren angelehnter Tür ich einen Lichtkegel erspähte. Als ich auch noch wüste Flüche hörte, musste ich unwillkürlich schmunzeln. Ich hätte mir denken können, dass ich nicht die Einzige war, die heute Nacht keinen Schlaf fand.
So leise wie möglich betrat ich die Wohnküche. Das warme Licht der Deckenlampe flutete den Raum, der seit jeher mein Lieblingsort in unserer Wohnung war. Zu meiner Rechten zog sich eine einfache Küchenzeile die weiße Wand entlang, und zu meiner Linken führte eine Glastür hinaus auf den Balkon, den ich dank meiner Höhenangst nur selten betrat. Eine Couch besaßen wir nicht, dafür einen gemütlichen, aus dunklem Holz gefertigten Esstisch, der mittig im Raum stand und an dem gerade mein Vater und meine Tante saßen. An der Wand, die der Tür gegenüberlag, reihten sich meine größten Schätze aneinander: eine Sammlung von Taylor-Swift-Schallplatten, die ich letztes Jahr zu einem guten Preis auf dem Mottainai-Flohmarkt in Chiyoda erstanden hatte.
Ich trat zu meiner Tante und beugte mich über ihre Schulter. »Spielt ihr schon wieder Shōgi?«, fragte ich. »So spät? Wird das nicht irgendwann langweilig?«
»Du verstehst das nicht, Aiko-chan.« Mai vergrub die Hände in ihrem kurzen, rötlich gefärbten Haar, das einen starken Kontrast zu ihrer quietschgelben Bluse darstellte. Sie sah aus, als würde sie in Gedanken einen Mord planen, während sie mit zusammengezogenen Brauen auf das Brett starrte. »Das hier ist eine Frage der Ehre. Es geht um Leben und Tod.«
»Seit wann geht es bei einem Brettspiel um Leben und Tod?«
Mai nickte zu ihrem Bruder. »Seit ihm.«
Mein Vater zwinkerte mir zu. Mit dem kurzen weißen Haar und seinem gleichfarbigen Bart, der von der Länge her Ojīchans Konkurrenz machen konnte, wirkte er deutlich älter, als er eigentlich war. Er trug ein graues Sweatshirt, auf dem ein Abbild des blauen Igels Sonic prangte. Ich hatte es ihm vor vielen Jahren zum Geburtstag geschenkt, und er hatte es seitdem so oft getragen, dass der Aufdruck hier und da schon etwas ausgeblichen war.
Interessiert beobachtete ich die beiden eine Weile dabei, wie sie die weißen, flachen, fünfeckigen Shōgi-Steine über das hölzerne, in neun mal neun Felder aufgeteilte Spielbrett schoben. Das Ziel war es, den König des jeweils anderen matt zu setzen. Und wenn ich mir das Brett so ansah, war mein Vater mal wieder kurz davor, zu triumphieren.
»Nächstes Mal spielen wir etwas anderes«, knurrte Mai, als sie ihren silbernen General verlor.
Mein Vater nickte strahlend zu seinem Sweatshirt hinunter. »Ich hätte nichts gegen eine Partie Sonic Racing einzuwenden.«
»Nur über meine Leiche«, gab Mai zurück.
Sobald sie sich wieder auf das Spiel konzentrierte, berührte ich behutsam ihr Haar. »Darf ich mir deinen Nacken ansehen, Oba-chan?«
Im ersten Moment erstarrte Mai. Dann nickte sie, wenn auch zögerlich. Sanft schob ich ihr Haar beiseite und entblößte gerötete, schuppige Haut. Zu Beginn ihres Neurodermitis-Schubs vor ein paar Tagen hatte es deutlich schlimmer ausgesehen, aber noch war er nicht vorbei.
»Juckt es sehr?«, fragte ich Mai, während ich die Cortisonsalbe aus einer Schublade unter dem Küchentresen hervorkramte und wieder hinter sie trat.
»Ich bemerke es gar nicht«, entgegnete sie, doch kaum, dass ich etwas Salbe auf ihre Haut strich, zuckte sie zusammen. »Okay, vielleicht ein bisschen.«
Vorsichtig massierte ich die Cortisonsalbe in ihren Nacken. Als ich fertig war, griff Mai nach meiner Hand und drückte sie leicht. Mit dem Daumen fuhr sie über die Überbleibsel der Kratzer, die ich Yuki zu verdanken hatte.
»Darf ich daraus schließen, dass das kleine Raubtier dich immer noch nicht leiden kann?«, fragte sie, während sie mit ihrer anderen Hand einen Spielstein auf das Brett legte.
»Natürlich kann sie mich leiden«, widersprach ich. »Wir müssen uns nur aneinander gewöhnen, das ist alles. Das passiert nicht von heute auf morgen.«
»Du hast sie jetzt seit fast einem Monat.« Mai strich ein letztes Mal behutsam über meinen Handrücken, dann ließ sie mich los. Es war ihre Art, sich zu bedanken. »Was jetzt nicht ist, wird auch nichts mehr. Sorry, Aiko-chan. Vielleicht klappt es beim nächsten Streuner.«
»Okay, ich wechsle das Team«, erklärte ich, trat zu meinem Vater und ging neben ihm in die Knie.
»Wenn du jetzt in meinem Team bist, kannst du Mai bitte ablenken?«, flüsterte er mir zu. »Ich darf heute nicht verlieren. Mein Wetteinsatz ist zu hoch.«
»Worum habt ihr diesmal gewettet?«, flüsterte ich zurück.
»Sie kauft mir mein Lieblingssushi, wenn ich gewinne. Du weißt schon, das leckere von Koshikawa.«
»Und darauf hast du dich eingelassen?«, fragte ich Mai. »Du weißt doch, dass Otou-san immer gewinnt. Deswegen hält sich mein Mitleid ehrlich gesagt in Grenzen.«
»Er hat eine Glückssträhne«, knurrte sie. »Irgendwann wird die auch wieder vorbei sein. Und ich schwöre dir, das wird heute passieren. Denn nie im Leben werde ich diesem alten Sack so teures Sushi kaufen.«
Eine halbe Stunde später stand fest, dass Mai doch Sushi bei Koshikawa würde kaufen müssen.
»Gewonnen!«, rief mein Vater freudestrahlend, als er Mais König matt setzte. Er hob den Spielstein an seine Lippen und presste einen Kuss darauf, wie er es immer zu tun pflegte, wenn er eine Partie für sich entschied.
»Ich hasse dich«, verkündete Mai, ihren tödlichen Blick auf ihren Bruder gerichtet. »Eines Tages werde ich dich schlagen, und du wirst mir vor Scham nicht mehr in die Augen sehen können.« Mit diesen Worten erhob sie sich, wuschelte mir im Vorbeigehen durchs Haar und verschwand hinaus auf den Flur.
Kaum dass sie fort war, wandte ich mich wieder meinem Vater zu. Ich wollte gerade etwas sagen, als er von einem heftigen Hustenanfall geschüttelt wurde und sich beide Hände auf Mund und Nase presste. Hastig holte ich ein feuchtes Tuch vom Küchentresen, dann kniete ich mich neben ihn. Splitter gruben sich in mein Herz, wann immer ich ihn so sehen musste.
»Wann darf ich dich endlich ins Krankenhaus bringen?«, fragte ich leise, während ich seine Hände kurz darauf mit dem Tuch säuberte. »Oder wenigstens zu einem Arzt? Mit einer chronischen Bronchitis ist nicht zu spaßen, Otou-san.«
»Ich habe doch dich«, widersprach er mit einem Lächeln. »Du bist meine Ärztin. Seit du bei mir wohnst, geht es mir viel besser.«
Unwillkürlich glitt mein Blick zur Seite, dorthin, wo Keiko mittlerweile in der Wohnküche schwebte. Mein Vater konnte nicht ahnen, dass nicht ich dafür verantwortlich war, dass es ihm besser ging, sondern die heilenden Fähigkeiten meines Kodamas, den er nicht sehen konnte. Von dessen Existenz er nichts ahnte.
Baumgeister konnten Krankheiten zwar nicht vollständig heilen, doch sie vermochten es, Symptome zu lindern und Schmerzen zu nehmen. Mais Neurodermitis war seit Keikos und meinem Umzug in diese Wohnung vor ein paar Jahren ebenfalls besser geworden, ihre Schübe seltener. Wie Kodama das schafften, wusste ich nicht. Aber Wunder bedurften auch keiner Erklärung.
»Was ich brauche, ist eine Partie Shōgi mit meiner einzigen Tochter.« Sanft entzog mein Vater mir seine Hände. »Bitte.«
Da war etwas, was er mir verschwieg. Ich sah es in seinen Augen. Wann immer ich das Thema Arzt oder Krankenhaus ansprach, stahl sich ein Schatten auf sein Gesicht. Bisher hatte ich ihn noch nicht dazu bringen können, mir zu verraten, was hinter seinem Verhalten steckte. Und auch Mai hüllte sich in Schweigen. Ich wusste zwar von seiner Sozialphobie, aber es schien einen weiteren Grund zu geben, warum er zu keinem Arzt wollte. Einen schwerwiegenderen, den er für sich behielt. Noch war das in Ordnung. Bisher sorgte Keiko dafür, dass sich seine Lunge nicht verschlimmerte. Ohne sie hätte er sicherlich schon längst einen Fassthorax samt Lungenemphysem entwickelt, das man operieren müsste. Aber ich bezweifelte, dass Keiko ihm ewig würde helfen können.
Diese Zweifel und Sorgen waren es, die mich in unserer nachfolgenden Partie Shōgi ablenkten. Doch auch ohne sie hätte ich bestimmt haushoch verloren. Selbst nach all den Jahren wusste ich nicht, wie mein Vater es schaffte, jedes einzelne Mal zu gewinnen.
Nach seinem Sieg küsste er den letzten Spielstein, dann tätschelte er meine Hand. »Du magst im Shōgi-Spielen miserabel sein, aber dafür hast du andere Talente, Aiko-chan.«
»Und die wären?«
Er hob sein Handgelenk und präsentierte stolz das Armband aus grünen und schwarzen Perlen, das ich ihm vor Jahren gemacht hatte. Er hatte es seitdem nie abgenommen. »Ich kenne niemanden, der schönere Armbänder anfertigt als du. Ich glaube, das ist deine wahre Berufung.«
Ich verdrehte die Augen, konnte mir ein Lachen jedoch nicht verkneifen. Er beugte sich über den Tisch und strich mir eine Strähne hinters Ohr. Mit einem Mal verstummten alle Zweifel, alle Sorgen. »Außerdem wirst du eines Tages die beste Ärztin sein, die Tōkyō je gesehen hat«, flüsterte er.
Ich schenkte ihm ein Lächeln, ehe wir gemeinsam das Spiel wegräumten. Danach schob ich meinen Stuhl neben ihn und lehnte meinen Kopf an seine Schulter. Eine Weile saßen wir so da und sahen hinaus in die Nacht, die hinter der Glastür zum Balkon lauerte. Ich liebte diese Stille, in der ich nur seinem Atem lauschte. In der ich für einen kurzen Moment alles andere vergessen konnte. Mein Examen, das ich mit der Bestnote bestehen musste, um schnellstmöglich eine gute Stelle als Assistenzärztin zu finden. Otou-sans kranke Lunge.
Und Tsukuyomi.
Ich presste die Augen zusammen. Großartig, jetzt meldeten sich die Sorgen wieder zu Wort, lauter als zuvor.
»Lies mir etwas vor, Aiko-chan«, flüsterte mein Vater auf einmal. Er hielt meine Hand in seiner und strich mit seinem Daumen beruhigend über meinen Handrücken. »Hilf deinem alten Wrack von einem Vater, einzuschlafen.«
Seine Bitte riss mich aus meinen erdrückenden kreisenden Gedanken. Ich öffnete die Augen und entdeckte ein abgegriffenes Buch mit einem schmucklosen weißen Cover, das er mir hinhielt.
Ich schluckte schwer, als ich erkannte, um was für ein Buch es sich handelte.
»Bist du sicher? Das habe ich dir schon so oft vorgelesen.«
Er nickte lächelnd. »Ich könnte es jeden Tag hören.«
Zögerlich nahm ich das Buch an mich. Es enthielt eine Sammlung der bedeutsamsten Legenden der japanischen Mythologie, angefangen bei dem Mythos um das Götterpaar Izanami und Izanagi. Langsam schlug ich das Buch auf und fuhr mit einem Finger über die Zeilen des Inhaltsverzeichnisses. Mittlerweile waren all die Götter, die hier aufgelistet waren, nur noch Namen für mich. Ich konnte ihnen keine Gesichter mehr zuordnen, verband keine Erinnerungen mit ihnen. Aber wenn mich jemals eine ihrer Reinkarnationen berühren sollte, würde Inaris Seele sie erkennen.
Schließlich begleitete ich meinen Vater in sein Schlafzimmer, setzte mich neben das Kopfende seines Bettes und begann, zu lesen, während Keiko unsichtbar auf meiner Schulter schlief. Wie immer fühlte es sich wie ein kleiner Verrat an, Otou-san Legenden und Mythen aus diesem Buch vorzutragen, ohne ihm zu offenbaren, dass all das einmal Realität gewesen war.
Erneut fragte ich mich, wer von diesen Gottheiten noch immer wiedergeboren wurde so wie ich. Laut Ojīchan folgten nur noch wenige Reinkarnationen den Hinweisen in ihren Träumen und gelangten so zum Schrein der Kodama. Alle, die es nicht taten, starben irgendwann ohne einen Kodama an ihrer Seite und beendeten somit ihren Reinkarnationszyklus. Vermutlich ohne jemals zu erfahren, dass sie eine göttliche Seele in sich getragen hatten.
Ich hielt kurz inne und sah zu meinem Vater. Er ahnte nicht, dass ich die Reinkarnation der Fuchsgöttin war. Meine Mutter war im Bilde gewesen und hatte die Wahrheit relativ schnell akzeptiert, weil sie von Anfang an bei meinen Albträumen dabei gewesen war. Weil sie erleichtert gewesen war, dass es eine Erklärung dafür gegeben hatte, so abwegig sie auch klingen mochte. Aber bei meinem Vater hatte ich noch nicht die richtigen Worte finden können. Nach dem Tod meiner Mutter vor sieben Jahren war ich zu ihm gezogen, um mich während seiner Rente um ihn zu kümmern. Seitdem war ich mehrfach versucht gewesen, es ihm zu gestehen, doch mittlerweile war ich nicht sicher, ob ich das überhaupt noch wollte. Denn zugegebenermaßen hatte ich unheimliche Angst vor seiner Reaktion. Hatte Angst, dass sich dann alles zwischen uns verändern würde.
Deshalb las ich ihm lieber die Geschichten anderer vor, anstatt ihm die zerrissenen Seiten meiner eigenen Geschichte zu präsentieren.
Als ich das fünfte Kapitel erreichte, geriet ich ins Stocken.
»Weiter, Aiko-chan«, flüsterte mein Vater.
Ich holte zitternd Luft, dann begann ich mit der nächsten Geschichte – der Legende um die Fuchsgöttin Inari und den Mondgott Tsukuyomi.
»Eines Tages sandte die Sonnengöttin Amaterasu ihren Bruder, den Mondgott Tsukuyomi, vom Himmel hinunter auf die Erde, um dort die übrigen Gottheiten kennenzulernen. Die Fuchsgöttin Inari war so aufgeregt, den so viel höhergestellten Mondgott zu treffen, dass sie beschloss, ihm ein Festmahl auszurichten. Denn Inari galt nicht nur als die Göttin der Füchse, sondern auch als Göttin der Fruchtbarkeit und Nahrung.« Für einen kurzen Moment haderte ich mit mir, ob ich weiterlesen sollte.
Otou-san weiß nicht, wer du bist, sagte ich mir in Gedanken. Er kann es nicht wissen.
»Inari wandte sich der Erde zu und öffnete den Mund«, fuhr ich schließlich fort. Meine Stimme zitterte kaum merklich. »Sogleich quoll frisch gekochter Reis aus ihrem Mund und ergoss sich über die Erde. Als Nächstes drehte sich die Göttin zum Meer. Alsbald drangen Fische aus ihrem Mund und sprangen in das kühle Nass. Zuletzt wandte sie sich gen Wald, und zwischen ihren Lippen quoll Wild hervor, endlos viel Wild.«
»Diese Frau muss einen sehr großen Mund gehabt haben«, murmelte mein Vater. »Wenn ich das könnte, müssten wir nie wieder hungern.«
Ich blickte kurz auf und schenkte ihm ein vorsichtiges Lächeln, bevor ich mich erneut dem Buch zuwandte. Der nächste Absatz war der schlimmste von allen. Ich musste mehrmals schlucken, bevor ich mich dazu durchringen konnte, das Kapitel zu Ende zu lesen.
»Aber als der Mondgott Tsukuyomi erschien und das Festmahl Inaris sah, wurde er wütend. Er empfand es als ekelhaft und seiner unwürdig, denn Inari war in seinen Augen eine minderwertige Gottheit, wohnte sie doch auf der Erde und nicht wie er und seine Schwester oben im Himmel. In seinem Wahn zerstörte er das Festmahl, doch das war ihm noch nicht Strafe genug. Er wollte Rache an der Göttin nehmen, die ihn mit diesem Mahl angeblich beleidigt hatte. Und so tötete der Mondgott die Fuchsgöttin.«
Mit einem Mal stahlen sich Fetzen meines letzten Albtraums vor mein inneres Auge. Ich hörte wieder die herzzerreißenden Schreie der jungen Frau, die einst Inaris Seele beherbergt hatte, so wie ich es nun tat. Meine Finger krallten sich um die Buchdeckel, so fest, dass meine Knöchel weiß hervortraten. »Als Tsukuyomi zur Sonnengöttin in den Himmel zurückkehrte, war diese jedoch entsetzt über Inaris Tod. Sie wollte ihren Bruder fortan nie wiedersehen und verbannte ihn in den nächtlichen Himmel, während sie weiter über den Tag herrschte. Deshalb kann man Sonne und Mond auch heute niemals gleichzeitig am Himmelszelt erblicken. Die Sonnengöttin soll ihrem Bruder noch immer nicht verziehen haben.«
Ich verschwieg meinem Vater, wie die Geschichte weiterging. Erzählte ihm nicht, dass der Tod einer Gottheit nicht das Ende war. Behielt für mich, dass dank einer hinterhältigen List des Chaosgottes jede Gottheit ihren Tod immer wieder aufs Neue durchleben musste.
Zu wissen, dass mein vergangener und zukünftiger Mörder bei jenem Schrein gewesen war, den auch ich so oft besuchte, jagte mir nicht einen, sondern zahllose Schauer über den Rücken.
Nun war es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich ihm begegnen würde. Nur noch eine Frage der Zeit, bis ich erneut durch die Hand des Mondgottes sterben würde.
Kapitel 4
Shibuya schlief nie. In diesem Stadtteil Tōkyōs wurden die Nächte stets von zahllosen leuchtenden Reklametafeln erhellt, die die Hochhäuser zierten. Tausende von Passanten strömten unentwegt über die Zebrastreifen der riesigen Kreuzung im Zentrum Shibuyas, an die sich Lokale, Restaurants, Clubs und Karaoke-Boxen schmiegten und für eine noch größere Menschenflut sorgten. Ich hätte diese Massen gerne gänzlich vermieden, aber ich begnügte mich damit, das bunte Treiben von meinem Platz neben der Hachikō-Statue am Eingang zum Bahnhof zu beobachten, während ich auf Minako wartete.
Trotz der kühlen Februarnacht und meines gelben Parkas, unter dem ich meinen Lieblingsstrickcardigan trug, rann mir kalter Schweiß den Rücken hinab. Jedes Mal, wenn jemand zu nah an mir vorbeilief, zuckte ich unwillkürlich zusammen und presste mich dichter in den Schatten der Statue. Allein der Gedanke, dass irgendjemand von diesen Passanten die Reinkarnation des Mondgottes sein könnte, ließ Panik in mir aufsteigen.
Seit Ojīchan mir eröffnet hatte, dass der Mondgott beim Schrein gewesen war, war bereits eine knappe Woche vergangen. Und noch immer fiel es mir schwer, nicht daran zu denken, was das für mich bedeutete.
Um mich abzulenken, legte ich den Kopf in den Nacken und starrte zu der lebensgroßen Hundestatue empor, die auf einem quaderförmigen Granitsockel thronte. Das aus Bronze gefertigte Abbild eines Akita war dem treuen Hund Hachikō gewidmet, der einst auf diesem Bahnhof zehn Jahre lang auf die Rückkehr seines verstorbenen Herrchens gewartet hatte.
Meinst du, Yuki würde auch so lange auf mich warten?, fragte ich lautlos und spähte zu Keiko hinüber, die neben mir in der Luft schwebte. Mit ihrem sanften Leuchten schaffte sie es jedes Mal aufs Neue, mich zu beruhigen.
Sie antwortete nicht, das tat sie nie, aber ich wusste, dass sie mir zuhörte und mich verstand. Kodama kommunizierten durch ihr Licht und ihre Wärme. Und die Art, wie Keiko kurz aufflackerte, verriet, dass sie Zweifel an der Treue meiner Katze hegte.
Ich lachte leise, während ich mein Hörgerät verstellte, um den nächtlichen Lärm Shibuyas etwas zu dämpfen. Doch mein Lachen erstarb, als ein Mann besonders dicht an mir vorbeieilte. Instinktiv presste ich meinen Rücken fester gegen die Statue. Im nächsten Moment spürte ich Keiko direkt neben meiner Wange. Sie ließ sich auf meiner Schulter nieder und verharrte dort, während ich mir stumm befahl, gleichmäßig zu atmen.
Würdest du ihn erkennen, wenn du ihn siehst?, fragte ich nach einer Weile, den Blick auf die Menschenmenge gerichtet, die gerade die Shibuya-Kreuzung überquerte. Würdest du Tsukuyomi erkennen, Keiko?
Aber noch ehe meine Begleiterin reagieren konnte, vibrierte mein Handy. Hastig kramte ich es aus der Tasche meines Parkas hervor. Als ich Minakos Namen auf dem Display aufleuchten sah, stahl sich ein erleichtertes Lächeln auf meine Lippen.
»Hey, Mina-chan«, begrüßte ich sie, während ich mich erhob und einen Blick auf meine Armbanduhr warf. »Du bist echt früh dran.«
»Tut mir leid, Doc«, antwortete Minako mit rauer Stimme. Sie klang leicht außer Atem. »Bin gerade auf dem Weg zur Bahn. Sollte in zwanzig Minuten da sein.«
Ich lehnte mich mit dem Rücken an die Statue. Minako war nie pünktlich, deshalb war ich auch erst zehn Minuten später an unserem gewohnten Treffpunkt erschienen, aber das musste sie nicht erfahren. »Haben dich deine Zahlen wieder zu sehr in ihren Bann gezogen?«
Minako stieß ein freudloses Lachen aus. »Vielmehr zur Verzweiflung getrieben. Und meine neue Podcastfolge hat beim Hochladen auch Probleme gemacht.«
»Welche war das noch mal?«, fragte ich. »Die über Itō Shiori?«
»Mhm.« In der Ferne ertönte eine Polizeisirene. »Aber das werden definitiv mehrere Folgen. Und mein Männerhass wächst mit jedem Recherchetag mehr, das kannst du mir glauben.«
Ich wusste nicht, wie Minako die Zeit fand, ihren MeToo-Podcast neben ihrer Masterarbeit so regelmäßig zu bespielen. Und wie sie es schaffte, an den Frauenschicksalen, über die sie berichtete, nicht zu zerbrechen. Es gab keinen Menschen, den ich mehr bewunderte als sie.
Ich wollte gerade etwas erwidern, da ertönte plötzlich eine vertraute männliche Stimme zu meiner Linken.
»Ich muss gestehen, dass es äußerst interessant ist, wer sich hier am Vorabend einer Prüfung herumtreibt.«
Als ich zur Seite sah, entdeckte ich Professor Satō. Sein von Grau durchgezogenes schwarzes Haar war ordentlich zurückgekämmt, und die etwas zu große eckige Brille saß gewohnt schief auf seiner Nase. Er trug einen fein säuberlich gebügelten schwarzen Anzug, der etwas zu vornehm für das nächtliche Shibuya war.
Ich verneigte mich vor ihm, das Handy noch immer an mein Ohr gepresst. »Guten Abend, Satō Sensei.«
Satō tat es mir gleich, dann spähte er kurz verstohlen über seine Schulter. »Sie kennen sich hier bestimmt besser aus als ich, Suzuki-san«, sagte er mit gesenkter Stimme. »Gibt es in dieser Gegend eigentlich auch irgendwo Tee? Schönen bitteren, gesunden Tee?«
Bei anderen Professoren würde man sich wundern, sie im Zentrum der Partymeile Shibuyas anzutreffen, vor allem zu dieser späten Stunde. Aber nicht bei Satō. Der Grund dafür stürmte im nächsten Moment auf uns zu, in Gestalt eines jungen Mannes Anfang dreißig. Sein kurzes schwarzes Haar war leicht zerzaust, und seine Wangen von der nächtlichen Kälte gerötet. Er trug eine dunkelblaue Winterjacke über einem karierten Hemd und eine einfache schwarze Hose.
»Du willst bitte was haben?«, fragte der Neuankömmling Satō. »Ich hoffe, meine Lippenlesekenntnisse sind doch nicht so gut, wie ich dachte. Denn für einen kurzen Moment sah es so aus, als hättest du von Tee gesprochen.«
Gespielt theatralisch warf mein HNO-Professor beide Arme in die Luft. »Jede Woche schleppst du mich hierher, Haru«, beschwerte er sich. »Was hat dir dein armer alter Vater getan, um das zu verdienen?«
Haru verdrehte die Augen. »Ich sorge nur dafür, dass er ein bisschen Spaß hat.« Er schenkte mir ein Lächeln und neigte den Kopf leicht nach vorn. »Abend, Suzuki-san.«
Ich verneigte mich ebenfalls vor Satōs Sohn. Dieser arbeitete als Arzt im Nakamura-Krankenhaus, in dem ich seit dem fünften Studienjahr meine Praktika absolvierte. Doch nicht selten war er auf dem Uni-Campus unterwegs, und alle Medizin-Studierenden kannten und liebten ihn. Weil er sich nie zu schade dafür war, jedem zu helfen, sei es mit Prüfungsfragen oder persönlichen Problemen. Dabei blieb er stets respektvoll, aber gleichzeitig unkonventionell. Auf dem Campus benahm er sich eher wie ein Student als wie ein fertig ausgebildeter Arzt, doch niemand störte sich daran. Vermutlich, weil er Satōs Sohn war.
»Hast du Nakamura-san irgendwo gesehen?«, wollte Haru wissen, während er umherspähte, zweifellos auf der Suche nach seinem besten Freund. »Wir sind eigentlich verabredet, aber er geht nicht an sein Handy.«
Wenn mich nicht alles täuschte, hatte ich Harus Freund vorhin durch die Tür einer Karaoke-Box verschwinden sehen. Seine ungewöhnlich hochgewachsene Statur fiel in jeder Menschenmenge auf, auch im bunten Treiben Shibuyas. »Ich glaube, er ist ins Jankara gegangen.« Freundlich nickte ich in Richtung der beliebten Karaoke-Box, die etwa zwanzig Schritte entfernt war. »Aber Vorsicht, er schien ziemlich beschäftigt zu sein«, fügte ich hinzu. »Er war in Begleitung einer Frau.«
Haru strahlte erst mich, dann die Karaoke-Box an. »Fantastisch. Ich habe schon ewig kein Date mehr gecrasht. Komm mit, alter Mann, wir verderben jetzt jemandem seinen Spaß.« Mit diesen Worten packte er einen sichtlich genervten Satō am Arm. »Außerdem habe ich dich noch nie singen gehört. Du hast bestimmt eine bezaubernde Singstimme«, erklärte er seinem Vater, während er ihn mit sich davonschleifte.
»Bereiten Sie sich gut auf die morgige Prüfung vor, Suzuki-san!«, rief mir Satō zu. »Sie ist sehr wichtig.«
»Ich habe meine letzte Prüfung vorm Examen auch verhauen«, kommentierte Haru über seine Schulter und zwinkerte mir zu. »Und aus mir ist trotzdem etwas geworden. Also lass dich nicht stressen.«
»Darüber lässt sich streiten«, brummte Satō, bevor er und Haru von der Menge verschluckt wurden.
»Nakamura?«, fragte Minako unvermittelt. »Nakamura Chiaki?« Für einen kurzen Moment hatte ich vergessen, dass ich noch immer mein Handy ans Ohr gepresst hielt. »Der Playboy aus Amerika?«
Ich lachte kurz auf, während Keiko auf meinem Kopf herumrollte. »Genau der. Sag bloß, er ist auch auf deinem Informatik-Campus bekannt?«
Minako stieß ein Schnauben aus. »Nicht bekannt. Berüchtigt. Es passiert nicht oft, dass mitten auf dem Campus rumgemacht wird, aber wenn doch, dann ist es in 99 von 100 Fällen immer Nakamura mit irgendeiner anderen Studentin.«
Ich konnte nicht behaupten, dass ich Nakamura Chiaki wirklich kannte. Für mich war er lediglich mein größter Rivale, wenn es um das Stipendium ging, das dem besten Medizinabsolventen winkte und meinen Einstieg als Assistenzärztin um einiges erleichtern würde. Außerdem war er der Sohn einer renommierten Ärztin, die ihn für das Medizinstudium aus Los Angeles nach Tōkyō geholt hatte, nachdem sein Vater gestorben war. Und einer der beliebtesten Studenten der Fakultät, obwohl er fast nie zu Lehrveranstaltungen erschien. Aber sonst? Sonst wusste ich nichts über ihn. Und ich müsste lügen, würde ich behaupten, dass ich das ändern wollte.