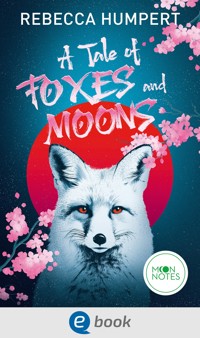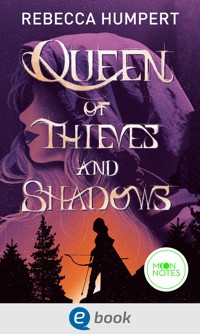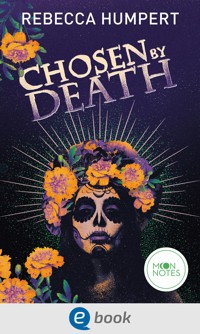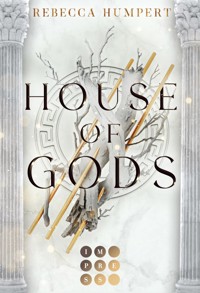
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Willkommen in Aeternitas. Die Todgeweihten grüßen dich.« Die 22-jährige Keira umgibt sich lieber mit lateinischen Texten als mit Menschen. An ihrer Uni ist sie eine Außenseiterin, nicht zuletzt, weil ihr Geist immer wieder von fremden Erinnerungen überflutet wird, die sie unerwartet aus ihrer Realität katapultieren. Als sie ein Stipendium am geheimnisvollen Aeternitas Institut auf der Isle of Skye gewinnt, freut sie sich auf einen Neuanfang. Was sie nicht weiß: Sie ist, genau wie alle Studierenden am Aeternitas, die Wirtin einer Seele der griechischen Mythologie. Sie hat ein Semester Zeit, um herauszufinden, wessen Reinkarnation sie ist – gelingt ihr dies nicht, muss sie sterben. Nur ihr mysteriöser Tutor Kanan, der Aeternitas einst selbst überlebt hat, kann ihr dabei helfen, doch er verfolgt seine ganz eigenen Ziele im Institut … Erkunde eine Welt voller Götter und mythologischer Ungeheuer! //»House of Gods« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Rebecca Humpert
House of Gods
»Willkommen in Aeternitas. Die Todgeweihten grüßen dich.«
Die 22-jährige Keira umgibt sich lieber mit lateinischen Texten als mit Menschen. An ihrer Uni ist sie eine Außenseiterin, nicht zuletzt, weil ihr Geist immer wieder von fremden Erinnerungen überflutet wird, die sie unerwartet aus ihrer Realität katapultieren. Als sie ein Stipendium am geheimnisvollen Aeternitas Institut auf der Isle of Skye gewinnt, freut sie sich auf einen Neuanfang. Was sie nicht weiß: Sie ist, genau wie alle Studierenden am Aeternitas, die Wirtin einer Seele der griechischen Mythologie. Sie hat ein Semester Zeit, um herauszufinden, wessen Reinkarnation sie ist – gelingt ihr dies nicht, muss sie sterben. Nur ihr mysteriöser Tutor Kanan, der Aeternitas einst selbst überlebt hat, kann ihr dabei helfen, doch er verfolgt seine ganz eigenen Ziele im Institut …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© privat
Rebecca Humpert wurde im Jahre 1995 als Tochter eines jordanischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren. Nach ihrem Abitur studierte sie Psychologie und arbeitet heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Uni in Baden-Württemberg. Ihren Kindheitstraum, Geschichten erzählen zu dürfen, hat sie bis heute jedoch nicht aufgegeben.
Vorbemerkung für die Leser*innen
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler für den Roman enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du während des Lesens auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfestellen.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Rebecca Humpert und das Impress-Team
Kapitel 1
Ovid hatte zwar selbst vorhergesagt, dass er durch seine Schriften ewig leben würde, aber wahrscheinlich hatte der römische Dichter nicht damit gerechnet, dass die schweißnassen Finger einer fluchenden Lateinstudentin auch noch Jahrtausende später über seine Verse fahren würden.
Im Kopf übersetzte ich den lateinischen Text, während ich immer wieder Schlüsselwörter unterstrich. Als ich das Ende des Epilogs erreicht hatte, hielt mein Stift für einen kurzen Augenblick inne. Schließlich umkreiste ich das letzte Wort, das wohl bedeutendste seines gesamten Werkes.
Vivam. Ovid hatte recht behalten. Er lebte noch. Und mit ihm jene Götter, Monster und Helden, deren Schicksale er einst niedergeschrieben hatte. Es hatte etwas Tröstliches zu wissen, dass manche Dinge fortbestanden, ganz gleich, wie viel Zeit auch vergangen sein mochte. Dass sie ewig währten wie der Wind, der in diesem Moment auffrischte und mir lose Strähnen meines langen schwarzen Haares ins Gesicht blies. Hastig wischte ich sie mir aus der Stirn und sah auf. Fasziniert musterte ich die zerklüftete Küste der Isle of Skye, die allmählich aus dem Grau vor uns aufzutauchen begann. Der rauen Landschaft wohnte etwas Majestätisches inne, etwas Wildes, das bewies, dass sich diese Insel nicht bändigen ließ.
Ein paar Minuten ließ ich diesen beeindruckenden Anblick auf mich wirken, bevor ich meine Haare zusammenband, um mich wieder ungestört meiner Lektüre widmen zu können. Doch kaum hatte ich den Kopf gesenkt, spürte ich, dass ich beobachtet wurde. Sofort krampften sich meine Finger fester um den Buchdeckel, dann glitt mein Blick zu der grauhaarigen Frau, die mir gegenübersaß. Neben dem Fährmann und mir war sie die einzige weitere Passagierin der Ocean Killer. Ich schätzte sie auf Ende sechzig oder Anfang siebzig, doch in ihren stechend blauen Augen lag etwas Jugendliches, das nicht so recht zu den zahllosen Falten passen wollte, die ihr schmales Gesicht zierten. In einer Hand hielt sie eine entkorkte Whiskyflasche, die andere hatte sie auf der Bank abgestützt, auf der sie saß.
Als sich unsere Blicke kreuzten, schenkte sie mir ein Lächeln, das einen fehlenden Vorderzahn entblößte. Doch das, was mich wirklich überraschte, war die Tatsache, dass sie mir in die Augen sah anstatt dorthin, wo normalerweise die Blicke Fremder ihr Ziel fanden. Meine Finger entspannten sich kaum merklich.
»Hullo.«
Die Frau setzte an, etwas zu erwidern, als die Fähre plötzlich einen heftigen Ruck nach vorn machte. Fluchend umklammerte sie ihre Flasche. »Jings! Crivens! Help ma boab! Wenn ich wegen dir meinen Whisky verschütte, ziehe ich dir das von deinem Lohn ab!«, rief sie dem langbärtigen Fährmann zu. »Ich teile mir dieses alte Ding mit meinem Bruder«, erklärte sie mir. »Familienunternehmen.«
»Das einzige alte Ding hier bist du, Maggie«, entgegnete der Bärtige, während seine Finger liebevoll über das hölzerne Lenkrad glitten, nur wenige Schritte von mir entfernt. »Die Ocean Killer ist eine Schönheit.«
Maggie verdrehte die Augen und nickte in Richtung der schon leicht verschimmelten Holzplanken unter unseren Füßen. »Aye. Kommt ganz darauf an, wie du Schönheit definierst.« Sie nahm einen tiefen Schluck aus ihrer Flasche, dann fiel ihr Blick auf das Buch in meinem Schoß.
»Was liest du da, wee yin?«
Zögerlich klappte ich die abgegriffene Lektüre zu und hielt sie der Frau hin, damit sie den Titel entziffern konnte.
»Ovids Metamorphosen im Original«, las sie laut vor. »Ist das Science-Fiction?«
Ich schüttelte den Kopf. »Das sind mythologische Erzählungen in Versform. Ovid war ein römischer Dichter.«
»Ah, Latein. Ist auf der Liste der unsinnigsten Sprachen ganz weit oben, aye?« Ein weiterer Schluck. »Deswegen habe ich den Kram nie gelernt.«
»Du hast auch sonst keine Sprachen gelernt, Mags«, ertönte die Stimme des Fährmannes, der uns wieder den Rücken zugekehrt hatte.
»Klappe«, knurrte Maggie. »Liest du das Zeug freiwillig?«
Meine Finger zupften an dem eingerissenen, mit zwei Brandflecken gezeichneten Buchdeckel herum. »Ich schreibe darüber meine Bachelorarbeit.«
»Hast du das gehört, Fergus? Die Kinder lernen heutzutage an der Uni echt Dinge fürs Leben.« Maggie stieß ein kehliges Lachen aus. »Wo studierst du? Oxford?«
»University College London.«
»Aye, das ist gut. Ich hasse Oxford. Stinkreiche Schnösel.«
Sie musterte meine Ausgabe der Metamorphosen. »Sind die Gedichte schnulzig? Ich hasse Happy Ends.« Ein tiefer Whiskyschluck. »Sind mir zu unrealistisch.«
Ich schenkte ihr ein zaghaftes Lächeln. »Eigentlich haben die wenigsten antiken Mythen ein Happy End.«
»Umso besser. Tragische Geschichten mag ich am liebsten. Da fühle ich mich immer gleich besser, wenn ich weiß, dass es anderen noch dreckiger geht als mir.« Mit diesen Worten erhob sie sich und schlurfte zu ihrem Bruder, um sich mit ihm über die Unsinnigkeit alter Sprachen zu unterhalten.
Als die Küste immer näher kam und ich bereits den Hafen von Armadale ausmachen konnte, zog ich den Faltflyer, den mir mein Professor zusammen mit den übrigen Stipendiumsunterlagen für das Semester am Aeternitas Institut gegeben hatte, aus meinem Rucksack hervor und legte ihn als Lesezeichen in Ovids Werk. Ich ertappte mich dabei, wie ich erneut das Wappen des Instituts, das auf der ersten Seite des Flyers prangte, bewunderte. Es bestand aus einem prunkvollen in Gold gefassten A, das von zahllosen Lorbeeren umrankt wurde. Vielleicht hatte Professor McManus recht. Möglicherweise würde es mir tatsächlich guttun, eine Weile fort vom UCL zu sein, fort vom lärmenden London. Fort von den Bildern, die mich um meinen Schlaf brachten.
»Bringen Sie häufig Studierende nach Armadale?«, fragte ich Maggie, die mir mittlerweile wieder gegenübersaß und sichtlich gelangweilt mit ihrer leeren Flasche hantierte. Ich schlang meine Jeansjacke etwas fester um meinen Körper, doch die Fährfrau schien der frische Septemberwind nicht zu stören. Sie machte keinerlei Anstalten, die dünne knallgelbe Regenjacke, die neben ihr auf der Bank lag, über ihr graues Kleid zu streifen.
»Was sollen die in diesem gottverlassenen Kaff wollen?« Ihre lallende Aussprache ließ vermuten, dass das nicht ihre erste Whiskyflasche gewesen war.
»Dort liegt doch das Aeternitas Institut.«
Ich konnte nicht sagen, ob ich es mir eingebildet hatte, doch für den Bruchteil eines Moments schien sich ein Schatten in Maggies eisblaue Augen gestohlen zu haben.
»Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, wee yin.«
Hastig zog ich den Institutsflyer aus meiner Lektüre und reichte ihn ihr. »Ich habe ein Stipendium für ein Semester an diesem Institut gewonnen.« Ich verschwieg, dass es laut meines Professors keine anderen Bewerberinnen gegeben hatte. McManus hatte jedoch in hohen Tönen von Aeternitas geschwärmt, deshalb wusste ich, dass es eine gute Einrichtung sein musste.
Die Fährfrau studierte den Flyer eine Weile mit zusammengezogenen Brauen. Schließlich zuckte sie mit den Schultern und gab ihn mir zurück. »Da muss sich jemand einen Scherz erlaubt haben. Bei Armadale gibt es kein Institut.«
Verständnislos starrte ich erst sie, dann den Flyer in meiner Hand an. Ich drehte ihn um und deutete auf die Anreisemöglichkeiten, die am unteren Ende des Papiers vermerkt waren. »Die Ocean Killer wird hier sogar als bevorzugte Reisemöglichkeit von Mallaig nach Armadale angegeben.«
»Ungefragte Werbung wärmt wirklich mein altes Herz, aber ich habe noch nie von diesem Ding gehört.« Maggie fuhr sich mit einer Hand durch ihr schulterlanges, vom Wind zerzaustes Haar. »Es gibt Sabhal Mòr Ostaig, ein gälisches College auf Sleat. Da musst du ein Stück die Küste hoch. Armadale ist da nur ein Umweg.«
»Das ist es nicht. Das Aeternitas Institut liegt direkt neben dem Armadale Castle.«
»Neben diesem Schloss liegt nichts außer den Tränen von Touristen, die dort zu viel Kohle für überteuerte Souvenirs ausgegeben haben.« Maggie musterte mich einen Moment lang, dann glitt ihr Blick zu meinen Händen. Erst jetzt merkte ich, dass sich meine zitternden Finger in den Flyer gekrallt hatten.
»Eines kann ich dir versichern, wee yin –«
»Ich heiße Keira.«
»Ist mir völlig egal, wie du heißt«, brummte Maggie. »Tatsache ist, ich kenne diese verdammte Insel wie meine Westentasche. Ich lebe seit fast vierzig Jahren bei Armadale und noch nie habe ich von diesem Institut gehört.« Sie stellte ihre Flasche neben sich zu Boden, verschränkte die Arme vor der Brust und sah zur Seite.
»Noch nie.«
Der Rest der Überfahrt verlief schweigend.
Als wir endlich die Küste erreichten, stolperte ich vor Erleichterung beinahe über meinen Koffer. Doch zu meiner Überraschung steuerte die Ocean Killer nicht auf den Hafen zu, sondern auf einen einsamen hölzernen Steg, der weit abseits lag. Maggie ignorierte meinen fragenden Blick.
Ich hievte mein Gepäck von Bord, schulterte meinen Rucksack, presste meine Metamorphosen samt Flyer an die Brust und stieg auf dem schmalen Holzsteg aus.
»Du hast etwas verloren, wee yin.«
Als ich mich umwandte, sah ich, wie Maggie den gestrickten Anhänger, der an meinem Rucksack befestigt gewesen war, in die Höhe hielt.
»Selbstgemacht?«
Ich nickte.
»Aye.« Sie begutachtete den weißen Kater mit dem grauen spitzen Hut, den ich Gandalf getauft hatte, genauer. »Ich verstehe nichts von Handarbeit, aber das gefällt mir.«
»Sie können ihn behalten, wenn Sie möchten.« Der Wind, der über Skye hinwegjagte, blies mir inzwischen unentwegt lose Strähnen in die Stirn. »Ich habe genug davon.«
Ein Strahlen stahl sich auf Maggies Gesicht. »Ich werde ihn in Ehren halten. Aye, Fergus, wann hast du das letzte Mal ein Geschenk von einem Passagier bekommen? Ich wette noch nie – ah, verdammt.« Eine Sekunde später hatte sie Gandalf beinahe in einer Whiskypfütze ertränkt. Sie bückte sich schwerfällig, hob den Anhänger auf und wischte ihn notdürftig an ihrem Kleid ab. »Das geht wieder raus.« Der Kater verschwand in ihrer Tasche.
»Bist du sicher, dass wir dich nicht zurück nach Mallaig bringen sollen?« Die Alte kniff die Augen zusammen. »Du siehst ein bisschen blass aus, wee yin.«
Entschieden schüttelte ich den Kopf, während ich versuchte mir meine wachsende Unsicherheit nicht anmerken zu lassen.
Ich scheiterte vermutlich kläglich.
Maggie kaute auf ihrer Unterlippe herum, dann seufzte sie und prostete mir mit ihrer leeren Whiskyflasche zu. »Morituri te salutant,wee– ich meine, Keira. Und probier unbedingt den Scotch Whisky im Drunk Deer, da vergisst du all deine Sorgen.«
»Ich dachte, Sie können kein Latein.«
Die Fährfrau zuckte mit den Schultern. »Kann ich auch nicht. Aber das kenne ich aus Gladiator. Weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal, was das bedeutet.«
Ich schenkte ihr ein letztes Lächeln, drehte mich um und begann den Holzsteg hinunterzugehen. Als ich noch einmal einen Blick über die Schulter warf, ertappte ich Maggie dabei, wie sie mir nachsah, einen seltsamen Ausdruck im Gesicht, den ich nicht deuten konnte.
Plötzlich rutschte ich auf dem nassen Steg aus und ließ meine Lektüre fallen. Gerade so konnte ich mich mit einer Hand, in der ich immer noch den Flyer hielt, abfangen. Als ich mich wieder aufrichtete und nach meinen Metamorphosen griff, merkte ich zu spät, dass ich mich am Papier des Flyers geschnitten hatte.
»Allanaa.« Blutstropfen fanden ihren Weg auf die Seiten, verschmierten das Ende des Epilogs. Es dauerte einen Moment, bis ich feststellte, dass mein Blut Ovids letztes Wort durchgestrichen hatte, jenes Vivam, das von seiner Zuversicht, ewig zu leben, zeugte.
Ich sah auf, doch die Fähre war verschwunden, die graue schottische See ungestümer als zuvor. Einige Sekunden lang starrte ich aufs Meer und hielt nach der Ocean Killer Ausschau. Der Nebel war nicht dicht genug, um die Fähre so schnell verschluckt zu haben, aber egal, wie sehr ich die Augen zusammenkniff, ich konnte sie nicht mehr entdecken.
Maggies Abschiedsworte hallten in meinen Ohren wider. Auf einmal war ich mir nicht mehr sicher, ob sie die Wahrheit gesagt hatte, ob sie die Bedeutung ihrer Worte tatsächlich nicht gekannt hatte.
Morituri te salutant.
Meine Finger gruben sich erneut in Ovids Lebenswerk, nun nicht mehr schweiß- sondern blutverschmiert.
Die Todgeweihten grüßen dich.
Kapitel 2
In dem winzigen Dörfchen, das sich an die zerklüftete Küste schmiegte, lernte ich zwei Dinge:
Erstens, ich würde nie wieder in meinem Leben Fisch essen. Ich konnte nur hoffen, dass ich den intensiven Lachsgeruch eines Tages von meiner Haut würde schrubben können.
Und zweitens, keiner der Dorfbewohner hatte je etwas von einem Institut namens Aeternitas gehört.
Meine Kartenapp lotste mich zwar zum Armadale Castle, doch hier fand ich nur ein Besucherzentrum und ein nahes Moor vor. Ich erkundigte mich bei einer älteren Dame an der Rezeption des Zentrums nach dem Institut, erntete jedoch lediglich ein entnervtes »Nicht schon wieder«.
Nicht schon wieder? »Hat hier sonst noch jemand nach Aeternitas gefragt?«
Die Frau runzelte die Stirn. »Ich weiß nicht, was das soll, aber ich habe keine Zeit für Ihre Albereien. Hier gibt es kein Institut, hat es noch nie und wird es auch nie geben.«
Als ich das Besucherzentrum verließ, spürte ich Blicke auf mir. Blicke, die mir vertraut waren, an die ich mich eigentlich längst gewöhnt hatte. Doch jetzt, da ich so nervös war, brannten sie wieder stärker, rissen eine Wunde auf, die ich verheilt geglaubt hatte.
Der Vormittag wurde zum Mittag und ging langsam in den Nachmittag über, während ich nach jemandem Ausschau hielt, der ähnlich orientierungslos wie ich zu sein schien, aber ich begegnete niemandem.
Irgendwann fand ich mich vor dem Pub wieder, den Maggie erwähnt hatte. Ich zögerte einen Moment, dann trat ich ein, ging zur Theke und schilderte dem Mann dort meine Situation.
»Wenn es hier ein Institut gäbe, hätte ich schon längst davon erfahren.« Der graubärtige Inhaber des Drunk Deer wischte zum wiederholten Male über die hölzerne Theke. »Ich habe hier noch nie irgendwelche Studenten bedient. Überhaupt gibt es in diesem Kaff kaum junge Leute wie dich, nighean.« Der Wirt warf den Lappen hinter sich und verschränkte die Arme vor der breiten Brust. »Ich hätte diese Nacht noch ein Zimmer frei, falls du eine Unterkunft brauchst.«
Ich zwang mich zu einem Lächeln und schüttelte den Kopf. »Hätten Sie vielleicht den Fahrplan der Fähre, die nach Mallaig fährt? Online finde ich nichts.«
Der Mann fasste unter die Theke und beförderte ein winziges Prospekt zutage, auf dem vorne eine imposante Fähre abgebildet war. Dankend griff ich danach, hielt jedoch inne, als ich die Schrift auf der Titelseite entziffert hatte. »Das ist leider die falsche Fähre.«
»Du bist doch mit der CalMac angereist, aye?«
»Naw, mit der Ocean Killer. Sie hat etwa eine halbe Meile entfernt an einem Holzsteg angelegt, nicht am Hafen direkt.«
Er sah mich verständnislos an. »Außer der CalMac dürfen hier keine Fähren anlegen, nighean.«
»Aber ich bin mit der Ocean Killer angereist. Die Fährfrau hat das Drunk Deer empfohlen. Sie heißt Maggie.«
Der Wirt zuckte mit den Schultern. »Kenne keine Maggie. Aber ich werde sie wohl oder übel der Hafenbehörde melden müssen. Diese Schmarotzer hinterziehen bestimmt Steuern.«
Als ich kurz darauf den lärmenden Pub samt Prospekt verließ, wurde ich von einem Regenschauer begrüßt. Erste Tropfen fanden ihren Weg auf den Flyer, den ich über das Prospekt gelegt hatte. Ich sah zu, wie der Name des Instituts fortgewaschen wurde, wie das prunkvolle Wappen zerfloss, bis beides nicht mehr zu entziffern war. Bis keines von ihnen mehr existierte.
So wie Aeternitas nicht zu existieren schien.
Mit leicht zittrigen Fingern tippte ich den Namen des Instituts bei Google ein, wartete auf die Ergebnisse, die mir die Suchmaschine ausspucken würde.
Nichts. Keine Treffer zum AeternitasInstitut. Kein einziges Suchergebnis.
Ich starrte das Display meines Handys an, suchte nach einer Erklärung, fand keine. Es schien fast so, als würde das Institut, von dem McManus so geschwärmt hatte, tatsächlich nicht existieren. Aber er hatte mich nicht angelogen. Natürlich nicht. Warum sollte er? Mein Professor hatte mir Fotos vom Institut, das von der Architektur her dem Parthenon nachempfunden war, gezeigt, war mit mir auf der Website gewesen. Warum wurde mir das alles nun nicht mehr angezeigt? Es sei denn … Ich schloss die Augen, erinnerte mich an die Stunden mit McManus zurück, in denen wir gemeinsam für dieses Stipendium recherchiert hatten. Immer an seinem Arbeitslaptop, nie an meinem. Mit einem Mal begann ich an allem, was er mir je erzählt hatte, zu zweifeln.
Während ich zurück in Richtung Hafen ging, probierte ich noch einmal jemanden unter der Nummer des Instituts zu erreichen, doch jedes Mal kam die Meldung, dass die Rufnummer nicht vergeben sei. Inzwischen zitterte ich so sehr, dass ich Mühe hatte, meine Metamorphosen nicht fallen zu lassen. Auch McManus nahm nicht ab. Danach wählte ich wieder die Nummer meiner Mutter, aber sie war ebenfalls nicht zu erreichen. Vermutlich war sie noch in der Praxis, doch auch dort ging niemand ran.
Als ich gerade eine SMS an McManus tippte, gab mein Akku den Geist auf. Allanaa. Mein Rückflug von Glasgow nach London war erst für den 17. Dezember geplant. Vielleicht konnte ich ihn umbuchen, aber das würde wahrscheinlich nicht günstig werden. Außerdem wusste ich nicht, wo ich das Semester über wohnen sollte. Mein Apartment in Camden hatte ich für diese Zeit an Ayla, eine Kommilitonin, die zwei Semester unter mir war, untervermietet. Ich konnte mir vorstellen, dass sie nicht sonderlich begeistert sein würde, sollte ich jetzt wieder vor der Tür stehen.
Als ich den Hafen erreicht hatte, hievte ich mein Gepäck vom Pier und ging stattdessen ein Stück an der Küste entlang, bis ich schließlich stehen blieb und mich hinsetzte. Ich schloss die Augen, versuchte meinen unregelmäßigen Atem zu beruhigen. Es würde sich alles aufklären, ganz sicher.
Ein sanfter Gesang riss mich aus meinen Gedanken. Ich öffnete die Augen, sah mich um und entdeckte eine hochgewachsene Frau, die etwa knietief im Meer stand. Überrascht stellte ich fest, dass sie auf Lateinisch sang, doch die Bedeutung ihrer hektischen Verse blieb mir verborgen. Ungewöhnlich langes dunkles und leicht welliges Haar floss ihren Rücken hinunter.
Ein hastiger Blick Richtung Himmel verriet mir, dass der Sturm, der sich schon seit meiner Ankunft ankündigte, bald über die Insel hereinbrechen würde.
Die Fremde begann ihren schmalen, in ein langes weißes und augenscheinlich viel zu dünnes Kleid gehüllten Körper im Wind zu wiegen. Ich beobachtete sie eine Weile lang, dann legte ich mein Handy und meine Metamorphosen neben meinen Rucksack, rappelte mich auf und näherte mich ihr. Etwas an ihr faszinierte mich. Machte mir gleichzeitig Angst, trotzdem zog ich meine Sneaker samt Socken aus und watete ins gräuliche Wasser.
»Ein Sturm zieht auf«, rief ich ihr zu. »Sie sollten nicht hier draußen sein.« Genauso wenig wie ich.
Die Frau drehte sich immer noch nicht um, ich war nicht sicher, ob sie mich überhaupt gehört hatte. Ihr merkwürdiger Gesang wurde lauter, durchdringender, übertönte den Wind.
Mittlerweile waren tintenschwarze Wolken aufgezogen und ein fernes Grollen kündigte noch weitaus Schlimmeres an.
Als ich die Frau fast erreicht hatte, begann es.
Ein beißender Schmerz explodierte hinter meiner Stirn und zwang mich in die Knie. Ich presste meine Hände auf die Ohren, kniff die Augen zusammen und wartete. Darauf, dass es aufhörte. Dass die Bilder und Stimmen, die keinen Sinn ergaben, wieder einmal aus meinem Kopf verschwanden. Ich schmeckte blutige Tränen auf meinen Lippen, die jemand anderes vergossen hatte, hörte Schreie, die mich zerbrachen. War gefangen in einer Erinnerung, die nicht mir gehörte.
Als ich plötzlich etwas an meinem Rücken spürte, wurde die Vision zerrissen. Ehe ich reagieren konnte, drang etwas Spitzes durch den Stoff meiner Jeansjacke – und stieß mich ins Wasser.
Panisch schlug ich um mich, wollte mich aus dem eiskalten Nass hochstemmen, aber was auch immer mich nach unten drückte, bewies einen eisernen Griff. Ohne nachzudenken, öffnete ich den Mund, um zu schreien, und verschluckte Wasser, viel zu viel Wasser. Meine Lunge fing Feuer, doch dieses Brennen war nichts im Vergleich zu dem stechenden Schmerz, der sich durch meine rechte Hand fraß.
Auf einmal verschwand der Druck auf meinem Rücken. Im nächsten Moment legte sich etwas Warmes um meine Taille und ich wurde aus dem Meer gehievt.
Ich würgte Wasser nach oben, schnappte keuchend nach Luft.
Männliche Stimmen ertönten, doch ich verstand nicht, was sie sagten, weil die Frau nun nicht mehr sang, sondern schrie.
Erst, als sich von hinten eine Hand auf meinen Mund legte, begriff ich, dass ich diejenige war, die schrie.
Ohne zu zögern, biss ich in die Finger. Fluchend wurde ich losgelassen und landete auf Händen und Knien im feuchten Sand. Eine seltsame klebrige Süße hatte sich auf meine Lippen gestohlen.
Durch brennende, halb zusammengekniffene Augen musterte ich meine schmerzende Hand – und erstarrte. Das Letzte, was ich sah, bevor mein Blick verschwamm, war ein tiefrotes A auf meinem Handrücken, umrankt von Lorbeeren, die es zu ersticken drohten.
Es war dasselbe Symbol, das ich schon auf dem Flyer des Instituts bewundert hatte.
Das Wappen von Aeternitas.
Kapitel 3
Der Geschmack nach Honig weckte mich.
Meine Lider waren schwer wie Beton, ein brennender Schmerz pulsierte hinter meinen Schläfen und eine harte Oberfläche presste sich gegen meinen Rücken. Mühevoll befreite ich mich aus der Dunkelheit, öffnete die Augen, nur um von noch mehr Finsternis empfangen zu werden. Es dauerte einen Moment, bis ich mich an die Schwärze gewöhnt hatte und glaubte eine Decke zu erkennen, die sich über mir wölbte. In der Mitte befand sich eine kreisrunde Öffnung, durch die ich ein Stück des sternenübersäten Nachthimmels erspähen konnte.
Hastig wollte ich aufstehen, doch meine Beine gehorchten mir nicht. Meine Finger fanden meine Schläfen, gruben sich hinein, um den Schmerz zu betäuben. Langsam fügten sich Erinnerungsfetzen zusammen, ergaben ein Bild, das nicht zu der Umgebung passte, in der ich mich gerade befand. Ich war am Strand gewesen, frustriert, weil ich das Institut nicht hatte finden können. Da war eine Frau gewesen, die gesungen hatte. Im Meer. Bilder und Stimmen hatten mich überfallen, sich in meine Gedanken gestohlen, wie sie es immer wieder seit Februar zu tun pflegten. Und dann – dann hatte die Welt plötzlich sämtliche Farben verloren.
Noch einmal versuchte ich mich aufzusetzen und diesmal gelang es mir.
Hektisch sah ich mich um, suchte nach meinem Gepäck, nach meinen Metamorphosen, aber alles war verschwunden. Stattdessen begrüßte mich fahle Dunkelheit, hier und da durchbrochen von Fackeln, die an den Wänden hingen, und aus Ton gefertigten Öllampen, die auf dem Boden des Raumes standen. Ich kniff die Augen zusammen. Nein, kein einfacher Raum. Eine weite Halle, die etwa doppelt so groß zu sein schien wie der Hörsaal an der UCL. Neben jeder Lampe ragte eine menschengroße Statue in die Höhe, die in der Mitte der Halle einen Kreis bildeten.
Meine Armbanduhr verriet, dass es neun Uhr abends war. Wann war ich auf Skye angekommen? Um elf? Was hatte ich die ganze Zeit über getan? Und wie war ich hierhergekommen, allanaa? Mein Blick verließ meine Uhr, fuhr zu dem seltsamen Symbol, das sich über meinen rechten Handrücken spannte. Ein A umrankt von Lorbeeren, versehen mit einer römischen Zahl nahe meinem Handgelenk. Die Finger meiner anderen Hand krallten sich in den Buchstaben, probierten die tiefrote Farbe abzukratzen, aber es war, als hätte sie sich unter meine olivfarbene Haut gefressen, sich dort gegen meinen Willen verewigt. Panik begann sich um meine Kehle zu schlingen, während ich mich mühsam auf die Beine kämpfte. Ich wollte schreien, aber die Süße lag tonnenschwer auf meiner Zunge.
Das hier musste ein Traum sein. Natürlich. Anders ließ sich nichts davon erklären. Ich schloss die Augen, holte zitternd Luft. Wenn ich sie wieder öffnete, würde ich zu Hause sein, in meinem winzigen, mit Tolkien-Büchern vollgestopften Apartment und Frodo würde um meine Beine streichen.
Nur ein Traum. Nur ein Traum. Nur ein –
»Keira MacKay?«
Ich riss die Augen auf, fuhr herum und stieß beinahe mit einem hochgewachsenen Mann zusammen, der hinter mir stand. Erschrocken taumelte ich einen Schritt zurück. Der Fremde trug ein schwarzes Sakko, das beinahe mit der schwach erhellten Dunkelheit um uns herum verschmolz. Sein Kopf war rasiert, seine Hände hinter dem leicht gebeugten Rücken verborgen. Ich schätzte ihn auf Mitte oder Ende fünfzig.
Er musterte mich einen Moment lang schweigend, ein leises Lächeln auf den schmalen Lippen, dann trat er zur Seite. Hinter ihm entdeckte ich einen kleinen steinernen, etwa hüfthohen Tisch und ein Feuer, das in einem offenen Kamin zu züngeln schien. Instinktiv wich ich noch etwas zurück. Auf einmal spürte ich jedoch Hände an meinen Schultern, die mich daran hinderten zu fliehen. Ich wollte mich losreißen, aber mein Körper war schwächer als gewöhnlich.
Voller Entsetzen nahm ich wahr, wie ich nach vorn geschoben und schließlich nach unten gedrückt wurde. Keine Sekunde später schlugen meine Knie auf dem Boden auf. Meine Hände fingen sich am Tisch vor mir ab, der Druck auf meinen Schultern blieb. Als ich den Kopf hob, erkannte ich kunstvolle Gravierungen an den Seitenflächen des Steins. Sie erzählten die Geschichte von Romulus und Remus, jenen Brüdern, die von Wölfen aufgezogen worden waren und einst Rom gegründet hatten. Mein Blick glitt hinauf zur Ablagefläche des Tisches, in die mehrere Handvoll römischer Zahlen eingeritzt waren. Mein Herz setzte einen Schlag aus, als ich dunkle Spuren auf dem von Feuer hell erleuchteten weißen Stein sah. Das war kein Tisch.
Es war ein Opferaltar.
Mit aller Kraft, die ich aufbringen konnte, versuchte ich erneut mich aus den Fängen der Person, die mich von hinten festhielt, zu winden, doch je heftiger ich mich wehrte, desto unnachgiebiger gruben sich Finger in meine Schultern. Ich wollte schreien, aber meine Zunge war noch immer beschwert von der Süße, die mir alle Worte raubte.
»University College London«, ertönte wieder diese kratzige Stimme von eben. Der kahlköpfige Mann kniete mittlerweile auf der anderen Seite des kleinen Altars. Er studierte einen Stapel Papiere, das Rascheln nur durchbrochen von meinem eigenen hektischen Atem. »Bachelor in Latein und Griechisch, aye?« Er blätterte weiter. »Sie schreiben Ihre Abschlussarbeit bei Professor McManus. Ein sehr geschätzter Kollege.« Noch mehr Papierrascheln. »Vergangenen Mai hatten Sie ein Diagnosegespräch bei Ihrer Therapeutin, weil ein Verdacht auf eine Dissoziative Persönlichkeitsstörung bestand, nicht wahr?«
Ich erstarrte, vergaß für einen kurzen Augenblick, mich gegen die unsichtbaren Hände hinter mir zu wehren. Das waren Dinge, die er nicht wissen durfte. Meine Finger klammerten sich an die steinerne Platte des Altars, bis meine Knöchel schmerzten. Nicht real. Das hier konnte nicht real sein, nichts davon.
Mit einem Mal legten sich die Finger des Mannes grob unter mein Kinn, zwangen mich, ihn über den Altar hinweg anzusehen.
»Möchten Sie frei sein von ihnen?« Die Papiere waren verschwunden, stattdessen hatte sich seine Hand auf meine gelegt. »Von den Erinnerungen, die nicht Ihnen gehören?« Er packte meine Hand, zog sie näher zu sich heran und presste sie flach auf den Altar. »Von den Stimmen, die keinen Sinn ergeben?« Sein Blick fuhr hinunter zu den Lorbeeren, die sich in meine Haut gefressen hatten.
»Die Ewigkeit hat Sie gezeichnet.« Er sah mich wieder an. Seine Finger verließen mein Kinn, glitten über das Brandmal, das den Großteil meiner rechten Wange bedeckte und mein unteres Augenlid streifte. Angewidert zuckte ich zusammen. »Aber wie ich sehe, sind Sie bereits gezeichnet.« Er krallte sich schmerzhaft in meine Wange, dann ließ er seine Hand sinken. »Auf mehr als nur eine Weise.«
Plötzlich zuckte der Mann mit dem Kopf, wandte ihn zur Seite und schüttelte ihn, so ruckartig, dass ein hässliches Knacken ertönte.
»Kein Gold. Ich weiß, dass du Gold hasst«, murmelte er. Ein Lachen erklang, gefolgt von einem heftigen Kopfschütteln. »Aye, rot. Nur rot. Nur für dich.« Er zog etwas hinter dem Altar hervor, verstärkte den Griff um meine Hand und trieb die Spitze eines Messers in meinen markierten Handrücken. Ich versuchte verzweifelt mich loszureißen, wollte schreien, meine Lippen gehorchten mir jedoch nach wie vor nicht.
»Das reicht, Cam«, ertönte eine dunkle Stimme hinter mir.
Ich riss wieder an meiner Hand, wurde festgehalten. Tiefer, immer tiefer drang die Klinge, während sie das A nachzeichnete, den Buchstaben mit Blut tränkte.
»Cameron!« Der Druck auf meinen Schultern verschwand und ein zweiter komplett in Schwarz gehüllter Mann trat neben den Altar. Er packte den Arm des Fremden und entwendete ihm das Messer. »Du vergisst dich schon wieder.«
Schwer atmend starrte Cameron den Neuankömmling an. »Sie hat es mir befohlen, Kanan«, stieß er hervor, die Augen leicht geweitet. »Sie befiehlt es mir jedes Mal, das weißt du doch.« Er wandte sich wieder mir zu, drehte meine Hand um und presste die blutige Haut auf die Altarplatte.
»Omnia mutantur, nihil interit«, flüsterte er. Worte, die ich aus den Metamorphosen kannte.
Alles ändert sich, nichts geht zugrunde.
Ich versuchte noch einmal mich zu befreien, doch plötzlich ließ er mich von selbst los.
»Salve in Aeternitate.« Mit diesen Worten stand Cameron auf und ließ mich mit dem anderen Mann allein, der sich nun zu mir kniete. Wie hatte Cameron ihn genannt? Ich wusste es nicht mehr.
»Ich werde Ihnen nichts tun, Ms MacKay.«
Er schien kaum älter als ich zu sein, vielleicht Mitte oder Ende zwanzig. Sein dunkles Haar war zurückgebunden, der Anflug eines Bartes zierte sein schlankes Gesicht. Mit tintenschwarzen Augen musterte er mich, bevor er meine schmerzende Hand vom Altar nahm und das Blut, das aus meiner Haut sickerte, mit einer Stoffbinde fortwischte. Ich wollte meine Hand wegziehen, aber er hielt mich fest. Sein Griff war nicht so schmerzhaft wie Camerons, aber trotzdem unnachgiebig.
Auf einmal erschien eine ältere, in einen dunklen Hosenanzug gekleidete Frau neben ihm und berührte seine Schulter. Ihr schneeweißes Haar war zu einem vornehmen Dutt hochgesteckt.
Der Mann sah nach oben, hob eine Hand, drückte die der Frau leicht und stand auf. Einen Moment später hatte ihn die Dunkelheit erneut verschluckt. An seiner statt kniete sich nun die Frau neben mich. Diesmal legten sich sanfte Finger auf meine Hand, tasteten sie entlang, verschmierten Blut auf meiner Haut. Ehe ich sie ihr entziehen konnte, hatte sie eine weitere Stoffbinde hervorgeholt und bandagierte die Wunde so behutsam, dass ich ihre Finger kaum spürte. Als sie fertig war, verharrte ihre Hand auf meiner. Nicht fordernd wie die der Männer, sondern vorsichtig, sanft. Als ich den Blick von unseren Händen löste und der Frau zum ersten Mal richtig ins Gesicht sah, entdeckte ich ein trauriges Lächeln auf ihren Lippen. Und Leere in ihren Augen.
Sie war blind.
Schließlich ließ die Fremde mich los, stand ebenfalls auf und verschmolz mit der Finsternis.
Ich saß noch einen Augenblick lang am Altar, versuchte zu begreifen, was hier gerade geschehen war. Verfluchte mich selbst, dass ich mich nicht heftiger gewehrt hatte.
Mühsam erhob ich mich, dann stolperte ich umher, suchte nach einem Ausgang. Ich musste jedoch schnell feststellen, dass die kreisrunde Halle, in der ich wieder der einzige Mensch war, keinen Ausgang besaß, nur Gänge, die von ihr abzweigten. Viele Gänge, endlose Gänge, fünfzehn Gänge. Ich rannte jeden entlang, rüttelte an jeder Tür, doch alle waren verschlossen. Ich suchte nach Fenstern, nach irgendeiner Öffnung, die Freiheit versprach, aber ich fand keine einzige bis auf das Loch in der Kuppel.
Salve in Aeternitate. Willkommen in Aeternitas.
Das konnte unmöglich Aeternitas sein.
McManus hatte von diesem Institut geschwärmt, hatte behauptet, dass mir ein Semester hier viele Türen für meine weitere wissenschaftliche Laufbahn öffnen würde. Dass es hoch angesehen war in der Welt der Altertumswissenschaften. Und ich hatte ihm geglaubt. Ich hatte ihm vertraut.
Irgendwann fand ich mich erneut in der Halle wieder, sank an einer Wand, die am weitesten vom Opferaltar entfernt war, zu Boden und kauerte mich dorthin, den Rücken gegen ein kunstvolles Fresko gelehnt.
Nur ein Traum. Ich umklammerte meine bandagierte Hand, tippte mit dem Fuß auf den steinernen Boden.
Nur ein Traum.
Ich presste die Augen zusammen, öffnete sie wieder.
Ein Traum, der mich nicht gehen lassen wollte.
Erst ein entferntes Geräusch ließ mich aus meiner panischen Starre ausbrechen. Ich sah in die Richtung, aus der das Scharren gekommen war, und beobachtete, wie noch jemand von dem jungen Mann aus einem Gang, über dem eine römische, in Gold gefasste Eins prangte, hereingetragen und vor dem Altar abgelegt wurde, dann noch jemand. Und noch jemand.
Die meisten schienen ähnlich benommen zu sein wie ich und wehrten sich kaum, während die Männer abwechselnd das A, das alle auf den Handrücken trugen, mit einer Klinge ritzten.
Aufwachen, ich musste aufwachen. Aber ich tat es nicht.
Deshalb begann ich zu zählen. Zwanzig, mit mir einundzwanzig. Einundzwanzig Menschen, die bewusstlos hierhergebracht worden waren. Ich ballte meine unverletzte Hand zu einer Faust und biss hinein. Meine Zähne gruben sich in mein Fleisch, betäubten die Fragen, auf die es keine Antworten zu geben schien.
Schon bald war ich nicht mehr die Einzige, die versuchte aus dem Inneren dieses Gebäudes zu fliehen. Je mehr Zeit verstrich, desto mehr Menschen rappelten sich vom Boden auf, rannten umher, füllten die Halle mit ohrenbetäubendem Geschrei in den verschiedensten Sprachen, sobald sie feststellen mussten, dass es keinen Ausgang gab, keine offenen Türen, nicht einmal Fenster.
Dass wir Gefangene waren.
»Was soll der Scheiß?«, brüllte ein schlanker Mann, dem blonde Locken wirr in die Stirn fielen.
Doch er bekam keine Antwort, auch nicht von dem jungen Fremden, der an einer Statue lehnte und uns die ganze Zeit über beobachtete, als wollte er sich jeden unserer Schritte einprägen. Als würde er auf etwas warten. Immer wieder trat Cameron neben ihn, beugte sich zu ihm hinunter und murmelte etwas. Der Dunkelhaarige nickte manchmal und schüttelte ab und an den Kopf. Irgendwann wurden die beiden belagert, wurden angeschrien, mit Fragen bombardiert, manchmal sogar körperlich angegangen, aber sobald sie ihre Messer aus den Gürteln zogen, wichen die anderen zurück.
Messer, an denen unser aller Blut klebte.
Nur ein Traum.
Ich hörte den Gesang der Frau immer noch, wenn ich die Augen schloss, darauf hoffend, dass ich endlich aufwachen würde. Nein, es war nicht die Frau. Ich drehte den Kopf zur Seite und legte mein Ohr an die Wand, an der ich lehnte. Jemand sang, doch der Gesang, der durch den Stein drang, bestand nicht aus Worten, nur aus zarten Lauten. Bis er mit einem Mal verstummte. Ich lauschte noch einen Moment lang, dann löste ich mein Ohr von der Wand und richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die Halle.
Eine Halle, die mittlerweile gähnend leer war.
»Gang I«, ertönte es flüsternd neben mir.
Erschrocken wandte ich den Kopf und entdeckte den jungen Mann, der sich neben mich gekniet hatte.
»Dort werden Sie auch Ihr Gepäck finden.« Sein Blick wanderte hinunter zu der bandagierten Hand, die ich an meine Brust gepresst hielt. »Morgen werden wir Ihnen Ihre Fragen beantworten, das verspreche ich Ihnen.«
Hastig rappelte ich mich auf, drehte mich um und stürmte den Gang hinunter, über dem die römische Eins prangte. Ich wusste nicht, warum ich ihm glaubte, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Lügen in seinen Worten gelauert hatten.
Die Türen, an denen ich bereits vor Stunden gerüttelt hatte, waren nun mit Wachstafeln versehen, in die verschiedenste römische Zahlen eingraviert waren, jede Zahl ergänzt durch die Worte »Relictum ignotum«.
Unbekanntes Überbleibsel? Rest? Die Knoten in meinem Hirn verstärkten sich, bis ich das Gefühl hatte, sie nie wieder entwirren zu können. Meine Aufmerksamkeit glitt zurück zu den römischen Zahlen. Auf einmal kam mir ein Gedanke. Ich riss die Bandage von meiner Hand. Dort, unterhalb des noch blutigen As, hatte sich ebenfalls eine römische Zahl in meine Haut gefressen.
MMMXXVI.
Nach kurzem Suchen hatte ich eine Tür gefunden, in deren Wachstafel diese Zahl eingeritzt war.
Ich stieß sie auf, betrat einen dämmrig beleuchteten, kreisrunden Raum – und wich einen Schritt zurück, als mich das weit aufgerissene Maul eines Wolfes begrüßte.
Unbehaglich musterte ich die steinerne Statue, die mittig im Raum stand und von zwei Öllampen, die nahe der Tür an den Wänden befestigt waren, erleuchtet wurde. Die Augen des hungrigen Wolfes erinnerten mich an den Mann, der seine Klinge in meine Hand gerammt hatte. Cameron. Mein Blick fiel auf den Sockel der Statue, fand Worte, die dort eingraviert waren. Ich beugte mich hinunter, entzifferte den Beginn der Verse des Lykaon-Mythos, wie Ovid ihn einst in seinen Metamorphosen verewigt hatte. Dieser handelte von einem arkadischen König, der es gewagt hatte, dem Göttervater Menschenfleisch als Speise vorzusetzen. Ich richtete mich wieder auf. Das war seine Bestrafung gewesen. Ein Opfer für ein Opfer.
Als ich an der Statue vorbeitrat und mich weiter in dem fensterlosen Raum umsah, entdeckte ich zu meiner Erleichterung tatsächlich meinen Koffer samt Rucksack auf einem schmalen Bett an der linken, mit einem farbenfrohen Fresko verzierten Wand des Zimmers.
Ehe ich zu meinem Gepäck eilen konnte, hörte ich jedoch plötzlich etwas. Meine Aufmerksamkeit schnellte zu einem Bett, das an der gegenüberliegenden Wand stand. Eine Frau mit knapp schulterlangem, schwarzem, von einer lilafarbenen Strähne durchzogenem Haar saß auf der Matratze, die Knie an die Brust gezogen, die Augen starr an die Wand gerichtet. Ihr Mund bewegte sich, doch ihre Worte waren leise, kaum vernehmbar. Zögerlich trat ich näher, bis ich sie verstehen konnte. Es waren nur zwei Worte, die immer wieder ihre Lippen verließen. Worte, die mir einen Schauer über den Rücken jagten.
»Memento mori.«
Mein Blick glitt hinunter, klebte erneut an dem blutigen A.
Ich presste eine Hand auf den Mund, biss in meine Haut, bis sich die ekelhafte Süße, die immer noch an meinen Lippen haftete, mit dem metallenen Geschmack nach Blut mischte.
»Memento mori.«
Bedenke, dass du sterben wirst.
Kapitel 4
In dieser Nacht hatte mich kein Schlaf gefunden. Stattdessen hatte ich auf dem Boden gekauert und unaufhörlich zwei Stricknadeln zwischen den Fingern gedreht, um meine Nervosität zu bekämpfen. Dank meiner Powerbank, die ich tief unten in meinem Koffer vergraben gefunden hatte, hatte ich mein Handy aufladen können, denn nach Steckdosen hatte ich in diesem Raum vergeblich gesucht. Ich musste jedoch bald feststellen, dass ich keinen Empfang hatte.
Die Frau, die auf dem Bett mir gegenübersaß, hatte inzwischen aufgehört, »Memento mori« zu murmeln und war stattdessen dazu übergegangen, die karierten Blätter ihres Collegeblocks mit unverständlichen Formeln zu füllen, hin und wieder unterbrochen durch ein unterdrücktes Fluchen. Sollte sie ähnlich überfordert mit dieser Situation sein wie ich, ließ sie sich das jedenfalls nicht anmerken. Mich ignorierte sie, doch das war mir egal. Ich war zu panisch, zu verwirrt, um Worte zu Sätzen zu formen, besonders gegenüber Fremden. Immer wieder fuhr mein Blick zu der Wolfsstatue, dann zu meiner Hand, an der getrocknetes Blut klebte. Irgendwann musste ich mir eingestehen, dass ich nicht träumte. Aber trotzdem musste es eine logische Erklärung für die letzten Stunden geben, irgendetwas, was verriet, warum man uns alle mit einer Art süßer Droge betäubt und in dieses fensterlose Gebäude verschleppt hatte.
Als ich es nicht mehr in diesem winzigen Zimmer aushielt und meine Armbanduhr sieben Uhr morgens anzeigte, schlüpfte ich hinaus auf den Gang. Ich trug immer noch meine schwarze Jeans, meinen grauen UCL-Pullover und meine dunkelblaue Jeansjacke, weil ich keinen Sinn darin gesehen hatte, mich umzuziehen.
Zögerlich betrat ich die Halle, in die der Gang mündete. Zuerst fiel mir das Tageslicht auf, das den Raum durch die Öffnung in der Kuppel flutete. Dann stellte ich fest, dass sich bereits einige andere hier herumtrieben, miteinander tuschelten und ratlos um einen halbmondförmigen, aus hellem Stein gefertigten Tisch herumliefen, der auf einmal inmitten des Statuenkreises aufgebaut worden war. Granatäpfel, geschnittenes dickes Brot, Oliven, Kannen gefüllt mit Wasser und Milch und in sorgsame Würfel geschnittener Schafskäse häuften sich auf dem Tisch.
Soweit ich das beurteilen konnte, hatte bisher niemand das Essen angerührt und auch ich traute ihm nicht über den Weg, nach allem, was letzte Nacht geschehen war.
»Haben wir keinen Hunger?« Eine junge Frau mit langem dunklem Haar, das zu einem Zopf geflochten war, trat aus einem Gang, über dem eine römische XV prangte. Sie trug ein in verschiedenen Grüntönen gemustertes, beinahe knöchellanges Kleid und eine farblich passende Brille, die viel zu groß für ihr zierliches Gesicht war. Daran, dass keine Verwirrung in ihrem Blick lag, erkannte ich, dass sie nicht zu uns gehörte, sondern zu jenen, die für all das verantwortlich waren.
»Was läuft hier?« Ein Mann hob seinen Arm hoch und deutete auf das A auf seinem Handrücken. Seiner Stimme wohnte ein leichter, italienisch klingender Akzent inne. »Ich dachte, das hier wäre eine verdammte Elite-Uni und kein Gefängnis.«
»Uni?« Ein auffällig blasser Mann, dessen Haar die Farbe von Kupfer hatte, sah sichtlich verwirrt aus. »Mir wurde gesagt, dass ich einen All-Inclusive-Wellness-Aufenthalt gewonnen hätte.«
»Wo sind die Kameras? Das muss doch irgendeine Aufzeichnung fürs Trash-TV sein«, ertönte eine hohe weibliche Stimme hinter mir.
Die grün gekleidete Frau wiegte den Kopf nachdenklich hin und her.
»Uni ja. Elite, darüber lässt sich streiten. Wellness? Leider nicht. Gefängnis?« Ein merkwürdiges Lächeln schlich sich auf ihre Lippen. »Sind wir nicht alle Gefangene dieser kapitalistischen, auf Leistung getrimmten Gesellschaft?« Sie faltete die Hände vor ihrem Körper, musterte uns einen nach dem anderen. »Ich sehe so viele Fragen in Ihren müden Augen.«
Eine blonde Frau trat einen Schritt nach vorn, die Finger um ein Smartphone gekrampft. »Warum gibt es in diesem Loch keinen Empfang? Und was ist mit WLAN? Steckdosen wären auch ganz nett.«
Die Frau in dem grünen Kleid hob eine Augenbraue. »Das ist gerade Ihre drängendste Frage?«
»Ja.«
»Warum findet man bei Google nichts zu diesem Ding?«, rief ein breitschultriger, ungewöhnlich großer Mann, der eben von einer Frau Aidan genannt worden war.
Das Lächeln der Fremden wurde breiter. »Weil wir nicht gefunden werden wollen.« Sie klatschte in die Hände. »So, das reicht fürs Erste. Sie können Ihren Tutor nachher mit Fragen löchern. Ich werde Ihnen nun stattdessen zeigen, wo Sie die nächsten drei Monate wachsen und gedeihen werden.« Sie strich unsichtbare Falten aus ihrem Kleid. »Eigentlich ist die erste Führung nicht meine Aufgabe, aber weil Mr Finnigan anscheinend noch seinen Schönheitsschlaf nachholen muss –«
»Reizend wie immer, Ms Thomson.«
Alle Blicke schnellten zu einem Mann, der die Halle unbemerkt betreten hatte. Er lehnte an einer weiblichen, mit Pfeil und Bogen bewaffneten Statue, die wahrscheinlich die Jagdgöttin Diana darstellen sollte. Ihre lebensechten Züge waren von bemerkenswerter Handarbeit. Aber es war nicht die Statue, die meine Aufmerksamkeit auf sich zog, sondern derjenige, der sich nun von ihr abstieß. Es war derselbe junge Mann, der die Betäubten letzte Nacht in diese Halle getragen und vor dem Altar abgelegt hatte. Der mir Antworten auf meine Fragen versprochen hatte. Sein dunkles Haar war wieder zurückgebunden, doch statt der schwarzen Kleidung der vergangenen Nacht trug er heute ein weißes Hemd und dunkelblaue Jeans.
»Ah, Kanan. Endlich. Willst du übernehmen?« Ms Thomson strahlte uns an. »Dieses Mal scheinen ziemlich viele Zweifler dabei zu sein.« Sie legte den Kopf schief und presste eine Hand auf ihre Brust. »Vertrauen Sie auf Ihr Herz, Hospites.«
Hospites? Warum hatte sie uns gerade »Wirte« genannt?
Der Mann – Mr Finnigan – ging zu dem gedeckten Tisch, nahm eine grüne Olive und steckte sie in den Mund.
»Es ist nicht vergiftet, falls das Ihre Sorge sein sollte.«
Thomson trat neben ihn und nahm das Brett, auf dem Schafskäse aufgehäuft war, an sich, genauso wie den Krug Milch. »Wie oft soll ich in der Küche noch erklären, dass tierische Produkte die Erderwärmung um ein Vielfaches –«
»Cass.«
»Aye?«
Finnigan packte die Frau behutsam an den Schultern und schob sie vom Tisch fort. »Du kannst deine tierischen Produkte später entführen. Ich würde behaupten, dass es gerade dringendere Angelegenheiten gibt.« Er warf uns einen flüchtigen Blick über die Schulter zu. »Mir werden gerade nicht wenige Todesblicke zugeworfen.«
»Schon gut, schon gut.« Thomson winkte fröhlich in unsere Richtung. »Wir sehen uns übermorgen in Ihrem ersten Geschichtsseminar.« Als Finnigan sie losließ, zwinkerte sie ihm zu. »Bonam fortunam.« Mit diesen Worten verschwand sie in dem Gang, aus dem sie gekommen war.
Ich starrte ihr einen Moment lang hinterher. Wofür hatte sie ihm Glück gewünscht?
Nachdenklich wandte ich mich Finnigan zu, der anscheinend etwas sagen wollte, doch dann wohl registrierte, dass die ersten Anwesenden schon wieder losgestürmt waren, um nach einem Ausgang zu suchen, während sich andere über versteckte Kameras unterhielten. Niemand schenkte ihm Aufmerksamkeit, bis seine dunkle Stimme plötzlich durch das Chaos schnitt.
»Sie haben Anfälle.«
Sofort verstummte jedes Gemurmel, jedes Gelächter, und selbst die, die schon fast in einem Gang verschwunden waren, hielten inne.
Finnigan hatte die Arme vor der Brust verschränkt und musterte uns einen nach dem anderen. Es schien, als versuchte er sich alle Gesichter genaustens einzuprägen. Schließlich begann er auf- und abzuschreiten, jede seiner Bewegungen langsam und bedächtig. Er glich einem Raubtier, das kurz davor war, sich auf seine Beute zu stürzen.
»Sie haben seit einigen Monaten das Gefühl, dass Sie immer wieder unfreiwillig in die Erinnerungen eines anderen eindringen. Sie hören Stimmen, deren Sprache Sie vielleicht noch nicht einmal verstehen. Vermutlich seit Beginn des Jahres, nicht wahr?« Allein Finnigans Schritte und seine Stimme hallten in der Halle wider. »Sie haben deshalb Probleme bekommen, seien sie privater oder beruflicher Natur. Weil Sie nie abschätzen können, wann die nächste Attacke über Sie hereinbrechen wird.«
Meine Finger gruben sich in meine Oberarme, während ich einen Blick in die Gesichter der übrigen Anwesenden riskierte. Cameron hatte letzte Nacht bereits erwähnt, dass er von meinen Anfällen wusste, doch nun sah ich, dass es jedem von ihnen genauso erging wie mir.
»Sie haben sich Antworten in therapeutischer Behandlung erhofft, aber keine zufriedenstellenden erhalten. Bis zum heutigen Tage fragen Sie sich, was mit Ihnen nicht stimmt, was sich seit Beginn des Jahres verändert hat. Was Sie tun können, um diese Anfälle zu vermeiden.« Finnigan hielt inne und warf uns einen fragenden Blick zu. »Liege ich ungefähr richtig?«
Die Totenstille, die nun in der Halle herrschte, war ihm anscheinend Antwort genug.
Ich hatte geglaubt, es wären Panikattacken. Dann hatte meine Therapeutin die Vermutung geäußert, dass es sich um etwas anderes handeln könnte, hatte versprochen, mir zu helfen.
Kurz darauf hatte McManus mir die Nachricht überbracht, dass er mich für ein Stipendium vorgeschlagen hatte.
Auf einmal schienen diese zwei Dinge miteinander verwoben zu sein.
Finnigan strich an uns vorbei.
»Nun, da ich Ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit habe, können wir mit unserem Rundgang beginnen. Folgen Sie mir bitte.« Er hob eine Hand, deutete auf den halbmondförmigen Tisch, der von den Statuen umrahmt wurde. »Frühstück, Mittag- und Abendessen werden hier gemeinsam eingenommen.« Er ging weiter, passierte einige der Gänge, die von der Halle abzweigten und deren Eingänge alle von je zwei schlanken Säulen flankiert wurden.
»Sie werden festgestellt haben, dass von dieser Halle, auch Atrium aeternitatis genannt, fünfzehn Gänge abzweigen.« Er sah sich kein einziges Mal zu uns um, doch das musste er auch nicht. Wir folgten ihm, gierig nach Antworten, nach einer Erklärung, warum Aeternitas Dinge über uns wusste, die niemand wissen durfte.
»Die Gänge folgen der Gliederung von Ovids fünfzehn Büchern der Metamorphosen, dem umfangreichsten Werk, das je zur römischen und griechischen Mythologie verfasst worden ist. Sie werden also in der Folge eine Darstellung der Mythen, die Ovid im ersten Buch der Metamorphosen niedergeschrieben hat, an den Wänden und in den Räumen des ersten Ganges finden.«
»Wer zum Geier ist Ovid?«, raunte jemand hinter mir.
»Einer der größten Dichter und Geschichtenerzähler, den die Welt je gesehen hat«, antwortete Finnigan, ohne sich umzudrehen. Es war mir schleierhaft, wie er das hatte verstehen können. »Viele Mythen kennen wir heute nur, weil Ovid sie einst niederschrieb, damit sie für alle Ewigkeit Bestand haben würden.«
Er machte eine ausschweifende Handbewegung und deutete auf all die Wandmalereien und Statuen um uns herum. »Die Fresken des Atriums sind anderen Werken gewidmet, wie Homers Odyssee und den Fabeln des Phaedrus.«
Wir bogen in Gang I ein. An den Wänden wurden die Augen des Argus von der Göttin Juno auf Pfauenfedern verbannt und die Nymphe Daphne in einen Lorbeerstrauch verwandelt, um sie vor Apollo zu schützen.
»Ist das hier eine geschlossene Anstalt?«, flüsterte jemand neben mir.
»Würde die fehlenden Ausgänge erklären«, entgegnete die blonde Frau, die immer noch verzweifelt auf ihrem Handy herumtippte.
»Sie werden bereits festgestellt haben, dass Ihre Zimmer momentan alle in Gang I liegen.« Finnigan zeigte auf die Wachstafeln, die an den Türen hingen, an denen wir vorbeigingen. »Zumindest fürs Erste. Im Laufe des Semesters werden sie Ihre Zimmer wechseln, werden in höhere Gänge aufsteigen, bis Sie Gang XV, in dem die Dozierenden untergebracht sind, erreicht haben. Wie schnell Sie das tun, hängt von Ihren Fortschritten ab.«
»Fortschritte in was?«, fragte jemand, doch Finnigan ignorierte ihn. Stattdessen zog er die letzte Tür, die ganz am Ende des Ganges auf uns wartete und im Gegensatz zu den seitlichen Türen keine Wachstafel aufwies, auf und bedeutete uns, ihm in den Raum zu folgen.
»Am Ende eines jeden Ganges befindet sich ein Cubiculum, eine Art Gemeinschaftsraum, in dem Sie arbeiten und sich mit Ihren Kommilitonen, die im selben Gang wohnen wie Sie, treffen können.«
Der Raum war bedeutend größer als das Zimmer, in dem ich die Nacht verbracht hatte, aber ebenso kreisrund. An den Wänden waren kupferfarbene Liegemöbel und niedrige Hocker aufgestellt, über denen lichtspendende Öllampen angebracht waren, hier und da gab es niedrige, schneeweiße Altäre, die entfernt an den Opferaltar im Atrium aeternitatis erinnerten. Aber es waren weder die Altäre noch die seltsamen Möbel, die mich in ihren Bann zogen, sondern etwas, was die Wand, die gegenüber der Tür lag, in Beschlag nahm.
Eine riesige Wandmalerei erstreckte sich über mehrere Fuß den Stein entlang. Sechzehn Frauen starrten uns entgegen, füllten das kunstvolle, mit prächtigen Farben gemalte Fresko aus. Sie alle hielten Becher in den Händen, als würden sie gemeinsam die Meditrinalia feiern, jenes antike Weinfest zu Ehren der altrömischen Heilgöttin Meditrina. Mein Blick huschte über ihre ausdruckstarken Gesichter, ordnete jedes Mythen zu, die ich größtenteils auch in meiner Bachelorarbeit behandelte. Diana, Daphne, Medea, Arachne und zahllose weitere, alle deutlich erkennbar anhand ihrer typischen Attribute. Einzig und allein eine Frau, die ganz rechts stand, konnte ich auf Anhieb keiner Mythengestalt zuordnen.
Ich war die Letzte, die den Raum verließ, weil ich meine Augen nur schwer von der Malerei lösen konnte.
Als Nächstes steuerte Finnigan Gang VII an und öffnete dort die erste Tür auf der linken Seite.
»Unsere Bibliothek.« Er bedeutete uns wieder, hinter ihm einzutreten.
»Die Bibliothek von Aeternitas ist der antiken römischen Bibliothek nachempfunden, die der Senator Plinius der Jüngere einst selbst in Auftrag gegeben hat. Wie Sie sehen können, ist sie dreigeteilt.« Er breitete die Arme aus, deutete auf weite Durchgänge, die rechts und links in die Wände des mittleren Raumes eingelassen waren, an dessen hinterer Wand sich zahllose Bücherregale entlangzogen. »In diesem Raum finden Sie lateinische Schriften, rechts dieselben in griechischer Sprache, links auf Englisch.«
Auf niedrigen, etwa kniehohen, steinernen Altären, die zwischen den Regalen an den Wänden standen, thronten Büsten verschiedenster römischer und griechischer Dichter und Literaten. Direkt in der Mitte des riesigen Raumes ruhte eine Büste des Ovid. Ich trat näher und beugte mich hinunter, um die Inschrift, die in den Sockel eingraviert war, entziffern zu können.
In nova fert animus mutatas dicere formas corpora.Publius Ovidius Naso.
Der erste Vers der Metamorphosen, der von Ovids Absicht kündete, über jene mythischen Kreaturen schreiben zu wollen, die sich in neue Körper verwandelt hatten. Es war das erste Mal, dass ich eine Büste des Ovid mit dieser Gravur sah.
»Vereinzelt haben wir auch deutsche, französische und spanische Übersetzungen der bedeutendsten Werke wie beispielsweise der Metamorphosen oder der Ilias. Fragen Sie gerne mich oder Ms Thomson, wenn Sie eine Übersetzung benötigen, die Sie hier nicht finden können.«
»Was soll der Scheiß?«, beschwerte sich ein stämmiger Mann mit kurzem schwarzem Haar, der an einer der beiden Eingangssäulen lehnte und die Bibliothek kaum betreten hatte. »Ich kann kein Wort Latein.«
»Dann werden Sie es nun lernen, Mr Williams«, erwiderte Finnigan, bevor er sich uns wieder zuwandte. »Ein Wort der Warnung. Halten Sie sich von dem Auguren fern, der sich hier irgendwo herumtreiben muss. Er hat die schlechte Angewohnheit, unsere Studierenden mit blutigen Vorhersagen zu verstören.«
»Alles andere hier ist auch überhaupt nicht verstörend«, raunte Aidan einem lockigen Mann zu, der neben mir stand. »Schrei, wenn du ne Kamera siehst, Brandon.«
»Wo kann man hier eine rauchen?«, rief jemand hinter mir.
Finnigan drehte sich noch nicht einmal um, während er uns aus der Bibliothek hinaus auf den Gang und zurück ins Atrium lotste. »Nirgendwo. Ihre Lunge wird es Ihnen danken.«
»Ich glaube, Sie wollten uns noch erklären, wieso wir hier sind und warum genau Sie Details unserer privaten Patientenakten kennen«, meldete sich Aidan wieder zu Wort. Er hatte seine Hände in den Taschen seiner weißen Baseballjacke vergraben, das blonde leicht lockige Haar klebte ihm in der Stirn.
Anstatt zu antworten, führte Finnigan uns in einen weiteren Gang, der mit einer IX gekennzeichnet war. Kurz darauf blieben wir vor einem gewaltigen Fresko stehen, das Hercules im Schein einer nahen Öllampe bei der Verrichtung der zwölf Aufgaben, die die Göttin Juno ihm auferlegt hatte, zeigte.
»Ich gehe davon aus, dass die Aufgaben des Hercules Ihnen allen ein Begriff sein dürften.« Finnigan schritt vor dem Fresko auf und ab. »Was war Hercules’ wichtigste Eigenschaft? Was zeichnete ihn aus? Weshalb musste er diese Aufgaben überhaupt verrichten?«
»Er konnte gut singen«, meldete sich jemand zu Wort.
Finnigan hob eine Augenbraue. »Das wäre mir neu. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass er ein Held von unglaublich jähzorniger Natur war.«
»Jähzornig? Der Typ war im Disney-Film doch total nett«, widersprach Aidan. »Und er hatte so witzige Ohren.«
Finnigan legte einen Zeigefinger zwischen seine Brauen und schloss für einen kurzen Moment die Augen. »Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ein Zeichentrickfilm hat sehr wenig mit der Realität gemeinsam, Mr Hunter.«
»Realität? Den Typen gab es doch nicht wirklich.«
Finnigan hatte gerade einen Arm ausgestreckt, um eine Hand an das Fresko zu legen, hielt jedoch mitten in der Bewegung inne. »Sein Name hat überdauert, nicht wahr? Ebenso seine Legende.« Ein befremdliches Lächeln stahl sich auf seine Lippen. »Was spricht dagegen, dass noch mehr von ihm überdauert haben könnte?«
»Sie scheinen gerne um den heißen Brei herumzureden«, brummte Aidan.
»Was wäre, wenn –« Ein Schrei verschluckte den Rest von Finnigans Satz.
Der Mann namens Brandon, der wenige Schritte von mir entfernt stand, beugte sich ruckartig nach vorn, ging in die Knie und wäre vermutlich hart auf dem Steinboden aufgeschlagen, hätte Finnigan ihn nicht in letzter Sekunde aufgefangen und sanft zu Boden gesetzt. Tränen rannen sein schmerzverzerrtes Gesicht hinunter, und er zitterte am ganzen Körper.
Ich kannte das nur zu gut, hatte es selbst mehrfach am eigenen Leib erlebt. Meine Finger krallten sich ineinander.
Er hatte einen Anfall.
Finnigan zog ein kleines, schwarz eingeschlagenes Notizbuch und einen Kugelschreiber aus seiner Hosentasche und notierte etwas darin. Minuten verstrichen, in denen er sich flüsternd mit Brandon unterhielt, bevor er sich schließlich wieder erhob. Seine Finger fanden das Fresko, an dem Brandon nun lehnte, und fuhren die Aufgaben des Hercules entlang.
»Was wäre, wenn jene Mythen über antike Götter, Helden und Ungeheuer, die Sie an all diesen Wänden sehen, eigentlich mit dem Zerfall des Römischen Reiches hätten sterben sollen? Wenn Mythen nur weiterleben können, solange man sie verehrt und ihrer gedenkt?« Finnigans Hand presste sich gegen das Fresko, dorthin, wo Zeus seinen Sohn Hercules vom Olymp herab beobachtete. »Was wäre, wenn es damals einen Geschichtenerzähler gegeben hätte, der Worte auf so eine außergewöhnliche Art und Weise miteinander verweben konnte, dass seine Verse selbst an die Ohren jener Wesen drangen, die dem menschlichen Auge stets verborgen bleiben sollten?«
Er trat zu einer abgeblätterten Stelle der Wandmalerei, während Brandons schwerer Atem die Stille zerschnitt.
»Was wäre, wenn die Mythen verhindern wollten, dass sie dasselbe Schicksal wie das Römische Reich ereilte? Wenn sie für die Ewigkeit bestehen bleiben wollten?«
Ewigkeit. Mein Blick wanderte zu dem A, das meinen rechten Handrücken zierte. Aeternitas.
Endlich wandte sich Finnigan von der Wand ab und musterte uns erneut. »Was wäre, wenn ebenjene mythische Kreaturen einen Dichter namens Ovid aufsuchten, um ihm mit ihren letzten Atemzügen ihre Geschichten zu erzählen? Wenn er jene Atemzüge zu Werken verwob, die die Ewigkeit überdauern sollten? Wenn er die Seelen der Mythologie unsterblich machte, nicht aber ihre Körper? Oder zumindest Überbleibsel jener Seelen, Relikte vergangener Zeiten? Relikte, die weitaus kostbarer waren, als es eine Statue, ein Fresko jemals sein könnte? Und die nun dazu verdammt waren, sich in menschlichen Körpern einzunisten, weil ihnen ihre eigenen geraubt worden waren?«
Etwas regte sich in meinem Gedächtnis.
Überbleibsel. Relictum.
Die Inschrift, die die Wachstafel an meiner Zimmertür zierte, drängte sich wieder nach vorn. Relictum ignotum.
Unbekanntes Überbleibsel.
»Was wäre, wenn der Preis für Unsterblichkeit höher ist, als Sie sich vorstellen können?« Er legte eine Hand auf Brandons Schulter, der immer noch schwer atmend an der Wand lehnte, das Fresko des Hercules in seinem Rücken. »Was, wenn die Erinnerungen, die Sie heimsuchen, Ihnen fremd erscheinen, weil sie nicht Ihnen gehören?«
»Wem sollen sie dann gehören?«, fragte Aidan.
Finnigan ließ Brandon los und verschränkte die Arme vor der Brust. »In Ihrem eigenen Interesse hoffe ich, dass mir jeder Einzelne von Ihnen in drei Monaten eine Antwort darauf geben wird.« Sein Blick glitt zurück zu der prächtig verzierten Wand, verharrte dort einen Moment lang. »Denn auch unsterblichen Seelen ist Ungeduld nicht fremd.«
Kapitel 5
Ohrenbetäubende Stille erfüllte das Atrium.
Plötzlich brach Aidan in grölendes Gelächter aus. Ein Moment verstrich, dann stimmten andere mit ein. Nur meine Lippen blieben geschlossen.
»Sorry, ich konnte nicht anders.« Er legte den Kopf in den Nacken und starrte an die Decke. »Also, wo sind hier die versteckten Kameras?«
Finnigan verzog keine Miene. »Gehen Sie sie suchen, Mr Hunter.« Er schritt an uns vorbei in die Halle. »Aber ich kann Ihnen versprechen, dass Sie nichts finden werden. Weder Kameras noch einen Ausgang. Und mit der Zeit werden Sie feststellen müssen, dass Sie in Aeternitas am meisten verstehen werden, wenn Sie aufhören, für alles eine logische Erklärung zu erwarten.«
Er hielt inne, als er den Opferaltar erreicht hatte, hinter dem immer noch ein Feuer loderte. Nachdenklich berührte er die Ablagefläche, die in unserem Blut getränkt war. »Ich war einst wie Sie. Vor vier Jahren stand ich dort, wo Sie heute stehen, mit denselben Fragen auf den Lippen. Ich habe Aeternitas auch kein Wort geglaubt.« Er zog seine Hand zurück. »Und ich habe teuer dafür bezahlt.«
»Also wollen Sie uns wirklich weismachen, dass auf der freaking Isle of Skye die Wiedergeburten von irgendwelchen Göttern leben?« Aidan breitete beide Arme aus, deutete theatralisch um sich. »Ist das hier die Wish-Version von Camp Half-Blood oder was?«
»Sie sind keine Wiedergeburten. Sie sind Hospites, menschliche Wirtinnen und Wirte. Wenn Sie sterben, wird sich Ihr Relictum, Ihre antike Seele, einen neuen Hospes suchen.« Finnigan schob seine Ärmel nach oben. »Aeternitas liegt auf Skye, weil die ersten Hospites der Weisheitsgöttin Minerva und des Titanen Prometheus, die immer noch als die mächtigsten Relicta gelten, sich für diese Insel entschieden haben. Sie wollten ins Exil, wie Ovid selbst einst ins Exil gegangen ist, um die Relikte des Vergangenen zu beschützen.«