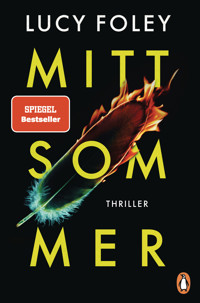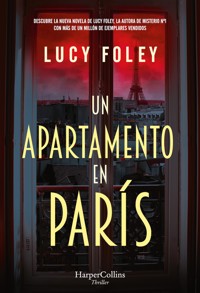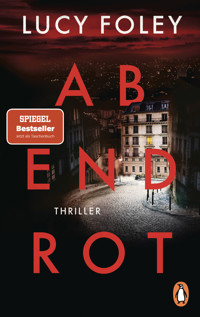
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Schweigsame Nachbarn. Verschlossene Türen. Tödliche Geheimnisse.
Der Spiegel-Bestseller jetzt als Taschenbuch.
Ein einsames Haus am Ende einer verwinkelten Seitengasse im Pariser Stadtviertel Montmartre: Pleite und nur mit einem einzigen Koffer in der Hand steht Jess vor der Tür ihres Bruders, der versprochen hat, sie für ein paar Wochen bei sich wohnen zu lassen. Doch sie findet seine Wohnung leer vor – es scheint, als habe er sie überstürzt verlassen. Die Nachbarn machen keinen Hehl daraus, dass Fremde in diesem Haus nicht willkommen sind. Je länger ihr Bruder verschwunden bleibt, desto mehr fühlt Jess sich beobachtet in dem alten Gebäude mit seinen geheimen Durchgängen und vielen verschlossenen Türen. Immer unerbittlicher wächst in ihr der Verdacht, dass dieser Ort ein schreckliches Geheimnis verbirgt. Und auch unter den Nachbarn suchen sich lang begrabene Feindseligkeiten ihren gefährlichen Weg ans Licht. Dann macht Jess eine unfassbare Entdeckung. Und die Situation im Haus eskaliert …
Nach ihren sensationellen Erfolgen »Neuschnee« und »Sommernacht« garantiert Bestsellerautorin Lucy Foley wieder atemlose Spannung.
Noch mehr atemlos Spannung von Bestsellerautorin Lucy Foley:
Neuschnee Sommernacht Mittsommer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ein einsames Haus am Ende einer verwinkelten Seitengasse im Pariser Stadtviertel Montmartre: Pleite und nur mit einem einzigen Koffer in der Hand steht Jess vor der Tür ihres Bruders, der versprochen hat, sie für ein paar Wochen bei sich wohnen zu lassen. Doch sie findet seine Wohnung leer vor – es scheint, als habe er sie überstürzt verlassen. Die Nachbarn machen keinen Hehl daraus, dass Fremde in diesem Haus nicht willkommen sind. Je länger ihr Bruder verschwunden bleibt, desto mehr fühlt Jess sich beobachtet in dem alten Gebäude mit seinen geheimen Durchgängen und vielen verschlossenen Türen. Immer unerbittlicher wächst in ihr der Verdacht, dass dieser Ort ein schreckliches Geheimnis verbirgt. Und auch unter den Nachbarn suchen sich lang begrabene Feindseligkeiten ihren gefährlichen Weg ans Licht. Dann macht Jess eine unfassbare Entdeckung. Und die Situation im Haus eskaliert …
LUCY FOLEY hat in der Verlagsbranche gearbeitet, bevor sie ihren großen Traum wahr machte und sich ganz dem Schreiben widmete. Ihre beiden Thriller Neuschnee und Sommernacht wurden zu riesigen internationalen Erfolgen und standen wochenlang auch auf der deutschen Bestsellerliste. Wenn sie nicht gerade mörderisch spannende Plots entwickelt, reist Lucy leidenschaftlich gern – zum Beispiel nach Paris. Ein Aufenthalt in einem alten Stadthaus in Montmartre inspirierte sie zu Abendrot. Lucy Foley lebt in London.
»Ein unglaubliches Zusammenspiel aus Spannung, falschen Fährten und unerwarteten Wendungen.« The Times
»Dieser Thriller hält Sie bis zum Schluss in Atem!« Daily Mail
»Ein absolut fesselndes Ratespiel.« Vogue
»Lucy Foley ist eine geborene Geschichtenerzählerin, und dies ist ihr bislang bestes Buch.« Chris Whitaker
»Die Twists sind grandios!« Ruth Ware
www.penguin-verlag.de
Lucy Foley
ABENDROT
Thriller
Aus dem Englischen von Ivana Marinović
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel The Paris Apartment bei HarperCollins, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2022 by Lost and Found Books Ltd
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Christine Neumann
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: www.buerosued.de
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28520-3V006
www.penguin-verlag.de
Für Al – für alles.
Prolog
Freitag
BEN
Seine Finger verharren über der Tastatur. Er muss alles niederschreiben. Das hier – das ist die Story, mit der er sich einen Namen machen wird. Ben zündet sich noch eine Zigarette an, eine Gitanes. Etwas klischeehaft, die hier zu rauchen, aber tatsächlich mag er den Geschmack. Und ja, na gut, er mag auch, wie er aussieht, wenn er sie raucht.
Er sitzt vor dem bodentiefen Appartementfenster mit Blick in den Hof. Abgesehen von dem matten grünlichen Schein, der von der einzigen Laterne ausgeht, ist alles in Finsternis getaucht. Es ist ein schönes Gebäude, doch in seinem Herzen birgt es etwas Verrottetes. Und nun, da er es entdeckt hat, kann er den fauligen Gestank überall riechen.
Bald schon sollte er seine Zelte hier abbrechen. Er hat sein Gastrecht in diesem Haus überstrapaziert. Jess hätte sich kaum einen schlimmeren Zeitpunkt aussuchen können, um zu Besuch zu kommen. Sie hat ihm praktisch keine Vorlaufzeit gelassen. Und sie hat am Telefon auch keine Einzelheiten genannt, aber da ist ganz klar was im Busch; irgendein Problem bei irgendeinem miesen Job in einer Bar, wo sie gerade arbeitet. Seine Halbschwester hat ein Talent dafür, genau dann aufzuschlagen, wenn sie nicht erwünscht ist. Sie ist wie ein wandelnder Magnet für Ärger; er scheint ihr überallhin zu folgen. Sie war eben noch nie gut darin, sich an die Regeln zu halten. Hat nie kapiert, um wie viel einfacher es das Leben macht, wenn man den Leuten gibt, was sie wollen, ihnen sagt, was sie zu hören wünschen. Zugegebenermaßen hat er ihr mal gesagt, sie könne vorbeikommen, »wann immer du willst«, aber er hat es nicht wirklich so gemeint. Ist ja klar, dass Jess ihn beim Wort nimmt.
Wann war das letzte Mal, dass er sie gesehen hat? Immer wenn er an sie denkt, fühlt er sich latent schuldig. Hätte er mehr für sie da sein sollen, auf sie achtgeben? Jess, sie ist zerbrechlich. Oder … nein, nicht unbedingt zerbrechlich, aber auf eine Art verletzlich, die den Leuten auf den ersten Blick entgeht. Ein »Armadillo« eben, ganz weich unter dem gut gepanzerten Äußeren.
Wie auch immer. Er sollte ihr die genaue Adresse durchgeben. Nachdem er ihren Kontakt angetippt hat, hinterlässt er eine Sprachnachricht: »Hey, Jess, also, es ist die Nummer zwölf, in der Rue des Amants. Alles klar? Zweite Etage.«
Sein Blick bleibt an einer huschenden Bewegung unten im Hof hängen. Jemand durchquert ihn eilig. Beinahe schon rennend. Er meint, eine Silhouette auszumachen, kann aber nicht erkennen, wer es ist. Dennoch, irgendwas an der Hast ist seltsam. Er verspürt ein winziges Aufwallen von Adrenalin.
Ihm fällt ein, dass er immer noch die Sprachnachricht aufnimmt, und löst den Blick vom Fenster. »Klingel einfach. Ich warte oben auf dich …«
Er bricht ab. Zögert, horcht.
Ein Geräusch.
Schritte im Flur … sie nähern sich der Wohnung.
Die Schritte verstummen. Jemand ist da draußen, direkt vor der Tür. Er wartet auf ein Klopfen. Es kommt keins. Stille. Wenn auch eine aufgeladene Stille, wie ein angehaltener Atemzug.
Merkwürdig.
Dann ein anderes Geräusch. Er steht reglos da, die Ohren gespitzt, angestrengt lauschend. Da ist es schon wieder. Metall auf Metall, das Scharren eines Schlüssels. Dann das Klackern, als er in den Schließmechanismus einrastet. Er nähert sich der Tür und kann sehen, wie der Zylinder sich dreht. Jemand schließt sie von außen auf. Jemand, der einen Schlüssel, aber hier nichts verloren hat.
Die Klinke senkt sich. Die Tür geht mit ihrem vertrauten lang gezogenen Ächzen auf.
Er legt sein Handy auf dem Küchentresen ab, die Sprachnachricht vergessen. Wartet und sieht stumm zu, wie die Tür nach innen aufschwingt. Wie die Gestalt den Raum betritt.
»Was tust du denn hier?«, fragt er. Ruhig, vernünftig. Nichts zu verstecken. Keine Angst. Oder zumindest noch nicht. »Und warum …?«
Da erst sieht er das Ding in der Hand.
Jetzt. Jetzt kommt die Angst.
Drei Stunden später
JESS
Herrgott noch mal, Ben. Jetzt geh schon an dein Handy. Ich friere mir hier draußen den Arsch ab. Mein Eurostar hatte bei der Abfahrt in London zwei Stunden Verspätung; ich hätte um halb elf ankommen sollen, aber jetzt ist schon nach Mitternacht. Und es ist kalt heute, hier in Paris noch kälter als daheim in London. Es ist erst Ende Oktober, aber mein Atem dampft in der Luft, und meine Zehen in den Chucks sind ganz taub. Verrückt, wenn man daran denkt, dass es erst vor ein paar Wochen eine Hitzewelle gab. Ich bräuchte mal eine ordentliche Jacke. Aber es gab schon immer einen Haufen Zeug, das ich brauchte und das ich nie bekommen werde.
Ich habe Ben jetzt wahrscheinlich schon zehnmal angerufen: erst als mein Eurostar einfuhr, dann auf dem halbstündigen Fußweg vom Gare du Nord hierher. Ging nicht ran. Und auch auf meine SMS hat er nicht geantwortet. Vielen Dank für nichts, großer Bruder.
Dabei hat er behauptet, er würde da sein, um mir die Tür aufzumachen. »Melde dich, wenn du da bist«, hieß es in seiner Sprachnachricht. »Klingel einfach.«
Tja, hier bin ich. Mit »hier« meine ich eine schummrig erleuchtete, kopfsteingepflasterte Sackgasse in einem richtig vornehmen Viertel. Das Wohngebäude vor mir befindet sich an ihrem Ende und steht ganz allein für sich da.
Ich werfe einen Blick hinter mich, die menschenleere Straße runter. Neben einem geparkten Wagen, etwa fünf, sechs Meter entfernt, meine ich, eine Bewegung im Schatten zu erkennen. Ich mache einen Schritt zur Seite, um besser zu sehen. Da ist doch … Ich spähe in die Dunkelheit. Ich könnte schwören, dass da jemand hinter dem Auto kauert.
Erschrocken zucke ich zusammen, als ein paar Straßen weiter eine Sirene die Stille der Nacht zerreißt. Lausche, während ihr Jaulen in der Nacht verebbt. Sie klingt anders als zu Hause – nieh-nah, nieh-nah, wie die Imitation eines Kindes –, trotzdem beschleunigt sie meinen Herzschlag.
Ich schaue wieder zu der dunklen Stelle hinter dem geparkten Auto. Nun kann ich keine Bewegung mehr ausmachen, noch nicht einmal die Gestalt, die ich zuvor meinte, gesehen zu haben. Vielleicht war es doch nur eine optische Täuschung.
Ich blicke wieder an dem Gebäude hoch. Die anderen Häuser in der Straße sind schon richtig schön, aber dieses hier schlägt sie um Längen. Es liegt ein Stück zurückversetzt, hinter einem großen Metalltor mit hohen Mauern zu beiden Seiten, die eine Art Garten oder Hof verbergen müssen. Erdgeschoss und vier Etagen zähle ich. Große, hohe Flügelfenster, allesamt mit schmiedeeisernen Balkonen davor. Üppig wuchernder Efeu erklimmt die Fassade; er sieht aus wie ein emporkriechender dunkler Fleck. Wenn ich den Hals verrenke, kann ich so was wie eine begrünte Dachterrasse ganz oben erkennen, die spitzen Wipfel von Bäumen und Büschen wie schwarze Schattenrisse vor dem Nachthimmel.
Ich überprüfe noch einmal die Adresse. Rue des Amants, Nummer zwölf. Ich bin definitiv richtig. Ich kann immer noch nicht ganz glauben, dass Ben in diesem schnieken Gebäude wohnt. Er meinte, dass er die Wohnung über einen Kumpel bekommen habe, irgendein Typ, den er noch aus Studententagen kennt. Ben wusste sich immer schon zu helfen. Da ist es nur logisch, dass er es mit seinem Charme geschafft hat, sich eine Bude wie diese anzulachen. Und Charme muss es gewesen sein. Mir ist schon klar, dass Journalisten mehr verdienen als Kellnerinnen, aber so viel mehr nun auch wieder nicht.
Das Tor vor mir verfügt über einen Löwenkopftürklopfer aus Messing; der dicke Metallring wird von gefletschten Zähnen gehalten. Der obere Rand des Tores, so bemerke ich, ist mit Kletterschutzstacheln gespickt. Und über die gesamte Länge der Mauern zu beiden Seiten des Tores sind Glasscherben eingelassen, die einen in Stücke reißen würden, sollte man versuchen rüberzuklettern. Diese Sicherheitsvorkehrungen wollen nicht so recht zu der Eleganz des Gebäudes passen.
Ich hebe den Klopfer an, kühl und schwer in meiner Hand, und lasse ihn fallen. Sein Scheppern hallt durch die Gasse – in der Stille noch viel lauter als erwartet. Tatsächlich ist es hier so ruhig und dunkel, dass nur schwer vorstellbar ist, dass diese Straße Teil derselben Stadt sein soll, durch die ich heute Nacht vom Gare du Nord hergelaufen bin, mit all ihren grellen Lichtern und Menschenmassen, den Leuten, die in und aus den Restaurants und Bistros strömten. Ich denke an die Gegend rund um die riesige erleuchtete Kathedrale auf dem Hügel oben – Sacré-Cœur –, an der ich vor keinen zwanzig Minuten vorbeigekommen bin, an die Touristentrauben, die Selfies schossen, die zwielichtigen Typen in Steppjacken, die gaunernd zwischen ihnen herumstreiften, allzeit bereit, den einen oder anderen Geldbeutel aus der Tasche zu fingern. Und an die Straßen und Boulevards mit den bunten Neonlichtern, die ich entlanggelaufen bin, die scheppernde Musik, die nächtlichen Imbisse, die Gruppen, die aus den Bars schwärmten, die Schlangen vor den Clubs. Das hier ist eine völlig andere Welt. Ich schaue erneut in die Gasse hinter mich – kein Mensch weit und breit. Das einzige Geräusch kommt vom Rascheln vertrockneter Efeublätter auf dem Kopfsteinpflaster. Ich kann das Röhren des Verkehrs in einiger Entfernung hören, das Hupen von Autos … aber selbst das scheint gedämpft, als würde es nicht wagen, in diese elegante, beinahe lautlose Welt einzudringen.
Ich dachte mir nicht viel dabei, als ich meinen Koffer vom Bahnhof durch die Stadt zog. Ich konzentrierte mich hauptsächlich darauf, nicht ausgeraubt zu werden, und darauf, dass das kaputte Rädchen meines Koffers nirgendwo stecken blieb und mich von den Füßen riss. Aber jetzt, zum ersten Mal eigentlich, kommt es bei mir an: Ich bin hier, in Paris. Eine andere Stadt, ein anderes Land. Ich habe es geschafft. Ich habe mein altes Leben hinter mir gelassen.
Ein Licht geht an in einem der Fenster über mir. Ich schaue hoch. Da steht eine dunkle Gestalt, Kopf und Schultern nur als Silhouette erkennbar. Ben? Obwohl, wenn er es wäre, würde er mir doch bestimmt zuwinken. Ich weiß, dass ich von der nahe gelegenen Straßenlaterne beleuchtet werde. Aber die Gestalt im Fenster ist so reglos wie eine Statue. Ich kann keine Gesichtszüge ausmachen, nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Aber die Person beobachtet mich. Kann gar nicht anders sein. Ich schätze mal, ich muss ziemlich schäbig und fehl am Platz aussehen mit meinem alten, zerbeulten Koffer, der trotz des Spanngurts drum herum zu bersten droht. Ein schräges Gefühl, zu wissen, dass jemand mich sehen kann, ich ihn aber nicht. Ich senke den Blick.
Aha. Da rechts neben dem Tor erblicke ich ein Klingelschild mit Knöpfen für die verschiedenen Wohnungen und einer eingelassenen Kameralinse. Der große Löwenkopfklopfer hängt wohl nur zu Showzwecken da. Ich trete vor und drücke die Klingel für die zweite Etage, wo Ben wohnt. Ich warte auf das Knistern seiner Stimme in der Gegensprechanlage.
Keine Antwort.
SOPHIE
Penthouse
Jemand klopft draußen ans Tor. So laut, dass Benoit, mein Silber-Whippet, aufspringt und losbellt.
»Arrête ça!«, rufe ich.
Benoit winselt leise, bevor er verstummt. Er schaut zu mir auf, da ist Verwirrung in seinen dunklen Augen. Ich kann den Missklang in meiner Stimme ebenfalls wahrnehmen – zu schrill, zu laut. Und ich kann meine eigene raue, flache Atmung in der darauf folgenden Stille hören.
Niemand benutzt je den Klopfer. Und ganz gewiss niemand, der mit diesem Gebäude vertraut ist. Ich gehe zu den Fenstern, die zum Hof hinausblicken. Zwar kann ich von hier aus nicht auf die Straße sehen, aber das Eingangstor führt direkt in den Hof – wenn also jemand hereingekommen wäre, würde ich ihn entdecken. Aber niemand ist eingetreten, dabei ist das Klopfen ein paar Minuten her. Ganz offenbar handelt es sich nicht um eine Person, von der die Concierge meint, dass sie ins Haus solle. Gut. Von mir aus. Ich konnte die Frau zwar nicht immer leiden, aber zumindest was das angeht, weiß ich, dass auf sie Verlass ist.
In Paris kann man noch im luxuriösesten Appartement wohnen, doch der Abschaum der Stadt wird einem zuweilen trotzdem vor die Tür gespült. Die Drogensüchtigen, die Landstreicher. Die Huren. Pigalle, das Rotlicht-Viertel, ist nur einen Katzensprung entfernt, wo es sich an die Rockzipfel vom Montmartre klammert. Hier oben, in dieser millionenschweren Festung mit ihrem Ausblick über die Dächer der Stadt bis hin zum Eiffelturm, habe ich mich stets vergleichsweise sicher gefühlt. Ich bin durchaus in der Lage, den Dreck unter dem Goldüberzug zu ignorieren. Ich bin gut darin, mich blind zu stellen. Normalerweise. Aber heute Nacht ist es … anders.
Ich gehe in den Flur, um einen Blick in den Spiegel zu werfen. Ich achte sehr darauf, was ich darin zu sehen bekomme. Nicht übel für fünfzig. Teils liegt es daran, dass ich mir die französische Art angewöhnt habe, wenn es darum geht, auf meine ligne zu achten. Was mehr oder weniger gleichbedeutend ist mit ständig hungrig zu sein. Ich weiß, dass ich selbst zu dieser Uhrzeit makellos aussehen werde. Mein Lippenstift sitzt einwandfrei. Ich verlasse die Wohnung nie, ohne ihn aufzutragen. Chanels »La Somptueuse« – mein Markenzeichen. Ein königlicher Rotton mit einem Stich ins Blaue, der eher sagt: »Nimm dich in Acht«, als eine verführerische Einladung auszusprechen. Mein Haar ist zu einem tief glänzenden schwarzen Bob frisiert, der alle sechs Wochen von David Mallet an der Notre-Dame-des-Victoires nachgeschnitten wird. Die Kanten akkurat, jegliche Spuren von Silber penibel übertüncht. Jacques, mein Mann, hatte mal recht unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er Frauen verabscheue, die sich ab einem gewissen Alter erlauben, die Haare grau stehen zu lassen. Obwohl er nicht oft da war, um meine zu bewundern.
Ich trage das, was ich als meine tägliche Uniform betrachte. Meine Rüstung. Seidene Equipment-Bluse, tadellos geschnittene schmale Zigarettenhose. Dazu ein Tuch aus gemusterter Hermès-Seide um den Hals, was ganz hervorragend geeignet ist, um jegliche verheerenden Spuren der Zeit an der empfindlichen Haut dort zu verbergen. Es ist ein recht neues Geschenk von Jacques mit seiner Liebe zu schönen Dingen. So wie diese Wohnung hier. So wie ich – zumindest so wie ich war, bevor ich die Unverfrorenheit besaß zu altern.
Makellos. Wie eh und je. Wie erwartet. Und doch fühle ich mich schmutzig. Befleckt von dem, was ich heute Nacht habe tun müssen. Meine Augen im Glas des Spiegels glitzern. Das einzige Zeichen. Obgleich auch mein Gesicht ein wenig hager ist – wenn man denn ganz genau hinsähe. Ich bin noch dünner als sonst. In letzter Zeit musste ich nicht auf meine Ernährung achten, musste nicht gewissenhaft jedes Glas Wein und jeden Happen Croissant abzählen. Ich könnte nicht mal sagen, was ich heute Morgen zum Frühstück hatte … ob ich überhaupt daran gedacht habe, etwas zu essen. Mit jedem Tag sitzt mein Bund lockerer, treten die Knochen meines Brustbeins schärfer hervor.
Ich löse mein Halstuch. Ich kann einen Seidenschal so gekonnt knoten wie jede gebürtige Pariserin. Daran erkennt man mich als eine von ihnen, eine von diesen stilbewussten, vermögenden Frauen mit ihren kleinen Hunden und der exzellenten Erziehung.
Ich betrachte noch einmal die SMS, die ich Jacques gestern Abend geschickt habe. Bonne nuit, mon amour. Tout est bien ici. Gute Nacht, Liebster. Hier ist alles gut.
Hier ist alles gut. Dass ich nicht lache.
Ich weiß nicht, wie es zu alledem kommen konnte. Was ich jedoch weiß, ist, dass alles damit anfing, dass er herkam. In die zweite Etage zog. Benjamin Daniels. Er hat alles ruiniert.
JESS
Ich ziehe mein Handy hervor. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, hatte Ben auf keine meiner Nachrichten geantwortet. Eine aus dem Eurostar: Bin unterwegs! Und dann: Am Gare du Nord! Hast du einen Uber-Account?!!! Nur für den Fall, dass er sich plötzlich spendabel genug fühlen sollte, mir ein Taxi vorbeizuschicken. Schien mir einen Versuch wert.
Da ist eine neue Nachricht auf meinem Handy. Nur dass sie nicht von Ben ist.
Du dumme kleine Schlampe. Denkst wohl, du kannst einfach so davonkommen?
Scheiße. Ich schlucke gegen die plötzliche Trockenheit in meiner Kehle an. Blockiere die Nummer.
Wie bereits gesagt, herzukommen war eine recht kurzfristige Aktion. Ben klang nicht begeistert, als ich ihn heute anrief und verkündete, ich sei unterwegs. Stimmt schon, ich habe ihm nicht viel Zeit gelassen, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Andererseits hatte ich schon immer das Gefühl, dass unsere familiären Bande für mich wichtiger sind als für meinen Halbbruder. Letztes Weihnachten schlug ich vor, zusammen abzuhängen, aber er meinte, er sei eingespannt. »Ski fahren«, sagte er. Hatte ja keine Ahnung, dass er überhaupt Ski fahren kann. Manchmal kommt es mir sogar vor, als wäre ich ihm peinlich. Ich stehe für die Vergangenheit, und er wäre das alles gerne los.
Ich musste ihm also erklären, dass ich verzweifelt bin. »Hoffentlich nur für ein, zwei Monate, und ich komme auch für mich selbst auf«, versprach ich. »Sobald ich Fuß gefasst habe, suche ich mir einen Job.« Oh, ja. Einen, wo sie nicht allzu viele Fragen stellen. So landet man in den Spelunken, in denen ich auch bisher gearbeitet habe – gibt eben nicht viele Läden, die einen nehmen, wenn die Referenzen so mies sind.
Bis zu diesem Nachmittag war ich in der Copacabana-Bar in Brighton angestellt gewesen. Das eine oder andere üppige Trinkgeld machte alles wett. Meist von einem Haufen Banker-Trottel aus, sagen wir mal, London, die die anstehende Hochzeit eines Dick, Harry oder Tobias feierten und zu besoffen waren, um die Scheine richtig abzuzählen – entweder das oder aber für solche Typen ohnehin nur lästiges Kleingeld. Wie auch immer, jedenfalls bin ich seit heute arbeitslos. Wieder mal.
Ich drücke erneut den Klingelknopf. Keine Reaktion. Sämtliche Fenster im Haus sind dunkel, selbst jenes, das erleuchtet war. Herrgott noch mal. Er kann sich doch nicht aufs Ohr gehauen und mich komplett vergessen haben … oder doch?
Unter all den anderen Klingelschildchen ist eines abgesetzt: Concierge, steht da in geschwungener Gravur. Wie in so einem feinen Hotel – ein weiterer Beweis, dass es sich hier um ein echt exklusives Wohnhaus handelt. Ich drücke die Klingel, warte. Nichts. Aber ich kann mir nicht helfen: Ich sehe förmlich vor mir, wie jemand sich über die Kameralinse die kleine Videoaufnahme von mir anschaut, mich abschätzt und dann beschließt, nicht aufzumachen.
Also hebe ich noch einmal den schweren Klopfer und donnere mehrmals damit gegen das Tor. Die Schläge hallen noch lauter als zuvor – jemand muss es doch hören. Ich jedenfalls höre einen Hund irgendwo im Inneren des Hauses kläffen.
Ich warte fünf Minuten. Niemand kommt.
Scheiße.
Ich kann mir kein Hotel leisten. Ich habe nicht genug für ein Rückfahrticket nach London, und selbst wenn, ist es völlig ausgeschlossen, dass ich zurückkehre. Ich gehe meine Optionen durch. Mich in eine Bar hocken, abwarten?
Da höre ich hinter mir Schritte hohl über das Kopfsteinpflaster klackern. Ben? Ich wirble herum in der Erwartung, dass er sich gleich entschuldigt, mir sagt, dass er nur kurz los ist, um Kippen zu holen oder so. Aber der Kerl, der auf mich zukommt, ist nicht mein Bruder. Er ist zu groß, zu stämmig, hat eine Kapuze mit Pelzbesatz über den Kopf gezogen. Er bewegt sich rasch, und da ist etwas Entschlossenes in seinem Gang. Ich packe den Griff meines Koffers etwas fester. Darin befindet sich buchstäblich alles, was ich besitze.
Er ist nur noch wenige Meter entfernt, so nah, dass ich im Schein der Straßenlaterne das Schimmern seiner Augen unter der Kapuze ausmachen kann. Er greift in seine Jackentasche, zieht seine Hand wieder hervor. Unwillkürlich weiche ich einen Schritt zurück. Und nun sehe ich es: etwas Metallenes, das in seiner Hand aufblitzt.
DIE CONCIERGE
Loge
Ich betrachte sie über den Bildschirm der Gegensprechanlage, die Fremde am Tor. Was mag sie hier wollen? Sie klingelt schon wieder. Sie muss sich verirrt haben. Allein ihr Anblick sagt mir, dass sie hier nichts verloren hat. Nur, dass sie selbst überzeugt scheint, dass sie hierher will, so entschlossen, wie sie ist. Jetzt blickt sie in die Kameralinse. Ich werde sie nicht reinlassen. Ich darf nicht.
Ich bin die Pförtnerin dieses Gebäudes, hier in meiner loge sitzend, einem winzigen Anbau in der Ecke des Hofs, der wahrscheinlich zwanzigmal in die Wohnungen über mir passen würde. Aber es ist immerhin meins. Mein privater Rückzugsraum. Mein Heim. Die meisten Menschen würden es nicht mal eines Namens wert erachten. Wenn ich auf dem Klappbett sitze, kann ich beinahe alle Ecken des Raumes berühren. Feuchtigkeit steigt vom Boden auf und kriecht von der Decke herab, die Fenster halten die Kälte nicht draußen. Aber es verfügt über vier Wände. Da ist Platz, um meine Fotografien aufzustellen, mit ihren Echos eines einst gelebten Lebens; all die kleine Relikte, die ich gesammelt habe und an denen ich mich festhalte, wenn ich mich am einsamsten fühle; die Blumen, die ich hin und wieder morgens im Hof pflücke, damit etwas Frisches und Lebendiges sich hier drin befindet. Dieser Ort vermittelt, trotz all seiner Mängel, Sicherheit. Ohne ihn habe ich gar nichts.
Wieder betrachte ich das Gesicht auf dem Monitor. Als die Laterne es in ihr Licht taucht, erkenne ich eine Ähnlichkeit: die scharfe Kontur der Nase und des Kiefers. Aber mehr noch als ihr Äußeres ist es etwas an der Art, wie sie sich bewegt, sich umschaut. Ein hungriger, gerissener Zug, der mich an jemand Bestimmtes erinnert. Erst recht ein Grund, sie nicht reinzulassen. Ich mag keine Fremden. Ich mag keine Veränderung. Veränderungen waren immer gefährlich für mich. Er selbst hat das bewiesen – indem er hierherkam mit seinen Fragen, seinem Charme. Der Mann, der in das Appartement in der zweiten Etage zog: Benjamin Daniels. Nachdem er herkam, wurde alles anders.
JESS
Er kommt direkt auf mich zu, der Typ in dem Parka. Er hebt den Arm. Das Metall der Klinge blitzt wieder auf. Scheiße. Ich will mich gerade umdrehen und losrennen, mir wenigstens ein paar Meter Vorsprung verschaffen …
Aber halt, nein, nein … Jetzt erst sehe ich, dass das Ding in seiner Hand kein Messer ist. Es ist ein iPhone in seinem Metallgehäuse. Ich stoße die Luft aus, die ich angehalten habe, und stütze mich, von einer plötzlichen Woge der Müdigkeit übermannt, auf meinen Koffer. Ich bin schon den ganzen Tag überspannt, kein Wunder, dass ich vor jedem Schatten erschrecke.
Ich sehe zu, als der Typ jemanden anruft, und kann eine leise blecherne Stimme am anderen Ende vernehmen – eine Frauenstimme, glaube ich. Dann beginnt er zu reden, übertönt sie, lauter und lauter, bis er in sein Headset brüllt. Ich habe keine Ahnung, was genau die Wörter bedeuten, aber ich muss nicht viel Französisch können, um zu verstehen, dass es sich nicht um höfliches Geplänkel handelt.
Nachdem er seine wutentbrannte Ansprache losgeworden ist, legt er auf und schiebt ungehalten das Handy in seine Jackentasche zurück. Dann spuckt er ein einzelnes Wort aus: »Putain.«
Das kenne ich nun doch. Ich habe zwar bei meiner Mittleren Reife in Französisch nur mit einem »ausreichend« abgeschnitten, aber dafür habe ich irgendwann mal sämtliche Schimpfwörter nachgeschlagen und bin gut darin, mir Zeug zu merken, das mich interessiert. Nutte. Das bedeutet es.
Jetzt dreht er sich um und steuert wieder in meine Richtung. Ich kapiere, dass er bloß das Eingangstor zu dem Gebäude nutzen will. Ich trete beiseite und komme mir total albern vor, weil ich so überreagiert habe. Aber es ist nur logisch – ich habe praktisch die gesamte Eurostar-Fahrt damit verbracht, über meine Schulter zu schauen. Nur für den Fall.
»Bonsoir«, sage ich mit meinem besten Akzent und werfe ihm mein strahlendstes Lächeln zu. Vielleicht lässt dieser Typ mich ja rein, und ich kann hoch in den zweiten Stock, um an Bens Wohnungstür zu klopfen. Vielleicht funktioniert bloß seine Klingel nicht oder so.
Der Typ antwortet nicht. Er wendet sich nur der kleinen Tastatur neben dem Tor zu und hämmert vier Zahlen ein. Endlich bedenkt er mich mit einem flüchtigen Blick über die Schulter. Es ist definitiv nicht der freundlichste Blick. Ich erhasche einen Schwall seiner Alkoholfahne, schal und säuerlich. Der gleiche Atem wie bei den meisten Gästen im Copacabana.
Ich lächle erneut. »Ähm … Excusez-moi? Bitte, ähm … ich brauche Hilfe, ich suche meinen Bruder, Ben. Benjamin Daniels …«
Ich wünschte, ich hätte etwas mehr von Bens Gespür, seinem Charme. »Benjamin Silberzunge«, nannte Mum ihn ganz früher. Er hatte immer schon die Gabe, jedermann dazu zu bringen, das zu tun, was er wollte. Vielleicht ist er deswegen als Journalist in Paris gelandet, während ich in Brighton für einen Kerl mit dem liebevollen Kosenamen »der Perversling« Bier ausschenken musste, und das in einer miesen Spelunke, wo ich an den Wochenenden Junggesellenabschiede bediente und während der Woche das Gesindel aus dem Viertel.
Der Typ dreht sich langsam zu mir um. »Benjamin Daniels«, sagt er. Es ist keine Frage, nur der Name, den er wiederholt. Ich meine etwas in seiner Miene zu erkennen: Wut, oder vielleicht auch Angst. Er weiß, wen ich meine. »Benjamin Daniels ist nicht hier.«
»Wie meinen Sie das, er ist nicht hier? Das ist die Adresse, die er mir gegeben hat. Er wohnt im zweiten Stock. Ich kann ihn nicht erreichen.«
Der Mann kehrt mir den Rücken zu. Ich betrachte ihn, als er das Tor aufschiebt. Endlich dreht er sich zu mir um, ein drittes Mal, und ich denke: Vielleicht wird er mir ja doch noch helfen. Dann sagt er sehr langsam und sehr laut: »Verpiss dich hier, kleines Mädchen.«
Bevor ich dazu komme, etwas zu erwidern, scheppert es, und ich mache erschrocken einen Satz rückwärts. Er hat mir das Tor direkt vor der Nase zugeknallt. Als das metallene Echo verhallt, bleibe ich allein mit dem Geräusch meines schnellen, lauten Atems zurück.
Trotzdem, er hat mir geholfen – auch wenn er es nicht weiß. Ich warte noch einen Augenblick, werfe rasch einen Blick die Straße runter, dann hebe ich die Hand an die Tastatur und tippe dieselben Zahlen ein, die ich ihn erst vor wenigen Sekunden habe benutzen sehen: 7561. Bingo – das kleine Lämpchen leuchtet grün auf, und ich höre, wie sich der Riegel des Tores mit einem Klack öffnet. Meinen Koffer hinter mir herziehend, schlüpfe ich hindurch.
MIMI
Dritte Etage
Merde.
Ich habe doch gerade seinen Namen gehört, da draußen in der Nacht. Ich hebe den Kopf, lausche. Aus irgendeinem Grund liege ich auf der Bettdecke, nicht darunter. Mein Haar ist feucht, das Kissen klamm und durchweicht. Ich fröstle.
Höre ich das wirklich? Habe ich es mir eingebildet? Sein Name … der mir überallhin folgt?
Nein – ich bin mir sicher, dass es real war. Eine Frauenstimme, die durch mein geöffnetes Schlafzimmerfenster wehte. Irgendwie habe ich sie über die drei Stockwerke hinweg vernommen. Irgendwie habe ich sie durch das tosende weiße Rauschen in meinem Kopf gehört.
Wer ist sie? Warum fragt sie nach ihm?
Ich setze mich auf, ziehe meine knochigen Knie an meine Brust und greife nach meinem Kindheits-doudou: Monsieur Gus, ein abgewetzter alter Plüsch-Pinguin, den ich immer noch neben meinen Kopfkissen aufbewahre. Ich drücke ihn gegen mein Gesicht, um mich mit dem Gefühl seines harten kleinen Kopfs, der weichen, sich verschiebenden Böhnchen in seinem Körper und seinem muffigen Geruch zu trösten. Genau wie ich es tat, wenn ich als kleines Mädchen schlecht geträumt hatte. Du bist nicht länger ein kleines Mädchen, Mimi. Das hat er gesagt. Ben.
Der Mond scheint so hell, dass mein gesamtes Zimmer in ein kühles blaues Licht getaucht wird. Beinahe Vollmond. In der Ecke kann ich meinen Plattenspieler ausmachen, die Kiste mit den Vinylalben daneben. Ich habe die Wände in einem so dunklen, schwärzlichen Lila gestrichen, dass sie keinerlei Licht reflektieren, doch das Poster, das mir gegenüber hängt, scheint zu glühen. Es ist eine Fotografie von Cindy Sherman; ich habe mir ihre Ausstellung letztes Jahr im Centre Pompidou angeschaut. Seitdem bin ich völlig fasziniert davon, wie roh, wie abgedreht und intensiv ihre Arbeiten sind – es ist das, was auch ich mit meiner Malerei rüberzubringen versuche. Auf dem Poster – Untitled Film Still #3 – trägt sie eine kurze schwarze Perücke und starrt einen an, als sei sie besessen oder als stünde sie davor, die Seele des Betrachters zu verschlingen. »Putain!«, meinte meine Mitbewohnerin Camille lachend, als sie es sah. »Was, wenn du einen Typen mit nach Hause bringst? Wird er sich diese krasse Furie anschauen müssen, während ihr es treibt? Das wird ihn bloß aus dem Rhythmus bringen.« Schön wär’s, dachte ich damals. Zwanzig Jahre und immer noch Jungfrau. Nein, schlimmer. Eine Jungfrau aus der Klosterschule.
Ich betrachte Cindy, die dunklen Schatten unter ihren Augen wie Blutergüsse, das ausgefranste Haar, das meinem gar nicht so unähnlich ist, seit ich es mir mit einer Schere vorgeknöpft habe. Es ist, wie in einen Spiegel zu schauen.
Ich wende mich zum Fenster, blicke in den Hof runter. Das Licht im Kabuff der Concierge ist an. Natürlich – der neugierige alte Drachen ist sich für nichts zu schade. Ständig taucht sie aus irgendwelchen dunklen Ecken auf. Immer auf dem Beobachtungsposten, immer da, schaut sie einen an, als würde sie alle deine Geheimnisse kennen.
Das Gebäude formt ein U um den Hof. Mein Schlafzimmer befindet sich an dem einen Ende davon, sodass ich, wenn ich schräg nach unten schaue, in seine Wohnung sehen kann. Die letzten zwei Monate saß er beinahe jeden Abend dort, an seinem Schreibtisch, und arbeitete bis spät in die Nacht, alle Lichter an. Nur ganz kurz erlaube ich mir hinzusehen. Die Fensterläden sind geöffnet, doch das Licht ist aus, und der Raum hinter dem Schreibtisch wirkt mehr als nur leer – so, als verfüge die Leere über eine eigene Form von Tiefe und Gewicht. Ich schaue wieder weg.
Ich gleite von meinem Bett und gehe auf Zehenspitzen durch den Flur ins Wohnzimmer, wobei ich versuche, nicht über das ganze Zeug zu stolpern, das Camille überall herumliegen lässt, als wäre es eine Erweiterung ihres Schlafzimmers: Zeitschriften und achtlos fallen gelassene Pullover, schmutzige Kaffeetassen, Nagellackfläschchen, Spitzen-BHs. Von dem großen Fenster hier habe ich einen direkten Blick auf den Hofeingang. Ich sehe, wie das Tor sich öffnet. Eine schattenhafte Gestalt schlüpft durch den Spalt. Als sie in das Licht der Laterne tritt, erkenne ich sie besser: eine Frau, die ich noch nie hier gesehen habe. Nein, sage ich stumm. Nein, nein, nein, nein, nein. Geh weg. Das Tosen in meinem Kopf wird lauter.
»Hast du auch das Klopfen gehört?«
Ich wirble herum. Putain, Mist! Camille fläzt mit glimmender Zigarette in der Hand auf dem Sofa, die Stiefeletten auf der Armlehne abgelegt – falsches Schlangenleder mit Zwölf-Zentimeter-Absätzen. Wann ist sie heimgekommen? Wie lange liegt sie schon dort im Dunkeln?
»Ich dachte, du wärst aus?«, sage ich. Normalerweise, wenn sie durch die Clubs zieht, bleibt sie bis zum Morgengrauen weg.
»Oui.« Sie zuckt die Achseln, nimmt einen Zug von ihrer Kippe. »Ich bin erst seit zwanzig Minuten zurück.« Selbst in dem spärlichen Licht kann ich sehen, wie ihr Blick von mir abgleitet. Normalerweise würde sie direkt zu einer Anekdote über irgendeinen neuen Club ansetzen, in dem sie war, oder einen Typen, dessen Bett sie gerade erst verlassen hat – einschließlich einer viel zu detaillierten Beschreibung seines Schwanzes beziehungsweise seiner Fähigkeiten in der Benutzung desselben. Ich habe oft das Gefühl, dass ich stellvertretend durch Camille lebe. Dankbar, dass jemand wie sie sich überhaupt dafür entschieden hatte, mit mir abzuhängen. Als wir uns an der Sorbonne kennenlernten, erzählte sie mir, dass sie gerne Menschen sammle, behauptete, dass sie mich interessant fand, weil ich diese »krasse Energie« hätte. An meinen schlechteren Tagen vermute ich jedoch, dass diese Wohnung hier mehr damit zu tun hat.
»Wo warst du denn?«, frage ich, wobei ich versuche, halbwegs normal zu klingen.
Sie zuckt die Achseln. »Hier und da.«
Ich habe den Eindruck, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt, etwas, das sie mir nicht verraten will. Aber im Moment kann ich nicht über Camille nachdenken. Das Tosen in meinem Kopf scheint alle meine Gedanken zu übertönen.
Es gibt da nur eine Sache, die ich weiß: Alles, was hier geschehen ist, geschah wegen ihm – Benjamin Daniels.
JESS
Ich stehe in einem kleinen, dunklen Hof. Das Wohnhaus schließt es von drei Seiten regelrecht ein. Der Efeu hier wuchert wie wild und rankt sich beinahe bis zum vierten Stock hoch, wobei er sämtliche Fenster umgibt und die Regenrinnen verschluckt, sogar die zwei Satellitenschüsseln. Vor mir windet sich ein kurzer Weg zwischen mit dunklen Hecken und Bäumen bepflanzten Beeten hindurch. Ich kann den süßlichen Geruch welker Blätter riechen, frisch umgegrabene Erde. Zu meiner Rechten befindet sich eine Art Anbau, kaum größer als ein Gartenschuppen. Die zwei Fenster scheinen mit Holzläden verschlossen; auf einer Seite stiehlt sich ein winziger Lichtspalt durch eine Ritze.
In der Ecke gegenüber mache ich eine Tür aus, die ins Hauptgebäude führen muss. Die steuere ich an. Als ich losgehe, taucht in der Finsternis rechts von mir urplötzlich ein bleiches Gesicht auf. Ich bleibe wie angewurzelt stehen. Aber es ist nur die Statue einer nackten Frau, lebensgroß, ihr Leib von noch mehr schwarzem Efeu umschlungen, ihre Augen starr und leer.
Die Tür in der Ecke hat ebenfalls ein Codeschloss, aber sie lässt sich problemlos mit derselben Zahlenfolge öffnen – Gott sei Dank. Ich schiebe sie auf und trete in einen dunklen, hallenden Raum. Eine Treppe schwingt sich in noch schwärzere Finsternis empor. Ich entdecke das orangefarbene Glimmen eines Lichtschalters an der Wand und knipse ihn an. Summend erwachen die trüben Lampen zum Leben. Dann ein Ticken – irgendeine Stromsparvorrichtung vielleicht. Jetzt kann ich den dunkelroten Teppich unter meinen Füßen sehen, der einen steinernen Fliesenboden bedeckt und sich die polierte Holztreppe hochzieht. Über mir windet sich das Geländer schneckenartig in die Höhe, und in seiner Mitte befindet sich ein Aufzugschacht – eine winzige, klapprige Kabine, die wohl so alt sein muss wie das Haus selbst. Überhaupt sieht der Lift so in die Jahre gekommen aus, dass ich mich frage, ob er noch in Betrieb ist. Kalter Zigarettengeruch hängt in der Luft. Trotzdem ist alles sehr gepflegt und sehr weit weg von der Bruchbude in Brighton, in der ich bis heute gehaust habe.
Rechts von mir scheint sich eine Erdgeschosswohnung zu befinden, links erblicke ich eine weitere Tür: Cave steht drauf. Einer verschlossenen Tür habe ich noch nie lang widerstehen können – ich schätze, man könnte auch sagen, dass dies das Hauptproblem in meinem Leben war und ist. Ich schiebe sie auf und erblicke ein paar Stufen, die abwärtsführen. Ein Schwall Kellerluft schlägt mir entgegen. Feucht und modrig.
Da höre ich ein Geräusch irgendwo über mir. Das Knarzen von Holz. Ich lasse die Tür zuschwingen und spähe hinauf. Ein paar Treppen über mir huscht etwas über die Wand. Ich warte, dass jemand um die Ecke biegt und in den Spalten des Geländers auftaucht. Aber der Schatten hält inne, als würde er auf etwas warten. Und dann, auf einmal, wird es dunkel – die Zeitschaltuhr muss abgelaufen sein. Ich strecke mich zum Lichtschalter und knipse ihn wieder an.
Der Schatten ist fort.
Ich steuere den Lift in seinem Metallkäfig an. Das Ding ist definitiv uralt, aber ich bin viel zu fertig, um auch nur daran zu denken, mein Gepäck die Treppe hochzuschleifen. Im Inneren ist gerade so Platz für mich und meinen Koffer. Ich ziehe die schmale Tür zu, drücke den Knopf zur zweiten Etage und stütze mich an der Wand ab. Sie gibt unter dem Druck meiner Handfläche nach. Ich ziehe sie hastig zurück. Es ruckelt ein bisschen, als der Lift sich in Bewegung setzt; ich halte die Luft an.
Und hoch geht’s. Auch im ersten Stock befindet sich bloß eine, diesmal mit einer Messingnummer markierte, Wohnungstür. Ist da etwa nur ein Appartement pro Etage? Die müssen ja riesig sein. Ich stelle mir die schlafende Gegenwart der fremden Menschen hinter diesen Türen vor. Ich frage mich, wer darin lebt, wie Bens Nachbarn wohl sind. Und natürlich frage ich mich, in welcher Wohnung wohl der Arsch lebt, dem ich gerade am Tor begegnet bin.
Der Lift kommt ruckartig im zweiten Stock zum Halt. Ich trete in den Flur und zerre den Koffer hinter mir her. Da ist es ja: Bens Appartement mit seiner Messingnummer 2.
Beherzt klopfe ich zweimal.
Keine Antwort.
Ich gehe in die Hocke und besehe mir das Schloss. Es ist so ein altmodisches Ding, das sich locker knacken lässt. Was muss, das muss. Ich fummle meine Kreolen aus den Ohrläppchen und biege sie auseinander – der Vorteil von billigem Modeschmuck –, womit ich zwei lange, stabile Metalldrähte zur Verfügung habe. Ich mache mich ans Werk und probiere den Kniff aus. Tatsächlich hat Ben ihn mir als Kind beigebracht, also kann er sich kaum beschweren. Ich bin so gut darin, dass ich einen normalen Schließzylinder in unter einer Minute knacke.
Ich stochere mit dem Ohrringdraht herum, bis ein Klicken ertönt. Ja! – Die Tür geht auf. Ich halte einen Moment inne. Irgendwas daran fühlt sich nicht richtig an. Ich habe die letzten Jahre gelernt, verstärkt auf meine Instinkte zu vertrauen. Und genau an diesem Punkt hier stand ich schon mal. Die Hand um eine Türklinke geschlossen. Nicht wissend, was ich auf der anderen Seite vorfinden würde …
Tief durchatmen. Einen Moment lang fühlt es sich an, als würde die Luft sich um mich zusammenziehen. Ich erwische mich dabei, wie ich den Anhänger meiner Halskette umklammere. Der heilige Christophorus. Mum gab uns beiden einen, damit er über uns wacht – auch wenn das eigentlich ihr Job war und nicht etwas, das man an einen kleinen Metallheiligen delegiert. Ich bin nicht religiös und bin auch nicht sicher, ob Mum es war. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, mich je davon zu trennen.
Mit der anderen Hand drücke ich die Klinke runter. Unwillkürlich kneife ich die Augen zusammen, als ich den Raum betrete.
Drinnen ist es stockfinster.
»Ben?«, rufe ich.
Keine Antwort.
Ich wage mich weiter hinein und taste nach einem Lichtschalter. Als es hell wird, enthüllt sich mir die Wohnung. Mein erster Gedanke ist: Jesus, ist die riesig. Größer noch, als ich erwartet hatte. Und prachtvoller. Hohe Decken. Dunkle Holzstreben über mir, polierte Parkettdielen unter mir, deckenhohe Fenster, die zum Innenhof hinausgehen.
Ich mache einen weiteren Schritt in den Raum hinein. In dem Moment landet etwas auf meiner Schulter. Ein dumpfer, schwerer Hieb. Dann das Brennen von etwas Scharfem, das durch meine Haut reißt.
DIE CONCIERGE
Loge
Ein paar Minuten nach dem Klopfen spähte ich durch die Fensterläden meiner Loge, als die erste Gestalt mit Kapuze den Hof betrat. Mit einiger Verzögerung sah ich eine zweite Gestalt folgen. Der Neuankömmling, das Mädchen. Wie sie da mit dem Rollkoffer über das Kopfsteinpflaster polterte, machte sie genug Lärm, um die Toten aufzuwecken.
Ich hatte sie über den Monitor der Gegensprechanlage beobachtet, bis es aufhörte zu klingen. Ich bin gut im Beobachten. Ich fege und wische die Flure der Bewohner; ich nehme ihre Post entgegen; ich öffne die Tür für sie. Aber ich beobachte auch. Ich sehe alles. Und es verleiht mir eine seltsame Art von Macht, auch wenn ich die Einzige bin, die sich dessen bewusst ist. Die Bewohner dieses Gebäudes vergessen, dass es mich gibt. Es kommt ihnen entgegen. Sich einzubilden, dass ich nichts weiter bin als eine Verlängerung dieses Gebäudes, nur das sich bewegende Teil einer großen Maschinerie, so wie der Aufzug, der sie zu ihren schönen Wohnungen befördert. Auf gewisse Weise bin ich Teil dieses Ortes geworden. Er hat mich in jedem Fall gezeichnet. Ich bin sicher, dass die Jahre des Lebens hier mich unmerklich haben schrumpfen lassen, gebückt und in mich zurückgezogen; wohingegen die Stunden, die ich damit zubrachte, die Flure und Stufen des Hauses zu schrubben, meine Muskelstränge herausgearbeitet haben. In einem anderen Leben wäre ich in meinem Alter vielleicht mollig und schwerfällig geworden. Aber den Luxus hatte ich nicht. Ich bin sehnig und knochig. Stärker, als ich aussehe.
Ich schätze mal, ich hätte losgehen und sie aufhalten können. Hätte es sogar sollen. Aber Konfrontationen sind nun mal nicht meine Art. Ich habe gelernt, dass Beobachten eine weitaus mächtigere Waffe ist. Und es hatte diesen Anschein von Unvermeidbarkeit, dass sie hier ist. Ich konnte ihr die Entschlossenheit ansehen. Sie hätte ihren Weg ins Haus gefunden, ganz egal, was ich getan hätte, um sie davon abzuhalten.
Dummes Mädchen. Es wäre so viel besser gewesen, wenn sie kehrtgemacht und diesen Ort verlassen hätte. Nie wieder zurückgekommen wäre. Aber nun ist es zu spät. So soll es denn sein.
JESS
Mein Herz rast, meine Muskeln krampfen.
Ich senke den Kopf, sehe eine Katze, die in einer verschwommenen Bewegung schnurrend um meine Beine streift. Geschmeidig, schwarz, mit einer weißen Fellkrause um den Hals. Ich fahre mit der Hand hinten unter meinen Jackenkragen. Als ich sie wieder hervorziehe, schimmert Blut an meinen Fingern. Autsch.
Die Katze muss von dem Küchentresen neben der Tür direkt auf meine Schulter gesprungen sein und sich, als ich nach vorne kippte, Halt suchend festgekrallt haben. Jetzt sieht sie durch verengte grüne Augen zu mir auf und gibt ein Maunzen von sich, wie die Frage, was zum Teufel ich hier verloren habe.
Eine Katze! Herrjemine. Ich muss lachen, höre aber gleich wieder auf, wegen des seltsamen Echos, das durch den hohen Raum hallt.
Ich hatte keine Ahnung, dass Ben eine Katze hat. Mag er Katzen überhaupt? Es erscheint mir verrückt, dass ich das nicht weiß. Aber ich nehme mal an, dass es generell nicht viel gibt, was ich über sein Leben hier weiß.
»Ben?«, rufe ich. Erneut prallt der Klang meiner Stimme zu mir zurück. Keine Antwort. Ich glaube nicht, dass ich eine erwartet habe – es ist zu still, zu leer hier drin. Und da ist ein merkwürdiger Geruch. Etwas Chemisches.
Plötzlich habe ich das dringende Bedürfnis nach einem Drink. Das Wichtigste zuerst. Ich betrete den kleinen Küchenbereich zu meiner Rechten und fange an, die Schränke zu durchforsten. Ich finde eine halbe Flasche Rotwein. Ich würde zwar etwas mit mehr Schub vorziehen, aber in der Not frisst der Teufel auch Fliegen, und überhaupt könnte der Spruch genauso gut das Motto meines ganzen verkackten Lebens sein. Ich schenke mir ein ordentliches Glas ein. Auf dem Tresen liegt auch eine Schachtel Kippen, hellblaue Verpackung: Gitanes. Ich hatte keine Ahnung, dass Ben noch raucht. Ist ja klar, dass er sich für eine fancy französische Marke entscheidet. Ich angle mir eine heraus, zünde sie an, inhaliere und huste wie damals beim ersten Mal, als eines der anderen Pflegekinder mich ziehen ließ. Das Zeug ist echt stark, würzig und ungefiltert. Bin mir nicht sicher, ob ich es mag. Trotzdem schiebe ich den Rest der Packung in die Tasche meiner Jeans – das ist Ben mir schuldig – und schaue mich das erste Mal richtig in der Bude um.
Ich bin … erstaunt. Und das ist gelinde ausgedrückt. Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet hatte, aber das hier gewiss nicht. Ben ist eher der kreative, coole Typ (nicht, dass ich ihn in seiner Gegenwart je als cool bezeichnen würde), doch ganz im Gegensatz dazu ist die gesamte Wohnung mit einer altmodischen Oma-Tapete bedeckt: silbrig, mit einem zarten Blumenmuster. Als ich die Hand an die Wand lege, merke ich, dass sie gar nicht aus Papier ist, sondern aus stark verblichener Seide. Ich entdecke hellere Stellen, wo einst Bilder gehangen haben müssen, und kleine rostfarbene Flecken im Stoff. Von der hohen Decke hängt ein Kronleuchter, dessen geschwungene Metallarme die Glühbirnen halten. Ein langer Schweif Spinnweben schwingt träge hin und her – von irgendwoher muss es ziehen. Und offenbar gab es mal Vorhänge an den Fenstern, denn ich sehe eine leere Gardinenstange über mir, an der sich noch die Messingringe befinden. Ein schlichter Schreibtisch steht an einem der Flügelfenster. Außerdem gibt es ein Regal, auf dem sich mehrere elfenbeinfarbene Taschenbücher reihen sowie ein dickes blaues Französischwörterbuch.
In der Ecke neben mir steht ein Garderobenständer mit einer alten Khakijacke dran; ich bin sicher, dass ich sie schon mal an Ben gesehen habe. Vielleicht sogar bei unserem letzten Treffen vor ungefähr einem Jahr, als er in Brighton vorbeikam und mich auf ein Mittagessen einlud, bevor er sich sang- und klanglos wieder aus meinem Leben verkrümelte. Ich greife in die Taschen und ziehe einen Schlüsselbund sowie ein braunes Lederportemonnaie hervor.
Ist es nicht ein bisschen komisch, dass Ben fort ist, aber das hiergelassen hat?
Ich öffne das Portemonnaie; im hinteren Fach steckt ein dickes Bündel Euroscheine. Ich nehme mir einen Zwanziger und dann, als kleine Zugabe, noch zwei Zehner. Wenn er hier wäre, müsste ich ihn sowieso um Geld anhauen. Ich werde es ihm zurückzahlen … irgendwann.
Vorne bei den Bankkarten steckt auch eine Visitenkarte im Fach: Theo Mendelson. Redaktion Paris, Guardian. Und in Bens Handschrift mit Kuli draufgekritzelt (manchmal denkt er nämlich dran, mir eine Geburtstagskarte zu schicken): BRAUCHT EINEN PITCH VON DER STORY.
Als Nächstes schaue ich mir die Schlüssel an. Einer von ihnen gehört zu einer Vespa, was seltsam ist, da er beim letzten Mal noch einen alten Mercedes aus den Achtzigern mit Faltverdeck fuhr. Der andere ist ein großes altmodisches Exemplar und sieht aus, als könne er zu der Wohnung gehören. Ich gehe zur Tür und probiere ihn aus – das Schloss dreht sich klickend.
Das Unbehagen in meiner Magengrube wächst. Er könnte eine extra Ausfertigung besitzen, überlege ich. Das hier könnte der Zweitschlüssel sein, den er mir geben wollte. Er hat wahrscheinlich auch einen Ersatzschlüssel für die Vespa; womöglich ist er sogar damit weggefahren. Und was sein Portemonnaie angeht, hat er wahrscheinlich noch Bargeld in der Hosentasche.
Als Nächstes entdecke ich das Badezimmer. Es gibt nicht viel zu berichten, außer die Tatsache, dass Ben keine Handtücher zu besitzen scheint, was schon ziemlich schräg ist. Ich kehre in den Wohnbereich zurück. Das Schlafzimmer muss hinter der geschlossenen Flügeltür liegen. Ich gehe darauf zu, die Katze folgt mir schattengleich. Einen Moment zögere ich.
Die Katze maunzt mich erneut an, wie um zu fragen: Worauf wartest du? Ich nehme einen großen Schluck von meinem Wein. Tief durchatmen. Tür aufschieben. Noch einmal durchatmen. Augen öffnen. Leeres Bett. Leeres Zimmer. Niemand ist hier. Ausatmen.
Okay. Ich meine, ich dachte nicht wirklich, dass ich irgendwas in der Art vorfinden würde. So ist Ben nicht. Ben ist in jeglicher Hinsicht ordentlich, aufgeräumt; ich bin hier die abgefuckte Chaotin. Aber wenn einem einmal so etwas passiert ist …
Ich leere den Rest meines Weins, bevor ich die Einbauschränke im Schlafzimmer durchgehe. Nicht viel in Sachen Hinweise, außer dass die meisten Klamotten meines Bruders aus Läden stammen, die Acne (warum bitte sollte man Klamotten tragen wollen, die nach einer Hautkrankheit benannt sind?) und A.P.C. heißen.
Zurück im Wohnzimmer gieße ich den letzten Rest Rotwein in mein Glas und kippe ihn runter. Dann schlendere ich zum Schreibtisch vor dem bodentiefen Fenster, das zum Innenhof hinausgeht. Auf dem Tisch befindet sich bis auf einen abgegriffenen Kuli nichts. Kein Laptop. Dabei schien Ben siamesisch damit verwachsen, als er mich letztes Mal zum Mittagessen einlud; er holte ihn sogar heraus, um schnell noch was zu tippen, während wir auf unsere Bestellungen warteten. Ich schätze mal, er hat ihn bei sich, wo auch immer er gerade ist.
Auf einmal überkommt mich das eindeutige Gefühl, dass ich nicht allein bin, dass ich beobachtet werde. Wie ein Kribbeln, das mir über den Nacken läuft. Ich wirble herum. Niemand da, außer der Katze, die auf einem Stuhl hockt. Vielleicht war es nur das.
Die Katze sieht mich einige Sekunden an, bevor sie den Kopf zur Seite neigt, so als würde sie eine Frage stellen. Es ist das erste Mal, dass ich sie so still sitzen sehe. Dann hebt sie eine Pfote an ihr Mäulchen und leckt sie ab. Und da erst bemerke ich, dass sowohl die Pfote als auch die weiße Fellkrause blutverschmiert sind.
Ich greife nach der Katze, um sie mir genauer anzusehen, aber sie schlüpft flink unter meiner Hand hindurch. Vielleicht hat sie nur eine Maus gefangen oder so? Eine der Pflegefamilien, bei denen ich untergebracht war, hatte auch eine Katze: Suki. Obwohl sie klein war, konnte sie eine ganze Taube verputzen; einmal kam sie komplett blutverschmiert zurück wie so ein Wesen aus einem Horrorfilm, und meine Pflegemutter Karen fand die kopflose Leiche erst am späten Vormittag. Ich bin sicher, dass irgendwo in der Wohnung eine kleine tote Kreatur herumliegt und nur darauf wartet, dass ich drauftrete. Oder sie hat draußen im Hof etwas getötet – die Fenster stehen ein Stück weit offen, so muss sie hier ein und aus gehen können, über den wuchernden Efeu vielleicht.
Trotzdem. Ein bisschen habe ich mich schon erschrocken. Als ich sie so sah, da dachte ich einen Moment lang …
Nein. Ich bin nur müde. Ich sollte mich hinlegen und versuchen, ein bisschen zu schlafen.
Ben wird morgen früh auftauchen und erklären, wo er gesteckt hat. Ich werde ihm sagen, dass es arschig von ihm war, mich so stehen zu lassen, und dass ich praktisch bei ihm einbrechen musste. Und es wird sein wie in den alten Zeiten, den ganz alten Zeiten, bevor er zu seiner hochglanzpolierten reichen Familie zog und sich eine neue Art zu sprechen, eine neue Weltsicht angewöhnte, während ich durch das staatliche Fürsorgesystem bugsiert wurde, bis ich alt genug war, um mich allein durchzuschlagen. Ich bin sicher, ihm geht’s gut. Ben stoßen keine schlimmen Dinge zu. Er ist der Glückspilz von uns beiden.
Ich schlüpfe aus meiner Jacke und werfe sie aufs Sofa. Wahrscheinlich sollte ich duschen – ich bin mir ziemlich sicher, dass ich müffle. Ein bisschen nach Körperausdünstungen, aber hauptsächlich nach Essig. Du kannst eben nicht im Copacabana arbeiten und nicht nach dem Zeug stinken; wir benutzten es nach jeder Schicht, um die Theke abzuwischen. Aber ich bin zu müde für eine Dusche. Ich glaube, Ben hat etwas von einem Klappbett erwähnt, doch ich kann keins entdecken. Also schnappe ich mir eine Decke vom Sofa und lege mich im Schlafzimmer angezogen aufs gemachte Bett. Ich klopfe die Kissen zurecht, um sie bequemer anzuordnen. Dabei rutscht etwas hervor und fällt auf den Boden.
Ein Damenslip: schwarze Seide, Spitzenbesatz, definitiv teuer. Iiih. Herrje, Ben. Ich will gar nicht dran denken, wie der unters Kissen gelangt ist. Ich weiß nicht mal, ob Ben eine Freundin hat. Und da verspüre ich unwillkürlich einen traurigen Stich. Ben ist alles, was ich habe, und nicht mal das weiß ich über ihn.
Ich bin zu müde, um mehr zu tun, als die Unterhose mit der Fußspitze wegzukicken, sodass ich sie wenigstens nicht sehen muss. Morgen werde ich auf dem Sofa schlafen.
JESS
Die Stimme eines Mannes. Dann eine andere Stimme, die einer Frau.
Ein Schrei reißt durch die Stille.
Ich setze mich im Bett auf und lausche angestrengt, das Herz hämmert gegen meine Rippen. Ich brauche kurz, um zu begreifen, dass die Geräusche aus dem Innenhof kommen und durch die geöffneten Fenster im Wohnzimmer hereindringen. Ich schaue auf den Wecker neben Bens Bett. Kurz vor sechs, fast schon Morgen, aber es ist immer noch dunkel.
Der Mann brüllt erneut. Es klingt lallend, als habe er getrunken.
Ich schleiche mich ins Wohnzimmer zum Fenster und gehe in die Hocke. Die Katze stupst ihr Gesicht gegen meinen Schenkel, miaut. »Schh«, ermahne ich sie, aber eigentlich mag ich das Gefühl ihres warmen, festen Körpers an meinem.
Ich spähe in den Hof. Zwei Gestalten stehen unten: eine groß gewachsen, eine viel kleiner. Der Kerl ist dunkelhaarig, sie ist blond; ihr langer Haarschweif fällt im kühlen Licht der einzigen Laterne silbern herab. Er trägt einen Parka mit pelzbesetzter Kapuze, die mir bekannt vorkommt, und mir wird klar, dass es der Kerl ist, den ich vor dem Tor »kennengelernt« habe.
Die Stimmen werden lauter – sie brüllen nun gegeneinander an. Ich bin ziemlich sicher, dass ich die Frau das Wort police sagen höre. Daraufhin ändert sich sein Tonfall – ich verstehe die Worte nicht, aber es liegt eine neue Härte darin, eine Drohung. Ich sehe, wie er zwei Schritte auf sie zumacht.
»Laisse-moi!«, schreit sie und klingt nun ebenfalls anders – eher verängstigt als wütend. Er macht noch einen Schritt auf sie zu. Mir wird bewusst, dass ich mich so nah an die Scheibe gedrückt habe, dass mein Atem das Glas beschlagen hat. Ich kann nicht nur hier sitzen, lauschen, zusehen. Er hebt eine Hand. Er ist so viel größer als sie.
Eine plötzliche Erinnerung … Mum, sie schluchzt. Es tut mir leid, es tut mir leid. Immer wieder, wie die Worte eines Gebets.
Ich hebe eine Hand und schlage damit gegen die Fensterscheibe. Ich will ihn für einen Moment ablenken, ihr die Zeit geben, sich zu entfernen. Ich sehe beide verwirrt aufblicken und ducke mich weg.
Als ich wieder nach draußen spähe, bekomme ich gerade noch mit, wie er etwas vom Boden aufhebt, etwas Großes, Sperriges, rechteckig. Mit einem heftigen Stoß schleudert er es in ihre Richtung … auf sie herab. Sie weicht zurück, und das Ding explodiert zu ihren Füßen. Es ist ein Koffer, aus dessen Innerem Klamotten zu allen Seiten herausfliegen.
Dann sieht er direkt zu mir hoch. Dieses Mal ist keine Zeit, mich wegzuducken. Ich verstehe, was sein Blick zu bedeuten hat: Ich habe dich gesehen. Und ich will, dass du es weißt.
Ja, denke ich, seinen Blick unverwandt erwidernd. Und ich habe dich gesehen, du Arschloch. Ich kenne Typen wie dich. Mir machst du keine Angst. Bloß, dass mir sämtliche Nackenhaare zu Berge stehen und das Blut in meinen Ohren rauscht.
Ich schaue zu, wie er zu der Statue rübergeht und sie brutal von ihrem Sockel stößt, sodass sie umkippt und krachend auf den Boden fällt. Dann steuert er die Tür an, die zurück ins Gebäude führt. Ich höre ihren Knall durchs Treppenhaus hallen.
Die Frau bleibt im Hof zurück, wo sie sich auf alle viere hinablässt, um die Sachen aufzusammeln, die aus dem Koffer geflogen sind. Noch eine Erinnerung: Mum, auf ihren Knien im Flur. Bettelnd, flehend …
Wo, bitte, sind die anderen Nachbarn? Ich kann nicht die Einzige sein, die diesen Aufruhr mit angehört hat. Es ist keine Entscheidung, runterzugehen und zu helfen – es ist etwas, das ich tun muss. Ich schnappe mir die Schlüssel und renne die Treppen runter.
Als ich in den Hof hinaustrete, blickt die Frau, immer noch auf Händen und Knien, mir entgegen. »Hey«, sage ich. »Sind Sie okay?«
Zur Antwort hält sie eine Seidenbluse hoch; sie ist mit Erde verschmiert. Dann, in gebrochenem Englisch: »Ich bin nur gekommen, um meine Sachen zu holen. Ich sage ihm, es ist aus, für immer. Und dann … tut er das hier. Er ist ein Mistkerl. Ich hätte ihn nie heiraten dürfen.«
Jesus, denke ich. Genau das ist der Grund, warum ich weiß, dass ich als Single besser dran bin. Mum hatte schon einen unfassbar miesen Männergeschmack. Und mein Vater war der Schlimmste von allen. Angeblich ein netter Typ. Von wegen, ein echt beschissener Dreckskerl war er. Wäre besser gewesen, wenn er sich bei Nacht und Nebel verpisst hätte, so wie Bens Vater es getan hatte, bevor er zur Welt kam.
Die Frau flucht leise vor sich hin, während sie die Klamotten in den Koffer stopft. Die Wut scheint wieder die Oberhand über die Angst gewonnen zu haben. Ich eile hinüber, gehe in die Hocke und helfe ihr die Sachen aufzuklauben: High Heels mit französischen Markennamen auf der Innensohle, ein schwarzer Spitzen-BH, ein kleiner orangefarbener Pulli aus dem weichsten Stoff, der mir je unter die Finger gekommen ist. »Merci«, bedankt sie sich zerstreut. Dann kräuselt sie die Stirn. »Wer sind Sie? Ich habe Sie hier noch nie gesehen.«
»Ich wollte eigentlich meinen Bruder Ben besuchen.«
»Ben«, wiederholt sie, wobei sie seinen Namen langzieht. Sie mustert mich von oben bis unten und registriert zweifelsohne meine abgewetzte Jeans und meinen alten Pulli. »Er ist Ihr Bruder? Bevor er kam, dachte ich, alle Engländer haben immer Sonnenbrand und keinen Stil und schlimme Zähne. Ich wusste nicht, dass sie so … schön sein können, so charmant, so soigné.« Anscheinend gibt es im Englischen nicht genug Wörter, um zu beschreiben, wie wundervoll mein Bruder ist. Sie fährt damit fort, Klamotten in ihren Koffer zu stopfen, nicht ohne eine gewisse Aggressivität in ihren Bewegungen, und ich erwische sie dabei, wie sie einen finsteren Blick zur Haustür wirft. »Ist es denn so seltsam, dass ich genug hatte, zu sein mit einem dummen, idiotischen Versager, einem … alcoolique? Dass ich ein bisschen flirten wollte? Und ja, d’accord, vielleicht wollte ich Antoine eifersüchtig machen. Damit er sich um etwas anderes kümmert, nicht nur um sich selbst. Ist es so eine Überraschung, dass ich anfing, mich woanders umzusehen?« Sie schwingt den Vorhang aus seidig glänzendem Haar über ihre Schulter. Schon beeindruckend, das mit dieser Eleganz hinzukriegen, während man auf allen vieren herumkrabbelt, um seine Spitzendessous aus einem gekiesten Beet aufzuklauben.
Sie schaut wieder zum Gebäude und hebt ihre Stimme, fast so, als wolle sie, dass ihr Ehemann sie hört. »Er sagt, ich interessiere mich nur wegen seinem Geld für ihn. Natürlich interessiere ich mich nur für sein Geld. Es war das Einzige, was es – wie sagen Sie? – lohnenswert machte? Aber nun …«, sie zuckt die Achseln, »… es lohnt sich nicht mehr.«
Ich reiche ihr ein knallblaues Seidenkleid und einen babyrosa Stoffhut mit JAQUEMUS-Aufdruck vorne drauf. »Haben Sie Ben in letzter Zeit gesehen?«, frage ich.
»Non«, antwortet sie, eine Augenbraue gewölbt, als würde ich ihr was unterstellen. »Pourquoi? Warum fragen Sie?«
»Er wollte gestern Abend zu Hause auf mich warten, aber er war nicht da … und er antwortet auch nicht auf meine Nachrichten.«
Ihre Augen werden groß. Und dann, kaum hörbar, murmelt sie etwas: »Antoine … non. C’est pas possible …«
»Wie meinen Sie?«
»Oh … rien, nichts.« Doch mir entgeht nicht ihr Blick, der Richtung Gebäude zuckt – ängstlich, ja, argwöhnisch –, und ich frage mich, was das zu bedeuten hat.
Dann versucht sie, die Schnallen ihres prallen Koffers zu schließen – aus braunem Leder, über und über mit einer Art Logo bedruckt –, aber ich sehe, dass ihre Hände zittern, was ihre Bewegungen fahrig macht. »Merde!« Endlich rasten die Schnallen ein.
»Hey«, sage ich. »Wollen Sie reinkommen? Ein Taxi rufen?«
»Auf keinen Fall«, erwidert sie heftig. »Da gehe ich nie wieder rein. Gleich kommt mein Uber …« Wie aufs Stichwort piept ihr Handy. Sie wirft einen Blick drauf und stößt einen erleichterten Seufzer aus. »Merci. Er ist da. Ich muss los.« Sie dreht sich um und blickt am Gebäude hoch. »Wissen Sie, was? Scheiß auf diesen Ort. Er ist böse.« Dann wird ihre Miene sanfter, und sie sendet eine Luftkuss zu den Fenstern über uns. »Aber wenigstens eine gute Sache ist mir hier passiert.«
Sie zieht den Griff des Koffers hoch, wendet sich ab und stakst Richtung Tor davon.
Ich eile ihr hinterher. »Was meinen Sie mit ›böse‹?«