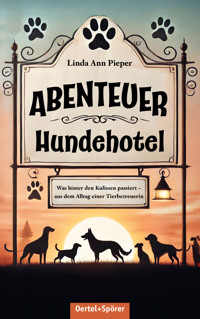
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oertel + Spörer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Abenteuer Hundehotel – mit Chaos, Charme und Charisma Willkommen im Hundehotel, wo der Wahnsinn täglich bellt! Hier treffen bissige Biester auf geduldige Tierpfleger, Promihunde auf absurde Sonderwünsche und Abgabehunde auf ihre zweite Chance im Leben. Linda Ann Pieper erzählt in 30 Kapiteln herrlich amüsante und manchmal nachdenkliche Geschichten aus ihrem Alltag in der Tierpension. Ob ein cleverer Schäferhund, der Türen besser öffnet als ein Schlosser, ein geiziger Hundebesitzer, der selbst beim Halsband sparen will, oder die Hündin, die lieber hungert, als das Hotel zu verlassen – hier ist für Lacher, Tränen und Kopfschütteln gesorgt. Neben humorvollen Episoden beleuchtet die Autorin auch die ernsteren Seiten des Tierschutzes und der Verantwortung, die diese Arbeit mit sich bringt. Ihre Geschichten zeigen, dass das Leben mit Vierbeinern nie langweilig ist – und immer voller Überraschungen steckt! Für alle, die das Leben mit Hunden lieben, und für alle, die wissen wollen, was im Hundehotel wirklich abgeht – ein tierisch unterhaltsames Lesevergnügen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Linda Ann Pieper
Abenteuer Hundehotel
Was hinter den Kulissen passiert – aus dem Alltag einer Tierbetreuerin
Oertel+Spörer
Titelbild: Mag. Bernhard Rehrl
Foto Rückseite: Linda Ann Pieper
Haftungsausschluss
Die Hinweise in diesem Buch wurden von der Autorin sorgfältig recherchiert und geprüft. Es können jedoch keinerlei Garantien übernommen werden. Eine Haftung der Autorin, des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Sämtliche Teile des Werks sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die schriftliche Zustimmung des Verlags und der Autorin unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Oertel+Spörer Verlags-GmbH+Co.KG ∙ 2025
Postfach 16 42 · 72706 Reutlingen
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Dr. Gabriele Lehari
DTP und Repro: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-96555-208-1
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1 Vom Traum zur Wirklichkeit
Kapitel 2 Iwan – der (gar nicht) Schreckliche
Kapitel 3 Das Blutbad
Kapitel 4 Halsband-Dilemmas und Uniformen
Kapitel 5 Sparsamer Hundemarken-Muffel
Kapitel 6 Bellos großes Abenteuer
Kapitel 7 Monas Verwandlung
Kapitel 8 Auf der Suche nach Superhunden
Kapitel 9 Der Wert eines Lebens
Kapitel 10 Tiernamen und Menschentypen
Kapitel 11 Über eigene Grenzen gehen
Kapitel 12 Rote Teppiche und bellende Stars
Kapitel 13 Besser verhungern als nachgeben
Kapitel 14 Kleiderordnung für Besucher
Kapitel 15 Kontrollwahn und Papierkram
Kapitel 16 Schneechaos versus Sonnenschirm
Kapitel 17 Königin des Ein- und Ausbruchs
Kapitel 18 Sprachkultur Internet
Kapitel 19 Welpen mit bissiger Super-Mama
Kapitel 20 Erziehungsmangel ergibt großes Chaos
Kapitel 21 Aktive, passive und gar keine Hilfe
Kapitel 22 Tickende Zeitbombe
Kapitel 23 Mit Familie an der Front
Kapitel 24 Pandemie – Stille in der Tierpension
Kapitel 25 Zeit ist relativ
Kapitel 26 Vermittlungshilfe mit Hindernissen
Kapitel 27 Erholsame Zeiten
Kapitel 28 Schnüfflerin auf Spurensuche
Kapitel 29 Jahreswechsel mit Zahnlücke
Kapitel 30 Ein neues Rudelmitglied
Nachwort: Der gute Geist
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
seit gefühlt hundert Jahren trage ich den Wunsch in mir, all meine tierischen Abenteuer und kuriosen Begegnungen aus der Tierpension in einem Buch festzuhalten. Doch immer kam etwas dazwischen. »Für das, was einem wichtig ist, nimmt man sich die Zeit«, heißt es ja so schön. Ach ja, wenn das doch so einfach wäre! Denn wer auch nur einmal versucht hat, mit einem wuseligen Hund auf dem Schoß einen einzigen Satz zu schreiben, weiß, dass das eher dem Versuch gleicht, ein Schiff in einem Sturm zu steuern – ohne Steuerrad.
Die Wahrheit ist: Mein Leben war ein einziges Chaos aus Bellen, Kinderlachen, Telefonklingeln und Türglockengebimmel. Als Alleinerziehende von drei aufgeweckten Kindern, die nebenbei eine Tierpension auf einem 3500 qm großen Gelände führt, kann man sich kaum in Ruhe an den Schreibtisch setzen und eine inspirierende Muse erwarten. Eher klopft eine überdrehte Französische Bulldogge mit der Pfote an die Tür und fordert ihre Streicheleinheiten ein!
Nicht nur die pelzigen Gäste hielten mich auf Trab, sondern auch meine menschlichen Mitstreiter: Mitarbeiter, Kunden und natürlich die lieben Besucher, die oft mit den besten Absichten (aber nicht immer dem besten Timing) hereinschneiten. Mein Schreibtisch verwandelte sich dabei immer wieder in ein Schlachtfeld aus Post, E-Mails und To-do-Listen, und mein Kopf war gefühlt wie eine Bahnhofshalle voller Trubel.
Doch dann, endlich – Trommelwirbel! – wurde ich Pensionistin. Plötzlich hatte ich die Zeit, meine Abenteuer niederzuschreiben, ohne dass ein frecher Beagle mir den Stift aus der Hand klaut. Nun lade ich Sie herzlich ein, mit mir durch die Geschichten zu reisen, die das Leben in einer Tierpension so besonders machen – mal humorvoll, mal tief berührend, aber immer mit einem Augenzwinkern.
Da gibt es zum Beispiel den cleveren weißen Schäferhund, der wirklich jede Tür aufbekommt (ja, sogar den Kühlschrank!). Oder den gutmütigen Schutzhund, der tatsächlich das Mobbing an einer Schule beendet hat – auf seine ganz eigene, beeindruckende Weise. Und dann wäre da noch die teure, gehörlose Dalmatiner-Dame, die sich für ein paar Leckerlis gern als »Hör-Hund« ausgibt. Und die Kunden – oh ja, jeder ein echtes Unikat! Manchmal treiben sie einen an den Rand des Wahnsinns, aber sie sorgen immer für die eine oder andere unerwartete Überraschung.
Dieses Buch ist Ihre Einladung in eine Welt, in der nicht nur Tiere, sondern auch Menschen Freundschaften knüpfen und das Herz berühren. Es ist eine Sammlung von kleinen und großen Momenten, von Lachtränen und Abschiedsschmerz und dem unzertrennlichen Band zwischen Menschen und Tieren.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen – und lassen Sie sich verzaubern von dieser bunten, pelzigen und liebenswert chaotischen Welt!
Herzlichst
Linda Ann Pieper
Alle Namen und Charaktere in diesem Buch sind verändert, um die Anonymität zu wahren. Die Inhalte basieren auf meinen persönlichen Erfahrungen und Meinungen. Sie erheben weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf rechtliche Verbindlichkeit. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen, lebend oder verstorben, sind rein zufällig.
Kapitel 1 Vom Traum zur Wirklichkeit
Bis zum Jahr 1996 war Salzburg für Hundebesitzer eine echte Herausforderung – zumindest, wenn sie vorhatten, ihren Liebling für ein paar Tage in professionelle Obhut zu geben. Damals gab es zwei Tierheime, die eher als Notlösungen herhielten, und ein Katzenhotel, das natürlich für Hunde völlig ungeeignet war. Eine echte Hundepension? Fehlanzeige!
Wer verzweifelt eine Unterkunft für seinen Vierbeiner suchte, stieß unweigerlich auf das kuriose Phänomen der »Geheimpensionen«. Diese geheimnisvollen Orte versteckten sich in den dunklen Ecken privater Hinterhöfe oder fristeten ihr Dasein im muffigen Keller des Nachbarn – natürlich ohne Genehmigung oder nennenswerte Ausstattung. Hundebesitzer, die keine andere Wahl hatten, ließen ihre treuen Begleiter dort zurück, begleitet von einem mulmigen Gefühl und der leisen Hoffnung, dass ihr Vierbeiner die Tage halbwegs heil überstehen würde. Fürsorge und Qualität in der Hundebetreuung? Tja, die standen damals ganz hinten in der Warteschlange, irgendwo zwischen dem alten Futternapf und einem schiefen Gartentor.
Damals war ich Hundebesitzerin und kannte diese Misere nur zu gut. Eines Tages besuchte ich eine der inoffiziellen Pensionen und der Anblick dort war ernüchternd: winzige, schmutzige Zwinger, in denen mehrere Hunde dicht an dicht eingesperrt waren. Der Lärm war ohrenbetäubend, die Betreiber unfreundlich und von Liebe zu den Tieren war nichts zu spüren. Meinen Hund in so einem Umfeld unterzubringen? Niemals! Urlaub war für mich keine Option, wenn es bedeutete, meinen geliebten Vierbeiner so einem Schicksal zu überlassen. Doch mir war damals nicht bewusst, dass genau diese Frustration der Anstoß für eine große Veränderung in meinem Leben sein würde.
Zu jener Zeit war ich noch Sekretärin in einem großen Unternehmen. Ich trug täglich schicke Kleider, achtete auf perfekt gepflegte Nägel und hätte mir kaum vorstellen können, eines Tages in Gummistiefeln über ein Gelände zu stapfen, Hunde zu betreuen und mich mit Themen wie Zwingerhygiene, Hundeernährung und Verhaltensschulung auseinanderzusetzen. Das Leben hatte jedoch andere Pläne für mich und erst im Rückblick wurde mir klar, wie sich alles über die Jahre hinweg langsam entwickelt hatte.
Als Kind hätte ich so gerne einen Hund gehabt
Schon als Kind war ich völlig vernarrt in Tiere, besonders in Hunde. Aber in unserem Haushalt war an einen Hund nicht zu denken – keine Chance. Stattdessen hatten wir zwei Streifenhörnchen, die zwar süß waren, aber eben keine treuen Hundeaugen hatten. Mein großer Traum war ein eigener Hund, doch meine Eltern winkten rigoros ab. Also zog ich mit hängendem Kopf los und suchte Trost auf den Bauernhöfen in der Nachbarschaft. Dort verbrachte ich Stunden damit, Kühe zu füttern, Katzen zu kraulen und sehnsüchtig den Hofhunden beim Herumtollen zuzusehen. Ich war so oft dort, dass die Tiere mich vermutlich als eines von ihnen ansahen. Der Junge von nebenan, der einen Labradormischling namens Lola besaß, war für mich der absolute Held. Lola war einfach perfekt: verspielt, loyal und immer zu einem Abenteuer bereit. So einen Hund wollte ich auch!
Einmal war meine Sehnsucht so groß, dass ich mich heimlich zum örtlichen Tierheim schlich. Durch den Zaun zu spähen war das Einzige, was mir blieb, aber das reichte mir. Und dann entdeckte ich ihn: einen neugierigen Schäfermischling, der sich sofort ans Gitter drückte und versuchte, mich zu beschnuppern. Natürlich konnte ich nicht widerstehen und streichelte ihn, während ich mir ausmalte, wie es wäre, wenn er »mein« Hund wäre. Doch zu Hause? Da wagte ich es nicht einmal, das Wort »Hund« in den Mund zu nehmen. Ich wusste, dass ich da gegen eine Mauer aus elterlicher Ablehnung prallen würde.
Erst viele Jahre später, als ich bereits verheiratet war und meine drei Kinder hatte, schlich sich der Gedanke an einen Hund wieder in mein Leben. Mein Mann und ich lebten damals in einem Haus auf dem Land und die Umgebung schien ideal für einen Hund. Ich spürte, dass die Zeit gekommen war, mir endlich meinen Kindheitstraum zu erfüllen. Also begann ich, mit meinem Mann zu verhandeln. Wochenlang diskutierten wir – er war skeptisch, ich entschlossen. Schließlich einigten wir uns darauf, dass ein kleinerer Hund ein Teil der Familie werden sollte. Unsere Wahl fiel auf einen Mischlingswelpen, den wir von einer Familie übernahmen. »Wir schauen nur mal«, hatten wir uns gesagt. Doch als wir vor Ort ankamen und die kleinen, tapsigen Welpen auf uns zustürmten, war klar: Wir würden nicht ohne Hund nach Hause gehen.
Eine herzlich unvernünftige Entscheidung
Dino, so nannten wir unseren neuen Familienzuwachs, war ein aufgeweckter kleiner Racker. Schon bei unserem ersten Besuch verfing sich einer der Welpen mit seinen winzigen Zähnchen in meinen Haaren und ich nahm das als Zeichen: Das war »mein« Hund! Doch wie es oft so kommt, hatte ich mich etwas verschätzt. Dino wuchs schneller als erwartet. Das niedliche Welpen-Halsband, das ich gekauft hatte, passte nicht mehr, bevor er es überhaupt einmal getragen hatte. Der »kleine« Mischling stellte sich als ziemlich groß heraus und mit seiner wachsenden Größe kam auch sein Temperament zum Vorschein.
Dino war alles andere als einfach. Er zerstörte Möbel, buddelte im Garten, konnte nicht allein schlafen, stahl Essen vom Tisch, war nicht stubenrein und brachte mich mehr als einmal an den Rand der Verzweiflung. Besonders seine Neigung, Nachbars Hühner zu jagen, versetzte uns in unangenehme Situationen. Doch trotz all seiner Unarten blieb er unser Familienhund und ich begann ihn zu trainieren. Als sich herausstellte, dass Dino ein Alphahund mit einem Gewicht von 32 Kilo war, besuchte ich Hundetrainings-Kurse und bald war ich selbst als Kursleiterin in unserem Hundeverein aktiv.
Das erste Hundehotel in Salzburg entstand
Die Idee, eine Hundepension zu eröffnen, kam fast beiläufig. Eine Schülerin aus meinem Hundeverein fragte mich, ob ich während ihrer Arbeitszeit auf ihre Hündin aufpassen könnte. Zunächst dachte ich mir nichts dabei, doch bald folgten immer mehr Anfragen. Ehe ich mich versah, war unser Haus voller Hunde. Irgendwann wurde uns klar, dass wir eine größere Lösung finden mussten, und so entstand 1998 die erste Hundepension in Salzburg – aus einer Notwendigkeit heraus, die ich nie geplant hatte.
Heute blicke ich mit einem Lächeln auf diesen Wendepunkt zurück. Es war eine Entscheidung, die mein Leben vollkommen verändert hat, und manchmal führen gerade die ungeplanten Wege zu den schönsten Abenteuern. Was als Versuch begann, meinen eigenen Hund gut zu betreuen, entwickelte sich zu einer Karriere, die ich mit Leidenschaft und Liebe weiterführte – und die mir gezeigt hat, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen.
Die Behörden blieben beinhart
Die Behörden waren nicht gerade bekannt für ihren Humor – sie blieben eisern. Kaum hatten wir den Gewerbeschein für die »Pflege und Betreuung von Tieren« ergattert, flatterte auch schon die nächste Schikane ins Haus: »Für so etwas gibt es im Siedlungsgebiet keine Betriebsstätten-Genehmigung! Entweder ab ins Gewerbegebiet mit euch oder ihr baut im Grünland und lasst das als Sonderfläche deklarieren.« Ja, klar! Als könnte man einfach mit dem Finger schnippen und ein Stückchen Grünland in Bauland verwandeln. Das dauert gefühlt eine Ewigkeit, wenn es überhaupt jemals klappt. Diesen Gedanken konnte ich also direkt in die Tonne werfen.
Aber wegziehen? Ich wollte doch nicht aus unserem geliebten Einfamilienhaus raus, das wir mit so viel Herzblut und Schweiß errichtet hatten. Alle Nachbarn waren mit unserer Hundepension einverstanden und ich hatte sogar eine Unterschriftenliste, die ich stolz bei den Behörden einreichte. Keiner störte sich am gelegentlichen Bellen unserer Gäste. »Die kleinen Fluffis von Hausnummer XX sind viel lauter als eure«, hieß es oft, und das stimmte: Die zwei winzigen Yorkshire Terrier weiter die Straße runter kläfften Tag und Nacht, während unsere Vierbeiner erstaunlich ruhig waren. Trotzdem kam das Bellen-Verbot für uns.
Dann die Flut an amtlichen Schreiben! Einer unserer Kunden war glücklicherweise ein Rechtsanwalt. Sein Rat? »Gründet doch einfach einen Verein! Vereinsmitglieder können kostenlos ihre Hunde bei euch abgeben. Perfekte Zwischenlösung!« Gesagt, getan. Der »gemeinnützige Verein« war geboren und die Mitgliederzahl explodierte. Natürlich wurde unser Rechtsanwalt Ehrenmitglied – er sah die Sache sportlich. Mit seiner Hilfe zogen wir die Sache endlos in die Länge. Wir reichten Einsprüche ein, baten um Fristverlängerungen und schickten sogar seinen charmantesten Mitarbeiter, um die Beamtinnen zu bezirzen. Unser Rechtsanwalt lachte dabei jedes Mal und ließ uns seine Arbeit netterweise nicht in Rechnung stellen.
Fast niemand wollte uns – die Erfolgsstory der Ungewollten!
In der Zwischenzeit suchte ich verzweifelt nach einem neuen Standort. Zehn Monate lang durchforstete ich Gewerbeimmobilien, schrieb Anfragen, führte Telefonate – doch keiner wollte uns ein Grundstück vermieten. Verständlich, wer will schon eine Horde Hunde als Mieter? Blieb nur der Neubau. Aber nochmal bauen? Wir hatten gerade erst unser eigenes Haus fertiggestellt! Doch was sollte man machen?
Die Suche nach einem geeigneten Grundstück führte zu den lustigsten Angeboten. Eine Gemeinde bot uns ein Grundstück mitten im Wald an, ohne Busverbindung, ohne Nahversorger, dafür mit einer Tankstelle als Nachbar. Eine andere Gemeinde schlug uns ein winziges Grundstück zwischen Betonklötzen vor – garniert mit einem Strommast in der Mitte, der wie ein gigantischer Moskito-Zapper summte. Wer wollte da schon hin? Niemand – und wir auch nicht.
Endlich stießen wir auf ein passendes Grundstück in Neumarkt. Es war ein kleines Wunder: Der Bürgermeister dort hatte gerade einem ähnlichen Betrieb die Genehmigung erteilt, der dann aber abgesprungen war. »Wenn euer Nachbar einverstanden ist, könnt ihr es haben«, sagte er. Das war unser Glückstag! Die Nachbarn, eine sympathische Familie mit einem Taxiunternehmen, kamen vorbei und waren sofort überzeugt: »Eure Pension ist uns lieber als eine Tischlerei mit Kreissägen.« Hurra, wir hatten unser Grundstück!
Rudel-Nächte: Schnarch-Konzert und Kuschelchaos
Doch die Behörden machten uns weiterhin das Leben schwer. Zu Ostern 1998 flatterte ein besonders fieser »blauer Brief« ins Haus. Was blieb uns anderes übrig? Wir packten unsere fünfzehn Hunde und zogen heimlich für eine Woche in eine leer stehende Lagerhalle, während andere Hunde bei einer befreundeten Tierpension untergebracht wurden – in einer echten »Nacht- und Nebelaktion«. Der Rohbau unseres neuen Hauses stand schon, aber die Beamten ließen nicht locker. Mehrmals kamen sie mit Polizei bei uns vorbei und fragten: »Wo sind die Hunde?« Niemand verriet unser Versteck. Es fühlte sich an wie in einem Agentenfilm – wir gegen die Bürokratie.
Die »Nächte im Rudel« waren ein Erlebnis. Ich schlief auf einem provisorischen Bett, umringt von fünfzehn Hunden, die es sich um mich herum gemütlich machten. Morgens wachte ich regelmäßig mit mehreren Hunden im Bett auf, während die restlichen dicht an mich gekuschelt am Boden lagen. Es war chaotisch, aber auch eine der lustigsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Am Ende hat sich all der Aufwand gelohnt. Wir haben durchgehalten und unsere Hundepension hat ihr Zuhause gefunden – trotz aller behördlichen Hindernisse und unfreiwilligen Abenteuer.
Neubau im Turbo-Modus: Chaos trifft Kreativität
Der Bau unseres Hundehotels war ein Abenteuer, das selbst einen erfahrenen Baumeister ins Schwitzen brachte. Mit einer Gesamtfläche von über 700 qm im Innenbereich und einer ebenso beeindruckenden Zaunanlage sollte dieses Projekt in Rekordzeit entstehen. Der ortsansässige Baumeister hatte alles fest im Griff – zumindest theoretisch. In der Praxis gaben sich die Handwerker die Klinke in die Hand, sofern diese schon montiert war, und sorgten für ein ständiges Kommen und Gehen. Es war wie ein großes Theaterstück, in dem jeder Handwerker seine Rolle perfekt kannte – außer vielleicht der, der für die Innentüren zuständig war.
Neben der Tierpension wurde gleichzeitig der Büromöbelhandel meines Mannes mit hochgezogen, was bedeutete, dass wir nicht nur bellende Vierbeiner, sondern auch stapelweise Bürokratie zu jonglieren hatten. Der erste Spatenstich erfolgte am 1. März 1998, und genau sechs Monate später, am 1. September 1998, zogen wir ein. Warum so schnell? Nun, die Ämter standen uns im Nacken, die Schule fing im September an, und der Büromöbelhandel musste dringend in sein neues Zuhause umziehen, damit das alte Gebäude verkauft werden konnte. Unsere Sekretärin und der technische Zeichner arbeiteten in dieser Übergangszeit übrigens kurzerhand in unserem Wohnzimmer – was für zusätzliche Verwirrung sorgte, wenn sich zwischen Aktenordnern und Bauplänen plötzlich ein neugieriger Hundekopf hervorschob.
Abenteuerland Rohbau: Einzug mit Tohuwabohu-Garantie
Als wir endlich übersiedelten, war das Haus natürlich noch weit entfernt von »fertig«. Keine Innentüren, kein Außenputz und die Straße glich mehr einer Offroad-Strecke für Baufahrzeuge. Aber hey, wer braucht schon eine Küche, wenn die wichtigsten Dinge wie Kinderzimmer, Bad und Hundebereich funktionieren? Meine pragmatische Haltung dazu: »Ein Wohnzimmer wird doch total überbewertet!« Immerhin hatten wir genug Platz für die Hunde – und das war die Hauptsache.
Die Behörden hatten für unsere Hundepension spezielle Anforderungen. 240 cm hohe Zäune, Krankenstationen, Quarantäneräume und dazu noch die Vorschrift, dass bei der Fütterung immer zwei qualifizierte Mitarbeiter anwesend sein mussten. Klar, bei einem Rudel Welpen, die den ganzen Tag Futter zur Verfügung haben, ist das superpraktisch – nicht? Manche Vorschriften klangen so absurd, dass man sich fragte, ob die Beamten je selbst mit einem Hund zu tun hatten. Glücklicherweise wurde nicht jeder Unsinn streng kontrolliert und die meisten Beamten zeigten sich vernünftig.
Für sechs Monate trug meine Pension sogar stolz den Titel »Tierheim«. Das fühlte sich an, als hätte ich den Jackpot geknackt – nur ohne das viele Geld, denn Unterstützung gab es keine. Dafür aber jede Menge zusätzliche Pflichten und noch mehr Papierkram. Also entschied ich mich bald, diesen negativ klingenden Titel wieder abzulegen. Schließlich hatte ich bewiesen, dass meine Anlage als Tierheim funktionieren konnte. Mission erfüllt!
Getrennt vereint: Das Kunststück des Rudelwohnens
Getrennt, aber dennoch verbunden – ein Motto, das die perfekte Inspiration für unser »Rudel-Reich« lieferte. Der Bau? Eine akrobatische Meisterleistung: Wie erschafft man ein Paradies für Vierbeiner, das nicht nur gemütlich, sondern auch so behördengerecht ist, dass selbst die kritischsten Inspektoren vor Begeisterung den Atem anhalten? Der Wohnbereich für uns Menschen im ersten Stock war schnell geplant – ein echtes Kinderspiel. Doch der Hundebereich? Das war eine Herausforderung, die es in sich hatte.
Kaum hatte ich begonnen, den Hundebereich zu gestalten, landeten die Inspirationen aus verstaubten Tierheimbüchern schneller im Papierkorb, als man »Zwingerreihen« sagen konnte. Solche Konzepte? Nicht bei mir! Stattdessen entwarf ich ein großzügiges 120 qm großes »Hundewohnzimmer« – eine wahre Wellness-Oase für Vierbeiner. Die zentrale Spielfläche lud zum ausgelassenen Toben ein, während halb offene, gemütliche Rückzugsorte den Hunden eine exklusive Wohlfühlatmosphäre boten, ganz wie in einem eleganten Boutique-Hotel. Schieferblaue Wände, warme Holzverschalungen und riesige Fenster verliehen dem Raum eine lichtdurchflutete Eleganz, die selbst Architekten begeistern würde. Sogar die Stützsäulen wurden raffiniert integriert, sodass sie sich stilvoll in das Design einfügten – praktisch, chic und absolut hundegerecht!
Unser Hundewohnzimmer war das Herzstück des Hauses. Es hatte alles: eine elegante Ledercouch, schöne in die Fliesen eingearbeiteten Bilder, einen modernen Hängefernseher und sogar ein Klavier – man weiß ja nie, wann ein Hund in Stimmung ist »Für Elise« zu klimpern. Der Raum hätte glatt als stylisches Designhotel-Wohnzimmer durchgehen können, nur eben mit einem Hauch mehr Pfoten-Abdrücken und dem subtilen Duft nach Abenteuer.
Ende 2000 verabschiedete sich meine Ehe endgültig und einvernehmlich und ab 2001 stand ich plötzlich allein da – mit drei lebhaften Kindern, einem unfertigen Rohbau, der mehr Schulden als Ziegel hatte, und einem Hundehotel, das in Sachen Geschäftigkeit locker mit einem Ameisenhaufen konkurrieren konnte. Trotzdem ließ ich mich nicht unterkriegen. Irgendwie schaffte ich es, zwischen Hundekeksen und all den anderen Herausforderungen den Überblick zu behalten. Ich hatte etwas aufgebaut, das aus dem Rahmen fiel: eine Tierpension, die frischen Wind und humorvollen Charme in die Welt der Hundebetreuung brachte.
Kapitel 2 Iwan – der (gar nicht) Schreckliche
Meine ersten Jahre in der Hundepension waren wie ein großer Abenteuerspielplatz – ein chaotischer, haariger, bellen- und heulgespickter Spielplatz. Ich hatte damals noch die naive Vorstellung, dass ich mich von der winzigsten Chihuahua-Dame bis hin zum imposantesten Rottweiler durch nichts erschüttern lassen würde. »Eine gute Hundepension kann jeden Hund betreuen«, so meine selbstsichere Devise. Doch die Realität holte mich schnell ein – vor allem, wenn es um die etwas größeren Kaliber ging. Besonders das Wort »Dobermann« ließ mich damals innerlich zusammenzucken, denn in meinem Kopf spukten sofort Bilder von grimmig dreinschauenden, hochtrainierten Wachhunden mit kupierten Ohren und einem Blick, der direkt in die Seele schnitt. Doch wie heißt es so schön? Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
Der Fernsehauftritt und der Dobermann-Schock
Eines schönen Tages kam ein Anruf, der mich in einen Ausnahmezustand versetzte. Der ORF wollte über meine Hundepension berichten. Fernsehen! Das war meine große Chance, mich und meine noch junge Hundepension einem breiten Publikum vorzustellen. Natürlich sagte ich sofort zu, doch kaum hatte ich aufgelegt, packte mich das Lampenfieber. Ich war noch nie im Fernsehen gewesen und meine Vorstellungskraft spielte verrückt. Würde ich stammeln? Würde ich aussehen wie ein aufgescheuchtes Huhn? Und während ich mir noch überlegte, wie ich das alles überstehen würde, erhielt ich einen zweiten Anruf – eine Kundin wollte kurzfristig ihren Dobermann bei mir unterbringen.
»Ein Dobermann?«, fragte ich, und meine Stimme klang höher als sonst. »Ja, natürlich, kein Problem«, log ich, während mir innerlich das Herz bis zum Hals schlug. Der Gedanke, dass ich zum allerersten Mal in meinem Leben einen Dobermann in der Pension haben würde und dann auch noch vor laufender Kamera, ließ mich die Nacht kein Auge zumachen. Ich sah mich schon in einer Panikattacke auf dem Boden kauern, während der Dobermann fröhlich durchs Bild tapste und das Kamerateam sich köstlich über mein Elend amüsierte.
Am Drehtag war es dann so weit: Der Dobermann kam pünktlich und ich war bereit, ihm mutig entgegenzutreten. Doch als er durch die Tür tappte, fiel ich fast vom Glauben ab. Dieser Hund war … ein Kuschelbär! Ein freundlich wedelnder Riese, der sich ohne Zögern ins Rudel einfügte und mich mit seinem entspannten Wesen völlig umhaute. Mein Bild vom furchteinflößenden Dobermann zerplatzte schneller als eine Seifenblase. Der TV-Dreh verlief reibungslos und ich war plötzlich die »Hundeflüsterin«, die sogar mit einem Dobermann spielerisch umgehen konnte. Die lokale Presse jubelte und meine Pension war plötzlich Stadtgespräch. In den Tagen danach klingelte das Telefon ununterbrochen. Wer hätte gedacht, dass ein Dobermann und ich ein so perfektes Team abgeben würden?
Iwan – der Champion unter den Rottweilern
Während ich den Dobermann also erfolgreich gemeistert hatte, war meine nächste große Herausforderung einer der »sanften Riesen« – ein Rottweiler namens Iwan. Ich mochte Rottweiler von Anfang an. Sie hatten diese beruhigende Präsenz, fast wie ein Fels in der Brandung, der auch bei Sturmwinden ruhig stehen bleibt. Und so freute ich mich besonders, als eine Kundin zwei dieser prächtigen Tiere für drei Wochen bei mir anmeldete: Kady, ein zierliches Weibchen von zarten 50 Kilo, und Iwan, ein Rüde mit stolzen 60 Kilo, der zudem die höchste Stufe im Schutzhundesport erreicht hatte – Schutzhund-3, kurz SchH 3.
Die Besitzerin klärte mich allerdings darüber auf, dass Iwan eine kleine »Spezialanforderung« hatte: Sollte uns ein aggressiver Hund begegnen, müsste ich sofort die Leine loslassen. Andernfalls könnte er womöglich mich statt des anderen Hundes »regulieren«. »Na super«, dachte ich, »Was für eine nette Aussicht.« Aber na ja, was tut man nicht alles für seine Hunde. Also nahm ich Iwan mit einem mulmigen Gefühl mit auf unsere ersten Spaziergänge – immer mit dem Gedanken, die Leine im Notfall loszulassen.
Zum Glück entpuppte sich Iwan als echter Gentleman. Kein aggressives Verhalten, kein Bellen, nichts. Iwan war der wohlerzogene King im Hundeparadies, ein echter Ruhepol mit stolzer Haltung. Er lief neben mir her, voller Selbstbewusstsein und mit einer beeindruckenden Gelassenheit, die eine beruhigende Sicherheit ausstrahlte. Es war, als würde seine Anwesenheit sämtliche Sorgen vertreiben, und ich konnte nicht anders, als mich von seiner Souveränität mitreißen zu lassen. Je länger wir zusammen unterwegs waren, desto mehr spürte ich, wie sich meine Anspannung löste und ich die Spaziergänge mit ihm tatsächlich genießen konnte.
Der wilde Schäferhund-Mix
Doch dann kam der Tag, an dem meine Nerven wirklich auf die Probe gestellt wurden. Ich war gerade mit Iwan unterwegs, als plötzlich ein frei laufender Schäferhund-Mix auf uns zuschoss – ohne Halsband, ohne Besitzer in Sicht. Mein Herz hämmerte in meiner Brust und ich hörte sofort die warnenden Worte von Iwans Besitzerin in meinem Kopf: »Lass die Leine los, wenn es brenzlig wird.« Aber der Gedanke, diesen 60-Kilo-Rottweiler einfach loszulassen, ließ mir den kalten Schweiß ausbrechen. Was, wenn er den anderen Hund in Stücke zerlegte? Oder schlimmer noch, was, wenn er beschloss, komplett die Kontrolle zu übernehmen und all meine Anweisungen in den Wind zu schlagen?
Ich hatte keine Zeit zu überlegen. Der Schäferhund-Mix stürmte immer näher und in einem Reflex rief ich Iwan ein scharfes »Pla-atz« zu. Iwan gehorchte sofort und legte sich neben mich, brav wie ein Musterschüler, während ich fieberhaft versuchte, die Situation zu entschärfen. Mein Puls raste, aber ich wusste, dass Iwan zuverlässig liegen bleiben würde – seine Ausbildung war erstklassig. Die Spannung war zum Greifen nah und ich machte ein paar Schritte auf den Schäferhund-Mix zu, Adrenalin pur in meinen Adern. Dann brüllte ich aus voller Kehle: »Nein!« und setzte ein entschlossenes »Hey!« hinterher. Zu meiner Erleichterung blieb der Schäfermix minutenlang wie angewurzelt stehen, drehte sich dann um und trottete davon, als hätte er soeben den leibhaftigen Hundegott persönlich getroffen.
Iwan? Der lag seelenruhig neben mir, als wäre nichts passiert. Als ich ihm das Kommando »Los, weiter!« gab, sprang er auf und trabte fröhlich voran, als wäre der ganze Vorfall nur eine winzige Unterbrechung im großen Abenteuer unseres Spaziergangs. »Puh«, dachte ich erleichtert, »das war knapp.« Für einen Moment fühlte ich mich wie eine Heldin aus einem Actionfilm – nur ohne Explosionen, aber mit einem perfekt erzogenen, heldenhaften Hund an meiner Seite.
Hurra – endlich durfte ich mit dem Superstar trainieren!
Als die Besitzerin ihren Hund abholte, erzählte ich ihr von meiner unheimlichen Begegnung, bei der ich die Situation so elegant gelöst hatte. Zu meiner Erleichterung meinte sie, sie hätte genauso reagiert. Da fühlte ich mich gleich ein Stück besser! Allerdings musste ich zugeben, dass mein eigener Haushund zu dieser Zeit zwar auf dem Weg zum Schutzhund war, aber von solch hohen Prüfungen wie Iwan noch meilenweit entfernt. Doch allein die Chance, einen waschechten Turnierhund mal »am Platz« führen zu dürfen, war für mich wie ein Sechser im Lotto!
Stellen Sie sich vor, sie haben ein ganz nettes Springpferd und plötzlich kriegen Sie die Gelegenheit, ein preisgekröntes Superpferd zu reiten – das war’s für mich mit Iwan. Also fragte ich die Besitzerin etwas schüchtern, ob ich ihn mal in meinen Hundeverein mitnehmen könnte. Zu meinem großen Glück sagte sie Ja! Ich konnte es kaum erwarten, bis die nächste Reservierung anstand.
Beim nächsten Besuch nahm ich sie beim Wort – und Iwan natürlich mit. Es war, als würde ich mit einem Formel-1-Wagen an einem Kart-Rennen teilnehmen. Iwan war einfach perfekt! Mein Hundetrainer-Herz schlug Purzelbäume. Wer weiß, was die Prüfung SchH 3 bedeutet, kann sich vorstellen, wie beeindruckend dieser Hund arbeitete. Das jetzt im Detail zu beschreiben, würde den Rahmen sprengen – sagen wir einfach, er war ein Hundetrainingstraum auf vier Pfoten. Nach dem Training hatte ich Iwan noch besser im Griff und mein Herz hüpfte vor Freude.
Mobbing in der Schule – und wie Iwan zum Retter wurde
Ich habe lange überlegt, ob ich diese Geschichte aufschreiben soll, denn besonders stolz bin ich nicht auf mein Verhalten. Aber sie gehört nun mal zu meiner Vergangenheit. Zur Verteidigung kann ich vorab sagen: Es gab in meinem Leben nur zwei Momente, in denen ich Hunde als »Pseudo-Waffe« einsetzte. Und auch da nur, weil ich wusste, dass ich immer selbst klarkomme. Das eine Mal verscheuchte ich mit meinem treuen Begleiter eine besonders hartnäckige Gruppe von Glaubensvertretern, die trotz meiner permanenten Ablehnung immer wieder mit ihren Zeitungen an der Tür klingelten. Das andere Mal war die Sache mit dem Rottweiler Iwan und einer Jugendbande, die den Schulweg zur echten Gefahrenzone machte.
Was tun, wenn Kinder sich fürchten, den Schulweg zu betreten? Was tun, wenn eine Bande von Schülern nur darauf wartet, andere zu verprügeln oder auszurauben? Was tun, wenn einem bekannt ist, dass schon mehrere Kinder blutig geschlagen wurden? Mein erster Versuch war, mich an den Direktor zu wenden und ihn auf das Mobbing aufmerksam zu machen. »Wir wissen von dem Problem, aber wir können wenig tun«, meinte er. Die Lehrer beobachteten die Rabauken in den Pausen, aber auf dem Heimweg waren die Kinder auf sich allein gestellt. Und so änderte sich wochenlang nichts – im Gegenteil, es wurde immer schlimmer.
Zum Glück blieb mein eigenes Kind weitgehend verschont und erlitt nur einmal eine kleine Verletzung. Aber es war klar: So konnte es nicht weitergehen. Die Angst der anderen Kinder, die sich jeden Tag umsahen, bevor sie spielen oder zur Schule gehen konnten, brach mir das Herz. Also entschloss ich mich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ich sammelte Informationen, sprach mit anderen Eltern und setzte alles daran, eine Veränderung herbeizuführen, damit unsere Kinder wieder sicher und unbeschwert leben konnten.
Die Konfrontation mit der Jugendbande
Eines Tages beschloss ich, die Jugendbande höchstpersönlich zur Rede zu stellen. Da saßen sie wieder – fünf Jungs, irgendwo zwischen 11 und 14 Jahre alt, und lümmelten sich auf ihrer Stamm-Bank, als hätten sie nicht nur die Straße, sondern das ganze Viertel gekauft. Mit festem Schritt marschierte ich auf sie zu, innerlich meinen mutigen »Elternsprechtag-Blick« aufgesetzt. »Was glaubt ihr eigentlich, was ihr hier macht?«, fragte ich in meinem strengsten Ton. Die Antwort? Ein kollektives Augenrollen, schnippische Sprüche und eine Parade vulgärer Handzeichen, die sie wohl extra für solch feierliche Anlässe einstudiert hatten. Bevor ich noch Luft holen konnte, hatten die Jungs sich schon schadenfroh grinsend aus dem Staub gemacht.
Na wunderbar. Gespräch gescheitert und ich war kein bisschen weiter. Es war klar: Plan B musste her. Doch was jetzt? Die Schulleitung war hilflos, die Polizei konnte wegen der Minderjährigkeit der Jungs kaum etwas ausrichten und die Eltern der Rabauken schienen sich herzlich wenig für die Eskapaden ihrer Sprösslinge zu interessieren – vermutlich froh, dass sie zu Hause keinen Ärger machten. Mir blieb also nur eine Wahl: Wenn niemand diese Flegel zur Räson bringen konnte, dann würde ich ihnen eben selbst auf die Pelle rücken.
Mein »theatralischer« Auftritt mit Iwan
Es machte mir keinen Spaß, aber der Zustand konnte so nicht bleiben. Eines Nachmittags, als die Schule aus war, schnappte ich mir Iwan und machte mich auf den Weg. Die fünf Bengel saßen, wie üblich, auf ihrer Bank und machten sich über die vorbeigehenden Schüler lustig. Mit schnellem Schritt ging ich auf sie zu, Iwan an der kurzen Leine. »Sitz!«, befahl ich, und Iwan setzte sich brav an meine Seite. Plötzlich herrschte Stille. Keine frechen Kommentare, keine Gesten – und vor allem: kein Weglaufen.
Es reichte, dass Iwan da war. Seine bloße Anwesenheit und meine ernste, langgezogene Ansage: »Wegrennen wäre jetzt keine gute Idee. Bleibt hier und hört mir gut zu.« Totenstille. Die Jungs schauten mich an, als wäre ich gerade aus einem Gruselfilm gestiegen. »Ich sag das nur einmal: Ich will nicht noch mal sehen oder hören, dass ihr jemanden verprügelt, beschimpft oder beklaut. Weder hier noch irgendwo anders. Klar?« Man konnte die Angst in ihren Gesichtern sehen. Drei Minuten stand ich vor ihnen, in totaler Stille. Ich schaute ihnen nacheinander tief in die Augen, bevor ich mit einem scharfen »Fuß!« Iwan und mich aus der Szene zurückzog.
Zivilcourage oder Selbstjustiz?
Meine Freunde nannten es später »Zivilcourage«, manche zögerten nicht, von »Selbstjustiz« zu sprechen. Wie auch immer man es drehte, nach meinem kleinen Auftritt an der Schule herrschte plötzlich Frieden. Das Mobbing, das die Schüler monatelang gequält hatte, endete so abrupt, dass es fast schon magisch wirkte. Nur wenige wussten, was wirklich hinter diesem plötzlichen Wandel steckte, und ich machte keinen großen Wirbel darum. Die Geschichte war einer dieser Momente, die man besser nicht breittritt – vor allem nicht, wenn schlaue Anwälte vielleicht daraus ein juristisches Drama hätten stricken können. Aber ganz offen? Ich bereue diesen Tag nicht. Die Schulleitung und die Polizei hatten kläglich versagt, und ich konnte einfach nicht zusehen, wie Kinder Tag für Tag in Angst lebten.
Gut, es war vielleicht nicht die ehrenhafteste Lösung, einen Hund als »Pseudo-Waffe« einzusetzen, aber Iwan war in dieser Rolle grandios. Mit seiner eindrucksvollen Präsenz schüchterte er die frechen Jungs ein, ohne auch nur ein einziges Mal knurren zu müssen. Er saß einfach nur da, majestätisch und ruhig, während die Flegel merkten, dass ihre Tage als Mini-Tyrannen gezählt waren. Iwan war an diesem Tag mein stiller Held, der völlig unaufgeregt für Frieden sorgte. Die erleichterten Gesichter der Kinder, die zum ersten Mal seit Langem ohne Angst zur Schule gehen konnten, werde ich nie vergessen. Ihr Lächeln war für mich der beste Beweis, dass manchmal unkonventionelle Mittel die einzigen sind, die wirklich etwas bewirken.
Kapitel 3 Das Blutbad
Manche Gesprächspartner fragten mich oft mit neugierigen Augen: »Wie oft wurdest du schon gebissen?« Als jemand, der mit so vielen Hunden zu tun hat, war das wohl eine verständliche Frage. Die Leute blickten dabei meist auf meine Arme und Hände, um zu prüfen, ob irgendwo Narben zu sehen sind. Ich wünschte, ich könnte stolz behaupten, dass ich noch nie einem Hundebiss zum Opfer gefallen bin. Doch trotz größter Vorsicht blieb mir diese schmerzvolle Erfahrung nicht erspart. Wenngleich ich die Beißvorfälle noch an einer Hand abzählen konnte – zumindest, wenn ich das hier beschriebene »Blutbad« als einen einzigen Vorfall rechne.
Bissvorfälle waren selten, aber unvermeidbar. In Hundepensionen oder anderen Einrichtungen, wo viele Hunde zusammenkamen, waren Bissverletzungen bei Menschen sehr selten. Der Profi, also ich, schätzte die Situation immer gut ein und traf entsprechende Vorkehrungen. Die oberste Regel lautete: Kein Tierbetreuer durfte verletzt werden! Denn fiel ein Mitarbeiter aus, war das nicht nur unangenehm, sondern konnte den ganzen Betrieb durcheinanderbringen. Hunde, bei denen eine erhöhte Beißgefahr bestand, wurden daher in gesicherten Räumen untergebracht. Wenn es notwendig war – etwa bei Tierarztbesuchen oder intensiven Pflegeeinheiten – kam auch mal der Maulkorb zum Einsatz. Aber selbst die beste Planung konnte nicht immer verhindern, dass es ab und zu doch zu einem Vorfall kam.
Vertrauen zu meinen eigenen Hunden
Im Laufe der Jahre hatte ich schon über ein Dutzend große Hunde als eigene Haustiere. Nicht alle von ihnen waren immer leicht zu führen. Mein allererster Hund Dino stand ein einziges Mal sogar knurrend über meiner Kehle. Ich reagierte in dieser Situation aus dem Bauch heraus richtig. Nachdem ich die Rangordnung klarstellte, kam es nie wieder zu so einem Vorfall.
Ich hatte zu jedem meiner Hunde ein besonderes Vertrauensverhältnis. Keiner meiner eigenen Hunde hatte jemals einen Menschen gebissen. Das wäre auch undenkbar gewesen, denn ein Hund, der einen Menschen biss, stellte in vielerlei Hinsicht eine ernsthafte Gefahr dar. Ein solcher »Beißer« hätte kaum noch unbeschwert mit anderen Menschen in Kontakt kommen können, was sein Leben als Haustier erheblich eingeschränkt hätte. Vielleicht hatten meine Hunde gespürt, dass ich so eine Situation niemals zugelassen hätte, und hatten sich deshalb stets entsprechend verhalten.
Delogierung bei Haushalt mit mehreren Tieren
Dann kam dieser eine Sonntag, der das Potenzial zum »Blutbad« in sich trug. Es war ein recht ruhiger Tag, so wie die meisten Sonntage in unserer Hundepension. Keine Ankünfte, keine Abreisen, keine Besichtigungen – nur etwas Routinearbeit. Ich freute mich auf einen entspannten Tag, bis plötzlich das Telefon klingelte. Es war die Polizei, mit der wir regelmäßig zusammenarbeiteten, insbesondere wenn es um Tierbergungen oder Unterbringungen ging.
Zur Polizei und der Tierrettung hatte ich einen guten Draht. Obwohl das nicht unser eigentlicher Job war, halfen wir manchmal im Tierschutz aus. Deswegen war es nicht ungewöhnlich, von Beamten oder anderen Organisationen angerufen zu werden. Gerade an gesetzlichen freien Tagen waren die Tierheime schwach oder gar nicht erreichbar. Gut, dass es meinen Betrieb gab – irgendwer war dort immer.
»Wir haben morgen eine Delogierung«, hieß es seitens der Polizisten. »Es handelt sich um einen Messi-Haushalt, wo eine Unmenge an Tieren auf engstem Raum lebt. Wegen bestialischem Gestank beschweren sich laufend die Nachbarn. Nun ist der Familie die Wohnung komplett gekündigt worden. Sieben Rottweiler, unzählige Katzen, Vögel, Hamster und Reptilien sind dort. Für die Kleintiere haben wir schon eine Unterbringung gefunden, aber für die Hunde und Katzen brauchen wir dringend Hilfe. Könnt ihr ein paar davon aufnehmen?«
Wir konnten weder ungeimpfte noch unkastrierte Katzen, Vögel oder Reptilien aufnehmen – uns fehlten dafür sowohl die nötige Erfahrung als auch der Platz. Anders verhielt es sich mit Rottweilern: Grundsätzlich waren wir bereit, sie aufzunehmen, sofern uns ausreichend Informationen vorlagen. Die zuständigen Behörden prüften den Fall und schon bald wurde berichtet, dass die beiden erwachsenen Rottweiler als äußerst aggressiv eingestuft worden waren. Während für den Rüden bereits eine Unterkunft gefunden war, suchten die Mutterhündin und ihre fünf 11 Wochen alten Welpen weiterhin dringend nach einer passenden Unterbringung.
Die Verantwortung für ein großes, aggressives Muttertier, das ich nie zuvor gesehen hatte, konnte und wollte ich nicht übernehmen. Die fünf Welpen hingegen bereiteten mir keine Sorgen – schließlich waren sie noch unschuldige, unbedarfte Jungtiere. Nach einem weiteren Telefonat erfuhr ich, dass die Kleinen am nächsten Tag direkt von der Besitzerin gebracht würden. Sie sollte vor Ort den Aufnahmevertrag unterschreiben, wodurch ich offiziell zur rechtmäßigen Eigentümerin der Welpen wurde und für jeden von ihnen ein neues, liebevolles Zuhause suchen konnte. Alles schien unkompliziert – dachte ich zumindest …
Rottweiler-Welpen kamen an
Der nächste Tag brach an und ich machte mich bereit für die Ankunft der angekündigten Hunde. Es gab noch einiges vorzubereiten: Ich richtete einen separaten Bereich für die Welpen ein, sorgte dafür, dass genügend Wasser und Futter bereitstanden, und hielt Decken für die Kleinen bereit, damit sie sich schnell sicher und geborgen fühlen konnten. Meine Gedanken kreisten dabei immer wieder um die Mutterhündin, die nicht mitgebracht werden sollte, und um die Umstände, die diese Welpen so dringend auf der Suche nach einem neuen Zuhause gemacht hatten.
Am späten Nachmittag war es dann so weit. Ich hörte ein Auto auf den Hof fahren und sah aus dem Fenster. Was ich erblickte, ließ mich einen Moment innehalten: Eine chaotische Familie stieg aus dem Wagen. Von geordneter Übergabe oder einem ruhigen Abschied war nichts zu spüren. Die Mutter, eine Frau mit fahlem Teint, schwankte so sehr, dass es offensichtlich war, wie viel Alkohol sie intus hatte. Ihr Ehemann, ebenfalls sichtlich betrunken, taumelte hinter ihr her, während zwei Kinder, etwa im Grundschulalter, die Traglast für die fünf kleinen Rottweiler-Welpen übernahmen.
Die Szene, die sich dann abspielte, war verstörend. Die Frau plapperte lautstark und unverständlich, während der Mann sie versuchte zu überreden, nicht noch eine Zigarette auf dem Hof anzuzünden. Die Kinder setzten in der Zwischenzeit die Transportboxen auf den Boden, öffneten sie und ließen die Welpen hektisch herauskrabbeln. Die Kleinen wirkten erschöpft, sichtlich mitgenommen von der Reise und dem Tumult um sie herum. Ihre Körperhaltung sprach Bände: eingeklemmte Schwänzchen, zitternde Beine und sie wichen sofort zurück, wenn sich einer der Erwachsenen ihnen nähern wollte.
Ich versuchte, Ruhe in die Situation zu bringen und die Tiere zu beruhigen, doch der chaotische Lärmpegel der Familie erschwerte alles. Die Übergabe des Aufnahmevertrags verlief entsprechend zäh. Die Mutter unterschrieb nur widerwillig und murmelte dabei unverständliche Floskeln, während der Vater ungeduldig danebenstand und lallend verkündete, dass sie jetzt »endlich frei« seien.
Es war keine liebevolle Abschiedsszene, sondern ein trauriger Moment, der mir nur zu deutlich zeigte, unter welchen Bedingungen diese Welpen vermutlich ihr bisheriges Leben verbracht hatten. Während die Welpen noch versuchten, ihre erste Begegnung mit der neuen Welt zu verarbeiten, lieferten sich die Eltern einen hitzigen Streit darüber, wer die nächste Runde Bier holen müsste.
Am Ende waren die Welpen bei uns – und ich um eine absurde Anekdote reicher. Als die Familie schließlich den Hof verließ und der Motor des Autos nicht mehr zu hören war, atmete ich tief durch. Vor mir lagen fünf kleine, erschrockene Seelen, die ab jetzt eine Chance auf ein besseres Leben bekommen sollten.
Es stank bestialisch
Bereits bei der Ankunft der Familie schlug mir ein Geruch entgegen, der jedem Müllcontainer Konkurrenz gemacht hätte. Die Welpen hatten während der Fahrt anscheinend ihre Mägen gründlich entleert und dabei eine explosive Mischung aus Nudeln, Wurstresten und halbverdautem Futter hinterlassen – nicht etwa auf dem Boden der Transportbox, sondern direkt in ihrem Fell. Als wäre das nicht schon genug, mischte sich auch noch Durchfall in dieses unschöne Szenario, der ebenfalls großzügig verteilt worden war. Die kleinen Rottweiler sahen aus, als hätten sie eine sehr unglückliche Begegnung mit einem Kochtopf und einem Misthaufen zugleich gehabt.
Doch das war nur die oberflächliche Katastrophe. Unter dieser ersten, bereits erschütternden Schicht lauerte ein durchdringender, süßlich fauliger Gestank, der sich wie ein ungebetener Gast in meine Nase setzte. Binnen Sekunden hatte ich das Gefühl, meine Nasenschleimhäute würden sich verabschieden, und die Übelkeit stieg unaufhaltsam in mir hoch. Es war ein Geruch, der nicht nur den Raum, sondern auch meine Sinne vollständig in Beschlag nahm – eine Duftwolke, die man nicht einfach ignorieren konnte, selbst wenn man es verzweifelt versuchte.
Obwohl ich schnell den Papierkram mit der Familie erledigt hatte – eine sportliche Leistung angesichts der duftenden Gesellschaft – öffnete ich gleich danach sämtliche Fenster im Besucherbereich. Doch es war zwecklos: Der Gestank hatte bereits Besitz vom gesamten Erdgeschoss ergriffen. Unsere weißen Kittel, mit denen wir die Welpen getragen hatten, hatten inzwischen einen bräunlichen Farbton angenommen und waren ebenso stinkend wie deren Träger. Ich hatte schon vieles erlebt, aber dieser Geruch war eine echte Zumutung, die sich unauslöschlich in mein Gedächtnis brennen würde.
Die Lösung war klar: Die Welpen mussten sofort in die Wanne. Am nächsten Tag erwarteten wir Kunden und diesen Geruch konnte ich weder ihnen noch meinem Team oder mir selbst zumuten. Normalerweise war ein Badetag für Welpen eine entspannte Angelegenheit: Wasser auf angenehme Temperatur einstellen, Welpe in die Wanne setzen, ordentlich einschäumen, abbrausen, abtrocknen – fertig. Doch dieser Tag sollte alles andere als normal verlaufen.
Kampf im Badezimmer
Ich betrat den Raum, in dem die fünf Welpen auf mich warteten. Ich konnte bislang sowas immer locker allein. Bestückt mit dem nötigen Zubehör befand ich mich im Gruppenzimmer 4, in welchem eine abgestufte Hunde-Badewanne eingebaut war. Trotz des fürchterlichen Gestanks sahen die Kleinen auf ihre Weise niedlich aus, ein kleines, zitterndes Häufchen Elend. Doch sobald ich nur einen Schritt auf sie zuging, brach Chaos aus. Einige Welpen begannen panisch zu schreien, als wäre ich der Teufel persönlich. Andere fletschten ihre Milchzähne und knurrten bedrohlich. Elf Wochen alte Welpen, die so aggressiv reagieren – das hatte ich noch nie erlebt. Was hatten die armen Kleinen bloß erlebt, dass sie dermaßen durchdrehten? Ich stand zwei Meter von den Welpen entfernt und sie schrien, als ginge es um ihr Leben.
Damit sie zur Ruhe kommen, verharrte ich einige Minuten vor ihnen in der Hocke. Wenn ein elf Wochen alter reinrassiger Rottweiler-Welpe drohend seine Milchzähnchen zeigt, sieht das irgendwie drollig aus. Ich näherte mich dem ersten kleinen Badegast vorsichtig, mit der Absicht, ihn sanft aus der Gruppe herauszunehmen. Doch bevor ich reagieren konnte – Schnapp, da war es passiert. Ein Biss – und er war tief. Blut tropfte aus meiner Hand und ich wusste, das Baden hier wird nicht die einfache Prozedur, die ich mir erhofft hatte. Jetzt war klar: Ich brauchte Unterstützung. Das hieß, so routinemäßig locker würde das Baden nicht möglich sein. Allein arbeiten schon gar nicht. Abwarten, bis die Welpen vertrauter werden, ging auch nicht, denn wie beschrieben zog sich der Gestank durch absolut alle Räume. Oder bildete ich mir das ein? Ich hatte den Geruch jedenfalls »in der Nase«.
Zusammen mit einem meiner kräftigen Mitarbeiter, ausgerüstet mit bissfesten Handschuhen und Gummistiefeln, gingen wir in die zweite Runde. Unsere Strategie? Eine Schlinge um den ersten Welpen legen und ihn wie ein kleines Wildpferd in die Badewanne bringen. Doch selbst dort entpuppte sich der kleine Kerl als alles andere als kooperativ. Der winzige Rottweiler kämpfte mit einer Kraft, die ich bei so einem kleinen Wesen nicht für möglich gehalten hätte. Kaum entkam das Schnäuzchen dem festen Griff meines Mitarbeiters, schnappte es zu.
Gemeinsam sind wir stark
Wir arbeiteten jetzt im Team und verfolgten dabei das Motto: »Geht nicht – gibt’s nicht!« Aus den Leinen formten wir improvisierte Schlingen, die kurzerhand zu Lassos umfunktioniert wurden. Damit zogen wir die kleinen Badeverweigerer, einen nach dem anderen, aus ihrem Versteck. Mein Kollege übernahm den Job des »Maul-Controllers« und hielt die kleinen Schnauzen geschickt zu, während ich mit Wasser und Schaum bewaffnet meinen Part erledigte. Einen Maulkorb wollte ich den Welpen, die sich noch in ihrer sensiblen Prägungsphase befanden, auf keinen Fall zumuten.
Sobald ich einen der Kleinen in die Wanne gehoben hatte, begann der eigentliche Kampf: Ein wild zappelndes, protestierendes Fellknäuel gründlich abzubrausen, einzuschäumen und anschließend abzutrocknen – alles, während es verzweifelt versuchte, mir aus den Händen zu entkommen –, klingt vielleicht simpel, doch in Wahrheit war es eine schweißtreibende, nervenaufreibende Herausforderung, die nichts mit der Vorstellung eines friedlichen Welpen-Badens zu tun hatte.
Die Kraft der widerwilligen Welpen hatte ich unterschätzt. Kaum entkam das Schnäuzchen dem Griff, wurde gebissen. Nach jedem Welpen mussten wir eine kurze Pause einlegen, um unsere Wunden zu verarzten. Es war ein wahrer Kampf und eine blutige Prozedur. Die einst strahlend weiße Badewanne war jetzt mit rosaroten Spritzern verziert – Blut, nicht von den Hunden, sondern von uns. Der Raum sah aus, als hätte ein Massaker stattgefunden.





























