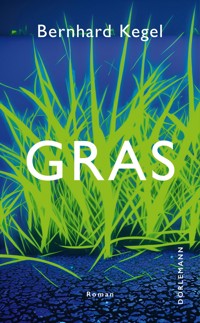Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
So hatte sich Anne Detlefsen den ersten gemeinsamen Urlaub nicht vorgestellt: Statt mit ihr die Sonne von Santa Cruz zu genießen, hat Hermann Pauli sich auf die Suche nach einem seltsamen Hai begeben, der selbst den Experten der örtlichen Charles-Darwin-Forschungsstation Rätsel aufgibt. Ist es möglich, dass die Lebensgemeinschaften im Meer sich rasant verändern? Und auch Anne bekommt plötzlich zu tun. Als vor der Insel Nacht für Nacht Schiffe in Flammen aufgehen, juckt es die Leiterin der Kieler Mordkommission in den Fingern, der Sache auf den Grund zu gehen. Kommt der Brandstifter aus den Reihen der Fischer, die zur Durchsetzung ihrer Interessen bekanntlich auch vor Gewalt nicht zurückschrecken? Die Verhältnisse sind kompliziert – im Wasser wie an Land. Fesselnd und zugleich sachlich fundiert gewährt Bernhard Kegel in seinem neuesten Wissenschaftsroman Einblicke in Faszination und Abgründe der biologischen Forschung – diesmal vor der zauberhaften und legendenumrankten Kulisse des Galapagos-Archipels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
mare
Bernhard Kegel
Abgrund
Roman
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2017 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel / Petra Koßmann, mareverlag, Hamburg
Abbildung plainpicture / Christopher Civitillo – aus der plainpicture Kollektion Rauschen
Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg
Datenkonvertierung E-Book bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-330-9
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-251-7
www.mare.de
Inhalt
Prolog
Teil 1
1 Isla Santa Cruz, Charles Darwin Research Station
2 Isla Isabela, Queen Mabel
3 Isla Santa Cruz, Puerto Ayora
4 Isla Fernandina, Queen Mabel
5 Isla Santa Cruz, Puerto Ayora
6 Isla Isabela, Canal Bolívar, Queen Mabel
7 Isla Santa Cruz, Charles Darwin Research Station
8 Isla Isabela, Canal Bolívar, Queen Mabel
9 Isla Santa Cruz, Puerto Ayora
10 Isla Santa Cruz, Charles Darwin Research Station
11 Isla Isabela, Canal Bolívar, Queen Mabel
12 Isla Santa Cruz, Charles Darwin Research Station
13 Isla Santa Cruz, Puerto Ayora
14 Isla Santa Cruz, Charles Darwin Research Station
15 Islas Galapagos, 0° 22′ 15″ S, 90° 27′ 14″ W
Teil 2
16 Isla Santa Cruz, Charles Darwin Research Station
17 Islas Galapagos, 0° 25′ 22″ S, 90° 22′ 20″ W
18 Isla Santa Cruz, Charles Darwin Research Station
19 Isla Daphne Major
20 Parque Nacional Yasuní, Ecuador
21 Isla Daphne Major
22 Kiel, Deutschland
Epilog
Dank
Prolog
»Man nehme fünfundzwanzig Haufen Kohlenschlacken, die hier und da auf einem Grundstück vor der Stadt ausgekippt sind, stelle sich einige von ihnen zu Bergen vergrößert und den Rest des Grundstücks als Meer vor, dann hat man das richtige Bild von dem allgemeinen Eindruck, den die Encantadas oder Verwunschenen Inseln bieten. Eher eine Gruppe von erloschenen Vulkanen als von Eilanden; genauso, wie die Welt aussehen würde, wenn als Strafgericht eine Feuersbrunst darüber hinweggegangen wäre.
Es ist zu bezweifeln, ob irgendeine Stelle auf Erden dieser Inselgruppe an Trostlosigkeit gleichkommt.«
Herman Melville
James Island (Isla Santiago), Galápagos, Oktober 1835
»Covington!«
Syms kniete im dichten Gestrüpp auf dem Boden, um den Vogel zu untersuchen, den er gerade geschossen hatte. Gehört hatte er nichts, seine Ohren waren taub vom Knall des Schusses. Doch irgendein Gefühl ließ ihn aufblicken. Hatte jemand gerufen? Er hob den Kopf, schob den Hut in den Nacken, streckte den Rücken und sah sich nach allen Seiten um.
»Hier bin ich, Covington. Hier drüben.«
Auf einer kleinen Lichtung, etwa fünfzig Meter entfernt, sah Syms Covington einen jungen Mann, der wild mit den Armen durch die Luft ruderte und zu lachen schien. Er saß auf etwas, das einem großen runden Stein ähnelte, einem Stein, der sich offenbar bewegte. »Sieh dir an, wie stark sie sind«, rief der Mann. Seit sie zusammen über die endlose Weite der Pampa geritten waren, nannte Syms ihn gern Don C. D.
Er runzelte die Stirn und staunte. So ausgelassen hatte er seinen Herrn noch nie erlebt. Ihm gegenüber gab er sich sonst eher ernst und wortkarg, und nun saß er auf dem Rücken einer grotesk riesigen Schildkröte und amüsierte sich wie ein Kind. Jetzt riss er die Knie hoch wie ein Rodeoreiter und brach erneut in Gelächter aus. »Ich wette, sie können einen erwachsenen Mann tragen. Versuch’s auch mal.« Er schlug mit der flachen Hand auf den Panzer. »Los, beweg dich! Mach schon!«
Syms verstand nichts von dem, was sein Herr rief, war aber aufgestanden, um besser sehen zu können, zeigte ein breites Grinsen und winkte. Er wollte nicht, dass Don C. D. merkte, wie schlecht es mittlerweile um sein Gehör stand. Er hatte um diese Position gekämpft, und er hatte sie verdient, mehr als jeder andere an Bord, deshalb wollte er sie unter keinen Umständen verlieren. Während die Beagle auf See ihre Messungen durchführte, unternahm der Naturforscher immer wieder weite, mitunter wochenlange Reisen ins Landesinnere. Und er, Syms Covington, Sohn eines Metzgers aus Bedford und eigentlich als Fiedler und Schiffsjunge an Bord, durfte ihm dabei zur Hand gehen, eine einmalige Gelegenheit, dem eintönigen Leben auf dem Schiff zu entkommen und Land und Leute kennenzulernen. Vom einfachen Matrosen zum Entdecker – was für ein Aufstieg!
Er wusste, dass Don C. D. ihn anfangs seltsam gefunden und nicht besonders gemocht hatte. Aber er verfügte über eine gut lesbare Handschrift, erwies sich in jeder Beziehung als gelehriger Schüler und war seinem Herrn bald eine unentbehrliche Hilfe geworden. Wenn der nun erführe, dass sein Hörvermögen unaufhaltsam schwand, so wie Wasser aus einer offenen Schale verdunstete, sicher würde er zum ordinären Bootsjungen zurückgestuft werden, wenn er überhaupt auf der Beagle bleiben durfte. Dabei präparierte er so schnell und sorgfältig wie kein Zweiter an Bord. Mehr als zehn kleine Bälge schaffte er in der Stunde, und ihre Qualität ließ nichts zu wünschen übrig, Don C. D. hatte ihn mehrfach gelobt. Wahrscheinlich hatte er sein Geschick vom Vater geerbt, der es als Rossschlächter aber mit viel größeren Körpern zu tun hatte. Teufel noch mal, er würde es nicht zulassen, dass diese lächerliche Taubheit ihm alles zerstörte. Seit wann brauchte man für diese Arbeit Ohren?
Also hielt er sein Problem, solange es ging, geheim. Natürlich hatte er die Schildkröten, mit denen Don C. D. seinen Schabernack trieb, auch entdeckt, sie waren ja kaum zu übersehen. Überall im Buschland und bis in die Gipfelregionen stieß man auf ihre Wechsel. Auf diesen seltsamen Inseln schienen sie die großen Pflanzenfresser zu sein, wie anderswo die Antilopen oder Wildpferde. Doch er mochte sie nicht. Sie waren ihm unheimlich. Ihr Fauchen, das sie von sich gaben, wenn man ihnen zu nahe kam, ihre langen, faltigen Hälse, ihre uralten Gesichter mit den kleinen wässrigen Augen. Diese Kreaturen hatten etwas Diabolisches, fand er, wie die hässlichen Inseln, auf denen sie lebten. Er freute sich auf den Moment, da dieser trostlose Ort hinter der Beagle im Dunst verschwinden würde.
Die beiden Männer hatten in der letzten Stunde auf dem Berghang einiges an Höhe gewonnen, und Syms beschattete seine Augen, um tief unter sich Buccaneer Cove zu suchen, ihre Landungsstelle. Schnell hatte er das Lager entdeckt. Wenigstens mit seinem Sehvermögen stand alles zum Besten, deshalb war er auch ein so guter Schütze.
Dort unten Zelte aufzustellen, hatte sich als schwierig erwiesen. Sie hatten etliche Versuche gebraucht, weil der Boden von den Bauten der Land-Iguanen vollkommen durchlöchert war. Doch jetzt standen ihre Zelte, und er konnte Benjamin Bynoe, den Arzt der Beagle, und Kapitän FitzRoys Diener Harry Fuller erkennen, die sich am Ausrüstungsstapel zu schaffen machten. Er winkte, aber die beiden waren zu beschäftigt und zu weit entfernt, um ihn zu bemerken. Nach der Beagle, die am Morgen Kurs auf Chatham im Südosten des Archipels genommen hatte, hielt er vergeblich Ausschau. FitzRoy beabsichtigte, dort Trinkwasser aufzunehmen. Nur auf Chatham gebe es Wasser in ausreichender Qualität, hatte er gesagt. Ergiebige Süßwasserquellen waren auf diesen Inseln Mangelware, und vor ihnen lag eine lange Fahrt über den schier unendlichen Pazifik.
Syms schaute wieder auf die Lichtung, wo das vorsintflutliche Biest sich nun mitsamt seiner schweren Last tatsächlich in Bewegung setzte. Er verfolgte verblüfft, wie es sich mit seinen krummen Beinen scheinbar mühelos erhob und davonstapfte, mit Don C. D., seinem jungen Herrn, auf dem Rücken.
»Oh, ohoho«, rief der und versuchte, das Gleichgewicht zu halten, was ihm zunächst auch gelang. Wahrscheinlich lacht er, dachte Syms, denn er sah, dass sein Herr den Mund weit aufgerissen hatte. Doch plötzlich war es mit der Balance vorbei, er fuchtelte ein letztes Mal mit den Armen durch die Luft, rutschte nach hinten ab und landete mit dem Rücken voran im Dreck.
Don C. D. glaubte, diese Kreaturen gehörten ursprünglich nicht hierher, deshalb hatte er ihnen bisher kaum Beachtung geschenkt. Ähnlich große Schildkröten fände man auch auf anderen ozeanischen Inseln, hatte er erklärt. Sie waren vermutlich Essen auf Beinen, eine Hinterlassenschaft der Seefahrer, die sich nun jederzeit an dem lebendigen Fleischvorrat bedienen konnten. Sie selbst machten es ja nicht anders. Kapitän FitzRoy hatte fast fünfzig Riesenschildkröten auf die Beagle schleppen lassen, bei den größten Exemplaren mussten vier Mann zupacken. Und was sie heute Abend am Feuer essen würden, war auch nicht schwer zu erraten. Don C. D. mochte die Tiere am liebsten, wenn ihr Fleisch nach Art der Gauchos im Panzer geröstet wurde. Syms hätte ja gegrillte Iguanen vorgezogen. Ihr Geschmack erinnerte entfernt an Hühnchen oder Kaninchen. Sie waren leicht zu fangen, mindestens genauso hässlich und …
Er kniff die Augen zusammen. Warum stand sein Herr nicht auf? Hatte er sich verletzt? Syms hörte nur das Rauschen der Büsche. Oder war es sein eigenes Blut? Verdammt, 1831, als die HMS Beagle unter Kapitän FitzRoy ihre Reise angetreten hatte, war er fünfzehn Jahre alt gewesen, jetzt war er neunzehn, ganze sieben Jahre jünger als sein Herr und mit Sicherheit zu jung, um taub zu werden.
Endlich stand Don C. D. wieder auf, klopfte den Staub von der Kleidung, und Syms konnte sich beruhigt dem Vogel zuwenden, den er geschossen hatte. Vögel waren seine Spezialität. Er nahm das Tier vorsichtig in die Hand. Es sah nahezu unversehrt aus, weil er Vogeldunst als Munition verwendete, ein feines, fast staubförmiges Schrotgemisch. Statt von Bleikugeln durchsiebt zu werden, starben sie an Herzversagen.
Das Tier war etwas größer als ein Sperling, einer dieser kleinen schwarzen Burschen, die sie bisher auf jeder Insel des Archipels angetroffen hatten. Manchmal hüpften sie arglos und ohne jede Scheu vor ihren Füßen herum, und man musste aufpassen, sie nicht zu zertreten. Es schien mehrere unterschiedliche Arten zu geben, die Syms kaum voneinander unterscheiden konnte, deshalb schoss er lieber ein paar Vögel mehr als einen zu wenig. Sein Herr hielt einige für Finken, andere für Grasmücken und Amseln. Er hatte die auf Chatham und Charles gesammelten Tiere nicht beschriftet und bewahrte sie in der gleichen Kiste auf. Es würde schwer, wenn nicht gar unmöglich sein, die Bälge später nach ihren Herkunftsinseln zu sortieren. Offenbar interessierten ihn die Vögel nicht besonders. Syms hatte sich schon gefragt, ob sein Herr die Lust am Sammeln verloren hatte, doch Don C. D. hatte ihm einen anderen Grund für diese scheinbare Nachlässigkeit genannt. Er ging schlicht nicht davon aus, auf derart ähnlichen und nah beieinanderliegenden Inseln jeweils eigene Kombinationen von Pflanzen- und Tierarten zu finden, etwas, das Syms nicht beurteilen konnte. Es machte jedenfalls unter diesen Umständen keinen Sinn, von jeder Insel eine vollständige Kollektion ihrer Bewohner sammeln zu wollen. Zoologisch waren die Galápagosinseln nicht besonders ergiebig. Das Besondere war ihre Geologie, der Vulkanismus, und der Platz auf der Beagle war ohnehin begrenzt, sie konnten nicht alles mitnehmen, was sie fanden. Die Spottdrosseln machten allerdings eine Ausnahme, auf die legte Don C. D. großen Wert. Er hatte Syms auf ihre von Insel zu Insel variierende Gefiederfärbung aufmerksam gemacht und angeordnet, besonders auf sie zu achten. Ihm selbst wäre das nicht aufgefallen.
Syms war ein Gewohnheitsmensch. Egal ob groß oder klein, ob spektakulär oder gewöhnlich, jedes Tier wurde von ihm mit der gleichen Sorgfalt behandelt, und über jedes einzelne Exemplar führte er genauestens Buch. Er maßte sich ohnehin nicht an, die Bedeutung seiner Jagdbeute beurteilen zu können. Das überließ er den Gelehrten daheim in England, denen er seine Bälge zur Begutachtung übergeben würde. Ihm ging es nicht um neue Erkenntnisse oder gar wissenschaftlichen Ruhm. Er hoffte, nach seiner Rückkehr mit der privaten Sammlung ein wenig Geld machen zu können. Und er war nicht der Einzige, der auf einen kleinen Gewinn spekulierte. Einige Offiziere der Beagle hatten ebenfalls begonnen, eigene Sammlungen anzulegen.
Der kleine Vogel hatte einen ungewöhnlich kräftigen Schnabel, dessen Basis die gesamte Kopfhöhe einnahm. So etwas hatte er noch nie gesehen. Ob die Weibchen genauso ausgestattet waren? Syms setzte sein Messer an, führte blitzschnell einige Schnitte aus und zog den Balg vom Fleisch wie einen Handschuh vom Finger. Danach stülpte er ihn vorsichtig wieder zurück, wog ihn in seiner Hand und nahm sich vor, in Zukunft verstärkt nach den graubraunen Weibchen Ausschau zu halten. Von denen hatte er noch zu wenige. Es brachte mehr ein, wenn er Sammlern Männchen und Weibchen einer Art zum Kauf anbieten konnte. Den blutigen Klumpen, der von dem kleinen Tier übrig geblieben war, warf er zwischen die Sträucher.
Stunden später hockten sie in der Nähe ihrer Zelte um ein Lagerfeuer, in dem die fleischbepackten Brustplatten zweier großer Schildkröten brieten. Bynoe und Fuller starrten in die Flammen, während Syms gewissenhaft seine Flinte reinigte. Don C. D. stand einige Meter entfernt vor einem kraterförmigen Loch, aus dem der Schwanz eines Leguans herausragte, und pulte fluchend an seinen Fingern herum. Er hatte einige Leguane mit Opuntienblättern gefüttert und sich über ihre Streitigkeiten amüsiert. Die Art und Weise, wie sie ihre Köpfe schnell auf und ab bewegten, um Artgenossen zu imponieren, sah wirklich komisch aus. Doch während die kleinen Drachen in die fleischigen Kakteenblätter bissen, ohne sich im Mindesten um deren Stacheln zu scheren, hatte er sich beim Abschneiden nahezu unsichtbare haarfeine Dolche in die Haut gejagt. Schließlich bückte er sich, packte den Echsenschwanz mit beiden Händen und zog kräftig daran. Syms hob die Augenbrauen und hielt inne. Mit den schwarzen Meeresechsen war sein Herr genauso umgesprungen.
Zuerst geschah gar nichts. Dann buddelte sich das gut ein Meter lange Tier frei, drehte sich um, suchte augenscheinlich den Übeltäter, um ihn dann für Minuten in völliger Bewegungslosigkeit zu fixieren. Naturforscher und Landleguan starrten sich an, bis der Mensch nicht mehr an sich halten konnte und losprustete.
»Da staunst du, was?«, rief Don C. D. lachend.
Harry Fuller grinste. »So etwas hat er noch nicht erlebt.«
»Ja, er scheint richtig fassungslos zu sein«, sagte Bynoe, der mit einem Ast in der Glut herumstocherte. »So etwas tut man doch nicht, eine ehrwürdige Leguanmutter am Schwanz zu ziehen.«
»Woher wissen Sie, dass es ein Weibchen ist?«, fragte der Steward.
»Überleg doch mal, Fuller. Warum hat sie wohl ein Loch gebuddelt, hm?« Der Doktor schmunzelte und versicherte sich mit kurzem Seitenblick auf Don C. D., dass er ihrer Unterhaltung folgte. »Natürlich, um darin ihre Eier abzulegen, ist doch klar. Hab ich recht, Mr. Darwin?«
Der junge Naturforscher nickte. Syms blickte in die Runde, konnte dem Gespräch aber nicht wirklich folgen. Wenn er gejagt hatte, war es immer besonders schlimm. Er legte seine Flinte, die er sorgfältig in ein Tuch gewickelt hatte, neben sich auf den Boden ab und fragte: »Ist das Essen endlich fertig? Ich habe einen Bärenhunger.«
Neun Tage blieben die vier Männer auf James Island, der heutigen Isla Santiago. Don C. D. untersuchte Krater und Lavaflüsse, und es zog ihn tiefer ins Landesinnere und damit höher hinauf. Auf anderen Inseln des Archipels hatte er gesehen, dass es in höheren Lagen feuchter wurde, was eine üppig wuchernde tropische Vegetation begünstigte.
Und so war es auch hier. Sie wanderten durch Wälder aus mächtigen Palo-Santo-Bäumen. Auf den Mimosen kletterten Leguane herum und mampften still die Blätter in sich hinein. Sie stießen auf einen See voller riesiger Schildkröten, die hier ihre Bäuche mit Wasser füllten. Noch weiter oben, in Regionen, die fast immer in Wolken gehüllt waren, war es so feucht, dass das Wasser von den mit Flechten überwucherten Baumästen in ein dichtes Gestrüpp aus Farnen und Seggen tropfte. Der Boden war schlammig, ein Lebensraum, der es fast unvorstellbar erscheinen ließ, dass nur wenige Hundert Meter tiefer Trockenheit und unerbittliche Hitze herrschten.
An diesen vulkanischen Berghängen löste eine Baumart die andere ab, und hier stießen die Entdecker auch auf eine Zone, die von Guayavita-Bäumen dominiert wurde, die voller beerenartiger Früchte hingen. Sie waren allerdings so sauer, dass sich Don C. D. bei dem Versuch, sie zu essen, alles zusammenzog und er sie sofort ausspuckte. Den Schildkröten machte das nichts aus. Sie fraßen die Früchte mitsamt den Flechten, die an den Ästen hingen.
Syms fiel auf, dass sein Herr bei der Betrachtung der Bäume tief in Gedanken versunken war, und er sprach ihn darauf an. »Ach«, antwortete Don C. D., »ich kann mich nicht erinnern, diesen Baum auf den anderen Inseln gesehen zu haben. Und hier bildet er in mittlerer Höhe ganze Wälder. Wie kann er dann nur wenige Kilometer entfernt, unter ähnlichen Bedingungen, fehlen?«
Ein einheimischer Schildkrötenjäger, der sie auf der Wanderung begleitete, war ihrer Unterhaltung gefolgt und berichtete nun von seinen eigenen Beobachtungen: »Das ist nichts Ungewöhnliches, mein Herr. Auf vielen der Inseln gedeihen Bäume und Pflanzen, die es auf den anderen nicht gibt.«
Syms hätte schwören können, dass sein Herr in diesem Moment unter der Hutkrempe erbleichte. Er sagte auf dem ganzen Weg kein Wort mehr und blieb in tiefe Grübelei versunken.
Syms hatte das seltsame Verhalten Don C. D.s bald vergessen, doch als er viele Jahre später im fernen Australien, wo er sich inzwischen niedergelassen hatte, das als Buch veröffentlichte Reisejournal seines Herrn las, erinnerte er sich wieder daran und verstand, was dem mittlerweile berühmten Naturforscher in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein musste. Sicher war es ein Moment größter Enttäuschung, vielleicht Verzweiflung gewesen. »Leider«, so hieß es in der Niederschrift, »war ich mir dieser Tatsachen nicht bewusst, bis meine Sammlung fast vollendet war.« Leider … denn es gab kein Zurück mehr. Darwin konnte mit seiner Sammeltätigkeit nicht noch einmal von vorn beginnen. Es war zu spät. James Island war seine letzte Station auf den Islas Encantadas.
Einige Tage später näherte sich die vertraute Silhouette der Beagle. Die Männer lösten ihr Lager in der Buccaneer Cove auf, luden die Ausrüstung und alles, was sie zusammengetragen hatten, auf ein Boot und fuhren hinaus zu dem Schiff, das noch für Jahre ihr Zuhause sein würde.
Fünf Wochen Galápagos lagen hinter der Besatzung. Charles Darwin und sein Gehilfe Syms Covington hatten neunzehn Tage und zehn Nächte auf vier verschiedenen Inseln verbracht. Sie legten in dieser Zeit etwa achtzig Kilometer zurück. Heute heißt es, dass diese Stunden, Tage und Kilometer die Welt veränderten.
Drei Tage später lichtete die Beagle die Anker und brach gen Westen auf. Während der folgenden Wochen auf See hatten der Naturforscher und sein Gehilfe viel Zeit, das Gefundene zu sichten, zu katalogisieren und zu verpacken. Mithilfe von Covington und der Offiziere, die ihre eigenen Kollektionen beisteuerten, brachte die Beagle allein aus Galápagos etwa fünfhundert Sammlungsstücke mit nach England, mehr als die Hälfte davon Pflanzen. Zum Rest gehörten fünfundsechzig Vögel, fünfzehn Reptilien, fünfzehn Fische, siebzehn Landschnecken, etwa fünfundachtzig Gliederfüßer, vierzig Steine und diverses Meeresgetier. Die Auswertung dieser Funde und ihre wissenschaftliche Beschreibung durch englische Experten nahmen mehr als zehn Jahre in Anspruch.
Teil 1
»Ich habe dich beobachtet. Du bist nur Gerede. Deine Empörung ist ein Furz. Du lässt Luft ab, du stänkerst herum, ansonsten bist du wie alle anderen, nein, schlimmer noch, du weißt Bescheid, und du lässt dir dein Wissen versilbern.«
Ilija Trojanow, Eistau
1
Isla Santa Cruz, Charles Darwin Research Station
Anne lag regungslos in ihrem Bett, starrte in die Dunkelheit und lauschte den leisen Stimmen, die von draußen in den Raum drangen. Wahrscheinlich gehörten sie einigen der jungen Ecuadorianer, die in den Bungalows hinter dem Küchenhäuschen wohnten.
Sie führte die linke Hand zum Mund und leckte einen Blutstropfen von der Haut. Nach dem Aufwachen war sie völlig durch den Wind gewesen und hatte unwillkürlich nach einer der neuen Lampen getastet, die Hermann in ihrem Kieler Schlafzimmer links und rechts neben dem Bett an die Wand geschraubt hatte. Doch statt blankes Metall und den Kippschalter zu berühren, war sie über scharfkantige Steine geschrammt und hatte sich prompt den Fingerknöchel aufgerissen.
Nicht einmal eine Nachttischlampe gab es hier, fluchte sie innerlich und ärgerte sich gleichzeitig über ihre Dummheit. Der Groll, der sie schon den ganzen Tag begleitet hatte, war wieder da, und es half auch nichts, sich daran zu erinnern, dass sie den Raum nur zum Schlafen nutzte. Studenten mochten sich darin wohlfühlen, in ihrem Alter hatte man jedoch andere Ansprüche, und sie sah nicht den geringsten Grund, warum sie sich davon verabschieden sollte, nur weil sie jetzt mit einem Biologieprofessor liiert war. Sicherlich, dieses Zimmer lag nicht in einem Hotel, sondern in einer Forschungsstation – aber was hatte sie dann hier verloren, allein, ohne Hermann? Vielleicht hätte sie sich doch eine Unterkunft in der Stadt suchen sollen, das hätte ihr auch die langen Wege erspart. Sie war gestern kurz davor gewesen und hatte nur aus Rücksicht Hermann gegenüber darauf verzichtet, der einen solchen Umzug sicher als Affront empfunden hätte. Andererseits hatte er auch herzlich wenig Rücksicht auf sie genommen.
Während Hermann schon dabei gewesen war, seine zweite Bootstour vorzubereiten, und unten am Wasser mithilfe eines ohrenbetäubenden Kompressors Druckluftflaschen befüllt hatte, war sie gestern unter sengender äquatorialer Sonne durch die Gegend marschiert. Zuerst hatte sie den Zuchtgehegen hier auf dem Stationsgelände einen Besuch abgestattet und sich gefragt, ob es wohl etwas Langweiligeres gab, als Landleguanen und Schildkrötenopas wie Lonesome George beim Schlafen zuzusehen. Sie wunderte sich, dass die großen Reptilien ihren Kopf dabei einfach in den Vulkandreck legten. Schliefen alle Schildkröten so oder nur die auf Galápagos? Denen war nach einigen Hundert Jahren Kontakt mit der Außenwelt anscheinend noch immer nicht aufgegangen, dass ihnen von anderen Kreaturen Gefahr drohen könnte. Wozu schleppten sie den schweren Panzer mit sich herum, wenn sie ihn nicht einmal nachts benutzten?
Dann hatte sie sich den kleinen Strand im Nationalpark angesehen. Er war voller kreischender junger Galapagueños gewesen, kein Ort, an dem eine Frau in ihrem Alter, deren Kinder schon lange aus dem Haus waren, sich wohlfühlte. Später, als Hermann und die anderen schon gen Westen aufgebrochen waren, hatte sie sich kurz hingelegt und war dann mit müden Beinen durch Puerto Ayora gelaufen, das touristische Zentrum der Galápagosinseln, ein Ort, der nur aus Tauchbasen, Tourveranstaltern, Restaurants und Boutiquen für Reiseandenken und bedruckte T-Shirts zu bestehen schien. Blaufußtölpel, Leguane, Seelöwen und Schildkröten, in allen nur erdenklichen Materialien, Farben und Variationen. Und natürlich der bärtige großväterliche Charles Darwin, immer wieder Darwin. Noch aus dem Jenseits schien er seine schützende Hand über den Archipel zu halten. Was wäre wohl aus diesen Inseln geworden, wenn er nicht gewesen wäre?
Danach war sie todmüde ins Bett gefallen. Und das alles, um sich nicht länger als nötig in ihrem Quartier aufhalten zu müssen. Die einzige Lichtquelle des aus rohem Vulkangestein gemauerten Bungalows war eine von der Decke baumelnde Energiesparlampe, in der spartanischen Dusche platzten die Kacheln von den Wänden. Was hätte sie dort tun sollen? Sich auf einem der harten Holzstühle vor die Tür setzen? Auf dem Bett liegen wie jetzt? Sie war regelrecht auf der Flucht gewesen. Das darf sich nicht wiederholen, dachte sie. Sie musste versuchen, das Beste aus ihrer Situation zu machen, das Positive sehen. Sie hatte noch zwei ganze Tage für sich.
Nachdem sie den Bungalow zum ersten Mal inspiziert hatte, war sie so deprimiert gewesen, dass sie schnell wieder auf die Terrasse mit den losen Steinplatten getreten war und sehnsüchtig zu einem Gebäude hinübergesehen hatte, das etwa hundert Meter entfernt lag und über einen holperigen Schotterweg zu erreichen war. Dort hatte sie mit Hermann die ersten beiden Nächte verbracht, bevor das Schiff ausgelaufen war. Obwohl die Zimmer dieses Hauses kaum mehr Bequemlichkeit boten, hatte es ihr dort besser gefallen. Es war romantischer gewesen, der Raum großzügiger geschnitten, mit hoher Holzdecke und einer Terrasse, von der man über den undurchdringlichen Busch mit den alles überragenden stacheligen Opuntienbäumen hinweg auf das Meer sehen konnte. Ihr Nachbar hatte sich dort eine Hängematte aufgehängt, was in ihr wenigstens einen Hauch von Urlaubsstimmung aufkommen ließ.
Während Hermann drinnen das Gepäck abstellte, hatte sie draußen vor dem neuen Quartier die Lippen zusammengepresst und mit den Tränen gekämpft. Erst dieses Schiff, auf dem sie sich anfangs die Seele aus dem Leib gekotzt hatte, und jetzt das … Dabei hatte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal geahnt, dass sie das Zimmer für Tage allein würde bewohnen müssen. Aber auf das Schiff hatte sie nicht noch einmal gewollt. Sechs Tage auf der Queen Mabel waren genug gewesen.
»Anne, Liebling, mach bitte nicht so ein Gesicht.« Hermann war neben sie getreten, hatte den Arm um sie gelegt und sie an sich gedrückt. »Ich rede noch mal mit der Verwaltung, okay? Vermutlich hat Valeria uns das erstbeste Zimmer gegeben, das frei war. Vielleicht können wir ja wieder da drüben einziehen. Wäre dir das lieber?« Sie nickte stumm. Aber zu einem Umzug war es nicht mehr gekommen.
Was den Mangel an Komfort ihrer Unterbringung anging, hatte Hermann sie vor Antritt der Reise vorgewarnt, wie sie zugeben musste, und sie hatte sich von seiner Schilderung zunächst nicht abschrecken lassen. Sie verstand, dass er als Meeresbiologe hierhergehörte, in die berühmte Charles-Darwin-Forschungsstation, zumal Dieter Grumme, der deutsche Leiter der marinen Abteilung, ein alter Bekannter von ihm war. Er wollte nicht in irgendeinem der Hotels wohnen, unter ahnungslosen Touristen, die eine Spottdrossel nicht von einem Finken unterscheiden konnten und oft genug nicht die geringste Vorstellung davon hatten, wo sie sich hier befanden.
Auch als er darauf bestand, diese sonderbare Inselwelt nicht mit einem der luxuriösen Touristenschiffe zu erkundeten, sondern mit der Queen Mabel, hatte sie überaus verständnisvoll reagiert. Es war noch das größere der beiden Boote, die Wissenschaftler der Station für ihre Exkursionen nutzten, neben den modernen Kreuzfahrtschiffen wirkte es aber wie eine museumsreife Nussschale, die bei jeder Welle heftig schaukelte und ihren Passagieren außer einem Etagenbett und einem einzigen Tisch, an dem die Wissenschaftler aßen und jede freie Minute verbrachten, nichts zu bieten hatte. Hinten im Heck war jeder verfügbare Raum mit Tauchutensilien zugestellt, auf den Bänken standen Kisten mit Forschungsgerätschaften. Sogar die Gänge außen neben der Kajüte waren nahezu unpassierbar, weil man über Stapel von Pressluftflaschen und große Kanister mit Trinkwasser und Treibstoff klettern musste. Die Besatzung aß am Küchentresen im Stehen.
Hermann störte das alles nicht. Sie bewunderte seine Anspruchslosigkeit. Für ihn war entscheidend, dass er hier sein und dieses außergewöhnlich reichhaltige Meer befahren konnte. Kalte und warme Wasserströmungen aus drei verschiedenen Richtungen verwandelten es in einen gigantischen Whirlpool, so unberechenbar, dass er die Seeleute vergangener Jahrhunderte ein ums andere Mal in Verwirrung gestürzt hatte. Ein mit seinem Schiff vom Winde verwehter Bischof aus Panama hatte die Inseln durch Zufall in einer bis dahin unerforschten Meeresgegend entdeckt. Die Leute sprachen von den Islas Encantadas, den Verzauberten Inseln, und glaubten, sie trieben frei im Ozean, seien mal hier, mal dort zu finden. Und doch war dieser Ort, so abgelegen er war, zum Synonym für eine der großen Ideen der Menschheit geworden.
Vieles, was man über Darwin und Galápagos erzähle, sei zwar ein seit Jahrzehnten widerlegter Mythos, hatte Hermann ihr erklärt, dieser Mythos habe den Inseln und ihren absonderlichen Bewohnern aber eine Aura verliehen, die weltweit ihresgleichen suche und geradezu greifbar mache, was Evolution bedeute. Deshalb sei es keineswegs selbstverständlich, sondern ein Privileg, dass sie in der berühmten Charles-Darwin-Station untergekommen seien und an Bord der Queen Mabel dürften. Hermann versuchte, ihr ihre spartanische Unterkunft schmackhaft zu machen, indem er auf die vielen Wissenschaftler verwies, die sich darum rissen, hier wohnen und forschen zu dürfen, und die oft lange darauf warten mussten. Manchmal vergaß er einfach, dass Anne nicht zu dieser Zunft gehörte.
Doch sie hatte Hermanns Entsetzen bemerkt, als er bei ihrer Ankunft das kleine verschlafene Nest seiner Erinnerung im heutigen Puerto Ayora kaum noch wiedererkannte. Der Tourismus war in den letzten Jahren explodiert. Sollte er, der hier vor Jahren selbst geforscht und monatelang nach unbekannten Tintenfischarten gesucht hatte, sich die Inselnatur etwa von einem dieser angelernten Guides erklären lassen? Niemand, und er wiederholte, niemand werde ihn dazu bringen, eines dieser Kreuzfahrtschiffe zu betreten. Es schien ihm wirklich ernst damit zu sein, und sie hatte es akzeptiert – um sich dann jeden Tag, nachdem sie auf der ach so begehrten Queen Mabel vergeblich nach einem Platz gesucht hatte, wo sie sich niederlassen und ein paar Sonnenstrahlen tanken konnte, an Bord eines der modernen Schiffe zu wünschen, die oft in den gleichen Buchten ankerten wie sie. Im Gegensatz zu ihnen konnten die Touristen sogar die Inseln betreten und sich zu den dösenden Seelöwen und Leguanen in den Sand setzen, durften sich den Vogelkolonien nähern und die Vulkane besteigen. Den Forschern war dies nicht erlaubt, weil sie Meereswissenschaftler waren und die Inseln mit ihren einsamen Stränden nicht Gegenstand ihrer Untersuchungen. Keiner von ihnen hätte es gewagt, ohne Genehmigung einen Fuß darauf zu setzen. Ein gutes Verhältnis zur Nationalparkverwaltung war die Voraussetzung ihrer Arbeit. Wer den Verboten zuwiderhandelte, brauchte sich kein zweites Mal um einen Arbeitsplatz zu bewerben, würde nie wieder ein Sandkorn oder eine Muschelschale außer Landes schaffen können.
Der Kontrast zwischen dem Luxus, der zahlungskräftigen Touristen geboten wurde, und den Umständen, unter denen die Forscher zu leben und zu arbeiten gezwungen waren, hätte größer kaum sein können, und Anne war verblüfft, wie klaglos die Wissenschaftler sich damit abfanden. Sie schienen nichts anderes erwartet zu haben und erzählten von exotischen Orten, wo die Arbeitsbedingungen und Lebensumstände noch weitaus schlechter gewesen seien. Wie Hermann waren sie offenbar voll und ganz damit zufrieden, hier ihrer Arbeit nachgehen zu dürfen. Alles andere war sekundär. Anne nahm es als Aufforderung, sich nicht so anzustellen – mit mäßigem Erfolg.
Sie hatte sich ihren ersten Auslandsurlaub seit Jahren anders vorgestellt, ganz anders. Eine bequeme Liege am Pool oder Sandstrand, ein gutes Buch, abends ein gepflegtes Dinner, ein bisschen Romantik … Immerhin war es ihre erste gemeinsame Reise mit Hermann.
Ihre beste Freundin Birgit fiel ihr ein, die es nicht eine Minute in diesem Zimmer ausgehalten hätte. Mit großen Augen hatte sie Anne angesehen, als die ihr von dem neuen Mann in ihrem Leben erzählte. »Im Ernst? Ein Biologieprofessor? Meinst du wirklich, so einer passt zu dir?«
Was für eine Frage. Natürlich passte Hermann zu ihr, dachte Anne trotzig. Hermann passte besser zu ihr als jeder andere Mann, der ihr in den letzten zehn Jahren begegnet war, daran zweifelte sie keine Sekunde, auch wenn er sie jetzt in dieser verdammten Baracke allein gelassen hatte. Sie wusste ja, warum er es getan hatte – nicht etwa aus Geiz oder Gedankenlosigkeit, sondern aus tief empfundener Begeisterung für seine Sache, die ihr tausendmal lieber war als die Langeweile, der Überdruss oder die großmäulige Mir-gehört-die-Welt-Attitüde, die sie bei anderen Männern erlebt hatte.
Manchmal erschrak sie darüber, wie viele Sorgen sie sich um ihre Beziehung machte, wie groß ihre Angst war, Hermann nach wenigen Monaten wieder zu verlieren. Sie hatte vergessen, wie schwer es war, die Freiräume, die jeder von ihnen für sich beanspruchte, so auszutarieren, dass beide auf ihre Kosten kamen, und allzu leicht fiel sie in Verhaltensweisen zurück, die sie schon lange überwunden geglaubt hatte.
Sie lutschte sich einen weiteren Blutstropfen vom Handrücken und musste wieder an die sündhaft teuren Kieler Nachttischlampen denken und wie lange sie nach ihnen gesucht hatte. Sie hatte Hermann gebeten, die Lampen anzubringen, und der entzog sich dieser hausmännlichen Aufgabe so lange, bis es darüber fast zum Streit gekommen wäre. Warum hatte sie es nicht einfach selbst gemacht, wie in all den Jahren zuvor, in denen es keinen Mann in ihrem Leben gegeben hatte? Sie wusste genauso gut wie er, wie man Bohrmaschine und Schraubenzieher benutzte.
Trotzdem … sie würde unter keinen Umständen noch einmal an einem Ort wie diesem tagelang auf ihn warten. Natürlich hatte sie ihr Einverständnis zu seiner zweiten Ausfahrt mit der Queen Mabel gegeben, doch schon gestern war ihr klar geworden, dass sie sich und ihrer Beziehung damit keinen Gefallen getan hatte. Umso mehr freute sie sich auf die letzte Woche ihrer Reise, die sie im ecuadorianischen Teil Amazoniens verbringen würden, darauf hatte sie bestanden. Dort würde es all das geben, was sie hier vermisste. Die komfortable Dschungellodge mitten im Nationalpark hatte sie selbst ausgesucht. Als ob sie geahnt hätte, was sie auf Santa Cruz erwartete.
Sie seufzte, wischte sich eine klebrige Schweißschicht von der Stirn und roch daran. Seltsam, die tropische Hitze lockte Duftstoffe aus ihr heraus, die daheim selbst die heißesten Tage nicht hervorbrachten. Auch Hermann verströmte hier einen kräftigen Geruch, den sie noch nie an ihm bemerkt hatte, aber es war ihr nicht unangenehm, im Gegenteil. Als sie am Nachmittag ihres ersten Tages auf Santa Cruz miteinander geschlafen hatten, klebten sie aneinander wie zwei verliebte Schnecken. Gierig schnüffelten sie sich gegenseitig die neuen ungewohnten Düfte von der Haut. Später, als sie gemeinsam unter der lauwarmen Dusche standen, erzählte Hermann, dass Schnecken Zwitter seien und einander spitze Liebespfeile ins Fleisch jagten. Kichernd wie zwei alberne Teenager spekulierten sie, wie es wohl wäre, weibliche und männliche Erregung im gleichen Körper zu spüren, ob sich die Gefühle potenzierten oder eines stärker wäre und die Oberhand gewinnen würde. Das hatte sie nun davon, dass sie sich mit einem Zoologen eingelassen hatte.
Anne wälzte sich von einer Seite auf die andere. Es war so warm, und sie hätte so gerne geschlafen … Sie lauschte den leisen Geräuschen der Geckos und den spanischen Stimmen. Es kam ihr auf einmal seltsam vor, dass sie kein Kichern, kein Lachen hörte. Dort hinten wohnten junge Leute, wahrscheinlich Praktikanten und Studenten vom tausend Kilometer entfernten Festland, die ihre Zeit auf Santa Cruz, weit weg von zu Hause, sicher nicht nur für die Rettung der hiesigen Tierwelt nutzten. In solchen Runden ging es normalerweise feuchtfröhlich und laut zu. Doch wer auch immer sich um diese Zeit da draußen aufhielt – sie glaubte drei oder vier Stimmen unterscheiden zu können –, es hörte sich so an, als führten sie eine ernsthafte, immer wieder von längeren Pausen unterbrochene Unterhaltung.
Ob es die Stimmen waren, die sie wach hielten? Nein. Der Jetlag, dachte Anne. Ihr langer Flug über den Atlantik lag nun schon eine Woche zurück, die Zeitumstellung machte ihr aber immer noch zu schaffen. Sie tastete nach dem Reisewecker, der neben ihr auf dem wackeligen Nachttisch stand. Drei Uhr fünfzehn. Sie rechnete stumm: drei Uhr fünfzehn plus sieben. Na klar, die Kollegen in Kiel arbeiteten schon seit Stunden. Um diese Zeit trafen sie sich oft zu Besprechungen. Sie sah sie vor sich, Becker, Hollinger, Bock und die anderen, wie sie mit übermüdeten, blassen Gesichtern um den großen Tisch saßen und ihren schaurigen Kaffee in sich hineinschütteten. Die Vorstellung hellte ihre Stimmung schlagartig auf. Die Blume, Sitz der Bezirkskriminalinspektion Kiel, war wirklich das Letzte, was sie hier vermisste. Glücklicherweise war sie weit weg von alldem, war mit Hermann um die halbe Welt geflogen. Galápagos, Ecuador – mein Gott, sie hatte eine Gänsehaut bekommen, als er ihr dieses Reiseziel vorschlug.
Und es war ja auch großartig. Überwältigend. Die Unterbringung war nur das eine, etwas, das hoffentlich bald vergessen sein würde. An das, was sie mit Hermann vor der Isla Isabela erlebt hatte, würde sie sich dagegen ihr ganzes Leben erinnern, genauso wie an die Delfine im Canal Bolívar, die sich von der Bugwelle der Queen Mabel durch das Wasser schieben ließen, bis sie die Lust verloren und weiterzogen, an die Echsen in der Steilwand vor Española, die großen Rochen während der Überfahrt nach San Cristóbal, ihre übermütigen Salti, aus denen die pure Lebenslust zu sprechen schien. Die Forscher hatten ihr erklärt, dass die Tiere sich auf diese Weise ihrer Hautparasiten entledigten, und Anne glaubte zuerst, sie hätte sich verhört. Hatten sie keine Augen im Kopf, oder war es ihre Fantasielosigkeit, die sie zu solchen Erklärungen greifen ließ?
Sie legte ihre Hand auf das Bett neben ihr, strich über das Laken und dachte an Hermann, ihren Tintenfischverrückten, ihren Professor. Wie er aus vollem Halse gelacht hatte, als sie vor Isabela inmitten von Pinguinen, Pelikanen und verspielten Seelöwen im Wasser schwammen. Ein großer Schwarm fingerlanger blassblauer Fische hatte die Tiere herbeigelockt. Ringsumher jagten die Boobies, legten in zehn, fünfzehn Meter Höhe die Flügel und ihre hellblauen Füße an und schossen mit dem Schnabel voran wie Pfeile ins Wasser, metertief und in einen Mantel aus silbrigen Luftblasen gehüllt. Kurze Zeit später tauchten sie wie Korken wieder an der Oberfläche auf, um sich sofort ein weiteres Mal in die Luft zu schwingen und einen neuen Fischzug zu starten … ein unglaublicher Moment, ein Erlebnis, das sie nie für möglich gehalten hätte. Plötzlich hatte sie verstanden, warum manche von Galápagos als einem Paradies sprachen.
Und jetzt lag sie, eine Frau jenseits der fünfzig, mitten in der Nacht wach und verzehrte sich nach ihrem Liebhaber – war das zu glauben? Sie getroffen zu haben, hatte Hermann einmal gesagt, sei ein kostbares Geschenk, mit dem er nicht mehr gerechnet hätte. Verdammt – wenn es so war, und sie wusste, dass er es ehrlich meinte, was hatte er dann jetzt da draußen auf dem Pazifik verloren? Was an ihrer Entdeckung so außerordentlich gewesen war, hatte sie nicht genau verstanden, und es interessierte sie im Grunde auch nicht. Ein Hai wie jeder andere, aufdringlich, grau und hässlich und nicht einmal besonders groß. Ein wenig schadenfroh wünschte sie Hermann, dass er jetzt wie sie wach lag und sich mit der Frage herumquälte, ob dieser Fisch es wirklich wert war, sie hier allein gelassen zu haben.
Anne stützte sich auf ihren Ellenbogen und trank einen Schluck aus der Wasserflasche, die sie sich auf den Nachttisch gestellt hatte. Sie konnte nicht anders, sie musste die Ohren spitzen und dem Getuschel vor ihrem Bungalow zuhören, obwohl nur Wortfetzen an ihr Ohr drangen und sie kaum Spanisch verstand. Die Stimmen schienen ganz aus der Nähe zu kommen. Warum setzten sie sich nicht vor ihren eigenen Zimmern zusammen? Jetzt, da sie genauer hinhörte, kam ihr die Unterhaltung seltsam gehetzt vor. Und waren es nicht mehr Stimmen geworden? Anne wusste nicht, worum es ging, doch sie meinte, eine Beunruhigung aus dem lauter werdenden Gespräch herauszuhören.
Fuego.
Wie ein geschliffener Diamant aus einer Handvoll Kieselsteine stach dieses Wort plötzlich aus dem spanischen Kauderwelsch heraus, so unvermittelt, dass sie einen Moment brauchte, um zu begreifen, dass sie es sich nicht eingebildet hatte.
Fuego – das hieß Feuer, oder nicht? Ein Adrenalinstoß schoss durch ihren Körper. Die Station war von knochentrockenem Buschland umgeben. Wenn das in Brand geraten war, musste sie weg, so schnell wie möglich, runter zum Meer.
Sie sprang aus dem Bett, zog hastig Shorts und T-Shirt über, riss die Tür auf und sah sofort, dass sie sich nicht verhört hatte. Irgendwo hinter den Dächern der Station und den allgegenwärtigen Opuntienbäumen stieg eine Rauchsäule in den Nachthimmel, von unten beleuchtet durch ein helles, flackerndes Licht. Hin und wieder sah man sogar eine Flammenzunge, die in die Höhe schoss und schnell wieder verschwand. Wo genau, war nicht zu erkennen. Es war aber nicht der Busch, der da brannte, dafür war der Rauch zu weit entfernt. Es bestand keine unmittelbare Gefahr.
Ein paar Meter weiter rechts, wo die steinige Zufahrt auf die Terrasse traf, stand eine Gruppe von sieben oder acht Personen und starrte auf die Bucht hinaus. Sie erkannte Carol, eine kanadische Geologin, und Salvatore und Lieke, zwei der Doktoranden. Alle drei waren mit auf dem Schiff gewesen. Wenigstens jemand, mit dem sie reden konnte, dachte Anne erleichtert, obwohl sie auch mit ihren Englischkenntnissen haderte. Es war so lange her, dass sie sich in einer Fremdsprache verständigt hatte.
Die Tür des Nachbarzimmers öffnete sich, und ein hagerer Mann in Unterhosen erschien auf der Schwelle. Er fuhr sich mit beiden Händen über den kahl geschorenen Kopf und erstarrte mitten in der Bewegung, als er die Rauchsäule sah. Auch Reinhardt Schwan, ein Schweizer Sedimentologe, der an einer amerikanischen Universität unterrichtete, war auf der Queen Mabel gewesen. Sie hatte gar nicht gewusst, dass sie alle Nachbarn waren. Tagsüber hatte sie keinen von ihnen gesehen.
»Was ist passiert?«, rief sie auf Englisch und trat auf die Gruppe zu. Einige drehten sich kurz um, junge, ratlose Gesichter. Anne kam sich in dieser Gesellschaft furchtbar alt vor.
Eine junge Frau mit rundem, puppenhaftem Gesicht ließ einen spanischen Wortschwall los, in dem Anne nur das Wort explosión verstand.
»Was? Eine Explosion? Es hat eine Explosion gegeben?« Anne sah fragend von einem zum andern.
»Ich glaube, ich bin davon aufgewacht«, bestätigte Lieke, die durch ihre Größe und die langen strohblonden Haare aus der Gruppe herausstach. Anne hatte sie schon auf der Queen Mabel bewundert, eine bildhübsche junge Holländerin, von der weder die einheimische Bootsbesatzung noch die männlichen Wissenschaftler die Augen lassen konnten.
Die jungen Ecuadorianer redeten jetzt alle durcheinander. Anne sah Reinhardt und Carol Hilfe suchend an. Sie wusste, dass die beiden ausgezeichnet Spanisch sprachen.
»Sie sagen, eine ganze Weile sei nur ein rötlicher Schimmer zu sehen gewesen«, übersetzte Carol. »Dann habe es irgendwann geknallt, und immer mehr Rauch sei aufgestiegen. So hoch wie jetzt schlagen die Flammen erst seit ein paar Minuten. Mehr wissen sie nicht. Sie rätseln schon die ganze Zeit, was da passiert sein könnte. Sie vermuten, dass es in der Bucht brennt.«
»Ja«, Anne nickte, »so sieht es aus. Aber was soll da brennen?«
»Quizás un barco«, sagte ein junger Mann mit ernstem Gesicht.
»Was?«
»Ein Schiff.«
»Wenn ihr es genau wissen wollt, müsst ihr zum marinen Labor gehen«, sagte Reinhardt und gähnte. Er schien nicht besonders beunruhigt zu sein.
Sie standen einen Moment unschlüssig beieinander. Jetzt hörte man das Feuer sogar, ein leises Prasseln, hin und wieder ein lautes Knacken. In der Ferne, vielleicht im Hafen, heulte eine Sirene auf.
Auf dem Weg vor ihnen näherten sich von rechts knirschend Schritte. Die Umrisse eines Mannes schälten sich aus der Dunkelheit. Er trug nur Badeshorts und blieb im Dunkeln stehen.
»Hola!«, grüßte der Mann. »Weiß von euch jemand, was da los ist?«
Anne erkannte seine Stimme. Es war David Bartels, einer der deutschen Doktoranden, der offenbar in dem Haus wohnte, in das sie gerne umgezogen wäre. Jetzt war fast die gesamte Forscherriege der Queen Mabel versammelt. Nur die kleine Isabelle fehlte. Und Hermann natürlich.
»Konntest du von deiner Terrasse aus etwas erkennen, David?«, fragte Lieke.
Er drehte sich um und blickte in die Bucht. »Nein, nur einen Feuerschein. Nicht viel mehr als von hier.«
»Also, jetzt will ich es genau wissen.« Salvatore blickte sich um. »Kommt jemand mit?«
Reinhardt machte eine wegwerfende Handbewegung. »Was geht denn uns das an? Gibt es eben ein Scheißschiff weniger. Sind sowieso mehr als genug. Ich für meinen Teil leg mich wieder ins Bett.« Er drehte sich um und verschwand in seinem Zimmer, ließ die Tür aber offen stehen.
Salvatore war auf den Weg getreten und wartete. Die meisten hatten nur Unterhosen und T-Shirts an, manche trugen nicht einmal Schuhe an den Füßen. Einige schüttelten den Kopf.
»Ich komme mit«, sagte Anne und lief schnell in ihr Zimmer, um sich Sandalen anzuziehen.
»Ich auch«, sagte Carol.
David, Lieke und zwei der Ecuadorianer schlossen sich ebenfalls an. Zusammen ließen sie die anderen auf der Terrasse zurück und liefen schweigend den Weg entlang, der zum Meer und zu den Verwaltungsgebäuden der Station hin sanft abfiel. Sie passierten das entomologische Labor und ein größeres futuristisches Gebäude mit einer wellenförmigen Dachkonstruktion, in dem sich Büros und das Herbarium der Station befanden.
Die bodennahen Lampen, die den Weg hätten beleuchten sollen, waren kaputt, alles lag im Dunkeln. Nur mit Mühe hatte Anne gestern den Weg aus Puerto Ayora zurückgefunden, der immer finsterer wurde, je näher sie ihrem Quartier kam. Sie war allein gewesen und wäre auf der zu Anfang noch asphaltierten Straße fast über ein hühnergroßes Wesen gestolpert, das dort munter hin und her lief, ohne sich von ihrer Gegenwart im Geringsten beeindruckt zu zeigen. Mit klopfendem Herzen war sie stehen geblieben und hatte versucht herauszubekommen, mit wem sie es zu tun hatte. Es war eine Art Reiher, erkannte sie schließlich, der mit seinem langen, spitzen Schnabel große schwarze Käfer von der Straße pickte. Vor ihrem Zimmer hatte sie am Morgen schon eine Schlange gesehen und wenig später neben einem der Schildkrötengehege einen monströsen schwarzen Tausendfüßer, der ihr mehr als unheimlich gewesen war. Das sei eines der wenigen Tiere, vor denen man sich auf Galápagos in Acht nehmen müsse, hatte ihr ein Pfleger erklärt, den ihr Aufschrei herbeigelockt hatte. Sie hatte sich vorgenommen, diesen Weg nie wieder allein und ohne Taschenlampe entlangzugehen.
Das Feuer war hinter Häusern und Bäumen verborgen, nur seine Geräusche und ein rötlicher Schimmer wiesen ihnen den Weg. Einmal war ein lautes Krachen zu hören, als sei irgendeine größere Konstruktion zusammengestürzt.
Sie kamen an ein Rondell, wo endlich auch ein paar Lampen brannten, liefen um ein flaches Gebäude herum und dann auf einen Maschendrahtzaun zu. Das Tor war nur angelehnt. Dreißig Meter weiter öffnete sich der Blick auf die Bahía Academy, eine lang gestreckte Bucht, an deren Ende Puerto Ayora lag. Um freien Blick auf das Feuer zu haben, mussten sie am marinen Labor vorbei bis zum Wasser hinuntergehen. Ein paar Leguane, die auf der Kaimauer schliefen, machten ihnen widerwillig Platz.
»Tatsächlich, wieder ein Schiff«, rief Salvatore, der als Erster ankam.
Die Bucht war voller bunter Positionslichter. Und mittendrin stand eine Segeljacht vom Bug bis zum Heck in Flammen. Ihr Mast war umgeknickt und auf die Kajüte gestürzt.
Anne hatte sich schon gefragt, warum hier fast alle Boote an Bojen festgemacht waren, darunter viele Privatjachten, vor allem aber Wassertaxis und Ausflugsboote, die für Tagestouren und Tauchfahrten genutzt wurden. Wer an Land oder von der Pier auf sein Schiff wollte, musste mit dem Panga fahren oder eines des vielen kleinen Shuttleboote nehmen. Dass zwei der größeren Kreuzfahrtschiffe weit draußen ankerten, wunderte sie nicht, für Pötte dieser Größe gab es in dieser Bucht einfach nicht genug Platz. Für die kleineren Schiffe schien ihr das Hafenwasser eigentlich tief genug zu sein. Wahrscheinlich wollte man allzu großes Gedränge vermeiden. Die Bucht war schmal, die Zahl der Liegeplätze im Hafen begrenzt, und während der Stoßzeiten herrschte reger Verkehr.
Mittlerweile standen alle auf dem kleinen Steg und starrten schweigend in die Bucht hinaus. Lieke sprach aus, was sich wohl alle fragten: »Wieso fängt so ein Schiff mitten in der Nacht an zu brennen?«
»Ihr habt doch von einer Explosion gesprochen«, sagte Anne. »Vielleicht ist eine Gasflasche hochgegangen.«
»Einfach so? Dazu braucht es doch mindestens einen Funken, irgendetwas, das das Gas entzündet.«
Carol wies auf die vielen Bootslichter hin. »Wo Lampen leuchten, fließt Strom. Und wo Strom fließt …« Sie hob die Schultern und ließ sie wieder fallen.
»Und warum kommt niemand und versucht zu löschen«, fragte jemand. »Gibt es im Hafen keine Feuerwehr?«
»Natürlich gibt es die«, antwortete David. »Aber sieh’s dir doch an, die würde jetzt viel zu spät kommen. Da ist nichts mehr zu retten. Sie sollten es einfach ausbrennen lassen.« Er wandte sich ab und lief auf das Haus zu. Wieder huschten ein paar Leguane davon. Auf dem braun-schwarzen Vulkangestein waren sie kaum zu erkennen. »Ich geh wieder nach oben. Ich bin müde. Kommst du mit, Lieke?«
»Hört ihr das?«, rief Salvatore plötzlich. Die anderen, die sich David anschließen wollten, blieben abrupt stehen.
»Was meinst du?«
»Ich hab Stimmen gehört. Da schreit jemand.«
»War bestimmt nur ein Vogel.« David legte den Kopf schief und runzelte die Stirn. »Ich hör nichts.«
»Ich auch nicht«, sagte Lieke.
»Pscht«, machte der Italiener. »Seid doch mal still. Da!« Die anderen hielten die Luft an und lauschten. Nach einer Weile schüttelte David den Kopf. »Also, ich höre nichts. Ist doch auch Quatsch, Salvatore. Auf den Schiffen da in der Bucht sind um diese Zeit keine Menschen mehr.«
»Warum denn nicht? Guck doch hin. Auf den anderen Booten sind doch auch welche.« Tatsächlich waren auf einigen Schiffen spärlich bekleidete Menschen zu sehen. Manche schienen Eimer in der Hand zu halten. Wahrscheinlich hatten sie Angst, dass das meterhoch auflodernde Feuer auf ihr Schiff übergreifen könnte. Vom Ufer aus war kaum zu erkennen, wie weit die Leute vom Brandherd entfernt waren.
»Da, wieder!« Salvatore erstarrte. »Ganz deutlich. Da schreit jemand. Verdammt, da sind Menschen im Wasser.«
»Salvatore hat recht.« Carol machte ein entsetztes Gesicht, und auch die anderen hatten es jetzt gehört.
»Scheiße …«, fluchte David.
»Wir müssen irgendwie da hin, oder?« Der Italiener sah sich hektisch um. »Man muss doch helfen. Wo ist das Panga?«
David ergriff seinen Arm. »Du willst doch nicht mit dem Schlauchboot zu einem brennenden Schiff fahren? Denk an den Funkenflug. Viel zu gefährlich. Da kannst du gleich schwimmen.«
»Ich glaube, das sind die Leute auf den anderen Schiffen, die da rufen«, sagte Lieke.
Unschlüssig standen sie nebeneinander auf der kleinen Anlegestelle, lauschten dem Prasseln des Feuers und starrten in die Bucht hinaus. Dann entdeckte jemand das hell erleuchtete Schiff, das sich aus Puerto Ayora näherte. Vorn im Bug stand ein Mann mit einem Schlauch. Ein Aufatmen ging durch die Gruppe. »Jetzt kommen sie. Na toll.«
»Besser jetzt als gar nicht.«
Sie versuchten zu erkennen, was um die brennende Jacht herum geschah. Aber die Entfernung war zu groß, und niemand hatte daran gedacht, ein Fernglas mitzunehmen.
Anne fiel ein, was der Italiener gesagt hatte, als er den Steg erreicht und das brennende Schiff gesehen hatte. »Salvatore, hast du vorhin wieder gesagt? Es ist wieder ein Schiff?«
»Hmhm. Als wir auf der Queen Mabel waren, soll schon eins gebrannt haben. Ein Bekannter aus Puerto Ayora hat es mir erzählt.«
»Merkwürdig«, sagte Anne. Aus der Dunkelheit hinter ihr waren leise Stimmen und Schritte zu hören. David und die anderen hatten sich schon auf den Rückweg begeben. Kurz entschlossen hakte sie sich bei Salvatore unter und fragte: »Gehen wir?« Sie hatte keine Lust, wieder allein durch diese exotische Dunkelheit zu irren.
Salvatore nickte, aber er zögerte noch. »Du hast die Schreie doch auch gehört, oder?«
»Ja«, antwortete Anne. »Aber ob da wirklich jemand um Hilfe gerufen hat, kann ich nicht sagen.«
»Ich bin mir fast sicher, dass das nicht von den anderen Booten kam.« Der junge Mann war sichtlich verwirrt. »Bestimmt kann ich heute Nacht nicht mehr schlafen.«
»Mach dir keine Sorgen. Jetzt ist ja die Hafenfeuerwehr da. Wenn da wirklich jemand ist, holen sie ihn raus.«
»Ja«, sagte Salvatore und sah noch einmal aufs Wasser hinaus. »Hoffentlich.«
2
Isla Isabela, Queen Mabel
Die drei Männer waren um halb sechs aufgestanden, hatten in der Morgendämmerung vor der Kajütentür stehend einen Kaffee getrunken und dann an der Westküste der lang gestreckten Vulkaninsel Isabela einen ersten Tauchgang unternommen. Als sie wieder aus dem Wasser kletterten, wartete das Frühstück: Tortilla, Toast, Schinken, Früchte und eine Riesenkaraffe mit kaltem Saft. Der Schiffskoch hatte alles aufgefahren, was seine kleine Küche hergab. Danach stellten sie die Teller zusammen, und ein Besatzungsmitglied räumte den Tisch ab. Während der Koch mit dem Abwasch begann, machten die drei Wissenschaftler es sich auf der Sitzbank um den großen Tisch bequem. Alberto stapelte in der Ecke ein paar Kissen aufeinander, ließ sich zufrieden seufzend in das weiche Lager sinken, streckte die Beine auf der Sitzbank aus und schloss die Augen. Dieter tat es ihm auf der anderen Seite gleich. Bald verrieten ihre tiefen, gleichmäßigen Atemzüge, dass sie eingeschlafen waren.
Auch Hermann kämpfte einen Moment mit seiner Müdigkeit. Es war spät geworden gestern, und für seine Verhältnisse hatte er viel getrunken. Doch er blieb sitzen und klappte seinen Computer auf, um sich die Videos anzusehen, die er aufgenommen hatte. Für seine beiden Kollegen waren Tauchgänge in tropischen Meeren alltägliche Routine, er hingegen erlebte sie als seltene Kostbarkeiten, die es irgendwie zu konservieren galt, für den langen Winter daheim, für die dunklen Momente, in denen er fürchtete, dass das Leben im Meer auf der Kippe stand. Vielleicht würde er später versuchen zu schlafen, jetzt wollte er die Protagonisten dieses Morgens noch einmal Revue passieren lassen, wollte sich einprägen, was er gesehen hatte, weil er nicht wusste, ob und wann er noch einmal Vergleichbares erleben würde. Er hatte das Gefühl, dass die Tage wie im Fluge vergingen. Bald würde er wieder in Kiel sein.
Er nahm die Speicherkarte aus der Kamera und blickte, während der Computer hochfuhr, durch das Kajütenfenster auf Fernandinas fast 1500 Meter hohen La Cumbre, den aktivsten Vulkan des Archipels, um dessen Kratergipfel sich dekorativ einige Wolken gruppiert hatten. Zuletzt war er im April 2009 ausgebrochen, ohne Vorwarnung, ohne dass die Nadeln der seismischen Station in Puerto Ayora in den Tagen zuvor auch nur einen Erdstoß registriert hätten. La Cumbre war eine schlafende Dämonin, die jederzeit erwachen konnte. Irgendwo tief unter dem schildförmigen Berg befand sich der Hot Spot, dem diese Inseln und alles, was darauf lebte, ihre Existenz verdankten, eine Lavaquelle, die seit Jahrmillionen nicht versiegte.
Hermann wandte sich dem Monitor zu und startete den Film. In diesen Gewässern musste man immer mit starken Strömungen rechnen, die einem den schönsten Tauchgang verleiden konnten. An manchen Plätzen blieb einem nichts anderes übrig, als sich an einem Felsen festzuhaken und darauf zu warten, was die Strömung so vorbeitreiben würde. Und wenn die äquatoriale Unterströmung mal wieder einen Schwung frischen Tiefenwassers in den Kanal zwischen Isabela und Fernandina drückte, konnte das Wasser empfindlich kalt sein. Wegen dieser kalten, kohlendioxidreichen Wassermassen aus den Tiefen des Pazifiks glaubten manche Wissenschaftler, auf Galápagos das versauerte Meer der Zukunft studieren zu können. Deshalb waren Lieke, David, Salvatore und die anderen hierhergekommen.
Doch heute Morgen hatte nichts dergleichen ihren Tauchgang beeinträchtigt, keine tückischen Strömungen, keine Kälte, keine störenden Gedanken an das Sterben der Korallenriffe oder die Versauerung der Ozeane. Die düsteren Szenarien zur Zukunft des Planeten schienen ein paar Meter unter der Wasseroberfläche zu einem Hirngespinst katastrophensüchtiger Medien zu schrumpfen. Obwohl Hermann es besser wusste, oder zumindest glaubte, es besser zu wissen – wer konnte bei den hochkomplexen Zusammenhängen, um die es hier ging, schon sicher sein –, ertappte er sich manchmal bei der Hoffnung, die Forscher und ihre Computer könnten sich irren und all die schrecklichen Vorhersagen zur Veränderung des Weltklimas und deren Folgen würden sich wie das Waldsterben als Untergangsfantasie einiger notorischer Schwarzseher entpuppen.
Sie hatten viel gesehen, und Alberto hatte auf seinem Klemmbrett mit dem wasserfesten Papier eine lange Liste von Tierarten notiert, darunter auch große wie die Grünen Meeresschildkröten, die hier sehr häufig waren, und eine in Keilformation schwimmende Schule Goldener Kuhnasenrochen. Ein vier Meter langer Hammerhai war gemächlich über ihren Köpfen dahingeglitten. Vielleicht war er auf dem Weg nach Norden, um bei den weit abgelegenen Inseln Darwin und Wolf auf seine Verwandtschaft zu stoßen. Seine Artgenossen versammelten sich dort zu Hunderten, einer der spektakulärsten Tauchplätze der Welt, sofern man die Nerven hatte, durch eine Wolke von kreisenden Hammerhaien abzutauchen.
Das Tier, das ihm und Anne hier in der Nähe so telegen vor die Kamera geschwommen und der Anlass für diese Bootstour gewesen war, hatte sich nicht blicken lassen, natürlich nicht. Darauf zu hoffen, dass es ihnen noch einmal begegnen würde, war sowieso ziemlich naiv. Manche Arten, wie die Galápagoshaie, waren zwar recht ortstreu, andere legten aber gewaltige Distanzen zurück, und schwimmen mussten die großen Haie immer, sonst drohten sie zu ersticken. Dazu kamen die Sichtverhältnisse, die alles andere als optimal waren. Ihre Suche war also vermutlich aussichtslos, aber es war ihre einzige Chance. Wenn sie das Rätsel lösen wollten, mussten sie tauchen, Ausschau halten und hoffen, dass das Tier sich zeigte. Hermann war vom bisherigen Verlauf ihrer Unternehmung jedoch nicht enttäuscht, im Gegenteil, er konnte sich keine schönere Art vorstellen, einen Tag zu beginnen, als mit einem solchen Ausflug in die Tiefe. Wenn es ihnen nicht gelang, den Hai zu finden, würden sie in jedem Fall eine Menge Spaß haben.
Die Bedeutung seiner ersten Begegnung mit dem Tier war Hermann zunächst gar nicht bewusst gewesen. Kurz nach ihrer Rückkehr in die Station hatten Anne und er beschlossen, sich auf der schattigen Terrasse des marinen Labors die Videoaufnahmen anzusehen. Sie hatten sich in der Teeküche Wasser heiß gemacht, die dampfenden Tassen standen vor ihnen auf dem Tisch, im Gesträuch um die Station piepsten die Darwinfinken, unten auf der Rampe putzten zwei Pelikane ihr Gefieder, und an einem schmalen, schattigen Plätzchen drängten sich ein Dutzend Meeresleguane neben- und übereinander zusammen, um der sich ankündigenden Mittagshitze zu entkommen, als plötzlich die Tür zu den Büros aufging und Dieter Grumme heraustrat, der Leiter der marinen Abteilung der Charles-Darwin-Station. In seiner Begleitung befand sich ein zweiter Mann, der einen dicken, grau melierten Schnurrbart trug. Hermann stutzte, als er ihn sah, dann strahlte er über das ganze Gesicht.
»Ich glaub’s ja nicht. Alberto!«
»Überraschung!«, posaunte Dieter und trat mit seinem Begleiter zu ihnen an den Tisch.
»Und was für eine«, rief Hermann. Er kannte Alberto Luengo Costa aus den späten Neunzigerjahren, als er nach einem starken El Niño in mehreren lateinamerikanischen Ländern Untersuchungen an Humboldt-Kalmaren durchgeführt hatte. Sie waren damals gute Freunde geworden, doch jetzt hatten sie sich seit Jahren nicht mehr gesehen.
Hermann stand sofort auf, um seinen Kollegen zu begrüßen, der erst am Vortag aus Guayaquil angereist war. Er machte ihn mit Anne bekannt und stellte ihn ihr als einen der besten Fischkenner Südamerikas vor. Die beiden waren etwa im selben Alter und musterten sich interessiert. Alberto war noch immer ein sehr attraktiver Mann, auch wenn er an den Hüften ein wenig fülliger geworden war. Das mittlerweile angegraute Haar stand ihm ausgezeichnet. Um seine braunen Augen bildeten sich tiefe Lachfältchen, und er warf Hermann einen anerkennenden Blick zu, der sich unzweifelhaft auf Anne bezog. Hermann quittierte es mit einem Lächeln, nahm sich aber vor, Alberto, der damals auch seine Frau Brigitte kennengelernt hatte, so bald wie möglich aufzuklären, denn von ihrem Tod wusste er mit Sicherheit nichts. Er sollte nicht auf falsche Gedanken kommen.
Sie plauderten, fragten nach diesem und jenem Kollegen, mit dem sie damals zusammengearbeitet hatten, nach aktuellen Projekten und den Gründen ihres Aufenthalts in der Station, als Albertos Blick zufällig auf den Computer fiel, der, von niemandem beachtet, die Tauchvideos abspielte. Gerade schob sich der schlanke Körper eines Hais ins Bild.
»Oh«, rief er, »wen haben wir denn da?« Er stand etwas seitlich hinter Anne und beugte sich so weit nach vorne, dass er das Gleichgewicht verlor und sich auf der Tischplatte und ihrer nackten Schulter abstützen musste.
Sie schrie überrascht auf, lachte dann aber. Hermann hatte sie nach einem ähnlichen Zwischenfall schon ganz anders erlebt. Sie mochte es nicht, wenn ihr Menschen zu nahe kamen. Der Mann, der ihr kürzlich vor einem Schaufenster aus Versehen auf den Fuß getreten war, tat ihm heute noch leid. Wenn die Erste Kriminalhauptkommissarin in ihr zum Vorschein kam, wenn sie den Ton hören ließ, mit dem sie ihre Männerriege zusammenstauchte, glaubte Hermann manchmal, einen anderen Menschen vor sich zu haben. Es war unschwer zu erkennen, dass sie Alberto mochte. Seinen Überfall kommentierte sie mit keinem Wort.
»Ein Hai«, stellte sie trocken fest, zog die Augenbrauen hoch und sah den Ecuadorianer mit einem leichten Schmunzeln über die Schulter hinweg an. »Was ist an dem so ungewöhnlich?«
Alberto hatte neben ihr wieder festen Stand gefunden und machte ein betretenes Gesicht. »Entschuldigen Sie bitte.« Er strich sich verlegen über den Schnurrbart und setzte dann ein charmantes Lächeln auf. »Ich habe nicht aufgepasst. Aber dieses Tier … ich muss gestehen … ein Hai, Sie haben recht. Ein sehr interessantes Exemplar sogar. Was sind das für Aufnahmen? Wo stammen die her?«
»Der Bursche ist uns gestern vor die Linse geschwommen«, schaltete sich Hermann ein. »Vor der Westküste von Isabela. Ich habe vergessen, wie die Bucht heißt.« Das Tier verschwand aus dem Bild. Die Kamera schwenkte auf einen Schwarm Doktorfische. »Warte, gleich kommt er zurück.«
Alberto kniff die Augen zusammen und wartete. Der Hai schien ihn wirklich zu interessieren. »Ah ja, da ist er wieder.« Er stützte sich mit den Händen auf den Knien ab, um besser sehen zu können. »Absolut faszinierend. Die Aufnahmen stammen wirklich von hier?«
»Glaubst du uns nicht?«, fragte Hermann. »Von wo denn sonst?«
»Ich frage nur, weil das kein gewöhnlicher Hai ist. Ich meine, keine der Arten, die man hier üblicherweise findet.«
»Sondern?«
Alberto zögerte. »Ich weiß nicht …«
Jetzt schaute auch Dieter Grumme genauer hin. »Hm«, brummte er. »Ich verstehe, was du meinst. Ein Seidenhai vielleicht?«
Alberto widersprach vehement. »Nein, das ist kein Seidenhai. Sieh dir an, wo die Rückenflosse ansetzt. Kann ich das noch mal sehen, bitte?«
Anne trank einen Schluck aus ihrer Teetasse und erhob sich. »Kommen Sie, setzen Sie sich. Dann können Sie ihn besser erkennen.«
»Nicht doch. Bitte! Bleiben Sie sitzen.«
»Es macht mir nichts aus. Wirklich nicht. Wann erlebt man schon mal so etwas? Sogar der beste Fischkenner Ecuadors ist ratlos.«