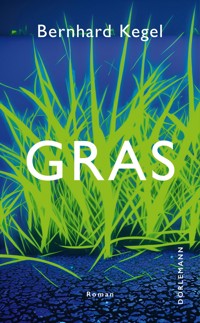9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Paläontologe Dr. Helmut Axt, genannt Hackebeil, sucht im Ölschiefer der Grube Messel nach Fossilien. Doch das, was die weltbekannte Fundstätte bei Darmstadt diesmal preisgibt, lässt sein wissenschaftliches Weltbild einstürzen: Es sind die versteinerten Überreste eines Menschen mit Armbanduhr. Durch welches Zeitloch ist der Tote aus unserer Welt in den 50 Millionen Jahre alten Öschiefer geraten? Axt tritt eine Reise an, die ihn viele Millionen Jahre zurück ins Eozän führt – in ein Erdzeitalter, in dem Menschen eigentlich nicht vorkommen dürften. Und doch ist er dort nicht allein. Ein außergewöhnlicher Wissenschaftskrimi über eines der spannendsten Gebiete der Naturwissenschaften, die Evolutionsforschung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Bernhard Kegel
Das Ölschieferskelett
Eine Zeitreise
Über dieses Buch
Der Paläontologe Dr. Helmut Axt, genannt Hackebeil, sucht im Ölschiefer der Grube Messel nach Fossilien. Doch das, was die weltbekannte Fundstätte bei Darmstadt diesmal preisgibt, lässt sein wissenschaftliches Weltbild einstürzen: Es sind die versteinerten Überreste eines Menschen mit Armbanduhr. Durch welches Zeitloch ist der Tote aus unserer Welt in den 50 Millionen Jahre alten Öschiefer geraten? Axt tritt eine Reise an, die ihn viele Millionen Jahre zurück ins Eozän führt – in ein Erdzeitalter, in dem Menschen eigentlich nicht vorkommen dürften. Und doch ist er dort nicht allein.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Bernhard Kegel, Jahrgang 1953, ist promovierter Biologe und leidenschaftlicher Jazzgitarrist. Er lebt als vielfach ausgezeichneter Schriftsteller von Romanen und Sachbüchern in Berlin und Brandenburg. Im Fischer Taschenbuch Verlag sind lieferbar seine Romane »Das Ölschieferskelett«, »Der Rote« und »Ein tiefer Fall«. Zuletzt erschien von ihm »Tiere in der Stadt. Eine Naturgeschichte«.
Impressum
Covergestaltung: bürosüd°, München
Coverabbildung: aus dem ›Buch der Palmen‹ von Karl Friedrich Philipp von Martius
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Die Originalausgabe erschien 1996 im Ammann Verlag, Zürich
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402769-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
I
1 Messel
Kopfschmerzen
Hackebeil
Gorgo
Röntgenstrahlen
2 Mitbringsel
Schmäler
Das Herbarblatt
Dinos
Der Vortrag
Der Wirbel
Dumme Fragen
Halluzinationen
Der Lazaruseffekt
3 Die Falle
Der Plan
Enameloid von Prionace
Die Höhle
II
4 Erdrutsch
Der Zusammenbruch
Nach Osten
Sonntagnachmittagsschinken
Die Ralle
5 Lügen
Dr. Di Censo
Sorgen
King und Kong
Kunstharz
6 Safari
Messi
Max
Der Eozän
Ein letzter Versuch
III
7 Angriff
Besuch
Klartext
Neugier
Sintflut
8 Fußspuren
Die Kambrische Explosion
Dr. Livingstone
Der See
IV
9 Tinnitus
Diebe
Nachwort
Zeittabelle der Erdgeschichte
Im Gedenken an Karel Zeman
Wäre mein Leben ohne seinen Film anders verlaufen?
In mancher Hinsicht leben auch Paläontologen so; ihr physisches Leben folgt dem geradlinigen Trend der Zeit, aber ihre Gedanken bewegen sich vorwärts und rückwärts durch die Äonen und springen von Pfad zu Pfad, auf denen die Zeit manchmal rätselhafte Schritte tut.
Peter Douglas Ward, Der lange Atem des Nautilus
I
»Eine unmäßige Vorliebe für Käfer«, antwortete der berühmte britische Populationsgenetiker J. B. S. Haldane auf die Frage eines Kirchenmannes, welche Eigenschaften des Schöpfers sich ihm durch das Studium der Natur offenbart hätten.
Die Zahl der heute bekannten Käferarten liegt bei etwa 400000. Sie sind damit die mit großem Abstand artenreichste Tiergruppe der Erde.
1Messel
Lustlos stocherte Max Behringer mit seinem Spaten in dem lockeren Schiefer. Dann stützte er sich mit einem Seufzer auf den abgewetzten Holzstiel und blinzelte in die Sonne, deren letzte Strahlen gerade noch auf den Boden der Grube fielen. Der schwarze Schiefer schien das Licht wie ein Schwamm in sich aufzusaugen. Es wurde früh dunkel hier unten, und mit dem Licht verschwand auch die Wärme, sogar an einem heißen Sommertag wie diesem. Sobald sich Schatten über den Grubenboden senkte, kroch durch dicke Schichten feuchten Gesteins die Kälte empor.
Das Gelände lag wie ausgestorben. Kein Mensch, selbst dort hinten in der Nähe des schon im Schatten liegenden steilen Grubenrandes, wo die Belgier im Augenblick ihre Ausgrabungen durchführten, überall nur zersplitterter Schiefer und dreckige Plastikplanen. Ganz in der Nähe standen die verlassenen Gerätschaften der Geologen herum. Sie hatten hier in den letzten Wochen alles auf den Kopf gestellt, zahllose meterlange Bohrer in den Schieferboden getrieben und waren Max mit ihren Sonderwünschen und einem unsäglichen Kommandoton auf den Wecker gegangen. Das zurückgelassene Bohrgestänge sah in der kargen Umgebung der Grube aus wie eine zerschellte Weltraumsonde.
Seltsam, dachte Max, sonst wühlten diese Gastforschergruppen doch bei Wind und Wetter so lange in dem Schiefer herum, wie es nur irgendwie ging, bis es so dunkel geworden war, dass man nichts mehr erkennen konnte und sich mit dem Spaten womöglich in den eigenen Fuß hackte. Die hofften natürlich bis zur letzten Minute, doch noch ihr Urpferdchen zu finden, ihren Ameisenbären, ihre Beutelratte oder irgendetwas anderes, Spektakuläres, das den ganzen Aufwand lohnte und ihnen eine triumphale Heimkehr garantierte. Aber so ging das natürlich nicht. Mit Gewalt war da nichts zu machen. Niemand wusste das besser als Max. Schließlich arbeitete er nicht erst seit gestern hier.
Max hatte immer wieder seinen Spaß, wenn er den auswärtigen Gästen bei der Arbeit zuschauen konnte. Brachte wenigstens mal etwas Abwechslung in den Laden, andere Stimmen, neue Gesichter, nicht immer nur diese Langweiler oben aus der Station. Einige, die das erste Mal in die Grube kamen, liefen anfangs wie auf Eiern, weil sie fürchteten, mit ihren klobigen Gummistiefeln kostbare Fossilien zu zertreten.
Na ja, irgendwie konnte er sie schon verstehen. Messel war etwas Besonderes. Sie mussten sich erst daran gewöhnen. Stieg ihnen dann der Geruch des berühmten Schiefers in die Nase, waren sie nicht mehr zu halten. Sie stürzten sich in die Arbeit, ackerten und schufteten, als hinge ihr Leben davon ab. Sie waren ja nur ein paar Tage hier, und vielleicht war der Sensationsfund genau in dem Stück Schiefer, das sie noch nicht aufgebrochen hatten. Viele Museen überall auf der Welt hätten sich gerne mit einem echten Messeler Urpferdchen geschmückt.
Am Anfang freuten sie sich über die alltäglichsten Fundstücke wie Kinder. Mit vor Aufregung geröteten Gesichtern rannten sie umher, stießen in ihren seltsamen Sprachen unverständliche Triumphschreie aus, und wenn Max dann hinzutrat und sich anschaute, was sie gefunden hatten, gab es selten mehr als winzige Fische oder ein Farnblatt zu bestaunen. Davon hatte er schon Hunderte zutage befördert. Man musste sich schon ziemlich dämlich anstellen, wenn man es fertigbrachte, hier keine Fossilien zu finden.
Die Belgier waren sowieso in Ordnung, auf die ließ er nichts kommen. Sie gruben hier regelmäßig und hatten immer einen Kasten Bier neben der Ausgrabungsstelle stehen, aus dem auch er sich bedienen durfte. Jetzt hockten sie wahrscheinlich in irgendeinem Gasthof und soffen sich die Hucke voll. Ganz schön trinkfest, diese Belgier.
Typisch! Es war Freitagnachmittag, und alle waren ausgeflogen, nur er musste hier noch seine Zeit totschlagen, er und Rudi, der ein paar Meter links von ihm auf dem Boden hockte und eine Zigarette rauchte.
Vielleicht waren die Belgier schon abgereist. Ihm erzählte man ja nichts. Er war ja hier nur für die Dreckarbeit zuständig. Diese studierten Weißkittel wollten sich die Hände nicht schmutzig machen. Teufel noch mal, wie er diesen Job manchmal hasste. Wenn er sich zu Hause die völlig verdreckten Gummistiefel auszog, schwor er sich immer wieder, dass das nicht mehr so weitergehen könne. Bei Regen wurde das Zeug so glatt, dass man alle naselang ausrutschte und sich von oben bis unten einsaute. Eine Müllkippe wollten sie aus der Grube machen. Ha, wenn das kein Witz war! Eine Müllkippe, das war dieses Loch doch schon lange.
Er seufzte, stieß den Spaten wieder in den schwärzlichen Grund und brach ein neues Stück Schiefer heraus, das aussah wie dunkelgrauer, an manchen Stellen grünlich schimmernder Blätterteig.
Er blickte auf die Uhr. In einer knappen Stunde war Feierabend, und dann konnten die ihn hier alle mal kreuzweise.
»Biste eingeschlafen oder was?«, rief er Rudi missmutig zu, der immer noch unbeweglich im Schiefer hockte, obwohl seine Zigarette schon lange verglüht war. Jetzt brummte der unwillig, schnappte sich seinen Spaten und schlurfte auf die andere Seite der Ausgrabungsstelle.
Fauler Hund, dachte Max, aber im Grunde mochte er den Rudi ganz gern. Rudi redete nicht viel, er war sogar ziemlich maulfaul. Aber das störte Max nicht. Besser, als plappern wie ein Wasserfall. Das hätte ihm gerade noch gefehlt.
Das Schöne an dem Job war, dass ab und zu und unvorhersehbar etwas richtig Aufregendes passieren konnte. Das Ganze erinnerte ihn manchmal an die Wundertüten, die man früher für ein paar Groschen beim Zeitungshändler kaufen konnte. Man wusste nie, was einen erwartete. Entweder derselbe Scheiß wie immer oder etwas Neues, das man noch nie zuvor gesehen hatte.
Meistens fanden sie natürlich nur diese kleinen Fische, Hunderte, die nahmen sie kaum noch zur Kenntnis. Riesige Schwärme musste es davon gegeben haben, damals, als das hier alles noch ein See war. Aber letztes Jahr, als er das Urpferdchen gefunden hatte, da war was los. Donnerwetter! Die Wissenschaftler oben aus der Senckenberg-Station waren völlig aus dem Häuschen, wie wild gewordene Bienen. Später kamen dann auch noch die Leute von der Presse und knipsten, was das Zeug hielt.
Und er hatte es gefunden, er, Max Behringer. Einer der Pressefritzen bestand sogar darauf, ihn zu interviewen. So etwas passierte einem auf dem Bau natürlich nicht. Bisher gab es nur ganz wenige von diesen Skeletten, und das, was er entdeckt hatte, war vollständig gewesen, ein Urpferdchen mit allem Drum und Dran. Sogar was das Biest gefressen hatte, konnten sie später feststellen. Das muss man sich mal vorstellen, fünfzig Millionen Jahre alt, und die können dir sagen, was es zum Frühstück gefuttert hat.
Vor einigen Wochen hatte er eine Fledermaus gefunden. Die waren zwar ziemlich häufig hier, aber sie stellte sich als eine bisher unbekannte Art heraus, schon die sechste in Messel. Max war das egal, und er konnte die Aufregung kaum nachvollziehen, aber da oben in der Station gab es die Schäfer, und die war ganz heiß auf die Dinger. Schon komisch, womit sich die Leute ihr ganzes Leben beschäftigen. Fledermäuse, na ja, ihm sollte es recht sein.
Sogar für fossile Krokodilscheiße gab es begeisterte Abnehmer. Überhaupt schien diese versteinerte Tierkacke besonders wichtig zu sein. Sie waren ganz versessen darauf. Die Senckenberg-Stiftung hatte ein Sonderforschungsprogramm über diese Koprolithen aufgelegt. Bei Rudi und Max hießen sie einfach Scheißfossilien.
Tatsächlich schien die Grube voll davon zu sein, die reinste Kloake. Wenn man erst einmal wusste, wonach man suchen musste, fand man überall Koprolithen. Es gab große klumpenförmige, kleine krümelige und, besonders auffällig, spiralförmig gedrehte, richtig kunstvoll, wie ein Schneckengehäuse. Die Wissenschaftler versuchten jetzt herauszufinden, zu wem welche Form gehörte. Kürzlich war hier in der Station ein internationales Treffen zu diesem Thema. Es war unfassbar: zwanzig, dreißig erwachsene und eigentlich ganz normal aussehende Männer und Frauen, allesamt Doktoren und Professoren, die sich für nichts anderes als versteinerte Scheiße interessierten.
Aber was soll’s, jeder hat so seine Schwächen. Immerhin konnten sie mitunter auch ganz nett sein, vor allem, wenn man sie mit einem ihrer Forschungsgegenstände beglückte. Die Fledermaustante war über seinen Fund so happy, dass sie ihm eine Flasche Schampus geschenkt hatte, echten französischen Champagner. Das war doch ein anständiger Zug von ihr. Vorher hatte er die Schäfer immer so arrogant gefunden mit ihrer spitzen Nase und dem ungewöhnlich großen Mund. Die kann Spargel quer fressen, meinte Rudi.
Jetzt saß sie wahrscheinlich da oben und kratzte und polkte das Skelett aus dem Schiefer. Mit Zahnbürsten, kleinen Spachteln und Sandstrahlgebläsen rückten sie den Funden zu Leibe, wochenlang. Er hatte schon öfter dabei zugesehen. Musste wohl ziemlich kompliziert sein, wegen des hohen Wassergehaltes. Nee, das wär nichts für ihn, dann schon lieber mit dem Spaten arbeiten. Da hatte man wenigstens was in der Hand.
Er atmete einmal tief durch und legte einen Zahn zu. So verging die Zeit schneller. Er schaute auf das Stück Schiefer hinunter, das er gerade losgebrochen hatte.
Komisches Zeug, dieser Ölschiefer! Stein, aber weich wie Blätterkrokant. Als er hier anfing, hatte einmal jemand versucht, ihm zu erklären, dass der Name ziemlicher Unsinn sei, weil es sich streng genommen weder um Schiefer handele noch um Öl. Max hatte nicht viel davon verstanden. Es war ihm doch schnuppe, wie das Zeug nun wirklich hieß und was es genau darstellte. Früher hatten sie hier jedenfalls tatsächlich Öl gewonnen und Benzin daraus hergestellt, aber das lohnte sich schon lange nicht mehr. Jetzt stritten sich die Fossilienfritzen und die Gemeindeverwaltung um die Grube. Diese Schreibtischhengste wollten eine Müllkippe daraus machen. Na klasse, dann konnte er seinen Job sowieso vergessen. Im Augenblick herrschte Waffenstillstand, aber man konnte ja nie wissen, wie lange so etwas anhielt.
Halt! Er stutzte. Da war etwas.
Nachdem er schon ein paar ungewöhnliche, größere Funde zutage gefördert hatte, kannte Max das Gefühl in seinen Händen, wenn zwischen zwei Platten etwas verborgen war. Sie klebten dann irgendwie anders aneinander.
Vorsichtig steckte er sein Messer zwischen die Schieferbruchstücke und versuchte sie zu lockern. Nach einigem Hinundherruckeln löste sich endlich die obere Platte mit einem schmatzenden Geräusch. Tatsächlich, sein Gefühl hatte ihn nicht getäuscht, da war etwas Weibliches, Knochiges. Sah irgendwie seltsam aus, wie, ja, wie … Ach, darüber sollten sich die Herren Spezialisten den Kopf zerbrechen, dafür wurden sie ja schließlich bezahlt.
»Rudi, komm doch mal her«, rief Max und beugte sich über seinen Fund. »Was sagst’n du dazu?«
»Hm«, machte Rudi nachdenklich und hockte sich neben das Fundstück, eine Gruppe kleiner Knochen, aufgereiht wie auf einer Perlenschnur.
»Scheiße, ausgerechnet jetzt«, fluchte Max, dem langsam klar wurde, was er sich eingebrockt hatte. Wenn die Verrückten oben in der Station davon erfuhren, waren sie imstande, ihm sein ganzes Wochenende zu vermiesen. So langweilig und lahmarschig sie normalerweise auch sein mochten, angesichts von frischem Fossilienmaterial konnten sie einen beängstigenden, durch nichts und niemanden zu bremsenden Fanatismus an den Tag legen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie von ihnen verlangten, ein Fundstück am Wochenende zu bergen. Meistens kamen sie in solchen Fällen mit irgendwelchen obskuren Fossilienräubern, die sich hier herumtreiben und ihnen zuvorkommen könnten. Dabei ging es nur um ihre eigene Gier.
»Hm«, sagte Rudi.
»Wenn das was Interessantes ist, dann sitzen wir hier noch mindestens zwei Stunden fest, das ist dir doch klar, oder?« Max bückte sich und kratzte mit seinem Taschenmesser vorsichtig neben dem Fundstück herum. »Da ist noch mehr«, sagte er. »Hab ich jedenfalls noch nicht gesehen so was.«
Rudi nickte bedächtig und brummte: »Du musst Hackebeil Bescheid sagen!«
Hackebeil hieß eigentlich Dr. Helmut Axt und leitete oben die Außenstation des Senckenberg-Museums, aber sie nannten ihn nur Hackebeil, wegen seines Namens und wegen seines spitzen Kinns.
»Du weißt, was das bedeutet?«, fragte Max und sah seinen Kollegen eindringlich an. Mann, hatte der eine lange Leitung. »Dein Wochenende kannst du dann vergessen.«
»Hm …« Das gab Rudi zu denken. »Und wenn du einfach bis Montag wartest?«
Max nickte. Na bitte, endlich, genau das hatte er hören wollen. Rudi machte eine Geste, dass sein Mund versiegelt sei.
Vorsichtig legte Max die Schieferplatte wieder an Ort und Stelle, besprühte das Ganze mit Wasser und deckte dann zusammen mit Rudi eine Plastikplane über die Ausgrabungsstelle. Wenn der Messeler Schiefer trocken wurde, begann er sich zu wellen wie feuchtes Papier und zersprang schließlich in zahllose kleine dünne Plättchen. Alles, was sich darin befand, zersprang natürlich mit. Da war dann nichts mehr zu machen. Es war das A und O ihrer Arbeit. Sie mussten immer darauf achten, dass die Grabungsstellen feucht und gut abgedeckt waren. Das hatte ihnen Hackebeil x-mal eingeschärft. Direkte Sonneneinstrahlung war Gift, tödlich.
Gemeinsam stiefelten Max und Rudi anschließend auf den Maschendrahtzaun zu, der den Ausgrabungsbereich der Grube Messel umgab und von dem Gebiet abtrennte, das schon für die zukünftige Müllkippe hergerichtet worden war.
»Also dann«, sagte Max, als sie am Tor angekommen waren, wo sein Fahrrad stand. »Bis Montag!«
»Ja, bis Montag«, sagte Rudi und hielt nochmals zum Zeichen der Verschwiegenheit den Zeigefinger an die Lippen.
Kopfschmerzen
In der Rechten eine schaukelnde Plastiktüte, schleppte sich Michael Hofmeister schweren schlürfenden Schrittes die Knesebeckstraße entlang. Am Zeitungsladen überflog er kurz die Schlagzeilen der Tagespresse KLIMACHAOS! IST DIE KATASTROPHE NOCH AUFZUHALTEN? KLIMAFORSCHER WARNEN: HANDELN, BEVOR ES ZU SPÄT IST! Danke, kein Interesse, dachte er. Das Ganze stank doch zum Himmel.
Er hatte kürzlich von einer neuen Theorie über den Untergang der Dinosaurier gelesen, nach der diese Riesen aus ihren kilometerlangen Darmwindungen derartige Mengen von Methan ausgeschieden hätten, dass ihr Verdauungstrakt heutzutage unter das Bundes-Immissionsschutzgesetz gefallen und nur unter erheblichen Auflagen genehmigungsfähig gewesen wäre. Folglich war irgendwann das Klima gekippt. Die Theorie mit dem Meteoriteneinschlag und dem anschließenden atomaren Winter sagte Micha eigentlich mehr zu, schon deshalb, weil es zu den Riesenechsen irgendwie besser gepasst hätte, wenn ihr Ende mit einem solchen Paukenschlag eingeläutet worden wäre, aber er musste zugeben, dass auch die Saurierfurzhypothese nicht ohne Reiz war. Er machte sich da gar nichts vor. Die Menschen bekamen das auch hin, nur machten sie sich nicht selbst die Mühe, sondern überließen das Vergiften ihren Maschinen und jetteten solange lieber in den Urlaub. Jeder Organismus machte die Erde auf seine Weise kaputt. Wo blieb denn der evolutionäre Fortschritt, wenn die Menschheit es den Dinos einfach nachmachte. Den anderen Tier- und Pflanzenarten, kaum mehr als bloße Trittbrettfahrer, die mit in den Strudel gerissen wurden, war es letztlich egal, ob sie wegen Reptilienfurzen, Autoabgasen oder sonstigen Naturkatastrophen ausstarben.
Meine Güte! Micha schüttelte verärgert den Kopf und riss sich von den Zeitungsüberschriften los. Warum war er nur plötzlich so schlecht gelaunt?
Mit letzter Kraft steuerte er ein Café an, ließ sich an einem der wenigen freien Tische erschöpft in den weißen Plastikstuhl fallen und versuchte zwischen den engstehenden Tischen Platz für die langen Beine zu finden. Es war heiß, für seinen Geschmack definitiv zu heiß. Schon seit Wochen brannte die Sonne auf die Stadt herab, und wer konnte, hatte schon lange das Weite gesucht.
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und starrte missmutig auf die klebrige Speisekarte. In seinem Schädel hatte sich zunächst eine träge, dumpfe Müdigkeit breitgemacht und in ihrem Schlepptau eine erste Androhung von Übellaunigkeit. Aber jetzt war sie voll da, ausgereift, unverkennbar, unbeherrschbar, ein besonders schwerer Fall. Die Zeitungen hatten ihm den Rest gegeben. Dabei hatte doch alles so gut angefangen.
Vor ein paar Stunden hatte er die letzte Lehrveranstaltung des Sommersemesters absolviert, die Vorlesung in Spezieller Zoologie von Gechter. Er hatte sich zunächst wie alle anderen auch in wirklich prächtiger Stimmung befunden. Mit seinen Kommilitonen hatte er in einem Dahlemer Gartenlokal das Semesterende gefeiert und sich für seine Verhältnisse einen ziemlich heftigen Rausch angetrunken. Wie so oft, hatten sie über Gechter gelästert.
Während sich normale Menschen ihren Haustieren anglichen, hatten es Zoologieprofessoren schwerer. Sie passten sich ihrer Spezialtiergruppe an, in Gechters Fall den »Nurfüßern« oder Pantopoden. Diese Tiefseebewohner waren weitläufige Verwandte der Spinnen und sahen auch so aus: lange dürre Beine und ein ebenso dürrer Körper. Trotz der Schwere der Aufgabe war Gechter die Metamorphose bemerkenswert gelungen. Er war ein freundlicher, gutmütiger Mensch und ein hervorragender Zoologe und Lehrer, aber er sah einfach zum Piepen aus.
Die Versammlung löste sich langsam auf. Auch Micha hatte sich in einer relativ langwierigen Prozedur verabschiedet, war mit der U-Bahn zum Zoo gefahren und hatte etwa eine Stunde in verschiedenen Buchläden herumgestöbert. Langsam, aber sicher verwandelte sich dort sein nachmittäglicher Alkoholrausch in bleierne Müdigkeit, was wiederum angesichts der in den Läden angebotenen Büchermassen zu einer eklatanten Entscheidungsschwäche führte. Voll der besten Vorsätze, trug er schließlich Dostojewskijs Idiot und Walsers Halbzeit zur Kasse.
Die Bedienung kam. Er bestellte einen Kaffee, zündete sich eine Zigarette an, fläzte sich träge in den federnden Stuhl und blätterte ohne großes Interesse in seinen Neuerwerbungen. Nach dem zweiten Kaffee begann seine Müdigkeit bohrenden Kopfschmerzen zu weichen. Nur die schlechte Laune blieb. Sein Gehirn schien irgendwie periodisch anzuschwellen, jedenfalls drückte es mit zunehmender Kraft von innen gegen den Schädel und pochte an seine Schläfen. Das kann ja heiter werden, dachte er, packte die Taschenbücher wieder in die Tüte zurück, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und ließ seinen Blick über die Leute schweifen. Sie schienen alle durcheinanderzureden. In seinem Tran schnappte er zahllose Gesprächsfetzen auf: Strand, Sonne, Wein, Urlaub. Das hellte seine miese Stimmung wieder etwas auf.
Einzelne spitze Lacher einer großen Blonden am Nebentisch bohrten sich schmerzhaft in seine Gehörgänge. Sofort war er hellwach. Eigentlich genau sein Typ, nur ihr Organ war etwas zu schrill. Ein warnendes Stechen in seinem Kopf erinnerte ihn sofort daran, dass dies nun schon die zweite Sommerreise hintereinander war, die er ohne weibliche Begleitung antreten musste, und das war alles andere als ein erfreulicher Gedanke. Irgendwie lief es in letzter Zeit nicht besonders gut. Aber dieser Sommer würde die Wende bringen. Es musste einfach so sein. Er warf seiner Nachbarin einen flüchtigen Blick zu und musste grinsen.
Plötzlich trafen seine Augen mit denen eines hageren Typen zwei Tische weiter zusammen. Der Kerl musste irgendwas falsch verstanden haben, denn er grinste herausfordernd zurück, so als ob sein Lächeln ihm gegolten hätte, ja, in plumper Vertraulichkeit zwinkerte der ihm sogar zu. Micha schaute schnell in eine andere Richtung. Aber etwas an diesem Kerl ließ seinen Blick wie an einem Gummiband wieder zurückschnellen. Als sich ihre Blicke erneut trafen, grinste sein Gegenüber immer noch. In seinem rechten Schneidezahn blitzte irgendetwas. Mit eisiger Miene starrte Micha zurück.
Da der Gesichtsausdruck des Fremden unverändert blieb, beschloss Micha schließlich, ihn zu ignorieren. Er war einfach zu schlapp, um sich auf solche albernen Spielchen einzulassen. Vielleicht ein Schwuler, der auf ihn abfuhr. Wäre nicht das erste Mal, irgendwie standen die auf ihn. Manchmal war das ja ganz witzig, aber nicht jetzt, stöhnte er innerlich, bitte, nicht jetzt.
Er stand auf, holte sich von einem Ständer eine Tageszeitung und vertiefte sich ostentativ in die Sportseite.
Keine drei Minuten später hörte er eine Stimme hinter der Zeitung: »Tag, Micha!«
Noch bevor er die Zeitung sinken ließ, wusste er, wem die Stimme gehörte. Zwar zeigte der Hagere nicht mehr dieses impertinente Grinsen, aber da Micha sich nun wirklich gestört fühlte, machte das kaum noch einen Unterschied.
»Woher kennst du meinen Namen?«
»Du kennst meinen auch!«, sagte der Hagere nur, und sein Grinsen wurde wieder breiter. Als seine Lippen sich öffneten, kam eine Reihe schiefer Zähne zum Vorschein. Seine Gesichtszüge wurden plötzlich weicher, runder, kindlicher, und dann wusste Micha, wen er vor sich hatte. Ihm klappte der Unterkiefer herunter.
»Tobias! Das gibt’s doch nicht!«
»Na bitte. Ich hab dich sofort erkannt.«
»Ja, tut mir leid. Es ist schon so lange … Also … das ist ja ein Ding«, stammelte Micha. »Tobias Haubold. Nein, also wirklich.« Damit war sein Pulver vorerst verschossen. »Tja …«
Was sagte man nur in einem solchen Fall? Er hatte sich immer schwergetan, wenn er unvermittelt solchen Figuren aus seiner Vergangenheit gegenüberstand. Und diese hier stammte geradezu aus grauer Vorzeit. Wie lange hatten sie sich nicht gesehen? Es mussten so um die fünfzehn Jahre sein. Damals waren sie noch Kinder gewesen, echte Rotzbengel, die nichts als Blödsinn im Kopf hatten. Aber in diesem Fall gab es wohl kein Entkommen mehr.
»Setz dich doch!«, sagte er.
Tobias ließ sich auf dem freien Stuhl neben ihm nieder. »Weißt du, irgendwie wundert es mich gar nicht, dass ich dich heute hier treffe«, sagte er. »Komischerweise habe ich gerade in den letzten Tagen öfter an dich denken müssen, an die alten Zeiten.«
»Ah ja.« Micha war noch immer nicht besonders glücklich über den unerwarteten Verlauf dieses Nachmittags und wehrte sich nun auch gegen ein aufkeimendes schlechtes Gewissen. Er hatte so gut wie nie an Tobias gedacht.
»Ja, mir fielen die Abenteuer ein, die wir uns gemeinsam ausgemalt haben. War wirklich eine schöne Zeit damals.«
»Hmm …«, nuschelte Micha mit einer Verlegenheitszigarette zwischen den Lippen. Er fand Tobias aufdringlich.
Sie winkten nach der Bedienung. Micha bestellte einen dritten Kaffee, Tobias ein Bier. Er fragte Micha nach einer ganzen Reihe von Leuten aus, deren Namen ihm kaum noch etwas sagten.
»Aber an Schmidt kannst du dich doch noch erinnern?«, fragte Tobias.
Jedes Mal, wenn er den Mund aufmachte, irritierte Micha dieser mal schwarze, mal glitzernde Fleck auf seinem Schneidezahn. Tobias hatte schon immer schlechte Zähne gehabt.
»Welchen Schmidt?«
»Na, den fetten Erdkundelehrer.«
Trotz der bohrenden Kopfschmerzen schien dieser Name irgendetwas in ihm auszulösen. Widerwillig setzte sich sein Gehirn in Bewegung und brachte schließlich unter Mühen ein verschwommenes Bild zustande. »Ach so, den. Klar erinnere ich mich.«
Gefühle von Demütigung und Scham stellten sich ein. Neue Bilder kamen, grinsende Klassenkameraden, gackernde Mädchen, Turnhallengeruch, ein riesiger Bauch, ein krebsrotes Gesicht.
Schmidt! Fett war gar kein Ausdruck. Der Mann war eine einzige kugelrunde feste Fleischmasse gewesen. Jede normale Bewegung schien ihm solche Anstrengungen zu verursachen, dass er kaum noch in der Lage war zu sprechen, geschweige denn, sich fortzubewegen, so hatte er herumgeschnauft. Aber dieser Schmidt war nicht nur ihr Erdkunde-, sondern vor allem ihr Sportlehrer gewesen. In dieser Funktion hatte er es zu einem der meistgehassten Menschen in Michas Leben gebracht.
Kaum zu glauben! Er fasste sich an die Stirn. Daran hatte er schon eine Ewigkeit nicht mehr gedacht. »Die Seile«, flüsterte er vor sich hin und schüttelte ungläubig den Kopf. Typisch, dass Tobias Schmidt als Erdkunde- und nicht als Sportlehrer in Erinnerung hatte. Ihm hatte das alles nichts ausgemacht.
»Ja, und Sebastian, die alte Heulsuse«, sagte Tobias und kicherte.
Micha schreckte auf, überrascht, dass Tobias ihn verstanden hatte. Er sagte nichts, trank nur einen Schluck Kaffee und überließ sich wieder seinen Erinnerungen.
Sebastian Hollert war ein kleiner schwabbliger Fettsack, der zudem dadurch auffiel, dass er während der Schulpausen unvermittelt in hysterische Weinkrämpfe ausbrach und wild um sich schlagend alles und jeden wüst beschimpfte. Sebastian, Micha und Tobias bildeten das Schlappschwanztrio, dem es in den Sportstunden trotz verzweifelter Versuche nicht gelingen wollte, sich diese vermaledeite Hallendecke aus der Nähe anzusehen. Schmidt, der fette Sadist, stellte ihr Unvermögen an Seilen und Stangen immer wieder von neuem zur Schau. Tobias ließ diese Demütigungen damals mit erstaunlicher Gelassenheit über sich ergehen.
Das Gespräch schleppte sich zäh und mühsam dahin, und irgendwann gab Micha seinen Widerstand auf. Vielleicht spürte Tobias, dass Michas Bereitschaft, in Kindheitserlebnissen zu schwelgen, nicht sehr groß war, und er unterließ weitere Anspielungen auf ihre gemeinsame Vergangenheit.
Was dann folgte, war der unvermeidliche Austausch ihrer Kurzlebensläufe. Tobias war hocherfreut zu hören, dass Micha Biologie studierte und sich mit Begeisterung der Entomologie, insbesondere der Käferkunde, widmete. Er selbst erzählte, dass er nach einer Lehre als Steinmetz auf der Abendschule das Abitur nachgemacht und dann in derselben Firma wie sein Vater gearbeitet hatte. Nach dem plötzlichen Tod seiner Eltern sei er vor einem guten halben Jahr nach Berlin gekommen, um Geologie zu studieren. Sie hatten sich beide den Naturwissenschaften zugewandt und stellten mit einem Lächeln übereinstimmend fest, dass sie damit gut auf Kurs geblieben waren. Ein Forscherdasein war ihnen schon damals als das Größte erschienen.
Nun war eine so angeregte Unterhaltung im Gange, dass Micha seine Kopfschmerzen bald vergessen hatte. In den kurzen Gesprächspausen, die nichts Peinliches mehr hatten, betrachteten sie sich gegenseitig, suchten nach vertrauten Zügen in ihren Gesichtern, und Michas mürrische Zurückhaltung war regem Interesse und einem eigentümlich vertrauten Gefühl gewichen.
»Ich habe jetzt endlich eine Wohnung in Kreuzberg gefunden. Du musst mich unbedingt mal besuchen kommen«, sagte Tobias voller Begeisterung, und die Erregung brachte Farbe in sein kantiges Gesicht. Micha musste unwillkürlich grinsen, so sehr glich Tobias jetzt dem Bild, das in irgendeinem bisher verschlossenen Hinterstübchen seines Gehirns die Jahre überdauert hatte.
»Ich bin nur noch eine Woche in Berlin«, sagte Micha. »Dann fahre ich in den Urlaub.«
»Na, dann treffen wir uns eben, wenn du wieder zurück bist. Wo soll’s denn hingehen?«, fragte Tobias.
»Ägäis, ’n paar griechische Inseln abklappern.«
»Oh, toll, Kreta und so, ja? Na, ich muss erst mal renovieren, aber in drei, vier Wochen will ich auch wegfahren. Bin ein bisschen knapp bei Kasse, weißt du.«
»Und wo willst du hin?«
Wieder eroberte dieses charakteristische Grinsen das schmale Gesicht seines alten Schulfreundes. Ein Backpfeifengesicht, dachte Micha. In dieser Beziehung hatte Tobias sich wenig verändert. Er war nur noch kantiger geworden. Außerdem war da jetzt dieses seltsame Ding in seinem schiefen Schneidezahn. Schon damals sprossen seine Zähne unbändig in alle Richtungen. Braune Haare hingen ihm ungekämmt und fettig um den Kopf. Seine Lippen waren meist trocken und aufgesprungen gewesen, und da er andauernd an den trockenen Hautstückchen herumknabberte, oft auch blutig und verschorft, nicht gerade ein hübsches Kind. Heute könnte er ohne weiteres als Bösewicht in einem James-Bond-Streifen durchgehen.
»Ich wollte mich mal ein bisschen in der Slowakei umsehen«, antwortete Tobias nach kurzem Zögern, so als ob daran irgendetwas Geheimnisvolles wäre.
»Ungewöhnlich!«
»Ja, ich weiß. Aber preiswert und nicht so weit weg. Die Hohe Tatra soll sehr schön sein.«
»Klar, warum nicht?«
Ein Blick auf die Uhr zeigte Micha, dass es schon ziemlich spät geworden war. Er rief nach der Bedienung, um zu zahlen.
Er schrieb seine Adresse und Telefonnummer auf einen Bierdeckel und verabschiedete sich. »War nett, dich zu treffen, wirklich. Ich bin wahrscheinlich Anfang September wieder zurück. Du kannst dich ja dann mal melden.«
Tobias stand auf, um ihm die Hand zu geben. Er hatte, was seine Körpergröße anging, erheblich an Boden gutgemacht.
Früher war er ein Hänfling gewesen. Wenn er sich auf die Zehenspitzen stellte, reichte er Micha gerade bis an die Schultern, eine halbe Portion, ein Spargeltarzan mit dünnen Ärmchen und dürren knochigen Beinen, aus denen die Kniegelenke hervorstachen wie Geschwüre. Er wirkte als Kind zerbrechlich und kränklich. Sein hohlwangiges Gesicht hatte ausgesehen, als bekäme er nie genug zu essen. Vielleicht war dieser Eindruck gar nicht so falsch, denn Micha hatte mit eigenen Augen gesehen, wie dieses spacke Bürschchen im Schullandheim jeden Morgen sage und schreibe neun belegte Brote verdrückt hatte, ohne jemals den Eindruck zu vermitteln, jetzt sei es genug. »Schlechter Futterverwerter«, meinte Michas Mutter, als er ihr davon erzählte.
Er winkte Tobias aus ein paar Meter Entfernung noch einmal zu und marschierte dann in Richtung U-Bahn.
Hackebeil
»Dr. Axt, ich hab da was gefunden, das sollten Sie sich vielleicht mal anschauen.«
Montagmorgen war Max zunächst hinunter in die Grube gegangen, hatte die Fundstelle erneut freigelegt und noch etwas Schiefer um die kleine Knochenreihe entfernt. Dabei hatte er noch eine weitere Reihe kleiner Knochen gefunden, fast parallel zu der ersten. Anschließend war er ohne besondere Eile nach oben gelaufen, um Hackebeil zu benachrichtigen.
»Tut mir leid, ich kann jetzt nicht, Max. Bin gerade beim Röntgen«, sagte Axt, ein eher kleiner, aber kräftig gebauter Mann mit kurzgeschorenen Haaren und einem schräg nach vorne ragenden Unterkiefer, der Max heute aus irgendeinem Grunde provozierte.
»In einer halben Stunde komme ich runter, okay? Machen Sie nur weiter.«
»Hm.«
»Was ist es denn?«, rief Axt aus dem kleinen Nebenraum, in dem er gerade verschwunden war.
»Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Das müssen Sie schon selbst beurteilen«, antwortete Max so übellaunig, dass Axt überrascht um den Türpfosten blickte. »Na gut, ich beeile mich. In einer halben Stunde, ja?«
Max zuckte mit den Achseln und machte sich wieder auf den Weg. War ihm doch egal, ob Hackebeil jetzt, in einer halben Stunde oder überhaupt nicht kam.
Axt schaltete den Schirm an und betrachtete das, was in der unter dem Röntgengerät im Nachbarraum liegenden Schieferplatte verborgen war. Eine Schildkröte, schlecht erhalten und an mehreren Stellen auseinandergebrochen. Er hatte sich schon so etwas gedacht. Wenn man hier so viele Jahre gearbeitet hatte wie er, bekam man ein Gefühl dafür, ob ein Fund etwas hergab oder nicht. Der hier war es jedenfalls vorerst nicht wert, genauer untersucht zu werden. Vielleicht würden sie später für irgendwelche spezielleren Fragestellungen darauf zurückkommen, aber was das Skelett anging, bot dieser Fund nicht viel. Da hatten sie wesentlich Besseres auf Lager. Sie fanden so viele Fossilien, und die Präparation der Funde war so kompliziert und zeitaufwendig, dass sie es sich nicht leisten konnten, jedes Fossil freizulegen. Das hier kam jedenfalls ganz unten auf ihre Prioritätenliste und würde im Magazin enden, zusammen mit Hunderten von weiteren Stücken, die zu unbedeutend waren, um es bis zum Museumsschaustück zu bringen.
Das Sensationelle an der Grube Messel war zugleich eines ihrer größten Probleme: Es gab einfach zu viele Fossilien. Ein Kollege hatte kürzlich ernsthaft für einen Grabungsstopp plädiert, weil jetzt schon absehbar war, dass ihre Lagerkapazitäten bald erschöpft sein würden, wenn es so weiterging. Und dass es so weiterging, bezweifelte hier niemand. In Messel war wesentlich mehr zu holen als nur ein paar klägliche Pflanzenreste, hier ging es nicht nur um die Bergung einzelner versprengter Knochentrümmer wie andernorts. Ein ganzer See mit allem, was darin und an dessen Ufern gelebt hatte, war hier im Boden verborgen, Arbeit für Generationen von Wissenschaftlern. Im Laufe der Jahre hatten sie über dreißig Säugetierarten gefunden, dazu etliche Vögel, Fische, Reptilien und Amphibien, Insekten und viele Pflanzen. Oft waren sogar Haare, Federn und Weichteile wie Flughäute und Ohrmuscheln als dunkle Umrisse im Schiefer zu erkennen, so dass man eine recht genaue Vorstellung von dem Aussehen der Tiere gewinnen konnte. Mitunter ließ sich aus dem hervorragend erhaltenen Mageninhalt der Fundstücke ablesen, wer was oder wen gefressen hatte. Auch die zahlreichen Koprolithen lieferten dazu wertvolle Hinweise.
Mit Hilfe dieser vielfältigen Informationen versuchten sie dann, sich ein Bild von dem Leben an einem prähistorischen Gewässer zu machen, die komplexe Ökologie eines versunkenen tropischen Sees zu rekonstruieren, der einmal mitten in Europa gelegen hatte. Eine einmalige und faszinierende Aufgabe für einen Paläontologen, ein Privileg, wie es nur wenigen seiner Berufskollegen vergönnt war, darüber war Axt sich im Klaren. Ausgesprochen langweilige oder gar unappetitliche Forschungsrichtungen gab es in seinem Fachgebiet zuhauf, und er überließ sie gerne anderen, etwa den bedauernswerten Kollegen, die sich mit der relativ jungen Wissenschaft der Aktuo-Paläontologie beschäftigten. Schon diese Bezeichnung drehte einem den Magen um, die Arbeit, die dahintersteckte, erst recht.
Aktuo-Paläontologen untersuchten den Verlauf und die Beeinflussbarkeit von Verwesungsvorgängen. Mit anderen Worten: Sie töteten Tiere, ließen die Leichen verrotten und protokollierten minutiös den Zerfallsverlauf, beobachteten, wie sich der Leib ihrer Studienobjekte durch Fäulnisgase aufblähte, platzte und dadurch in charakteristischer Weise die Lagebeziehungen der Becken- und Wirbelknochen verändert wurden. Sie konnten sagen, welche typischen Kennzeichen ein Skelett besaß, das vor seiner Konservierung noch tage- oder wochenlang als Wasserleiche auf der Oberfläche eines Sees herumgetrieben war. Das mochten sehr wertvolle Informationen sein, die gerade ihnen hier in Messel zugutekamen, aber – bei allem Respekt vor der Leistung seiner Kollegen – Axt war doch froh, dass er mit dieser Art von Erkenntnisgewinnung nichts zu tun hatte. Der Fossilienkunde mochte insgesamt ein gewisser Hang zur Nekrophilie anhaften, aber das ging ihm doch zu weit.
Hier in Messel hatten sie mit ganz anderen, viel handfesteren Problemen zu kämpfen, etwa dem hohen Wassergehalt der Fossilien, der die Präparation und Konservierung der Funde ungemein erschwerte. Grabungsräuber konnten große Schäden anrichten. Einige der schönsten Messeler Fundstücke befanden sich in Privathand, ein Skandal.
Axt schaltete das Röntgengerät aus und ging in einen anderen Raum, um seine Gummistiefel anzuziehen. Er winkte Kaiser und Lelunke zu, den beiden Präparatoren, die über Fundstücke gebeugt an ihren Arbeitstischen saßen. Man hörte das Summen der Sandstrahlgebläse, mit denen sie das Kunstharz von den umgebetteten Präparaten entfernten, das Pusten der Sprühflaschen, mit denen die empfindlichen Fossilien feucht gehalten wurden.
»Ich geh mal runter in die Grube«, sagte Axt. »Max hat was gefunden.«
Trotz der Hitze draußen tat es gut, ein paar Schritte zu Fuß zu gehen. Von dem vielen Sitzen bekam er neuerdings regelmäßig Kreuzschmerzen. Obwohl er das eigentlich nie für möglich gehalten hatte, kam er langsam in das Alter, wo man sich mit solchen Problemen herumzuschlagen hatte. Marlis begann ihn schon aufzuziehen wegen seiner zahlreichen Wehwehchen.
Er trat durch die Eingangstür ins Freie und schlug den etwa dreißigminütigen Weg zu den Ausgrabungsstellen ein. Als er an dem hohen Maschendrahtzaun ankam und durch das Tor das eigentliche Grubengelände betrat, fiel sein Blick unwillkürlich auf die andere Seite, dorthin, wo sie den nordöstlichen Zufluss des ehemaligen Sees vermuteten. Das Gewässer hatte damals zwei Zuflüsse gehabt, darüber bestand nach den neuesten Ergebnissen kein Zweifel mehr. Die Funde bestimmter lachsähnlicher Fische und der feinen Gehäuse von Köcherfliegenlarven, deren heutige Verwandte auf schnellfließende Gewässer beschränkt waren, häuften sich in der Nähe dieser Zuflüsse. Die letzten Zweifel hatte sein Kollege Lutz vor kurzem zerstreut, als er eine wunderbare Arbeit über die dort gefundenen fossilen Larven des Käfers Eubrianax veröffentlichte. Die heute in Afrika lebenden Verwandten dieses Käfers waren hochspezialisierte Bewohner der Geröllbereiche von Stromschnellen und felsigen Brandungszonen. Stehende Gewässer mieden sie. Der perfekte Erhaltungszustand der fossilen Käferlarven deutete darauf hin, dass ihr damaliger Lebensraum in unmittelbarer Nähe des Sees gelegen haben musste. Das Ganze war ein Musterbeispiel für eine mit beinahe kriminalistischer Akribie ermittelte Indizienkette. Außerdem zeigte es, wie wichtig gerade die kleinen, unscheinbaren Fundstücke sein konnten, wenn man sie nur im richtigen Zusammenhang betrachtete und die richtigen Fragen stellte.
Zumindest zeitweise war der Messel-See Teil eines großen, zusammenhängenden Gewässersystems. Dafür sprachen auch die Verteilungsmuster unterschiedlicher Kleinfossilien, die als Ergebnis einer über größere Strecken hinweg wirksamen Frachtsonderung im Schiefer lagen, als hätte sie dort jemand fein säuberlich nach Größe und Gewicht sortiert. Auch die charakteristischen Rundungen kleiner Holzstückchen, die sich eindeutig auf Abrollungserscheinungen zurückführen ließen, sprachen für relativ weite Transportwege. Und wie der Fund eines Aals bewies, hatte dieses System sogar Verbindung zum Meer. Aale wurden im Meer geboren und kehrten zu Fortpflanzung und Tod aus den Flüssen und Seen des Festlandes wieder dorthin zurück. Das war im Tertiär nicht anders als heute.
Fossilien waren weit mehr als nur tote Knochen. Schon als Kind hatte er davon geträumt, in abgelegenen Gegenden der Welt nach Zeugnissen vergangener Erdzeitalter zu suchen, vorzugsweise natürlich nach Dinosauriern oder Frühmenschen. Das waren nun mal die Fossilien schlechthin. Jetzt, als Erwachsener, grub er zwar nicht in der Wüste Gobi oder im afrikanischen Rift-Valley, und er fand auch keine Saurierknochen oder Australopithecus-Schädel, aber die Grube Messel, von deren Existenz er als Kind gar nichts gewusst hatte, bot in gewisser Hinsicht viel mehr als diese exotischen Schauplätze seiner Jungenträume.
Fossilien waren der Schlüssel, das Tor zu einer versunkenen Welt. Man musste sich nur lange und intensiv genug mit ihnen beschäftigen, dann stand dieses Tor irgendwann sperrangelweit offen. Er wusste mittlerweile so viel über diese versunkene Messeler Welt, dass sie für ihn in seltenen, kostbaren Momenten fast real wurde.
Manchmal, wenn er wie jetzt hinunter zur Grube lief und auf den alten Seezufluss blickte, war ihm, als hörte er das Rauschen des Wassers in den Stromschnellen, als sähe er eine grüne Dschungelwand emporragen, aus der seltsame Rufe zu ihm drangen. Er sah die Seerosen und die Palmen, und er roch die aus den Tiefen des Sees aufsteigenden Faulgase. Ohne den See je erblickt zu haben, glaubte er doch genau zu wissen, wie er vor Millionen Jahren ausgesehen hatte, lange bevor an Menschen überhaupt zu denken war. Seine Visionen, oder wie immer man es nennen sollte, waren völlig unberechenbar und geradezu unheimlich. Er konnte ihr Erscheinen in keiner Weise erzwingen, obwohl er das gelegentlich gerne getan hätte. Sie kamen, wenn er am wenigsten damit rechnete, und verschwanden, sobald er versuchte, sie festzuhalten. Möglicherweise ging es seinen Kollegen, die sich ebenso intensiv damit beschäftigten, ähnlich, aber er hatte sich nie getraut, jemanden darauf anzusprechen. Irgendwie war ihm das peinlich. Diese seltenen Momente waren sein Geheimnis und wahrscheinlich – das würde ihn im Grunde nicht wundern – schlicht und einfach ein fachgebietstypisches Zeichen von Überarbeitung.
Als er diesmal zur Grube hinunterlief, geschah jedoch nichts dergleichen. Stattdessen sah er schon von weitem Max und Rudi als kleine Farbtupfer unten im schwarzen Schiefer stehen. Max hatte einen guten Riecher für seltene Fundstücke, und wenn er ihn hinunterrief, musste es sich um etwas Ungewöhnliches handeln. Wie er mit den üblichen Fundstücken umzugehen hatte, wusste Max selbst. Allerdings hatte er heute Morgen muffelig gewirkt und war vielleicht zu seltsamen Scherzen aufgelegt.
Axt war ziemlich humorlos, was Wissenschaft anging. Wissenschaft war eine todernste Angelegenheit, besonders seine. Ein einziges Fundstück konnte Theoriegebäude zum Einsturz bringen, die weit über die Zoologie hinausgingen. Da hörte der Spaß auf. Der 1974 gefundene Ameisenbär zum Beispiel hatte eine solche Erschütterung ausgelöst. Es hätte ihn hier eigentlich gar nicht geben dürfen. Es war der erste und einzige fossile Ameisenbär außerhalb Südamerikas. Derartige Funde stellten viele der Vorstellungen in Frage, die sich man bisher über die Wanderungen urzeitlicher Lebensformen gemacht hatte, und möglicherweise ließen sich daraus sogar ganz neue Ideen über die Lage der Urkontinente und ihre Verbindungen untereinander ableiten.
Als er dann neben Max und Rudi vor den kleinen Knochen stand, durchzuckte ihn zunächst ein ganz und gar lächerlicher Gedanke: Sieht aus wie Finger, dachte er, menschliche Fingerknochen, aber das war völlig abwegig. Nein, Fingerknochen konnten das nicht sein, aber er wusste sofort, dass es sich um einen ganz außergewöhnlichen Fund handeln musste.
»Gut, dass Sie mich gerufen haben, Max«, sagte er, nur mühsam seine Erregung kontrollierend. »Das ist was Besonderes.«
»Wusst ich’s doch.« Max zeigte ein stolzes Lächeln und boxte Rudi in die Seite.
Durch vorsichtiges Anheben der schweren oberen Schieferplatte versuchten sie gemeinsam herauszufinden, wie groß das Skelett war.
»Das gibt es doch gar nicht!«, rief Axt verblüfft aus. Der Fund schien fast zwei Meter lang zu sein. Man erkannte es unter anderem an der leichten Aufwölbung des Schiefers. Wenn das stimmte, dann war dies eines der größten Skelette, die hier unter seiner Leitung jemals gefunden worden waren. Axts Puls begann zu rasen. Vielleicht standen sie vor einer Sensation, dem Höhepunkt seiner bisherigen Arbeit. Man musste in Messel auf die größten Überraschungen gefasst sein. Niemand konnte wissen, was in dieser großen schwarzen Gesteinsmasse alles verborgen lag. Möglicherweise warteten dort nicht nur sanfte Erschütterungen, sondern kapitale Erdbeben auf die Welt der Wissenschaft, und er, Helmut Axt, wäre dann gewissermaßen das Epizentrum.
Wahrscheinlich ein Krokodil, dachte er und versuchte, durch viele leidvolle Erfahrungen gewarnt, seine allzu ungezügelt aufkommende Euphorie zu bremsen.
Aber auch für ein Krokodil wäre das ein ziemlich kapitaler Bursche. Krokodile waren die größten Tiere, die damals hier gelebt hatten, eine uralte Tiergruppe, Vettern und Zeitgenossen der Dinosaurier, und obwohl sie diese um Jahrmillionen überlebt hatten, in der Öffentlichkeit bei weitem nicht so hoch angesehen. Etwas anderes kam eigentlich kaum in Frage. Genaueres würde er allerdings erst wissen, wenn er das Fundstück unter dem Röntgengerät hatte.
Es konnten auch mehrere Skelette sein, die dicht beieinanderlagen. Oder ein Raubtier, das gerade sein Opfer verschluckte. Er selbst hatte einen Raubfisch gefunden, der an einem viel zu großen Beutetier jämmerlich krepiert war. Für die quasi im Maul verklemmte Beute hatte es kein Vor und Zurück mehr gegeben, und der Räuber war entweder verhungert oder erstickt.
Mit knackenden Knien richtete Axt sich wieder auf und sagte: »Wir müssen die Platte heraustrennen und vorsichtig nach oben schaffen.«
»Klar, Chef.«
»Aber passt auf, dass nichts kaputtgeht.«
»Logisch«, sagte Max und verdrehte die Augen.
Axt schickte Rudi in die Station, um schwereres Werkzeug und Unterstützung zu holen. Der anfallende Abraum musste ebenfalls sorgfältig untersucht werden. Um ja nichts zu zerstören, trennten sie in stundenlanger Arbeit mit Spaten, Stemmeisen und Motorsäge einen großen Quader heraus, etwa siebzig Zentimeter breit, zwanzig Zentimeter dick und gut zwei Meter lang. Der schwarze Gesteinsblock ruhte auf einem Schiefersockel. Mit klopfendem Herzen stand Axt schließlich am späten Nachmittag vor dem Ergebnis ihrer Arbeit, das aussah wie ein archaisches Monument. Es war atemberaubend.
Ihr größtes Problem bestand darin, die schwere Schieferplatte mit dem unschätzbar wertvollen Inhalt unversehrt nach oben in die Station zu transportieren. Für derartige Dimensionen waren sie nicht ausgerüstet. Die meisten ihrer Funde ließen sich bequem in Plastiktüten nach oben tragen. Sie mussten sich etwas einfallen lassen. Ohne einen Kran oder etwas Entsprechendes kamen sie nicht weiter. Außerdem war es spät geworden. Schweren Herzens brach Axt die Bergung ab und schickte seine Mitarbeiter nach Hause.
Ratlos umkreisten sie am nächsten Tag den aufgebahrten Quader wie eine Horde tanzender Wilder, die um Regen bitten.
Plötzlich hatte Max eine Idee. Er erinnerte sich an ein Türblatt, das schon ewig im Keller der Station stand. Wenn sie es unter den Quader schieben könnten, bestände keine Gefahr, dass der Fund beim Transport auseinanderbrach. Aber wie?
Sabine Schäfer, die Fledermausexpertin, schlug schließlich vor, bei den Leuten von der Müllkippe nachzufragen, ob sie nicht einen kleinen Kran hätten, den sie für die Bergung zur Verfügung stellen könnten.
Axt verzog widerwillig das Gesicht. Er konnte diese Typen nicht ausstehen. Menschen, die die Grube Messel mit Müll vollkippen wollten, zeigten in seinen Augen ein derart erschreckendes Ausmaß an Ignoranz, dass es ihm regelrecht die Sprache verschlug. Man stelle sich vor, die ägyptische Regierung käme auf die Idee, das Grab der Könige zu einer Deponie für Sondermüll auszubauen oder in der Cheopspyramide einen Atombunker einzurichten. Er sah sich jedenfalls außerstande, diese Leute um irgendetwas zu bitten.
Sabine erklärte sich bereit, selbst hinüberzugehen und zu fragen. Vielleicht konnte sie mit weiblichem Charme etwas ausrichten. Als sie eine Stunde später zurückkam, hatte sie überall rote Flecken im Gesicht, und ihre Nase schien noch spitzer geworden zu sein.
»Na?«, fragte Axt. »Wie ist es gelaufen?«
»Beschissen«, fauchte sie. Ihre Augen funkelten wie zwei Warnlampen. »Aber wir kriegen unseren Kran.«
»Oh, damit habe ich wirklich nicht gerechnet.«
»Es war auch ein hartes Stück Arbeit«, sagte sie und warf einen giftigen Blick zu den Gebäuden der Mülldeponie hinüber. »Ich glaube, die hätten es am liebsten gesehen, wenn ich ihre Stiefel geleckt hätte und vor ihnen auf Knien auf dem Boden herumgerutscht wäre. Widerliche Typen. Scheißfreundlich, aber dieses arrogante Grinsen war einfach unerträglich.« Sie schüttelte sich.
Axt schaute sie mitfühlend an. »Mach dir nichts draus! Du hast doch erreicht, was du wolltest.«
»Ja, aber erst am Freitag. Sie sagen, dass sie den Kran die ganze Woche über selbst brauchen. Dabei steht das Ding dahinten nur rum.«
»Hm, vielleicht ist er kaputt.«
»Quatsch! Die wollen uns nur zappeln lassen.«
Nach kurzer Diskussion entschieden sie, den Schieferquader mit einem primitiven Zelt aus Plastikplanen vor Witterungseinflüssen zu schützen. In dem Zelt konnten sie das Fossil schon für den Transport vorbereiten. Um den Schieferblock wurde ein Holzrahmen gebaut und dieser anschließend mit Polyurethan ausgeschäumt.
Am Freitagmorgen warteten sie zunächst vergeblich auf den versprochenen Kran. Sie bauten das Zelt wieder ab, und Max war nach oben gelaufen, um das Türblatt aus dem Keller zu holen. Es lehnte jetzt gegen den wieder freigelegten Schieferblock, und die ganze Gruppe stand eine Weile wie Falschgeld herum und starrte unschlüssig zur Deponie hinüber.
Axt kochte vor Wut. Genau das hatte er befürchtet. Es war unfassbar, welchen Demütigungen sie ausgesetzt waren. Nicht genug, dass es ihnen an allen Ecken und Enden an Geld fehlte und sie mitunter gezwungen waren, wegen lächerlicher Etatposten einen entwürdigenden Eiertanz aufzuführen, jetzt waren sie auch noch auf die Hilfe der Leute angewiesen, die eine der berühmtesten Fossilienlagerstätten der Welt unter Tonnen von Joghurtbechern und Bananenschalen verschwinden lassen wollten. Da tröstete es ihn wenig, dass es auch anderen Fundstätten nicht viel besser ergangen war. Die französischen Kollegen aus Montceau-les-Mines konkurrierten zum Beispiel jahrelang mit einem Tagebauunternehmen. Unter der Woche schabten die Bagger meterdicke Kohleschichten von den Hängen, und an den Wochenenden schwärmten dann die Paläontologen aus, um noch zu retten, was zu retten war. Als sich der Kohleabbau nicht mehr lohnte, wurde die ganze Grube einfach zugeschüttet, ein mehr als klarer Hinweis, wie viel den Menschen die Erforschung der Vergangenheit wert war. Den Schweizern vom Monte San Giorgio oberhalb des Luganer Sees erging es noch schlimmer. Der dortige Tonschiefer wurde kurzerhand zermahlen und als Rheumaheilmittel verkauft. Weil sich in dem Schiefer so viele Dinosaurierknochen fanden, wurde das Präparat Saurol genannt. Ein schwacher Trost. Dort hatte man zum Beispiel die Giraffenhalsechse Tanystropheus gefunden mit ihren grotesk verlängerten Halswirbelknochen.
Irgendwann stöhnte Sabine auf und sagte: »Ich geh noch mal rüber.« Man sah, dass es ihr schwerfiel, aber sie hatte Erfolg. Eine halbe Stunde später war der Kran endlich an Ort und Stelle. Man hatte sie schlicht vergessen.
Im Führerhaus saß ein mürrischer, zigarettenrauchender Kerl, der sich Mühe gab, so uninteressiert und gelangweilt wie nur möglich zu wirken. Er drängelte ununterbrochen, schaute alle fünf Minuten auf die Uhr und quittierte ihr übervorsichtiges Treiben mit spöttischem Grinsen oder genervtem Stöhnen. Sie versuchten; nicht darauf zu achten.
Es gelang ihnen, den Quader mit Hilfe des Krans leicht anzuheben. Dann schoben sie vorsichtig, Zentimeter für Zentimeter, die Holzplatte unter den Gesteinsblock.
Das Türblatt samt Schieferplatte schwebte hoch in der Luft. Es schaukelte bedenklich. Axt konnte nicht hinsehen, so aufgeregt war er. Wenn sie nun herunterfiel oder irgendwie aus dem Gleichgewicht kam und von der glatten Holzplatte rutschte? War dieser kleine Kran für solche Gewichte überhaupt ausgelegt? Er sah sich schon am Boden herumkriechen und die Bruchstücke einsammeln.
Aber alles lief reibungslos, und wenige Minuten später befand sich die schwere Last auf dem knarrenden Anhänger des Stationstreckers. Gut eingepackt in feuchtes Zeitungspapier und von je einem Mann an den Ecken bewacht, machte sich der Schieferblock hinter dem von Max gesteuerten Trecker auf den gefahrvollen, weil unebenen Weg in die Station. Dort wurde unterdessen in fieberhafter Eile Platz geschaffen. Kurz nach fünf Uhr am Nachmittag wuchtete der Kran den Schieferquader vor der Station auf einen Rolltisch, der unter der ungewohnten Last bedenklich ächzte und anschließend durch die große Flügeltür in den ebenerdig gelegenen Präparationsraum geschafft wurde.
Es herrschte eine fühlbare knisternde Spannung im Haus. Die Luft war wie elektrisiert. Keiner wollte sich auf den Heimweg machen, bevor nicht klar war, was sie da gefunden hatten. Ernüchterung trat ein, als sie den Tisch in den Röntgenraum fahren wollten, denn er passte weder durch die Tür noch unter das Röntgengerät, das nur für Objekte von maximal zwei Metern Länge ausgelegt war. In der ganzen Aufregung hatte niemand daran gedacht. Axt überlegte einen Moment, dann erklärte er die Aktion erst einmal für beendet und verschob alles weitere auf Montag. Aufgeregt diskutierend verabschiedeten sich alle vor der Eingangstür der Station. So etwas erlebte man auch in der Grube Messel nicht alle Tage.
Gorgo
Michas überraschendes Zusammentreffen mit Tobias hatte ihn in eine seltsame Stimmung versetzt. Plötzlich drängten längst vergessen geglaubte Erinnerungen an die Oberfläche, tauchten Gesichter und Namen auf. Unangekündigt und in den seltsamsten Momenten waren sie da und begannen ein Eigenleben zu führen.
Er kramte aus irgendwelchen Schuhkartons uralte Klassenfotos heraus, die er sich schon eine Ewigkeit nicht mehr angesehen hatte. Hinten in der letzten Reihe erkannte er Ulrike mit ihren Zöpfen, sein großer Schwarm.
Viele der Erinnerungen, die ihn beschäftigten, hatten natürlich mit Tobias zu tun. Sein Freund war innerhalb der Klasse anfangs einigem Gespött und Gehänsel ausgesetzt gewesen, zumal er mit Nachnamen auch noch Haubold hieß, was von einigen der Jungs offenbar als Aufforderung missverstanden wurde. Es dauerte aber nicht lange, bis er sich auch bei viel größeren und kräftigeren Klassenkameraden Respekt verschafft hatte. Tobias war ein ausgesprochen unangenehmer Gegner, den man aufgrund seiner Konstitution zwangsläufig unterschätzte und gegen den eben auch die stärksten Jungen der Klasse nur schlecht aussehen konnten. Tobias war ungeheuer schnell und mutig und ging, wenn es denn sein musste, keiner Auseinandersetzung aus dem Weg.
Es war kurz vor Weihnachten gewesen, als er auf ihn aufmerksam wurde. Bei ihren Lehrern schien ein besänftigender, die Menschen milde und versöhnlich stimmender Weihnachtseffekt noch irgendwie zu funktionieren, denn in einem wahren Ausbruch von Menschenfreundlichkeit hatten sich zu dieser Zeit die Schulstunden gehäuft, in denen Filme gezeigt, irgendwelche Jugendanekdoten erzählt oder sonstige, normalerweise undenkbare Aktivitäten entfaltet wurden. Merkwürdigerweise spielten gerade die Lehrer, welche die höchste Autorität genossen, in der Weihnachtszeit verrückt.
Ihr Biologielehrer Kusch präsentierte ihnen damals ein Buch, das in einem renommierten Wissenschaftsverlag erschienen war und über die sehr eigentümliche Fauna einer erst jüngst entdeckten Südseeinsel berichtete. Als neues Paradebeispiel für das Wirken der Evolution, so wie die berühmten Darwinfinken der Galápagosinseln, wurden dort Tiere gezeigt, die sich allesamt durch ausgesprochen ungewöhnliche Ausbildungen ihrer Nasen auszeichneten. Einige dieser sogenannten Rhinogradentia hangelten sich mit Hilfe ihrer Riechorgane durch die Baumkronen, andere fingen ihre Beute, indem sie diese mit Nasen anlockten, die wie Blüten aussahen. Das Buch wirkte absolut seriös. Die neuentdeckten Tierarten wurden ausführlich beschrieben und sogar in Zeichnungen dargestellt.
Die Klasse war zwischen Zweifel und Begeisterung hin und her gerissen, und noch lange bis in die nächste Pause zogen sich erregte Diskussionen, was denn nun davon zu halten war. Ein Teil nahm alles für bare Münze, wobei der absolut seriöse Verlag das Hauptargument darstellte (»Die würden nie so’n Buch herausbringen, wenn da was nicht stimmen würde.«), während eine andere Gruppe vehement dafür plädierte, dass das Ganze ein Scherz sei (»so’n Quatsch, die woll’n uns verscheißern«).
Zu letzterer Gruppe gehörte auch Tobias. Es war selten, dass er sich so lautstark in eine Diskussion einschaltete, aber diesmal kämpfte er für seine Position und führte als das alles entscheidende Argument die Tatsache an, dass die Südseeinsel und damit die Heimat dieser Witzfiguren laut Buchtext kurz nach Abreise der Expedition als Folge eines Vulkanausbruchs untergegangen sein sollte. Das Ganze sei also gar nicht mehr nachprüfbar.
Auf dem Heimweg schlenderte Micha durch die Alleen im Charlottenburger Westend. Ihm fiel ein Junge mit einer blauen Pudelmütze auf, der etwa zwanzig Meter vor ihm dahinbummelte und gelegentlich mit Schneebällen in imponierender Treffsicherheit nach Baumstämmen warf. Als Micha ihn einholte, erkannte er Tobias. Zuerst zuckte er vor Schreck zurück, er erinnerte sich noch genau daran. Tobias war ihm noch nie auf dem Heimweg begegnet, und außerdem mochte er ihn nicht besonders, weil er auch zu den Schlappschwänzen gehörte.
»Gehst du immer hier lang?«, fragte Micha feindselig. »Hab dich hier noch nie gesehen.«
»Manchmal!« Tobias grinste von einem Ohr zum anderen und zeigte seine groteske Zahnreihe.
Er steuerte eines der Autos an, knetete sich einen neuen Schneeball, und schon waren sie in eine heftige Schlacht verwickelt. Sie litt allerdings unter starkem Nachschubmangel, da der Dreck, der noch auf der Straße lag, kaum schneeballtauglich war.
Sie tobten eine Weile herum, bis die Schneebeschaffung zu mühselig wurde.
»War lustig heute die Biostunde, ne?«, meinte Tobias plötzlich und warf die letzten Schneereste, die er noch in der Hand hielt, auf den Boden.
»Ja, ganz nett«, sagte Micha gelangweilt, aber in Wirklichkeit war er natürlich begeistert gewesen und noch immer ganz aufgeregt, wenn er an die Stunde zurückdachte.
»Zum Piepen, wie viele auf Kusch reingefallen sind. So ein Blödsinn, Rhinogradentia, Nasobeme, wo gibt’s denn so was.« Als er »Nasobeme« sagte, hielt er sich die Nase zu, so dass das Wort noch merkwürdiger klang. Micha musste lachen. Aber dass Tobias so sicher schien, ärgerte ihn irgendwie.
Sie schlenderten langsam weiter. Nach einer Weile hielt er es nicht mehr aus, blieb stehen und stemmte die Fäuste in die Hüften. »Erzähl mir bloß nicht, dass du nicht auch irgendwann mal an die Geschichte geglaubt hast.«
»Nur ganz am Anfang! Ehrlich! Aber als ich dann die erste Zeichnung gesehen habe, war ich mir sicher.«
»Ich mir auch«, fügte Micha schnell hinzu, damit ja nicht der Eindruck entstand, er sei auf diesen Kinderkram hereingefallen.
»Aber toll ist so was schon«, sagte Tobias schwärmerisch.
»Was meinst du?«
»Na, so eine Expedition auf eine unbekannte Insel.«
»Ja, das ist toll«, antwortete Micha wie aus der Pistole geschossen und grinste. So eine Expedition war wirklich das Größte.
»Kennst du die Geschichte von King Kong? Der hat auch auf so einer unbekannten Insel gelebt.«
»Klar kenn ich King Kong.« Er hatte den alten Schwarzweißstreifen vor kurzem in der Kindervorstellung ihres Eckkinos gesehen.
Als Micha jetzt daran zurückdachte, fiel ihm auf, dass der Film ihn als Kind wegen seiner phantastischen Geschichte gepackt hatte. Die Abenteuer und Entdeckungen auf der unbekannten Insel hatten ihn ungemein fasziniert. Trotz aller tricktechnischen Perfektion interessierten ihn an dem modernen Remake des Films in erster Linie die seidig schimmernden Schenkel von Jessica Lange und ihr hinreißend dümmliches Lachen.
Plötzlich bekam Micha eine Gänsehaut. Dieses kurze Gespräch war der Beginn ihrer Freundschaft gewesen, und doch hatte es schon so vieles von dem, was ihre Beziehung später ausmachen sollte. Er sah Tobias vor sich, wie er mit weit ausholenden Bewegungen seiner dünnen Ärmchen die gigantischen Dimensionen eines Kampfes von Wal und Krake andeutete, über den er gerade gelesen hatte, die Lichtblitze der Tintenfische, das weit aufgerissene Maul des Pottwals. Dieser unscheinbare, schmächtige Junge verfügte über eine Begeisterungsfähigkeit, die ihn mitreißen konnte. Er war der unerschütterlichen Überzeugung, dass er die Abenteuer und Entdeckungen, die sie sich gemeinsam ausmalten, wirklich erleben würde. Aus ihm musste einfach ein Entdecker und Wissenschaftler werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte. Es dauerte nicht lange, da durchstreiften sie zusammen die Eiswüsten der Pole und die Hölle des tropischen Regenwaldes, erforschten den Verlauf von Meereshöhlen, landeten auf fremden Planeten und entdeckten neue Lebensformen.
Bei alledem behielt Micha jedoch immer einen Rest zurückhaltender Skepsis bei, die Tobias völlig fremd war. Als hätte er Angst gehabt, sich zu sehr auf die Phantasien seines neuen Freundes einzulassen, wappnete er sich zeitweilig mit einer mürrischen Abwehrhaltung, indem er Tobias’ Vorschläge mit einem »So ’n Quatsch«, »du spinnst« oder »Das glaubste doch selbst nicht« kommentierte, um ihm im nächsten Moment wieder begeistert nachzurennen und eine hinter einer Nebelwand auftauchende Vulkaninsel zu erforschen.
Mit dem Anbrechen der wärmeren Jahreszeit begannen sie immer häufiger, Ausflüge in den Grunewald zu unternehmen oder die damals noch sehr viel abenteuerträchtigere Umgebung ihres Stadtbezirks zu erkunden. Das Entsetzen und die Freude hätten kaum größer sein können, als sie zum ersten Mal ein völlig verwildertes Trümmergrundstück durchstreiften, im Hintergrund als dramatische Kulisse eine große, zerfallene Ruine, und plötzlich auf einen Haufen weißgebleichter Knochen stießen. Die Schädel waren mit Sicherheit tierischen Ursprungs, wahrscheinlich von Pferden oder Rindern, aber die Knochen … Immer wieder spekulierten sie, ob nicht auch Menschenknochen darunter waren, ob sie die Überreste eines abscheulichen Verbrechens, Opfer eines Bombenangriffs oder doch nur Pferdeknochen vor sich hatten.
Als ihnen eine Schulstunde die Archäologie näherbrachte, beschlossen sie sofort, bei ihren Expeditionen auch solche Aspekte mit zu berücksichtigen. Sie waren ja schließlich keine Fachidioten. Als sie kurze Zeit später einmal von der Lietzenseebrücke in das flache Wasser schauten, entdeckten sie am Grund des Sees einige Steinbrocken, die eindeutig Teile einer Statue oder etwas Ähnlichem darstellten. Zweifellos handelte es sich um Bruchstücke des steinernen Brückengeländers, aber sie waren überzeugt, eine bedeutende Entdeckung gemacht zu haben, welche die Altertumswissenschaft revolutionieren würde. Tobias grübelte noch tagelang darüber nach, wie sie nur die großen Brocken aus dem See bergen könnten.
Es war wieder eine dieser Weihnachtsschulstunden, in der Kusch einen Film mit dem vielversprechenden Titel Reise in die Urwelt zeigte. Sie waren völlig aus dem Häuschen.
Eine Reise in die Urwelt!
Dass sie darauf noch nicht gekommen waren! Dagegen waren ja die Pferdeknochen auf ihrem Trümmergelände geradezu Pipifax.
Und diese Tiere! Natürlich ganz besonders die Saurier! Nie würde er den Kampf zwischen dem riesigen Tyrannosaurus mit seinem furchtbaren Gebiss und dem armen Stegosaurus vergessen. Den in Knochenäxten endenden Schwanz hatte er dem übermächtig scheinenden Angreifer in die Eingeweide gerammt, ihn sogar in die Flucht geschlagen und war doch qualvoll an seinen furchtbaren Wunden zugrunde gegangen. Der Kampf der Giganten. Die Drachen in der Luft. Die riesigen Fleischberge in den Sümpfen. Aber auch die Säbelzahntiger, die Mammuts, die Riesenlibellen. All das sollte es auf diesem Planeten wirklich gegeben haben? Es war unglaublich, unfassbar.
Während Micha nur hingerissen, fasziniert und begeistert war, reagierte Tobias zunächst wie geschockt, redete in der Schule kein Wort mit ihm und mied regelrecht seine Gegenwart. Später auf dem Heimweg verfiel er aber in eine Begeisterung, die alles, was Micha bisher bei ihm erlebt hatte, in den Schatten stellte.
»Wir müssen unbedingt diese Höhle finden«, sagte Tobias ein paar Tage später.
»So’n Quatsch! Das is irgend ’ne Höhle.«
»Nein, das ist ’ne besondere Höhle. Durch diese Höhle gelangt man in die Urwelt. Die vier Jungs im Film haben es doch gezeigt.«
»Du spinnst ja!«
So verliefen danach noch viele Diskussionen. Tobias behauptete irgendetwas, das der Film gezeigt hatte, Micha widersprach vehement, und Tobias schüttelte verständnislos den Kopf, wie er so etwas nur abstreiten könne, wo es doch im Film zu sehen war, von den Filmkameras eingefangen. Immer wieder dasselbe, es war zum Haareraufen.