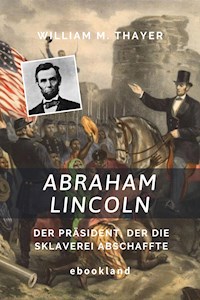
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Biografien bei ebookland
- Sprache: Deutsch
Wahrscheinlich hat seit den Tagen Washingtons kein Mann einen so großen, festen Platz in den Herzen der amerikanischen Bürger eingenommen wie Abraham Lincoln. Ermordet, eingesargt, begraben, wird er unter den wenigen unsterblichen Namen weiterleben, denen keine Vergänglichkeit droht, weiterleben in den dankerfüllten Herzen der farbigen Rasse, die er unter der Bedrücker Fersen hervorzog und zur Würde der Freiheit und Menschlichkeit erhob. Er wird weiterleben in jedem schwergeprüften Familienkreis, der Vater, Gatten, Sohn oder Freund dahingegeben, um gleich ihm den Tod fürs Vaterland zu sterben. Er wird weiterleben in der glorreichen Gemeinschaft der Märtyrer, die im Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit, die drei dem Himmel entstammenden Prinzipien, den Tod erlitten: weiterleben in der Liebe aller Menschen unter der Sonne, die Tyrannei, Sklaverei und das Unrecht verabscheuen. Das Lebensbild, das er zurücklässt, zeigt uns, wie Redlichkeit und gute Grundsätze ihm, der sich durch eigene Kraft und Fleiß aus der bescheidensten Sphäre des Volkes emporgearbeitet, zu einer der hervorragendsten Stellungen unseres Erdballes verhalfen und ihm einen Namen verliehen, der in den Augen der Nachwelt immer größer strahlen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abraham Lincoln
Der Präsident, der die Sklaverei abschaffte
William M. Thayer
Impressum
© 1. Auflage 2019 ebookland im Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: William M. Thayer
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-236-4
Verlags-Seite und Shop: www.ceBooks.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Dank
Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem Verlag ceBooks.de erworben haben.
Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.
ceBooks.de, [email protected]
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:
Neuerscheinungen von ceBooks.de und anderen christlichen Verlagen
Neuigkeiten zu unseren Autoren
Angebote und mehr
http://www.cebooks.de/newsletter
Inhalt
Titelblatt
Impressum
1. Abraham Lincolns Geburtsort
2. Der Schulknabe
3. Die alte Farm wird verkauft
4. Der Bau des neuen Hauses
5. Die erste Jagdbeute
6. Trübere Tage
7. Hellere Stunden
8. Die neue Mutter und die Schule
9. Abraham leiht ein Buch, und was damit geschieht
10. Arbeit und Erfolg
11. Höheres Streben
12. Auf dem Prahm
13. Verschiedene Begebenheiten
14. Die Übersiedlung nach Illinois
15. Die zweite Fahrt nach New Orleans
16. Im Pionierkramladen
17. Abrahams Einfluss auf seine Kameraden
18. Auf dem Kriegspfad
19. Eine ungeahnte Auszeichnung
20. Abraham Lincoln als Landtagsabgeordneter
21. Ein tüchtiger Rechtsanwalt
22. Der an Bedeutung zunehmende Staatsmann
23. Zu höheren Würden berufen
24. Das Leben im Weißen Haus
25. Lincolns Interesse für die Vaterlandsverteidiger
26. Lincolns Wirken im Interesse der farbigen Rasse
27. Verlängerter Aufenthalt im Weißen Haus
28. Vom Meuchelmörder erschossen
29. Die Begräbnisfeierlichkeiten
Unsere Empfehlungen
1. Abraham Lincolns Geburtsort
Schon die flüchtige Beschreibung der elenden Blockhütte, in welcher Abraham Lincoln das Licht der Welt erblickte, genügt, eine Vorstellung von der bescheidenen Lebenssphäre und den ärmlichen Verhältnissen zu wecken, denen er durch seine Geburt angehörte. Es war ein roh zusammengefügter Schuppen, der, in einer der unfruchtbarsten und ödesten Gegenden der Grafschaft Hardin im Staat Kentucky stehend, weder mit hölzernem Fußboden, noch mit einem Fenster oder selbst einer Tür versehen war. Sein Vater bezog diese Hütte aus dem einfachen Grund, weil er zu arm war, sich eine behaglichere Wohnung zu verschaffen; doch darf man hieraus nicht folgern, dass seine Lage eine besonders dürftige, seine Armut eine ungewöhnlich bittere gewesen wäre. Die Bewohner jenes Distriktes waren durchgehend unbemittelt und ungebildet und kaum imstande, dem Boden so viel Ertrag abzugewinnen, wie sie zur Stillung ihres Hungers bedurften.
In dieser anspruchslosen Umgebung begrüßte Abraham Lincoln am 12. Februar des Jahres 1809 das Licht der Welt. Sein Vater hieß Thomas Lincoln, seine Mutter nannte sich vor der Verheiratung Nancy Hanks; als sie den Ehebund schlossen, war Thomas achtundzwanzig, seine Frau dreiundzwanzig Jahre alt, und drei Jahre später wurde ihnen ihr Sohn Abraham geboren. Die Hütte des jungen Paares stand in dem Teile der Grafschaft Hardin, der jetzt zu La Rue County gehört, nicht weit von Hodgensville am südlichen Arm des Nolinsflusses. Eine nie versiegende Quelle, deren silberheller Wasserstrahl aus einem nahen Felsen hervorrieselte, nahm dem Ort etwas von seinem sonst trostlosen Aussehen und verlieh ihm den stolz klingenden Namen „Rock Spring Farm“, d. h. „Felsenquellfarm“.
„Wie aber kam Thomas Lincoln hierher?“, wird man fragen. „Woher kam er und wer waren seine Voreltern?“
Thomas Lincoln wurde im Jahre 1778 in der Grafschaft Rockingham im Staat Virginien geboren. Zwei Jahre später ließ sein Vater sich durch die umlaufenden Gerüchte über die große Fruchtbarkeit des Bodens und die schnell zunehmende Bevölkerung von Kentucky verleiten, in diesen Staat überzusiedeln und wurde er in Mercer, der jetzigen Grafschaft Bullitt ansässig. Er hatte damals fünf Kinder, drei Söhne und zwei Töchter, von denen Thomas das vorjüngste war.
Nun aber hegten vor hundert Jahren die Indianer im ganzen Nordwesten der Vereinigten Staaten die bitterste Feindschaft gegen den weißen Mann. Der Pionier riskierte sein Leben, wenn er sich dort niederließ; er musste stets die Flinte zur Hand haben, damit er sich, sei es im Hause, sei es im Freien, jederzeit gegen die wilden Angreifer verteidigen könne. Selbst wenn er den Acker bestellte oder sein Feld umzäunte, oder wenn er im Walde Holz haute, durfte die Schusswaffe nicht fehlen, wusste er doch nicht, ob nicht tückische Indianer ihm auflauern und ihn unversehens überfallen würden.
Als Thomas Lincolns Vater vier Jahre in Kentucky gewohnt, begab er sich eines Tages ins Feld, um eine Einfriedigung aufzurichten. Den sechsjährigen Thomas nahm er mit sich, seine beiden ältesten Söhne Mordecai und Josias aber stellte er bei der Arbeit auf einem nahegelegenen Acker an. Während er eifrig beschäftigt war, die Pfähle einzuschlagen, ertönte plötzlich ein Schuss und von den Kugeln der im Hinterhalt liegenden Indianer durchbohrt, sank der Vater leblos zu Boden. Die größeren Knaben wurden vom heftigsten Schrecken erfasst, der kleine Thomas aber stand wie gelähmt vor Entsetzen da. Josias ließ in seiner Herzensangst zu der zwei (engl.) Meilen weit entfernten Ansiedelung, und Mordecai, der älteste, floh ohne Säumen zur Hütte, wo er vom Bodenraum aus durch eine Schießscharte die Indianer sehen konnte. Einer der Wilden war gerade im Begriff, seinen kleinen Bruder vom Boden aufzuheben; doch kaum hatte Mordecai dies wahrgenommen, als er auch schon seine Büchse auf die Rothaut anlegte und den frechen Eindringling tötete. Sowie dieser zusammenstürzte, erwachte Thomas aus seiner Betäubung und rannte aus Leibeskräften der Hütte zu; Mordecai aber blieb auf seinem Posten und feuerte jedes Mal drauf los, sobald der Kopf eines Indianers aus dem Unterholz hervorschaute. Indessen dauerte es nicht lange, so kam Josias mit einer Anzahl Kolonisten von der nahen Ansiedelung zurück, und nun machten die Wilden sich eiligst aus dem Staube, ja, sie ließen außer dem toten Kameraden noch einen Verwundeten zurück; Mordecais Büchse hatte treffliche Dienst geleistet.
Dieser Tag brachte tiefe Trauer über die Familie von Abraham Lincolns Großvater; es war wohl die trübste Stunde, die sie je kennen gelernt, da man den entseelten Körper des starken Beschützers in die bescheidene Hütte trug; sein Tod schuf nicht nur eine große Öde, er zog auch schwere Folgen nach sich. Wer sollte sie hinfort gegen Angriffe verteidigen? wer sie mit Brot versorgen? Der Aufenthalt in der unwirtlichen Gegend brachte schon Mühsal genug mit sich, und doch wurden die Entbehrungen und die Drangsale durch des Wilden wohlgezielten Schuss hundertfältig vermehrt.
Abraham Lincoln lauschte als Knabe oftmals mit gespanntem Interesse der Erzählung dieses Ereignisses. Es war ein zu erschütterndes, zu wichtiges Kapitel aus der Familiengeschichte, als dass er sich mit dem einmaligen Hören hätte begnügen können. Wieder und immer wieder bat er seinen Vater, der als guter Erzähler bekannt war, ihm die aufregenden Ereignisse jener Zeit zu schildern, und dieser willfahrte seinem Wunsch um so lieber, als es ihn selbst mit einer Art Stolz erfüllte, die Bilder jenes Tages zu entfalten und dem Knaben die früheren Erlebnisse seiner Großeltern mitzuteilen.
„Es würde länger als eine Woche in Anspruch nehmen“, pflegte er zu sagen, „wollte ich dir alles erzählen, was dein Großvater uns über jene trüben Zeiten berichtete. Schon in dem ersten Jahre, da er hierhergezogen war, 1780, griffen die Indianer in großer Stärke die Kolonisten an. Sofort wurden alle Männer aufgefordert, sich in Compagnien zusammenzuschließen, und Daniel Boone, der große Jäger von Kentucky, der bereits fünf Jahre in unserem Staat ansässig gewesen, ward zum Oberstleutnant gemacht, während General Clark den Oberbefehl über die Gesamttruppen übernahm. Sie brachen auf und zogen dem Feind entgegen, mit dem sie nahe bei den Lower Blue Sicks zusammenstießen. Hier kam es zu einer furchtbaren Schlacht, in der die Weißen geschlagen und nahezu von den Indianern aufgerieben wurden. Boones Sohn erhielt eine schlimme Wunde; sein Vater machte den Versuch, ihn beim Rückzug mit fortzutragen, lud ihn auf seinen Rücken und schwamm mit ihm über den Fluss, doch ehe er das andere Ufer erreichte, hatte der Jüngling den Geist aufgegeben. Der betrübte Vater setzte kaum den Fuß aufs Land, als er entdeckte, dass die Wilden hinter ihm her geschwommen kamen, und nun blieb ihm keine Wahl, er musste sein totes Kind zu Boden werfen und in wilder Hast von dannen fliehen. Er entkam den Verfolgern und erreichte ungefährdet die Station Bryant.
„Kurze Zeit vor diesem Ereignis hatten die Indianer drei kleine Mädchen geraubt und fortgeschleppt. Die Kinder, die zu den Bewohnern des Fort Boonesboro gehörten und unter denen sich auch Boones Tochter befand, belustigten sich damit, in einem Kanoe auf dem Kentuckyfluss zu schaukeln und nach dem jenseitigen Ufer zu rudern; plötzlich stürzten mehrere Wilde aus den Büschen hervor, sprangen ins Wasser, ergriffen das Kanoe und zogen es ans Land. Die Kinder, von wahnsinniger Angst erfasst, schrien so laut sie konnten um Hilfe und ihre Weherufe verhallten nicht ungehört. Aber ehe die aus dem Fort herbeieilenden Männer das Kanoe erreichen konnten, waren die Indianer mit ihrer Beute entflohen. Die Sonne war schon untergegangen und die einbrechende Nacht hinderte die Verfolgung – doch ließ die Stafregung keinen zur Ruhe kommen; man benutzte die Zeit bis zum Tagesanbruch, so viele Männer wie möglich zusammenzurufen und machte sich dann in aller Frühe auf, den Feinden nachzusetzen. Erst gegen Abend, nachdem sie vierzig Meilen zurückgelegt, wurden die Kolonisten der Indianer ansichtig, die sich gerade gelagert hatten und mit der Bereitung ihres Essens beschäftigt waren. In der Besorgnis, die Wilden würden die Mädchen eher töten, als sie herausgeben, waren die Kolonisten übereingekommen, die Feinde so plötzlich anzugreifen, dass ihnen keine Zeit bliebe, den Kindern ein Leid zuzufügen. Aus diesem Grunde feuerten sie, als sie nahe genug gedrungen, alle zu gleicher Zeit auf die Indianer und gaben sorgfältig acht, dass ihre Kugeln keines der kleinen Mädchen träfen. Nicht einer der Wilden wurde verwundet; trotzdem war der Angriff so plötzlich und mit solchem Getümmel verbunden, dass die Rothäute voller Entsetzen aufsprangen und schleunigst die Flucht ergriffen, während sie nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Waffen zurückließen.“
Abraham wurde nicht müde, diesen langausgesponnenen Geschichten zuzuhören, die um so interessanter für ihn waren, als die Begebenheiten sich wirklich zugetragen und seine Vorfahren sie zum größeren Teile persönlich erlebt hatten. Sie prägten sich seinem Gedächtnis aufs lebhafteste ein. gruben sich tief in sein Herz, und wie sehr sie auch sein Gemüt bewegten und erschütterten, ist doch mit Sicherheit anzunehmen, dass ihm die eigenen Verhältnisse trotz aller Entbehrungen als sehr bevorzugte erschienen, wenn er sie mit der Lage verglich, in der seines Großvaters Familie sich befunden.
Nach dem' Tode ihres Gatten verließ Abrahams Großmutter den Ort, der für sie die schmerzlichste Erinnerung in sich barg, und Thomas, sein Vater, musste sich, sobald er nur irgend groß genug war, selbst fortbringen. Von rastlosem Wandertrieb beseelt und durch die bittere Notwendigkeit zum Erwerb gezwungen, suchte er sich bald hier, bald dort Arbeit und nahm seinen Aufenthalt zeitweilig da, wo sich ihm die günstigste Gelegenheit zu leidlichem Verdienste bot. Er war weder unternehmend, noch auch besonders fleißig, das Umherstreifen behagte ihm wohl und die Gesellschaft lustiger Kameraden sagte ihm zu sehr zu, als dass er am emsigen Schaffen hätte Freude finden können. Indessen bot sein Wanderleben ihm doch auch einige Vorteile; er sah viel von der Welt, bestand manch heiteres Abenteuer und sammelte nützliche Kenntnisse, die er in späteren Jahren gut zu verwerten wusste, und die ihm überall das besondere Wohlwollen seiner Freunde gewannen.
Als Thomas Lincoln ungefähr sechsundzwanzig Jahre alt war, gab er sich bei Josef Hanks, einem Zimmermann in Elisabethtown – Kentucky – in die Lehre und machte hier die Bekanntschaft von Nancy Hanks, der Nichte seines Meisters, die ihm so wohl gefiel, dass er um sie freite und sie als Gattin heimführte. Nun war er nicht nur ein gesetzter Ehemann, sondern zu gleicher Zeit auch ehrsamer Handwerker geworden, doch erwies sich die Frau von größerem Werte für ihn, als sein Gewerbe, denn er brachte es nie über die rohesten Arbeiten in demselben hinaus. Die Neuvermählten gründeten ihren Haushalt in Elisabethtown in einer Wohnung, welche die Blockhütte am Nolinsfluss noch an Armseligkeit übertraf und die sie deshalb bald gegen die letztere vertauschten.
So kam es, dass Thomas Lincoln (Abrahams Vater) die dürftige Behausung in der Grafschaft Hardin als Eigentum erwarb. Hier wurden ihm drei Kinder geboren; zuerst eine Tochter, die er Sarah nannte, darauf Abraham und endlich Thomas, der schon im zarten Alter starb.
Thomas Lincoln konnte weder lesen noch schreiben, hatte er doch niemals den Fuß in eine Schulstube gesetzt; seine Frau dagegen verstand sich wohl einigermaßen aufs Lesen, aber sie hatte zu wenig Übung im Schreiben, um einen Brief zustande zu bringen. Wenn sie ihre Namensunterschrift für ein Dokument brauchte, flössen ihr die Buchstaben leicht genug aus der Feder, ja sie konnte noch ein paar Worte hinzusetzen und hatte damit viel vor ihrem Mann voraus, der statt seines Namens nur ein Zeichen zu machen verstand.
„Du kannst schreiben lernen“, sagte Mrs. Lincoln bald nach der Hochzeit zu ihrem Eheherrn. „Du bist noch nicht zu alt zum lernen.“
„Das ist denn doch sehr fraglich“, erwiderte ihr Gatte, der seiner sorglosen Natur gemäß es durchaus nicht der Mühe wert hielt, sich im Alter von achtundzwanzig Jahren noch Elementarkenntnisse anzueignen, selbst wenn seine Frau das Lehramt übernehmen wollte.
„Oh nein, es ist gar nicht fraglich“, beharrte diese. „Wenn nichts anderes, kannst du wenigstens lernen, deinen Namen zu schreiben und das wäre ein großer Fortschritt gegen das Kreuz, mit dem du jetzt Schriftstücke unterzeichnen musst. Komm, lass mich dich lehren, soviel kann ich dir schon beibringen.“
Nach längerem Zaudern willigte der gutmütige Gatte endlich ein, bei seiner Frau Schreibstunden zu nehmen und gab sich auch wirklich Mühe, das Vorgesetzte Ziel zu erreichen. Indessen brachte er es nicht weiter, als bis zur Ausführung seines Namenszuges, dessen Entzifferung allemal den Scharfsinn des Lesers auf die Probe stellte; jedenfalls aber hatte der Schreiber die Genugtuung, sich über die unwissende und indolente Klasse hinausgeschwungen zu haben, die sich damit begnügt, statt der Unterschrift ein X zu machen.
Thomas Lincoln und seine Gattin waren Mitglieder der Baptistengemeinde und gehörten zu den gottesfürchtigen Leuten, die sich alles Ernstes bestreben, einen christlichen Lebenswandel zu führen. Bei Mrs. Lincoln trat die religiöse Gesinnung deutlicher zutage als bei ihrem Mann, dem sie auch geistig weit überlegen war. Dr. Holland sagt von ihr: „Sie war eine zarte, blasse Frau von ernster, empfindsamer Gemütsart, die viele heroische Eigenschaften und ein so feines Gefühl besaß, dass sie vor manchem in ihrer rohen Umgebung zurückbebte.“ Und Lamon teilt uns mit: „In ihrer Familie galt ihr Verstand für etwas Wunderbares.“ Soviel ist gewiss, sie war eine kluge, verständige, rechtschaffene Christin und ihr Gatte bereute niemals seine Wahl, sondern gab sich vielmehr dem mächtigen und veredelnden Einfluss hin, den sie auf ihn ausübte.
Als Abraham vier Jahre alt war, ließ sein Vater sich sechs Meilen von Hodgensville, in einer fruchtbareren und schöneren Gegend am Knobfluss nieder. Wie es möglich, dass ein so armer Mann ein Grundstück von zweihundert und achtunddreißig Morgen käuflich erwerben und mit hundert und achtzehn Pf. Sterling bezahlen konnte, müsste als Rätsel erscheinen, hätten wir nicht zugleich zu melden, dass er nach Ablauf eines Jahres zweihundert Morgen für hundert Pf. Sterling wiederverkaufte und sich mit dem Besitze von achtunddreißig Morgen Landes begnügte. Aber auch in diesem beschränkteren Umfange erscheint die Erwerbung einer eigenen Farm als ein entschiedener Schritt zur Wohlhabenheit, wenn wir uns der kläglichen Armut erinnern, in der Mr. Lincoln sich bei Schließung seines Ehebundes befunden. Mehr noch als dies tritt uns aus dem Umstand, dass er sich in einer fruchtbareren und malerischen Gegend ankaufte und während des ersten Jahres seines dortigen Aufenthaltes sogar sechs bis acht Morgen Landes urbar machte, die erfreuliche Tatsache entgegen, er sei endlich von regerem Unternehmungsgeist beseelt worden, als er bis dahin an den Tag gelegt. Der Einfluss seiner Frau hatte ihn über die rast- und planlose, ja verschwenderische Lebensweise emporgehoben, der er sich im Jünglings- und ersten Mannesalter ergeben.
Hier nun, am Ufer des Knobflusses, stellte Abraham oder „Abe“, wie er von Eltern und Freunden vertraulich genannt wurde, die ersten Versuche im Angeln cm; hier spielte er im Wasser oder begab sich, gewöhnlich in Begleitung eines gewissen Billy Gallaher, auf lange Wanderungen in die Umgegend. Für einen Knaben von sechs bis sieben Jahren war er verwegen und unternehmend; eines seiner Lieblingsspiele bestand darin, sich an den Zweig einer Sycomore zu hängen und über dem Wasser hin und her zu schwingen. Als er sich eines Tages mit seinem teuren Spielgefährten in dieser gewagten Unterhaltung erging, entschlüpfte der Zweig seinen Händen und er stürzte in den Fluss. Wäre Billy kein besonnener und gewandter Knabe gewesen, würde Thomas Lincoln an jenem Tage einen guten Sohn und Amerika einen guten Präsidenten verloren haben; doch der gute Gallaher säumte nicht, dem verunglückten Kameraden zu Hilfe zu kommen und es gelang seinen tapferen Bemühungen, „Abe“ einem nassen Grabe zu entreißen.
Außer diesem Freunde besaß Abraham in Dennis Hanks, seinem um einige Jahre älteren Vetter, einen sehr lieben Gefährten. Der Pflegevater von Nancy Hanks hatte auch Dennis in seine Familie aufgenommen, und da er jetzt in der Nachbarschaft von Thomas Lincoln wohnte, war es natürlich, dass die Knaben viel mit einander verkehrten. Dennis hing mit großer Vorliebe dem Jagen und Fischen nach und „Abe“ folgte ihm oft bei den langen Streifereien durch Wald und Feld, obschon er selbst damals noch zu jung für den Gebrauch von Schusswaffen war und sich auch später weder als Jäger noch als Angler auszeichnete.
Das Lincolnsche Häuschen am Knobfluss war wenig besser, als das am Nolinfluss. Es bestand ebenfalls aus einer Blockhütte ohne Holzfußboden, die außer dem einen Wohnraume zur ebenen Erde noch einen Bodenraum enthielt und nur mit dem einfachsten Hausrat und den notdürftigsten Kochutensilien ausgestattet war. In dieser anspruchslosen Umgebung stellte es sich bald heraus, dass Abraham einen besonders hellen Kopf besaß; sein Takt und seine Klugheit, sowie sein reges Streben bewiesen unverkennbar, wie sehr er in der geistigen Entwickelung den meisten Kindern seines Alters voraus war, und seine Eltern wussten die Überlegenheit ihres Sohnes wohl zu schätzen.
2. Der Schulknabe
„Riney hat mir mitgeteilt, er wolle eine Schule eröffnen“, bemerkte Mr. Lincoln eines Tages gegen seine Frau, „und hat mich gefragt, ob wir ihm Sarah und Abraham anvertrauen wollten.“
„Bist du nicht auch der Meinung, dass wir ihm jedenfalls die Kinder schicken sollten, selbst wenn er ihnen nicht viel beibringen kann?“ entgegnete diese. „Mag der Unterricht auch noch so armselig ausfallen, ist er doch besser als gar keiner.“
„Darin hast du recht“, pflichtete ihr Gatte bei. „Riney wird bald am Ende seiner Kunst stehen, indessen lernen die Kinder auch wenig, so lernen sie doch etwas.“
„Du weißt doch“, fiel Mrs. Lincoln zögernd ein, „dass er weder schreiben noch rechnen kann? Und wer in den beiden Gegenständen völlig unbewandert ist, kann auch im Lesen kaum etwas Besonderes leisten.
„Oh ja, ich weiß es“, erwiderte ihr Mann, „doch er macht sich nicht anheischig, etwas anderes als lesen zu lehren. Mit dem Schreiben von Zahlen und Buchstaben gibt er sich gar nicht ab – sein ganzer Vorschlag besteht darin, den Kindern beizubringen, was er selbst versteht, darüber hinaus will er nichts unternehmen.“
„Dann bin ich völlig zufriedengestellt, denn mehr kann man vom besten Lehrer nicht verlangen“, meinte Mrs. Lincoln. „Ich fürchtete, er möchte die Torheit begehen, sich einer Aufgabe zu unterziehen, der er nicht gewachsen.“
Der von den Gatten bezeichnete Hiskias Riney war ein neu- eingetroffener Ansiedler, der sich nicht weit von der Lincolnschen Hütte niedergelassen hatte. Er war ein ungebildeter, unwissender Mann, dem selbst in jener schularmen Gegend fast jegliche Befähigung zum Lehren abging. Indessen trieb die Not ihn, auf irgend eine Weise Geld zu verdienen, damit er sein äußerst geringes Einkommen etwas vermehre, und da sich ihm in der Einsamkeit des Waldes kein anderer Erwerbszweig bot, verfiel er auf den kühnen Gedanken, eine Schule zu eröffnen. Die Eltern gingen auf seinen Vorschlag ein, weil ihnen kein besserer Unterricht für ihre Kinder zu Gebote stand, und so sehen wir denn den Helden dieses Buches in Begleitung seiner Schwester Sarah den ersten Gang zur Schule antreten, sehen ihn täglich mit ihr zu Rineys Hütte wandern, um wenigstens lesen zu lernen. Abe eignete sich bald die Kenntnis der Buchstaben an, und wenn die Geschwister auch nur gemeinsam eine halbzerrissene Fibel besaßen, scheinen sie doch großen Nutzen aus ihr gezogen zu haben; ihr eigner heller Verstand leistete ihnen dabei bessere Dienst als der beschränkte Geist des Lehrers.
Übrigens war Rineys Schule von kurzer Dauer, schon nach fünf oder sechs Wochen hörte der Unterricht auf, vermutlich weil der Quell des Wissens beim Lehrer versiegt war und man wohl annehmen darf, dass viele Schüler ihn im Lesen überflügelten. Doch sei dem, wie ihm wolle, soviel ist gewiss, dass „Abe“ und seine Schwester in ein anderes „Pionier-College“ geschickt wurden, wie Abraham Lincoln vierzig Jahre später diese primitiven Schulen im Urwalde scherzhaft zu bezeichnen pflegte.
„Mr. Hazel ist viel gescheiter als Riney“, versicherte Mr. Lincoln, „und wenn der Weg bis zu seinem Hause auch weit ist, müssen wir doch versuchen, die Kinder bei ihm zur Schule gehen zu taffen.“
„Gewiss“, versetzte seine Gattin, „es ist hohe Zeit, dass Abe anfange schreiben zu lernen und das kann Hazel ihm gut beibringen. Die Kinder werden sich aus der großen Entfernung nichts machen; wenn wir das Geld für den Unterricht erschwingen können, müssen wir sie in die Schule schicken.“
Die letzte Bemerkung berührte eine Frage, welche Tom Lincolns Gedanken vielfach in Anspruch nahm; es war kein leichtes Ding, das nötige Geld für die einfachsten Bedürfnisse herbeizuschaffen. Selbst wenn er sich ausschließlich mit Roggenbrot und Milch als täglicher Speise begnügen wollte, erforderte es doch noch einen ziemlichen Grad von Scharfsinn und große Sparsamkeit, um das Schulgeld für die Kinder zu erübrigen; indessen erwiderte er:
„Ich habe einen Kostenüberschlag gemacht und glaube, wir können das Geld aufbringen. Hazel kann Abe die erste Unterweisung im Schreiben geben, das wird von unberechenbarem Nutzen für ihn sein, denn ich hoffe, wir werden noch eines Tages in einer Gegend leben, wo ich mein Handwerk verwerten kann.“
„Das müsste denn wohl sehr weit von hier sein“, entgegnete Mrs. Lincoln. „In dieser Gegend können wir jetzt keinen großen Zuwachs der Bevölkerung erwarten. Sollte Indiana wirklich als freier Staat in die Union aufgenommen werden, so böten sich uns allerdings bessere Aussichten.“
Die Frage, ob Indiana in dieser Weise mit den Vereinigten Staaten verbunden werden solle, erfüllte die Gemüter zur Zeit mit großer Aufregung; der Vorschlag war im Kongress zur Verhandlung gebracht und die Freunde der Sklaverei boten alles auf, das Zustandekommen des geplanten Ereignisses zu hintertreiben. Besonders ließen die Sklavenhalter von Kentucky es sich angelegen sein, gegen den Vorschlag zu wirken, da ein zweiter freier Staat ganz in der Nähe ihren Sklaven nur eine um so lockendere Versuchung bieten würde, dort vom Asylrecht Gebrauch zu machen.“
Die Angelegenheit wurde, wie überall in der Hütte des weißen Mannes in Kentucky, auch bei Lincolns erörtert, und alle hegten den lebhaften Wunsch. Indiana möge ein freier Staat werden; waren sie doch fest überzeugt, die Wohlfahrt jedes Sklavenstaates' müsse früher oder später unter dem Fluche der Menschenknechtung verkümmern.
„In einem freien Staat hat man in jeder Hinsicht bessere Aussichten“, war alles, was Mr. Lincoln erwiderte.
Hazels Schule befand sich vier (engl.) Meilen weit von der Rock Spring Farm entfernt in dem einzigen Blockhause jenes Distriktes. Zu diesem Pionierinstitut wanderten Sarah und Abraham Tag für Tag, ihr Mittagessen, ein Stück Roggenbrot, in der Tasche tragend, ohne dass sie während der acht oder zehn Wochen ihres Schulbesuches sich jemals einer Abwechslung in der Kost zu erfreuen gehabt hätten. Hier legte Abraham den Grund zu seiner künftigen Laufbahn; er lernte schreiben, wenn auch in sehr mangelhafter Weise, und es gewährte ihm solches Vergnügen, selbständig die Schriftzeichen zu bilden, dass er sich mit größtem Eifer der fleißigen Übung unterzog. Daneben machte er außerordentlich schnelle Fortschritte im Lesen und erregte nicht nur durch seine Begabung, sondern auch durch einzelne edle Charakterzüge in so hohem Grade die Aufmerksamkeit des Lehrers, dass dieser prophezeite, er würde nicht, wie sein Vater, zeitlebens ein Bewohner des Urwaldes bleiben. Den verlässlichsten Quellen, derer wir uns bedienen konnten, entnehmen wir die Versicherung, dass Abraham während seines kaum vierteljährigen Schulbesuches bei Hazel alles lernte, was dieser seinem Schüler überhaupt mitzuteilen imstande war.
Was nun den Bücherschatz betrifft, mit dem die Lincolnsche Hütte ausgestattet war, so bestand er in keinem größerem Vorrat, als der Bibel, dem Katechismus und der schon erwähnten Fibel, selbst für einen Pionier eine bescheidene Bibliothek, und doch, wenn man sie dem Inhalte nach schätzt, ein wertvoller Besitz. Wo in einer Büchersammlung die Bibel den ersten Platz einnimmt, da ist es wohl um sie bestellt, und Katechismus wie Fibel sind würdige Gefährten des Buches der Bücher. „Die Bibel, der Sabbat und die Volksschule sind die drei Schutzwachen unseres Landes“ und hier finden wir sie als Grundelemente des gedeihlichen Familienwohles, wie sie Grundelemente der Nationalwohlfahrt sind. Ihnen reihten sich zu rechter Zeit auch andere gleich wertvolle Besitztümer an.
Fehlte es den Bewohnern jener Gegend damals an jeder Gelegenheit, ihren Kindern eine tüchtige Schulbildung zu geben, so waren sie in Bezug auf die Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse fast noch übler dran. Meilenweit im Umkreise gab es weder eine Kirche noch auch regelmäßige, gemeinschaftliche Andachtsübungen. Wenn „Pfarrer Elkins“ ab und an auf seinen Rundreisen durch diesen Teil von Kentucky kam, so predigte er in der Lincolnschen Hütte, wo er, wie überall bei den Ansiedlern, ein hochgeehrter Gast war, dem jedes Mal das herzlichste „Willkommen“ entgegengebracht wurde. Außer diesen einfachen Gottesdiensten waren die christlichen Familien auf Benutzung der Bibel und Heiligung des Sabbats im eigenen Hause angewiesen. Mrs. Lincoln genoss, wie wir schon erwähnt, den Vorzug, lesen zu können und da die Bibel das einzige Lesebuch war, das ihr zu Gebote stand, benutzte sie es um so fleißiger, nicht nur zur eigenen Erbauung, sondern auch zu der ihrer Angehörigen, denen sie täglich aus der heiligen Schrift vorlas.
Auf diese Weise kam es, dass Abraham, schon ehe er lesen konnte, viele Erzählungen aus dem Worte Gottes kannte; sie erfüllten ihn mit solchem Interesse, dass er ihnen stets mit Wonne lauschte und nie müde wurde, sie wieder und immer wieder zu hören. Sobald er imstande war, einigermaßen fließend zu lesen, griff er in Ermangelung anderer Bücher zur Bibel und las besonders die erzählenden Abschnitte derselben so oft durch, dass er bald einen großen Teil der heiligen Schrift auswendig wusste. Als er älter wurde und andere Bücher seine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, vernachlässigte er die Bibel mehr und mehr, doch hatte der stete Gebrauch des Wortes Gottes in seinen Kinderjahren einen so tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen, dass derselbe niemals verwischt wurde. War er auch beim Antritt seiner staatsmännischen Laufbahn kein ausgesprochener ernster Christ, so legte er doch oftmals Zeugnis von seiner bewunderungswürdigen Bibelkenntnis ab. Seine Gespräche und öffentlichen Reden erhielten durch Anführung von Schriftstellen oder Anspielungen auf biblische Personen das Gepräge großer Anschaulichkeit, und wir werden aus dem Folgenden sehen, dass dies eine Buch die Quelle gewesen sein muss, aus der die Redlichkeit, das edle Streben, das Beharren beim Rechten und das unerschütterliche Gottvertrauen hervorgingen, die sein Wirken im öffentlichen Leben auszeichneten.
Uns sind aus der Zeit, wo er im weißen Hause residierte, drei Vorfälle bekannt, die als Beweis gelten können, wie sehr er mit dem Inhalt der Bibel vertraut war. Es wurde ihm viel Verdruss durch Leute bereitet, die fortwährend Klagen über einzelne hohe Beamte erhoben. Zu einem derselben sagte er bei solcher Gelegenheit: „Mein Freund, gehen Sie nachhause und lesen Sie den zehnten Vers des dreizehnten Kapitels der Sprüche Salomos aufmerksam durch.“ Die Worte des angedeuteten Spruches lauten:
„Unter den Stolzen ist immer Hader, aber Weisheit macht vernünftige Leute.“
General Fremont, dem er das Kommando abgenommen hatte, willigte ein, sich als Gegenkandidat für die Präsidentenwürde aufstellen zu lassen, nachdem Lincoln wiederum für dies Amt in Vorschlag gebracht worden war. Eine kleine Schar von Politikern und Offizieren, die sich ebenfalls in ihren Erwartungen getäuscht sahen, sammelten sich um Fremont. Aber als dieser – wohl sehend, dass seine Kandidatur ihm mehr Feinde als Freunde mache – im Begriff war, seinen Namen zurückzuziehen, entgegnete Mr. Lincoln einem Herrn, der den Gegenstand zur Rede brachte: „Geben Sie acht, was ich Ihnen aus diesem Buche vorlesen werde!“ Und er nahm. die Bibel zur Hand und las aus dem ersten Buche Samuels die folgenden Worte: „Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schuld und betrübten Herzens waren; und er war ihr Oberster, dass bei vierhundert Mann bei ihm waren.“
Henry Ward Beecher, der Herausgeber der Zeitung ‚The Independent‘ unterzog Lincolns Administration einstmals einer scharfen Kritik, die in mehreren Artikeln des von ihm verlegten Blattes veröffentlicht wurde. Ein Leser schnitt mehrere derselben aus und sandte sie direkt an Mr. Lincoln. Dieser nahm gelegentlich das Kuvert auf und las den Inhalt von Anfang bis zu Ende durch, dann aber schleuderte er die Zeitungsausschnitte auf den Boden indem er ausrief: „Was ist dein Knecht, der Hund, dass er solch große Ding tun sollte.“ Die in den Artikeln enthaltenen Vorwürfe waren aus Unwahrheiten basiert, also ungerecht und grausam, darum floss ihm sofort das Zitat aus der Bibel über die Lippen.
Einer von Abraham Lincolns Biographen hat behauptet, sein Vater habe kein Interesse für des Sohnes Erziehung gehabt; doch zeigen die angeführten Tatsachen, dass diese Folgerung eine haltlose ist. Eltern, die durch ihre Armut gezwungen, fast ausschließlich von Roggenbrot lebten, müssen ein entschiedenes Interesse für die Erziehung ihrer Kinder gehegt haben, wenn sie sich bemühten, ein paar Dollar Schulgeld zusammenzubringen und die Kleinen dann täglich den stundenlangen Weg machen ließen, damit sie den ersehnten Vorzug genössen. Wenn dies Gleichgültigkeit gegen Schulbildung genannt werden kann, dann darf man nur wünschen, recht viel von derselben zu sehen. Dass Thomas Lincoln und seine fromme Frau den innigen Wunsch hatten, ihren Kindern eine gute Erziehung zu geben, unterliegt keinem Zweifel; ebenso ist es eine verbürgte Tatsache, dass ihnen schon frühe Abrahams ungewöhnliche Begabung auffiel; aber dass sie je die Erwartung gehegt, er werde sich dereinst als Staatsmann einen bedeutenden Namen erwerben, ist aus der Luft gegriffen; es bot sich ihnen auch nicht die geringste Aussicht, dass er je den Druck der Armut von sich schütteln und aus der bescheidenen Lebenssphäre in die Ruhmesbahn eintreten würde; von einer solchen Möglichkeit konnten sie damals keine Ahnung haben.
*
Es war im Herbste des Jahres 1816. Indiana war als freier Staat der Union einverleibt worden und dieser Anschluss bewirkte, dass Tausende von Auswanderern dorthin strömten. Die allgemeine Aufregung bemächtigte sich auch Thomas Lincolns und seiner Frau; sie erwogen ernstlich, ob sie nicht dem Beispiele anderer folgen und sich gleichfalls in Indiana niederlassen sollten, bis sie sich nach langem Hin- und Herreden wirklich zu dem geplanten Schritt entschlossen, vorausgesetzt, dass sie ihre Farm würden verkaufen können.
„Wenn wir mit der Herbstarbeit zu Ende sind, müssen wir uns auf die Wanderschaft machen“, lautete Mr. Lincolns endgültiger Entschluss.
„Das heißt, wenn es dir bis dahin gelungen, die Farm zu verkaufen“, fügte seine Frau mit Nachdruck hinzu. „Es ist hier in unserer Gegend nicht so leicht, einen Käufer zu finden; wer weiß, ob wir uns nicht noch länger werden gedulden müssen.“
„Es wird sich schon ein Kaufliebhaber finden“, entgegnete Mr. Lincoln mit großer Zuversicht in Blick und Ton.
„Hast du etwas Näheres über den Mann gehört, von dem Gallaher neulich sprach?“
„Keine Silbe, doch hat es ja noch lange Zeit.“
Der Nachbar Gallaher hatte einen Bekannten, der eine kleine Farm zu erstehen wünschte, von Lincolns Absicht in Kenntnis gesetzt und letzterer glaubte fest, Mr. Coby, der mutmaßliche Käufer, werde über kurz oder lang in Person bei ihm erscheinen. Seine Frau teilte diese Erwartung nicht so zuversichtlich, und obwohl sie großes Verlangen trug, nach Indiana zu ziehen, erschien ihr die Schwierigkeit, zu so ungünstiger Jahreszeit und in so entlegenener Gegend eine Farm zu verkaufen, weit größer, als ihrem Mann.
„Wenn überall in diesem Jahre, sollten wir bald aufbrechen“, meinte Mrs. Lincoln, „sonst wird uns der Winter im Urwalde überfallen, ehe wir uns häuslich eingerichtet haben und seiner Unbill Trotz bieten können.“
„Sind wir nur erst in Indiana, so wird es nicht lange Zeit in Anspruch nehmen, den Wald zu lichten und uns eine Wohnstatt zu schaffen“, erwiderte ihr Gatte.
„Das glaube ich gerne“, warf die vorsichtige Frau ein, „indessen können wir das erst näher in Betracht ziehen, wenn sich ein Käufer gefunden; bis dahin aber müssen wir uns bestreben, fleißig zu arbeiten und geduldig zu warten.“
„Nun, ich denke, das hätten wir seither immer getan und bedürften jetzt des Bestrebens nicht mehr“, fiel Mr. Lincoln schnell ein. „Ich habe mein Lebtage nichts anderes getan als arbeiten und warten; wenn ich mich aber noch viel länger aufs Warten lege, verliere ich am Ende gar das Anrecht auf mein Grundstück, wie es mehr als einem armen Kerl hier zu Land ergangen ist.“
„Das ist leider nur allzu wahr“, stimmte Mrs. Lincoln seufzend bei.
„Und nach den Erfahrungen anderer zu urteilen, bietet sich auch mir die Aussicht, dass meine rechtmäßigen Ansprüche auf unsere Farm als null und nichtig erfunden werden können“, fuhr Mr. Lincoln fort. „Hier bei uns weiß ein Mensch wahrhaftig nicht, ob sein eigener Grund und Boden ihm gehört oder nicht.“
Diese im Unmut ausgesprochenen Worte enthielten keine Übertreibung; in ganz Kentucky herrschte große Aufregung wegen der Unsicherheit des Eigentumsrechtes auf käuflich erworbenen Grundbesitz. Viele Ansiedler, die jahrelang alle Kräfte der Hebung ihrer Farmen gewidmet, mussten sich überzeugen, dass ihre Kaufkontrakte nicht rechtsgültig abgefasst waren. So erging es unter anderen auch den Nachkommen Daniel Boones, die in betrügerischer Weise um alle Güter gebracht wurden, welche ihr heldenmütiger Vorfahre angekauft; gar manche hatten Angst und Sorge auszustehen und viele wurden von solchen Verlusten betroffen, dass nahezu jeder Grundbesitzer fürchtete, seine Rechtsansprüche könnten sich möglicherweise auch unzulänglich erweisen. Thomas Lincoln teilte diese Besorgnis mit den anderen. Einer seiner Biographen behauptet, er sei nur aus diesem Grunde nach Indiana ausgewandert; die Tatsache, dass Kentucky ein Sklavenstaat, Indiana dagegen ein neuer freier Staat gewesen, habe seinen Entschluss nicht im mindesten beeinflusst. Dem können wir nicht beistimmen.
Es ist nicht zu bezweifeln, dass die Unsicherheit des Grundbesitzes in Kentucky ein Hauptbeweggrund seiner Übersiedelung gewesen ist, doch war es durchaus nicht der einzige Beweggrund. Die Veränderungssucht, die als Überbleibsel seines früheren Wandertriebes noch immer wieder zum Vorschein kam, war ohne Frage ein stark mitzählender Faktor. Mehr als alles andere aber trieb ihn die Erregung zu diesem Schritte, die sich nach Gründung des neuen freien Staates der Gemüter unbegüterter Menschen bemächtigte; sahen sie doch alle Vorzüge des freien Staates im rosigsten Lichte und hofften sie doch, diese Vorzüge zum eigenem Vorteil auszubeuten. Wäre Indiana ein Sklavenstaat geblieben, würde Thomas Lincoln sicherlich nicht dorthin gezogen sein; der allgemeine Enthusiasmus über den im Interesse der Freiheit gestatteten Anschluss an die Union verlockte ihn, wie so viele Hundert andere, zur Auswanderung.
Der Grund, weshalb er gerade den Ort zur Ansiedelung wählte, an dem wir ihm später begegnen werden, lag wahrscheinlich in dem Umstande, dass ein alter Bekannter – Thomas Carter – sich vor ihm daselbst ansässig gemacht hatte. Die näheren Details des Ereignisses selbst werden uns im folgenden Kapitel erschlossen werden.
3. Die alte Farm wird verkauft
Es mochte um die Mitte des Monates Oktober im Jahre 1816 sein, da erschien in Thomas Lincolns Hütte ein Fremder, der sich als Colby (der früher erwähnte Kaufliebhaber) zu erkennen gab.
„Ich höre, Sie wollen Ihre Farm verkaufen“, hub er nach der ersten Begrüßung an.
„Ja, ich bin mit dem Gedanken umgegangen“, entgegnete Mr. Lincoln, „und da Gallaher mir mitgeteilt, Sie würden kommen, mich über die Kaufbedingungen zu befragen, haben wir Sie sogar erwartet und uns der Hoffnung hingegeben, mit Ihnen handelseinig zu werden. Sagt Ihnen das Grundstück im Allgemeinen zu?“
„Nachdem was Gallaher mir über dasselbe erzählt, allerdings. Eine große Farm kann ich nicht erstehen, dazu bin ich nicht vermögend genug.“
„Dann geht es Ihnen nicht besser als uns allen“, warf Mr. Lincoln ein. „Der hiesige Boden ist keine Goldgrube für den Landmann. Wieviel Geld können Sie in einem Grundstücke anlegen?“
„Für den Augenblick habe ich nur eine kleine Summe disponibel“, versetzte ausweichend der Fremde, „und wenn ich eine Farm kaufe, muss ich eine Art Tauschhandel eingehen. Wieviel verlangen Sie für das Grundstück?“
„Dreihundert Dollar“, erwiderte Mr. Lincoln, ohne sich zu besinnen, „das ist die Summe, die ich festgesetzt habe.“
„Muss das Geld bar ausgezahlt werden?“
„Ja – wenigstens habe ich dies vorausgesetzt; doch würde ich für einen Teil der Zahlung etwas anderes nehmen.“
„An barem Geld habe ich, wie gesagt, keinen großen Vorrat“, fuhr Mr. Colby fort, „doch besitze ich etwas, was im Handel gleichen Wert hat.“
„Und was ist das?“
„Ich habe mich, seit Sie im Sommer von mir hörten, ein wenig aufs Spekulieren gelegt, habe mein Korn zur Bereitung von Whiskey verwandt und mir noch von anderer Seite welchen dazu gekauft, denn ich glaubte sicher, es würde sich hier damit ein gutes Geschäft machen lassen. Diese Erwartung ist bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen, ich habe nur wenig verkauft. Wenn ich Sie nun zum größeren Teil in Whiskey bezahlen dürfte, würde ich den Kauf sofort abschließen und höchst wahrscheinlich fänden Sie in Indiana schnellen Absatz für den vielbegehrten Artikel.“
Mr. Lincoln schüttelte bedenklich den Kopf. „Es ist mir nicht im Traume eingefallen“, meinte er endlich, „dass ich eine solche Art Bezahlung erhalten könnte; wer weiß, ob ich den Whiskey jemals anbringen würde. Ich will geradezu in den Urwald gehen.“
„Das ändert nichts an der Sache, Sie werden doch immer in der Nähe von Ansiedlern leben und wie man mich versichert hat, verstehen sich die Leute drüben nicht auf die Whiskeybrennerei, die einen eigenen Kunstgriff erfordert; also würden Sie ihn aus diesem Grunde dort um so leichter verkaufen.“
„Aber er würde sich, selbst wenn wir einen Prahm benutzten, beim Umzuge sehr schwierig fortschaffen lassen.“
„Im Gegenteil, ich wüsste nichts, was sich leichter per Achse oder per Boot transportieren ließe. Sie werden gewiss keine halbe Wagenladung mitzunehmen haben und er wird Ihnen drüben noch einmal so viel einbringen, als hier.“
„Das ist alles recht schön gesagt, indessen wer garantiert mir dafür?“
„Ach, sehen Sie denn nicht ein, dass der Whiskey da, wo man ihn nicht gut herzustellen versteht, auch höhere Preise erzielen würde, als hier?“
„Freilich sehe ich das ein und gebe zu, dass er sich möglicherweise in Indiana besser verwerten ließe – doch das müsste er auch, denn es ist kein Kinderspiel, ihn dorthin zu schaffen. Trotzdem aber würde es mir lieber sein, wenn Sie ihn hier auf eine oder die andere Weise zu Geld machen und die Farm bar bezahlen könnten.“
„Ich wüsste nicht, wie ich das zustande bringen sollte“, entgegnete Colby, „habe ich doch bereits alles Mögliche versucht. Die Wahrheit zu gestehen, sind die Leute in unserer Gegend samt und sonders reichlich mit Whiskey versorgt, und wenn ich ihn im Lauf der Zeit auch ohne Zweifel zu gutem Preise werde verkaufen können, ist mir damit diesen Augenblick nicht geholfen.“
„Freilich nicht; aber wenn ich gleich fest entschlossen bin, die Farm unter einigermaßen annehmbaren Bedingungen zu verkaufen, war ich nicht darauf vorbereitet, einen solchen Handel abzuschließen, wie Sie in Anregung bringen. Es wird daher am zweckmäßigsten sein, wenn sie sich das Grundstück noch einmal genau ansehen. – Sie brauchen nicht weit zu gehen, der Acker liegt nahe beim Hause – und ich will derweil die Sache mit meiner Frau besprechen und mir überlegen, ob ich auf ihr Anerbieten eingehen kann.“
Mit diesen Worten führte Lincoln seinen Besucher ins Freie und überließ ihm die Besichtigung der Farm, deren Grenzen er genau angedeutet hatte; er selbst aber schickte sich an, mit seiner Frau zurate zu gehen. Der Vorschlag, das Gehöft gegen Whiskey einzutauschen, war in Mrs. Lincolns Augen ein so ungewöhnlicher und komischer, dass sie belustigt ausrief: „Welch ein merkwürdiger Handel; ich habe nie von etwas Ähnlichem gehört!“
„Ich auch nicht“, erwiderte ihr Gatte, „verkaufen aber muss ich die Farm auf jeden Fall, und dies dürfte die letzte Gelegenheit sein, die sich mir diesen Herbst bietet.“
„Du hast recht; so lass uns die Sache reiflich überlegen. Vielleicht verkauft der Whiskey sich in Indiana schneller, als wir erwarten; doch will ich deinem Urteile nicht vorgreifen, du musst nach eigenem Ermessen tun, was dir am besten dünkt.“
„Nun denn, am besten wäre es, meiner Meinung nach, wenn wir einen Kauf zu annehmbaren Bedingungen abschließen könnten,, und wenn ich denken müsste, dass sich außer dieser Gelegenheit jetzt keine andere mehr bieten dürste, würde ich den Whiskey anstatt baren Geldes nehmen und es darauf ankommen lassen, ob er drüben leicht oder schwer verkäuflich.“
„In diesem Herbst wird sich dir kaum eine zweite Gelegenheit zum Verkaufe bieten. Du weißt, wie selten in dieser Gegend derlei Nachfragen angestellt werden.“
„Dann“ entgegnete Mr. Lincoln, wie ratlos ins Blaue starrend, „dann werde ich mich – falls er wirklich nicht alles in klingender Münze auszahlen kann – doch entschließen müssen, den Whiskey zu nehmen.“
„Tue, was du für geraten hältst“, versetzte seine Gattin. „Du kannst besser beurteilen, als ich, ob es zweckdienlich ist.“
Mr. Lincoln begab sich zu dem draußen weilenden Mann und als er sich überzeugt, dass ihm nur die Wahl bliebe, den Whiskey zu nehmen oder auf den Verkauf zu verzichten, erkundigte er sich nach dem Preise des Branntweins, über den sie noch nicht gesprochen hatten.
„Wie hoch berechnen Sie die Kanne?“ fragte er. „Sie werden ihn mir natürlich etwas billiger lassen, da ich Ihnen eine so große Menge abnehme.“
„Das versteht sich; ich gebe Ihnen die Kanne um fünf Cents billiger, als ich sie sonst im Fass zum Großhandels-Preis verkaufe.“
„Damit bin ich zufrieden, und nun lassen Sie mich nachrechnen, wieviel es ausmachen wird.“
Mr. Lincoln, der sich, wie wir hörten, nie mit dem Studium der Rechenkunst abgegeben, wohl aber im praktischen Leben einigermaßen mit Zahlen umzugehen gelernt hatte, fing an, sich die Summe im Kopfe zusammenzustellen. „Siebzig Cents die Kanne“, sagte er laut, „macht – lass mich sehen, siebzig Cents die Kanne macht –“
„Ach, hundert Kannen machen siebzig Dollar“, unterbrach ihn Colby, „und vierhundert Kannen würden auf zweihundert und achtzig Dollar kommen.“
„Richtig, – vierhundert Kannen Whiskey und den Rest in barem Geld.“
„So ist's; es werden gerade zehn Fässer, von denen jedes vierzig Kannen hält und zwanzig Dollar zahle ich bar aus.“
„Schon recht, ich gehe auf den Handel ein. Wann wollen Sie die Zahlung leisten?“
„Sobald sie von hier aufzubrechen denken.“
„Das wird ungefähr am ersten November sein; indessen muss ich den Whiskey und das Geld eine Woche früher haben, damit wir alle Vorbereitungen zur Abreise treffen können.“
„Wohlan, so lassen Sie uns den Zahlungstermin acht Tage früher festsetzen. Ich werde mich rechtzeitig einstellen, ja, wenn Ihnen damit gedient sein sollte, kann ich den Whiskey auch schon eher bringen.“
„Richten Sie das ein, wie es Ihnen am besten passt“, entgegnete Mr. Lincoln. Damit war die Sache abgetan und Colby machte sich auf den Heimweg.
Es war ein wunderlicher Handel, ein kleines Gehöft um zehn Fässer Whiskey und zwanzig Dollar in Gold zu verkaufen, der jedenfalls den Beweis liefert, dass Abraham Lincolns Vater sich keines großen Besitzes an irdischen Gütern zu erfreuen hatte. Aber schlimmer als dies, welche trübe Aussichten für den Knaben hätten sich möglicherweise an den Erlös aus dem väterlichen Grundbesitz knüpfen können; sehen wir doch täglich, wie Haus und Hof verschuldet und verschleudert werden, weil der Eigentümer sich dem Trünke ergeben. Das war zum Glück hier nicht zu befürchten. Mr. Lincoln besaß keinen Hang zum Genuss geistiger Getränke, die er. wie allgemein üblich, in geringer Quantität zu sich nahm; dem Übermaße im Trinken aber war er von Herzen feind. Würde uns heutzutage ein solches Geschäft in einem eigentümlichen, ja geradezu verdächtigen Lichte erscheinen, so war das bei der damaligen Bevölkerung des Urwaldes durchaus nicht der Fall.
Weder der Verkauf, noch der Genuss von Whiskey kamen ihnen als etwas Bedenkliches vor. In Kentucky existierten zur Zeit noch keine Mäßigkeitsvereine, die selbst da, wo sie in Neu-England im Auftauchen begriffen, noch nicht die strenge Forderung gänzlicher Enthaltsamkeit von Spirituosen in sich schlossen, eine Forderung, die sich erst fünfzehn Jahre später geltend machte, um der überhandnehmenden Trunksucht entgegenzuwirken. Die Zeit bis zum Wegzug war kurz und die Vorbereitungen mussten beschleunigt werden, weil Colby seinen Besitz sobald wie möglich anzutreten wünschte. Mr. Lincoln beeilte sich deshalb, Hab und Gut nach Indiana zu bringen und dann wieder zurückzukommen, um Frau und Kinder zu holen. Da er jedoch kein Boot besaß, blieb ihm nichts übrig, als einen Prahm zu bauen, eine Arbeit, die ihn, trotzdem er Erfahrung in dem Fache hatte, mehrere Tage lang unausgesetzt in Anspruch nahm.
Endlich waren die Umzugsangelegenheiten geordnet, Colby hatte den Whiskey gebracht und die Geldsumme ausgezahlt und nun schritt man zum Verladen. Vor allen Dingen wurden Mr. Lincolns Handwerksgeräte, dann die Töpfe und Kessel, die rohbehauen Tische und Sessel und endlich die Fässer mit Whiskey auf den Prahm geschafft und daneben die mancherlei Sachen besorgt, die ein solcher Aufbruch allezeit in sich schließt.
Mrs. Lincoln, Sarah und Abraham, die den Bau des Fahrzeuges mit besonderem Interesse beobachtet hatten und nicht vom Ufer wichen, als es von Stapel gelassen und beladen wurde, harrten dort solange aus, bis das kunstlose Boot ins tiefere Wasser geschoben und, stromabwärts treibend, ihren Augen entschwunden war.
Die Fahrt ging eine Zeit lang glücklich von statten. Air. Lincoln gelangte mit seinem Prahm in den Ohiostrom, und da ihm weder Wind noch Wetter Gefahren in den Weg legten, wollte er sich schon über den günstigen Erfolg seines Unternehmens Glück wünschen, als ihm plötzlich ein Unfall begegnete. Infolge einer kleinen Unvorsichtigkeit geriet das Fahrzeug ins Schwanken und die dadurch in Bewegung versetzten Fässer rollten der einen Seite zu, was den Prahm völlig aus dem Gleichgewicht brachte. Mr. Lincoln sprang schnell auf die andere Seite, um wenn irgend möglich sein Boot zu retten, doch zu spät! Die schweren Fässer gaben den Ausschlag, das Fahrzeug kippte um und er samt seinen Besitztümern lagen im Fluss. Mochte das nun auch der beste Platz für den Whiskey sein, so war die Lage des Mannes doch sehr bedenklich; indessen klammerte er sich ans Boot und hielt sich dadurch über Wasser.
„Lasst nicht los“, rief einer von den am Ufer beschäftigten Arbeitern ihm zu. „Lasst nicht los, wir kommen Euch zuhilfe.“
„Dann macht so schnell ihr könnt“, erwiderte Lincoln, „ich werde mich nicht lange festhalten können.“
„Wir sind im Nu bei Euch“, hieß es zum Troste, und damit liefen sie auf ein nahes Boot zu, lösten geschwind das Tau, und schnell rudernd, hatte einer von ihnen bald das verunglückte Fahrzeug erreicht, wo er Mr. Lincoln aus seiner misslichen Lage befreite.
„Euch ist's schlimm ergangen“, meinte der Ruderer.
„Es hätte weit schlimmer ausfallen können“, entgegnete Mr. Lincoln. „Mir ist's, als hätte ich besonderes Glück gehabt, da mir der Unfall hier begegnete, wo gleich Hilfe zur Hand ist.“
„Aber Ihr habt Eure Ladung verloren. Übrigens wird es möglich sein, einiges davon zu retten, wir müssen uns sofort an die Arbeit machen.“
„Dabei wird, fürchte ich, nicht viel herauskommen, der Strom ist hier gewiss zehn bis fünfzehn Fuß tief.“
„Nein, nein, .so tief ist er nicht, aber selbst wenn es der Fall wäre, müssten wir doch den Versuch machen, etwas zu retten.“
Mittlerweile hatten sie das Ufer erreicht, und nun berieten die Männer miteinander, wie sie Lincolns Fahrzeug wieder flott machen und die versunkenen Schätze aus dem Wasser herausfischen könnten. Solcher Art Unfälle waren auf dem Ohiostrom keine seltene Erscheinung, die Uferbewohner hatten schon manchem in Gefahr schwebenden Abenteurer die helfende Hand entgegengestreckt, und bei dieser Gelegenheit säumten auch Lincolns Retter nicht, ihre Pläne zu fassen und auszuführen.
Vor allen Dingen bemühten sie sich, den Prahm festzumachen, und als ihnen dies gelungen, setzten sie ihn wieder instand. Daraus schritten sie zur Rettung der untergegangenen Ladung, soweit sich dieselbe bewerkstelligen ließ. Unter dem Beistand anderer Leute aus der Nachbarschaft und mit Hilfe der einfachen Werkzeuge, die ihnen zu Gebote standen, durchsuchten sie den Fluss und brachten einen Teil des Handwerksgerätes, Äxte, einen eisernen Kochtopf und ein paar andere Gegenstände ans Ufer, ja sie setzten ihre Bemühungen mit solcher Ausdauer fort, dass sie sogar drei Fässer Whiskey retteten. Sobald die Sachen aufgeladen waren und Lincoln seinen freundlichen Helfern für ihren Beistand gedankt, machte er sich wieder auf die Fahrt, hatte jedoch nicht unterlassen, vorher genaue Erkundigungen über den in Aussicht genommenen Weg einzuziehen. Nach allem, was man ihm mitgeteilt, schien es das ratsamste, bei der Thomsonsfähre anzuhalten und seine Habe von dort auf einem Karren ins Innere des Landes zu schaffen, wo er, wie schon erwähnt, eine bestimmte Gegend zur Ansiedelung ins Auge gefasst hatte.
Er setzte also seine Stromfahrt nicht weiter, als bis zur Fähre fort und fand hier einen Mann, namens Posey, welcher der Gegend kundig und auch erbötig war, ihn achtzehn (engl.) Meilen weit in die jetzige Grafschaft Spencer zu bringen.
„In die Gegend hinein führt keine Fahrstraße“, versetzte er auf Mr. Lincolns Frage. „Wir werden uns den Weg selbst bahnen und dabei gelegentlich von unserer Art Gebrauch machen müssen.“
„Das tut mir leid“, entgegnete Mr. Lincoln. „Haben sich dort noch keine Ansiedler niedergelassen?“
„Ja, hier und da einer, und die werden froh sein einen neuen Ankömmling zu sehen. Wir wollen uns, wenn Sie damit einverstanden sind, schon durcharbeiten.“
„So lassen Sie uns drauf losgehen, ich trage kein Bedenken“, erwiderte Lincoln.
Als Entschädigung für den Transport des Haus- und Handwerksgerätes willigte Posey ein, den Prahm zu übernehmen, der für den bisherigen Besitzer keinen Wert mehr hatte, dem neuen Eigentümer aber gerade sehr zustatten kam. So war denn alles in Ordnung gebracht, und als sie den Ochsenkarren beladen hatten, begaben sie sich auf den Weg, mussten aber schon nach halbstündiger Wanderung zu den Äxten greifen, um einen Pfad zu bahnen.
„Habe ich's nicht vorhergesagt!“ rief Posey aus. „Mir ist's auf dem Wege zur Mühle gerade so ergangen.“
„Wie weit, glauben Sie, werden wir uns durch solch' Dickicht durcharbeiten müssen?“ fragte Lincoln.
„Ziemlich weit, fürchte ich; wir sind hier in einer regelrechten Wildnis.“
„Nun denn, je frischer wir alsdann drauf losgehen, um so eher kommen wir ans Ziel.“ Und ohne sich weiter aufzuhalten schwangen beide die Äxte und bahnten einen Weg.
„Ich habe meilenweit Pfade durch ebensolche Dickicht gebrochen“, bemerkte Posey, „es sollte mich nicht wundern, wenn wir diese Arbeit auf der halben Strecke fortsetzen müssten.“
„Das hoffe ich nicht“, entgegnete Lincoln, „sonst würde ich mich nach Kentucky zurückwünschen. Es müsste ja eine endlose Arbeit sein, bis zu dem Platz durchzudringen, den ich zum Wohnort erwählt habe.“
„Nun, verlieren Sie nicht den Mut; so schlimm, wie hier, wird es nicht lange bleiben, doch sauer genug ist die Arbeit trotz alledem.“
Mit der Entschlossenheit erprobter Pioniere drangen sie vor, ab und an wegsames Terrain findend, wo sie ohne Gebrauch der Axt weiterschreiten konnten, dann aber wieder zum Stillstehen gezwungen, bis sie einen Pfad durch das vor ihnen liegende Dickicht gebahnt. Unter diesen Umständen ist es nicht befremdlich, wenn wir hören, dass sie mehrere Tage brauchten, um die verhältnismäßig kurze Strecke von achtzehn (engl.) Meilen zurückzulegen. Es war eine angreifende Wanderung voll Schwierigkeit und Mühsal, und Mr. Lincoln versicherte später oftmals, jenes Wegbahnen von Thomsons Fähre bis zur Spencer County sei das sauerste Stück Arbeit gewesen, das er je im Leben vollbracht.
Ein paar Meilen südlich von ihrem Reiseziel trafen sie endlich auf die Hütte eines gastfreien Kolonisten, der sie herzlich willkommen hieß und mit Speise und Trank erquickte, so gut sein einfacher Haushalt beides aufzuweisen hatte. Er kannte den Distrikt aufs Genaueste und riet Mr. Lincoln, sich an einem bestimmten Platz ansässig zu machen, zu dem er ihn selbst geleiten wolle. Dieser war froh, das Ziel seiner Wanderung erreicht zu haben und fand den Ort, welchen sein neuer Freund Wood ihm zur Wohnstätte vorschlug, außerordentlich einladend.
„Er ist besser, als ich erwartet habe!“ rief Lincoln aus. „Ich kann mir keinen besseren Platz wünschen.“
„Der Ansicht war ich auch“, entgegnete Wood, „ich habe ihn schon seit längerer Zeit ins Auge gefasst.“
„Hier ist übrigens noch viel Raum für andere Kolonisten“, fuhr Lincoln fort; „nach achtzehn Meilen Weges die erste Hütte zu finden, lässt auf keine dichte Bevölkerung schließen.“
„Die haben wir hier auch nicht“, erklärte Posey.
„Die Einwanderung nimmt zwar bedeutend zu, doch bleibt noch immer Raum genug für neue Ankömmlinge.“
„Und ganz einsam werden Sie sich trotz der spärlichen Bevölkerung nicht fühlen“, versicherte Mr. Wood, „Sie haben mehrere Nachbarn, die nicht allzu ferne wohnen; eine Familie lebt nur zwei Meilen von hier gegen Osten zu. und innerhalb sechs oder acht Meilen gegen Norden und Westen finden Sie noch zwei andere Farmer. Der freie Staat lockt eine Menge Ansiedler her.“
Posey kehrte mit seinem Gespann zur Thomsonsfähre zurück, und nachdem Mr. Lincoln seine Habe untergebracht und Mr. Woods Obhut anvertraut hatte, trat er die Heimreise zu Fuße an.
Die Entfernung zwischen dem alten Wohnorte in Kentucky und dem neuen in Indiana betrug in gerader Linie ungefähr hundert (engl.) Meilen, doch war der Weg, auf dem er gekommen, fünfundzwanzig Meilen weiter. Jetzt schlug er den kürzeren Weg ein und erreichte nach Verlauf dreier Tage die Grafschaft Hardin.
Hier wurde er mit großer Herzlichkeit von den Seinen willkommen geheißen; Abraham war ganz Ohr, als der Vater seine Erlebnisse mitteilte, und mehr als alles andere erregte das Abenteuer auf dem Ohiostrom sein lebhaftes Interesse.
Indessen blieb ihnen vor der Hand nicht viele Zeit zum Fragen und Erzählen; man machte sich eilends daran, die Betten und Kleider, die Mr. Lincoln nicht mitgenommen, auf zwei bereitgehaltene Pferde zu packen und brach dann auf.
Mrs. Lincoln, ihre Tochter und Abraham ritten den größeren Teil des Weges, legten jedoch auch abwechselnd kürzere Strecken zu Fuß zurück; trotzdem nahm die Reise eine ganze Woche in Anspruch, während welcher sie nachts in wollene Decken gehüllt und am Boden liegend, unter dem sternenhellen Himmel schliefen.
Das war nun selbst für sie eine neue und eigenartige Erfahrung, die möglicherweise bedenkliche Folgen nach sich ziehen konnte. Aber sie kannten keine Furcht, denn zu jener Zeit gestatteten weder Männer noch Frauen in diesen Landesteilen sich, vor Gefahren zurückzubeben.
Der Zaghaftigkeit unserer heutigen Frauenwelt gegenüber berührt uns der Heldenmut des weiblichen Geschlechtes jener Tage wie etwas Wunderbares. An Not und Mühsal gewöhnt, hatten sie gelernt, auch drohende Gefahren ruhig ins Auge zu fassen und große Entbehrungen als notwendige Zugabe des Pionierlebens zu betrachten. Erlebnisse, die jetzt das Glück der meisten Frauen zerstören würden, dienten nur dazu, bei ihnen den Mut und die tapferen Eigenschaften zu entfalten, die sie besonders für die Aufgabe geeignet machten, welche Gott ihnen zugewiesen. Es sind uns aus der Geschichte unseres Landes viele Tatsachen bekannt, die den Heldenmut des weiblichen Geschlechtes damaliger Zeit in den westlichen Staaten illustrieren. Bald nachdem Abrahams Großvater sich in Kentucky niedergelassen, trat ein mit Flinte und Tomahawk bewaffneter Indianer in eines Mr. Davieß Hütte, um sie auszurauben und die Familie fortzuschleppen. Mrs. Davieß war mit ihren Kindern allein. Mit großer Geistesgegenwart forderte sie den braunen Gast auf, ein Glas Whiskey zu trinken und stellte die Flasche vor ihn hin. Der Indianer lehnte die Flinte an den Tisch, um das Glas zu füllen, doch kaum hatte er die Flasche emporgehoben, so ergriff Mrs. Davieß sein Gewehr, legte es auf ihn an und drohte, ihm die Kugel durch den Kopf zu jagen, wenn er sich nicht ergebe. Starr vor Schrecken, ließ der Wilde die Flasche aus der Hand gleiten, setzte sich eingeschüchtert auf einen Sessel und versprach, niemandem etwas zuleide zu tun, wenn seine Gegnerin nicht auf ihn feuern wolle. In dieser Stellung hielt sie ihn, bis ihr Mann nachhause kam.
In einem anderen Falle sehen wir das Haus eines Air. Merrill nachts von mehreren Indianern angegriffen und den Familienvater, der sich an die Haustür gewagt, schwer verwundet niedersinken. Da die Wilden den Versuch machen, ins Innere zu dringen, bietet Mrs. Merrill alle Kräfte auf, ihnen dies zu wehren und unter dem Beistand ihrer Tochter gelingt es ihr, die Tür vor ihnen zu verschließen. Voll Ingrimm hauen die Indianer ein Loch in die Tür, groß genug, um einem zurzeit das Hineinschlüpfen zu gestatten. Aber unverzagt trotz des Schmerzensgestöhnes ihres Gatten und seines Blutverlustes und unbeirrt durch ihrer Kinder Angstgeschrei, ergreift Mrs. Merrill eine Axt und erteilt dem ersten Eindringling, sobald er sich weit genug durch die Öffnung gezwängt, den Todesstreich. Dann zieht sie seinen Körper in die Hütte herein und wartet auf das Erscheinen eines zweiten Wilden. Hocherfreut, dass ihrem Kameraden der Eintritt gelungen, beeilen die Indianer sich, ihm zu folgen und werden ihres Irrtums nicht eher gewahr, bis vier von ihnen in dieser Weise beseitigt sind. Da klettern zwei in blinder Wut auf das Dach und versuchen, durch den Schornstein ins Innere zu gelangen; indessen heißt die Mutter ihre Kinder schnell das Stroh aus entern Bette aufs Herdfeuer schütten, und Rauch und Flammen bringen die Wilden bald halb erstickt in die Hütte herab. Mit äußerster Kraftanstrengung erhebt der verwundete Vater sich vom Boden und tötet diese beiden mit seinem Beil.
Derartige Geschichten ließen sich nach hunderten erzählen, wir haben diese nur angeführt, um zu zeigen, welche mannhafte Stärke die Frauen des Westens damals in verhängnisvollen Lagen entwickelten. Mrs. Lincoln war, wie ihre Pionierschwestern, eine entschlossene, furchtlose Frau und ertrug daher die mit der Reise verknüpften Beschwerden, ohne ein bängliches Zagen vor möglichen Gefahren zu hegen.
Als sie sich ihrem Bestimmungsorte auf zwei (engl.) Meilen genähert hatten, kamen sie zu der Hütte ihres nächsten Nachbars, eines Mr. Reale, der sie mit großer Freundlichkeit begrüßte und sich erbot, ihnen folgenden Tages bei Errichtung ihrer Hütte zu helfen. Das herzliche Entgegenkommen dieses Mannes machte auf alle einen wohltuenden Eindruck, und frohen Herzens legten sie sich abends, in ihre Decken gerollt, zum Schlafe nieder.
Wenn wir diese anscheinend unwichtigen Einzelheiten in unserer Erzählung ausführlicher mitgeteilt, so ist es geschehen, weil gerade die angeführten Erlebnisse viel beitrugen, in Abraham den Mut, die Energie und Ausdauer zu entwickeln, durch die er sich in späteren Jahren auszeichnete.





























