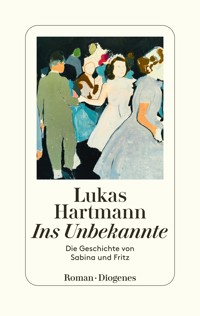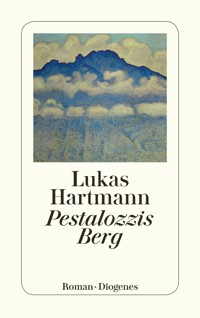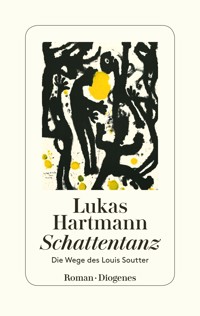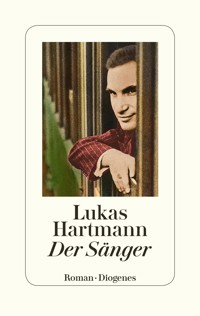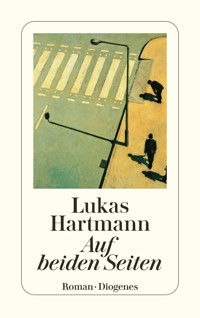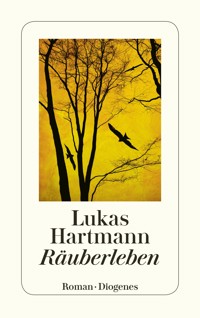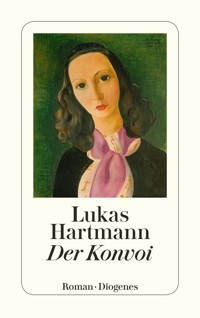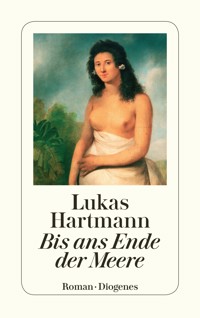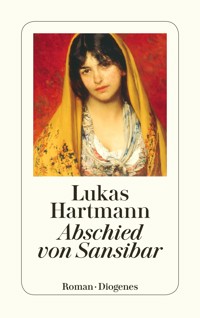
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Prinzessin von Sansibar, die mit einem Hamburger Kaufmann durchbrennt. Mit dieser verbotenen Liebe beginnt Ende des 19. Jahrhunderts die Saga einer west-östlichen Familie zwischen Europa und der arabischen Welt. Ein historischer Roman nach der wahren Geschichte von Emily Ruete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Lukas Hartmann
Abschiedvon Sansibar
Roman
Die Erstausgabe erschien
2013 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: Eugen von Blaas,
›Junges Mädchen mit Schleier‹, 1882 (Ausschnitt)
Copyright © Sotheby's/akg-images
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24297 3 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60336 1
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Ich verließ meine Heimat als vollkommene Araberin und als gute Mohammedanerin, und was bin ich heute? Eine schlechte Christin und etwas mehr als eine halbe Deutsche.
Emily Ruete,›Briefe nach der Heimat‹
Der ist in tiefster Seele treu, der die Heimat liebt wie du.
Theodor Fontane,Spruch auf Emily Ruetes Grabplatte
[7] 1
An Seine Hoheit, Sultan Bargash ibn Said ibn Sultan. Friede sei mit Dir, mein Bruder. Ich bitte Gott und Dich, dass Du nicht Dein Gesicht von mir abwendest, bevor Du diesen Brief gelesen hast. Du solltest Dein Herz nicht gegen mich und meine Kinder verhärten. Du solltest nicht denken, dass ich in Europa in schlechtem Ansehen stehe. Das Gegenteil ist der Fall.
Da saß er, wie jeden Nachmittag seit seiner Ankunft. Er liebte den Blick hinaus auf den See und zu den Bergen. Für den Balkon, oben im vierten Stock, war es im März noch zu frisch. Aber er hatte den Sessel nahe ans Doppelfenster gerückt, das eine Sicht von der Rigi bis zum Pilatus erlaubte. Draußen ging ein leichter Wind. Der See war mit Kräuselspuren überzogen, Wolkenschatten glitten darüber hin. Wenn die Sonne durchbrach, wurde das Wasser zum blendenden Spiegel, und zugleich erschienen in der halbseitig beschatteten Fensterscheibe Züge seines Gesichts, in denen er sich kaum erkannte. Man will so schwer ans Altwerden glauben. Er musste sich vorsagen, dass er fast achtzig war, es blieb ihm nicht viel Zeit. Über dem See und dem Blaudunkel der Berge schoben sich Wolken in- und auseinander, als folgten [8] sie unwillig den Befehlen eines Regisseurs. Er schloss die Augen und sah nun nicht mehr den See vor sich, sondern die Wüste frühmorgens, eine Dünenlandschaft, scharf geteilt in Licht und Schatten, jemand ritt auf einem schneeweißen Esel der Sonne entgegen. Wie oft war er in Wüsten gewesen. Die Briten hätten in Palästina ein wirksames Bewässerungssystem entwickeln müssen, seine Idee vom Baumwollanbau in großem Stil hätte die Konflikte zwischen Juden und Arabern verringert. Ein Träumer war er gewesen, das hatten ihm oft genug die Mutter und die Schwestern vorgeworfen, ein kränklicher Junge, und nie war er zu der Bedeutung gelangt, die er angestrebt hatte.
Vier Uhr schon meldeten die Glockenschläge der Hofkirche, von denen die Fensterscheibe erzitterte; seine Finger, die das kühle Glas berührten, spürten die Vibration. In der Ferne zeigte sich das Nachmittagsschiff, das mit rauchendem Schornstein auf die Anlegestelle vor dem Hotel Schweizerhof zuhielt. Das war sonst das Zeichen, sich wieder an den Schreibtisch zu setzen. Heute tat er es nicht. Neben anderen Briefen lag dort einer, den er gestern erhalten hatte. Die Sterbeurkunde war fast zehn Monate durchs zerstörte Deutschland geirrt. Er hatte es geahnt, nun kannte er die Wahrheit: Seine Schwester Antonie war am 24.April 1945 gestorben, im Bombardement britischer Flugzeuge, das kurz vor Kriegsende die Kleinstadt Bad Oldesloe bei Hamburg zerstört hatte. Die Engländer, deren Landsmann er aus eigener Wahl geworden war, hatten seine Schwester, die halbarische Deutsche, getötet. Was für eine himmeltraurige Ironie!
[9] Antonie, für ihn lange nur Tony. Das Mädchen mit dem blaukarierten Schürzenkleidchen hatte er über alle Maßen geliebt, es hatte ihn, obwohl nur ein Jahr älter als er, getröstet, wenn die Mutter an dunklen Wintertagen mit niemandem reden wollte und im Bett noch unter zwei Decken fror. Eine dritte breitete der kleine Junge bisweilen über sie, seine eigene, und in ihrem Zustand bemerkte sie es nicht einmal. Später wurde ihm Antonie fremder, sie heiratete Brandeis, den chauvinistischen Wichtigtuer, dann verschwand sie für lange Jahre mit ihm in der Südsee, im deutschen Kolonialgebiet. Nach der Kristallnacht, 1938, hatte er sie nicht mehr gesehen, auch Rosalie nicht, die jüngere Schwester. Eine auseinandergebrochene Familie wie hunderttausend andere in diesem unseligen Europa. Als der Krieg zu Ende war, wollte er zumindest erfahren, ob die Schwestern noch lebten. Er hatte, von London und der Schweiz aus, Briefe an ihre Vorkriegsadressen geschrieben, an die Besatzungsbehörden, an die Suchstellen. Und nun war eine Antwort eingetroffen, eine endgültige.
Es gab Tage und Wochen, da war Tony seine wichtigste Stütze gewesen. Der Vater fehlte ja im Haushalt; von ihm kannte er nur die Fotografien, die in schmalen Goldrahmen auf dem Kommodenaufsatz standen. Wie inständig hatte Tony die Geschwister ermahnt, nicht laut zu sein, wenn die Mutter an ihrem Heimweh litt, wie oft hatten sie versucht, ihr Lachen zu zügeln, wenn die Lebenslust in ihnen durchbrach! Die Wohnungen, an die er sich erinnerte, waren düster. Man stieß sich an den Möbeln, so eng standen sie in den kleinen Zimmern. Die Zärtlichkeitsanfälle der Mutter, wenn sie endlich wieder aufstand, man glaubte zu ersticken in ihren Umarmungen. »Ihr seid mein Ein und Alles«, immer [10] wieder dieser Satz in ihrem harten und dennoch singenden Deutsch. Er kann ihn sich halblaut vorsagen: »Ihr seid mein Ein und Alles«, und gleich ist wieder diese Beklemmung da, auch nach siebzig Jahren. Er möchte die Zärtlichkeit erwidern, hat Angst davor, lässt die Arme hängen. »Mein Said! Mein Said! Was bist du für ein stiller Junge!« Die Gesichter der Dienstmädchen, die sich vor das der Mutter schieben und zu einem einzigen werden, keines mehr würde er wiedererkennen. Was er anschauen wollte, war IHR Gesicht: so blass oft, diese lange schmale Nase (eine Prinzessinnennase, sagte er sich später), und wie konnte ihn schon die Andeutung eines Lächelns froher machen. Tony brachte ihr Tee ans Bett. Den schwachen Kaffee, den man in Deutschland trank, mochte sie nicht: »Eine Brühe. Das nennt man doch Brühe, ja?« Manchmal fragte er sich, ob Tony ihr glich, ob sie werden wollte wie die Mutter, denn sie ging ebenso leise durch die Zimmer, hielt den Kopf ein wenig schief, ein wenig gesenkt, genau wie sie. Rosa indessen, die Kleine, kämpfte um Aufmerksamkeit, sie war draller als Tony, drängte sich in den Vordergrund, wo es ging. Die Mutter wies sie zurecht, dann weinte sie in hohen, durchdringenden Tönen.
Er, Said, weinte nie laut, ihm liefen einfach die Tränen über die Wangen. Bei jedem Umzug durchnässten Tränen den Hemdkragen. Die Dienstmädchen tadelten ihn deswegen. Tony trocknete ihm mit ihrem Taschentuch das Gesicht; kleine Taschentücher mit Spitzenbesatz hatte sie, die sie sorgsam auseinander- und wieder zusammenfaltete. Diese Sorgfalt stets.
Said war vier, als sie von Hamburg wegzogen, ein undeutliches Bild von der Eisenbahnfahrt nach Dresden, [11] Gerumpel, Rauchgeruch, der barsche Ton des Schaffners. Ölsardinen wollte Said nicht essen, hartes Brot auch nicht, man musste ihn streng ermahnen. So wenig Licht in der neuen Wohnung. Eine alte Dame kam häufig zu Besuch und hob ihm das Kinn hoch, sie nannte die Mutter beim Vornamen: Emily, sie war eine Baronin, eine Gönnerin, das verstand er später. Tony brachte Said das Alphabet bei, das sie selbst von einem der Kindermädchen gelernt hatte, sie sang ihm das ABC-Lied vor, und Rosa sang es mit, aber voller Fehler. Die Mutter hatte wenig Geduld, wenn sie Said etwas beibringen sollte, sie hatte ja selbst Mühe mit dem Schreiben, manchmal schrieb sie etwas in rätselhaften Zeichen und von der falschen Seite her. Das waren Zeiten, in denen sie hoffnungsvoll wirkte, gar überschwenglich. Wenn Emily sang, klang es fremd, Schleiftöne, Kehllaute; man verstand nicht, worum es in ihren Liedern ging. Um Liebe, sagte sie einmal, um nichts als um Liebe.
Sie ging nicht gerne in Kirchen, die Geschwister aber, alle drei, liebten es, im Kerzenglanz der Frauenkirche vom Orgelspiel umbraust zu werden. Dort drin saßen sie an hohen Feiertagen, unter einem steinernen Himmel. Als sie auch Dresden verließen, vermisste Said am meisten diesen Weihnachtsglanz. Das Bild in einer Illustrierten, das er kürzlich gesehen hatte, zeigte eine Ruine mit eingestürzter Kuppel. Er, Rudolph, wie er sich seit langem nannte, hatte es kommen sehen, er hatte gewarnt vor der neuen Schlächterei, doch die Wand an Ignoranz, an Fanatismus und Überheblichkeit war undurchdringlich gewesen. Wer hätte je gedacht, dass einmal Tausende von Bomben über Deutschland niederregnen würden?
[12] Said, Rudolphs erstes Ich, begriff schon als Achtjähriger vieles. Die Mutter musste sparen, auch die Wäsche besorgte sie nun selbst und zeigte den Kindern halb lachend, halb empört ihre rot geschwollenen Hände. Im kleinen Rudolstadt, wo sie sich nun niederließen, war alles billiger zu bekommen. Schon in Dresden hatten die Leute anders gesprochen als in Hamburg, und hier sagten sie »nisch« statt »nicht« und sangen beinahe beim Reden, und Emily meinte, sie müsse die deutsche Sprache noch einmal neu erlernen.
Sie hatte Geheimnisse, die Mutter, die Geschwister versuchten sie, nachts in ihrem Zimmer, flüsternd aufzudecken. Emily kam von weither, aus Afrika, eigentlich hieß sie Salme oder Salima, das wussten sie, und es gab Leute, die sie deswegen auf der Straße anstarrten oder stehen blieben und mit erzwungener Freundlichkeit grüßten.
Die drei gingen jetzt zur Schule. Der tägliche Gang durch die Gassen von Rudolstadt schweißte sie zusammen gegen die Spottlustigen und Neugierigen, die ihnen nachliefen, sie umringten und fragten, warum sie keinen Vater hätten und die Mutter sich verstecke. Sie waren klug und fleißig; den Rückstand aufs Schulpensum holten Tony und Said rasch ein, und Rosa, die Jüngste, kam gerade in die erste Klasse. Ein älterer Junge wollte sich ihnen anschließen. Er roch schlecht, sein Vater war Gerbermeister, doch er war begabt im Zeichnen, der Begabteste weit herum. Er konnte Gesichter so zeichnen, dass man sie auf dem Papier wiedererkannte, und in der zweiten oder dritten Schulwoche forderte er die Geschwister auf, ihm Modell zu stehen, nur eine halbe Stunde, ihre Mutter sei doch eine Prinzessin, die Zeichnung wäre dann eine schöne Erinnerung an die Prinzessinnenkinder. [13] »Ach was, du bist meschugge«, sagte Tony, solche Wörter hatten sie in Dresden gelernt. Und alle drei schüttelten den Kopf und ließen ihn stehen. Der Junge rief ihnen nach: »Sie ist sowieso eine Negerprinzessin, das sagen alle. Da braucht ihr euch nüscht drauf einbilden.« Und als ob jemand sie herbeigehext hätte, standen plötzlich zwei Mädchen neben ihm und übertönten ihn noch mit ihrem »Es ist wahr, was er sagt, es ist wahr!« – »Nicht wahr, ganz falsch!«, schrie Tony zurück. Rosa packte Saids Hand und ließ sie nicht los; kein Wort mehr wechselten sie, bis sie zu Hause waren, und dort erzählten sie, durcheinanderredend, der Mutter, was geschehen war, und fragten sie, weshalb die Schulkinder auf eine so dumme Idee kämen. Prinzessinnen hatten doch, wie im einzigen Märchenbuch, das sie besaßen, eine durchscheinende Haut und lange blonde Haare, und sie trugen Kleider aus Seide mit goldenen Bändern. Zum Zerspringen schlug Saids Herz, als die Mutter in Tränen ausbrach und sagte, doch, es sei wahr. Von Geburt sei sie eine Prinzessin, ihr Vater habe als Sultan über die Insel Sansibar geherrscht. Wegen Heinrich habe sie auf ihr Prinzessinnenleben verzichtet und ihre Heimat verlassen, das werde sie den Kindern später genau erzählen, aber nicht jetzt, sie müssten älter werden, um das alles zu begreifen. Dem fügte sie das vertraute »Ihr seid doch mein Ein und Alles« hinzu, zog sie an sich und wollte sie nicht mehr loslassen. Im Redestrom der Mutter schwammen fremde Wörter mit und falsch betonte, ihre Sätze brachen ab, erstickten in Schluchzern. Es war so schmerzhaft, ihr zuzuhören, dass die Kinder mit ihr zu weinen begannen, erst leise und wimmernd, dann lauter. Es schien Said, von der Mutter habe jemand einen Schleier weggezogen, und [14] sie zeige sich so, wie er sie gar nicht sehen wollte. Er schaute sie jetzt mit neuen Augen an, suchte nach Merkmalen der königlichen Abkunft in ihrem schmalen Gesicht, und Rosa fragte plötzlich, warum sie denn, wenn doch die Mama eine Prinzessin sei, so wenig Zuckerzeug bekämen. Es war der Tag, da Said seine Unbefangenheit gegenüber der Mutter verlor; sie wiederzugewinnen, gelang ihm nie mehr. Und jetzt, im Alter, fragte er sich, ob er überhaupt je erfasst hatte, wer sie in ihrem Innersten war.
Hatte es geklopft? Rudolph fuhr zusammen, horchte nach hinten, zur Tür hin, ohne sich vom Fenster zu wenden. Es klopfte wieder, etwas stärker und fordernder. War es der Kellner? Oder Herr Sarasin, der versprochen hatte, mit ihm eine Partie Schach zu spielen? Der Hotelarzt? »Herein«, murmelte Rudolph, so leise, dass man ihn draußen im Flur unmöglich hören konnte. Dennoch ging die Tür, Schritte näherten sich, Männerschritte wohl, erst hallend auf dem Parkett, dann vom dicken Teppich gedämpft. Jemand stand hinter ihm und grüßte, und noch immer drehte Rudolph sich nicht um, obwohl die Spiegelung in der Scheibe undeutlich jemanden zeigte, den er zu kennen glaubte.
»Nehmen Sie sich einen Stuhl«, sagte er, »setzen Sie sich neben mich.«
Geräusche verrieten, dass der Stuhl beim Schreibtisch hochgehoben, weggetragen, neben seinem Sessel abgestellt wurde; zugleich ertönte das Tuten des ankommenden Kursschiffes. Rudolph hörte den raschen Atem des Besuchers, sein Gehör war besser als sein Sehvermögen, fast noch das des jungen Mannes, der im Taktschritt der Soldaten, die [15] er kommandierte, jede Abweichung erkannt und getadelt hatte.
»Was wollen Sie?«, fragte er und erschrak über die Müdigkeit in seiner Stimme.
Der Besucher ließ sich Zeit, bis er antwortete: »Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten, Herr Said-Ruete.« Den Namen hob er hervor, als handle es sich um einen Adelstitel.
»Diesen Doppelnamen zu führen«, sagte Rudolph, »hat mir der Hamburger Senat auf mein Gesuch hin gestattet, schon 1906.«
»Ich weiß.« Der Besucher rückte den Stuhl ein paar Zentimeter näher. »Es gibt aber vieles in Ihrem Lebenslauf, was ich mir nicht erklären kann.«
Rudolph deutete ein Lachen an. »Meinen Sie denn, dass ich mir selbst diese Achterbahn erklären kann?«
Das Kursschiff hatte inzwischen angelegt, nur wenige Passagiere stiegen aus. So kurz nach dem Krieg und um diese Jahreszeit gab es kaum Touristen in Luzern.
»Trotzdem«, sagte der Besucher, »Sie können ja versuchen, auf meine Fragen zu antworten.«
Rudolph schwieg. Neue Geräusche, Papier knisterte, ein Streichholz wurde angestrichen, Zigarettenrauch stieg in seine Nase. Der Blick ging durchs Fenster, weit hinaus, zu den Wolken, zum Schiff, das nun menschenleer vor dem Quai schaukelte. Mehr wollte er nicht sehen.
»Ich muss Sie bitten, die Zigarette auszumachen«, sagte er. »Meine Lungen sind angegriffen.«
Der Besucher bat um Entschuldigung, erhob sich, kam nach einer Weile wieder, er hatte wohl den Aschenbecher gefunden, der unbenutzt auf dem Clubtisch lag. Olga, die [16] aufsässige Tochter, hatte die brennende Zigarette immer ins Klosett geschnippt oder in ein Glas Wasser getaucht; das kurze bösartige Zischen, das dabei entstand, klang Rudolph noch in den Ohren. Jetzt hatte sie einen amerikanischen Journalisten geheiratet. Ihre zweite Ehe. Unsinnig der Versuch, die eigenen Kinder an Fehlern zu hindern. Auch der Sohn, Werner, wollte nun in die USA auswandern.
Vom Besucher war nichts mehr zu hören, er regte sich nicht, aber er war noch da.
»Wer sind Sie?«, fragte Rudolph unvermittelt. »Was wollen Sie von mir?«
»Sie können mich auch wegschicken, ich gehe sogleich, wenn Ihnen das lieber ist.«
Rudolph schwieg, blickte hinaus. Zwei Wolken mit halbkugelförmigen Auswüchsen schoben sich übereinander, als wollten sie sich paaren.
»Bleiben Sie«, murmelte er. »Ich bin oft genug ohne Gesellschaft.«
»Wenn ich bleibe, Herr Said-Ruete, dann erzählen Sie.«
»Wovon?«
»Von sich.«
»Und wohin soll das führen? Ich stand zeitlebens zwischen den Fronten. Ich wollte die Gegensätze versöhnen und bin mit allen meinen Vorhaben gescheitert. Ist das erzählenswert?«
»In Ihrer Mutter waren doch die Gegensätze viel schneidender, viel schmerzhafter als für Sie.«
»Ich habe sie weitgehend übernommen. Aber über meine inneren Kämpfe spreche ich nicht. Die sind abgeschlossen.« Rudolph streckte sich, spürte den Widerstand der Polsterung im Rücken.
[17] »Nun gut«, sagte der Besucher. »Dann widmen wir uns doch den äußeren Stationen Ihres Lebenswegs. Sie hätten Sultan werden können, Sultan von Oman und Sansibar.«
Rudolph war nahe daran aufzubrausen. »Das ist eine naive Annahme. Sogar wenn Bismarck alles getan hätte, um mich als Thronfolger durchzusetzen, wäre es ihm nicht gelungen. Die Briten hätten es verhindert.«
»Sie würden Ihre Stellung als Premier-Leutnant nie eintauschen gegen den Thron in Sansibar, haben Sie Bismarck gesagt.«
»Woher wissen Sie das? Er war schon nicht mehr Kanzler, als ich ihn traf, er bedauerte, dass Deutschland zugunsten von Helgoland auf Sansibar verzichtet hatte. Himmelschreiend nannte er den Vertrag mit England.« Rudolph atmete schneller, er spürte Stiche in der Brust, legte die Hand darauf. »Aber lassen wir das. Ich mag mich nicht ereifern.«
»Warum haben Sie denn«, fuhr der Besucher fort, »mit knapp dreißig die Offizierskarriere aufgegeben?«
»Weil mir der militärische Alltag immer mehr missfiel. Der Drill, das Herumschreien. Dass es im Wesentlichen darum geht, töten zu lernen. So ist es doch. Sie hätten meinen Schwager Troemer fragen sollen, den Mann meiner Schwester Rosa, er war als General in Verdun, sprach danach kaum noch ein Wort.«
»Nach Ihrem Abschied vom Militär wurden Sie Eisenbahninspektor in Ägypten, danach Direktor der deutschen Orientbank. Das sind doch erstaunliche Brüche in Ihrem Leben. Wie kam es dazu?«
»Ich war offen für Neues, ich suchte die Herausforderung. [18] Und ich hatte die Hoffnung, auf solche Weise dem Frieden zu dienen.«
»Das qualifizierte Sie aber nicht für diese Stellen. Wichtiger war wohl doch, dass Sie über die richtigen Beziehungen verfügten.«
»Wie Sie meinen. Sie unterschätzen meine Lernfähigkeit.«
»Mag sein. Überraschend auch, dass Sie eine Jüdin aus reichem Haus heirateten.«
»Ich habe aus Liebe geheiratet, nicht aus Geldgier, wie damals einige dachten.«
»Immerhin konnten Sie sich nach den vier Jahren in Kairo ein Leben als Privatier leisten. Das verdankten Sie vermutlich der Mitgift Ihrer Frau.«
Rudolphs Hände öffneten und schlossen sich, als würden sie etwas kneten. »Ihre Fragen werden zudringlich, Herr Unbekannt. Ich beantworte sie nicht.«
»Es war keine Frage, Herr Said-Ruete, es war eine Vermutung. Und sie geht noch weiter, wenn Sie gestatten. Der Onkel Ihrer Frau war Ludwig Mond, einer der reichsten Industriellen Englands. Man darf annehmen, dass er seine Nichte mit einem Legat bedacht hat, er sorgte ja, wie man weiß, gut für seinen Familienclan. Was sonst hat Ihnen denn ermöglicht, bei Ihrem Nomadenleben all die Jahre hindurch stets in den besten Hotels abzusteigen?«
Beinahe hätte Rudolph sich nach dem Besucher umgewandt. Doch er beherrschte sich, bloß die Wörter kamen überstürzt, in unterdrücktem Zorn aus seinem Mund. »Wollen Sie mich in die Ecke des Erbschleichers und Profiteurs drängen? Es wird Ihnen nicht gelingen. Wissen Sie denn, wie viele jüdische Emigranten meine Frau und ich in London [19] unterstützt haben? Wissen Sie, wie viel Geld ich in meine Reisen steckte, um zwischen Zionisten und Palästinensern zu vermitteln? Natürlich habe ich auch meine Mutter unterstützt. Das habe ich aber nie an die große Glocke gehängt.«
Der Besucher blieb gelassen, ja kühl. »Darüber weiß ich nur ungenau Bescheid. Deshalb bin ich da.«
»Gehen Sie jetzt«, sagte Rudolph und bemühte sich, seinen Atem zu beruhigen. »Was immer Sie beabsichtigen, Sie werden sich ohnehin erdichten, was Sie wollen.«
Der Besucher stand auf. »Vielleicht komme ich wieder, ich bin hartnäckig. Oder benachrichtigen Sie mich, wenn Sie es wünschen.«
Rudolph sah einen Schatten, der einen Moment lang die Scheibe verdunkelte, das durchscheinende Oval eines Gesichts, er hörte sich entfernende Schritte, diskreter als die fremde Stimme mit ihrem harten Akzent.
»Ihr Name«, sagte Rudolph halblaut, »wie war doch gleich Ihr Name?«
Doch da war es schon zu spät für eine Antwort. Die Zimmertür wurde sanft geschlossen, und plötzlich war Rudolph nicht mehr sicher, ob er einem Wachtraum erlegen war und der Dialog bloß in seinem Kopf stattgefunden hatte. Der Himmel wurde trüber, man ahnte die Dämmerung. Ende März hatten die Kastanienbäume längs der Seepromenade schon klebrige Knospen; noch würde es Wochen dauern, bis die Blätter aus ihnen drängten und rötliche Blütenkerzen die Kronen sprenkelten. Das Verhör, dem er sich widersetzt hatte, klang in ihm nach. Er hatte dem Unbekannten gegenüber die Mutter beiseitegeschoben, und doch [20] kreisten in diesen Tagen seine Gedanken viel zu oft um sie, um die Rätsel ihrer fahrlässigen Liebe, ihrer Flucht aus Sansibar, ihrer späteren Bitterkeit. Dabei hätte er sich, gestern oder vorgestern schon, um Therese kümmern sollen, die, ein paar Kilometer entfernt, im Kurhaus Sonnmatt lag. Wenigstens eine Weile ihre Hand halten, dazu ist man verpflichtet nach vierundvierzigjähriger Ehe. Er hatte sich zu abgespannt gefühlt für die Fahrt im Taxi, zugleich wich er ihr aus, denn es fiel ihm schwer, in den verlebten Zügen der Ehefrau letztlich sich selbst zu erkennen, und es fiel ihm noch schwerer, den direkten Blick aus ihren blassen Augen zu ertragen.
Seufzend stemmte er sich in die Höhe, versuchte, den Schmerz in der Schulter zu ignorieren und die Steifheit bei den ersten Schritten mannhaft – dieses Wort ging ihm absurderweise durch den Kopf – zu überwinden.
Es war Zeit für den Nachmittagstee. Er mochte die Eclairs, die am Dienstag serviert wurden, das Durchbeißen der Brühteigkruste, die kühle Vanillecrème auf der Zunge. Den käfigartigen Fahrstuhl mied er. Zu Fuß die Treppe hinunter, die Hand am Geländer. Der rote Teppich, der über die Stufen des offenen Treppenhauses lief, hatte ein rundum laufendes Muster, das auf manchen orientalischen Teppichen zu sehen war. Es umfasse den Raum des Paradieses, hatte ihm einst Konsul Schröder in Beirut erklärt. Rudolph selbst stellte sich nach dem eigenen Erlöschen das große Vergessen vor; die Sehnsuchtsvorstellungen von Christen und Muslimen, was nach dem Tod sein werde, waren in ihm lange schon verblasst. Mit Unwillen bemerkte er, dass ihm seine Hose zu weit geworden war; er hatte in den letzten Wochen [21] an Gewicht verloren, und jetzt schlug der Stoff um die Oberschenkel hässliche Falten. Aber vielleicht musste er den Gedanken aufgeben, immer noch so perfekt gekleidet zu sein wie bei all den Einladungen in den Londoner Jahren, wo er bisweilen sogar mit Ministern ins Gespräch gekommen war. Sie hatten allerdings seine wohlerwogenen Ratschläge nie befolgt und auf seine schriftlichen Eingaben kaum je oder dann mit Floskeln geantwortet.
Am Ecktisch im Blauen Salon saßen schon Madame Bloch aus Zürich und Dr.Weizmann aus Turin, dazu kamen, nachdem Rudolph sich gesetzt hatte, Herr Sarasin aus Basel und der Amerikaner James Peacock, ein in München stationierter Besatzungsoffizier, der hier seinen Urlaub verbrachte. Man begrüßte sich, erkundigte sich gegenseitig nach dem Befinden. Sarasins übliche Erwiderung bestand darin, die Augenbrauen hochzuziehen und zu seufzen, während Madame Bloch unentschlossen den Kopf mit dem üppigen Silberhaar wiegte, als gäbe es darauf keine Antwort. Das Hotel war nur zu einem Drittel besetzt, was immerhin das Stimmengewirr im Salon verringerte. Der Chef de Service, ein kleinwüchsiger Bündner, der von Tisch zu Tisch wieselte, klagte über die desolate Wirtschaftslage so kurz nach dem Krieg; ausländische Gäste seien immer noch eine Seltenheit, ganz anders als in den frühen Dreißigern, wo der Schweizerhof meist ausgebucht gewesen sei.
»Darunter waren ja auch viele vermögende Juden«, bemerkte Madame Bloch nahezu sachlich, »sie machten hier Zwischenstation, solange die Schweiz sie noch hereinließ.«
Darauf gab es am Tisch nichts zu sagen; man widmete sich dem Darjeeling-Tee, den der Kellner einschenkte, zerteilte [22] mit den Messerchen die Eclairs, die auf dünnen Porzellantellern serviert wurden. Ein Hotel wie der Schweizerhof bekam genügend Vollmilch zugeteilt, obwohl für die meisten Lebensmittel auch im kriegsverschonten Land immer noch strenge Rationierung galt. Rudolph bemühte sich, deswegen kein schlechtes Gewissen zu haben. Es war richtig, dass die Behörden den Tourismus anzukurbeln versuchten; dazu gehörte der Anschein von Luxus, dessen Verlockung er, der Enkel des großen Sultans Said ibn Sultan, immer wieder erlegen war.
Von Ausflügen war nun die Rede, die man unternehmen könnte, sofern das Wetter sich stabilisiere. Auf den Pilatus wäre Rudolph gerne wieder einmal gefahren, fürchtete aber, dass seine zunehmende Kurzatmigkeit das nicht zuließ. Er dachte zurück an die Sommeraufenthalte in Luzern mit Therese und den Kindern, an den überwältigenden Blick vom Pilatusgipfel aus. Wie ein Raubvogel wollte man sich in die Tiefe stürzen, dem Blau des Sees entgegen, und dann die Flügel ausbreiten und dahinschweben zwischen Himmelblau und Wasserblau, gefahrlos über allen Klüften. Das Gebiet rund um den Vierwaldstättersee war für ihn das Herzstück Europas, nicht nur wegen Schillers Tell-Mythos, dem man in der preußischen Kadettenanstalt heuchlerisch gehuldigt hatte, nein, die Innerschweiz zeigte en miniature, was Europa ausmachte, Täler und Höhen, fließendes und stehendes Wasser, Baukunst durch viele Jahrhunderte; und von oben gesehen gab es im Vielgestaltigen eine friedfertige Einheit, die vorausnahm, was aus dem zerrissenen und verwüsteten Kontinent jetzt werden musste. Diese Vision, so unwahrscheinlich sie anmutete, milderte immerhin ein [23] wenig die Resignation, die ihm seit Tagen durch die Glieder kroch.
Ob die Tischgesellschaft, fragte Herr Sarasin, die Zeit bis zum Dîner eventuell mit einer Partie Bridge überbrücken möchte. Madame Bloch stimmte sogleich zu, die Herren zögerten, Rudolph gab an, er lege sich lieber noch eine Weile hin, er habe heute am Schreibtisch seine Augen überanstrengt.
»Schreiben Sie denn so viel?«, fragte Herr Sarasin.
Rudolph stand mit Anstrengung auf. »Ich versuche, Familienmitglieder ausfindig zu machen.«
»Das tun heutzutage viele, Herr Said-Ruete«, sagte überraschend der schweigsame Dr.Weizmann. »Man kann, weiß Gott, von einer neuen Zerstreuung der Völker sprechen.«
Rudolph nickte, er ging zwischen den Tischen hindurch zum Ausgang. Schwerfällig kam er sich vor, um Jahre älter, als er hätte sein wollen. Eben setzte der Pianist am Flügel mit seinem Spiel ein; er kam aus dem Osten, er hieß Silberstein und nickte Rudolph zu, als spiele er zu dessen Ehren. Wie jeden Abend fing er mit einer Mazurka von Chopin an, die Rudolph aus dem Tritt brachte. Silberstein – erstaunlich, wie viele Namen Rudolph nun schon kannte – würde später Schubert-Ländler spielen, ungarische Tänze, Lieder ohne Worte von Mendelssohn, zwischendurch Improvisationen, die ins Jazzige gingen. Der Mann, kahlköpfig, mit einer Narbe auf der Stirn, hatte eine schwierige Vergangenheit, das stand in seinem Gesicht, aber Rudolph wollte sie nicht kennenlernen, zu vieles aus der eigenen Vergangenheit umstellte ihn in diesen Tagen. Tony war ihm nun wieder nähergerückt. Wie hatte sie wohl in ihren letzten Jahren [24] ausgesehen, die Schwester? Ihre Züge waren schon vor der Trennung von Brandeis hart geworden. Am Grab der Mutter, auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg, hatten sich die Geschwister, im März 1924, noch einmal getroffen, da hatte er mit einem kleinen Schrecken entdeckt, dass weiße Strähnen Antonies Haar durchzogen; seine hatten sich ohnehin längst gelichtet, und Tony hatte gesagt, sie wolle dereinst auch hier, auf der Familiengrabstätte der Ruetes, beigesetzt werden. Zu dieser Zeit waren Emilys Briefe bereits zum Vorschein gekommen, in Rosalies Haus, in dem sie in Jena gestorben war. Alle drei hatten sie inzwischen gelesen. Er hatte zu Lebzeiten der Mutter nichts gewusst von diesem Manuskript. Die Briefe, in akkurater Handschrift verfasst, waren an eine unbekannte Adressatin gerichtet, eine namenlose ehemalige Gefährtin aus Sansibar, und nie abgeschickt worden. So aufgewühlt war Rudolph von der Lektüre, dass er tagelang nichts essen mochte und mit aller Kraft dagegen ankämpfte, sich in Said zurückzuverwandeln, in den hilflosen kleinen Jungen, der im ersten Rudolstadter Winter fast gestorben war. Was hatte die Mutter ihnen alles verschwiegen! Und wie oft musste sie sich ihr Lächeln, ihre Trostworte abgerungen haben, wenn doch alles grundiert gewesen war von diesem uferlosen Heimweh nach der Insel Sansibar!
[25] 2
Sogar der Herrscher über Deutschland und seine Familie nehmen Anteil an meinem Schicksal und lassen mir guten Rat zukommen. Der Herrscher selbst hat meinem Sohn Said die Gunst gewährt, deutscher Offizier zu werden. Meine Töchter Thawka und Ghaza sind ebenfalls wohlauf; uns fehlt nichts außer der Möglichkeit, Dich zu sehen.
Im Halbschlaf, auf dem Sofa. Wohin sinkt, wohin driftet er jetzt? Kühle kommt durchs offene Fenster. Aber der Kopf, tief ins Kissen gesunken, ist heiß, und der Hals tut weh, es brennt, es sticht innendrin, das Gefühl, alles sei geschwollen, die Zunge füllt den Gaumen aus, man sollte schlucken und kann nicht. Das Atmen ist eine Qual, er hört ein Röcheln, es ist sein eigenes. Vom plötzlichen Hustengebell krümmt er sich zusammen, er spuckt Schleim, vermischt mit Blut. Die Mutterhand auf seiner Stirn, und wie durch einen Schleier sieht er den gewellten braunen Lampenschirm mit der Spitzenbordüre, über das Braun krabbelt eine Fliege. Dann das bärtige Gesicht, das sich vor alles Übrige schiebt, eine mürrische Männerstimme: »Diese Nacht wird er kaum überleben.« Er versteht, dass der Satz ihm gilt, dem Schwerkranken. Wird er sterben? Dann hätte er die schrecklichen [26] Halsschmerzen nicht mehr, wie sehr wünscht er sich das! Wieder der Lampenschirm, sanft erleuchtet jetzt, die Fliege fehlt. Süßlicher Geschmack im Mund, es bricht aus ihm heraus, ein Blutstrom, sagt man ihm später. Schreckensrufe, es wird geputzt um ihn herum, das Kissen gewechselt, das Laken. Wer macht das alles? Jetzt kann er die Augen länger offen halten, die Mutter ist da, nahe bei ihm. Aber richtig umarmen und küssen darf sie ihn nicht, wegen der Ansteckung, das weiß er doch, er ist achtjährig und sehr vernünftig, und die Schwestern dürfen auch nicht zu ihm. »Mama«, murmelt er und hält sich an ihrem Blick fest. »Mama« sagt er sonst nie, obwohl die anderen Kinder, die deutschen, ihre Mütter so nennen, »Bibi« will sie heißen, der Vater hat sie so gerufen, doch jetzt geht ihm nur dieses »Mama« über die Lippen, und sie schüttelt leicht den Kopf, lächelt, aber mit nassen Augen, und ihm scheint, dass allein ihr inständiger Blick seine Schmerzen lindern kann. Oder hat sie ihm dies alles, fragt sich Rudolph, später erzählt? Haben ihre nie abgeschickten Briefe seine Einbildungskraft beflügelt? »Meine Seele rang mit dem Allmächtigen um die Rettung eines kaum noch atmenden Kindes«, schrieb sie. »Das Kind schlug die Augen auf und erkannte mich.« Ja, er war wohl knapp am Tod vorbeigegangen; wie leicht, beinahe schwerelos hatte er sich gefühlt, als die Schmerzen endlich verschwanden.
Schwache Erinnerungen an die Zeit der Rekonvaleszenz. Er durfte wochenlang nicht hinaus, las die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, den Schweizerischen Robinson,Gullivers Reisen, lauter Bücher, die Emilys Gönnerin, die Baronin, ihm noch in Dresden geschenkt hatte. Wenn die Dämmerung kam, glaubte er manchmal, er sei mit der [27] gestrandeten Familie Wyss auf der tropischen Insel und nicht in Rudolstadt; er wäre gerne der tüchtige Fritz gewesen, der alle Gefahren bestand, und nicht der geschwächte Said, der schon nach ein paar Schritten außer Atem kam. Über der Lektüre vergaß er, dass nun auch die Mutter das Bett hütete, vielleicht war sie einfach erschöpft nach den durchwachten Nächten. Das Dienstmädchen wagte sich mit dem Essen wieder zu Said herein, er galt nicht mehr als ansteckend, zwei, drei Schulkameraden versahen ihn mit Hausarbeiten.
Das war aber noch nicht das Ende des Unglücks. Kaum stand Emily wieder auf den Beinen, erkrankten die Schwestern an Scharlach. Er hörte Rosa im Nebenzimmer wimmern, die Mutter klagen, von Tony kam kein Laut. Der Arzt weigerte sich, über die Schwelle zu treten. Dieses Haus sei verwünscht, hörte Said ihn sagen, man müsse den Jungen weggeben, bis die Mädchen die Krankheit überwunden hätten, er sei viel zu anfällig, habe keine Abwehrkräfte. Die Mutter gehorchte, sie gab ihn zum Lehrer Werth in Pension. Für zwei Monate? Oder länger? Es schien Said eine endlose Zeit. Nur wenige klare Erinnerungen. Das Gästebett unter der Treppe, mit einer spanischen Wand vom Wohnzimmer abgetrennt, sein Platz unten am Tisch. Der pausbäckige Werth war ein Pedant, stand das Abendessen nicht Schlag sechs Uhr auf dem Tisch, geriet er in üble Laune. Said behandelte er vorsätzlich von oben herab; es gewähre, stellte er klar, einem Jungen im Deutschen Reich keinerlei Vorrechte, von einem orientalischen Königsgeschlecht abzustammen. Seine zwei Söhne, etwas jünger als Said, zogen den fremden Namen spöttisch in die Länge: Saaaiid, sonst ließen sie den [28] Pensionär in Ruhe, luden ihn aber auch nicht zu ihren Zinnsoldatengefechten ein. Immerhin legten sie den Schulweg zu dritt zurück; meist schritt Werth mit durchgestrecktem Rücken fünfzig Meter vor ihnen her. Raufereien blieben Said, dieses Schutzes wegen, erspart. Freundlicher zu ihm war Frau Inge, die Hausmutter. Sie sorgte dafür, dass er das verlorene Gewicht wieder zulegte; vom abendlichen Haferbrei häufte sie immer noch eine zweite Portion auf seinen Teller und streute großzügig Zimt und Zucker darüber. Und wenn Werth daran erinnerte, dass man von Frau Ruete, die ja in beengten Umständen lebe, nur ein geringes Kostgeld verlange, brachte seine Frau ihn mit einem missbilligenden »Ach was!« zum Schweigen. Nicht zu bremsen war Werth allerdings, wenn er seine Begeisterung über das aufstrebende Deutsche Reich ausdrückte. Er glaubte, in Said, dem Halbfremden, einen willigen Zuhörer gefunden zu haben, und lieh ihm seinen großen Atlas aus, damit er nachverfolgen könne, wie aus dem Stückwerk von kleinen und mittleren Herrschaften ein Ganzes geworden sei, das Deutsche Reich, das nun gleichberechtigt im Konzert der Weltmächte mitspiele. Dazu spitzte Werth seine Lippen und pfiff leise die ersten Takte von »Heil dir im Siegerkranz«, das man in der Klasse allmorgendlich im Stehen sang. Wenn Said sich unbeobachtet fühlte, blätterte er im Atlas bis zu Afrika vor, wo die Farben zeigten, dass noch gar nichts deutsch war. Er fand Sansibar an der Ostküste und staunte, wie klein die Insel aussah, enttäuschend klein, kaum größer als eine längliche Rosine; der jetzige Sultan, der sein Onkel war, herrschte über ein winziges Reich, sogar ganz Afrika war nicht größer als Deutschland zwanzig Seiten weiter vorne. [29] Und doch gefiel es Said, sich nach Sansibar zu träumen, sich die Palmen vorzustellen, von denen die Mutter erzählte, die steinernen Häuser am Meer. Nie hätte er gedacht, dass er sechs Jahre später dort in einem deutschen Kriegsschiff vor Anker liegen würde, den Uferstreifen vor Augen, die Rufe des Muezzins im Ohr.
Es wurde Nacht in seinem Hotelzimmer. Ein paar helle Streifen noch über der Rigi, Abglanz des vergangenen Tages. Nach dem eigenen Raum, dem ganz und gar ihm gehörigen, hatte er sein Leben lang gesucht. Lag er im Orient, lag er im Okzident? Stets hatte er sich im Zwischendrin wiedergefunden, im Graubereich des Weder-Noch. Kein Deutscher mehr und doch vom Deutschtum geprägt. Kein wirklicher Brite, obwohl der Pass ihn zu einem machte. Kein Araber, bei weitem nicht, und doch die Sehnsucht, als solcher zu gelten.
In den Wochen beim Lehrer Werth hatte er, am Fenster sitzend, oft die winterlichen Wolkenbilder draußen betrachtet, aufgeplusterte Formen, die bei starkem Wind übereinander herfielen, einander wegschoben oder von unsichtbaren Kräften zerzaust wurden, ein aufregendes Schlachtengetümmel am Himmel. Wie unschuldig waren doch die Phantasien von Jungen, die später im Morast der Schützengräben fürs Vaterland starben. Tony spielte lieber mit Puppen, einer nähte sie, mit Emilys Hilfe, ein knöchellanges orientalisches Kleid und nannte sie Fatima.
Ihr sinnloses Ende in Bombentrümmern, er kam davon nicht los. Was für eine Barbarei, am Ende des Kriegs die Zivilbevölkerung gleichsam hinzurichten! Die Grenzen zwischen dem Guten, dem Notwendigen und dem [30] Verwerflichen hatten sich da schon längst verwischt. Und er, Rudolph, hatte sich herausgehalten aus dem Blutvergießen, hatte beide großen Kriege in neutralem Gelände überdauert. Dabei war er für die Soldatenlaufbahn bestimmt gewesen. Hatte ihn Feigheit geleitet? Klugheit? Widerwillen gegenüber jeglicher Kriegsgewalt? Er knipste die Lampe am Kopfende des Sofas an. Ihr warmer Schein schuf einen Trostraum, schon immer hatte er Tisch- und Bettlampen mehr gemocht als die Kronleuchter in den Palastsälen Londons, wo er, der Sohn der Prinzessin, sich hätte zu Hause fühlen wollen.
Ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass er das Dîner inzwischen versäumt hatte. Er würde sich eine Bouillon bringen lassen, mehr brauchte er nicht, dazu ein Glas Burgunder, vom leichteren. Er zog die Glocke. Ans Bankkonto, dessen rasches Schrumpfen ihm Therese vorgehalten hatte, wollte er nicht denken, es blieb noch genug; der Hauptzweck seines Lebens bestand nicht darin, den Kindern möglichst viel zu vererben. Sollte er jetzt noch Therese anrufen? Sie schlief bestimmt schon um diese Zeit, so matt, so kraftlos war sie geworden. Eine zunehmende Lungenschwäche wie bei Emily, seltsam, dass die Dinge sich manchmal wiederholen. Nein, den Anruf verschob er auf morgen, es war ohnehin kompliziert, über die Schaltzentrale des Hotels die Verbindung zur Sonnmatt herzustellen. Besuchen würde er sie erst am Wochenende, er war ja selbst auch krank, nicht besorgniserregend, wie der Hotelarzt ihm versichert hatte. An Rheumatismus starb man nicht, aber zum Herz musste er Sorge tragen, er durfte sich nicht überanstrengen.
Das Zimmermädchen kam, eine Innerschweizerin, deren [31] Dialekt er kaum verstand. Er bestellte seine Suppe. Das Mädchen nickte, es zündete die Kerze auf dem Schreibtisch an, zog die dunkelgelben Samtvorhänge, schlug die Bettdecke zurück. Rudolph hatte es aufgegeben, mir ihr ein Gespräch anzufangen.
Er war für die Soldatenlaufbahn bestimmt. Was daran hing, hatte ihn geprägt und dann in die Rebellion getrieben. Ein wenig Mondschein stahl sich ins Zimmer, die Wolkendecke war aufgerissen, die Uhrenkette auf dem Nachttisch glänzte. Seit knapp drei Jahren lebte die Familie in Berlin, die Mutter hoffte, ihr Einkommen durch Arabischunterricht aufzubessern. Wann war das? Nach 1880, wenn er richtig rechnete. Vier winzige, ärmliche Zimmer im Erdgeschoss, kaum ein Lichtstrahl im Hinterhof, Said besuchte das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium; er war ein stiller und fleißiger Schüler, verbarg angstvoll seine Abstammung. Dann kam er in die Kadettenanstalt Bensberg, das ehemalige Jagdschloss, das, spartanisch ausgestattet, 400Jungen Platz bieten musste. Erst lange hinterher begriff er, welche Not die Mutter dazu gezwungen hatte, ihn für eine Freistelle anzumelden. Den preußischen Drill mochte sie nicht. Aber ihr Sohn würde, sagte man ihr, auf solche Weise Fuß fassen in der Gesellschaft, zu einer angesehenen Stellung kommen, in der Armee oder in einem Amt. Bekannte, vor allem Onkel Johann, der Bruder des verstorbenen Vaters, hatten Emily geraten, direkt an den Kaiser zu schreiben und die vornehme Abkunft des Jungen herauszustreichen. Das hatte Erfolg, Said wurde aufgenommen. Noch wusste er nicht, was auf ihn wartete, er war dreizehn, schwächlich nach den [32] überstandenen Krankheiten. Die Musterung bescheinigte ihm trotzdem eine ausreichende Gesundheit, und eigentlich hatte er durchaus eine Neigung zum Militärischen, er konnte die großen Schlachten der Preußen der Reihe nach aufsagen, und für den Sieg bei Sedan gegen die schmählich unterlegenen Franzosen begeisterte er sich Mal für Mal. Um Said den Abschied zu erleichtern, beschloss Emily, mit den Töchtern eine Zeitlang in einer billigen Pension in Köln, unweit von Bensberg, zu bleiben; so konnte Said doch alle vierzehn Tage, beim sonntäglichen Urlaub, mit der Familie zusammen sein.
Ein stürmischer Herbsttag. Die Mutter begleitet ihn durch die Allee bis zum Anstaltsportal, Said trägt den Koffer mit den erlaubten Sachen, er stellt ihn ab, um sich die nassen Blätter von Schulter und Mütze zu wischen. Er weicht ihrem Abschiedsblick aus, die Tränen der Mutter erträgt er nicht. Hat nicht sie darauf gedrungen mitzukommen? »Kwa heri«, sagt sie und wiederholt den Abschiedsgruß kaum hörbar: »Kwa heri.« Er saugt mit einem scharfen Geräusch die Luft ein und wendet sich von ihr ab, der wachhabende Offizier treibt ihn zur Eile an. Und danach all die Schrecknisse. Das größte: der lange Schlafsaal mit den zwei Bettreihen, so stellt er sich ein Gefängnis vor. Man liegt da, schutzlos, der grobe Stoff des Nachthemds reibt an der Haut, diese Unruhe stets, die vielen Laute in der Nacht, Wimmern, Keuchen, Schnarchen, lautes Furzen unter Buh-Rufen und Gelächter, die Ruhe-Befehle der Aufsicht; man sehnt sich nach dem Zuhause und darf es nicht zeigen. Der Schrankappell morgens und abends, bei dem man stocksteif dasteht, keinen [33] Finger rühren darf. Die verstopfte Ablaufrinne des Pissoirs mit dem beißenden Gestank, der einem überall in die Nase steigt, sogar in den Klassenzimmern. Der Kaffee mit den Hautfetzen verdorbener Milch. Wie sehnt er sich nach dem gewohnten Tee! Die Morgenparade im Schlosshof, bei jedem Wetter, man trägt dazu den viel zu großen blauen Kadettenrock mit den Messingknöpfen, der sich bei Regen vollsaugt und auf einem lastet wie eine Rüstung. Das Befehlsgeschrei der Unteroffiziere. Alles muss auf den Zentimeter genau ausgerichtet sein. Irgendwo mit der Schuhspitze, mit dem Ellbogen von der schnurgeraden Reihe auch nur geringfügig abzuweichen, bedeutet scharfen Tadel, regungsloses Strafestehen. Demütigungen überall, zu jeder Zeit. Nur im Unterricht atmet Said freier, besonders in den Fächern, die von Zivilisten erteilt werden. Er bewährt sich im Englischen, in Erdkunde. Seine Schrift wird als vorbildlich bezeichnet, deswegen gilt er als Streber. Dabei geht es allen Kadetten darum, so schnell wie möglich die Leutnantsepauletten zu bekommen. Das ist ein Weg von sechs Jahren, die zwei letzten in der zentralen Anstalt in Lichterfelde. Said versucht sich nachts vorzustellen, wie er diese Jahre hinter sich bringen kann, es gelingt ihm nicht. Er friert oft im Bett, die Hände müssen aus hygienischen Gründen über der Decke liegen; wer dagegen verstößt, dem werden die Hände für drei Nächte an die Bettstatt gefesselt. Zum Glück ist Saids Bettnachbar zur Linken ein gutmütiger Kerl, etwas pummelig, schwerfälliger noch als Said auf der Hindernisbahn. Zu den Aalglatten, die sich überall durchmogeln und sich gegen Anfeindungen zu wehren wissen, gehören sie beide nicht. Nach dem Lichterlöschen flüstern sie manchmal [34] miteinander, er und Bernd, erzählen sich von zu Hause, von den Geschwistern, von ihren Lieblingsbüchern. Seinen Vater stellt Said als Kaufmann dar, der erfolgreich im Gewürzhandel tätig sei, so lügt er ihn sich ins Leben zurück. Aus den wenigen Fotos, die es von Heinrich Ruete gibt, versucht er einen lebendigen Menschen zu machen. Eine Aufnahme zeigt die junge Familie, noch ohne Rosa: Said, knapp einjährig, in steifem Röckchen auf Emilys Knien, daneben der Vater mit Tony, ein bärtiges Gesicht mit undurchschaubarem Ausdruck, streng gescheiteltem Haar.
Saids Mutter komme aus Sansibar und sei eine geborene Prinzessin: dieses Gerücht kursiert unter den Kadetten, wird aber von der Leitung nicht bestätigt, man billigt Said keine Sonderstellung zu. Bernd ist als Einziger eingeweiht, es schmeichelt ihm, mit dem Sohn einer Prinzessin befreundet zu sein. Er will ja später in den auswärtigen Dienst, nach Afrika, wie der Forscher Gustav Nachtigal; in einem der neuen deutschen Schutzgebiete will er Konsul werden. So viel Schneid traut man Bernd gar nicht zu, er hat ihn vom Vater, der als Schiffsarzt in der Welt herumkam.
Der Sonntagsurlaub alle zwei Wochen, ein Leuchtpunkt, auf den der triste Anstaltstrott hinstrebt, und dann doch wieder eine Qual. Said fährt nach Köln, herausgeputzt, kein Fädchen am Rock, die Mutter und die Schwestern holen ihn am Bahnhof ab, bestürmen ihn mit Fragen. Er weiß kaum etwas zu erzählen, immer wieder ihr »Du bist so bleich«. Todmüde ist er jedes Mal, schläft in der Pension den halben Sonntag durch. Dass die Mutter bei ihm sitzt und ihn streichelt, müsste er, als werdender Mann, zurückweisen, er tut aber, als merke er’s nicht, auch nicht, dass sie ihm zärtliche [35] Worte auf Suaheli zuflüstert, deren Sinn er bloß erraten kann. Er nimmt sich vor, die Sprache eines Tages zu erlernen, sein Vater hat sie fließend gesprochen, er war ja schon als Lehrling in Sansibar. Wenig will die Mutter von Heinrich erzählen, gar nichts davon, wie sie sich kennenlernten, wie sie flüchtete und Christin wurde. Es wühle zu viel auf, rechtfertigt sie sich. »Iss jetzt, mein Said!« Rote Grütze mit Sauerrahm setzt sie ihm vor, die mag er, und doch krampft sich der Magen nach den ersten Löffeln zusammen. Rosa lacht ihn an mit rotverschmiertem Mund, Tony blickt ernst. Und dann deutet die Mutter an, dass sie vielleicht bald schon nach ihrer Heimat segeln wird, mit Erlaubnis der Obrigkeit. Warum denn? Um ihr Erbe einzufordern, darauf nämlich habe sie ein Recht, und bekäme sie’s, wären ihre Sorgen zu Ende. Da herrscht nun eine Weile Ausgelassenheit am Tisch. »Wir wollen mit!«, ruft Rosa. Sie malen sich die lange Reise aus, nennen die Zwischenstationen, Alexandrien, Port Said, Aden. Said weiß inzwischen, dass Sansibar größer ist, als er einst gemeint hat, 2650 Quadratkilometer, so steht es im Kolonialatlas, er hat es auswendig gelernt. Und wichtig ist die Insel als Handelsstützpunkt. England und Deutschland wetteifern um die Vorherrschaft in Ostafrika. Mit Kopra- und Gewürzhandel hatte auch Saids Vater zu tun. Den Sklavenhandel, der Sansibar reich gemacht hat, haben die Europäer dem Sultan verboten, darin sind sich das Deutsche Reich und England einig: Menschen wie Tiere zu kaufen und zu verkaufen, ist ein Unrecht. Mit der Mutter spricht er nicht darüber, sie meidet dieses Thema.
Um fünf Uhr nachmittags schon muss er sich losreißen, beim Gang von der Bahnstation zur Anstalt mag er die Beine [36] kaum heben. Ginge er nicht mitten in einer Schar von Rückkehrern, würde er sich hinsetzen und Wurzeln schlagen, alles jetzt, nur nicht der Abendappell, nicht das Hissen der Fahne. Aber man gehorcht der Pflicht, man tut das Vorgeschriebene, man ist ja auch stolz auf dieses Deutschland. Bernd zu sehen, freut Said. Auch er sei bleich, hätten Bernds Eltern gefunden, der ewige Gemüseeintopf ernähre die Kadetten zu wenig, man brauche in diesem Alter viel Fleisch. Nachts stellen sie sich Berge von Koteletts vor, Schweinelenden, ganze Schinken, da haben sie doch etwas zum Lachen, so wie vor ein paar Stunden am kleinen Esstisch in der Pension. Hätten sie’s einmal zum Leutnant gebracht, sagt Bernd, sei die Kost bestimmt reichhaltiger. Das ist eine Aussicht, die Said Auftrieb gibt; mit schlechtem Gewissen denkt er daran, dass seine Mutter kein Schweinefleisch isst. Beim Einschlafen rinnen plötzlich Tränen aus seinen Augen, er kann auch nicht vergessen, dass die Mutter mit den Schwestern bald nach Berlin zurückkehren wird. Das hat sie ihm ganz zuletzt und verstohlen gesagt, auf der Schwelle schon: Er müsse sich auf eine größere Distanz zwischen ihnen einstellen, aber inzwischen habe er sich ja ans neue Leben gewöhnt. Nein, antwortet ihr Rudolph viele Jahre später, er wird sich nicht daran gewöhnen, nie, er wird sich bloß dem Rhythmus dieses Lebens beugen, weil er keine andere Wahl hat.
Das letzte Mal nach Bensberg kamen die Mutter und die Schwestern zu einer Theateraufführung zu Ehren des Kaisers. Wochenlang hatten die Kadetten, auch in der Freizeit, Szenen aus Schillers Fiesco geprobt. Die wenigen [37] Frauenrollen übernahmen ein paar der Jüngsten, die den Stimmbruch noch vor sich hatten, eine Quelle ewigen Gelächters während der Proben. Die beiden Deutschlehrer, die Regie führten, rivalisierten offen miteinander. Der eine war Zivilist, der andere Hauptmann, der eine schliff an der Deklamation, der andere an der Wirksamkeit der Massenauftritte. Die Handlung begriff Said nie ganz; ob Fiesco, der Graf von Lavagna, nun für die Republik oder die Monarchie einstand, konnte ihm niemand schlüssig erklären. Dennoch hatte er gehofft, eine wichtige Rolle zu bekommen. Den intriganten Mohren aus Tunis indessen hätte er nicht spielen wollen, auch wenn es Mitschüler gab, die witzelten, dafür wäre er doch von Natur aus geeignet. Schließlich musste er sich damit begnügen, Statist zu sein, ein Bürger Venedigs in viel zu engen Hosen, der die Bühne in festgelegten Schrittfolgen betrat und wieder verließ. Während der Aufführung versuchte er die Mutter und die Schwestern im halbdunklen Zuschauerraum zu erkennen. Vergeblich, er sah nichts als schummrige Flecken, die sich kaum vom Hintergrund abhoben. Er versäumte darüber seinen Abgang und wäre um ein Haar in Andrea Doria hineingestolpert, der sich mit seinem skrupellosen Neffen stritt. Said verbeugte sich am Schluss mit der Reihe der Statisten; der Beifall war dünn und brandete erst auf, als die Hauptdarsteller, Hand in Hand, vorne an die Rampe traten.
Im Festsaal trafen sich danach die Kadetten mit ihren Familien. Gratulationen schwirrten durchs Gedränge, es war drückend heiß. Die Erwachsenen tranken Sekt aus Kelchgläsern, die erhitzten Schauspieler durften, zur allgemeinen Erheiterung, davon nippen; für einmal zeigte sich die [38]