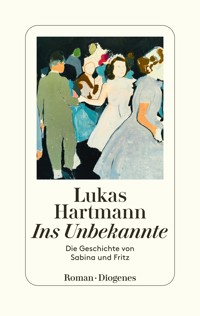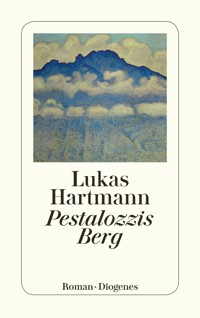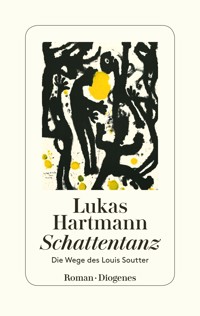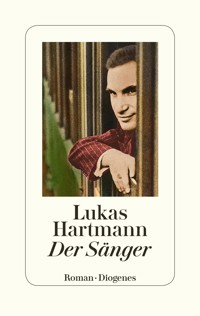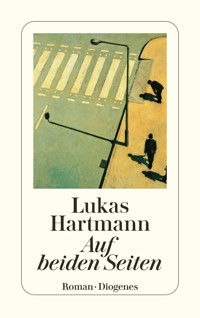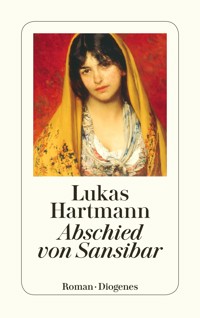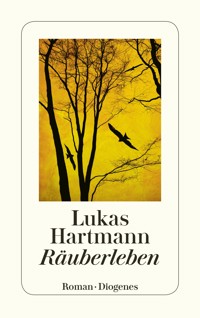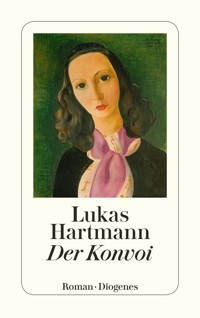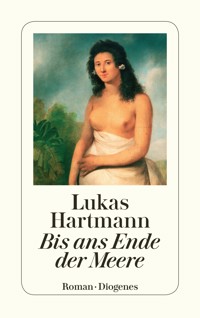12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Martha ist eine beeindruckende Frau, die es aus ärmsten Verhältnissen zu bescheidenem Wohlstand gebracht hat. Aber die Erinnerung an die Entbehrungen ihrer Kindheit als »Verdingkind« bei einer Bauernfamilie im Berner Umland lässt sie nie los: Keine Schwäche zeigen. Arbeiten ohne Unterlass. Hart sein zu sich und anderen. Das prägt auch ihre Söhne, die es in der Nachkriegszeit unbedingt zu etwas bringen wollen. Und ihre Enkel, die dagegen rebellieren und es erstmals wagen, sich ein anderes, ein freieres Leben zu erträumen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lukas Hartmann
Martha und die Ihren
Roman
Diogenes
1Entbehrungen
In diesem Haus kann ein kleines Kind nachts einfach verschwinden. Niemand weiß, wohin. Unheimlich ist es im Dunkeln, nicht einmal die Hand sieht man vor den Augen, erst wenn es hell wird, kommt sie wieder zum Vorschein, Martha liegt dann neben Frieda und Klara stumm da. Sie wohnen ja im Finsterboden, so heißt es hier. Die Matratze ist hart und schmal. Im Winter steigt nur wenig Wärme zur Dachkammer, da tut es gut, sich an die Schwestern zu schmiegen. Aber Klara flüstert Martha manchmal unheimliche Dinge ins Ohr, vom Großen ohne Kopf, der herumschleicht, bevor es Tag wird. Man sieht ihn nicht. Da sperrt Martha ihre Ohren zu, sie hat gelernt, wie man das macht. Auf der Matratze nebenan liegen die drei Brüder unter der geflickten Decke, zwei mit dem Kopf oben, einer unten, der hat manchmal die Füße der anderen im Gesicht, das gibt zu lachen oder zu schimpfen. Emil, der Älteste, flucht manchmal sogar laut. Als der Vater noch auf den Beinen war, hat er Emil deswegen geschlagen, Gott darf man nicht lästern. Jetzt muss der Ätti schon lange unten neben dem Ofen liegen, er klagt über Schmerzen, kann sich kaum bewegen. Aber der Ofen wird nicht richtig warm, sie wohnen hier und haben zu wenig Holz. Das Kleinholz, das die Kinder im Wald sammeln, reicht nicht aus.
»Wir sollten mit Kohle heizen«, sagt die Mutter, »aber Kohle ist zu teuer für unsereinen.«
Einer kommt manchmal mitten in der Nacht,
den ich nicht sehe. Aber er macht Geräusche, ganz leise,
und doch lauter als der Wind draußen,
lauter als das Atmen vom Ätti.
Als der Vater noch gesund war und herumzog, um mit der Rute Wasser aufzuspüren und Brunnen zu bauen, bekam er dafür Geld von den Bauern, größere und kleine Münzen, die er den Kindern zeigte. Dann wollte er, wie schon oft, einen Schacht sprengen, die Explosion kam zu früh und warf ihn um, sie hat ein Bein verletzt, es blieb krumm, strecken kann er es nicht mehr. Seit diesem Unfall kommt kaum noch Geld ins Haus. »Medikamente sind zu teuer«, sagt die Mutter, »den Doktor können wir uns nicht leisten.« Aber sie macht für den Vater Umschläge aus Heilpflanzen, die das Eitern verhindern. Sie hilft benachbarten Bauern mit der Wäsche gegen Brot, manchmal ein Stück Fleisch, die älteren Buben bewachen das Vieh auf der Weide, bekommen dafür eine Münze. Oder sie lesen bei den Bauern Obst aus dem Gras, das sie behalten dürfen und ungern mit den Jüngeren teilen, außer Karl, der fast immer schweigt, er hat eine Vorliebe für Martha, die Zweitjüngste, die aber die Kleinste ist, zwei Finger kleiner als Frieda.
Der Ätti stöhnt oft, manchmal setzt sich Martha neben ihn, hält eine Weile seine Hand. Das tue ihm gut, sagt er, lächelt sogar wie früher, als er den Kindern Geschichten erzählte, von Zwergen im Wald, die miteinander streiten und sich in den Bach schubsen, bis sie vor einem jungen Fuchs davonlaufen. Er machte das Geschrei der Zwerge mit hoher Stimme nach und brachte die Kinder zum Lachen. Nun ist er zu müde für solche Geschichten. Vielleicht stirbt er bald, das hat Klara nachts Martha ins Ohr geflüstert, sie wollte es nicht hören und stellte sich taub. Wie mochte es Martha früher, wenn der Ätti mit seiner rauen Hand über ihre Wange strich, wenn er sie hochhob, als wäre sie federleicht, und hin- und herwiegte. Alle wollten hochgehoben werden, sogar die Großen, und sie warfen ihm vor, er bevorzuge Martheli, das sei ungerecht. »Das macht er«, sagte Emil, »weil du so klein und zart bist.« Aber zäh ist Martha auch mit ihren sieben Jahren, und lesen hat sie von den Älteren gelernt, wenn sie um den Küchentisch herumsaßen und ihr die Buchstaben beibrachten. Martha mochte das runde O, aber auch das M, ihren Anfangsbuchstaben. Das Schreiben ergab sich dann wie von selbst. Die Lehrerin oben im Schulhaus staunte, als sie feststellte, dass Martha die Buchstaben schon kannte; aber sie ist geizig mit Lob, das sagen alle, und sie duldet kein Geschwätz. Darum senkt Martha den Kopf und presst die Lippen zusammen, wenn das Fräulein Bigler vor ihr steht und ihre Schrift kontrolliert. Die Buchstaben seien zu flüchtig geschrieben, tadelt das Fräulein, aber auch wenn Martha sich Mühe gibt, sind sie nie gerade genug.
Das M möchte ich gerne einmal
über die ganze Seite schreiben
wie eine Tür, die sich öffnet.
Aber da bekäme ich eine Strafarbeit.
Die Mutter ist ihr fremder als der Vater, sie hat so viel zu tun, schaut manchmal durch die Kinder hindurch in die Ferne, als ob sie durchsichtig wären. Die Mädchen helfen ihr beim Waschen und Zusammenlegen der trockenen Hosen und Röcke. Aber manchmal scheint es, als ob sie ihre Hilfe gar nicht bemerkt, als ob jemand in ihr drin sie lähmt. Frieda versucht, sie am Rockzipfel hierhin und dorthin zu ziehen, die großen Buben maulen, wenn ihnen etwas verboten wird, und plötzlich schimpft sie laut mit ihnen, während der Vater stumm auf dem Sofa liegt. Nur selten hört man einen Seufzer von ihm. In letzter Zeit sagt er oft, wenn Martha bei ihm sitzt und seine Hand hält, sie solle ihn wärmen, aber ihre Hand wird so kalt von seiner, dass sie sich zu fürchten beginnt.
In der Suppe, die die Kinder abends löffeln, schwimmt kaum mehr Fleisch, sie ist dünn, hat keine Fettaugen, schmeckt nach Salz, davon haben sie noch genug. Aber satt wird man nicht davon. Es ist auch nicht klug, auf dem Schulweg unreife Äpfel aufzusammeln und in sie hineinzubeißen. Obwohl die Älteren davor warnen, ist Martha manchmal so hungrig, dass sie doch davon isst, danach bekommt sie Bauchweh. Eine Nachbarin vom übernächsten Hof weiter oben, Brigitte, bringt ihnen manchmal eine Schüssel Haferbrei, das ist dann für die Kinder schon fast ein Festessen, vor allem wenn Brigitte Zucker und Zimt darübergestreut hat. Die sechs Kinder verteilen den Brei gerecht, sie zählen die Löffel nach Altersjahren, im Rechnen sind sie alle geschickt. Martha bekommt sieben gestrichene Löffel, Karl elf, aber wenn er satt ist, gibt er den Jüngeren von seiner Portion, und er freut sich, wie dankbar sie sind. »Wir müssen zusammenhalten«, sagt er dann, und sie stimmen ihm zu. Die Mutter steht schweigend dabei, und niemand weiß, ob sie überhaupt noch isst. Sie werde immer dünner, flüstert Klara der Schwester in der Dunkelheit zu, sie sollten beten, dann helfe ihnen der liebe Gott. Sie murmeln fast unhörbar ihr Abendgebet, das, wie die nächsten Tage zeigen, doch nichts nützt.
Ein Mann von der Gemeinde kommt an einem Samstag im Herbst vorbei, er weicht den Pfützen auf dem Vorplatz aus, über seinem Bauch hängt eine Uhrenkette. Er scheucht die Kinder ins Freie, er wolle mit der Mutter reden. Die zwei stehen dann drinnen beim Fenster, man sieht ihre Umrisse, hört ein Gemurmel, der Vater ist zu schwach, um sich einzumischen. Dann geht der gewichtige Mann wieder, er scheint zornig zu sein, tritt nun sogar in die Pfützen. »Er will euch zu anderen Leuten geben«, sagt die Mutter zu den Kindern, »das will ich nicht.« Und dann fügt sie, kaum vernehmlich, hinzu: »Aber wir bekommen von der Gemeinde jetzt ein Armengeld.« Sie öffnet ihre Faust, in der Hand liegen zwei große Münzen. »Fünfliber«, sagt Karl beinahe ehrfürchtig. Für einen Fünfliber, das weiß Martha, bekommt man am Waldfest zwei große Lebkuchen und zwei Tafeln Schokolade, genug zum Teilen für die ganze Familie, denn das sind sie ja, die Nydeggers, eine Familie, auch wenn sie, das habe der Fürsorger gesagt, der Gemeinde auf der Tasche liegt. »Wir brauchen jetzt Mehl und Zucker«, sagt Klara. »Salz haben wir noch. Unterhemden für den Winter wären auch nötig, aber dafür reicht das Geld nicht.« Klara und Martha werden mit der Mutter ins Oberdorf gehen und beim Krämer das Nötigste einkaufen. Es ist fast so, als ob sie das Kommando übernommen hätten, denn die Mutter schweigt und nickt. Die Kinder stehen um die Mutter herum, der Vater scheint zu lauschen, aber er sagt nichts, er ist nahezu stumm geworden, nur ab und zu einen Schmerzenslaut lässt er hören, den Martha kaum aushält, denn sie möchte dem Vater, der auch immer übler riecht, die Schmerzen nehmen und kann es nicht. Die Schwestern waschen ihn, er schaudert vor dem kalten Brunnenwasser zurück, versucht, sie abzuwehren, aber sie knöpfen ihm das Hemd auf, säubern ihm den Oberkörper, für die Notdurft schiebt ihm die Mutter mit Mühe eine flache Schüssel unter den Hintern, leert sie dann draußen auf den Haufen mit Unrat. Einen richtigen Mist gibt es nicht, am Anfang hatten sie noch Kaninchen und Hühner, die sind nun seit Monaten verschwunden. Die Wahrheit ist, und das weiß Martha genau: Die Mutter hat die Tiere den Nachbarn verkauft.
Die Jungen, die Küken, habe ich manchmal
in die Hand genommen, sie waren so weich und warm.
Ihr Herz hat geklopft, das spürten meine Finger.
Ich legte sie zurück ins Nest. Sie haben mich beschützt.
Zwei Tage ist es her, da hat der Vater am Morgen aufgehört zu atmen, er sei nun nicht mehr unter ihnen, sagt die Mutter, als Martha hinter Frieda die steile Treppe vom Gaden hinuntersteigt. »Vielleicht ist es besser so«, murmelt die Mutter, sie murmelt noch etwas, das vielleicht ein Gebet ist. »Man muss die Gemeinde benachrichtigen«, sagt sie dann und schickt Karl, der sich in der Umgebung auskennt, mit der Todesnachricht zum Gemeindehaus. Die Kinder wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, Frieda und Klara beginnen zu weinen, sie tasten nach ihren Händen, halten einander fest. Martha steht abseits und schweigt.
Die nächsten Stunden, die nächsten beiden Tage sind geschäftig. Ein Mann mit Glatze und Brille erscheint, es ist der Doktor, der den Totenschein ausfüllen muss, dann kommt der Pfarrer, den sie noch nie gesehen haben, er spricht ein Gebet mit lauter Stimme, die Martha in den Ohren schmerzt. Er drückt den Kindern die Hand, empfiehlt ihnen Gehorsam gegenüber der Mutter, er verschwindet bald, man kann ihm nichts anbieten, weder Schnaps noch eine Süßigkeit. Dann kommen die Tischler mit dem Sarg, in den sie den Vater legen, es kommen die nächsten Nachbarn, darunter der Alte mit dem weißen Bart, der weiter oben im Tobel wohnt, und drücken ihr Beileid aus, die freundliche Brigitte vom übernächsten Hof hat einen kleinen Blumenstrauß dabei, Astern aus ihrem Garten sind es, die sie vor den offenen Sarg legt. Da drinnen liegt der Ätti im einzigen Anzug, den er hatte, auf einem weißen Tuch liegt er, man könnte sich zu ihm legen, ihn ein letztes Mal umarmen. Aber die Leute wären empört.
Martha schläft wenig in den nächsten Nächten, sie glaubt, die Schritte vom Vater zu hören wie früher, wenn er, bevor es Tag wurde, zum Ofen ging und ihn fütterte, wie er sagte, er wollte nicht, dass seine sechs Kinder froren, und er wollte, dass man die Milch auf der Herdplatte wärmen konnte. Die Äste hatten die Größeren im Wald gesammelt und zu Reisigbündeln geschnürt, mit Erlaubnis vom Waldbesitzer, dem auch das kleine Taunerhaus gehört, für das sie ihm Zins zahlen, einen zu hohen, wie die Mutter schimpft. Hirschi heißt der Besitzer, er ist freundlich zu den Kindern, besonders zu den beiden Mädchen, denen er den Kopf tätschelt oder durchs Haar fährt, aber den Zins will er auf den Rappen genau, da gebe er kein Pardon, sagt er, Vertrag sei Vertrag.
Die Beerdigung findet drei Tage später statt, während deren der Vater im Haus aufgebahrt ist. »Zum Glück ist es kühl«, sagt Emil, »sonst würde er zu riechen beginnen.« Die Mutter ohrfeigt ihn wegen dieses Spruchs, er wehrt sich nicht dagegen.
Er hat recht, der Bruder, die tote Katze,
die vor dem Haus lag, hat auch gerochen,
Klara und ich haben sie im Wald begraben.
Vielleicht hat der Unsichtbare sie getötet,
weil sie krank war. Er kommt nur nachts ins Haus,
da gibt es nirgendwo mehr ein Licht.
Man muss hinauf ins Dorf für die Beerdigung, Gott sei Dank regnet es nicht. Ein paar Verwandte sind gekommen, zu denen die Familie keinen Kontakt mehr hatte, der Vater schämte sich, weil sie wegen seines Unfalls so arm geworden waren, er hatte ja keine Einnahmen mehr. Den Onkel Alois hat Martha lange nicht mehr gesehen, er ist der Bruder des Vaters, Schreiner von Beruf, gleicht ihm aber überhaupt nicht und schweigt fast die ganze Zeit. Er habe, sagt die Mutter nach dem Begräbnis, ihnen immerhin ab und zu Geld geschickt, ihr auch heute nach dem Kirchgang eine Zehnernote in die Hand gedrückt. Das sei nicht selbstverständlich.
Der Pfarrer in der Kirche redet nur wenige Sätze, Martha versteht nicht, was er sagt, versteht auch das Gebet nicht. Die Orgel, die sie noch nie gehört hat, erschreckt sie zuerst, aber dann hört sie ihr gerne zu. Die Glocken, die sie sonst von Weitem vernimmt, läuten danach viel zu laut, es ist ein Durcheinander von Tönen, sie will sich die Ohren zuhalten, aber Frieda hindert sie daran. Als der Sarg auf dem kleinen Friedhof ins Grab gesenkt wird, hört sie das laute Weinen der Mutter und weiß nicht, womit man sie trösten könnte. Ein einfaches Holzkreuz hat die Gemeinde bezahlt, wie Emil weiß, aber darauf steht nicht einmal ein Name, das wäre zu teuer gewesen. Man geht danach auch nicht in die Wirtschaft für den üblichen Umtrunk, niemand ist bereit, die Kosten zu übernehmen. Man hätte fragen müssen, sagt Emil hinterher, aber die Mutter war zu stolz dafür. Sie weiß auch, was nun geschieht: Man wird ihr die Kinder wegnehmen, sie kommen zu Bauern aus der Umgebung, wie es in solchen Fällen üblich ist, sie müssen nach dem Schulunterricht oder auch schon vorher auf dem Hof mithelfen, dafür gibt man ihnen zu essen und ein Bett oder eher einen Strohsack, und sie stehen unter der Aufsicht des Fürsorgers, der darauf achten soll, dass die Halbwaisen anständig behandelt werden. So viel erzählen sich die Kinder abends im Flüsterton, sie haben einiges gehört, sich anderes zusammengereimt, sie stolpern über die ungewohnten Wörter. Die Mutter sitzt zusammengesunken auf ihrem Stuhl, nur ab und zu bringt sie einen Satz hervor: »Ihr werdet es gut haben, und an den Festtagen sehen wir uns.« Wohin kommen sie nun, die Kinder? Die Mutter selbst, auch das erfahren die Kinder, soll in einer Wäscherei in einem Vorort der Stadt arbeiten, als Hilfskraft, dort war sie vor ihrer Heirat beschäftigt. Aber was sie da verdienen wird, reicht niemals aus für sechs Kinder und sie selbst. Und die Gemeinde steuert nur wenig bei. Die Mutter kann froh sein, dass man sie noch eine Weile im alten Taglöhnerhaus lässt.
2Das Verdingkind
Man holt sie ab, eines nach dem andern, auf freundliche Weise oder auf missmutige. Ein Mann von der Gemeinde ist jedes Mal dabei. Die Kinder müssen mitgehen, auch wenn sie die Leute nicht kennen, denn darunter sind solche aus anderen Dörfern, aber nur Männer. Die Kinder werden verdingt, auch das ist ein neues Wort für Martha. Später wird sie denken, dass das Wort ja stimmt, sie sind zu Dingen geworden.
Die Mutter hat gepackt, die wenigen Kleider für jedes der Geschwister zu einem Bündel gerollt. Ihre Augen sind noch röter geworden und ganz geschwollen. Sie umarmt jedes Kind, bevor es weggeht und dem Mann folgt, der es in seine Familie aufnimmt. Sie sagt leise: »Wir sehen uns bald wieder.« Martha geht als Letzte hinaus, der Mann, der sie abholt, heißt Bürgi, er nimmt Martha an der Hand, mit der andern trägt er ihr Bündel. Er ist mit dem Pferdewagen gekommen, einem Zweisitzer, und er hilft Martha beim Hinaufklettern. »Wenn du brav bist und fleißig, wirst du es gut haben bei uns«, sagt er und lenkt die Pferde mit den Zügeln, sein Kopf ist weit oben, beinahe wie ein tiefer Orgelton dröhnt seine Stimme. Bis vor zwei Jahren hatten sie in Marthas Familie auch ein paar Tiere, und weil sie wegen Vaters Unfall so viele Arzneien brauchten, mussten sie die verkaufen. Hätten nicht zwei mitleidige Nachbarinnen ihnen Bohnen und Kohl geschenkt und Milch vor die Türe gestellt, hätten sie betteln müssen. Den kleinen Milchkessel reinigte die Mutter mit großer Sorgfalt, stellte ihn abends wieder glänzend vor die Tür. Es kam Martha vor, wie wenn ein guter Geist den Kessel füllen würde, aber sie wusste schon, wer es war. Und sie hätte Brigitte, die so schön geflochtene Haare hatte, gerne etwas geschenkt, eine Zeichnung vielleicht, denn Martha zeichnete gerne, hatte aber keine Buntstifte.
Ich würde Blumen malen in allen Farben, wenn ich könnte,
am liebsten rote und gelbe, aber die Sonnenblumen
sind zu groß für ein umgedrehtes Kalenderblatt.
Und in der Nacht sehe ich nichts, höre nur Geräusche.
Der Hof von Bürgi, eine halbe Stunde entfernt, liegt, wie der Finsterboden, am Rand eines Bachgrabens, alles ist aber größer, als es bei Martha war, hablicher, sagen die Leute. Nach der Wiese, auf der ein paar Kühe weiden, fällt das bewaldete Gelände steil ab. Wo es enden würde, sieht man nicht, das Laub ist zu dicht.
Es ist gerade Mittag, als sie ankommen, das Pferd wiehert, eine Frau, etwa so alt wie Marthas Mutter, kommt aus dem Haus, mit langem schwarzem Rock, an der Hand zwei kleine Kinder, sie hat noch drei größere, stellt sich heraus. »Wir essen gerade«, sagt die Frau, die Elsbeth heißt, sie mustert Martha lange, sagt dann zum Mann: »Mager ist sie und klein. Und doch schon achtjährig?« Der Mann, Berthold, nickt, klopft auf seine Jackentasche: »Da sind alle Papiere. Das Mädchen sei gescheit, wurde mir gesagt, aber scheu.« Sie reden über Martha, als sei sie gar nicht da oder verstehe ihre Sprache nicht. Sie begleiten sie in die Küche, wo die Kinder gespannt am Tisch sitzen, eines von ihnen ist größer als die anderen, hat ein breites und plattes Gesicht, es stößt bei ihrem Anblick wimmernde Laute aus, die außer Martha niemanden erschrecken. Einen Knecht gibt es auch noch, der in sich hineinlacht, und eine Magd, die dauernd zwinkert. Martha ist die Zehnte – sie zählt genau – am langen Tisch und muss sich an dessen Ende setzen, auf einen Stuhl, der nicht für ein Kind ist, sodass sie mit dem Kopf nur knapp über die Tischplatte reicht. »Gebetet haben wir schon«, sagt Elsbeth, »wir brauchen es nicht zu wiederholen.« Der Bauer nickt, setzt sich oben an den Tisch, faltet trotzdem für einen Moment die Hände. Er wird bedient von der Magd, sie legt ihm geschwellte Kartoffeln auf den Teller, er nimmt sich Speck und Wurst von der Platte, die sie ihm hinhält. Das Essen wandert von Platz zu Platz bis zu Martha hinunter, für sie hat es noch zwei kleine Kartoffeln, eine davon schartig, das Fleisch ist weg. So wird es bleiben, denkt sie, ich komme zuletzt an die Reihe. Der Große mit dem breiten Gesicht sagt laut etwas Unverständliches, er scheint zu protestieren. Man achtet aber nicht auf ihn. Was ist wohl mit ihm?, fragt sich Martha. Ist er behindert? Das Wort kennt sie von Emil, dem Klügsten in ihrer Familie. Und gleich überfällt sie ganz unvermutet das Heimweh und treibt ihr Tränen in die Augen, die sie mit dem Ärmel wegwischt.
Der Bauer trinkt zwei Gläser Most, von dem sonst niemand bekommt. Am Ende der Mahlzeit sagt er: »Ich habe heute Martha abgeholt, sie hat ihren Vater verloren und wird bei uns bleiben. Ich erwarte von euch, dass ihr sie anständig behandelt.« Die Kinder nicken, sie sind das Nicken gewöhnt, denkt Martha und sieht, dass sich die zwei Jungen schräg gegenüber mit den Ellbogen heimlich in die Seite stoßen. Seltsame Namen haben sie, das erfährt sie später: Eusebius und Bartholomäus. Die zwei Mädchen, die Jüngsten der Familie, heißen Friederike und Leonore. Der Auffällige, der gar nicht richtig spricht, heißt Severin. Lauter Namen, die Martha noch nie gehört hat, aber sie merkt sie sich sogleich und bringt damit die Mutter Elsbeth zum Staunen. Nachdem sich Severin beruhigt hat, starrt er Martha ununterbrochen an, nicht feindselig, aber mit offener Neugier, die sogar einen Speichelfaden aus seinem Mundwinkel laufen lässt, was Martha belustigt und zugleich ein wenig anwidert.
Nach dem Essen zeigt ihr Elsbeth ihren Schlafplatz, das ist eine kleine Kammer hinter den größeren Räumen, sie kann sich dort knapp ausstrecken, ein Fenster gibt es nicht. Das war wohl einmal für den Hofhund, denkt sie, es riecht nach Tier hier drin, und sie sagt sich: Zum Glück legen sie mich nicht an eine Kette. Waschen kann man sich draußen am Brunnen, genau wie zu Hause im Finsterboden. Der Abort ist größer hier, man muss sich nicht hinkauern, kann sitzen und die Tür verschließen, man reinigt sich mit zurechtgeschnittenem Zeitungspapier und spült mit Wasser aus einem Eimer, den man am Brunnen nachfüllt. Das schärft Elsbeth der Neuen alles ein, nicht unfreundlich, aber sehr bestimmt.
»In der Schule muss man dich anmelden«, kündigt sie an, »ich komme morgen mit dir, der Ätti hat wohl deinen Taufschein mitgenommen.«
Martha schweigt, das weiß sie nicht. Sie hilft danach in der Küche beim Abwaschen, zusammen mit Leonore, dem jüngeren der Mädchen.
Im Bett dann, als es finster ist, kommt das Elend über Martha. Sie hat es den ganzen Tag niederhalten können, nun holt es sie ein, und sie wird von ihm durchgeschüttelt. Nicht einmal, als der Vater tot war, tat es tief drinnen so weh, und obwohl sie beide Hände auf den Mund presst, dringen Laute aus ihr heraus, die man draußen in der großen Stube hört. Denn die Tür wird geöffnet, die Mutter Elsbeth steht im Lichtschein von draußen und fragt: »Ist etwas nicht gut, Martha?« Dass sie ihren Namen nennt, macht alles noch schlimmer, Martha beißt sich in den Handrücken, um sich zu beherrschen, schüttelt heftig den Kopf. Doch Elsbeth beugt sich zu ihr hinunter, legt die kühle Hand auf Marthas Stirn und sagt leise: »Es kommt alles gut, du brauchst dich nicht zu fürchten.« Martha hat Sehnsucht nach allem Vertrauten, vermisst ihre Geschwister. Die Hand auf der Stirn ist trotzdem ein Trost, Martha schnieft noch ein wenig, und nach einer Weile zieht sich Elsbeth zurück.
Aber der andere ist da, der Unsichtbare,
er schnauft, er macht Geräusche,
vielleicht beschützt er mich vor dem Neuen,
er ist mitgekommen, er tut mir nichts.
Der nächste Tag ist ein Sonntag, daran hat Martha gar nicht gedacht. Man betet lange beim Morgenessen, man muss den Blick senken, die Hände schön falten, sonst klopft ihr Leonore, die neben ihr sitzt, mit stummem Vorwurf auf die Finger. Das Gebet des Vaters, von dem Martha das meiste nicht versteht, will gar nicht enden, bis alle in sein Amen einstimmen. Nur von Severin kommen seltsame, prustende Laute, und er bewegt sich unruhig, aber niemand achtet auf ihn. Dann singen sie gemeinsam ein Lied, das Martha nicht kennt, weder die Worte, in denen »Großer Gott« vorkommt, noch die Melodie, ein Choral sei es, raunt Leonore ihr ins Ohr, und die Mutter legt mahnend den Finger auf die Lippen. Auch mittags setzen sie sich zusammen, jetzt aber in der Stube, und singen Lieder, und am Nachmittag kommen Gäste ins Haus, sie trinken Wasser aus Gläsern, und einer, der seinen schwarzen Hut nicht abnimmt, liest lange aus der Bibel vor, auch jetzt versteht Martha das meiste nicht, vor allem nicht die langen Reihen von fremdartigen Namen, dann wird wieder gesungen. »Wir sind alle Brüder und Schwestern in Christus«, sagt Mutter Elsbeth leise. Sie sitzt Martha gegenüber und lächelt. Es sei die übliche Versammlung ihrer Gemeinschaft am Sonntag, erklärt sie geduldig, das gebe ihnen Kraft und Zuversicht für die ganze Woche. Severin stößt plötzlich ein Wehgeschrei aus, man muss ihn beruhigen, danach lacht er wieder unbändig, irgendjemand hat ihm etwas Süßes zugesteckt.
Als die Gäste gegangen sind, muss Martha beim Aufräumen helfen, die gespülten Gläser abtrocknen und ja keines fallen lassen, denn sie sind teuer, hört sie Friederike sagen. So vieles ist hier neu für sie, neu und fremd, ja beängstigend, und sie ist froh, dass sie sich, als es dunkel ist, nach der Katzenwäsche draußen in ihren Verschlag zurückziehen kann, wo alle Geräusche plötzlich gedämpft und weniger bedrohlich sind.
»Morgen ist Schule«, hat die Mutter Bürgi angekündigt, »du wirst die anderen begleiten, der Lehrer weiß dann schon, was er tun soll.« Sie hat wohl vergessen, dass sie Martha am ersten Tag auf dem Weg zur Schule begleiten wollte. »Und am Nachmittag«, da hebt die Mutter leicht die Stimme, »hast du eine Aufgabe bei uns, du wirst zu Severin schauen und darauf achten, dass er nichts Dummes anstellt.«
Das macht Martha Sorgen, bevor sie einschläft. Severin ist einen Kopf größer als sie, viel kräftiger und launisch, unsauber dazu, er riecht schlecht, wie soll sie es anstellen, wenn er sich gegen sie wehrt? Sie schläft dann auf ihrer Matratze trotzdem rasch ein, trägt nur das Unterhemd, wie sie es zu Hause gelernt hat. Auch jetzt versucht sie, die Gedanken an den Finsterboden fernzuhalten. Und dann ist sie im Traum trotzdem dort, aber das Haus ist leer, nur Katzen laufen darin herum, und das macht ihr Angst, vor allem, weil sie so laut miauen. Als sie wach ist, weiß sie lange nicht, wo sie ist und was sie an den fremden Ort gebracht hat, aber plötzlich fließen Tränen aus ihren Augen, ohne dass Martha sie zurückhalten kann.
Den Schulweg hätte sie allein nicht gefunden. Sie trägt eine Schürze, die in ihrem Bündel war, und frische Socken, denn die Mutter hat ihr eingeschärft, dass es vermögenden Leuten vor übel riechenden Socken graust. Die getragenen wird sie im Brunnen waschen.
Friederike und Leonore nehmen Martha, solange der Weg breit genug ist, in die Mitte, die Buben laufen voraus. Zwanzig Minuten dauere der Schulweg, belehren sie die Mädchen. Die Mutter hat eine Taschenuhr, die sagt ihr, wann die Kinder weggehen müssen. Die Straße, die zur Brücke führt, macht viele Kurven, bis man das Wasser sieht, gegenüber steigt sie an, steiler als auf der eigenen Seite. Die Mädchen fragen Martha, ob sie gut lesen könne, und Martha schweigt dazu, weil sie es ja selbst nicht weiß. Gerne lese sie, hätte sie sagen können, aber das behält sie für sich. Sie sind schwatzhaft, die beiden, ein und zwei Jahre älter als Martha, und deswegen kommen sie sich erfahren vor, warnen den Schulneuling vor den größeren Buben aus dem Dorf, die gerne spotten und die jüngeren Mädchen an den Haaren ziehen.
»Du musst tun, als mache es dir nichts aus«, raten sie Martha, »dann verleidet es ihnen. Und wenn sie sagen, wir seien Stündeler, dann hör einfach nicht hin.« Stündeler, erklären sie, nennen die von der Landeskirche die anderen, die zur Evangelischen Gemeinschaft gehören wie ihre Familie.
Es ist viel Neues, hoffentlich gerät es Martha nicht durcheinander. Auf halber Höhe des absteigenden Hangs rücken die Häuser zusammen, auch andere Schulkinder sind unterwegs, mustern die Neue, eine fragt: »Wer bist du? Wie heißt du?« Und Martha gibt Auskunft, wie sie es gelernt hat: »Martha Nydegger heiße ich, achtjährig bin ich, in der zweiten Klasse.«
»Dann kannst du schon lesen und schreiben?«
Martha nickt. Es gibt, hört sie, ein paar Ältere aus abgelegenen Höfen, die stottern dauernd beim Buchstabieren. Friederike und Leonore, die Martha untergehakt haben, lachen in sich hinein. Denn für sie ist Lesen schon so einfach wie Atmen, sagen sie, und sie singen gleich zusammen das ABC-Lied, das für Martha neu ist.
Das Schulhaus sieht man von Weitem, es hat einen kleinen Glockenturm, und daneben steht ein Klettergerüst mit fünf Stangen. Auch deren Zweck muss man Martha erklären. Es sind drei Klassen im Schulhaus, die Unterschule, die Mittel- und die Oberschule. In der Unterschule, wohin Martha gebracht wird, unterrichtet ein Mann, was selten sei, sagt man später zu Martha. Der Mann ist noch jung, er steht unter der Tür, begrüßt die Kinder mit Handschlag und das eine oder andere mit einem Schulterklopfen. Er fragt Martha freundlich, woher sie komme, sie nennt den Finsterboden, andere Fragen stellt er nicht, vielleicht weiß er schon, dass Martha ein Pflegekind bei den Bürgis ist. Sie sieht, wie gut rasiert er ist, die Männer, die sie kennt, haben meist Bartstoppeln. Er gibt der Klasse, sobald die Kinder sitzen, schriftliche Aufgaben, damit er nachprüfen kann, wie weit fortgeschritten die Neue ist. Zuerst zögert Martha, als er ihr eine Seite aus dem Lesebuch vorlegt, dann aber gibt sie sich einen Ruck und liest die Stelle fehlerlos, ohne zu stocken, im richtigen Tempo.
»Hoppla«, sagt der Lehrer. »Du gehörst zu den Fortgeschrittenen. Bist du im Rechnen auch so gut?«
»Ich glaube schon«, sagt Martha und löst ohne langes Überlegen eine Kopfrechenaufgabe, die er ihr stellt.
»Man muss dich rühmen«, sagt er, »so klein und schon so geschickt.« Und wieder sein Lächeln, das ihr guttut. Dann setzt er sie, die Kleine, zur dritten Klasse. »Ich glaube, da gehörst du hin, wir werden ja sehen.«
Die anderen hören mit großen Augen zu. Dass jemand aus der zweiten Klasse gleich in die dritte gesetzt wird, das hat es noch nie gegeben.
»Ich möchte«, sagt der Lehrer, »dass ihr Martha gut behandelt, sonst bin ich unzufrieden mit euch.«
»Aber sie ist doch jünger als wir«, widerspricht ein Junge mit auffällig abstehenden Ohren.
»Ja«, sagt der Lehrer, »aber sie ist weiter fortgeschritten als manche auf eurer Stufe.«
Martha glaubt, ein missfälliges Murmeln zu hören, vor allem von älteren Buben, aber sie fügen sich dem Lehrer, der Räber heißt, wie Martha am zweiten Tag in der Pause erfährt.
»Ihr werdet euch daran gewöhnen«, sagt er. »Es sind nicht alle gleich vor dem Herrn.«
Martha sitzt nun in der gleichen Klasse wie Friederike, die doch älter ist, und das beschäftigt diese mehr, als sie möchte. Auf dem Heimweg fragt sie Martha mehrmals, warum sie schon so gut lesen könne, und die weiß es ja selbst nicht, außer dass das Lesen ihr leichtfällt. Die Mutter Elsbeth stutzt, als die Töchter ihr von Marthas Beförderung erzählen, sie geht dann aber darüber hinweg und erklärt Martha, dass sie künftig an schulfreien Nachmittagen für Severin verantwortlich sei und ihn hüten müsse, sie sei froh darum, habe anderes zu tun. Der Junge sei behindert, wisse oft nicht, was er tue, aber er sei zugänglich für freundliche Worte, und freundlich sein könne Martha doch gut. Und dann zeigt sie ihr, wie das geht mit Severin. Die beiden Schwestern wissen es schon und schwatzen leise miteinander, diese Aufgabe wollen sie partout nicht mehr übernehmen. Manchmal wehre sich Severin plötzlich, kratze sie mit scharfen Fingernägeln, sagen sie hinterher zu Martha, jetzt müsse halt sie es ausprobieren mit ihm. Die Brüder seien zu groß fürs Hüten, die müssten mit dem Vater aufs Feld. Das gelte aber für Severin nicht, arbeiten wie die anderen könne er nicht, er lese manchmal schöne Steine auf statt Kartoffeln. Dazu kichern die Mädchen in sich hinein. »Der Herr«, sagt Friederike plötzlich in feierlichem Ton, »hat ihn so gemacht, es ist eine Prüfung für uns.«
Einmal am Tag muss Severin spazieren gehen, das heißt: draußen ein paar Hundert Schritte machen, das habe der Arzt empfohlen. Und Martha hat die Aufgabe, ihn an einer Art Ledergeschirr zu führen, wie Pferde sie tragen, die Mutter schnallt es ihm um den Oberkörper, kleine Glocken sind an ihm befestigt, die läuten laut und leise, je nachdem, wie er sich bewegt. An diesem Geschirr hängt auch eine Leine, eine Art Zügel, und die hält Martha in der Hand, damit sie Severin lenken kann. Elsbeth zeigt ihr, wie sie mit kleinen Rucken den Jungen in die eine oder andere Richtung lenkt.
»Braucht er das wirklich?«, fragt Martha besorgt.
»Ja«, sagt Elsbeth, »sonst läuft er plötzlich irgendwohin, verletzt sich im Gestrüpp oder fällt in den Bach. Einmal ist er weit gelaufen, wir haben ihn fast nicht mehr gefunden.«
»Und wenn er sich losreißt?«, fragt Martha weiter. »Er ist doch stärker als ich.«
»Du musst ihn fest genug halten, dann ist er ganz gehorsam. Und wenn er sich bückt und etwas anschauen oder anfassen will, hältst du die Zügel lockerer.« Sie schaut Martha in die Augen. »Er ist daran gewöhnt. Es braucht nicht Kraft, um ihn zu lenken, nur den Willen dazu.« Dann lässt sie, unter den Augen der Geschwister, Martha ausprobieren, Severin auf dem Vorplatz zu lenken, als wäre er ein Pferd. Sie traut es sich zuerst nicht zu, hält aber das dünne Seil fest in der Hand, und Severin gehorcht tatsächlich, mal gleich, mal zögernd, Marthas sanften oder stärkeren Bewegungen.
Elsbeth scheint zufrieden zu sein. »Du darfst aber mit ihm«, sagt sie, »nur bis zu den nächsten Häusern gehen und auf keinen Fall in den Wald und ins Unterholz. Hin und her kannst du ihn führen, den Weg auf und ab. Es ist gut, wenn er müde wird, dann schläft er besser. Und zum Abendessen musst du mit ihm wieder da sein. Wir haben eine kleine Glocke. Die klingt höher als die für unsere Leitkuh. Wenn du die hörst, ist es Zeit zurückzukommen, spätestens dann.«
Martha nickt, sie hat alle Anweisungen verstanden und wird sich Mühe geben, sie zu befolgen.
Als Elsbeth ins Haus zurückgeht, fragt Martha die Schwestern, ob Severin schon immer so gewesen sei. Er sei, als er eben erst gehen konnte, einmal gestürzt, sagt Leonore, und habe sich den Kopf aufgeschlagen und dann lange nicht mehr gesprochen. Seine Behinderung komme vielleicht daher.
Severin hat auch eine Schlafkammer wie Martha, aber im Keller, neben der Waschküche. Man höre ihn manchmal mitten in der Nacht rufen, sogar schreien, es komme vor, dass er sich schmutzig mache wie ein Säugling, darum trage er Windeln, die wechsle ihm aber nur Elsbeth selbst, das dürfe sonst niemand.
Es sind andere Geräusche in der Nacht,
jemand jammert, es ist nicht der Unsichtbare,
die Stimme kenne ich, sie macht mir nicht Angst,
am Tag kommt sie von Severin, so heißt er doch.
Die ersten Male, als Martha auf ihn aufpasst und ihn an der Leine führt, geht alles gut. Severin dreht sich immer wieder um und lacht Martha an, oder er brabbelt etwas, was sie nicht versteht, es sind unangenehme Laute, auch traurige, die von ihm kommen. Er versucht zu singen, lange gedehnte Töne, aber eine Melodie entsteht daraus nicht. Einmal, als sie weit genug von den Häusern entfernt sind, nimmt Martha seinen Ton auf, da lacht er unbändig und übertönt sie mit Leichtigkeit, fast ein heiseres Schreien ist es, und Martha fürchtet, dass man es bei den Bürgis hören wird. Aber als sie nach den weithin vernehmbaren Glockenschlägen pünktlich mit Severin zurück ist, fragt sie niemand danach. Er hat sich ihr in allem gefügt, immer wieder bei Schlenkern, die sie ihm befahl, gelacht, und in Martha ist ein kleines Machtgefühl entstanden. Dass sie einen so großen Jungen – bald vierzehn ist er – fast nach Belieben leiten kann, hätte sie nicht gedacht.
Aber schon nach einer Woche wird es schwieriger, da fängt Severin an, sich das eine oder andere Mal gegen ihre Zügelsignale zu sträuben, er bleibt einfach stehen, schüttelt heftig und immer grimmiger den Kopf, strebt plötzlich mit aller Kraft in eine Richtung, die sie nicht will, dorthin, wo es keinen Weg mehr gibt, nur Waldboden, einen Pflanzenteppich, Fallholz. Sie beginnen, miteinander zu kämpfen, meistens fügt er sich, sobald er lauter keucht.
Den Bürgis sagt sie nichts von Severins Auflehnung. Immer noch behält sie, die viel Kleinere, die Oberhand, und jammernd fügt er sich ihren Befehlen. Aber die Kämpfe mit ihm machen sie müde, beim Aufwärtsgehen schlottern ihre Knie, und die Beine schmerzen. Nun wird es jeden Tag schlimmer, sie beginnt sich vor den Stunden mit Severin zu fürchten, verschweigt aber auch das. Sie sieht, wie schlau er ist. Mit ihm zu reden hilft nicht, er hört ihr gar nicht zu, scheint vor allem auf den richtigen Moment zu warten, um sich loszureißen. Das gelingt in der zweiten oder dritten Woche immer häufiger. Das Seil entgleitet ihr, ihre Handflächen sind wund davon, und als er merkt, dass er frei ist, macht er lange Sprünge weg vom Weg, das Seil hinter sich herziehend. Martha setzt ihm nach, holt ihn fast ein, er lacht und vergrößert wieder den Abstand, bis er stolpert und das Seil sich irgendwo verfängt. Sie kann es packen, er stößt Wehlaute aus, sie sieht, dass sein Knie blutet, und sie schimpft: »Das hast du davon!« Sie hat ein Taschentuch dabei, netzt es mit Speichel, wickelt es um sein Knie. Er sträubt sich erst, lässt es dann zu, nun gibt er Töne wie ein jammerndes Kätzchen von sich. »Du musst brav sein«, beschwört sie ihn, nachdem ihr Atem ruhiger geht. Und zu ihrem Erstaunen nickt er und sagt ganz verständlich: »Will brav sein. Brav.«
So kehren sie ins Haus zurück, sehr langsam, denn Severin hinkt und macht keinen Versuch mehr auszureißen. Der Mutter Elsbeth erklärt sie mit schlechtem Gewissen, der Bub sei gestolpert und unglücklich gefallen. Sie schaut Martha zweifelnd an, forscht aber nicht weiter nach.
Bei den nächsten Spaziergängen weiß Martha nicht, wie sie sich verhalten soll, wenn Severin schlechte Laune hat und vor ihr wegläuft. Manchmal will er sie umreißen, dann lacht er und hält sich an ihr fest. Er scheint mit ihr ein Spiel zu spielen, dessen Regeln sie nicht begreift. Es kommt vor, dass auch sie von einem Sturz eine Schürfung davonträgt, und einmal, als sie wütend ist, packt sie ihn an den Armen, doch es gelingt ihm, sie mit den Fingernägeln am Hals zu kratzen, und diese Wunden wollen lange nicht heilen. Elsbeth sieht das wohl, fragt aber nicht danach. Nur der Lehrer Räber erkundigt sich nach der Verletzung, und sie schwindelt ihm vor, sie sei im Wald über eine Wurzel gestolpert. Er schaut sie merkwürdig an, mahnt sie dann, sie solle auf die Verletzung Wundsalbe streichen. Die bekommt sie von Elsbeth, die aber weiterhin nicht wissen will, was geschehen ist. Sie ahnt es wohl.
Die Kämpfe zwischen ihr und Severin werden heftiger. Martha beginnt, sich davor zu fürchten, und zugleich hat sie wachsende Lust, immer wieder die Stärkere zu sein. Sie ist sogar schneller als er, wenn er wegrennt, sie zwingt ihn zu Boden, setzt sich auf ihn. »Jetzt musst du brav sein«, ruft sie ihm ins Ohr, »sonst reiß ich dir einen Büschel Haare aus!«
Da beginnt er plötzlich zu jammern, zu winseln, beinahe wie ein kleiner Hund. »Nicht, nicht!«, stößt er hervor. »Will brav sein!« Dann schließt er, auf dem Rücken liegend, die Augen, als wäre er eingeschlafen, doch plötzlich lacht er laut, schüttelt Martha ab, und ihr Spiel beginnt von Neuem.
Sie ist oft erschöpft, und auf dem Rückweg bringt sie kaum mehr ein Bein vors andere. Aber wenn Elsbeth sie fragt, wie es gehe, und ihr Blätter und Zweiglein vom Rock wischt, lügt sie und beteuert, sie hätten es lustig zusammen, sie und Severin würden miteinander Fangen spielen.
Die beiden Mädchen glauben ihr nicht. »Er will der Stärkere sein«, sagt Friederike. »Und das ist er ja«, fügt Leonore hinzu. Martha schüttelt den Kopf und lässt sie stehen, da ist Severin schon in seinem Verschlag, und die Mutter hat ihm die verletzten Stellen mit ihrer Wundsalbe eingestrichen, die sie anschließend auch Martha überlässt, ohne sie aber selbst zu pflegen. Von all dem scheint der Bauer nichts zu bemerken, so wie er auch übersieht, dass die Schüssel, wenn sie unten am Tisch bei Martha ankommt, oft schon leer ist. Hin und wieder macht sich Martha jetzt aber bemerkbar und sagt halblaut: »Ich möchte auch noch davon.« Und sie staunt, als die Mutter mit einer schroffen Handbewegung dafür sorgt, dass die Schwestern etwas für sie übrig lassen. Als aber Martha einmal mit zerkratzten Unterarmen aus dem Wald zurückkommt und dem Vater Bürgi über den Weg läuft, nimmt er sie auf die Seite und sagt ihr: »Du musst ihm zeigen, dass du ihm wirklich wehtun kannst. Nimm einen dünnen Weidenzweig mit und schlag ihm damit in die Kniekehlen, sag ihm, du schlägst noch stärker, wenn er nicht gehorcht.«
»Das kann ich nicht«, sagt Martha.
»Das kannst du«, sagt Bürgi und wendet sich wieder seinen Pferden zu. Vor einem hat Martha Angst, es schnaubt, wenn es sie erkennt, wiehert sogar, dabei hat sie ihm nie etwas getan.
Aber Severin schlagen? Sie weiß doch, wie Schläge mit einer dünnen Rute wehtun können. Als der Vater noch gesund war, hat er sie manchmal auf diese Weise bestraft. Nicht in die Kniekehlen hat er geschlagen, sondern auf die Handflächen, und die Kniekehlen sind doch noch viel empfindlicher. Aber Eusebius schneidet ihr einen Weidenzweig, als sie ihn darum bittet, spitzt ihn zu, er fragt nicht wofür, schaut sie bloß forschend an.