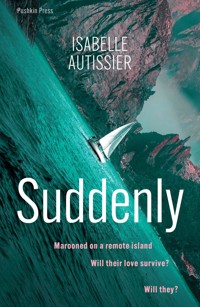Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
2021: Venedig ist von den Wassermassen eines letzten Acqua alta verschlungen worden. Guido Malegatti, einer der Überlebenden, fährt mit dem Boot durch die Ruinen, auf der Suche nach Frau und Tochter. Zwei Jahre zuvor: Angesichts des drohenden Meeresspiegelanstiegs bahnt sich der Konflikt innerhalb der Familie an. Guido als Wirtschaftsrat schwört auf den Tourismus und die Segnungen der Technik. Seine Frau Maria Alba schwelgt in der vergangenen Pracht einer Stadt am Rande des Zusammenbruchs. Und ihre 17-jährige Tochter Léa wird in dem Versuch, die geliebt Stadt zu retten, zur Gegnerin ihres Vaters. Isabelle Autissier entwirft das so dramatische wie realistische Szenario vom Untergang Venedigs. Mitreißend zeichnet sie aus der Perspektive dreier Familienmitglieder nach, wie es zur Katastrophe kommt, und stellt uns alle vor die Frage: Wie würde ich mich verhalten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabelle Autissier
ACQUA ALTA
Roman
Aus dem Französischen von Kirsten Gleinig
mare
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Le naufrage de Venise bei Éditions Stock, Paris.
Copyright © Éditions Stock, 2022
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Außenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
© 2024 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung Mark Owen / Trevillion Images
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-831-1
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-708-6
www.mare.de
Inhalt
DER NEBEL STEHT
GUIDO LIEGT AUSGESTRECKT DA
DAS LETZTE MAL
LÉA RENNT
MARIA ALBA LANGWEILT SICH
GUIDO HAT HART GEKÄMPFT
SEINE KRITIKER NENNEN
LÉA HAT GLEICH ZWEIMAL
LÉA HAT NICHT LANGE
IN DEN DARAUFFOLGENDEN
GUIDO SCHENKT SICH
LÉA LIEGT AUF DEM RÜCKEN
VENEDIG IST UNVERSCHÄMT
SIE HABEN SICH EINEN
AM 17. JULI WIRD LÉA
MARIA ALBA ÖFFNET
AM LIEBSTEN WACHT LÉA
HEUTE MORGEN BEBT GUIDO
LÉA BEUGT SICH NACH VORN
EIN EISIGER MORGEN
GUIDO WIRFT DEN BERICHT
LÉA WOLLTE NICHT
LANGSAM KOMMT
ES IST FRÜHLING GEWORDEN
SEIT SEINER FAHRT
LÉA HAT SICH VORGENOMMEN
MEIN DANK
DER NEBEL STEHT den Ruinen gut. Er säumt die Risse im Gestein, aus dem nutzlos gewordene Stahlträger hervorragen. Er verschleiert die Trostlosigkeit eines eingestürzten Erkers, eines klaffenden Daches, einer Fassade, aus der die leeren Fenster wie tote Augen starren. Und die Dunstschwaden nähren die Illusion, dass es doch noch einen Ausweg aus dem Unglück gibt, vielleicht alles nur verschwommen ist. Plötzlich stellt man sich vor, dass gleich die Sonne durchbricht und das Bild zerstreut. Die Unschärfe verschwindet, und die Schäden erweisen sich als nicht so schlimm. Eine unsichtbare Hand löst die Pause-Taste, und das Leben geht weiter wie vorher. Die Straßen beleben sich mit Passanten und Touristen und dem Klackern ihrer Rollkoffer, mit Geschrei, dem Geknatter der Schnellboote, dem Geruch nach Staub und altem Fett aus den Restaurants.
Leider gelingt der Sonne dieses Wunder schon seit Monaten nicht, und die Lagune wird immer nebliger. Hat der Einsturz womöglich mephitische Dünste freigesetzt, die so dicht sind, dass sie sich nicht vertreiben lassen? Oder hört die Lagune ganz einfach nicht auf, um ihre Stadt zu weinen: um Venedig?
GUIDO LIEGT AUSGESTRECKT DA, regungslos wie eine mittelalterliche Grabfigur, die Decke bis ans Kinn gezogen. Der Körper wirkt massig, aber nicht sehr groß, kaum mehr als einen Meter siebzig, was ihn immer geärgert hat. Der Kopf liegt gerade auf dem Kopfkissen. Die Wangenknochen springen hervor, ein kantiger Kiefer, große Augenhöhlen mit buschigen Brauen darüber und dunklen Ringen darunter. Trotzdem erscheint das Gesicht nicht traurig und schlaff, dieser Eindruck wird zerstreut von etwas Genussvollem, dem großen Mund mit den vollen Lippen und der breiten Nase, die er von seinen Vorfahren geerbt hat und deren bebende Nasenflügel als Einziges darauf hindeuten, dass er lebt. Nach monatelangem Krankenhausaufenthalt treten die geplatzten Äderchen auf seinem fahlen Teint hervor. Er ist erschöpft von den Operationen und Behandlungen und lässt sich gehen. Ein Dreitagebart und leicht graue Strähnen anstelle des glatt rasierten Gesichts und des strengen Haarschnitts, die bei ihm immer zum Pflichtprogramm gehörten. Auf einmal öffnet er die Augen, ohne zu blinzeln. Hübsche graue Augen mit goldenen Sprenkeln, seine Verführungswaffe.
Guido hat die Fähigkeit, augenblicklich vom Schlaf in den Wachzustand zu wechseln. Er liebt den Moment, wenn er sich wie ein Hellseher fühlt, und vertraut stets den ersten Gedanken, die ihm in den Sinn kommen, denen, die der Schlaf geformt hat und die er seine nächtlichen Visionen nennt. An diesem Morgen drängt sich ihm die Entscheidung auf: Er muss zurück nach Venedig.
Monatelang hat eine Rückkehr keinen Sinn gehabt. Zunächst hat Guido lange im Krankenhaus gelegen, gebrochene Schulter, Rippenverletzungen, Schädelfraktur. Nach dem künstlichen Koma musste er in der Reha den endlosen, verschlungenen Weg zurück in die Realität finden. Nach und nach ging es ihm besser, und die körperlichen Schmerzen legten sich, dennoch übermannten ihn die Probleme. Zum ersten Mal in seinem Leben widerstrebte es ihm, den Dingen ins Gesicht zu sehen. Er träumte von einem Zauberstab, der ihn verschwinden ließe und so weit weg wie möglich brächte, auf eine Insel im Pazifik oder zu irgendeinem wilden Stamm im entlegensten Winkel eines undurchdringlichen Urwalds. Weit weg, so weit weg wie möglich von dem, was ihn quälte: der Tod Maria Albas und das Verschwinden von Léa, der Einsturz des Hauses, in dem er die schönsten Momente seines Lebens verbracht hatte, dazu die Freunde, die Geliebten und selbst ein paar abgefeimte Kontrahenten, von deren Tod er Tag für Tag erfuhr.
Auch der Papierkram machte ihn wahnsinnig. Er hatte all die Erklärungsschreiben, Beschwerdeschreiben und Mahnschreiben ganz allein bewältigen müssen, die man an die Banken, Versicherungen und Entschädigungsfonds der Opfer schicken musste, und auf die schwachköpfigen Beamten geschimpft, die eine ruhige Kugel schoben und Nachweise und Beweise von ihm forderten, die natürlich in dem riesigen Durcheinander verloren gegangen waren. Selbst sein Status als gewählter Abgeordneter schien da nicht zu helfen. Nach den Beileidsbekundungen erntete er bestenfalls noch freundliche Reaktionen, wenn er sich auf das Rathaus berief.
Dass es öffentliche Kritik hagelte, hatte ihn mehr getroffen, als er zugeben mochte. Er hatte sich nicht daran gestört, dass man die gesamte Stadtverwaltung als inkompetent und korrupt darstellte. Das war üblich. Dass sie alle als Mörder beschimpft wurden, klang hart, konnte aber auf die akute Verzweiflung zurückgeführt werden. Aber dass man insbesondere der Stadtentwicklung Venedigs die Schuld gab und dem Wohlstand, den er sich bemüht hatte aufzubauen, der ihn Tag und Nacht beschäftigt und all seine Energie gefordert hatte, das konnte er tatsächlich nicht ertragen. Fehlte nur noch, dass man ihn persönlich für die Katastrophe verantwortlich machte. Wäre das von Léas Leuten aus der Umweltschutzszene gekommen, hätte es ihn nicht erstaunt, von seinen eigenen Freunden aus der Koalition allerdings, mit der er regiert, aber auch gestritten und gut gegessen hatte, verletzte ihn der Vorwurf tief. Wenn er besserer Stimmung war, gab er in Sachen Politik Voltaire recht: »Mein Gott, bewahre mich vor meinen Freunden. Mit meinen Feinden werde ich allein fertig.« In schlechten Momenten lösten die Hasstiraden Verbitterung aus und machten ihn wütend auf diejenigen, die die Verantwortung auf ihn abzuwälzen und ihn zu instrumentalisieren versuchten. Nachdem er eine Weile lang sämtliche Informationen verschlungen hatte, las er nun gar keine Zeitungen mehr, sah nicht mehr fern und ließ seinen Twitter-Account ruhen.
Der Morgenhimmel ist noch violett, als er die Wohnung in Mestre vis-à-vis von Venedig verlässt, in der er Zuflucht gesucht hat. Das geliehene Schnellboot wartet im inneren Hafen von Marghera auf ihn. Dunkler Nebel verschluckt die Umgebung und erstickt die Geräusche. In der Lagune ist er ganz allein. Rechts kann er kaum die sich dunkel abzeichnende Ponte della Libertà ausmachen, die einzige Zufahrtsstraße nach Venedig. Früher hätte es darauf zu dieser Zeit von Fahrzeugen gewimmelt. Man hätte die Straße eher gehört als gesehen, ihr dumpfes Grollen. Jetzt ist die Brücke für den Verkehr gesperrt, wie die gesamte Stadt. Mithilfe des GPS erreicht Guido nach einer halben Stunde die Nordostspitze Venedigs. Er hätte auch direkt über den Cannaregio-Kanal hineinfahren können, um zum Canal Grande zu gelangen. Aber die eingestürzten Gebäude blockieren vermutlich die Durchfahrt. Und außerdem will er nicht diese Dienstzufahrt nehmen. Er will die echte, die, die dreißig Millionen Menschen jährlich den Atem stocken ließ und sie zum Träumen brachte. Von Süden her zu kommen und gleich zu Beginn zwischen dem Dogenpalast und der Punta della Dogana mit der goldenen Weltkugel hindurchzufahren, führt einem die Einzigartigkeit Venedigs vor Augen. Wohin man auch blickt, alles ist besonders. Die Stadt präsentiert sich zugleich als kompakte, robuste Einheit mitten im Wasser und als eine unendliche Vielfalt ziselierter Steine, von denen jeder einzelne Geschichte atmet. Das Paradox ist augenfällig: das Venedig, das abgeschottet in seinem Bett aus Schlick und Schlamm daliegt, und das Venedig, das offen ist durch seine vielen Kanäle, durch die sämtliche Nationen der Welt gereist sind und noch immer reisen. Die Stadt pflegt ihre Superlative: zu viele Paläste, zu viele Kirchen, zu viel Eleganz an einem einzigen Ort. Selbst wenn man darauf vorbereitet ist, verblüfft einen Venedig, weckt Neugier, ist verwirrend und faszinierend.
Guido hat sich haufenweise Fotos von der Katastrophe und schreckliche Vorher-nachher-Ansichten angesehen. Er hat sie bis zum Überdruss geprüft. Jedes Detail, das er sah, jedes eingestürzte Gebäude, jede Zerstörung, versetzte ihm einen Stich ins Herz. Er stellte sich vor, dass sich ein kleines Loch in seiner Brust bildete, durch das ein Teil seiner Lebenskraft entwich. Wie viel Glauben sollte man den Hochglanzbildern schenken? Inwieweit deren Urteil übernehmen? Es gibt Dinge, die weiß man, aber sie sind einfach unannehmbar. Er hat sich Hunderte schockierender Handyvideos angesehen und ist davon nicht losgekommen, ebenso wie sich mehr als zwanzig Jahre vorher die ganze Welt an den Bildern der einstürzenden Zwillingstürme in Manhattan berauscht hatte, ohne es glauben zu können. Auf seinem Computer hat er die seltsamen Bewegungen am Horizont betrachtet, das Flackern, die klaffenden, größer werdenden Abgründe, die Mauerflächen, die zu Staubwolken wurden, die Schreie, das Weinen, die verlöschenden Lichter, die auflodernden Brände, und in dieser Weltuntergangsstimmung ein krampfartiges Grollen wahrgenommen, das letzte Röcheln einer sterbenden Stadt. Sobald er die Videos stoppte und aus dem Krankenhausfenster die Ruhe des beginnenden venezianischen Herbstes sah, prallten die beiden Realitäten aufeinander. Seinem Gehirn gelang es nicht, die tragischen Bilder der Vergangenheit und das friedliche Wiegen der Blätter übereinanderzuschieben. Er erlag der Versuchung, das Unerträgliche zu leugnen. Aber wenn er sich auch nur ein wenig bewegte, schmerzten seine Verletzungen und erinnerten ihn daran, dass das Schlimmste tatsächlich geschehen war.
Während er aus Richtung Norden näher kommt, erkennt Guido trotz des Nebels langsam die ockerfarbenen und altrosa Fassaden. Diese Gegend hat weniger gelitten als der Rest der Stadt, trotzdem spürt er einen ersten Stich im Herzen auf Höhe der Basilika San Zanipolo. Er hat das Bauwerk nie gemocht, es war ihm zu pompös. Wenn er Maria Alba ärgern wollte, nannte er es die Dickmadam. Das Einzige, was er lustig fand, waren die drei schmalen Türmchen, die oben an der Fassade wie Zuckerwerk auf einem Hochzeitskuchen aufgesetzt waren. Sie sind ebenso verschwunden wie die Kuppel und ein Teil des Daches, und er stellt sich das donnernde Geräusch vor, das es ausgelöst haben mag, als es mehr als dreißig Meter weiter unten zerschellte. Er wird wehmütig, empfindet fast schon Mitleid mit dem Bauwerk, das die Venezianer acht Jahrhunderte lang begleitet hat. Der Legende zufolge ging der Bau auf einen Traum des Dogen Tiepolo zurück, der sah, wie sich hier ein Taubenschwarm im Sumpf niederließ. Er deutete das als Zeichen von Gottes Segen für diesen Ort, den man ihm somit widmen musste. Wenn Guido Auslandsbesuch empfangen hatte, versäumte er es nie, ihn mit zu San Zanipolo zu nehmen, denn anhand der Marmorgrabmale ließen sich die gesamte Geschichte und das Machtstreben der Stadt erzählen, wobei sich die Maßlosigkeit in dem kolossalen Kirchenschiff und den überladenen Decken der Kapellen widerspiegelte. Vanitas! Vanitatum Vanitas!, der Geldsegen der Dogen konnte die Stadt nicht vor der Verdammung bewahren, in den Schlick zurückzukehren, dem alles entsprungen war.
Abgesehen von der Polizei im Schnellboot, die er umgarnen konnte, indem er sich als Mitglied der Stadtverwaltung auswies, ist er niemandem begegnet. Die Abwesenheit der Menschen ist derart befremdlich, dass sie Guido Angst macht. Natürlich weiß er, dass die Stadt komplett evakuiert wurde, niemand, der überlebt hat, ist noch hier. Die Gefahr durch Gas und Strom war zu groß, eine Katastrophe genügte. Aber die leblosen Fassaden sind ein Albtraum, im wahrsten Sinne des Wortes unmenschlich. Die alten Arbeiterviertel im hinteren Teil der Stadt waren die bodenständigsten geblieben, hier herrschte reger Verkehr von Vaporetti und anderen Schiffen. Jetzt verursacht der Motor des Bootes einen Höllenlärm in der Stille. Guido spürt sein Herz schneller schlagen und gibt Gas. Er muss es wissen.
Er sucht die Briccole, die berühmten dreifüßigen Holzpfähle, die die Kanäle markieren. Viele sind nicht da, wo sie hingehören, und die, an denen er vorbeikommt, ragen kreuz und quer in alle Richtungen, als wären sie bündelweise vom Himmel heruntergeworfen worden. Auf jedem meditiert ein Kormoran oder eine Möwe still vor sich hin.
Auch an der Ostspitze der Stadt packt Guido die Verzweiflung. Die zur Hälfte eingestürzten Steinwände, an denen er entlangfährt, erinnern kaum noch an die Mauer, hinter der sich das Erfolgsgeheimnis der Serenissima verbarg: ihr Arsenal. Guido hat diese Bauwerke gemocht, die, anders als die Basilika, vom venezianischen Genie und Pragmatismus zeugten. Hier war im Mittelalter die Fließbandarbeit erfunden worden. Statt einen Hangar zu nutzen, um ein einzelnes Schiff zu bauen, wurden die gerade fertiggestellten Schiffsböden rund um das zentrale Becken geschleppt, von einer Spezialwerkstatt in die nächste, um sie auszubauen und mit Eisenteilen, Masten, Segeln und Seilen auszustatten, wie heutzutage an einer Produktionslinie. Dante beschrieb es wie die Hölle, in der sich bis zu sechzehntausend Arbeiter plagten, für Guido hingegen war es eher das Paradies, in dem die ihm so wichtige Effizienz auf die Spitze getrieben wurde. Ohne ihr Arsenal hätte die Stadt niemals die Meere beherrscht und zu Sicherheit und Wohlstand gefunden. Im Nebel sucht er den alten Kran und die berühmten Türme zur Bemastung der Schiffe am Eingang, erblickt aber nur schlammbedecktes Geröll.
Als er in den Markus-Kanal einbiegt, macht Guido den Motor auf Höhe des Schifffahrtsmuseum aus und lässt sich bis zur Einmündung des Giudecca-Kanals treiben. Die Septembersonne dringt langsam durch den Dunst und verbreitet ein blassgelbes Licht, das von jedem Tröpfchen reflektiert wird und sich wie ein goldener Schleier über die Ruinen legt. Zum ersten Mal seit seinem ersten Liebeskummer als Jugendlicher muss er weinen. Das Panorama nimmt Gestalt an, prächtig und abscheulich. Nicht ein einziges Bauwerk scheint der gigantischen Hand entkommen zu sein, die anscheinend alles gepackt, zerquetscht und wieder fallen gelassen hat, was der Stolz der Stadt war. Obwohl es ihm so vertraut ist, hat er Mühe, sich das alte Stadtbild vor Augen zu führen, das der Postkarten und Selfies.
Venedigs Architektur hat wegen der hohen Fenster so anmutig gewirkt. Sie sollten die auf Pfählen im Schlick gebauten Gebäude möglichst nicht durch ihr Gewicht beschweren und verliehen der Stadt die Leichtigkeit und die ihr eigene himmelwärts gerichtete Dynamik. Jetzt haben die Fenster den Gebäuden zum Nachteil gereicht, weil sie sie angreifbarer machten. Guido betrachtet die Stadt wie einen Körper, der nach einem Flugzeugabsturz nicht mehr wiederzuerkennen ist. Der Markusplatz, der niedrigste Punkt der Stadt und Überschwemmungen am meisten ausgesetzt, war der Katastrophe schutzlos ausgeliefert. Die berühmte Front des Dogenpalastes, die Säulen, die Spitzbogen und der Balkon sind nur noch ein Haufen Schutt, der sich über den Kai erstreckt und sich mit den Wracks der Vaporetti mischt, die vor sich hin rosten. Auch die beiden seitlichen Mauern sind teilweise eingestürzt. Erhalten geblieben ist einzig die Rückwand, an der die jetzt in alle Richtungen offenen Stockwerke seltsam hängen, was das Ganze wie ein altes Puppenhaus aussehen lässt. Im Licht blitzen die vergoldeten Elemente auf wie Grabkerzen. Die Seufzerbrücke ist zertrümmert worden, weil das Gefängnis nachgegeben hat und nun am Dogenpalast lehnt. Vom Markusdom kann Guido lediglich die beiden Kuppeln ausmachen, die in einem seltsamen Gleichgewicht auszuharren scheinen. Hier und da erinnert ein Teil eines Freskos oder das Gesicht einer Statue an die Vergangenheit. Wo sind die beiden Säulen mit dem weltberühmten Löwen des heiligen Markus und der Statue des heiligen Theodorus, die die Besucher begrüßten? Und der große Campanile, von dem aus Guido seinen vornehmen Gästen die Stadt so gern von oben zeigte? Ist davon etwa nichts als jener Haufen roter Steine übrig, der die Piazzetta versperrt, auf der eine ganze Armada von Gondeln geborsten ist?
Guido erstarrt. Das Ausmaß der Zerstörung ist weitaus größer als das, was die Fotos, Reportagen und leidenschaftlichen Kommentare zeigen, die er sich von seinem Krankenhausbett aus angeschaut hat. Jetzt, wo er dieser Realität allein ausgesetzt ist, spürt er ihre Wucht im ganzen Körper und versucht, sie mit aller Kraft zurückzustoßen. Er sieht alles, aber er begreift nichts, seine Augen nehmen alles wahr, aber sein Gehirn nicht. Linker Hand ist die erhabene Fassade von San Giorgio Maggiore oberhalb des Portals gekappt. An der Stelle, wo der Campanile stand, ist nichts mehr, nichts als goldener Dunst. Könnte er doch nur schweißgebadet aufwachen und seinen Albtraum verfluchen.
Nach einer Weile startet Guido den Motor wieder, um sich dem Canal Grande zu nähern. Er kannte das Stadtbild in- und auswendig. Schon lange war er nicht mehr so überwältigt gewesen wie die Touristen hier an dieser Stelle, wo der Canal Grande mit dem Giudecca-Kanal zusammenfließt und die Punta della Dogana eine magische Schwelle markiert, an der man ins 17. Jahrhundert eintritt, ins Märchenland. Heute hat Guido Schwierigkeiten, die Dogana überhaupt auszumachen, deren Lager offenbar dem Erdboden gleichgemacht sind. Die Kirche Santa Maria della Salute hat besser standgehalten, da sie auf mehr als einer Million Pfähle steht und kein Gebäude in der Nähe ist, das auf sie hätte stürzen können. Sie hat die vielen Statuen verloren, die rund um die Kuppel balancierten, lediglich die Heilige Jungfrau, ganz oben, ist noch da und segnet die Ruinen und die Toten. Sie hat die Stadt einst vor der Pest beschützt. Aber niemand hat sie gebeten, ihre schützende Hand auch bei einer Überschwemmung über die Stadt zu halten.
Guido muss im Slalom um die Schutthaufen herumfahren, die den Canal Grande immer mehr versperren, je weiter er hineinfährt. Die Mauern Hunderte Jahre alter Paläste sind nur mehr bescheidene Backsteingebäude, allesamt nur noch Hindernisse für die Schiffe. Durch die klaffenden Öffnungen erblickt er Bruchstücke von Decken, von Fresken und kaputte Möbel. Guido hat die Kunst des Barock nie geschätzt. Zu viel Gold, zu viele Verzierungen, zu viel Schnickschnack, hätte seine Mutter gesagt. Er verstand, dass die Künstler endlos miteinander gewetteifert hatten, um ihre Kunstfertigkeit hervorzuheben und ihren Mäzenen zu schmeicheln, aber diese Überfülle war für ihn, den Bauern, der er noch immer war, die reinste Zeit- und Geldverschwendung. All das dafür!, denkt er, als sein Blick auf die Fetzen eines Gemäldes an einem Rahmen fällt, der am Kanalufer gestrandet ist. Seit dem Tag nach der Katastrophe haben die großen Privatmuseen, Guggenheim und Grassi, ohne Genehmigung ihre Trupps losgeschickt, um Bilder und wertvolle Objekte zu bergen, die die Katastrophe überstanden haben. Aber in den meisten öffentlichen Gebäuden ist die Mafia am Werk gewesen und hat dank des riesigen Chaos, das überall herrschte, oder gegen Bestechungsgeld alles, was ging, mitgehen lassen. Gemälde und Statuen warten nun in Kellern auf ebenso zahlungskräftige wie verschwiegene Kunden.
Guido kann noch so sehr versuchen, gleichgültig zu bleiben, er ist zutiefst unglücklich. Auch wenn er kein gebürtiger Venezianer ist, ist sein Leben seit mehr als zwei Jahrzehnten mit der Stadt verbunden. Sie hat die großen Schritte seiner beruflichen Entwicklung geprägt, aber noch mehr sein Privatleben. Die Katastrophe hat ihn der vertrauten Orte beraubt, die einen empfangen, sobald man aus dem Haus tritt – die Lieblingsbar, der kleine sonnenbeschienene Platz, der Blick in die Gassen, alles, was das Leben ausmacht und worauf man nicht mehr achtet, aber was einen irgendwo verankert. Von seinem Krankenhausbett aus hat er davon geträumt, dass er sich wieder in Venedig niederlassen kann, so wie es die Überlebenden von Fukushima dort getan haben. Was er nun sieht, macht seine Hoffnungen zunichte, und er fühlt sich selbst genauso zerstört, wie es all die Paläste sind. Die Stadt, in der kein Stein mehr auf dem anderen liegt, wirkt abstoßend wie ein vor aller Augen verwesender Kadaver, wie ein geschändeter Körper. Mancherorts haben Gasexplosionen ganze Stockwerke zertrümmert und zusammen mit Kurzschlüssen anschließend Brände ausgelöst, deren Trümmer und rußige Holzbalken im Dunst aussehen, als würden sie noch immer qualmen. Hinter solchen Mauern haben Menschen gelebt, Pläne geschmiedet, Lust und Leid und großes Glück empfunden. Mit dem Einsturz ist nicht nur die prächtige Architektur verschwunden, sondern mit ihr auch das unscheinbare Leben, das die Stadt zusammengehalten hat. Als er an der Ponte dell’Accademia ankommt, findet Guido nur noch zwei zertrümmerte Bogen vor, die sich einander entgegenrecken wie zu einer unmöglichen Umarmung.
Inzwischen schaut er sich nicht mehr um und konzentriert sich nur noch auf das direkte Umfeld des Bootes, um abzuschätzen, ob er bis zum Palazzo Barbini-Moro durchdringen kann. Sobald die schlichte Fassade auftauchte, wusste er normalerweise, dass er zu Hause war. Er musste nur noch den schmalen Rio del Malpaga hinauf, etwa zweihundert Meter hinter dem Palast festmachen, die drei Stockwerke erklimmen und die Tür der großen, luxuriösen Wohnung hinter sich schließen, die er sein Eigen nannte – sein ganzer Stolz, sein Zufluchtsort.
Aber der Rio ist unpassierbar. An der Einfahrt versperren lauter Gondeln den Weg, die ineinandergeschoben sind wie die Stäbe eines Mikadospiels, aus dessen Mitte ein Bug aufragt, als hielte er Wache, ganz umsonst.
Guido macht den Motor aus. Die gewaltige Stille trifft ihn wie ein Schlag. Wo ist das ständige Surren der Schiffsmotoren geblieben, wo sind die Fernsehgeräusche hin, die aus den Fenstern drangen, und vor allem die Glocken, die unzähligen Glocken, deren beruhigendes Läuten durch die Gegend schwebte?
Als er sich ausmalte, zurückzukehren und wieder hier einzuziehen, hat er nicht damit gerechnet, dass er noch nicht einmal sein Haus erreichen würde. »Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg«, pflegte er früher zu sagen. Als er wieder aufstehen und arbeiten konnte, hat er sich der Illusion hingegeben, die Dinge würden sich ihm schon wieder beugen. Und nun steht er ohnmächtig und bezwungen da. Er schließt die Augen und versucht, sein früheres Leben heraufzubeschwören: die geselligen Abendessen auf der Terrasse mit Wein und Gelächter, Maria Alba, die es so gut versteht, Essen und Menschen zusammenzubringen.
Maria Alba! Ein Schauer überfällt ihn, der nicht der Feuchtigkeit des Herbstanfangs geschuldet ist. Noch etwas, wozu er nicht den Mut gehabt hat. Dem Chaos, das die Katastrophe angerichtet hatte, entsprach das Chaos der Bergungsarbeiten. Die Trümmer wegzuschaffen und so viele Menschen wie möglich daraus zu befreien, war äußerst schwierig inmitten all des Wassers, des Schlamms und der wackeligen Häuser, von denen noch tagelang manche einstürzten. Ein Teil der menschlichen Überreste wurde in den Kühlräumen in Mestre gesammelt und nach Fundorten sortiert, um sie möglichst zuordnen zu können, aber viele wurden versehentlich durcheinandergebracht. Die Behörde hat ihm vorgeschlagen, eine genetische oder morphologische Untersuchung auf der Grundlage von Fotos machen zu lassen, um Maria Alba wiederzufinden. Man hat ihn nach den Kontaktdaten seines Zahnarztes gefragt, weil eine Röntgenaufnahme des Gebisses Aufschluss geben kann, wenn die Leiche verschwunden oder nicht ohne Weiteres identifizierbar ist. Aber der Zahnarzt und seine Praxis sind ebenfalls verschwunden. Und es widerstrebte Guido ohnehin, er hatte nicht den Mut, verspürte nicht den Drang, es aufzuklären. Es schien ihm, als würde er damit Maria Albas Tod besiegeln, und ohne es sich selbst einzugestehen, hoffte er noch, sie wiederzufinden, bewusstlos in irgendeinem Krankenhaus. Angesichts des Ausmaßes der Katastrophe begreift er nun, dass dieser Traum absurd ist. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Doch was ihn in diesem Moment schaudern lässt, ist schlimmer als der Tod seiner Frau, es ist die Vorstellung, dass sie vielleicht noch da ist, ein verwesender Körper unter dem Schutt. Ein schockierend realistisches Bild springt ihn an, Hautfetzen und Knochen, von Maden zerfressenes Fleisch.
Er spürt, wie ein heftiges Verlangen nach ihrer aristokratischen Schönheit wieder aufflackert, nach ihrer trägen Anmut, und er macht sich Vorwürfe, weil er sie vernachlässigt hat. Ihre Ehe war immer mehr zu einer Vernunftbeziehung geworden, vor allem seit er im Stadtrat saß. Die Macht hatte seine Zeit und Energie beansprucht und seine Sehnsüchte bestimmt. Maria Alba war zur Begleiterin verkommen, um nicht zu sagen zum schmückenden Beiwerk. Unweigerlich erschien sie stets an seiner Seite, führte den Haushalt, hörte ihm zu, spreizte ihre Schenkel, sanftmütig wie eh und je und immer darauf bedacht, nie bei einem Fehler ertappt zu werden, wie eine ausgeglichene und zuversichtliche Madonna. Manchmal, wenn er zu spät nach Hause kam, fand er sie mit rot geränderten Augen vor, aber über solche Launen sah er hinweg. Schließlich war sie da, wofür er ihr dankbar war, und achtete darauf, dass es ihm gut ging, aber nicht eine Sekunde lang hatte er sich vorgestellt, dass er sie eines Tages brauchen könnte.
Mit einem Mal ist er wirklich verzweifelt. Er will ihre Arme um seinen Oberkörper spüren, er will sein Gesicht in ihren Brüsten vergraben, er will ihren nach teurem Parfum duftenden Körper, um zu vergessen, um sich wie ein Kind auf ewig einlullen zu lassen, um nicht mehr entscheiden, wählen und kämpfen zu müssen. Er schließt die Augen, er ist noch im Krankenhaus, und sie ist da, am Fußende des Bettes, und wartet, dass er aufwacht. Sie lächelt.
»Guido, mein Liebster, keine Sorge, alles ist gut.«
Nein, sie ist nicht da. Er sitzt allein in der Barkasse inmitten der Ruinen, und er begreift, dass er jetzt immer allein sein wird. In diesem Moment beginnt er, um Maria Alba zu trauern.
Die Augen weiterhin geschlossen, lässt Guido die Katastrophe Revue passieren, als müsse er sich noch einmal davon überzeugen, dass sie wahr ist.
An jenem Abend hatte er das Essen mit den Vertretern der Mailänder Handelskammer abgesagt. Das war kein großes Opfer, diese arroganten Leute gingen ihm auf die Nerven, auch wenn er sie brauchte. Aber das Hochwasser war für 23 Uhr angekündigt, genau für den Zeitpunkt, zu dem er eigentlich nach Hause gekommen wäre. Seit zwei Tagen sprach man von nichts anderem als dem bevorstehenden Acqua alta, und die Wetterdienste hatten es als ernst vorhergesagt. Alle Zeichen standen auf Rot. Es regnete seit fast drei Wochen. Der Po, die Etsch und der Brenta stiegen über die Ufer und hatten trotz der vielen Umleitungen im Laufe der Jahrhunderte dazu beigetragen, den Wasserstand in der Lagune zu erhöhen. Es war ein starker Sturm angekündigt, der bereits die Küsten von Sizilien verwüstet hatte. Noch ärgerlicher war, dass er zeitlich genau mit dem Hochwasser und einem starken Koeffizienten bei Neumond zusammentreffen würde. Seit dem Vormittag blies der Schirokko seinen warmen, aber schonungslosen Atem, der den Canal Grande die Zähne fletschen ließ. Der Wind würde das Wasser der Adria Richtung Norden drücken, durch die Durchfahrten des Lidos, und ein Abfließen verhindern. Kurzum, es waren alle Voraussetzungen für eine starke Überschwemmung gegeben.
Guido war nicht besonders beunruhigt. Das berühmte Sturmflutsperrwerk MO.S.E. würde funktionieren. Er kam gerade aus einer Gemeinderatssitzung, in welcher der Chefingenieur Dalamati sie mit seiner Zuversicht in die Technik gelangweilt hatte. Es hatte vorher bereits Überschwemmungen gegeben, obwohl die achtundsiebzig riesigen absenkbaren Fluttore in Betrieb gewesen waren, die Venedig vom Meer abriegeln sollten, indem sie die drei Zufahrten blockierten. Die Hälfte von ihnen hatte auf halber Strecke geklemmt, und auf dem Markusplatz hatte man wieder Gummistiefel tragen müssen. Aber, so sagte der Ingenieur, dieses Mal würde alles gut verlaufen. Seine Teams hätten das Problem der Verschlammung gelöst, und die Probeläufe in der Woche vorher seien überzeugend gewesen.
»Das ist schließlich auch in Ihrem Interesse«, hatte Bürgermeister Carlo Zongi gemurrt.
Guido wollte unbedingt daran glauben. Er war zutiefst fasziniert vom MO.S.E.-Projekt. Er war noch ein Kind gewesen, als die Intellektuellen davon zu reden anfingen, Venedig für immer zu schützen, die Natur zu überwinden und das Damoklesschwert abzuwenden, das über der Stadt schwebte. Für den Sohn eines armseligen Bauern, der sich täglich den Naturkräften stellte, war es ein Wunschtraum, sie zu bändigen. Zudem war Guido wie die gesamte Nachkriegsgeneration ungeheuer technologiebegeistert. Er hatte noch lange die Zeitungen aufgehoben, in denen das wie Science-Fiction anmutende Projekt dem Volk nahegebracht wurde. Jedes Mal, wenn ein besonders starkes Hochwasser, das zusätzlich von Sturm und Unwetter angefacht wurde, die Stadt zu überschwemmen drohte, hielt es nicht länger an als ein übliches Hochwasser, in Ausnahmefällen vielleicht zwei oder drei Tage. Wenn man nun die Verbindung mit der Adria im kritischen Augenblick unterbrach, konnte man die Wasserhöhe kontrollieren. Aber das Ganze in die Praxis umzusetzen, war komplex. Um die drei Zufahrten zur Lagune zu verriegeln, mussten aneinandergrenzende Stahlkästen in einen Betonunterbau eingelassen werden, jeweils zwanzig mal dreißig Meter groß und dreihundert Tonnen schwer: achtzehn an der Bocca di Chioggia, neunzehn an der Bocca de Malamocco und einundvierzig an der Bocca di Lido. Normalerweise würden sie schön unter Wasser bleiben und die Schiffe passieren lassen. Bei Hochwassergefahr würden sie mit Druckluft gefüllt und dadurch aufgerichtet, um die Stadt zu schützen. Der Name Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MO.S.E.) war mit einem Augenzwinkern in Anlehnung an den aus den Fluten geretteten biblischen Mose gewählt worden, der auf mehreren Fresken in venezianischen Palästen abgebildet war – ausgleichende Gerechtigkeit.
Die Erkenntnis, dass etwas passieren musste, hatte nach dem kritischen Acqua alta vom 4. November 1966 mit einem Wasserstand von einem Meter vierundneunzig eingesetzt. Die Stadt erlebte mehr als fünfunddreißig Jahre lang Gerede, Streit und Untersuchungen, bis Ministerpräsident Silvio Berlusconi 2003 den ersten Spatenstich machte, danach noch einmal siebzehn Jahre Bauarbeiten, technische Rückschläge und gigantische Veruntreuungen, bis das Sperrwerk unter Ministerpräsident Giuseppe Conte 2020 schließlich funktionierte. Das System sollte den uralten Streit von Venedig beschließen. Jahrhundertelang hatte man Pfähle in den Boden versenkt, haufenweise Schlamm befestigt, Flüsse umgeleitet, Dämme gebaut und damit nach einem fragilen Gleichgewicht zwischen Verschlammung und Überflutung gesucht. Mit dem MO.S.E.-Projekt gewann die Stadt endgültig die Oberhand, indem sie nach Belieben das Wasserniveau kontrollieren