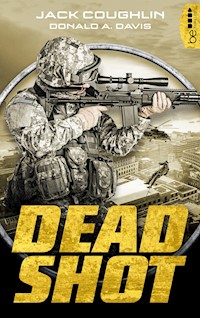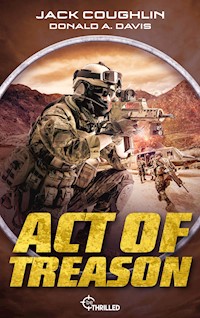
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Scharfschütze Kyle Swanson gerät ins Visier eines Mannes, den er einst vergötterte ...
Gunnery Sergeant Swanson und die attraktive CIA-Agentin Lauren Carson sind auf einer Mission in Pakistan. Aber Swanson wird gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Carson wird beschuldigt, eine Doppelagentin zu sein. Helfen kann ihnen nur der Mann, der sie auf die geheime Operation geschickt hat - Jim Hall, ein legendärer CIA-Agent, Swansons Mentor als Scharfschütze und Carsons Chef und ehemaliger Liebhaber.
Doch Hall spielt ein doppeltes Spiel. Und sein ehemaliger Schützling Swanson ist alles, was ihm dabei noch im Weg steht ...
Der vierte Roman um Sniper Kyle Swanson - spannende Militär-Action von den New-York-Times-Bestseller-Autoren Jack Coughlin und Donald A. Davis. Für alle Fans von Tom Clancy, Lee Child und Will Jordan!
"Coughlin kontrastiert anschaulich das Ethos von Soldaten, die nie einen Kameraden zurücklassen, mit der narzisstischen CIA-Kultur." (Publishers Weekly)
Die Kyle Swanson Thriller in der richtigen Reihenfolge:
1. Kill Zone
2. Dead Shot
3. Clean Kill
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Über die Autoren
Weitere Titel der Autoren
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Scharfschütze Kyle Swanson gerät ins Visier eines Mannes, den er einst vergötterte …
Gunnery Sergeant Swanson und die attraktive CIA-Agentin Lauren Carson sind auf einer Mission in Pakistan. Aber Swanson wird gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Carson wird beschuldigt, eine Doppelagentin zu sein. Helfen kann ihnen nur der Mann, der sie auf die geheime Operation geschickt hat – Jim Hall, ein legendärer CIA-Agent, Swansons Mentor als Scharfschütze und Carsons Chef und ehemaliger Liebhaber.
Doch Hall spielt ein doppeltes Spiel. Und sein ehemaliger Schützling Swanson ist alles, was ihm dabei noch im Weg steht …
Jack CoughlinDonald A. Davis
ACT OFTREASON
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch vonBenjamin Schöttner-Ubozak
Kapitel 1
SHOMALI-EBENE, AFGHANISTAN
Die beiden Humvees der 116. Infanteriekampfbrigade der U.S. Army National Guard befanden sich auf vertrautem Terrain. Der steinige Bergrücken, auf dem sie standen, gab den zehn amerikanischen Infanteristen ein Gefühl von einstweiligem Schutz und Sicherheit. Nach mehreren Stunden schweißtreibender Patrouille war es für sie ein Vergnügen, Feierabend zu machen und in die vorbereiteten Stellungen zurückzukehren.
Ihre Einheit war eine geschlossene Truppe aus Virginia, die seit Jahren zusammen trainierte, und die meisten der jungen Soldaten waren gute Freunde, die allesamt aus den Städten des üppig bewachsenen Shenandoah-Tals stammten. Vier von ihnen waren Afroamerikaner, darunter der bullige Sergeant Javon Anthony. Die 116. konnte ihre Herkunft bis zur berühmten Stonewall-Brigade aus dem Bürgerkrieg zurückverfolgen, aber in der Armee von heute hielt man es für politisch inkorrekt, diesen problembehafteten Abschnitt der amerikanischen Geschichte weiterleben zu lassen. Daher hatte man sich, als die Brigade in die 29. Infanteriedivision eingegliedert worden war, von dem alten blaugrauen Ärmelabzeichen verabschiedet, das den in einen Umhang gehüllten General Stonewall Jackson auf seinem Pferd Little Sorrel zeigte. Nur die Silhouette von »Stony on a Pony« war übrig geblieben.
Sergeant Anthony war das völlig egal. Für ihn beschränkte sich die Geschichte auf die letzte Woche, auf gestern, auf die letzte Stunde. Die Zeit in Afghanistan brachte einen Mann dazu, sich nur auf das zu konzentrieren, was vor ihm lag. Anthony saß in seinem Humvee, lauschte dem Summen des Funkverkehrs und stellte sich die Frage, die jeden Anführer plagte: Habe ich auch wirklich alles getan, was ich tun kann?
Mit seinen dreißig Jahren war der Sergeant der Älteste in der Gruppe, und er kannte jeden seiner Soldaten. Während der gesamten aktuellen Stationierungszeit, die nun schon sechs Monate andauerte, war er mit ihnen zusammen gewesen. Bis jetzt hatten sie Glück gehabt. Keiner von ihnen hatte mehr als einen Sonnenbrand und ein paar Kratzer davongetragen, während sie ihren schier endlosen, eintönigen und gefährlichen Routine-Patrouillendienst verrichteten. Er war froh, als nun die Nacht über die Berge hereinbrach und im Kalender ein weiterer Tag bis zur Heimreise gestrichen werden konnte.
Der Trupp hatte bereits oben auf dem Bergkamm Stellung bezogen. Von hier aus überblickten die Männer einen Sicherheitskontrollpunkt der afghanischen Polizei, der etwa fünfzig Meter entfernt an der im Tal verlaufenden Straße lag. Die grobschlächtig aussehenden Polizisten hatten Fahrzeuge in die vorbereiteten Standplätze gewunken, und ihr Anführer, ein junger Mann, näherte sich den Wageninsassen, um sich eine Zigarette zu schnorren und die Passwörter zu überprüfen. Er trug einen Pakol auf seinem schwarzen Haar – die traditionelle runde afghanische Kopfbedeckung –, eine Tarnuniform aus nicht zusammenpassenden Kleidungsstücken sowie staubige Sandalen. Über die rechte Schulter hatte er eine Kalaschnikow geschlungen, Modell AK-47. Sergeant Abdul Aref war ein großer Mann mit einem schmalen Gesicht, das von einer Hakennase dominiert wurde. Er sprach ein wenig Englisch, und seine besorgten Augen verrieten eines: Er war genauso froh wie Anthony, dass die Amerikaner wie jeden Abend in ihre vertraute Stellung zurückgekehrt waren. Diese zusätzliche Feuerkraft, die sich in unmittelbarer Nähe des Wachpostens der Polizei befand, hatte dazu beigetragen, hier den Frieden zu wahren.
Es war eine taktische Entscheidung gewesen, die US-Truppen als Verstärkung an den Kontrollpunkten entlang der Hauptstraßen in Afghanistan einzusetzen. Die Befehlshaber hatten befunden, dass es ein Fehler wäre, alle Soldaten in große Lager zurückzuziehen, da sie so die Nacht dem unerbittlichen Feind überließen. Die ständige Präsenz an den Checkpoints, verbunden mit der Anwesenheit afghanischer Sicherheitskräfte, bedeutete, die Kontrolle über ein Gebiet zu behalten. Kontrolle wiederum bedeutete Sicherheit, und Sicherheit bildete die Brücke, damit ein regelmäßiger Handelsverkehr möglich war – die Grundlage dafür, dass die Menschen in diesem verwüsteten Land wieder ohne Angst leben konnten.
Javon Anthony wies seine Soldaten an, sich für die Nacht einzurichten. Die Kampflöcher wurden mit Sandsäcken verstärkt, ebenso wie die schrägen Stützwände, hinter denen die Humvees mit der Nase voran parken konnten. Die Maschinengewehre vom Kaliber .50 befanden sich immer noch oberirdisch, von wo aus die Schützen die gesamte Umgebung ins Visier nehmen konnten. Anthony schritt die Stellung ab, überprüfte auch den kleinen Latrinenbereich in einigen Metern Entfernung und vergewisserte sich, dass jeder Mann seine Instruktionen für die kommende Nacht kannte, einschließlich desjenigen, der mit dem Nachtsichtgerät Wache schieben würde, während sein Partner schlief. Als die Dunkelheit über die Berge hereinbrach und die schwindende Dämmerung vom westlichen Himmel vertrieb, warf er einen letzten Blick auf den Straßenkontrollpunkt. Dort unten sah er Sergeant Abdul Aref, hob beiläufig die Hand zur Schläfe, um ihm einen lässigen Gruß zuzuwerfen, und erhielt ein Winken als Antwort.
Zufrieden griff Anthony zum Funkgerät und rief beim sieben Meilen entfernten Hauptquartier seiner Kompanie an, um zu melden, dass sein Team in Sicherheit war. »Saber, Saber. Hier ist Saber Three Alpha.«
»Saber Three Alpha, hier ist Saber. Berichten Sie.« »Verstanden. Three Alpha hat unsere Überwachungsposition eingenommen. Situation normal. Three Alpha, Ende.«
»Verstanden.«
Nachdem diese Formsache erledigt war, hatte er alles getan, was er tun konnte. Anthony belohnte sich selbst mit einem Moment der Entspannung. Seine Augen waren rot umrandet, weil er den ganzen Tag über in die karge Landschaft gestarrt und nach Anzeichen für mögliche Probleme und Hinterhalte gesucht hatte. Schmieriger Dreck und übel riechender Schweiß klebten an seinem Körper und sorgten dafür, dass er sich zusehends unwohl fühlte. Morgen, wenn sie ins Lager zurückkehrten, stand eine Dusche auf dem Programm. Er kippte eine Flasche Wasser hinunter, riss ein Paket mit Notration auf und tat, als wäre es eine richtige Mahlzeit. Danach schlief er auf der Stelle ein.
***
Eine lange Schlange aus Bussen, Personen- und Lastkraftwagen wartete darauf, kontrolliert zu werden, um endlich weiterfahren zu können. Die Fahrer und Passagiere nutzten die Kühle der Nacht zum Reisen, denn tagsüber brannte die sengende Sonne vom Himmel herab. Sergeant Aref beobachtete die Kolonne durch eine Schießscharte in einem Betonbunker am Straßenrand. Eine Metallstange als provisorische Schranke musste von einem Wachmann außerhalb des Bunkers angehoben werden, um die Fahrzeuge nacheinander durchzulassen. Der Bunker verfügte über eine kleine Heizung, die draußen von einem tuckernden Generator angetrieben wurde und gegen die kalte Luft ankämpfte, die sich wie eine Eisschicht von den hohen Gipfeln der Weißen Berge auf das Land darunter hinabsenkte.
Der Kontrollpunkt bewachte eine Landstraße: eine kleine, aber lebenswichtige Route, die einige der Weizenfarmen und Dörfer in der Shomali-Ebene mit den Hauptstraßen verband. Aref hatte Vertrauen in seine Anlage. Betonbarrieren, Sandsackhaufen und stählerne Pfosten zwangen alle Fahrzeuge, sich langsam in die Fahrspuren einzuordnen, bei den Markierungen zu stoppen und schließlich weiterzufahren. Tiefe Wassergräben verhinderten ein Weiterkommen abseits der Straße, falls doch mal ein Fahrzeug durchbrechen sollte. Aref faltete seine Hände und pustete hinein, um sie ein wenig aufzuwärmen.
Die steile, einspurige Straße am Ende des Pandschschir-Tals war bereits benutzt worden, als amerikanische Spezialeinheiten Osama bin Laden durch das Tal und ins nur wenige Kilometer entfernte Pakistan gejagt hatten. Das hatte der gesamten Region unter den Afghanen eine mystischen Ruf verliehen. Wer auch immer diesen Straßenabschnitt kontrollierte, besaß viel mehr als nur ein Stück Erde: Wenn es den Taliban gelänge, den Verkehr hier zum Erliegen zu bringen, könnten die Dorfbewohner glauben, dass Osama mit einer mächtigen Streitmacht zurückgekehrt wäre, um die Ungläubigen zu besiegen. Die Afghanen wussten aus ihrer langen, kämpferischen Geschichte, dass sie am Ende immer siegten, egal, wie lange es dauerte und welcher Preis zu bezahlen war.
Arefs Männer winkten ein Fahrzeug nach dem anderen auf den abgesperrten Parkplatz, wo eine letzte Durchsuchung vorgenommen wurde. Es war ein langsamer Prozess, und die Fahrer wurden ungeduldig, während die lange Schlange von Geländewagen, Privatautos, vollgestopften Bussen, großen Lastwagen und Pick-ups auf ihre Freigabe wartete. Diesel- und Benzinmotoren stießen giftige Abgase aus. Dennoch waren die Fenster heruntergelassen, und aus den Radios ertönte Musik. Einige Fahrer und Passagiere stiegen aus den Fahrzeugen aus, um sich zu unterhalten, während sie darauf warteten, an der Schranke vorgelassen zu werden. Die Soldaten hatten sich um ein kleines Feuer an der Seite versammelt und kochten Tee.
In dieser Nacht ließ sich der Mond nicht blicken, dennoch war der Himmel so klar, dass die Sterne wie kleine Warnlichter blinkten. Allerdings konnte man sie vom Kontrollpunkt aus nicht sehen, weil dort zwei Gestelle mit Scheinwerfern eine helle Kuppel in die Dunkelheit stanzten. Aref warf einen Blick auf seine Armbanduhr: fast ein Uhr nachts. Er beschloss, die Soldatengruppe um das Feuer herum aufzulösen und sie auf Patrouille zu schicken. Es gab keinen Grund zur Sorge. Die heutige Nacht schien nicht anders zu sein als alle anderen in den letzten zwei Wochen auch. Dennoch juckte ihn die Nervosität mehr noch als seine raue Decke.
***
Der Angriff ereignete sich zwei Stunden später, als ein alter Lastwagen in den Kontrollpunkt hineinfuhr. Seine Federn ächzten unter dem Gewicht der Schrottkisten, die mit einer schäbigen Plane abgedeckt waren. Der Fahrer starrte stur geradeaus, als wäre er in Gedanken, dann drückte er auf einen Knopf, um seine Bombe zu zünden – zwei Artilleriegranaten, die an Benzinkanistern befestigt worden waren. Eine gestohlene Kiste mit M84-Blendgranaten lag ebenfalls auf der Ladefläche – vier Behälter in einer Kiste, drei Granaten in jedem Behälter. Die Druckwelle wurde durch nichts aufgehalten, und Vorhänge aus spitzen, schweren Stahlsplittern peitschten durch die Gegend, während die Mischung aus Ammonium und Magnesium in den Granaten für einen gleißenden Lichtblitz sorgte, der tausendmal heller leuchtete als der eines Schweißbrenners. Der Fahrer wurde regelrecht zerfetzt
Javon Anthony hatte durch sein Nachtsichtgerät in die andere Richtung geschaut, dennoch haute ihn die Explosion um. Seine Brille, die das einfallende Licht verstärkte, wurde durch den Blitz erhellt und blendete ihn vorübergehend. Durch das Dröhnen war er nahezu taub geworden, und der Boden unter ihm bebte. Von den Schmerzen in seinen Augen gepeinigt, riss er sich die Brille herunter und schrie: »Alle aufstehen! Jones und Stewart: Nehmt die Gewehre. Alle scharf machen. Sofort!« Er schüttelte den Kopf in dem verzweifelten Versuch, besser sehen zu können, aber es war aussichtlos. Er sah nichts als tanzende rote und gelbe Flächen und spürte, wie warmes Blut aus seinen Ohren sickerte – in beiden war das Trommelfell gerissen.
Kaum hatte die Explosion den Kontrollpunkt erschüttert, pfiff von hinten eine Panzerfaust heran und schlug in einen der stehenden Humvees ein, der sich augenblicklich in einen brennenden Scheiterhaufen verwandelte. Dunkle Schemen krochen aus dem Gewirr von Bewässerungsgräben empor und stürmten den Kontrollpunkt, wobei sie mit automatischen Gewehren und weiteren Panzerfäusten auf die Soldaten schossen. Die überraschten Amerikaner waren kaum in der Lage zu reagieren, geschweige denn zu kämpfen.
Unten war der Kontrollpunkt völlig zerstört worden; an seiner Stelle gab es jetzt nur noch einen rauchenden Krater. Abdul Aref und sein gesamtes Team waren tot – ebenso wie die Insassen aller Fahrzeuge in einem Umkreis von hundert Metern. Autos und Menschen standen in Flammen, ähnelten seltsamen Fackeln in der Nacht, und ein Flügel der angreifenden Truppe wandte sich von den Amerikanern ab und rannte zu den verbliebenen Fahrzeugen, um dort noch mehr Schaden anzurichten. Sie schossen, während sie rannten, und durchlöcherten Autos und Lastwagen mit Kugeln. Mehrere Fahrer hatten es geschafft, von der Straße herunterzukommen; aber auch sie wurden getötet, als sie in einen Graben fuhren oder anhielten, um zu wenden. Ein Fahrzeug nach dem anderen wurde von den wie Vandalen einfallenden Taliban-Guerillas zerstört.
Derweil überrannten weitere Männer mit einem ganz anderen Auftrag die amerikanische Stellung.
Zunächst schoss Anthony fast blind um sich, denn sein Seh- und Hörvermögen kehrte nur langsam zurück. Schließlich nahm er das harte Hämmern des Maschinengewehrs wahr, das sich auf dem verbliebenen Humvee befand.
Er hörte, wie Flüche geschrien wurden. Das war Johnson – der im nächsten Moment in der Explosion einer Panzerfaust verschwand.
Javon Anthony versuchte, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Von überall her hörte der Sergeant das Stöhnen der Verwundeten, einige von ihnen schrien vor Schmerzen. Das Wichtigste zuerst! »Wie viele sind wir noch?«, fragte er laut, immer noch auf dem Boden liegend. Nur drei Stimmen meldeten sich. Dann sauste eine weitere Panzerfaustrakete über ihn hinweg und explodierte in einiger Entfernung. Vor der grellen Feuerwand zeichneten sich die Schatten von Männern mit Gewehren direkt über ihm ab. Er feuerte auf einen.
Anthony kroch zu Jake Henderson hinüber, der sich immer noch bewegte, und schoss. Mit vereinten Kräften brachten sie den Angriff rund um ihren Kampfplatz vorübergehend zum Erliegen.
»Wurdest du getroffen?«
»Nee. Ich war am Boden des Lochs eingeschlafen.«
»Wer ist sonst noch am Leben?«
»Ich habe Eddie Wilson da drüben rechts gehört«, sagte Henderson und wechselte schnell das Magazin.
»Wilson!«, rief Anthony. »Wilson! Wo zum Teufel steckst du?«
Doch Eddie Wilson antwortete nicht. Dann explodierte eine Panzerfaustrakete am Rande des Kampflochs, und Jake Henderson und Javon Anthony verloren augenblicklich ihr Bewusstsein. Die Angreifer überprüften, ob die beiden Amerikaner noch lebten, und als sie einen stabilen Puls feststellten, schleppten sie die beiden weg, um sie gefangen zu nehmen.
***
Bei einem Teil der Taliban-Einheit, die den amerikanischen Trupp angriff, handelte es sich um ein Snatch and grab-Team, ein Eingreif- und Entführungskommando, mit einer besonderen Mission. Während die anderen die eigentlichen Kämpfe ausfochten, nutzten sie das Chaos, um ihren Vorstoß an den Rand der Hauptgruppe zu decken.
Ein junger amerikanischer Soldat lag hilflos auf dem Rücken. Er hatte im Moment der Explosion direkt auf den Kontrollpunkt geblickt und war von der Erschütterung umgeworfen worden. Jetzt rieb er sich die geblendeten Augen und schrie vor Schmerzen. Sein Partner hatte die Taliban-Soldaten kaum erblickt, als sie ihm bereits in den Kopf schossen.
Starke Hände packten Eddie Wilson, und eine Faust schlug ihm so fest in den Magen, dass ihm die Luft wegblieb. Dann wurde er aus dem Kampfloch gezerrt und in den Bewässerungsgraben gestoßen.
Sie warfen ihn mit dem Gesicht voran nach unten in den Schlamm und fixierten seine Handgelenke mit flexiblen Plastikbändern, dann benutzten sie weitere starke Plastikschlaufen, um ihn an den Knöcheln zu fesseln. Wilson versuchte dabei, einen der Männer zu treten, erntete aber bloß einen harten Schlag in die Nieren. Kämpfer des Kommandos bogen seinen Oberkörper schmerzhaft nach hinten und verbanden die Fesseln seiner Knöchel mit denen der Handgelenke. Er hörte, wie Handfeuerwaffen abgefeuert wurden und dass es in der Ferne einige Explosionen gab, aber er lag nun wehrlos auf dem Boden.
Seine Entführer drehten ihn um, sodass sein Gesicht aus dem Schlamm freikam, und er schnappte nach Luft. Ein kleiner Lichtpunkt blitzte im Graben auf: ein Handy.
Wilsons Rücken war zurückgebogen, sein Hals freigelegt. Er schrie erneut auf und fluchte in ohnmächtiger Wut, als eine starke Hand seine Stirn packte und festhielt. Zwei muskulöse Beine schlossen sich um seine Taille.
Er hörte, wie zwei Männer ruhig miteinander sprachen. Dann wurde eine Taschenlampe eingeschaltet, und der helle Lichtstrahl schien ihm direkt in die Augen. Er schrie: »Sergeant! Oder wer auch immer – helft mir! Javon, wo seid ihr denn?«
Der Entführer hinter ihm streckte die Hand aus, und darin sah der Amerikaner die Klinge eines riesigen Messers aufblitzen. »Nein! Nein!«, schrie er und versuchte sich loszureißen, wobei sich seine Augen vor Angst weiteten. »Mama! Hilf mir!«
Der Taliban-Kämpfer drehte die starke Klinge und setzte sie am unteren Halsbereich des schreienden und sich aufbäumenden Soldaten an. Durch die Schneide des Messers entstand eine große tiefrote Wunde, die immer weiter aufklaffte, während sich das scharfe Metall unerbittlich hin und her bewegte. Eine Blutfontäne sprudelte aus Wilsons Hals, als sich der Terrorist langsam durch die Sehnen, die Venen und schließlich durch das Rückenmark arbeitete. Wilsons panische Schreie verklangen zu einem jämmerlichen Wimmern und dann zu einem Glucksen, während sein Kopf abgesägt wurde. Am Ende hob der Taliban-Kämpfer das abgetrennte Haupt mit dem blutüberströmten Hals in die Luft und drehte das Gesicht des Soldaten in Richtung der Handykamera, mit der sein Partner das Geschehen festhielt. Eddie Wilsons letzter Gesichtsausdruck war eine groteske Mischung aus Todesangst, Schock, Unglauben und Überraschung. Dann erlosch die Taschenlampe, und die beiden Männer rannten in Sicherheit, während der geschändete Leichnam des amerikanischen Soldaten zurückblieb.
Javon Anthonys gesamter Trupp war ausgelöscht worden. Sieben Männer wurden bei den Kämpfen getötet, Wilson gefoltert und noch vor Ort enthauptet, während Anthony und Henderson einer brutalen Gefangenschaft entgegensahen.
Zwei Tage später ging der grausame Film von der Enthauptung im Internet viral. Die Terroristen waren nicht länger auf Al Dschasira oder einen anderen Fernsehsender angewiesen, um ihre Schreckensbotschaften in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Mithilfe des Internets konnten sie alles, was sie wollten, direkt in die ganze Welt hinaustragen, und die schrecklichen Bilder vom Tod des jungen amerikanischen Soldaten verbreiteten sich unaufhaltsam wie ein pandemisches Virus im gesamten elektronischen Universum.
Kapitel 2
DAS ARABISCHE MEER VOR SOMALIA
Ghedi Sayid fuhr mit dem Trackball bis zum Menü, klickte und öffnete ein neues Fenster auf dem LCD-Farbmonitor des Radars auf der Brücke der Asad, etwa hundert Meilen östlich der somalischen Küste. Der Computer zeigte etwa zwei Dutzend Fischerboote um ihn herum an, zerschlissene und abgenutzte Dhaus, die ihre Netze auslegten. Sayid hatte geduldig gewartet, als eine neugierige Fregatte der italienischen Marine einen kurzen Halt eingelegt hatte, um die Fischereiflotte zu inspizieren. Alles, was sie gesehen hatten, waren Fischer, die ihrer Arbeit nachgingen, genauso wie sie es in diesen Gewässern seit Jahrhunderten taten, und deshalb war das Kriegsschiff in Richtung Süden davongefahren. Die Asad, das somalische Wort für »Löwe«, war das Mutterschiff, das die Boote koordinierte und den Fang verstaute. Der Punkt, der die italienische Fregatte darstellte, war jetzt nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen, was bedeutete, dass sie sich außerhalb der hundert Meilen Reichweite des Kelvin-Hughes-Radars befand. Zu weit entfernt, um zu helfen.
In der Zwischenzeit kam sein Ziel, der Fang des Tages, immer näher. Es war zu dunstig, um es mit bloßem Auge erkennen zu können, aber das Radar log nicht. Schweißflecken übersäten Sayids dünnes Hemd, das ihm wie ein heißer Lappen auf der Haut klebte, als er sich in seinem Stuhl auf der Brücke zurücklehnte. Die Sonne stand direkt über ihm und kochte die flirrende Luft vor der Küste von Somalias nordöstlicher Region Puntland. Die Besatzungsmitglieder gingen schweigend ihrer Arbeit nach und warteten darauf, dass ihr Anführer eine Entscheidung traf.
Das Radar log nicht, aber der Wetterbericht ebenso wenig. Ghedi Sayid wusste, dass die brütende Hitze einfach zu still war und dass die dunkle Linie, die tief am Horizont hing, die erste aufziehende Gewitterwolke eines größeren Sturms darstellte. Der Zeiger des Barometers fiel zusehends, und die Satellitenbilder zeigten, dass sich die Wolken in einem kreisförmigen Muster zusammenzogen. Ein Monsun war im Anmarsch. Die Fischer hatten per Funk darum gebeten, in den Hafen zurückkehren zu dürfen, aber er hatte ihnen die Erlaubnis verweigert. Was bedeutete, dass sie bei schwerem Seegang schnellstmöglich den Hafen anlaufen müssten, wenn diese Operation nicht bald durchgeführt wurde, und es bestand die Gefahr, dass einige der kleineren Boote kenterten, weil ihre Bordwände nur ein kleines Stück aus dem Wasser herausragten.
Der Somalier, dessen Haut wie Leder war, stieß einen Seufzer aus, aber niemand bemerkte es. Er hatte schon seit Langem geplant, solch eine Beute zu machen. Nachdem die internationalen Seestreitkräfte ihre Präsenz vor der somalischen Küste verstärkt hatten, um die Entführungen von Frachtschiffen gegen Lösegeld zu verhindern, hatte Sayid diese Art von Angriffen aufgegeben. Alle Schlachtfelder entwickelten sich weiter, auch die kleinen auf offener See, und er glaubte, eine Lösung gefunden zu haben, die die Karten neu mischen und die Anstrengungen insgesamt lohnender machen würde.
Eine Luxusjacht, ein großes, vornehmes Schiff, dessen Passagiere vermutlich so reich waren, dass sie eine Million Dollar in bar mit sich führten, kam auf ihn zu und lud geradezu dazu ein, gekapert zu werden.
Er wollte ein paar der namhaften Persönlichkeiten, die auf solchen Jachten residierten, entführen und sie tief im Landesinneren gefangen halten, wo sie niemand finden konnte. Die Lösegelder würden astronomisch hoch sein. Er war sich seiner akribischen Planung sicher. Er musste nur den Sturm überstehen, die Marineschiffe mehrerer Länder austricksen, mutig an Bord gehen, alle Personen auf der Jacht gefangen nehmen oder töten und anschließend das Boot versenken. Das dürfte die Art und Weise, wie das Geschäft mit den Entführungen abgewickelt wurde, grundlegend verändern. Ghedi Sayid würde ein blutiges Exempel statuieren und dafür sorgen, dass Luxusjachten nicht länger als Tabu galten.
Er scrollte weiter und klickte einen leuchtenden Punkt an. Das Bild einer hübschen weißen Jacht erschien auf seinem Bildschirm. Sie fuhr unter britischer Flagge und gehörte einem milliardenschweren Industriemagnaten. Der Mann würde entweder selbst an Bord sein oder schnell bezahlen, um seine Crewmitglieder und etwaige Gäste zu retten, die gefangen genommen wurden. Sayid biss sich vor Vorfreude auf die Unterlippe. Er wählte eine Nummer auf seinem Handy, woraufhin eine verschlüsselte Nachricht an eine sechsköpfige Crew geschickt wurde, die an der Küste nahe der Stadt Eyl bereitstand. Die Männer dort stiegen in ein Schnellboot, warfen einen großen Mercury-Außenbordmotor an und rasten zu einer bestimmten Abfangposition.
Sayid nahm das Zeiss-Fernglas aus seinem gepolsterten Etui und trat auf den Flügel der Brücke, wobei er darauf achtete, das glühende Metall nicht mit der bloßen Haut zu berühren. Sein konzentrierter Blick durchs Fernglas glitt entlang der Achse, wo die Jacht bald auftauchen sollte. Mit leiser Stimme sagte er: »Nun, Vagabond. Willkommen in der Piratenallee!«
***
»Sir! Es sieht so aus, als hätten wir einen Volltreffer gelandet.« Die ruhige, aber bestimmte Stimme des jungen Mannes, der in der Kommandozentrale der Vagabond vor einer Reihe von Bildschirmen saß, erregte sofort die Aufmerksamkeit von Sir Geoffrey Cornwell, des Eigners der Jacht.
»Zeigen Sie es auf Bildschirm zwei, wenn Sie so freundlich wären.« Cornwell betätigte einen Hebel mit seiner rechten Hand, um seinen Rollstuhl in eine bessere Position zu bringen. Das Bild eines kleinen Schnellbootes, das ein »V« aus weißen Wellen hinter sich herzog, kam ins Blickfeld. »Entfernung?«
»Fünfundzwanzig Meilen, Sir. Geschwindigkeit: dreißig Knoten. Es befindet sich auf einem direkten Abfangkurs, seitdem es Eyl verlassen hat.«
»Sehr gut«, sagte Sir Jeff. »Mr Styles. Bitte bringen Sie den Bird näher heran, um festzustellen, wer und was sich an Bord befindet. Gibt es sonst noch etwas in der näheren Umgebung?«
Der Techniker betätigte einen Schalter, und ein paar Meilen entfernt drehte ein kleines Flugzeug, das nicht viel größer als ein Spielzeug war, eine niedrige Schleife, damit die Kamera an Bord das Schnellboot der Piraten heranzoomen konnte. »Keine weiteren Schiffe im Gefahrenbereich, Sir. Eine Fischereiflotte liegt östlich vom Schnellboot. Das nächstgelegene Kriegsschiff ist die italienische Fregatte Espero, die sich gerade aus der Zone entfernt.«
Sir Jeff lächelte breit. »Dann sollten wir jetzt die Snake starten.«
»Aye, Sir.«
»Sind Sie sicher, dass das Ding funktionieren wird?« Kyle Swanson lehnte sich gegen die Rückseite von Sir Jeffs Rollstuhl.
»Diesbezüglich hege ich keinen Zweifel, Gunnery Sergeant. Unser ›Bird and Snake‹ wird nicht versagen.«
Swanson spürte ein leichtes Klacken unter seinen Deckschuhen, als sich irgendwo unterhalb der Wasserlinie der Vagabond zwei Türen auseinanderschoben und ein biegsames schwarzes Objekt von etwa drei Metern Länge aus dem Rumpf glitt und davonschwamm. »Für den Fall der Fälle werde ich ein Scharfschützengewehr besorgen. Wir wollen doch nicht, dass sie sich so weit nähern, dass man in Reichweite von Panzerfäusten ist.«
»Verwirren wir unsere Feinde!« Sir Jeff war in einer geradezu spielerischen Stimmung.
Swanson verließ das sich mittschiffs befindende innere Heiligtum, das Sir Jeffs elektronischer Spielplatz war. Er hatte den alten Mann seit zwei Monaten nicht mehr so energiegeladen erlebt. Obwohl er immer noch nicht wieder laufen konnte, brüllte Sir Jeff Befehle wie Nelson, Hornblower oder Lucky Jack Aubrey, während er den ersten Praxistest ihres revolutionären lasergesteuerten Torpedos orchestrierte.
***
Vor nicht allzu langer Zeit war die Vagabond eher eine schwimmende Krankenstation gewesen, auf der Swanson und Cornwell die einzigen Patienten gewesen waren. Sir Jeff war schwer verwundet worden, als Terroristen sein Schloss in Schottland in die Luft gesprengt hatten – die Tat war Teil eines hochkomplexen Plans, der schlussendlich dem Ziel diente, die Regierung von Saudi-Arabien zu stürzen und die Atomwaffen dieses Landes zu stehlen. Und Swanson hatte beim Aufspüren des Drahtziehers hinter den Anschlägen schwere Verletzungen erlitten. Nun hatten die beiden alten Freunde Wochen der Genesung und der schmerzhaften Physiotherapie hinter sich. Während Swanson bereits wieder auf dem Damm war, hatte Sir Jeff noch einen langen Weg der Genesung vor sich.
Der schottische Milliardär war im Rang eines Obersts des Special Air Service (SAS), einer Spezialeinheit der britischen Armee, in den Ruhestand getreten und hatte sich in die Privatwirtschaft zurückgezogen, wo er eine unerwartete Fähigkeit an sich entdeckt hatte: Gelegenheiten aufzuspüren, wo sie sich boten, und dann in außergewöhnliche wirtschaftliche Erfolge umzumünzen. Er war bereits äußerst wohlhabend gewesen, als er Kyle Swanson, den besten Scharfschützen des U.S. Marine Corps, vor vielen Jahren kennengelernt hatte. Der ruhige, unerschütterliche junge Soldat war ihm vom Pentagon als technischer Berater zur Verfügung gestellt worden, um ihn bei der Entwicklung eines Scharfschützengewehrs von Weltrang zu unterstützen, das sie nach dem mythischen Schwert von König Artus Excalibur tauften. Die Neuerungen, durch die sich dieses Gewehr auszeichnete, erwiesen sich als dermaßen bahnbrechend, dass sie Sir Jeff den Ruf einbrachten, ein visionärer Vordenker bei der Entwicklung von Militärtechnologie und neuen Waffen zu sein.
Nicht zuletzt aufgrund von Swansons Erfahrungen aus der realen Welt der modernen Schlachtfelder bildeten die beiden ein unschlagbares Gespann und entwickelten Strategien, die in der Zukunft zum Sieg führen würden. Der SAS-Oberst hatte seine Holdinggesellschaft in Excalibur Enterprises Ltd. umbenannt, war zum Milliardär mit vielen finanziellen Interessen geworden und hatte im Laufe der Zeit Swanson mithilfe eines Blind Trust zu einem Großaktionär gemacht. Das Pentagon, ihr wichtigster Kunde, segnete das Geschäft ab, obwohl Swanson, solange er noch im aktiven Dienst war, keine Kontrolle über die Gelder ausüben oder sie verwenden durfte.
Es war recht angenehm für ihn, zu wissen, dass er dadurch mittlerweile zum Multimillionär geworden war, aber das Geld hatte für Swanson lange nicht eine so große Bedeutung wie die harmonische Arbeitsbeziehung und der gegenseitige Respekt, die zu einer engen Freundschaft mit Sir Jeff und seiner Frau, Lady Patricia Cornwell, geführt hatten. Er betrachtete sie als die Eltern, die er nie wirklich gehabt hatte. Wo auch immer sie sich aufhielten, fühlte er sich wie zu Hause.
Wenn gerade einmal nichts anlag, verbrachten Swanson und Cornwell Stunden um Stunden damit, Ideen für neue Waffen zu entwickeln. Sie waren sich einig darüber, dass ein neues Zeitalter für einen der ältesten und spezialisiertesten militärischen Berufe angebrochen war – nämlich für den Scharfschützen. Die Fähigkeit, einzelne Ziele mit absoluter Präzision über große Distanzen auszuschalten, machte groß angelegte Militäroffensiven oftmals überflüssig. Die Zeit seit dem fatalen Saudi-Geschäft hatten sie ebenfalls damit verbracht, Ideen zu entwickeln und auszutauschen, und aus diesem ständigen Brainstorming war das »Bird and Snake«-Konzept entstanden, das nunmehr zum Einsatz kam. Die hoch oben am Himmel fliegende Drohne hatte das Piratenboot erfasst und lenkte den im Wasser schwimmenden lasergesteuerten Torpedo.
Die Vagabond hatte sich im Laufe dieser Entwicklung von einem praktisch umhertreibenden Krankenhaus in ein einzigartiges Kommandoschiff verwandelt, auf dem Sir Jeff in seinem Rollstuhl wie die Spinne in der Mitte eines unsichtbaren Netzes agierte. Normalerweise könnte die Jacht ein Spielplatz für die Reichen sein, aber es war nicht ungewöhnlich, dass sie zur Unterstützung amerikanischer und britischer Spezialoperationen eingesetzt wurde. Das friedliche Äußere der Jacht änderte sich nie, nur ihr Inneres und die ihr eigenen Fähigkeiten.
Kyle Swanson stand nun an der Reling auf der Backbordseite des Hauptdecks, und in seinen Händen hielt er das Originalmodell des Excalibur-Scharfschützengewehrs: eine Waffe von außerordentlicher Präzision mit einem Zielfernrohr aus reiner Magie; eine Waffe, die bereits jetzt neue Standards für Präzisionskämpfe setzte. Er spürte ein leichtes Kribbeln in den Nerven vor dem Kampf und hoffte, dass er ein paar Schüsse auf die Piraten würde abfeuern können. Er brauchte keine Medizin mehr – er brauchte ein wenig Action!
***
An Bord der Asad gab Ghedi Sayid das Signal, das die zweite Phase seiner Operation einleitete. Daraufhin löste sich die Fischereiflotte aus ihrer gewöhnlichen Position rund um das Mutterschiff und bildete eine lange Linie quer zu dem Kurs, den die sich nahende Jacht gemäß Sayids Plan gleich einschlagen würde. Der Kapitän des weißen Schiffes war sich offensichtlich noch keiner Bedrohung bewusst und behielt seinen augenblicklichen Kurs bei. Was sich ändern dürfte, wenn er das sich rasch nähernde Schnellboot entdeckte und schließlich realisierte, in welcher Gefahr er sich befand. Dann würde er die Richtung ändern und auf volle Fahrt gehen, um der unmittelbaren Bedrohung zu entkommen. Was ihn wiederum direkt auf die Linie der Fischerboote zutreiben würde.
Sayid war ein Pirat, ein Seemann, ein Terrorist – und auch ein Technikfreak, der Computer und die Bordelektronik dazu nutzte, Vorhersagen darüber zu treffen, was als Nächstes passieren würde. Er glaubte an das alte somalische Sprichwort Aqoon la’aani waa iftiin la’aan: Ohne Wissen zu sein bedeutet, ohne Licht zu sein. Das war der Grund, warum er in einem solch riskanten Geschäft dermaßen erfolgreich geblieben war.
»Lasst unsere Boote zu Wasser!«, befahl er. Daraufhin erwachte ein Kran auf dem Deck zum Leben, und innerhalb von fünf Minuten wurden zwei aufblasbare Zodiacs aus dem Laderaum gehievt, an denen bereits Außenbordmotoren vom Typ Yamaha F250B befestigt waren. Nachdem sie herabgelassen worden waren, kletterte in jedes der Boote ein Trupp von sechs Piraten. Die beiden kleinen Wasserfahrzeuge legten jedoch nicht unmittelbar ab. Erst wenn die Jacht den Kurs wechseln und auf die Fischereiflotte zuhalten würde, kämen die Zodiacs aus ihrem Versteck hinter der Asad hervor und würden sich von beiden Seiten der Beute nähern. Die Jacht, die dann umzingelt wäre, würde sich entweder ergeben oder versenkt werden.
Es ging jetzt nur noch darum, ein paar Minuten zu warten. Sayid wandte sich wieder dem Computer und dem Radar zu. Es hatte sich nichts geändert.
***
Sir Jeff tippte mit den Fingern auf der Tastatur und starrte auf das Video, das in Echtzeit vom kreisenden Bird – dem ultraleichten Spionageflugzeug, das kaum größer als eine Möwe war – an die Vagabond übertragen wurde. Auf den Bildern waren Männer mit Gewehren und Panzerfäusten zu erkennen, die vorne in dem Schnellboot kauerten. Daran bestand kein Zweifel. »Heizen Sie ihnen ein, Mr Styles.«
»Aye, aye, Sir.« Styles drückte einen Knopf, der die Drohne einen Laserstrahl auf die heißen Außenbordmotoren des Schnellboots richten ließ. »Laser eingeschaltet.«
»Geben Sie es an die Snake weiter.«
»Aye, Sir. Snake bestätigt.«
An Deck lag Kyle Swanson in Bauchlage mit dem Excalibur-Scharfschützengewehr, das er aus seiner Schutzhülle genommen hatte, auf einem Stapel gefalteter Unterlagen und starrte durch das Zielfernrohr. Er konnte deutlich das kleine Boot sehen, das mit heftig schaukelnden Bewegungen durch die dunklen Wellen brauste. Immer noch zu weit weg für einen Schuss.
Die Snake hatte sich seit dem Verlassen der Vagabond in Position geschlängelt und eine hauchdünne Antenne hinter sich hergezogen, mit der sie die Signale der kreisenden Drohne auffing. Als sie einen Punkt direkt vor dem entgegenkommenden Piratenboot erreichte, stellte sie ihren kleinen, batteriebetriebenen Motor auf ein Minimum an Geschwindigkeit ein, regulierte den Auftrieb und glitt fast regungslos knapp unter der Wasseroberfläche weiter. Zwei kleine Kammern auf ihrer Oberseite öffneten sich und entließen jeweils einen runden Kanister, der langsam nach oben trieb. Dann fuhr die Snake wieder hoch und schwamm in sicherer Entfernung davon. Die Kanister tauchten in dem Moment an der Wasseroberfläche auf, als das Schnellboot über sie hinwegraste.
Es gab einen grellen weißen Lichtblitz und eine Reihe von dumpfen Explosionen, woraufhin das Schnellboot in einen dichten Rauchschleier gehüllt wurde. Die Wolke färbte sich leuchtend orange, und ein klebriger Nebel legte sich über die Männer und das Schiff. Damit einher ging ein entsetzlicher Gestank, der die Piraten dazu brachte, hustend nach Luft zu schnappen. Der Mann, der das Boot steuerte, vollführte instinktiv wilde Bewegungen, um sich aus dem stinkenden Nebel zu befreien, und verringerte den Schub, da er nicht wusste, was geschehen war. Ein anderer Mann war vor Schreck über Bord gesprungen und schrie jetzt um Hilfe.
»Ha!«, brüllte Sir Jeff. »Beenden Sie es jetzt, Mister Styles!«
»Aye, Sir.«
Die Snake ging ein zweites Mal auf die Jagd. Sie schlängelte sich schnell und lautlos durchs Wasser, bis sie sich direkt unter das inzwischen stillstehende Ziel manövriert hatte. Ein weiterer Kanister wurde freigesetzt und entfachte ein Feuerwerk, das dem eines chinesischen Neujahrsfestes würdig war. Die an Bord verbliebenen Piraten mussten denken, sie wären in eine Geisterwelt hineingeraten, während Funken, maschinengewehrschnelle Detonationen und Flammenblitze aus dem Wasser um sie herum aufstiegen. Die Snake wiederum steuerte auf den sich drehenden Propeller zu, und als sie auf das Metall traf, wurde der Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert.
Durch das Visier seines Scharfschützengewehrs beobachtete Swanson, wie das Heck des Bootes aus dem Wasser gehoben wurde, als die Snake darunter detonierte. Dann kippte das Boot auf die Seite, und die Piraten wurden ins Wasser geschleudert.
»Brücke. Wir sind hier fertig. Zurück nach Hause!« Sir Jeff rollte vom Steuerpult zu einem breiten Fenster und sah mit Vergnügen zu, wie die Piraten hilflos im Wasser strampelten, während ihr zerstörtes Angriffsboot sank. Die Vagabond beschleunigte in einer rasanten Kurve, ging auf volle Geschwindigkeit und verließ das Gebiet auf dem Weg, über den sie gekommen war. Ihr stolzer, spitz zulaufender Bug schnitt achtunggebietend durch die Wellen – fast schien es so, als wollte sie die zurückgelassenen Piraten verhöhnen.
***
In der Ferne wischte sich Ghedi Sayid den Schweiß von der Stirn, seine Augen weiteten sich ungläubig. Sein ganzer Plan hatte sich in einem einzigen Augenblick in Luft aufgelöst. Er hatte sich unbesiegbar geglaubt, aber jetzt musste er feststellen, dass er seinen Gegner in hohem Maße unterschätzt hatte. Neue Fragen schossen ihm durch den Kopf … Quälende Fragen. Konnte er der italienischen Fregatte entkommen, die sicher zurückkehren und die Störung untersuchen würde? Konnte er dem aufkommenden Sturm trotzen? Würden seine Männer ihm noch vertrauen? Oder wäre er morgen bereits tot, und ein anderer Kapitän würde aus seinem Versagen Kapital schlagen? Er bellte eine Reihe von Befehlen, um so schnell wie möglich dem drohenden Unheil zu entkommen, und setzte sich dann in seinen Stuhl, ohne zu wissen, was gerade geschehen war.
Kapitel 3
GILGOT, PAKISTAN
Javon Anthony blickte in den dämmrigen Morgenhimmel. Seine Hand- und Fußgelenke waren mit Klebeband gefesselt, seine Arme gestreckt und hinter seinem Rücken zusammengebunden. Aber immerhin hatten sie ihm weder eine Augenbinde noch einen Knebel verpasst. Er lag auf der offenen Ladefläche eines Toyota-Pick-ups, und sein Atem ging rau und rasselnd, während das Fahrzeug über eine zerfurchte Schotterpiste rumpelte. Anthony stöhnte und veränderte seine Position, um es sich bequemer zu machen. Jake Henderson lag neben ihm. Ein bärtiger Mann, der auf dem Rand der Ladefläche saß, bemerkte, dass der Sergeant wach war, und trat Anthony gegen den Kopf und die Schultern. Die Tritte waren heftig, aber es mangelte ihnen an Kraft, da der Mann Ledersandalen und keine Stiefel trug. Sergeant Anthony stöhnte erneut und wälzte sich in einer Weise, als wären seine Bewegungen eine Folge der Treffer. Er beschloss, zumindest so zu tun, als hätte er abermals das Bewusstsein verloren. Er wollte Wasser. Aber das konnte warten. Er hörte den Wachmann lachen, als der ihm einen letzten Tritt verpasste.
Gewehrsalven und freudige Schreie rissen ihn eine Stunde später aus dem Schlaf. Der Wachmann stand jetzt aufrecht und entleerte das Magazin seiner AK-47 in den Himmel. Andere Gewehre und Pistolen wurden ebenfalls abgefeuert, und der Jubel schwoll an. Anthony war zwar nicht in der Lage, sich aufzusetzen, aber von seiner Position aus konnte er trotzdem die Dachkanten und oberen Ecken einiger Gebäude erkennen. Der Wachmann ging in die Hocke, streckte die Arme nach unten und hob unter Freudenschreien einen kleinen Jungen auf die Ladefläche des Pick-ups. Er war etwa zehn Jahre alt, und seine Augen weiteten sich, als er die beiden gefesselten Soldaten erblickte. »Hallo?«, fragte er grinsend, kniete sich hin und stupste Anthony mit einem Finger in den Oberschenkel. »Hallo?« Dann spuckte der Junge dem Sergeant ins Gesicht. Anthony fühlte, wie die Speichelspritzer ihm über die Stirn liefen.
Der Lastwagen, der immer langsamer geworden war, kam schließlich zum Stehen. Anthony hörte das Gemurmel und Getrampel einer sich nähernden Menschenmenge. Ein Meer aus feindseligen Gesichtern blickte auf die Ladefläche. Der Junge erhob sich und zeigte auf die gefesselten Soldaten. »Hallo!«, schrie er wütend; es war offenbar das einzige englische Wort, das er kannte. Andere stimmten mit ein, bis der ganze Mob unisono »Hallo … Hallo … Hallo« skandierte, als ob er eine Fußballmannschaft anfeuern wollte. Die Menschen verstanden, dass das Wort bedeutete, dass die Amerikaner angekommen waren. Ein paar Männer streckten ihre Hände über die Ladefläche und schlugen auf Anthony ein. Der Lastwagen begann auf seinen abgenutzten Federn zu schaukeln, und ein paar Steine flogen krachend auf die metallene Ladefläche.
Die Heckklappe wurde scheppernd aufgerissen. Männer packten Anthony an den Knöcheln und zerrten ihn aus dem Pick-up. Dann warfen sie ihn auf den harten Boden … Der Aufprall trieb ihm die Luft aus den Lungen. Anthony keuchte, versuchte einzuatmen, während die Meute über ihn herfiel. Er wähnte sich bereits dem Tode nahe – in Stücke gerissen von einem wütenden Mob –, als weitere Wachen herannahten und die Zivilisten beiseiteschoben. Sie stellten Anthony auf die zittrigen Beine, einen Moment später zerrten sie ihn und Henderson weg. Die beiden wurden etwa hundert Meter eine leichte Steigung hinaufgetrieben und dann durch eine große Tür in ein kleines Gebäude mit Lehmwänden und schmutzigem Boden gestoßen. Die Tür schlug zu und wurde von außen verriegelt. Draußen, den Hügel hinunter, brüllte der Mob höhnisch: »Hallo!«
***
Der Name Mohammed Walid war weit über sein Berglager in Wasiristan hinaus bekannt. Sein ganzes Leben hatte er der Aufgabe gewidmet, gegen die Feinde Pakistans und des Islam zu kämpfen. Er war jetzt in den Fünfzigern und seit seiner Zeit als naiver, aber äußerst begabter Schüler der Madrassa, der religiösen Schule in seiner Heimatstadt, weit aufgestiegen: Nach einem höchst erfolgreichen Studium in Frankreich hatte er einen blutigen Weg eingeschlagen und sich bis an die Spitze der Taliban-Führung hochgekämpft. Zwar waren die Taliban fast dem Untergang geweiht gewesen, als die von den USA angeführte Koalition sie aus Afghanistan vertrieben hatte. Doch Walid war es gelungen, einen sicheren Zufluchtsort in den Bergen Pakistans zu errichten und die Truppe Einheit für Einheit zu reorganisieren, sodass sie ihre alte Stärke zurückgewann und wieder kampfbereit war. Und das nicht nur in Afghanistan! Es schien, als könnten seine scharfen Augen alles sehen.
Walid hatte von der Ankunft der beiden amerikanischen Gefangenen erfahren, kaum dass die Lastwagen die zerklüftete Grenze zu Afghanistan überquert hatten und in das lange Tal hineingefahren waren, durch das man in die pakistanischen Stammesgebiete gelangte – das trostlose Wasiristan. Als die Fahrt in dem Dorf Gilgot endete, befanden sie sich nach wie vor auf der Hochebene, etwa acht Meilen von der Grenze und genauso weit von der nächstgrößeren Stadt Wana entfernt. Was bedeutete, dass zwischen Walids Hochburg in den Bergen und den Lastwagen nur ungefähr fünfzig Meilen lagen. Er hatte zuvor den Überfall und die Ermordung der amerikanischen Soldaten genehmigt, aber dass zwei von ihnen nicht getötet, sondern entführt worden waren, kam für ihn überraschend. Außerdem stellte es eine Bedrohung für seine Pläne dar, die beiden Amerikaner nach Pakistan zu bringen. Sie hätten in Afghanistan getötet werden sollen, wo ein offener Konflikt tobte.
Die Vereinigten Staaten würden gewiss Druck auf die Regierung in Islamabad ausüben, damit diese die Soldaten aus den Fängen der Taliban befreite und zurückbrachte. Daher rief Walid seine Berater zusammen, eine Gruppe langjähriger Gefährten, die er die Weisen nannte, und fragte sie: »Was sollen wir wegen der Situation in Gilgot unternehmen?«
»Fariq, der Neffe von Mustafa Khan, dem Dorfvorsteher, trägt die Verantwortung«, sagte einer der hochrangigen Berater. »Wieder einmal.« Er grunzte verächtlich. »Fariq war es, der das Angriffsteam nach Afghanistan geführt und die Gefangennahme der Amerikaner angeordnet hat. Aus unbekannten Gründen beschloss er, sie am Leben zu lassen und sie nach Hause zu bringen. Sein stolzer Onkel plant nun, ihn mit einer Feier zu ehren.«
»Fariq ist ein ehrgeiziger junger Mann«, bemerkte Walid.
»Sehr ehrgeizig«, stimmte der Berater zu. »Vielleicht sogar ein wenig zu ambitioniert.«
»Ich glaube, die beiden Gefangenen werden in Gilgot nicht lange überleben. Was wiederum die Aufmerksamkeit der Amerikaner und der anderen Kreuzfahrerstaaten auf dieses Gebiet lenken wird. Dabei könnten die Gefangenen sich in Zukunft noch als recht wertvoll für uns erweisen.«
»Ja, Anführer. Auf Ihren Befehl hin können wir sie zu uns bringen lassen. Fariqs Männer würden uns keinen Ärger bereiten.«
Nachdenklich verschränkte Walid die Arme vor der Brust und senkte den Kopf, bis sein buschiger Bart den Kaftan berührte. »Wir müssen auch Mustafa Kahn bei Laune halten. Er bewacht das Gebiet für uns und leistet gute Arbeit. Bitte lasst ihn wissen, dass ich ihm Glückwünsche und den Segen Allahs des Barmherzigen dafür übermittle, dass er einen so tapferen jungen Kämpfer in seiner Familie hat. Biete ihm fünfundzwanzigtausend amerikanische Dollar für die Soldaten.«
»Diesen Betrag wird er nicht akzeptieren.«
»Dann soll er eben einen Vorschlag machen. Hauptsache, die Amerikaner befinden sich in Sicherheit, bis wir die optimale Verwendung für sie gefunden haben. Ihr Blut in Gilgot zu vergießen wäre eine nutzlose Geste. Der Stolz eines eigensinnigen Jünglings würde dadurch befriedigt, mehr nicht. Beeilt euch, die Zeit verrinnt!«
Der Weise sollte recht behalten. Das Angebot wurde Mustafa Kahn unterbreitet und abgelehnt. Aber statt eines Gegenangebots kam eine höfliche, an den hochgeschätzten Mohammed Walid gerichtete Einladung, den in zwei Tagen stattfindenden Feierlichkeiten beizuwohnen und bei dieser Gelegenheit seinen Neffen Fariq persönlich kennenzulernen. Das Angebot abzulehnen wäre eine subtile Beleidigung der Autorität des Führers.
»Inschallah«, sagte Walid, als ihm Mustafa Kahns Antwort übermittelt wurde. Das war Gottes Wille. Er wies die Anwesenden an, den Raum zu verlassen, weil er etwas Zeit für sich brauchte, um Allah um Führung zu bitten – und um einen alten Kameraden anzurufen.
***
Jake Henderson war ein gut aussehender junger Mann aus Petersburg, Virginia, der in der Highschool als Schürzenjäger galt, weil er keine Gelegenheit ausgelassen hatte, den Mädchen hinterherzujagen. Er mochte die Frauen, und die Frauen mochten ihn. Die Zeit in der Armee hatte nichts an dem breiten Lächeln in seinem markanten Gesicht geändert. Die Berührung einer Frau, ja allein der Gedanke daran, brachte Jake für gewöhnlich auf Touren. Dass ihn zwei Frauen lachend betatschten und er statt Erregung bloß Todesangst verspürte, war eine Premiere in seinem Leben.
»Was machen die da, Javon? Warum baden sie mich und nicht dich?«
Sergeant Javon Anthony schüttelte den Kopf. »Ich schätze, du stinkst mehr«, antwortete er, und während er die Worte aussprach, wusste er, dass ihm etwas Schreckliches bevorstand.
Beide Männer waren in den letzten zwei Tagen regelmäßig von den Wachen verprügelt worden – mehr aus reiner Brutalität, als um an Informationen zu gelangen. Daher hatte er mit einer weiteren Tracht Prügel gerechnet, als sich die Tür geöffnet hatte und zwei Frauen mit Wassereimern und fein säuberlich gestapelten Kleidungsstücken hereingekommen waren. Zwei Wachen begleiteten sie und zogen Henderson auf die Beine, um ihn kurz darauf von seinen Fesseln zu befreien. Dann traten sie zurück, woraufhin die Frauen an ihre Arbeit gingen. Alle zogen verdrießliche Gesichter, als sie ihn in die Mitte eines Quadrats aus Öltüchern bugsierten. Danach begann eine der Frauen, mit einer Schere die vor Dreck starrende Uniform und seine schmutzige Unterwäsche zu durchschneiden. Die Stiefel hatten sie ihnen beiden bereits am ersten Tag abgenommen, jetzt waren auch noch Hendersons stinkende Socken dran. Alle zerstückelten Kleidungsstücke wurden in eine Ecke geworfen, sodass Jake nackt und schutzlos dastand.
Die Frauen badeten ihn und schrubbten den hartnäckigen Dreck mit einem Stück Seife weg, das nach Blumen roch. Ein Eimer Wasser wurde über seinen Kopf gegossen, und danach kam die Schere erneut zum Einsatz, um sein Haar und seinen Bart zu stutzen. Henderson stand so still wie möglich da, aber die Kälte des Wassers ließ ihn schlottern. Während die jüngere der beiden Frauen sein Haar schamponierte, reinigte die ältere sorgfältig den Schmutz unter seinen Nägeln. Als sie sich über seine Zehen beugte, wanderten ihre Augen zu seinem Penis, der so geschrumpft war, dass man ihn kaum noch sehen konnte. Sie sagte etwas in der Landessprache, woraufhin sich die Wachen vor Lachen bogen; dann benutzte die jüngere Frau Seife und Schwamm, um ihn im Schritt zu waschen, wobei sie ihre Finger länger als nötig auf dem Penis ruhen ließ. Anstelle von sexueller Erregung verspürte Jake einzig und allein Entsetzen. Er wimmerte, woraufhin die ältere Frau beruhigende Laute von sich gab und der jüngeren befahl, mit der Schikane aufzuhören. Sie trockneten den jungen Soldaten mit großen Handtüchern gründlich ab und massierten seine schmerzenden Muskeln anschließend mit einem wohlriechenden Öl.
Javon Anthony begann allmählich zu verstehen, was hier vor sich ging. Bereits den ganzen Morgen über war es erstaunlich laut außerhalb der Hütte gewesen, ja sogar Musik und Gelächter waren vom Marktplatz am Fuße des Hügels zu ihnen herübergedrungen. Und seitdem die Tür geöffnet worden war, hatte er immer wieder einen Blick auf den Platz erhascht: Bunte Banner, befestigt an hohen Masten, wehten dort im Wind. Im Laufe der Stunden hatte er beobachtet, wie die Menschenmenge auf dem Platz stetig anwuchs, während reisende Händler ihre Waren an den Ständen feilboten. Die Wachen waren fröhlich gestimmt, geradezu ausgelassen.
Die jüngere Frau musste mehrmals hin und her laufen, um die weggeworfenen Kleidungsstücke und Reinigungsartikel einzusammeln, und Jake Henderson erhielt ein Paar neue weiße Boxershorts, bevor ihm eine Wache Handschellen anlegte. Diesmal setzten sie ihn auf einen Stuhl, als wollten sie ihn sauber halten, und fesselten ihn wieder.
Auf einer kleinen Bank neben der Tür wickelte die ältere Frau eine dunkle Stoffrolle aus und legte dabei drei lange Messer in verschiedenen Größen frei. Das erste hatte eine breite Klinge im Stil eines Schlachtermessers; das zweite war ein langes Messer mit Wellenschliff, das in einer perfekten Spitze endete und zum Schneiden von Gelenken diente. Das dritte hatte eine schmale, leicht gebogene Klinge mit einem winzigen Haken am Ende, der für die Feinarbeit beim Häuten von Tieren verwendet wurde. »Sie werden mir Schwanz und Eier abschneiden!«, schrie Henderson zu Anthony und fing an, sich verzweifelt auf dem Stuhl zu winden.
Die Frau wog die größte Klinge in ihrer Hand und stellte sich rechts neben Jake, wobei sie ihre Handfläche auf die schlichte rote Tätowierung auf seinem Bizeps legte: das Wort »Jen«, ein Kürzel für Jennifer, den Namen seiner Verlobten. Mit einem Nicken befahl die Pakistanerin den beiden Wachen, Henderson zu fixieren, dann setzte sie routiniert die Klinge an und schnitt vier Linien in seine Haut, die ein Rechteck um die Tätowierung herum bildeten. Seltsamerweise verursachte die Prozedur kaum Schmerzen, und lediglich ein dünnes Rinnsal aus Blut lief Jakes Arm herunter. Die jüngere Frau trat vor und drückte ein Tuch auf die Wunde, um sie abzutrocknen, während die ältere Frau zur Bank zurückkehrte und die Klinge wechselte. Sie hielt das kleine Messer mit dem Haken ins Sonnenlicht, das durch das Fenster hereinfiel, bevor sie zufrieden nickte und sich wieder an die Arbeit machte. Während die Wachen sich abmühten, das Opfer ruhig zu halten, ging sie mit dem gebogenen Ende der Klinge unter einen der vier Schnitte und riss dann mit einer gleichmäßigen Bewegung das Rechteck aus Haut von der darunter liegenden Fettschicht ab. Henderson schrie vor Schmerz und blankem Entsetzen auf. Seine Augen weiteten sich. »Javon! Sie werden mich bei lebendigem Leib häuten!«
Die Frau hielt den Hautfetzen wie eine Trophäe hoch und ließ die Tätowierung vor Jakes Augen baumeln. Dann sagte sie etwas in der Landessprache, woraufhin die jüngere Frau herbeieilte, eine Salbe auf die Wunde strich und Henderson einen dicken Verband anlegte. Erstaunlich wenig Blut sickerte aus der Wunde. Die ältere Pakistanerin kehrte zur Bank zurück und machte sich daran, die Messer gründlich zu reinigen und zu schärfen, bevor sie sie auf das Stofftuch legte, das Ganze wieder zusammenrollte und einen Knoten in das kleine Lederband machte, welches das Bündel zusammenhielt. Schließlich gingen die beiden Frauen und die Wachen fort und schlossen die Tür.
Die Stimmung draußen wurde immer ausgelassener, wie Javon Anthony hören konnte, während er für seinen Freund betete, der an den Stuhl gefesselt blieb und unzusammenhängende Sätze murmelte, als würde er vor Angst allmählich verrückt werden.
Nach einer Weile öffnete sich die Tür zur Hütte, und sechs der Terroristen, die sie gefangen genommen hatten, kamen lachend herein – gemeinsam mit einem beleibten Mann mit dichtem grauem Bart. Der Alte ging direkt auf Jake Henderson zu und beugte sich über ihn, die Hände auf die Knie gestützt.
»Hallo, Amerikaner …« Er sprach Englisch mit einem starken Akzent. »Ich bin Mustafa Khan, der Anführer der Verteidigungsstreitkräfte in diesem Gebiet. In wenigen Minuten wird man uns auf den Marktplatz rufen. Ich selbst werde den Weg an der Seite meines Neffen gehen, des mutigen Kriegers Fariq. Er hat die Elitetruppe in Afghanistan angeführt, die euch aufgemischt hat. Die Menschen sind von überall her gekommen, um sie heute für ihre Taten auf dem Schlachtfeld zu ehren. Dann werden wir dich auf den Platz bringen, und Fariq wird dich persönlich den Frauen als Geschenk und Symbol seines Triumphzugs übergeben. Das wird gewiss ein großartiger Anblick sein. Danach werden wir ein Festmahl veranstalten.«
»Kämpfe gegen sie, Jake! Schlag zurück!«, schrie Javon Anthony, und irgendwie gelang es ihm, sich aufzurappeln; aber sogleich wurde er von den Wachen wieder zu Boden gestoßen. »Zeig den Bastarden, wo der Hammer hängt! Ihr Ziegenficker seid alle tote Leute! Wenn ihr ihm noch einmal so etwas antut, werden die Vereinigten Staaten dieses gottverdammte Dorf dem Erdboden gleichmachen, und wir sehen uns alle in der Hölle wieder!«
Mustafa Kahn ging zu Anthony und verpasste ihm eine schallende Ohrfeige. »Deine Zeit wird ebenfalls kommen, schwarzer Mann. Nur nicht heute. Hab Geduld.«
***
Am Vortag hatten die Vereinigten Staaten unerwartet Informationen über die Gefangenen aus einer sehr zuverlässigen Quelle erhalten, und am frühen Morgen dieses Tages war eine unbemannte Predator-Drohne gestartet, um einen Vergeltungsangriff auszuführen. Sie kreiste nun unbemerkt in neuntausend Fuß Höhe über dem Dorf Gilgot. Zu hoch, um gehört oder gesehen zu werden. Die Fluglotsen auf dem Luftwaffenstützpunkt in Bagram, Afghanistan, überprüften das Zielgebiet mit einer Infrarotkamera. Gestochen scharfe Bilder des Gebäudekomplexes erschienen in Echtzeit auf dem Kommandobildschirm und bestätigten die Meldung, dass ein amerikanischer Soldat während einer Stammesfeier geopfert werden sollte. Die Kamera lieferte auch eine Nahaufnahme des kleinen Gebäudes, in dem die Gefangenen jener Meldung zufolge festgehalten wurden.
Nach dieser Bestätigung wurde, ohne zu zögern, der Befehl zum Vergeltungsschlag erteilt. Zwei Hellfire-Luft-Boden-Raketen glitten von den Schienen unter der Drohne. Angetrieben von Feststoffraketenmotoren, setzten sie zum Flug an und folgten dem unsichtbaren Pfad eines reflektierten Laserstrahls.
Die Hellfires blitzten scheinbar aus dem Nichts am klaren Himmel auf und schlugen in das Dorfzentrum ein. Die beiden zwanzig Pfund schweren Sprengköpfe explodierten fast gleichzeitig unter ohrenbetäubendem Donnern. Die Hütte auf dem Hügel rettete das Leben der Menschen, die sich gerade darin aufhielten; dennoch wankte das kleine Gebäude bedrohlich, als es von einer gigantischen Erschütterungswelle und einem Trümmerregen erfasst wurde. Als Mustafa Kahn sich mühsam zur Tür bewegte, konnte er gerade noch sehen, wie ein riesiger, rot-orange pulsierender Feuerball sein Dorf verzehrte.
Hinter ihm ertönte das wahnsinnige Lachen von Sergeant Javon Anthony, der sich von einer Seite zur anderen wälzte. »Ich hab’s dir gesagt, Wichser! Ich habe versucht, deinen dummen Arsch zu warnen. Da geht deine verdammte Party dahin. Ein gewaltiger Sturm zieht über den Bergen auf, und er kommt direkt auf dieses Drecksloch zu. Du und dein pissiger Neffe werden dabei draufgehen!« Er lachte unentwegt, bis die Wachen ihn bewusstlos schlugen.
***
Der Warlord Mustafa Kahn würde nie erfahren, wie die Amerikaner an die Information gelangt waren, dass die entführten Soldaten in seinem Dorf gefangen gehalten wurden. Er taumelte zwischen den Leichen umher, hörte die Schreie der Verwundeten und sah die Verwüstung, die sich von dem großen Krater am nördlichen Rand des Platzes aus verbreitete. Er hatte versagt: Es war ihm nicht gelungen, seine Leute zu beschützen – das Schlimmste, was einem Stammesführer passieren konnte. Er wollte keinen weiteren Raketenangriff, der ihn entweder auf der Stelle töten oder eine Rebellion entfachen würde, in deren Verlauf Kinder seinen abgetrennten Kopf wie einen Ball herumkicken würden. Noch während Kahn das übliche Versprechen abgab, dass Allah sich an den Amerikanern rächen würde, begann er damit, seinen Neffen und dessen Freunde als verachtenswerte Objekte zu betrachten. Widerwärtige Individuen, die Gilgot ins Verderben gestürzt hatten. Die sechs jungen Kämpfer wurden in seinen Augen zu Gebrauchsgegenständen. Mustafa Kahn war überzeugt, dass er genug geopfert hatte, um ihnen Ehre zu erweisen und seine eigene Würde zu schützen. Jetzt mussten sie gehen.
Er nahm erneut Kontakt mit dem angesehenen Taliban-Häuptling Mohammed Walid auf, um ihm mitzuteilen, dass er die angebotene Summe von fünfundzwanzigtausend Dollar pro amerikanischem Gefangenen nicht nur akzeptieren, sondern begrüßen würde – und dass er das halbe Dutzend tapferer Helden, die sie gefangen genommen hatten, als Bonus dazugeben würde. Das Angebot wurde angenommen, und noch in derselben Nacht trafen drei auf Hochglanz polierte Geländewagen ein, um die Männer abzutransportieren, die sie wie eine Herde Kamele gehandelt hatten. Nichtsdestotrotz waren die jungen Kämpfer froh. Froh, Gilgot lebend verlassen zu dürfen.
Mustafa Kahn konnte sich endlich entspannen, das Geld zählen und gedanklich das Intermezzo als das abheften, was es war: ein einträgliches Unterfangen. Er hatte schon lange ein Auge auf einen majestätischen Jagdfalken geworfen, dessen Besitzer und Trainer etwa fünfundzwanzigtausend Dollar für den wundervollen Vogel verlangte. Jetzt hatte er genug Geld, um das Tier zu kaufen. Selbst wenn er etwa zehntausend Dollar unter den Dorfbewohnern aufteilte, die bei dem Raketenangriff Familienangehörige verloren hatten, blieben immer noch fünfzehntausend für ihn übrig. Außerdem hatte er sich die Gunst des mächtigen Taliban-Anführers Mohammed Walid gesichert.
Kapitel 4
LANGLEY, VIRGINIA
CIA-Direktor Bartlett Geneen und sein Gast übten sich beim Mittagessen in höflichem Schweigen, während philippinische Bedienstete in weißen Kitteln und zerknitterten schwarzen Hosen den Tisch in seinem Büro mit gewöhnlichem Geschirr eindeckten, anstatt das edle Porzellan zu verwenden, das dazu diente, eingeladene Politiker zu beeindrucken. Nachdem die Bediensteten gegangen waren, knabberten die beiden Männer in aller Ruhe an ihren Gemüsesalaten und in Senfsoße sautierten Jumbo-Garnelen. Sie kannten sich schon lange und würden sich zu gegebener Zeit um das Geschäftliche kümmern.
Geneen war ein Überbleibsel aus der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Mark Tracy, dessen Nachfolger Graham Russell ihn abermals ernannt hatte. Dem CIA-Direktor war es während seines gesamten Berufslebens gelungen, sich in der Welt der Nachrichtendienste strikt unpolitisch zu verhalten. Aus seiner Sicht spielte es keine Rolle, wer im Weißen Haus saß, denn er diente dem Amt, nicht dem Mann. Geneen gab ungeschönte Ratschläge, die sich auf Fakten stützten, und aus der politischen Schusslinie hielt er sich gekonnt heraus. Dafür gab es andere Leute. Und einer von ihnen saß derzeit auf der anderen Seite des Tisches.