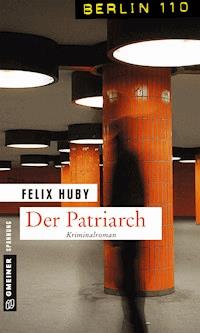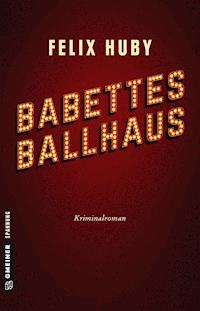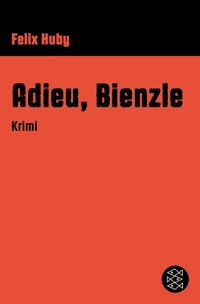
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Bienzle ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Kommissar Bienzles letzter Fall: Ein Mord in der eigenen Familie In Felsenbronn hat Kommissar Bienzle schon einmal ermittelt. Vor fünf Jahren. Damals deckte er eine mysteriöse Mordserie auf (»Bienzle und die letzte Beichte«). Auch diesmal hat der Fall eine lange Geschichte, die Bienzle zurückverfolgen muss, ehe er erste Anhaltspunkte findet. Dabei stößt er auf Ereignisse, die offenbar so brisant sind, dass seine unsichtbaren Gegner nicht vor einem Mordanschlag auf ihn selbst zurückschrecken. Die Bürger der Kleinstadt sind durch den Kommissar nicht nur in ihrer Ruhe gestört, sie haben Angst vor dem, was ans Licht kommen kann. So wird der letzte Fall des scheidenden Hauptkommissars zu einer gefährlichen Mission.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Ähnliche
Felix Huby
Adieu, Bienzle
Krimi
FISCHER E-Books
Inhalt
Montag
Den ganzen Abend schon hatte sie Schmerzen gehabt. Krämpfe in der Brust. Atemnot. Schweißausbrüche. Langsam ging sie durch ihre geräumige Wohnküche, stützte sich an der Kante des Küchenbüfetts ab, hielt sich für Sekunden an der Lehne des alten Sessels fest, der dicht bei dem linken Fenster neben der Tür zum Garten stand. Obwohl sie ihre Tabletten schon genommen hatte, öffnete sie das Röhrchen noch einmal, schüttelte eine Pille heraus und spülte sie mit einem Glas Wasser, das sie unter dem Hahn am Spülbecken gefüllt hatte, hinunter. Danach wurde es ihr ein wenig leichter. Sie schaute auf die Uhr. Mitternacht war längst vorbei. Dreimal war sie schon ins Bett gegangen und jedes Mal nach kurzer Zeit wieder aufgestanden. Aber sie brauchte ihren Schlaf. Das wusste sie. Sieben Stunden mindestens. Sie hielt sich deshalb an das immer gleiche Ritual: Punkt zehn Uhr am Abend putzte sie die Zähne, schlüpfte in ihr Nachthemd und kroch unter das dicke, rot-weiß karierte Plumeau. Sie las noch ein paar Zeilen in der Bibel und schlief darüber ein. Irgendwann in der Nacht kam sie zu sich und löschte das Licht.
Doch heute fand sie keine Ruhe. Sie hatte den alten Frotteebademantel übergezogen und war in ihre Filzpantoffeln geschlüpft. Sie wusste nicht, wie viele Runden sie schon in ihrer Küche gedreht hatte – schwer atmend und schwitzend. Und immer wieder sagte sie sich im Ton ihrer längst verstorbenen Mutter: »Geh aufrecht, Mädchen, heb die Füße!«
Gerlinde Bienzle stieß einen kleinen Seufzer aus. Sie lehnte jetzt an dem alten, braun-gelb gesprenkelten Schüttstein. Immer hatte sie sich dagegen gewehrt, eine neue Küche einbauen zu lassen. Warum eigentlich? Der Steintrog war nur mit Mühe sauber zu halten. Aber Gerlinde war eine Frau, die sich nur schwer von etwas trennen konnte. Dabei wäre so eine glänzende Fläche aus Nirostastahl viel leichter zu pflegen gewesen. Einen neuen Herd hatte sie sich zwar aufschwatzen lassen, aber sie hatte sich hartnäckig geweigert, den alten abzuschaffen. Im Winter kochte sie noch immer über der knisternden Flamme aus brennendem, nach Harz riechendem Holz und Tannenzapfen, die sie selbst gesammelt hatte. An den kalten Tagen wohnte sie dann auch in ihrer geräumigen Küche, schlief auf der alten Ottomane gegenüber der Eingangstür. Das erhöhte Kopfteil des Schlafsofas stieß an die fensterlose Wand, vor der eine kleine Truhe stand, die Gerlinde als Nachttisch diente. Eine einfache Leselampe auf der Ecke des Truhendeckels gab ein warmes Licht, daneben lag die Bibel, der man ansah, dass sie seit Jahrzehnten nahezu täglich im Gebrauch war. Über der Truhe hing ein Bild, das ein weites Getreidefeld zeigte, durch das Jesus mit seinen Jüngern schritt.
Links vom Eingang führte eine Tür zu den oberen Räumen des Hauses. Für sie sei das alles viel zu groß, pflegte Gerlinde Bienzle zu sagen, dabei maß keines der drei Zimmer im ersten Stock mehr als acht Quadratmeter. Ihr Neffe Ernst, der als Leitender Hauptkommissar bei der Kripo in Stuttgart arbeitete, hatte Gerlindes Zuhause schon immer ein »Hexenhäusle« genannt. Sie musste unwillkürlich lächeln, als sie daran dachte. Er war lange nicht mehr dagewesen – der Neffe aus der Landeshauptstadt. Aber vielleicht würde er künftig wieder öfter kommen, wenn er nun in Pension ging. Das hatte er ihr geschrieben. Es klang eigentlich ganz zufrieden, und dennoch konnte sie zwischen den Zeilen eine gewisse Traurigkeit herauslesen. Zum Beispiel aus dem Satz: »Es kann ja auch ganz schön sein, endlich nicht mehr ständig gebraucht zu werden.« Sie kannte ihren Neffen. Für den war das ganz bestimmt nicht schön!
Vielleicht hätte sie ihn zu Rate ziehen sollen, ehe sie damit begonnen hatte, die alten Geschichten wieder aufzuwühlen. Vielleicht hätte sie es aber auch besser ganz gelassen. Nach so langer Zeit. Natürlich kamen diese Unruhe und die Schmerzen in der Brust daher, dass sie – warum eigentlich? – in ihre Erinnerungen hinabgestiegen war. In ihrem Alter sollte man die Dinge doch eigentlich ruhen lassen. Sie hatte die achtzig längst überschritten und wusste um ihre Krankheit, die ihr nicht mehr viel Zeit zum Leben ließ. Trotzdem hatte sie es getan. Oder gerade deswegen.
Gerlinde Bienzle löschte das Licht in der Küche und ging durch die schmale Tür ins Treppenhaus. Zwölf Stufen führten steil in den ersten Stock hinauf. Nach ihrer Gewohnheit schaltete sie kein Licht an. Sie kannte ja jeden Tritt. Oben würde sie gleich links neben der Treppe ihre Schlafzimmertür öffnen und neben dem Türbalken den Schalter drücken.
Das grelle Klingeln ihres Telefons zerriss die dunkle Stille. Gerlinde erreichte den Treppenabsatz und ging nach rechts durch die Tür in ihr kleines Wohnzimmer. Das Telefon stand auf einem Schränkchen direkt neben der Tür. Gerlinde machte Licht, hob ab und schaute gleichzeitig auf die Wanduhr, deren Pendel gleichmäßig hin- und herschwang.
»Ja?«, sagte Gerlinde ins Telefon.
»Ich muss noch mal mit dir reden.« Sie erkannte die Stimme des Mannes sofort.
»Aber doch nicht jetzt!«
»Warum nicht jetzt?«
»Es ist gleich halb drei!«
»Na und? Wir können doch beide nicht schlafen.«
»Na gut, dann rede!«
»Nicht am Telefon!«
»Heißt das, du willst jetzt noch vorbeikommen?«
»Ich bin schon ganz in deiner Nähe. Ich rufe vom Handy aus an.« Er legte auf.
Gerlinde Bienzle starrte noch ein paar Augenblicke lang auf den Telefonhörer. Dann straffte sich ihr kleiner Körper, sie ging ins Schlafzimmer hinüber und kleidete sich sorgfältig an.
Ernst Bienzle kam am Morgen nicht langsam zu sich, tauchte nicht zögernd aus den Tiefen seines Schlafs auf in die Wirklichkeit wie andere Menschen. Er wurde schlagartig wach, und zwar immer zu der Zeit, die er sich am vorausgegangenen Abend vorgenommen hatte. Nur wenn er ausnahmsweise einmal einen Mittagsschlaf einlegte, an einem verregneten Sonntag zum Beispiel, fand er schwer wieder in einen halbwegs wachen Zustand zurück. Dann hatte er Mühe, sich zu orientieren, war grätig, wie der Schwabe sagt, also missgelaunt. Hannelore meinte, das liege an dem schlechten Gewissen, das er habe, weil er, statt irgendetwas zu schaffen, sich habe gehenlassen. Das machte ihn dann noch grätiger, weil er so etwas nicht gelten lassen wollte.
An diesem Morgen wachte er schon eine Stunde früher auf, als er es sich vorgenommen hatte, doch er war auch jetzt mit einem Schlag hellwach. Hannelore neben ihm schlief tief und fest. Sie atmete gleichmäßig, ihre Züge wirkten ruhig und entspannt. Bienzle setzte sich auf, sah zu ihr hinüber, betrachtete ihr schönes Gesicht eine Weile und hatte plötzlich ein ganz warmes Gefühl im Bauch. Vorsichtig schob er sich aus dem Bett und schlich auf Zehenspitzen hinaus.
In der Küche setzte er die Kaffeemaschine in Gang, öffnete die Kühlschranktür, entdeckte ein Stück Leberkäse und schob es, ohne viel nachzudenken, in den Mund. Er hatte vergessen oder verdrängt, dass er seit drei Wochen wieder einmal Diät hielt beziehungsweise es sich vorgenommen hatte. Und als es ihm wieder einfiel, rechnete er den Wert des Leberkäses – waren ja höchstens dreiunddreißig Gramm gewesen – auf vierundsiebzig Kalorien herunter.
Auf dem Küchentisch lag sein Handy. Er klappte es auf und las auf dem Display »Ein Anruf in Abwesenheit«. Er wählte die Mailboxnummer, hörte zuerst seine eigene knarzende Stimme und dann die seiner Tante Gerlinde. »Ernst, ich brauch dich. Ich hab Angst. Vielleicht hab ich was Dumm’s g’macht! Bitte, ruf mich so schnell wie möglich an.«
Bienzle schaute auf die Uhr über der Küchentür, ein berühmtes Modell des Designers Max Bill, es war 6 Uhr 50. Dann prüfte er noch einmal das Display. Seine Tante hatte um 2 Uhr 24 angerufen. Mitten in der Nacht! Bienzle schenkte sich einen Kaffee ein, schlürfte den ersten Schluck und wählte die Nummer seiner Tante Gerlinde. Er wusste, dass sie eine Frühaufsteherin war. Von ihr kannte er den Spruch: »Wer länger schläft als sieben Stund, verschläft sein Leben wie ein Hund.« Gerlinde Bienzle antwortete nicht.
Wenig später wusste er, warum: Gerlindes Nachbarin, Emma Hirrlinger, hatte ihn angerufen. Seine Tante war in der Nacht gestorben. Sie war fünfundachtzig Jahre alt geworden. Bienzle fiel ein, dass der Schwabe in so einem Fall sagt: »Da ischt d’ Hebamm auch nimmer dran schuld!« Aber ihm war nicht nach Scherzen zumute. Er hatte seine Patentante gemocht, sehr gemocht sogar. Hochdeutsch also: geliebt. Und er wurde sofort von seinem schlechten Gewissen gepackt, weil er sich in letzter Zeit so wenig um sie gekümmert hatte.
Er war ihr nächster Verwandter. Deshalb würde er so schnell wie möglich hinfahren müssen. Das wiederum nötigte ihm ein Lächeln ab. Er hatte mit einem Mal einen guten Grund, Urlaub einzureichen. Seine Kollegen und seine Vorgesetzten schienen zurzeit nichts Wichtigeres zu tun zu haben, als seinen Abschied vorzubereiten, und nervten ihn mit immer neuen Fragen. Dass man so etwas feierte, fand er unnatürlich, ja geradezu obszön. Hätte nur noch gefehlt, dass er auch noch für die Kosten des Festes hätte aufkommen müssen.
Als er drei Stunden später über die Waldhöhe kam und in der Senke vor sich Felsenbronn liegen sah, hielt er seinen Wagen an und stieg aus. Er fröstelte ein wenig. Es war Mitte April, aber der Winter hatte sich in diesem Jahr lange und zäh gehalten. Und auch jetzt war es für die Jahreszeit zu kalt, obwohl die Sonne schien und der Himmel sich klar, blau und wolkenlos über die Landschaft spannte. Der alte Stadtkern bildete das Zentrum Felsenbronns. An den Hängen zogen sich Neubausiedlungen hinauf, in denen sich phantasielos gebaute Ein- und Mehrfamilienhäuser aneinanderreihten. Sonst hatte sich nicht viel verändert, seitdem er in seiner Jugend, damals, in den späten fünfziger und den frühen sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, hier alle seine Ferien verbracht hatte. Dort hinten, am gegenüberliegenden Waldrand, stand Tante Gerlindes Hexenhäusle. Man ahnte nicht, dass man von dort nur wenige hundert Meter gehen musste und plötzlich an dem jähen Steilabfall zur Donau stand, die sich ein tiefes Bett in den Fels gegraben hatte.
Es war jetzt fünf Jahre her, da hatte Bienzle hier den Mord an dem Großbauern Paul Autenrieth aufgeklärt, der von einer alten Frau heimtückisch über den Felsrand gestoßen worden war – just an Tante Gerlindes achtzigstem Geburtstag. Und es war nur der letzte Mord in einer ganzen Kette gewesen – alle ausgelöst von dem alten, unscheinbaren Weiblein, das in der Kirche einen Platz gefunden hatte, von dem aus jedes Wort aus dem Beichtstuhl zu hören war. Schrecklich waren manche der Beichtgeheimnisse gewesen – so schrecklich, dass die alte Frau die vom Pfarrer ausgesprochene Vergebung nicht akzeptieren konnte. Also hatte sie auf ihre Weise für Gerechtigkeit gesorgt. Bienzle hob einen kantigen weißen Kalkstein auf und warf ihn ein Stück über das vor ihm liegende Feld. Früher hatte er einmal doppelt so weit werfen können. »’s isch nemme des!«, murmelte er, und eine seltsame Traurigkeit erfasste ihn.
Bevor er in Stuttgart losgefahren war, hatte er Gerlindes Hausarzt angerufen. Dr. Kleinert hatte problemlos Auskunft gegeben. Gerlinde Bienzle sei schon länger herzkrank gewesen. Angina pectoris. Aber eigentlich habe er sie medikamentös gut eingestellt gehabt. Allerdings wisse man bei so alten Menschen nie, was da so zusammenkomme. Jedenfalls sei die alte Dame ganz klar an Herzversagen gestorben, und so stehe es auch im Totenschein, den er noch vor Ort ausgefüllt habe. Bienzle erzählte dem Doktor, dass ihn seine Tante noch in der Nacht versucht habe zu erreichen. Sie habe sehr aufgeregt gewirkt.
»Ja«, antwortete Dr. Kleinert, »vor Aufregungen hätte sie sich natürlich in Acht nehmen sollen.«
Gegen elf Uhr am Vormittag traf Bienzle vor dem Häuschen seiner Tante ein. Einen Augenblick stand er ganz still an dem schmalen Törchen, vor sich den gepflegten Vorgarten. Links die Gemüsebeete, rechts die Blumenrabatten. Alles wie immer in feinster Ordnung. Einen Moment glaubte er, gleich müsse sich die grüngestrichene Tür öffnen, die direkt in die Wohnküche führte, und seine Tante Gerlinde werde heraustreten. Sie war immer mit kurzen, schnellen Schritten auf ihn zugekommen, hatte ihn an beiden Oberarmen gefasst – zu mehr Zärtlichkeiten reichte es bei ihr nicht –, und dann hatte sie immer das Gleiche gesagt: »Gut siehst aus, und groß bist worden!« Bienzle spürte einen Stich in der Herzgrube. Er stieß das Gartentor auf und schritt über den Plattenweg auf die schmale Giebelfront zu.
In Gerlindes Schlafzimmer hatten sich ein paar Nachbarinnen versammelt. Die Leichenwäscherin war schon dagewesen, hatte aber nichts unternommen. Warum auch? Gerlinde Bienzle lag ruhig auf dem Rücken in ihrem Bett. Sie trug ein hellblaues Kleid mit einem runden Spitzenkragen. Ihre Füße steckten in Schuhen mit einem kleinen Absatz. Ihre Haare waren ordentlich gerichtet.
»Genauso habe ich sie gefunden«, sagte Emma Hirrlinger, die Nachbarin. Die beiden hatten jeden Morgen nach einander geschaut. Mal die eine, mal die andere, wer halt zuerst den Tag angefangen hatte. »Man hat ja nie gewusst, wann man Hilfe braucht«, sagte Frau Hirrlinger. »In unserem Alter. Aber ich hab ihr ja heut Morgen nimmer helfen können.«
Bienzle nickte und überlegte, wo sonst in unserer Welt solche Absprachen auf Gegenseitigkeit wohl noch funktionierten. »Und Sie haben meine Tante so angetroffen? Lag sie denn angezogen auf dem Bett?«
»Ja!«
»Aber …«
»Ja, ich weiß, das war überhaupt nicht ihre Art!«, unterbrach ihn die Nachbarin.
Bienzle nickte. »Sie hat heute Nacht versucht, mich zu erreichen«, sagte er. »Kurz vor halb drei.«
Ernst Bienzle verließ das Schlafzimmer und ging in Gerlindes kleines Wohnzimmer hinüber. Er schloss die Tür hinter sich und wählte die Nummer des Arztes. »Herr Dr. Kleinert, können Sie mir sagen, wann genau meine Tante gestorben ist?«
Kleinert lachte ein bisschen. »Da fragt der Kommissar, was? – Todeszeitpunkt? Also ich bin ja kein Gerichtsmediziner«, wieder lachte er leise, »aber nach der Leichenstarre zu schließen und wenn man die Temperatur im Haus berücksichtigt, würde ich denken, so um halb vier rum. Warum fragen Sie? Sie werden ja wohl kaum einen Mord in Erwägung ziehen.«
»Ich weiß nicht«, sagte Bienzle. »Wahrscheinlich nur so ein beruflicher Reflex.«
»Das wird sich geben«, sagte Kleinert, »wie ich höre, gehen Sie ja demnächst in den Ruhestand.«
Bienzle ärgerte sich, dass ihn der Doktor daran erinnerte, und legte auf, ohne noch etwas zu sagen.
Wieder im Schlafzimmer, setzte er sich in einen Schaukelstuhl, der in der Ecke stand und den er selbst einmal seiner Tante geschenkt hatte. Wenn er sich recht erinnerte, zu ihrem sechzigsten Geburtstag.
»Wenn Sie mit ihr allein sein wollen …« Frau Hirrlinger ließ den Satz in der Luft hängen. Die anderen Frauen waren inzwischen gegangen.
»Ja«, sagte Bienzle. »Nur eine Frage noch: Ist Ihnen was aufgefallen heute Nacht?«
Frau Hirrlinger dachte nach. »So gegen drei Uhr bin ich mal kurz aufgewacht. Wegen dem Hund, der angeschlagen hat. Der Hasso – ein Stück den Weg hinauf. Ich bin dann aber gleich wieder eingeschlafen.« Frau Hirrlinger ging hinaus.
Bienzle saß unbeweglich in dem Schaukelstuhl, den schweren Oberkörper weit nach vorne geneigt, die Ellbogen auf den Knien. Klein, zart und zerbrechlich lag sie da auf ihrem Bett, seine Tante Gerlinde. Die Hände hatte sie gefaltet, aber das konnte die Nachbarin getan haben, die ihr ja auch die Augen zugedrückt hatte. Das Gesicht mit den vielen feinen Falten sah seltsam angestrengt aus. Das Kinn war nach vorn geschoben, die Backenknochen waren aufeinandergepresst. Von einem friedlichen Ausdruck im Antlitz der Toten konnte keine Rede sein.
»Sie sah aus, als ob sie ausgehen wollte oder einen wichtigen Besuch erwartet hätte. Mich hat sie exakt um 2 Uhr 24 angerufen und auf die Mailbox gesprochen: ›Ernst, ich brauch dich‹, hat sie gesagt. ›Ich hab Angst. Vielleicht hab ich was Dumm’s g’macht!‹ Und um die fragliche Zeit schlägt hier in der Nachbarschaft ein Hund an.«
»Bienzle, was willst du?«, sagte Hannelore am anderen Ende der Leitung. »Glaubst du, sie ist ermordet worden? Das ist doch absurd.«
Bienzle saß noch immer in Tante Gerlindes Schaukelstuhl, hatte aber seine starre Haltung aufgegeben. Er wippte leicht hin und her, während er telefonierte. »Ich hab ein Gespür für so was!«
»Jetzt hör aber auf!« Hannelore atmete tief durch. »Weißt du, was ich glaube? Du suchst dort in Felsenbronn einen Mordfall, damit du dich hier um nichts kümmern musst.«
Bienzle betrachtete angelegentlich die Fingerspitzen seiner linken Hand und sagte dann langsam: »Der letzte Mordfall des scheidenden Kommissars, und das Opfer ist seine eigene Patentante. Ist das nichts?«
»Bienzle, du bist pervers.«
»Du nennst das sonst ›déformation professionnelle‹.«
»Das wäre in diesem Fall viel zu milde«, sagte Hannelore und legte grußlos auf. Deshalb hörte sie auch nicht mehr, wie Bienzle sagte: »Ich lasse sie obduzieren! Und zwar von Kocher persönlich. Der muss her. Wenn ich das nicht schaffe, brauchen die mich zu meinem Abschied auch nicht zu feiern!«
Ernst Bienzle hatte überlegt, ob er sich ein Zimmer im Gasthof Adler nehmen sollte, entschloss sich dann aber, die Ottomane in Gerlindes Küche zu beziehen und dort zu schlafen. Zuvor aber wollte er ins Städtchen, um etwas zu essen. Er ließ den Wagen stehen und machte sich zu Fuß auf den Weg, der an einem schmalen Bach entlangführte. Das Ufer war von Erlen und Weiden gesäumt. Die Zweige zeigten einen ersten grünen Schimmer. Am Ende würde sich der Frühling doch nicht aufhalten lassen. Der weiche Boden des Wiesenweges gab bei jedem Schritt ein wenig nach. Schleierwolken waren wie lichte Vorhänge aufgezogen. Ein kühler Wind blies Bienzle ins Gesicht. Es war nicht ausgeschlossen, dass es in dieser Nacht noch einmal Frost geben würde.
Im Gasthof Adler herrschte wenig Betrieb. Bienzle hängte Hut und Mantel an die Garderobe und setzte sich an einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen. Vier Männer am Stammtisch, im Augenblick außer ihm die einzigen Gäste, sahen zu ihm herüber, musterten ihn ungeniert und begannen dann eine geflüsterte Unterhaltung.
Die Wirtin, eine dralle Rothaarige um die fünfzig, kam aus der Küche. Sie erkannte den neuen Gast sofort. »Ja, der Herr Bienzle. Ich hab ja halb und halb mit Ihnen gerechnet.« Damals, als er im Fall Autenrieth ermittelt hatte, hatte er hier, im Gasthof Adler, logiert.
Die Wirtin machte Anstalten, sich zu ihm zu setzen, aber er sagte rasch: »Wenn Sie mir bitte ein ganz schnelles Bier bringe könntet. Und die Speisekarte.«
Das Geschäft ging vor. Deshalb kehrte die Wirtin an den Tresen zurück und begann sofort, ein Bier zu zapfen, was sie aber nicht daran hinderte, laut herüberzurufen: »Mein herzliches Beileid auch noch. Es tut uns allen arg leid um die Gerlinde.« Vom Stammtisch kam zustimmendes Gemurmel.
Bienzle lehnte sich weit zurück, streckte die Beine von sich und schloss die Augen. Gerlinde war bei allen Leuten beliebt gewesen. Sie hatte nie mit jemandem Streit gehabt. Auseinandersetzungen war sie immer aus dem Weg gegangen. »Ich streit mich mit niemand, schon gar nicht mit einem Bösen«, hatte sie immer gesagt. »Wenn man einen rußigen Hafen anlangt, wird man selber schwarz!« Wer also sollte ein Motiv gehabt haben, die alte Frau umzubringen? Ein Raubmord schied aus. Es fehlte ja nichts in ihrem Häuschen. Mit den Nachbarn lebte sie in Frieden. Verwandte, die auf das kleine Erbe spitz gewesen sein könnten, gab es nicht. Bienzle war der einzige. »Und ich hätt ein Alibi«, sagte er leise zu sich selber. Er machte die Augen wieder auf.
Die Wirtin stellte sein Bier auf den Tisch und fragte: »Wisset Sie scho, was Sie esse wollet?«
Bienzle nickte: »Einen Zwiebelrostbraten mit Spätzle, aber bitte keine Sauce dazu. Ich mach grad eine Diät.«
Die Wirtin sah ihn an, schüttelte den Kopf und sagte: »Und da meinet Sie, die Sauce reißt’s raus? Soll ich denn dann auch noch den Fettrand vom Fleisch wegschneiden?«
»Ja nicht!«, rief Bienzle. »Dann schmeckt’s ja net!«
»Und Spätzle ohne Sauce schmecket glei zweimal net!«, gab die Wirtin zurück.
Bienzle nickte. »Also mit Sauce, bitte!«
Am Stammtisch erhob sich ein Mann, der ungefähr in Bienzles Alter war. Er hatte Schwierigkeiten aufzustehen, musste zuerst sein Kreuz geradeziehen und kam dann mit steifen Schritten herüber. »Du kennst mich nimmer, gell?«
Bienzle trank einen langen Schluck, setzte sein Glas ab, betrachtete das Gesicht des Mannes und sagte schließlich: »Wenn du der Uli Schlickenrieder bist, hab ich dich früher amal ganz gut gekannt.«
»Darf ich?«, fragte der andere.
Bienzle machte eine einladende Geste. Der Mann ließ sich genauso schwerfällig nieder, wie er zuvor aufgestanden war. »Ich hab’s gottsallmächtig im Kreuz.«
»Dann sind wir Leidensgenossen.« Bienzle nahm noch einen Schluck. Das Glas leerte sich schnell.
Früher, vor über fünfzig Jahren, hatten sie miteinander gespielt, wenn Bienzle in den Ferien bei seiner Tante gewesen war. Uli war kein Baum zu hoch gewesen, um hinaufzuklettern, die Donau nicht mal bei Hochwasser zu reißend, um darin zu schwimmen. Und er war der beste Fußballspieler gewesen.
»Man darf nicht drüber nachdenken«, sagte Bienzle.
»Wo drüber?«
»Über den Verfall!«
Schlickenrieder nickte. »Das Alter ist eine einzige Beleidigung! Deine Tante hat ’s gut, die hat ’s hinter sich.«
Bienzle wiegte seinen Kopf hin und her. »Ich glaub, sie hätt gern noch a Weile g’lebt.«
»Stimmt. Man hat sie nie klagen hören.«
»Deshalb solltet mir auch damit aufhören, Uli, oder? Wie geht’s dir sonst?« Bienzle wunderte sich über sich selbst. Er war nicht gesprächig, und mit Leuten, die ihm nicht vertraut waren, redete er nur das Nötigste. Aber jetzt hatte er richtig große Lust, sich mit diesem alten Freund aus der Kindheit zu unterhalten.
Der Rostbraten war genau richtig, und der Wein, den Bienzle ausgesucht hatte, ein Uhlbacher Lemberger, passte gut dazu. Also bestellte er eine Flasche und ein zweites Glas für Uli Schlickenrieder. Sie saßen noch lange zusammen, auch als die anderen Gäste gegangen waren. Kurz vor Mitternacht traten sie auf die Straße hinaus. Es hatte zu schneien begonnen. Dünne Flocken rieselten herab und schmolzen auf der Straße zu Wasser. Auf Bienzles Hut blieben sie wie ein Hauch von Puderzucker liegen.
»Das hat mir jetzt g’fallen«, sagte Uli Schlickenrieder, und der Kommissar nickte nachdrücklich dazu. Sie reichten sich die Hand und gingen in verschiedene Richtungen davon.
Bienzle stapfte über den Wiesenweg am Bach entlang zurück zu Gerlindes Häuschen. Er war noch keine hundert Schritte gegangen, da hörte es auf zu schneien. Die Wolken rissen auf, und ein unnatürlich großer, heller Mond beleuchtete die Landschaft. Der Rand des dichten Tannenwaldes auf dem Hügel jenseits des Bachs wirkte gegen den helleren Himmel wie ein Scherenschnitt.
Nach einer guten halben Stunde erreichte Bienzle das Hexenhäusle. Er legte die Hand auf die Klinke, schob den Schlüssel ins Haustürschloss und wunderte sich, dass die Tür aufschwang, ohne dass er ihn gedreht hatte. Bienzle glaubte sich zu erinnern, dass er abgeschlossen hatte. Oder hatte er es doch nicht getan? Er blieb stehen und dachte angestrengt nach, kam aber zu keinem Ergebnis. Endlich zog er die Tür vollends auf, betrat die Wohnküche und machte Licht. Alles war, wie er es verlassen hatte. Nur die rechte untere Tür des Küchenbüfetts stand zwei oder drei Zentimeter offen. Einem anderen Menschen wäre das womöglich nicht aufgefallen. Aber Bienzle hatte viele Jahre trainiert, kleinste Veränderungen in einem Bild, das er einmal mit den Augen aufgenommen hatte, zu registrieren. Zwar war er sich nicht mehr sicher, ob er die Haustür abgeschlossen hatte. Aber dass die Tür im Büfett zu gewesen war, wusste er genau. Er ging in die Hocke und wunderte sich, wie leicht ihm das auf einmal fiel. »Ja, ja, der Wein«, sagte er leise. Er besah sich die beiden Fächer im unteren Teil des Büfetts. Aber da war nichts zu entdecken, was ihn hätte irritieren können. Er erhob sich wieder, ächzte aus Gewohnheit, obwohl er mühelos hochkam, und stieg die Treppe hinauf, um Bettzeug aus Gerlindes Wäschekommode zu holen. Im Stillen verfluchte er sich, dass er die Ottomane nicht vor seinem Ausflug ins Städtchen bezogen hatte.
Der Leichnam seiner Tante war am Nachmittag abgeholt worden und befand sich nun in der Aussegnungskapelle auf dem Friedhof. Man würde sich dort wundern, wenn morgen der Wagen der Gerichtsmedizin kam, um die Tote zur Obduktion abzuholen. Der Kommissar hatte erreicht, dass der Pathologe in Tübingen damit einverstanden war, Dr. Bernhard Kocher in die Untersuchung mit einzubeziehen. Bienzle hätte gerne geglaubt, dass dies seiner Autorität zuzuschreiben war. In Wirklichkeit galt die Wertschätzung des Tübinger Mediziners seinem Stuttgarter Kollegen Dr. Kocher, der in letzter Zeit durch mehrere Artikel die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf sich gezogen hatte.
Bienzle warf ein Laken über die Ottomane, zog eine dicke Wolldecke in einen Bettbezug und nahm ein Sofakissen unter den Kopf. Er verschob das Zähneputzen auf den nächsten Tag und tröstete sich damit, dass Wein eine desinfizierende Wirkung habe. Fünf Minuten später war er eingeschlafen.
Dienstag
Geweckt wurde er lange vor dem Moment, den er sich vorgenommen hatte, von einem vielstimmigen Vogelchor. Die Tiere sangen, zwitscherten und tirilierten um die Wette. Irgendwo hatte er einmal gelesen, dass die männlichen Vögel im Frühjahr so ihr Revier abstecken und zugleich ein Weibchen anlocken wollten. Ihr Gesang und ihr Gezwitscher klangen wunderbar und störten ihn doch. Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass es vier Uhr morgens war. Gerlinde war jetzt vierundzwanzig Stunden tot. Bienzle zog die Decke über den Kopf, und nach einer Weile schlief er wieder ein.
Kurz nach acht Uhr trat er vor die Tür des Häuschens. Die Wolken hatten sich verzogen. Hinter den Hügeln am östlichen Ortsrand stieg die Sonne herauf. Bienzle deutete zwei, drei Kniebeugen an und beendete danach sofort seinen Frühsport. Er ging ins Haus zurück und setzte Kaffeewasser auf. Im Kühlschrank fand er Eier, ein paar Scheiben Wurst, einen Camembert, der noch nicht geöffnet war, eine Tüte Milch und einen Becher Joghurt. In einer Metallkiste lag ein halber Laib Bauernbrot. Er stellte alles auf den Küchentisch, zog ihn vor die Ottomane, schob das Bettzeug nur nachlässig zur Seite und ließ sich mit einem zufriedenen Seufzer auf seine Bettstatt sinken.
Jetzt erst fiel ihm ein, dass die Ottomane früher nicht hier gestanden hatte. Nur der Tisch mit vier Stühlen darum, die Truhe und das Küchenbüfett. Später war dann der Kühlschrank mit dem Tiefkühlfach dazugekommen.
Damals, als er noch ein Kind war, hatte es in Gerlindes Häuschen auch kein Badezimmer gegeben. Am Samstag wurde die Zinkbadewanne aus der Abstellkammer geholt und in der Küche aufgestellt. Gerlinde machte in einem Waschkessel das Wasser heiß, goss es mit einer großen hölzernen Schöpfkelle in die Wanne und füllte so lange mit kaltem Wasser auf, bis die Temperatur erträglich war.
Der kleine Ernst musste sich freilich nur selten den Baderiten der Tante unterziehen; denn im Sommer ließ sich der Bach hinterm Haus so weit aufstauen, dass man darin vier, fünf Züge schwimmen und nach Herzenslust herumtoben konnte. Das war überhaupt seine Lieblingsbeschäftigung gewesen, einen Damm aus Lehm, Reisig und Steinen von Ufer zu Ufer zu bauen. Schon am ersten Tag nach Ernst Bienzles Ankunft kam auch Uli Schlickenrieder und zog einen Handwagen hinter sich her, auf den er Steine und anderes »Baumaterial« geladen hatte. Am späten Nachmittag war der »Gumpen« dann fertig und zog noch mehr Kinder aus der Nachbarschaft an.
Gerlinde liebte das Treiben hinter ihrem Haus. Sie kam dann irgendwann mit einem Küchenstuhl, stellte ihn unter eine Weide und setzte sich, um den Kindern zuzuschauen. Zwischendurch ging sie in ihre Küche, schmierte ein paar Butterbrote und mischte aus ihrem selbstgefertigten Fruchtsirup und Wasser in einem Tonkrug einen Saft. Die ganzen Köstlichkeiten brachte sie auf einem Tablett, das sie neben ihrem Stuhl ins Gras stellte. Wenn sich dann Ernst und seine Freunde darüber hermachten, stieß sie ab und zu einen wehmütigen Seufzer aus. Als sie ihr Neffe eines Abends fragte, warum sie denn immer so komisch laut schnaufe, wenn sie den Kindern zusehe, sagte sie: »Ach weißt, ich hätt halt so gern selber Kinder g’habt!«
Bienzle stand auf, räumte das Frühstücksgeschirr in die Spüle und das Essen in den Kühlschrank. Dann stieg er die Treppe hinauf in Gerlindes kleines Wohnzimmer, das er Hannelore gegenüber immer nur als die Puppenstube bezeichnet hatte. Ein Ohrensessel, daneben eine Stehlampe, ein kleiner runder Tisch, ein kleines Bücherregal und ein mächtiger Eichenschrank mit abweisenden schweren Türen – das war die ganze Einrichtung. Auf dem Dielenboden lag ein Flickenteppich mit Fransen, die Gerlinde jeden Morgen glattkämmte. Vor dem einzigen Fenster hingen zur Seite geraffte Gardinen aus Tüll. Bienzle ging zu dem Sessel und griff in den Spalt zwischen Lehne und Sitzfläche. Er wusste, dass dort der Schlüssel zu dem Eichenschrank versteckt war.
Die Türen öffneten sich mit einem knarrenden Geräusch. Im gleichen Augenblick hörte Bienzle jemanden rufen. Er schloss die Schranktür wieder, steckte den Schlüssel in die Hosentasche und stieg die steile Treppe hinunter.
Vor der Haustür traf er auf zwei Frauen. Die eine saß im Rollstuhl und war nach seiner Schätzung weit über achtzig. Die andere mochte in seinem Alter sein und kam ihm bekannt vor.
»Irene?«
Sie nickte und lächelte verlegen.
»Wer ist der Mann?«, fragte die Frau im Rollstuhl.
»Das ist der Ernst Bienzle, Mama!«, antwortete die andere.
»Irene Brechtkern! Ja so was.«
Sie war noch immer schön. Großgewachsen, nicht mehr so schlank wie früher, aber sie hatte eine feste, gut proportionierte Figur. Die vollen schwarzen Haare hatte sie stramm nach hinten gekämmt und in einem Knoten zusammengefasst. Ihre Augen hatte er heller in Erinnerung. Jetzt wirkten sie, als hätte sich ein Schleier über das Blau gelegt. Aber ihre Züge waren noch immer von dieser unspektakulären Schönheit, die ihn einst bezaubert hatte. Der Strahlenkranz der Fältchen um ihre Augenwinkel verriet zwar ihr Alter, gab dem Gesicht aber einen freundlichen Ausdruck.
»Können Sie mir sagen, ob die Frau da meine Schwester ist?«, fragte die Mutter und deutete mit dem Daumen auf ihre Tochter. Bienzle wechselte einen Blick mit Irene, die nur die Schultern hob.
»Sie ist Ihre Tochter, Frau Brechtkern«, sagte der Kommissar. »Und ich bin der Neffe von Gerlinde Bienzle.«
»Ja, ja, die Gerlinde. Wo ist sie denn?«
»Ich hab dir doch gesagt, dass sie gestorben ist«, meldete sich Irene.
»Ja, alle verlassen mich, und am End bin ich ganz alleine übrig!«
Bienzle wollte etwas sagen, ließ es dann aber. Die alte Frau hatte ja recht, und dass sie zudem in einem Zustand war, in dem man ihr nichts mehr erklären konnte, hatte er begriffen.
»Wir wollten dir nur unser Beileid aussprechen«, sagte nun die Tochter. »Wir gehen jeden Morgen hier spazieren, und wir haben dann auch oft deine Tante besucht. Manchmal ist sie sogar mitgegangen. Für mich war das schön, weil ich dann jemanden zum Reden hatte.«
»Ja …« Bienzle zögerte ein wenig und sagte dann, eigentlich gegen seinen Willen: »Ich könnt ja mitkommen. Ich müsst nur andere Schuhe anziehen.«