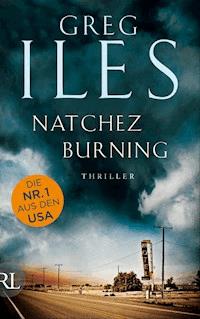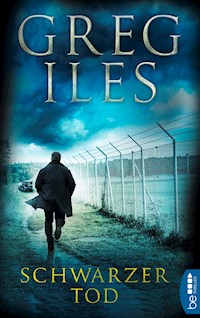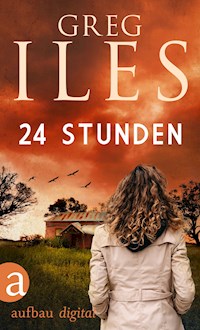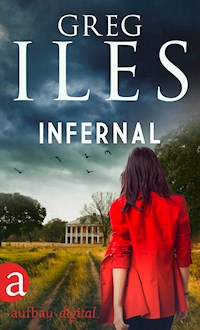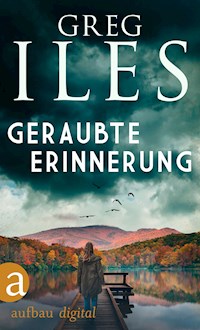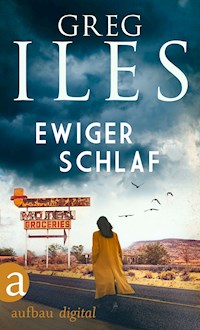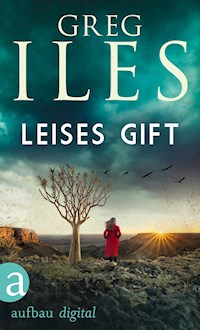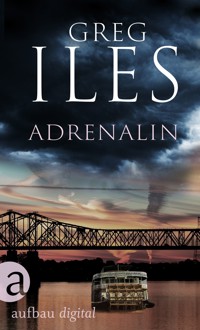
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Penn Cage
- Sprache: Deutsch
Blutiger Einsatz.
Penn Cage ist Bürgermeister in Natchez, Mississippi. Um seiner Stadt zu Geld zu verhelfen, hat er auf das Glücksspiel gesetzt. Nun fahren prächtige Dampfschiffe auf dem Fluss, alle zu Kasinos umgebaut. Doch ein Schiff unterscheidet sich von den anderen: die Magnolia Queen, auf der die finanzstärksten Spieler ein- und ausgehen. Ein Freund von Penn Cage hat Beweise, dass an Bord massive Verbrechen verübt werden. Als er kurz darauf brutal ermordet wird, verbeißt Cage sich in den Fall. Bald steht fest: Die Gäste der Magnolia Queen kommen nicht nur wegen des Glücksspiels. Sie wollen Blut sehen - Menschenblut ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 937
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Penn Cage ist Bürgermeister in Natchez, Mississippi. Um seiner Stadt zu Geld zu verhelfen, hat er auf das Glücksspiel gesetzt. Nun fahren prächtige Dampfschiffe auf dem Fluss, alle zu Kasinos umgebaut. Doch ein Schiff unterscheidet sich von den anderen: die Magnolia Queen, auf der die finanzstärksten Spieler ein- und ausgehen. Ein Freund von Penn Cage hat Beweise, dass an Bord massive Verbrechen verübt werden. Als er kurz darauf brutal ermordet wird, verbeißt Cage sich in den Fall. Bald steht fest: Die Gäste der Magnolia Queen kommen nicht nur wegen des Glücksspiels. Sie wollen Blut sehen - Menschenblut.
Über Greg Iles
Greg Iles wurde 1960 in Stuttgart geboren. Sein Vater leitete die medizinische Abteilung der US-Botschaft. Mit vier Jahren zog die Familie nach Natchez, Mississippi. Mit der »Frankly Scarlet Band«, bei der er Sänger und Gitarrist war, tourte er ein paar Jahre durch die USA. Mittlerweile erscheinen seine Bücher in 25 Ländern. Greg Iles lebt heute mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Natchez, Mississippi. Fünf Jahre hat er kein Buch herausgebracht, da er einen schweren Unfall hatte, nun liegen im Aufbau Taschenbuch seine Thriller „Natchez Burning“, „Die Toten von Natchez vor“, "Die Sünden von Natchez" und "Blackmail" vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Greg Iles
Adrenalin
Aus dem Amerikanischen von Bernd Rullkötter
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Zitat
1
2
3
»Penn?«, sagt Tim leise und berührt mich am Knie. »Alles klar?«
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Der Wächter am Torhaus von Jonathan Sands gafft die beiden gefesselten Männer auf dem Rücksitz meines Saab an.
19
20
21
22
23
24
25
»Hast du was zu essen in deinem Rucksack?«, fragt Caitlin. »Ich kann besser nachdenken, wenn ich nicht hungern muss.«
26
27
28
29
30
»Hier drin können wir sprechen«, sagt Kelly, tritt aufs Gaspedal des 4Runner und fährt vom Parkplatz. »Garantiert keine Wanzen.«
31
32
33
34
»Ein Ein-Kugel-Problem?«, wiederholt Caitlin Kellys Worte. »Du meinst, du willst Sands töten? Kaltblütig?«
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Von Caitlins Haus bis zum Büro des Bezirksstaatsanwalts sind es nur drei Blocks. Während der kurzen Fahrt rufe ich Chief Logan im Polizeirevier an.
52
53
Als er mich in sein Büro führt, fragt Shad mich über die Schulter: »Warum ist einer unserer angesehensten Ratsherren am helllichten Tag betrunken?«
54
55
56
57
58
59
60
»Penn?«, lässt sich Major McDavitt in meinem Headset vernehmen.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Epilog — Fünf Tage später
Danksagungen
Impressum
Buchtipps, die Ihnen ebenfalls gefallen könnten!
Für Madeline und Mark,
die den höchsten Preis für mein Schriftstellerleben zahlen.
Ich danke euch.
Niemand, der unrecht hat, kann einem Mann standhalten,
der recht hat und nicht nachgibt.
– Captain Bill McDonald, Texas Ranger
»Du bist ein Tier.«
»Nein, schlimmer. Ein Mensch.«
– Runaway Train
1
Mitternacht im Garten der Toten. Ein silberweißer Mond, der hoch über dem spiegelschwarzen Fluss und dem Deich steht, wirft sein kaltes Licht auf das Louisiana-Delta. Ich stehe zwischen den schimmernden Steinen auf der Mississippi-Seite und zittere. In weitem Rund bin ich der einzige lebende Mensch. Zu meinen Füßen liegt eine nackte Granitplatte; darunter ruht die Leiche meiner Frau. Auf dem Grabstein steht:
SARAH ELIZABETH CAGE
1963–1998
Tochter, Ehefrau, Mutter, Lehrerin
Du wirst geliebt
Doch ich habe mich nicht um Mitternacht auf den Friedhof geschlichen, um das Grab meiner Frau zu besuchen, sondern weil ein Freund mich dringend darum gebeten hat. Aber ich bin nicht um unserer Freundschaft willen gekommen, sondern aus Schuldbewusstsein, vor allem aber auch Furcht. Der Mann, auf den ich warte, ist fünfundvierzig, aber für mich wird er immer neun Jahre alt sein. Damals, während der Mondlandung von Apollo 11, erreichte unsere Freundschaft ihren Höhepunkt. In der Jugend sind Freundschaften inniger als später im Leben; deshalb empfindet man ein umso tieferes Gefühl der Schuld, wenn ein Freund aus Jugendtagen sich von einem entfernt und man nicht genug unternimmt, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. In meinem Fall ist es umso schmerzlicher, weil Tim Jessup im Laufe der Jahre immer wieder in Schwierigkeiten geraten ist.
Meine Furcht aber hat nichts mit Tim zu tun. Er ist bloß ein Bote, der mir möglicherweise Nachrichten bringt, die ich nicht hören will. Vielleicht werden diese Nachrichten die Gerüchte bestätigen, die in unserer Gegend kursieren. Und wenn diese Gerüchte stimmen, hat sich etwas Schreckliches, Monströses in meine Stadt eingeschlichen, und ich habe ihm die Tür geöffnet.
Ja, es ist meine Stadt: Vor zwei Jahren habe ich in einem Anfall von Pflichtgefühl für das Bürgermeisteramt kandidiert, um meine Heimatstadt Natchez zu retten, und ich war überheblich genug zu glauben, ich könne einen Pakt mit dem Teufel schließen, ohne unser aller Tugend zu schädigen. Aber das war Wunschdenken.
Meine Uhr zeigt 12.30 Uhr. Dreißig Minuten nach dem verabredeten Zeitpunkt, und immer noch ist neben den schulterhohen Steinen zwischen mir und der Cemetery Road nichts von Tim Jessup zu sehen. Nach einem stummen Abschied von meiner Frau gehe ich zurück zum Jewish Hill, unserem Treffpunkt. Ich mache kaum Geräusche im taufeuchten Gras. Die Namen, die in die Grabsteine gemeißelt sind, kenne ich mein Leben lang. Sie stehen für die Geschichte dieser Stadt – und meine eigene. Friedler und Jacobs und Dreyfus oben auf dem Jewish Hill; Knox und Henry und Thornhill bei den Protestanten; Donelly und Binelli und O’Banyon bei den Katholiken. Und auf dem »Colored Ground«, wie er auf der Friedhofskarte bezeichnet wird, liegen jene Sklaven, die im Dunstkreis der weißen Welt lebten und sich nach dem Tod einen Flecken geweihter Erde verdient haben. Die meisten Schwarzen aber wurden ohne Grabstein bestattet. Man muss weiter die Straße hinunter, zum staatlichen Friedhof, um die Gräber von wirklich freien Schwarzen zu finden. Viele waren Soldaten, die zu den 2800 unbekannten Toten der Nordstaatenarmee im amerikanischen Bürgerkrieg gehörten, die hier ruhen.
Aber dieser Friedhof hier atmet eine noch ältere Geschichte. Einige der Toten, die hier bestattet sind, wurden Mitte des achtzehnten Jahrhunderts geboren, doch würden sie morgen wieder zum Leben erwachen, würden Teile der Stadt ihnen kaum verändert erscheinen. Kleinkinder, die an Gelbfieber starben, liegen neben spanischen Dons und vergessenen Generalen. Alle verwesen unter weinenden Engeln und marmornen Heiligen, während sich die knorrigen Äste der Eichen, an denen Bärte aus Spanischem Moos herunterhängen, über ihnen ausbreiten. Natchez ist die älteste Stadt am Mississippi, älter als New Orleans; wenn man sich die verwitterten Grabsteine anschaut, die krumm und schief dastehen, gibt es keinen Zweifel mehr daran.
Ich war das letzte Mal hier, um einen Schaden in Höhe von einer Million Dollar zu begutachten, den betrunkene Randalierer an den unersetzlichen schmiedeeisernen Statuen angerichtet hatten, die diesen Friedhof so einzigartig machen. Deshalb werden die vier Tore vor Einbruch der Dunkelheit jetzt mit Eisenketten verschlossen. Tim Jessup weiß das; es ist einer der Gründe, weshalb er diesen Ort für unsere Verabredung gewählt hat. Als Tim mich anrief, dachte ich, er würde den Friedhof aus Gründen der Bequemlichkeit vorschlagen, denn er arbeitet auf einem der Casinoschiffe, der Magnolia Queen, die unterhalb des Jewish Hill vertäut ist, und seine Schicht endet um Mitternacht. Aber Tim sagte mir, es gehe ihm um die Abgeschiedenheit – nicht nur seinetwegen, auch meinetwegen. Außerdem nahm er mir das Versprechen ab, unter keinen Umständen bei ihm zu Hause anzurufen oder seine Handynummer zu wählen.
In einem anderen Leben war ich Staatsanwalt. Ich habe sechzehn Menschen in die Todeszelle geschickt. Rückblickend bin ich mir nicht mehr sicher, wie das zustande kam. Jedenfalls wachte ich eines Tages auf und begriff, dass ich nicht von Gott auserkoren war, die Schuldigen zu richten. Also gab ich meinen Job bei der Bezirksstaatsanwaltschaft von Houston auf und kehrte zu meiner jüngeren Frau und meiner Tochter zurück. Weil ich nicht wusste, was ich mit meiner überschüssigen Zeit anfangen sollte (und wegen akuten Geldmangels), schrieb ich meine Erfahrungen vor Gericht nieder und habe – wie ein paar andere Juristen, die John Grishams Beispiel folgten – genug Bücher verkauft, dass mein Name auf den Bestsellerlisten erschien. Wir legten uns ein größeres Haus zu und schickten Annie auf eine Privatschule. Ein nie gekanntes Gefühl der Selbstzufriedenheit schlich sich in mein Leben ein – das Gefühl, zu den Erwählten zu gehören, denen auf jedem Gebiet Erfolg beschieden ist. Ich hatte eine beneidenswerte Laufbahn, eine wunderbare Familie, etliche gute Freunde und eine Menge treuer Leser. Und ich war jung und arrogant genug zu glauben, dies alles verdient zu haben und dass es nie enden würde.
Dann starb meine Frau.
Vier Monate nachdem mein Vater, ein Arzt, bei ihr Krebs diagnostiziert hatte, mussten wir sie beerdigen. Sarahs Tod hätte mich und meine vierjährige Tochter beinahe zerbrochen. In meiner Verzweiflung flohen wir aus Houston und kehrten zurück in diesen kleinen Ort in Mississippi, wo ich aufgewachsen bin, zurück in die liebevolle Umarmung meiner Eltern. Seitdem sind sieben Jahre vergangen. Annie ist mittlerweile elf und die Reinkarnation ihrer Mutter. Zurzeit schläft sie zu Hause, während eine Babysitterin in meinem Wohnzimmer sitzt.
Ich schaue wieder auf die Uhr. Wo bleibt Tim Jessup? Ich gebe ihm noch fünf Minuten. Wenn er bis dahin nicht zu diesem mitternächtlichen Treffen erschienen ist, muss er halt wie jeder andere während der Öffnungszeiten zu mir ins Rathaus kommen.
Mein Herz pocht, nachdem ich den Hang zum Jewish Hill hinaufgestiegen bin, doch mit jedem Atemzug wird mir der Duft der grünen Oliven zugetragen, die Mitte Oktober immer noch blühen. Darunter verbirgt sich ein Gemisch durchdringenderer Gerüche: Kudzu und feuchter Humus und irgendetwas Totes, Verwesendes zwischen den Bäumen.
Als ich den Rand der Erdtafel erreiche, die den Jewish Hill bildet, fällt das Land mit atemberaubender Schroffheit vor mir ab. Bis zum Fluss geht es fast siebzig Meter steil eine Klippe aus windgepeitschtem Löß hinunter. Dieser üppige, fruchtbare Boden ist aus Fels entstanden, der von Gletschern fein gemahlen wurde. Aus dieser Höhe kann man mit fast berauschendem Stolz nach Westen über eine endlose Ebene blicken. Vielleicht war es dieses Gefühl, das viele Nationen veranlasst hat, unsere Gegend für sich zu beanspruchen. Frankreich, Spanien, England, die Konföderation – sie alle haben es versucht, und sie alle sind genauso gescheitert wie die Natchez-Indianer vor ihnen. Am westlichen Ende des Hügels steht eine Bank unter einer amerikanischen Flagge. Die Bank wartet auf Trauernde, Liebespaare und alle anderen, die hierherkommen. Sie ist der beste Platz, um Tims letzte vier Minuten abzuwarten.
Als ich mich auf den Weg dorthin machen will, bewegt sich ein Paar Scheinwerfer die Cemetery Road hinauf wie die Lichter eines Schiffes, das gegen den Wind ankämpft. Bald darauf rattert ein unscheinbarer Pick-up an den billigen Häuschen auf der anderen Straßenseite vorbei, verschwindet hinter der nächsten Kurve und hält auf die Devil’s Punchbowl zu, eine tiefe Schlucht, wo Geächtete vom Natchez Trace, der alten Handelsstraße, einst die Leichen ihrer Opfer abluden.
»Das war’s, Timmy«, sage ich laut. »Deine Zeit ist um.«
Der Wind, der vom Fluss kommt, lässt mich frösteln. Ich bin erschöpft und reif fürs Bett. Ich gehe nach rechts auf einen Hang zu, wo mein alter Saab hinter der Friedhofsmauer geparkt ist. Als ich mich vorbeuge, um den Hügel hinunterzurutschen, wird die Stille von einem drängenden Flüstern durchbrochen: »He, Alter! Bist du da oben?«
Ein Schatten schiebt sich vom Friedhof her zum Rand des Jewish Hill vor. Von meinem Standort aus kann ich alle vier Eingänge des Friedhofs sehen, doch ich habe keine Scheinwerfer gesehen und keinen Motor gehört. Aber Tim Jessup materialisiert so plötzlich wie eines der Gespenster, die nach Meinung vieler Einwohner von Natchez auf diesem alten Hügel herumspuken. Ich weiß, dass es Tim ist, denn er war früher ein Junkie und bewegt sich immer noch so: ruckartig, wobei er dauernd den Kopf schwenkt, als hielte er nach der Polizei Ausschau, während seine dünnen Beine ihn auf der Suche nach einer dunklen Ecke vorantreiben, in der er sich den nächsten Schuss setzen kann.
Jessup behauptet, seit längerer Zeit clean zu sein, hauptsächlich dank seiner neuen Frau Julia. Ich war zuerst skeptisch, als ich von Julias Ehe mit Jessup hörte, aber im Ort heißt es, sie habe Wunder gewirkt. Julia hat Jessup den Job als Blackjack-Dealer auf den Casinoschiffen besorgt, den er seit nunmehr einem Jahr ausübt, in letzter Zeit auf der Magnolia Queen.
»Penn!«, ruft Jessup schließlich mit lauter Stimme. »Ich bin’s, Mann. Komm raus!«
Sein Gesicht ist im Mondlicht erschreckend hager. Obwohl wir beide fast gleich alt sind – unsere Geburtstage liegen genau einen Monat auseinander –, sieht er zehn Jahre älter aus als ich. Seine Haut hat die lederne Beschaffenheit wie die eines Mannes, der zu viele Jahre der Mississippi-Sonne ausgesetzt war; sein ergrauender Schnurrbart ist von Zigarettenrauch braungelb verfärbt, und Haut und Augen zeigen eine gelbliche Tönung wie bei einem Menschen, dessen Leber bald den Dienst versagt.
Als Jungen hatten Jessup und ich eine enge Beziehung, weil wir beide Arztsöhne waren. Wir wussten um das Gewicht dieser Last, denn von den ältesten Söhnen wird meist erwartet, dass sie in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Diese Erwartung konnten weder Tim noch ich erfüllen, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Mit einem Seufzer der Resignation trete ich hinter dem Grabstein hervor und rufe in Richtung des Flusses: »Tim? He, Tim! Hier bin ich. Penn.«
Jessups Kopf schnellt herum, und seine rechte Hand zuckt zu seiner Tasche. Eine Sekunde lang fürchte ich, dass er eine Pistole zieht, aber dann erkennt er mich, und seine Augen weiten sich vor Erleichterung.
»Mann«, sagt er mit einem Grinsen. »Ich dachte schon, du hättest kalte Füße gekriegt.«
Er schüttelt mir die Hand, und ich staune, dass Jessup mit fünfundvierzig Jahren immer noch wie ein überdrehter Hippie klingt.
»Du bist derjenige, der sich verspätet hat«, erwidere ich.
Er nickt öfter als nötig, denn nichts ist ihm wichtiger, als in Bewegung zu sein. Wie teilt der Bursche bloß den ganzen Abend Blackjack-Karten aus?
»Ich konnte nicht so schnell vom Schiff runter«, erklärt er. »Ich glaube, sie beobachten mich. Sie beobachten uns immer. Jeden. Und vielleicht ahnen sie etwas.«
Ich möchte ihn fragen, von wem er redet, aber ich nehme an, dass er das Thema noch ansprechen wird. »Ich habe deinen Wagen gar nicht gesehen. Woher bist du gekommen?«
Das wettergegerbte Gesicht verzieht sich zu einem listigen Grinsen. »Ich hab so meine Tricks, Mann. Wer mit solchen Leuten zu tun hat, muss vorsichtig sein. Das sind Raubtiere. Sie spüren eine Bedrohung und reagieren blitzartig – zack!« Tim klatscht in die Hände. »Purer Instinkt. Wie bei Haien.« Er wirft einen Blick zur Stadt hinüber. »Wir sollten uns Deckung suchen.« Er deutet auf die einen Meter hohen Mauern, die ein Familiengrab umschließen. »Genau wie auf der Highschool. Erinnerst du dich noch, wie wir hinter diesen Mauern hier Gras geraucht haben? Im Sitzen, damit die Cops das Glühen der Joints nicht sehen konnten?«
Tim schwingt sich mit überraschender Behändigkeit über die Mauer, und ich folge ihm, wobei ich schaudernd an den einen Vorfall auf diesem Friedhof denke, den ich mit Tim in Verbindung bringe: Spät an einem Halloweenabend warfen wir, ein halbes Dutzend Jungen, unsere Liegeräder über die Mauer und rasten johlend über die schmalen Wege, bis uns eine Meute wilder Hunde die Eichen in der Nähe des dritten Tores hinaufjagte. Ob Tim sich auch noch daran erinnert?
Mit einem letzten besorgten Blick zur Cemetery Road lässt er sich auf den feuchten Boden sinken und lehnt sich an die bemoosten Ziegel in einer Ecke, wo zwei Mauern zusammentreffen. Ich setze mich an die angrenzende Mauer im rechten Winkel zu ihm, sodass meine Laufschuhe seine zermürbten Segelschuhe fast berühren. Jetzt erst wird mir klar, dass Tim sich nach der Arbeit umgezogen haben muss. Die Uniform, die er im Dienst trägt, ist schwarzen Jeans und einem grauen T-Shirt gewichen.
»Konnte nicht in Arbeitskleidung herkommen«, sagt er, als hätte er meine Gedanken gelesen, doch er hat nur auf meinen Blick reagiert. Offensichtlich haben die Drogen, die er im Laufe der Jahre genommen hat, seinen einst so scharfen Geist nicht gänzlich zerstört.
Ich beschließe, auf weiteren Smalltalk zu verzichten. »Du hast am Telefon ein paar ziemlich gruselige Dinge erwähnt. Gruselig genug, um mich zu dieser Stunde hierherzulocken.«
Tim nickt und wühlt in seiner Tasche nach etwas, das sich als gekrümmte Zigarette erweist. »Kann nicht riskieren, sie anzuzünden«, sagt er und steckt sie sich zwischen die Lippen, »ist aber gut zu wissen, dass ich sie für die Heimfahrt habe.« Er grinst noch einmal, bevor er eine ernste Miene aufsetzt. »Also, was hattest du vor meinem Anruf gehört?«
Ich möchte nichts wiederholen, was Tim nicht bereits selbst gesehen oder gehört hat. »Gerüchte über Prominente, die zum Glücksspielen einfliegen und dann schleunigst wieder abhauen. Profisportler, Rapper, was weiß ich. Leute, die normalerweise nicht hierherkommen.«
»Hast du von den Hundekämpfen gehört?«
Meine Hoffnung, dass die Gerüchte falsch sind, schwindet. »Ich habe gehört, dass sich in der Richtung irgendwas abspielt, aber es war schwer zu glauben. Okay, ich könnte mir denken, dass sich ein paar Hinterwäldler unten im Tal oder jenseits des Flusses auf so was einlassen, aber keine High Roller oder Berühmtheiten.«
Tim saugt an seiner Unterlippe. »Was noch?«
Diesmal antworte ich nicht. Ich habe andere Gerüchte gehört – zum Beispiel darüber, dass Prostitution und harte Drogen im Schutz der Glücksspielbranche gedeihen. Aber das gab es schon immer. »Ich will keine Vermutungen über Dinge anstellen, die vielleicht nicht wahr sind.«
»Du redest wie ein beschissener Politiker.«
Wahrscheinlich bin ich sogar einer geworden, aber ich fühle mich eher wie ein Anwalt, der die Wahrheit aus der Geschichte eines unzuverlässigen Mandanten herausfiltert. »Warum erzählst du mir nicht einfach, was du weißt? Dann werde ich dir sagen, ob es mit meinen Informationen übereinstimmt.«
Tim, der mit jeder Sekunde ängstlicher aussieht, gibt seiner Nikotinsucht schließlich doch nach. Er holt ein Feuerzeug hervor, lässt die Flamme auflodern, berührt damit das Ende der Zigarette und zieht die Luft durch das Papierröhrchen ein wie jemand, der an einer ellenlangen Wasserpfeife nuckelt. Er hält den Rauch besorgniserregend lange zurück, bevor er ausatmet und sagt: »Weißt du, dass ich ein Kind habe? Einen Sohn.«
»Ja. Ich habe ihn vor ein, zwei Wochen mit Julia im Supermarkt gesehen. Sieht prächtig aus.«
Tims Lächeln erhellt sein Gesicht. »Genau wie seine Mutter. Sie ist immer noch eine Schönheit, stimmt’s?«
»Stimmt«, pflichte ich wahrheitsgemäß bei. »Tja, also … was machen wir hier, Timmy?«
Er erwidert immer noch nichts, sondern nimmt einen weiteren langen Zug, wobei er die Hände um die Zigarette legt, als wäre sie ein Joint. Sein ganzer Körper bebt, aber nicht nur wegen der Kälte, und zum ersten Mal fürchte ich, dass er wieder Drogen nimmt.
»Tim?«
»Es ist nicht das, was du denkst. Ich trage den ganzen Scheiß seit längerer Zeit mit mir herum, und manchmal krieg ich das Zittern.«
Er weint, stelle ich erstaunt fest, und wischt sich die Tränen aus den Augen. Ich drücke sein Knie, um ihn zu trösten.
»Tut mir leid«, flüstert er. »Wir sind weit von der Mill Pond Road entfernt, stimmt’s?«
Die Mill Pond Road ist die Straße, in der ich aufgewachsen bin. »Ja. Alles in Ordnung?«
Er drückt seine Zigarette an einem Grabstein aus und beugt sich vor. In seinen Augen sehe ich eine Leidenschaft, die ich ihm gar nicht mehr zugetraut hätte. »Wenn ich dir mehr erzähle, gibt es kein Zurück. Verstehst du? Wenn ich dir sage, was ich weiß, wirst du nicht mehr schlafen können. Ich kenne dich. Dann bist du wie ein Pitbull und lässt nicht mehr los.«
»Hast du mich nicht deshalb herbestellt?«
Jessup zuckt die Achseln. Sein Kopf und seine Hände sind wieder zappelig. »Ich will dich nur warnen, Penn. Wenn du dem Problem aus dem Weg gehen willst, dann tu es jetzt. Klettere über die Mauer und renn zu deinem Auto. Ein kluger Mann würde das tun.«
Ich drücke den Rücken gegen die kalten Ziegel und denke über seine Worte nach. Das Schicksal kann sich urplötzlich von einem wolkenlosen Himmel auf dich stürzen, wie bei der Krebserkrankung meiner Frau, oder es kann dir auf deinem Weg auflauern, sichtbar für jeden, der es sehen will. Aber manchmal ist es bloß eine Straßengabelung, und nur selten steht ein Freund neben dir, der dir sagen kann, welcher Weg der bessere ist. Es ist die älteste menschliche Alternative: behagliche Ignoranz oder mit Schmerz erkauftes Wissen. Ich kann beinahe hören, wie Tim an seinem Blackjack-Tisch auf der Magnolia Queen fragt: »Erhöhen oder halten, Sir?« Wenn ich doch nur eine Wahl hätte! Aber da ich geholfen habe, die Queen nach Natchez zu bringen, ist die Sache von vornherein entschieden.
»Erzähl schon, Timmy. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit.«
Jessup schließt die Augen und bekreuzigt sich. »Dem Himmel sei Dank«, flüstert er. »Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn du nicht mitgemacht hättest. Ich hab mich weit aus dem Fenster gelehnt, Mann. Und ich bin ganz allein.«
Ich zwinge mich zu einem Lächeln. »Lass uns hoffen, dass mein zusätzliches Gewicht dich nicht aus dem Fenster stürzen lässt.«
Er mustert mich lange; dann zieht er etwas aus der Gesäßtasche. Es sind offenbar zwei Spielkarten. Er hält sie mir mit der Handfläche nach unten hin. Die Karten sind fast ganz unter seinen Fingern verborgen.
»Soll ich eine Karte ziehen?«, frage ich.
»Das sind keine Karten, das sind Fotos. Mit einem Handy aufgenommen.«
Ich strecke die Hand aus und nehme die Fotos entgegen. Ich habe Tausende von Tatortfotos bis ins Detail betrachtet und rechne nicht damit, von Schnappschüssen geschockt zu werden, die Tim Jessup in seiner Gesäßtasche mitgebracht hat. Aber als er sein Feuerzeug anzündet und es über das erste Foto hält, höre ich im Kopf ein Summen wie von tausend Wespen, und mir dreht sich der Magen um.
»Ich weiß«, sagt er. »Aber es kommt noch schlimmer.«
2
Linda Church liegt unter dem Mann, der ihren Lohn zahlt, und versucht, sich ihre Furcht nicht anmerken zu lassen. Während er verschwitzt und mit brennenden Augen in sie hineinstößt, stellt sie sich vor, eine Steinfigur in einer Kathedrale zu sein, deren tote Augen nichts enthüllen. Linda liest in ihrer Freizeit Fantasy-Romane, und manchmal malt sie sich aus, eine Gestalt in einem Buch zu sein, eine Edelfrau, die durch einen grausamen Schicksalsschlag gezwungen wird, Dinge zu tun, die sie hasst. So etwas passierte den Heldinnen am laufenden Band. Schon ihr Leben lang (oder seit sie als Vierjährige die Prinzessin in ihrer Kindergartenaufführung spielte) sucht Linda nach ihrem Prinzen. Er soll sie aus dem Dornenlabyrinth hinausführen, zu dem ihr Leben geworden ist. Als sie den Kerl kennenlernte, der sie nun vögelt, glaubte sie, der magische Moment sei endlich gekommen. Nur ein Jahr, bevor sie dreißig wurde (und mit einem trotz manch derber Behandlung unversehrten Äußeren), war Linda endlich vom Schicksal zu einem Prinzen gelenkt worden. Er sah aus wie ein Filmschauspieler und redete tatsächlich wie ein Prinz in den Filmen, die ihre Großmutter sich früher angeschaut hatte. Wie Laurence Olivier oder Cary Grant.
Aber Cary Grant war gar nicht Cary Grant. Er hieß Archie Leach oder so, also war er nicht der, für den man ihn immer gehalten hat. Hier zeigte sich die Wahrheit des Lebens: Nichts ist das, wofür man es hält, und niemand ist der, der zu sein er vorgibt.
Wäre Lindas Prinz zu einem Frosch geworden, hätte sie wenigstens den Trost des Vertrauten gehabt. Aber dieses Märchen endete anders, denn der falsche Prinz verwandelte sich in eine Schlange mit nadelscharfen Zähnen, aus denen scheußliches Gift spritzt. Linda wusste nun, dass sie nur eine von zwanzig oder dreißig Frauen war, mit denen er auf der Magnolia Queen geschlafen hatte und die er wahrscheinlich immer noch bumste, egal was er behauptete. Denn welche Frau konnte riskieren, ihn abzuweisen, solange gut bezahlte Arbeit kaum zu finden war?
»Was ist heute Abend mit dir los?«, grunzt er, ohne seine Bewegungen zu unterbrechen. »Drück die Pissklappen zusammen und sieh zu, dass er was zu tun hat.«
Vor allem hasst sie seine Stimme, denn seine klangvolle Redeweise in der Öffentlichkeit ist nur ein weiterer Mantel, der das verhüllt, was sich unter seiner Haut und hinter seinen kalten, berechnenden Augen befindet. Er ist tatsächlich wie eine Gestalt in ihren Büchern, aber kein Held, sondern ein Gestaltwandler, ein Dämon, der weiß, dass er am leichtesten in die Seele normaler Menschen eindringen kann, wenn er als das erscheint, was sie sich am innigsten wünschen; wenn er sie glauben lässt, dass er sie so sieht, wie sie gesehen werden wollen. Auf diese Weise hatte er Linda in die Falle gelockt. Er brachte sie dazu, an ihre geheimsten Fantasien über sich selbst zu glauben, lange genug, bis sie sich ihm willig hingab, um dann die Maske fallen zu lassen.
Die Schrecken jener Nacht haben sich Lindas Seele wie Narbengewebe eingeprägt. Binnen weniger Minuten begriff sie, auf was sie sich eingelassen hatte, und irgendetwas in ihrem Innern verdorrte für alle Zeit. Es geschah in diesem Zimmer, einem höhlenartigen Raum in den Tiefen der Magnolia Queen. Es ist eines von nur zwei Zimmern auf dem Casinoschiff, in denen es keine Sicherheitskameras gibt. Linda arbeitet oben in der Bar namens The Devil’s Punchbowl, die »Schüssel des Teufels«, aber die Frauen auf der Queen bezeichnen dieses verbotene Zimmer als die wahre Teufelsschüssel. Denn hier kümmert sich der Dämon um alle Geschäfte, die vom Tageslicht verschont werden müssen. Hierher bringt er Kartenzähler und andere Unruhestifter, um sie auf den Stuhl zu schnallen, der in der Mitte des Zimmers am Boden festgeschraubt ist. Hierher bringt er die Frauen, die das Gleiche ertragen müssen wie Linda in jener Nacht, als die Maske gefallen war.
Nachdem er sich davongemacht hatte und Linda sich wieder zurechtmachte, so gut es ging, schwor sie sich, das Schiff zu verlassen. Aber sie hatte nie den Mut aufgebracht. Zum Teil lag es natürlich am Geld und an der Versicherung. Hinzu aber kam die Fähigkeit des Geistes, sich selbst zu belügen. Eine vertraute Stimme flüsterte ihr ein, dass sie sich geirrt habe, dass sie einige jener Dinge, die er getan hatte, falsch verstanden habe. Dass sie im Grunde um diese Dinge gebeten habe – wenn nicht ausdrücklich, dann durch ihr Tun. Aber jeder neue Besuch des Dämons bestätigte ihren warnenden Instinkt, und ihre Furcht war gewachsen. Sie wollte unbedingt aufhören, wollte runter von der Queen und aus der Stadt flüchten, aber sie tat es nicht. Der Dämon schien eine seltsame Macht über sie zu haben – nein, er besaß diese Macht wirklich –, weshalb Linda Angst hatte, jemandem ihre schreckliche Lage anzuvertrauen. In Augenblicken der Klarheit geriet sie deshalb außer sich. Das war ein Fall schlimmster sexueller Belästigung. Natürlich könnte er dagegenhalten, dass die Beziehung einvernehmlich gewesen sei. Sie war ihm – scheinbar begeistert – sexuell gefügig gewesen, und abgesehen von seinem Büro und diesem Zimmer wird jeder Zoll des Casinos von Überwachungskameras abgedeckt, sogar die Toiletten, obwohl das gesetzlich verboten war.
Linda hat darüber nachgedacht, ob sie ein paar von den anderen Mädchen, mit denen er es treibt, bitten soll, zusammen mit ihr einen Anwalt aufzusuchen. Aber das wäre noch riskanter, als ihr ganzes Geld auf einen der Spieltische auf dem Oberdeck zu legen. Die Gewissheit, dass der Mann, der nun in ihr ist, das Gleiche mit diesen vielen anderen Frauen getan hat, lässt Linda schaudern, doch sie schreit nicht auf und versucht nicht, ihn wegzustoßen. Zwar würde die Heldin in einem ihrer Romane so handeln und ihm im »Augenblick der größten Leidenschaft« eine Hutnadel oder einen Dolch in den Rücken stechen, aber das wirkliche Leben ist anders. Im wirklichen Leben kommt dieser Augenblick und verstreicht, und wenn der Kerl sich dann von ihr rollt, hat Linda das Gefühl, dass ihre Seele mitsamt den blutigen Wurzeln herausgerissen wurde und nur noch eine leere Hülle von ihr übrig ist.
In diesem Zustand war Linda gewesen, als ihr wahrer Prinz auf der Bühne ihres Lebens erschien. Er ritt nicht auf einem weißen Ross und trug kein Wams und kein Zauberergewand, sondern die Uniform eines Blackjack-Dealers. Seine Augen waren ganz anders gewesen als die, die jetzt über ihr lodern; sie waren sanft, gütig und unendlich verständnisvoll gewesen. Irgendwie hatte sie geahnt, dass er ihre Qual durchschaute, bevor er sie ansprach. Allerdings kannte er die Einzelheiten nicht; dann wäre er ein toter Mann gewesen, denn er ist dem Gestaltwandler nicht gewachsen. Außerdem ist er zu gut für seine Arbeit – und auch zu gut für Linda. Doch dieser Meinung schließt er sich nicht an. Er liebt sie.
Leider ist er verheiratet. Mit einer wirklich netten Frau. Linda verachtet sich, weil sie den Mann einer Anderen haben will. Aber was soll man tun, wenn man jemanden aufrichtig liebt? Wie kann man ein Gefühl verbannen, das stärker ist als die Dunkelheit, die einen von innen her auffrisst?
»Du liegst da wie ’ne Matratze«, knurrt der Dämon verächtlich. »Willst du, dass ich ein paar Freunde über dich drübersteigen lasse, wenn ich fertig bin?«
Linda zuckt vor Furcht zusammen und bewegt die Hüften schneller. Sie schließt die Augen und betet, dass der Dämon, der sich in ihr bewegt, ihren heimlichen Prinzen nicht entdeckt und vor allem nicht dem auf die Schliche kommt, was ihr Prinz in genau diesem Moment tut, um die Welt wieder ins Lot zu bringen. Denn wenn der Dämon oder seine Handlanger das herausfinden, wird Timothy eines grässlichen Todes sterben. Und vorher werden sie ihn zum Reden bringen. Das ist eine ihrer Spezialitäten.
3
»Penn?«, sagt Tim leise und berührt mich am Knie. »Alles klar?«
Ich bin über drei verschwommene Fotos auf meinem Schoß gebeugt und versuche, nur mit Hilfe der flackernden Flamme eines Feuerzeugs die auf dem billigen Durchschlagpapier gedruckten Einzelheiten zu erkennen. Man braucht eine Weile, um Bilder wie diese wirklich zu sehen. Als stellvertretender Bezirksstaatsanwalt machte ich die Feststellung, dass die Bilder von Mordopfern, egal wie brutal zugerichtet sie waren, mich nicht so sehr erschütterten wie die von Überlebenden. Der Geist distanziert sich automatisch von den Toten – ein Überlebensvorteil unserer Gattung. Aber wir haben keinen wirksamen Filter, um das Leid lebender Menschen auszuschalten, abgesehen davon, dass wir uns physisch oder geistig, durch Leugnung, abwenden können (was unmöglich ist, wenn wir »richtig erzogen« sind, wie Ruby Flowers, eine der Frauen, die mich erzogen hat, es ausgedrückt hätte).
Das erste Foto zeigt das Gesicht eines Hundes, der aussieht, als wäre er von einem Lastwagen angefahren und hundert Meter über zerbrochenes Glas geschleift worden. Doch trotz der grässlichen Wunden steht das Tier aus eigener Kraft da und blickt mit seinem verbliebenen Auge in die Kamera. Ich zucke vor Abscheu zusammen, schiebe das Foto unter die beiden anderen und sehe ein blondes Mädchen vor mir – keine Frau, sondern ein Mädchen –, das ein Tablett voller Bierkrüge trägt. Es dauert einen Moment, bis ich zur Kenntnis nehme, dass dieses Mädchen, das nicht älter als fünfzehn Jahre sein kann, kein Oberteil anhat. Ein leeres Lächeln spielt um ihre Lippen, doch ihre Augen sind gespenstisch ausdruckslos wie die einer Psychiatriepatientin unter Thorazin-Einwirkung.
Ich schiebe das Bild zur Seite, und mir verschlägt es den Atem. Wahrscheinlich dasselbe Mädchen (ich bin mir nicht sicher) liegt auf einem Holzfußboden, und ein viel älterer Mann hat mit ihr Geschlechtsverkehr. Am bestürzendsten ist, dass dieses Bild zwischen einer Gruppe von Männern aufgenommen wurde, von hinten, die alles beobachten. Sie sind nur vom Knie bis zur Schulter zu sehen – drei tragen lange Hosen und Polohemden, während ein vierter mit einem Straßenanzug bekleidet ist –, doch alle halten einen Bierkrug in der Hand.
»Hast du diese Bilder gemacht?«, frage ich und kann meinen Ekel nicht verbergen.
»Nein … au, verdammt!« Tim reißt die Hand mit dem Feuerzeug zurück, und das flackernde Licht erlischt. »Hast du genug gesehen?«
»Zu viel. Wer hat das fotografiert?«
»Jemand, den ich kenne. Das genügt vorläufig.«
»Weiß er, dass du die Bilder hast?«
»Nein. Er würde tief in der Scheiße stecken, wenn man wüsste, dass er für diese Schweinereien verantwortlich ist.«
Ich lege die Fotos neben Tims Bein, schließe die Augen und reibe mir die Schläfen, um aufkommenden Kopfschmerzen entgegenzuwirken. »Wer ist das Mädchen?«
»Keine Ahnung. Sie holen immer wieder neue Mädchen ran.«
»Sie sieht aus wie fünfzehn.«
»Wenn nicht jünger.«
»Wurden die Fotos hier in der Gegend gemacht?«
»In einem Jagdlager ein paar Meilen von hier. Sie fahren Besucher mit ihrem VIP-Boot zu den Hundekämpfen. Der Veranstaltungsort ändert sich jedes Mal.«
Nun, da das Feuerzeug aus ist, kehrt meine Nachtsicht zurück. Tims hageres Gesicht wirkt im Mondschein fahl. Ich atme tief durch. »Meine Güte, ich wollte, ich hätte diese Fotos nicht gesehen.«
Er antwortet nicht.
»Und der Hund?«
»Der Verlierer in einem Kampf. Kurz bevor sein Besitzer ihn getötet hat.«
»Mein Gott. Und was war das Schlimmste?«
Tim seufzt wie ein Mann, der jede Illusion verloren hat. »Das dürfte von deiner Sensibilität abhängen.«
»Du sagst, so etwas wird von der Magnolia Queen veranstaltet?«
Tim nickt.
»Warum?«
»Um die Wale nach Süden zu locken.«
»Die Wale?«
»Die High Roller. Die Spieler mit dem großen Geld. Arabische Playboys, asiatische Erben von Treuhandfonds, Drogenbarone, Profisportler, Rapper. Das ist der reinste Zirkus, Mann. Die Typen werden aus aller Herren Länder von den Hundekämpfen angelockt. Vom Blutsport.« Tim schüttelt den Kopf. »Es ist zum Kotzen. Und es geht nicht nur um die Zuschauer, es geht auch um den Wettbewerb. Manche wollen ihren Killerhund mitbringen und gegen die besten Tiere antreten lassen. Letzte Woche ist ein Privatjet aus Macao eingeflogen. Der Sohn eines chinesischen Milliardärs brachte seinen Hund zum Kämpfen mit. Einen Bully Kutta. Hast du mal von den Biestern gehört? Der Bastard wog mehr als ich. Der Hund, meine ich.«
Ich versuche, mir einen Hund vorzustellen, der schwerer ist als Tim Jessup. »Ist der Bursche in Natchez gelandet?«
»Teufel, nein. Es gibt in der Umgebung noch andere Landestreifen, die für Privatjets geeignet sind.«
»Nicht viele.«
»Jedenfalls ist es ein Riesengeschäft. Diese Typen würden mich ohne Zögern umbringen, nur weil ich mit dir spreche. Ich wäre Hundefutter. Kein schöner Tod.«
Als Tim das Wort »Hundefutter« ausspricht, rührt etwas an einem Nerv in meinem Inneren. Es muss Furcht sein. Tim betrachtet mich aufmerksam und versucht, meine Reaktion zu deuten.
»Wieso habe ich das Gefühl, dass es damit noch nicht getan ist?«, sage ich.
Tim zögert wie ein Taucher kurz vor dem Sprung. Dann schnalzt er mit der Zunge und erwidert: »Sie zocken die Stadt ab, Penn.«
Der plötzliche Themenwechsel verwirrt mich. Ich lehne mich wieder an die Ziegel und richte den Blick auf die Flügel eines zwanzig Meter entfernten Engels. Der Tau lässt sich darauf nieder, und die Luft gleicht einem feinen Sprühnebel, den ich nur mit Mühe atmen kann. Vielleicht ist die Luft sogar dicht genug, um einen der Engel aus Stein abheben zu lassen. Das tiefe Grollen eines Schubschiffes auf dem Fluss tief unter mir lässt mich erkennen, dass Geräusche weiter getragen werden, als ich dachte. Deshalb senke ich die Stimme. »Wer zockt die Stadt ab?«
Tim legt die Arme um sich und wiegt sich langsam hin und her. »Die Leute, für die ich arbeite. Bei Golden Parachute Gaming oder wie du es nennen willst.«
»Die Muttergesellschaft der Magnolia Queen betrügt die Stadt? Wie denn?«
»Indem sie zu wenig Steuern zahlt, Alter. Wie sonst?«
Jessup spricht von dem Anteil der Bruttoeinnahmen, den die Besitzer der Casinoschiffe der Stadt für die Lizenz zahlen. »Das kann nicht sein.«
»Aber sicher doch. Ich bin nicht bloß aus alter Freundschaft hierhergekommen.«
»Tim, wie können sie uns um Steuern betrügen, ohne dass es die staatliche Glücksspielkommission herausfindet?«
»Das sind zwei verschiedene Fragen. Erstens, wie konnten sie zu wenig Steuern zahlen? Zweitens, weiß die Glücksspielkommission davon?«
Sein kaltes Sezieren dessen, was für mich und die Stadt ein Albtraum werden könnte, geht mir auf die Nerven. »Kennst du die Antworten?«
»Frage eins ist leicht zu beantworten. Schließlich haben sich Teenager sogar ins Verteidigungsministerium eingehackt. Glaubst du wirklich, dass das Netzwerk eines Casino-Unternehmens nicht manipuliert werden kann? Besonders von den Leuten, denen dieses Netzwerk gehört?«
»Und die zweite Frage?«
»Die ist nicht so leicht zu beantworten. Die Glücksspielkommission ist mehr oder weniger unabhängig, und ich weiß zu wenig über ihre Aktivitäten, um sagen zu können, was möglich ist. Sie hat drei Mitglieder. Wie viele müssten korrupt sein, damit die Geschäfte nicht gefährdet sind?«
Ich schüttle immer noch den Kopf. »Unser Betriebsprüfungssystem ist über Jahrzehnte in Las Vegas entwickelt worden. Niemand kann es überlisten.«
Jessup lacht spöttisch auf. »Angeblich kann man einen Lügendetektor auch nicht überlisten. Nehmen wir vorläufig mal an, die Glücksspielkommission ist sauber, und kehren wir zu Frage eins zurück. Es gibt keine Möglichkeit, die Einnahmen aus den verschiedenen Bereichen des Casinos zu verfälschen, weil alles straff reglementiert ist. Da hast du recht. Das Sicherheitssystem des Unternehmens verhindert so etwas. Jeder Quadratzentimeter des Schiffes wird rund um die Uhr durch Überwachungskameras beobachtet und abgehört. Die Kameras werden automatisch gelenkt – aus Vegas, nicht aus Natchez. Ein Kumpel von mir hat mich an einem Abend mal in die Sicherheitszentrale gelassen. Ich konnte beobachten, wie Pete Elliot die Frau seines Bruders in einer Ecke des Restaurants begrapschte.«
»Den Quatsch brauche ich nicht zu wissen.«
»Ich sag ja nur …«
»Worauf willst du hinaus?«
»Die einzige Methode, die Stadt zu betrügen, besteht darin, dass das Unternehmen die Bruttoeinnahmen zu niedrig ansetzt. Ihr von der Stadt habt einen hohen Betrag vor euch, rechnet euren Anteil aus und hakt nicht weiter nach. Stimmt’s?«
»So ungefähr. Aber die Glücksspielkommission arbeitet gründlicher. Um wie viel Geld geht es?«
Jessup lässt sein Feuerzeug aufflackern, betrachtet seinen angesengten Daumen und blinzelt dann in die Flamme, als müsse er eine Integralgleichung lösen. »Nicht sehr viel, wenn man den Monatsumsatz eines Casinoschiffes berücksichtigt. Aber für einen normalen Menschen geht es um eine Menge Kohle.«
»Okay, aber deine Argumentation hat einen entscheidenden Fehler.«
»Nämlich?«
»Das Casino hat keinen Vorteil. Wie sehr es uns auch abzockt, sein Gewinn ist winzig, verglichen mit dem Risiko. Die haben dort unten praktisch eine eigene Druckerpresse. Warum sollen sie die goldene Gans schlachten, nur um zwei zusätzliche Millionen pro Jahr zu klauen? Oder meinetwegen sogar pro Monat?«
Jessup lächelt. »Jetzt kommst du der Sache näher, Alter. Es ergibt keinen Sinn, oder?«
»Für mich nicht.«
»Für mich auch nicht.« Er steckt sich eine weitere Zigarette zwischen die Lippen und saugt daran wie jemand, der unter Wasser durch ein Schilfrohr atmet. »Bis wir uns klarmachen, dass es nicht die Muttergesellschaft ist, die euch beklaut, sondern ein einzelner Typ.«
»Nur einer? Unmöglich. Casinos überlassen einem Einzelnen nie so viel Macht.«
Tim stößt eine Rauchwolke aus. »Wer sagt, dass sie ihm überlassen wurde?«
»Das kann nicht sein, Timmy. Die Casinos tun alles, um eine solche Situation zu vermeiden.«
»Ja. Und sie sind geschickt, aber sie sind nicht Gott.« Er grinst vergnügt, als rauche er Marihuana und nicht Tabak. »Das Unternehmen setzt einiges über Menschen und Situationen voraus, und dadurch wird es angreifbar.«
Ich reibe mir das Kinn. Die feinen Stoppeln verraten mir, dass es spät wird. »Offensichtlich hast du einen Verdächtigen. Wer ist es?«
Tims Selbstgefälligkeit ist wie weggewischt. »Das brauchst du noch nicht zu wissen. Heute Abend ist er noch ›Mr. X‹, okay? Entscheidend ist, dass er lange genug für die Firma gearbeitet hat, um so etwas anzetteln zu können.«
Ich weiß einiges über die Golden Parachute Gaming Corporation. Aber statt Tim durch Mutmaßungen darüber zu verschrecken, wer der betreffende Manager sein könnte, beschränke ich mich lieber auf das, was er preisgeben will. Vorläufig. »Mr. X steht auch hinter den Hundekämpfen und den Mädchen?«
»Oh ja. So wird die Queen noch profitabler, und Mr. X macht nebenher ganz schön Kohle.«
Ich stöhne auf bei dem Gedanken, dass ich Golden Parachute widerwillig umworben und dazu beigetragen habe, die Magnolia Queen nach Natchez zu holen, wodurch ich die Voraussetzung dafür geschaffen haben könnte, meine Heimatstadt mit diesem Virus zu verseuchen. Aber statt mir selbst Vorwürfe zu machen, lasse ich meinen Frust an Tim aus. »Du hast dir eine tolle Woche ausgesucht, um mich zu informieren. An diesem Wochenende finden die Ballonrennen statt. Siebenundachtzig Heißluftballons und fünfzehntausend Touristen, darunter einer, dem ich jeden Wunsch erfüllen muss, damit er seine Recyclinganlage hier bei uns baut.«
Tim nickt. »Hab in der Zeitung darüber gelesen.«
»Im Ernst, Tim. Wie soll ich dir helfen, ohne die Identität von Mr. X zu kennen? Wenn ich sie nicht kenne, kann ich nichts unternehmen.«
Tim saugt wieder an seiner Zigarette, als atme er unter Wasser durch ein Schilfrohr. Immer wenn die Zigarette aufglüht, beobachte ich seine Augen, und was ich dort sehe, erschreckt mich. Das vorherrschende Gefühl ist Furcht, doch darunter mischt sich etwas, das mir wie Hass vorkommt.
»Was stellst du dir unter Hilfe vor?«, fragt er leise.
»Was meinst du damit?«
Sein Blick zuckt nach oben, und er schaut mir in die Augen. »Du hast für einen Bezirksstaatsanwalt in einer Großstadt gearbeitet. Also weißt du, was ich meine.«
»Ich habe die Fotos gesehen«, sage ich vorsichtig. »Eine schlimme Sache. Deshalb müssen wir sie den Behörden überlassen.«
»Den Behörden?« Er spuckt dieses Wort beinahe aus. »Hast du nicht gehört, was ich am Telefon gesagt habe? In dieser Sache kannst du keinem trauen, nicht mal der örtlichen Polizei.«
»Ich soll meiner eigenen Polizei nicht trauen?«
»Das ist nicht deine Polizei. Die Cops haben dort schon gearbeitet, bevor du dein Amt angetreten hast, und sie werden noch dort sein, wenn du weg bist. Das Gleiche gilt für den Sheriff und seine Leute. Für die bist du bloß ein politischer Tourist. Ein Durchreisender.«
Tims Einschätzung unserer Vollzugsbehörden verstört mich. »Ich vertraue diesen Männern. Wir sind mit den meisten von ihnen aufgewachsen, oder mit ihren Vätern.«
»Ich behaupte ja nicht, dass die Polizisten Gauner sind, aber sie denken an ihr eigenes Wohl und das ihrer Angehörigen. Außerdem haben sie gerne ein bisschen Spaß, so wie jeder andere auch. Viele von denen drücken ein Auge zu, um zusammen mit irgendeiner Berühmtheit fotografiert zu werden. Ich war auf vielen dieser Partys. Ich weiß, wen ich dort gesehen habe.«
Wie die volle Bedeutung einer Krebsdiagnose werden mir die Konsequenzen von Tims Worten erst allmählich klar. »Du kannst bezeugen, dass Mr. X persönlich bei diesen Hundekämpfen dabei war? Du hast erlebt, wie er die Prostitution von Minderjährigen gefördert hat?«
Jessup schnaubt geringschätzig. »Ist das dein Ernst? Du willst Mr. X wegen der Veranstaltung von Hundekämpfen verhaften lassen? Auf meine Aussage hin? Der Bastard könnte ein Dutzend aufrechter Bürger schwören lassen, dass er an jedem Tag oder Abend, den wir nennen, auf der Queen war.«
»Hundekämpfe sind in Mississippi ein Kapitalverbrechen«, sage ich mit ruhiger Stimme. »Es ist schon ein Verbrechen, bei einem Hundekampf zuzuschauen. Als Höchsturteil können zehn Jahre verhängt werden. Und bei Wiederholungsfällen gibt es schwerste Strafen.«
Tims Aufmerksamkeit scheint geweckt zu sein. Doch während ich die Tatsachen aufzähle, muss ich insgeheim zugeben, dass Jessup tatsächlich ein Problemzeuge wäre. »Natürlich wäre es tödlich, wenn wir jemanden wegen Hinterziehung schnappen könnten. Golden Parachute würde ihre Glücksspiellizenz verlieren, womit auf einen Schlag fünf Casinos schließen müssten. Das Finanzamt würde sie auffressen, und die Partner müssten Hunderte von Millionen Dollar nachzahlen.«
»Das hört sich schon besser an«, sagt Tim bitter.
»Und was schlägst du vor, wie man diese Sache in Angriff nehmen soll? Hast du Beweise, abgesehen von den Fotos?«
Er leckt sich die Lippen. »Okay, ich hab nicht genug. Aber ich arbeite seit einem Monat an einem Plan.«
Eine böse Vorahnung keimt in mir auf. Alles, was Tim mir bisher anvertraut hat, führt zu diesem Punkt. »Tim, ich werde dir nicht helfen, dein Leben zu riskieren. Ich habe Erfahrung mit solchen Dingen. Manchem Informanten wurde die Kehle durchgeschnitten.«
Jessup hat den Blick eines Märtyrers, der in die Flammen schreitet. Unvermittelt packt er mein Handgelenk mit überraschend kräftigem Griff. »Das hier ist unsere Stadt, Mann. Ich werde nicht hinnehmen, wie diese zugereisten Arschlöcher alles ruinieren, was unsere Vorfahren mühsam aufgebaut haben …«
»Pssst!« Ich spüre, wie mir das Blut in die Wangen schießt. »Ich höre dich auch so. Ich verstehe deine Wut, aber dein Leben ist das nicht wert. Es lohnt sich nicht einmal, dafür verprügelt zu werden. Die Männer hier haben schon um Geld gespielt, Sklaven verkauft, Indianerfrauen vergewaltigt und sich gegenseitig die Kehle durchgeschnitten, bevor Paul Revere seinen ersten silbernen Kerzenleuchter verkauft hat.«
Tims Augen glänzen. »Was ist los mit dir, Penn? Es geht um Unschuldige. Um minderjährige Mädchen und schutzlose Tiere. Jede Woche schickt Mr. X vier Pick-ups mit leeren Käfigen hundert Meilen in sämtliche Richtungen. Wenn sie zurückkommen, sind die Käfige voller Cockerspaniels, Pudel, Dalmatiner und Katzen. Die Ausbilder werfen sie in ein Loch mit hungernden Pitbulls, damit die das Töten lernen. Oder sie binden die armen Viecher an eine Spindel, damit die Hunde zum Laufen gebracht werden, und dann verfüttern sie die Tiere an die Kampfhunde. Sie werden in Stücke gerissen.«
Ein Schauder durchrieselt mich. Ich muss an eine Nachbarin denken, die drei Häuser von mir weg wohnt und im letzten Monat ihren siebenjährigen Cockerspaniel verloren hat. Sie ließ den Hund hinaus, damit er sein Geschäft machen konnte, und er kam nie zurück.
»Ich habe nicht darum gebeten«, beharrt Tim, »aber ich bin in einer Situation, in der ich etwas dagegen tun kann. Ich, okay? Was für ein Mann wäre ich, würde ich diese Scheiße einfach weiterlaufen lassen?«
Seine Frage ist wie eine Klinge, die tief in mein Gewissen schneidet. »Timmy … ach, verdammt. Was würdest du sagen, wenn ich nur deshalb noch Bürgermeister dieser Stadt wäre, weil ich nicht weiß, wie ich meinem Vater beibringen soll, dass ich zurücktrete?«
Jessup blinzelt wie ein Kind, das etwas zu verstehen versucht, was jenseits seines Begriffsvermögens liegt. »Ich würde sagen, dass du mich verarschen willst. Aber …« Seine Miene nimmt einen vollkommen anderen Ausdruck an. »Das willst du doch nicht wirklich, oder?«
»Doch.«
»Warum? Bist du etwa krank?«
Er stellt die Frage, weil unser letzter Bürgermeister zurückgetreten war, nachdem man bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert hatte. »Nicht körperlich. Eher seelisch.«
Tim blickt mich ungläubig an. »Seelisch? Machst du Witze? Ich bin seelenkrank! Mann, du hast überall im Ort verkündet, dass du die Dinge ändern willst. Die Menschen haben dir geglaubt. Und nun willst du aufgeben? Der Oberpfadfinder will den Krempel hinschmeißen? Warum? Weil es schwieriger ist, als du gedacht hast? Hat jemand deine Gefühle verletzt?«
Ich setze zu einer Erklärung an, doch Tim schneidet mir das Wort ab. »Die sind mit Geld zu dir gekommen, richtig? Nein … sie haben dich bedroht, stimmt’s?«
»Nein.«
»Doch!« Tims Augen blitzen. »Irgendwie haben sie dich in den Klauen, und jetzt fällt dir nichts anderes ein, als abzuschwirren.«
»Tim!« Ich packe sein Bein und drücke so kräftig zu, dass er garantiert einen Bluterguss bekommt. »Halt die Klappe und hör mir eine Sekunde zu!«
Seine Brust hebt und senkt sich vor Erregung und Wut.
Ich beuge mich so nahe an ihn heran, dass er meine Augen sieht. »Keines der Casinos ist an mich herangetreten. Keine Bestechungsversuche, keine Drohungen. Bis heute Abend war das, was du mir erzählt hast, bloß Getuschel.«
»Und jetzt?«
»Jetzt wollen mir die verdammten Fotos nicht mehr aus dem Kopf.«
Er lächelt traurig. »Ich hatte dich gewarnt.«
»Ja.«
Er reibt sich das Gesicht mit beiden Händen so heftig, dass sein Schnurrbart Kratzgeräusche macht. »Und was nun? Bin ich auf mich allein gestellt?«
»Ja. Es sei denn, du sagst mir, wer Mr. X ist.«
Tims Augen werden so ausdruckslos wie Murmeln.
»Mach schon. Ich kenne Gesetzeshüter, die nicht von hier sind. Verlässliche Leute. Nenne mir seinen Namen, und ich werde eine Ermittlung einleiten. Wir ziehen dem Typen das Fell ab. Ich habe schon früher mit solchen Kerlen zu tun gehabt, das weißt du. Sie wurden zum Tode verurteilt.«
Langsam und bedächtig drückt Tim seine Zigarette an den moosbedeckten Ziegeln hinter sich aus. »Genau. Deshalb bin ich zu dir gekommen. Aber du musst dir klarmachen, was dir bevorsteht, Penn. Dieser Typ hat Einfluss. Wenn jemand in Houston oder Washington sitzt, braucht er noch lange nicht sauber zu sein.«
»Tim, ich bin gegen den Chef des FBI angetreten. Und ich habe gewonnen.«
Jessup wirkt nicht überzeugt. »Das war was anderes. Jemand wie der muss sich an die Regeln halten. Das ist wie mit Gandhi, als er die Briten in Indien besiegt hat. Mach dir nichts vor. Wenn du dich mit Mr. X anlegst, schwimmst du ans seichte Ende des Lake St. John und hoffst, einen Alligator umzubringen, bevor er dich erwischt.«
Dieses Bild trifft mich mit primitiver Kraft. Ich bin nachts einmal mit einem Motorboot über das seichte Ende des Sees gefahren; kein Anblick ist mit dem der vielen Dutzend roter Augen zu vergleichen, die dicht über der Wasseroberfläche zwischen den krummen Zypressenstämmen lauern. Der erste Schlag eines panzerbewehrten Schwanzes im Wasser löst eine triebhafte Furcht aus, die dich beten lässt, dass die Verschlussschraube des Bootes nicht locker sitzt.
»Schon gut. Aber ich glaube, dass du ein bisschen verschreckt bist. Der Knabe ist auch nur ein Mensch.«
Jessup zupft an seinem Schnurrbart wie der nervöse Junkie, der er früher einmal war. »Du kennst ihn nicht, Mann … du kennst ihn nicht. Der Kerl ist nach außen so glatt wie Seide, aber innen hat er Sägezähne. Wenn die Hunde sich gegenseitig in Stücke reißen oder ein Mädchen hinten in einem Wohnwagen schreit, hat er plötzlich nicht mehr Eis, sondern Feuer in den Augen.«
»Tim.« Ich beuge mich vor und packe sein Handgelenk. »Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Wenn du dich weigerst, die Profis einzuschalten, wie sollen wir diesen Verrückten dann stoppen?«
Ein seltsames Licht erscheint in Tims Augen. »Es gibt nur eine einzige Methode, um solchen Leuten das Handwerk zu legen.«
»Und welche?«
»Von innen her.«
Herrje. Tim hat sich zu viele Krimiserien angeschaut. »Du willst den Typen, den du als leibhaftigen Satan beschreibst, mit einem Abhörgerät fertigmachen?«
Jessup lacht auf. »Scheiße, nein! Die Kerle nehmen Scanner mit aufs Klo.«
»Was hast du dann vor?«
Er schüttelt den Kopf mit kindlicher Hartnäckigkeit. »Das brauchst du nicht zu wissen. Aber Gott hat seine Gründe gehabt, mich in diese Lage zu bringen.«
Wenn Informanten über Gott reden, schrillt bei mir die Alarmanlage. »Tim …«
»He, ich erwarte nicht, dass du meinen Glauben teilst. Ich möchte nur, dass du nimmst, was ich dir übergeben werde, und das Richtige tust.«
Ich fühle mich verpflichtet, ihn von seinem Vorhaben abzubringen, aber hinter dem Wunsch, einen Kindheitsfreund zu schützen, verbirgt sich ein professionelles, zynisches Wissen um die Wahrheit: In Fällen wie diesem können die Männer an der Spitze häufig nur dann verurteilt werden, wenn es einen Zeugen im Inneren der Organisation gibt, der das kriminelle Geschehen direkt beobachtet. Und wer außer einem Märtyrer wäre dazu bereit?
»Was willst du mir denn übergeben?«
»Beweismaterial. Einen Pfahl, den wir durch das Herz von Mr. X treiben, und ein Messer, mit dem wir den Kopf des Unternehmens abschneiden. Sag, dass du mir hilfst, Penn. Versprich mir, dass du nicht zurücktrittst. Wir müssen diese Drecksäcke erledigen.«
Wider besseres Wissen strecke ich den Arm aus und drücke Tims dargebotene Hand. »Okay. Aber du musst Augen im Hinterkopf haben. Und vorne sowieso. Spitzel werden meist dann erwischt, wenn sie einen dummen Fehler machen. Du hast einen langen Weg hinter dir. Sieh zu, dass dir jetzt nichts passiert.«
Tim schaut mir ins Gesicht. »Klar, ich muss vorsichtig sein. Schließlich habe ich einen Sohn, nicht?« Als wäre ihm plötzlich etwas eingefallen, greift er nach meiner anderen Hand wie ein Pastor, der mich ersucht, Jesus als meinen Erlöser anzuerkennen. »Aber wenn etwas passiert, dann mach dir keine Vorwürfe. Für mich gibt es keine andere Wahl.«
Deine Frau und dein Sohn wären anderer Meinung, geht es mir durch den Kopf, aber ich nicke.
Dann sitzen wir stumm und verlegen da wie zwei Männer, die sich über ein unangenehmes Problem ausgesprochen haben und nichts mehr hinzufügen können. Smalltalk ist sinnlos, aber wie können wir uns sonst voneinander verabschieden? Indem wir uns die Handflächen aufschneiden und einen Bluteid schwören wie Tom und Huck?
»Bist du noch mit der Lady zusammen, die den Buchladen führt?«, fragt Tim schließlich in gezwungen beiläufigem Tonfall.
»Libby?« Anscheinend ist die Neuigkeit noch nicht bis in Tims Kreise vorgedrungen. »Wir haben uns vor ungefähr einer Woche getrennt. Warum?«
»Ich habe ihren Sohn in den letzten Wochen einige Male auf der Queen gesehen. Er war high wie ein Drachen. Hat wohl ’nen gefälschten Ausweis, der Junge.«
Nach allem, was ich heute Abend gehört habe, bringt diese Mitteilung das Fass zum Überlaufen. Ich habe zu viel Zeit und politisches Kapital darauf verwendet, den neunzehnjährigen Sohn meiner früheren Freundin vor Zusammenstößen mit dem Gesetz zu retten. Eigentlich ist er ein anständiger Junge, aber wenn er sein Versprechen gebrochen hat, clean zu bleiben, hält die Zukunft ernste Unannehmlichkeiten für ihn bereit.
Tim wirkt besorgt. »Hätte ich dir das nicht sagen sollen?«
»Bist du sicher, dass er high war?«
Plötzlich kniet Tim sich hin, angespannt wie ein aufgeschrecktes Reh, und hebt die Hand, damit ich schweige. Während sein Blick sich auf eine Stelle jenseits der Mauer richtet, zwischen uns und dem Fluss, sehe ich, was ihn beunruhigt: das Geräusch eines Autos, das die Cemetery Road heraufkommt. Wir lauschen dem Dröhnen des Motors und hoffen, dass er den Dienst versagt … aber das geschieht nicht. Ein schleifendes Quietschen von Bremsen, dann Stille.
»Er hat angehalten«, zischt Tim. »Direkt unter uns.«
»Immer mit der Ruhe«, flüstere ich, obwohl mein Herz rast. »Wahrscheinlich ist es ein Streifenwagen, und mein Auto wird überprüft.«
Tim hockt nun auf den Fußballen. Hastig rafft er die Fotos vom Boden auf, legt sie in eine Ecke der Grabstätte und setzt sie mit seinem Feuerzeug in Brand. »Verdeck das Licht mit deinem Körper«, befiehlt er.
Während ich gehorche, überquert er im Krebsgang zwei Gräber und schiebt den Kopf über den Rand der Mauer. Die Fotos kringeln sich bereits zu glühender Asche.
»Kannst du was sehen?«, frage ich.
»Noch nicht. Wir sind zu tief drin.«
»Lass mich einen Blick auf die Leute werfen.«
»Auf keinen Fall. Bleib da.«
Wütend über seine Paranoia, springe ich auf und klettere über die Mauer. Bevor ich sechs Meter zurückgelegt habe, höre ich das blecherne Kreischen eines Polizeifunkgeräts. Mir fällt ein Stein vom Herzen, aber Tim ist wahrscheinlich kurz davor, die Flucht zu ergreifen. Ich trabe zu der Bank unter dem Flaggenmast und spähe über den Rand des Jewish Hill.
Ein Einsatzwagen steht mit laufendem Motor hinter meinem Saab. In dem Einsatzwagen sitzt ein Polizist, der in sein Funkgerät spricht. Zweifellos lässt er mein Nummernschild überprüfen. In ein paar Sekunden wird er erfahren, dass das Auto dem Bürgermeister gehört, wenn er es nicht schon wusste. Nun steigt er aus seinem Wagen und knipst eine starke Taschenlampe an. Er lässt den Strahl über die Friedhofsmauer gleiten und richtet ihn dann auf die Hecke direkt unter dem Jewish Hill. Die Lampe ist hell genug, um einen sich drehenden Engel in seinem gespenstischen Tanz über den Toten erstarren zu lassen.
Ich habe die Wahl, so lange zu warten, bis der Mann abfährt, oder ihm gegenüberzutreten, und entscheide mich für die zweite Möglichkeit. Zum einen wird er vielleicht nicht weiterfahren, sondern einen Abschleppwagen kommen lassen, zum anderen bin ich der Bürgermeister, und es geht niemanden etwas an, was ich hier mitten in der Nacht zu suchen habe. Ich könnte ja, von Depressionen geplagt, das Grab meiner Frau besucht haben.
Als der weiße Strahl den sich drehenden Engel verlässt und sich zu mir herauftastet, jogge ich zurück zu dem ummauerten Grab, das Tim und mir Schutz geboten hat. Mein alter Freund ist so leise verschwunden, wie er erschienen war. Der Geruch von verbranntem Papier liegt immer noch in der Luft, und zwei winzige Aschestücke glühen orange in der Ecke der Grabstätte. Es sind die einzigen Überreste der Indizien eines Falles, von dem ich nicht weiß, wie ich ihn anpacken soll. Schließlich bin ich kein Staatsanwalt mehr, sondern Bürgermeister. Und niemand weiß besser als ich, wie wenig Macht ich wirklich habe.
4
Julia Jessup beobachtet, wie ihr sieben Monate alter Sohn in der Krippe schläft, die ihre Schwägerin aus San Diego geschickt hat. Sie beneidet ihren kleinen Jungen darum, dass er so fest schlafen kann, während sein Vater fort ist. Eine makellose, glänzende Speichelblase bildet sich beim Ausatmen auf seinen Engelslippen und platzt beim Einatmen. Julia versucht ein Lächeln, aber sie bringt es nicht ganz zustande. Irgendwo zwischen ihrem Bauch und ihrem Herzen hat sich Furcht eingenistet – wie ein Wurm, der ihr Inneres auffrisst. Tim hat versprochen, dass alles glattgehen und dass er sicher zurückkehren wird, aber Julias Furcht schenkt ihm keinen Glauben.
Sie hat einen langen Weg zurückgelegt, bevor sie diesen Ort erreicht hat, diese kleine Zuflucht vor der Härte der Welt. Vor gefühlten hundert Jahren heiratete sie ihren Highschool-Freund, den Footballstar und Teenieschwarm der Schule. Der Golden Boy schwängerte sie mit neunzehn Jahren, heiratete sie eine Woche später und infizierte sie zwei Wochen vor der Geburt des Babys mit Herpes. Julia fand es heraus, als das Baby sich während der Geburt ebenfalls ansteckte und acht Tage später unter Todesqualen starb. Danach war es schwierig, an ihren romantischen Illusionen festzuhalten. Aber sie hatte es versucht.
Sie litt, während er mit seinen idiotischen Freunden durch die Kneipen zog und sich mit geistlosen Schlampen vergnügte, sich während der Jagdsaison in den Wäldern herumtrieb, an Paintball-Turnieren teilnahm oder angelte, wobei sie manchmal in einem von Moskitos umwölkten Fischerboot neben ihm saß, schwitzte und ihm zusah. Aber letzten Endes musste sie sich der Tatsache stellen, dass sie sich nicht mit einem Mann, sondern mit einem Jungen verbunden hatte und dass ihre gemeinsame Zukunft bedeutete, ihn mit jedem Flittchen zu teilen, das ihm ins Auge fiel, wobei er sich alle Geschlechtskrankheiten zuziehen konnte, die Julia bisher erspart geblieben waren.
Die ersten Jahre nach der Scheidung waren jämmerlicher, als sie sich hätte vorstellen können. Julia stammte aus gutem Hause, doch als die Ölbranche in den Achtzigern zusammenbrach, war ihr Vater aus dem Geschäft und beendete seine ziel- und erfolglose Arbeitssuche mit einer Kugel in den Kopf. Nach der Scheidung war sie überwiegend auf sich allein gestellt. Sie arbeitete als Kellnerin und an einer Registrierkasse, beim Einparkservice auf Partys und verkaufte Kosmetika an Frauen, die in einer Woche mehr für Gesichtscreme ausgaben, als Julia in einem Monat an Miete zahlte. Meistens machte sie einen Bogen um Männer und sah zu, wie ihre Freundinnen, die in Natchez geblieben waren, den Umgang mit dem anderen Geschlecht auf jede erdenkliche Art vermasselten. Wenn Julia Gesellschaft brauchte, wählte sie ältere Männer – verheiratete, die sich keine Illusionen machten. Im Übrigen wartete sie ab.
Dann war sie Tim Jessup begegnet – oder wieder begegnet. Natürlich kannte sie ihn noch aus der Schule, aber sie hatte sich nie mit ihm verabredet, denn er war drei Jahrgänge über ihr gewesen. Damals war er einer der großspurigen Typen gewesen, die dachten, dass das gute Leben wie ein vom Schicksal ausgebreiteter roter Teppich vor ihnen lag. Doch bald nach der Highschool wurde er eines Besseren belehrt.
Julia hatte kaum noch an Tim gedacht, jedenfalls nicht, bis sie eines Abends den Auftrag erhielt, Hors d’œuvres auf dem Casinoschiff zu servieren. Tim hatte sie von seinem Blackjack-Tisch aus beobachtet und dann nach Feierabend auf sie gewartet. Sie frühstückten im Waffle House, unterhielten sich über die gute alte Zeit in St. Stephen’s und dann, überraschenderweise, auch über die weniger guten Zeiten, die seither den größten Teil ihres Lebens ausgefüllt hatten. Am Ende jener Nacht wusste Julia, dass Tim der Mann sein konnte, auf den sie gewartet hatte. Es gab nur einen Haken: Er hatte ein Drogenproblem.