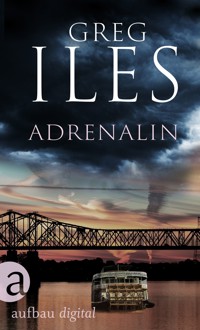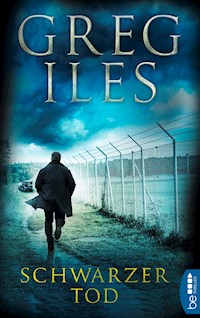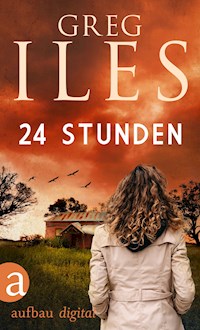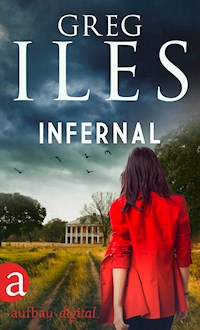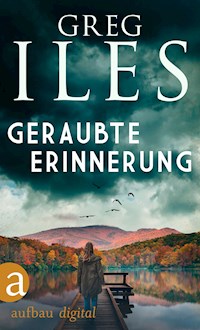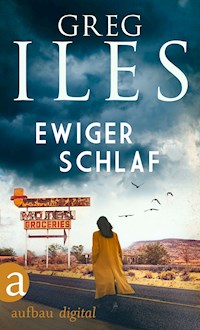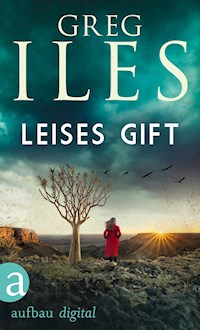9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ronin-Hörverlag, ein Imprint von Omondi GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: World War 2 Series
- Sprache: Deutsch
Teil 2 von »Spandau Phoenix«! Eine neue Gefahr ist aus der Asche des Dritten Reichs auferstanden: Phoenix! Rudolf Heß, die rechte Hand Hitlers, ist tot und sein persönliches Tagebuch, die »Spandauer Papiere«, landen durch Zufall in den Händen des unscheinbaren Polizisten Hannes Apfel. Nur Stunden später ist Hannes nicht nur das Ziel von mehreren internationalen Geheimdiensten, sondern wird auch noch von der mysteriösen und skrupellosen Gruppe »Phoenix« gejagt! Denn was auch immer in den »Spandauer Papieren« geschrieben steht – es könnte den Kalten Krieg wieder eskalieren lassen ... und sogar einen alten Feind zurückbringen. Hannes’ heillose Flucht führt ihn und seine wenigen Verbündeten durch das geteilte Berlin und darüber hinaus, da erreicht ihn ein schreckliches Angebot: Der mysteriöse Mann, der hinter »Phoenix« steht, zwingt Hannes, sich zu entscheiden: zwischen seiner Frau und seinem ungeborenen Kind oder Millionen von Menschenleben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Inhalt
Spandau Phoenix
1. Kapitel
Lufthansa-Flug 417: südafrikanischer Luftraum
El Al Flug 331: über Tel Aviv, Israel
Jan Smuts Airport, Johannesburg
2. Kapitel
Das nördliche Transvaal, Republik Südafrika
3. Kapitel
Horn House: das nördliche Transvaal, Republik Südafrika
Flughafen Tempelhof: Amerikanischer Sektor, Westberlin, BRD
Internationaler Flughafen Frankfurt-Main, BRD
4. Kapitel
El Al Flug 331: Luftraum von Zaire
5. Kapitel
Pretoria, Republik Südafrika
MI5-Hauptquartier: Charles Street, London, England
Zimmer 604, Burgerspark Hotel: Pretoria, Republik Südafrika
6. Kapitel
Horn House: das nördliche Transvaal, Republik Südafrika
Mosambik-Kanal, Indischer Ozean
7. Kapitel
Horn House: das nördliche Transvaal, Republik Südafrika
Burgers Park Hotel, Pretoria
8. Kapitel
Horn House: das nördliche Transvaal, Republik Südafrika
Burgers Park Hotel, Pretoria
Horn House: das nördliche Transvaal
9. Kapitel
Jan Smuts Airport: Johannesburg
Bronberrick Motel: südlich von Pretoria
Horn House: das nördliche Transvaal
MV Casilda: Madagaskarkanal, vor Mosambik
Zimmer 520: The Stanley House, Pretoria
Bronberrick Motel: südlich von Pretoria
10. Kapitel
Das nördliche Transvaal, Republik Südafrika
Zimmer 604: das Protea Hof Hotel
11. Kapitel
Van der Walt Straat, Pretoria
Raum 604: das Protea Hof Hotel, Pretoria
Das Voortrekker-Denkmal, Pretoria
Zimmer 604: das Protea Hof Hotel, Pretoria
12. Kapitel
MI5 Hauptquartier: Charles Street, London
Grenze Mosambik/Südafrika
Horn House: das nördliche Transvaal, Republik Südafrika
13. Kapitel
Grenze Mosambik/Südafrika
Horn House: das nördliche Transvaal
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Horn House
Protea Hof Hotel, Pretoria
17. Kapitel
Horn House
Die Union Buildings, Pretoria
18. Kapitel
MI5 Hauptquartier: Charles Street, London, Großbritannien
Protea Hof Hotel, Pretoria
MI5 Hauptquartier: Charles Street, London, Großbritannien
19. Kapitel
Angolanischer Luftraum
Das nördliche Transvaal, Republik Südafrika
Die Union Buildings, Pretoria
Visagie Straat, Pretoria
20. Kapitel
Horn House
Das nördliche Transvaal
Horn House
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Epilog
Washington
Westberlin, Aktuelle Politische Information (API)
Martin-Luther-Krankenhaus: Britischer Sektor, Westberlin
Danksagung
Über den Autor
Entdecke auch unsere Ronin-Hörbücher
Spandau Phoenix
Buch zwei
Von Greg Iles
Aus dem Englischen von Franca Tödter und Ulrike Koch
1. Kapitel
2:04 Uhr
Lufthansa-Flug 417: südafrikanischer Luftraum
Das deutsche Verkehrsflugzeug zitterte mit dem zunehmenden Luftwiderstand im Sinkflug. Hannes Apfel holte tief Luft und umklammerte die Armlehnen fester. Die Durchsageglocke ertönte.
»Achtung, meine Damen und Herren«, sagte eine männliche Stimme. »Hier spricht Ihr Kapitän. Wir beginnen jetzt unseren Landeanflug auf den Jan Smuts International Airport. Wir werden voraussichtlich pünktlich ankommen. Die Temperatur in Johannesburg liegt bei 25 Grad. Seit zwei Wochen hat es nicht mehr geregnet, und es wird auch in nächster Zeit kein Regen erwartet. Wir hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt in Südafrika genießen und freuen uns, dass Sie mit Lufthansa geflogen sind. Eine gute Ankunft und Dankeschön.«
»Schöne Abwechslung«, bemerkte Hauer.
»Was?«, sagte Hannes.
»Das Wetter.«
»Wie bitte?«
»Es ist Sommer hier, Hannes. Kein Schnee. In Berlin haben wir seit drei Wochen kaum die Sonne gesehen.«
»Oh. Entschuldigung. Ich habe über den Austausch nachgedacht. Hast du dich schon für einen Plan entschieden?«
Hauer nickte. »Mit unseren begrenzten Ressourcen gibt es wirklich nur eine Möglichkeit. Wir müssen einen Ort finden, der weitläufig und offen ist, aber auch genug Versteckmöglichkeiten für mich bietet. Ein leeres Fußballstadion wäre ideal. Ich kann mich auf der Tribüne verstecken, während du den Austausch auf dem Spielfeld vornimmst. Du wirst zwei Aufgaben haben. Die erste besteht aus einem Schauspiel.«
»Einem Schauspiel?«
Hauer nickte. »Du wirst eine Granate in der Hand halten und so tun, als würdest du alle in die Luft jagen, wenn sie Iris nicht sofort ausliefern, sobald sie die Papiere berühren.«
»Dafür muss ich nicht schauspielern«, sagte Hannes.
»Ich fürchte, das musst du doch. Es wird keine scharfe Granate sein, an so was kommen wir nicht ran. Wir müssen eine Granatenhülse in einem Laden für Armeebedarf kaufen. Sie ist nur ein Hilfsmittel, um die Sache zu beschleunigen. Mein Plan sieht vor, dass Iris zehn Sekunden nach der Übergabe der Papiere bei dir sein wird.«
»Und mein zweiter Job?«
»Laufen. Sobald du Iris hast, läufst du in die vorbereitete Deckung. Die Entführer haben nicht die Absicht, dich lebend entkommen zu lassen. Wenn du die ersten Schüsse hörst, rennst du wie der Teufel.«
»Was ist dein Job?«
Hauer machte mit Daumen und Zeigefinger eine Pistole. »Rückendeckung. Sobald du Iris aus meiner Schusslinie gebracht hast, fange ich an, die Leute niederzuschießen. Der erste Schuss, den du hörst, wird meiner sein. Ich werde die Männer auf dem Feld ausschalten und alle, die den Austauschort decken.«
Hannes studierte Hauers Gesicht. »Kannst du das schaffen?«
»Ich werde dich nicht anlügen. Zwei Scharfschützen wären besser. Aber ich bin immer noch einer der fähigsten Scharfschützen in Deutschland. Ich kann es schaffen.«
Hannes starrte aus dem kleinen Fenster auf die Sterne, die in der afrikanischen Dunkelheit hingen. »Hast du diesen Plan schon einmal umgesetzt?«
Hauer lächelte. »Ich habe gesehen, wie er umgesetzt wurde. Vor zehn Jahren habe ich gesehen, wie Terroristen ihn erfolgreich gegen die Kölner Polizei eingesetzt haben.«
»Oh.«
Die Lufthansa-Maschine neigte sich auf 65 Grad nach Steuerbord und setzte zum Anflug an. Hannes hielt sich an den Armlehnen seines Sitzes fest und starrte geradeaus. Hauer beobachtete ihn schweigend und wünschte, er könnte seinen Sohn mehr beruhigen. Wenigstens hatte er Hannes erspart, was er selbst wusste: dass die Terroristen, die seinen Geiselaustauschplan ausgenutzt hatten, aus dem Kölner Fußballstadion entkommen waren, nur um eine Stunde später in einem Bahnhof in die Luft gesprengt zu werden. Mit Iris von einem Austauschpunkt zu entkommen, dürfte nicht allzu schwierig sein. Aus Südafrika zu entkommen, war eine ganz andere Sache. Hauer legte seine schwielige Hand auf die von Hannes und drückte sie fest.
»Wir kriegen sie schon, Junge«, sagte er leise.
Hannes sah seinen Vater an und reckte sein Kinn entschlossen nach vorne. »Ich bin bereit. Aber da ist etwas, das mir nicht aus dem Kopf geht. Wer hat diesem Südafrikaner, der Professor Natterman angegriffen hat, die Kehle durchgeschnitten? Warum hat er es getan? Und wo ist er hingegangen? Ist er einfach verschwunden?«
Hauers Gesicht verfinsterte sich. Er wusste genau, warum der unbekannte Mörder dem Südafrikaner die Kehle durchgeschnitten hatte, und wenn Hannes das Folienpaket in seiner Mantelinnentasche öffnete, würde er es auch wissen. Der Mörder war mit drei Seiten des Spandauer Tagebuchs entkommen. Auf Hauers Anweisung hin war das Päckchen für die Dauer des Fluges versteckt geblieben. Aber früher oder später würde er Hannes die Wahrheit erzählen müssen. Sonst würde er es selbst herausfinden.
»Hannes«, sagte er, »ich habe das Gefühl, dass wir unserem flüchtigen Mörder früher begegnen werden, als du denkst.«
2:20 Uhr
El Al Flug 331: über Tel Aviv, Israel
Die El Al 747 flog in einer bequemen Höhe von 8500 Metern über dem Ben-Gurion-Flughafen, einer aus einem Dutzend winziger Punkte auf den grün leuchtenden Bildschirmen der Flugsicherung. Ein technischer Defekt an einem Eastern Whisperjet auf der Landebahn drei hatte zu einer Verspätung geführt, und bis die Männer, die den Himmel über Tel Aviv überwachten, die Freigabe erteilten, mussten Professor Natterman und sein zurückhaltender jüdischer Begleiter zusammen mit 270 anderen ungeduldigen Reisenden am Himmel warten.
»Was sind das für mysteriöse Dinge, die wir abholen müssen?«, fragte Natterman. »Waffen? Sprengstoff?«
Stern blickte in die Dunkelheit hinaus. »Wir werden Waffen brauchen«, murmelte er. »Aber wir müssen sie in Südafrika besorgen, nicht in Israel. Ich habe das alles von Ihrer Hütte aus arrangiert.«
Natterman versuchte erfolglos das Sodbrennen zu ignorieren, das ihm zusetzte, seit sie in Hamburg losgeflogen waren. Das und der stechende Schmerz in seiner aufgerissenen Nase machten die unerwartete Verzögerung fast unerträglich. »Glauben Sie, dass sie schon in Pretoria angekommen sind?«, fragte er.
Stern schaute auf seine Uhr. »Wenn sie den ersten Flug aus Frankfurt genommen haben, müssten sie jetzt in Johannesburg landen.«
»Gott steh ihnen bei.«
Stern grunzte skeptisch.
»Ich habe darüber nachgedacht, was Sie mir in Frankfurt erzählt haben«, sagte Natterman. »Über diesen Lord Grenville. Der, dem die Phoenix AG gehört. Wenn Grenville Engländer ist und seine Firma ihren Sitz in Südafrika hat, warum sind Sie dann überhaupt nach Berlin gekommen?«
»Das ist eine gute Frage, Professor. Aber die Antwort ist kompliziert und zumindest im Moment noch geheim.«
»Wenn Sie mir nichts sagen wollen«, brummte Natterman, »warum bin ich dann überhaupt hier? Ein Mann wie Sie tut nichts ohne einen guten Grund.«
»Das ist wahr, Professor«, sagte Stern. »Ich habe Sie aus zwei Gründen mitgenommen. Der eine ist, dass Sie mir nützliche historische Informationen liefern können. Ich weiß, Sie können es kaum erwarten, mir von all Ihren Theorien über Rudolf Heß zu erzählen, und ein paar davon sind sicher auch für mich interessant. Aber lassen Sie mich erst einmal erklären, wie das Ganze ablaufen soll. Sie wollen wissen, was meiner Meinung nach in Südafrika vor sich geht. Schön und gut. Aber Sie müssen sich die Antworten verdienen. Sie werden mir jetzt meine Fragen zum Fall Heß beantworten. Dann werde ich entscheiden, wie viele Informationen ich Ihnen im Gegenzug gebe. Wenn Sie mir Dinge erzählen, die ich noch nicht weiß, werde ich Sie mit einer Gegenleistung belohnen. Aber das ist das einzige Mal, dass wir über Rudolf Heß sprechen werden. Sind Sie einverstanden?«
Natterman saß fast eine Minute lang schweigend da. Dann räusperte er sich und sagte: »Was wollen Sie wissen?«
»Erzählen Sie mir von Heß und den Briten. Gab es 1941 eine pronationalsozialistische Gruppe in der britischen Regierung?«
Natterman faltete die Hände auf seinem Schoß zusammen. »Es ist sehr kompliziert, Stern.«
»Ich glaube, ich kann Ihnen folgen, Herr Einstein.«
»Also gut. Ja, es gab eine Gruppe von Nazi-Sympathisanten – sehr hochrangig –, die einen Deal mit Hitler machen wollten. Das ist bewiesen. Oder zumindest wird es gerade von einem Oxford-Akademiker bewiesen. Die Frage ist: War diese Gruppe aufrichtig überzeugt? Wissen Sie, was ich meine, Stern? Waren die Mitglieder dieser Gruppe englische Faschisten, die das Hakenkreuz liebten? Oder einfach nur Männer, die auf alles Gold aus waren, das sie bekommen konnten? Waren es paranoide Antikommunisten, die um jeden Preis Frieden wollten, damit Hitler Russland vernichten konnte? Oder – und das ist der Knackpunkt – waren es patriotische Engländer, die Hitler an der Nase herumführten, bis es für ihn zu spät war, in England einzufallen? Verstehen Sie jetzt, was ich mit kompliziert meine?«
Stern winkte mit der Hand.
»Und wenn es Nazi-Sympathisanten waren«, fuhr Natterman fort, »haben sie dann wirklich im Geheimen gearbeitet? Oder wusste der britische Geheimdienst die ganze Zeit von ihnen? Welch besseres Ablenkungsmanöver hätte sich der MI5 ausdenken können, als Hitler von echten Verrätern an der Nase herumführen zu lassen und ihn glauben zu lassen, er könne England ohne Invasion neutralisieren, bis er mit dem Angriff auf Russland nicht mehr warten konnte? Vergessen Sie nicht, dass diese ›Verräter‹ nicht zu den Leuten gehörten, die man einfach so wegen Hochverrats verhaftet. Wir reden hier über das Rückgrat der britischen Regierung und Industrie. Was wäre, wenn der MI5 beschlossen hätte, diese blaublütigen Verräter auszunutzen, solange sie noch konnten, und ihnen dann auf die Finger zu klopfen, wenn alles vorbei ist? Stimmen Sie mir zu, Stern?«
»Ich bin Ihnen voraus, Professor. Was wäre, wenn die Top-Offiziere des britischen Geheimdienstes – in der Annahme, dass es sich um ein paar heimliche Rote aus Oxford handelte – glühende Antikommunisten gewesen wären? Brüder im Geiste mit einer angeblichen aristokratischen Gruppe aus Hitler-Verehrern? Was wäre, wenn der britische Geheimdienst aus rein pragmatischen Gründen einen Deal mit Hitler machen wollte, um ihm die Möglichkeit zu geben, Stalin zu vernichten? Oder … der britische Geheimdienst könnte beauftragt worden sein, ein solches Geschäft zu erkunden. In diesem Fall wäre der Anstoß, mit Hitler Frieden zu schließen, von der höchsten Ebene der britischen Regierung ausgegangen. Und ich meine von ganz oben. Churchill ausgenommen, natürlich. Aber einschließlich der Krone.« Stern zwinkerte Natterman zu. »Stimmen Sie mir zu, Professor?«
Natterman warf ihm einen finsteren Blick zu. »Sie hätten Historiker werden sollen, verdammt. Sie haben den Kernpunkt meiner These getroffen – Duke of Windsor. Der britische Geheimdienst hat jahrelang dabei geholfen, Windsors dunkle Vergangenheit zu vertuschen. Alle Aufzeichnungen über die Kriegsaktivitäten des Dukes sind auf Anordnung der Regierung Ihrer Majestät für immer versiegelt. Trotzdem gibt es immer mehr Beweise, die Windsor mit den Nazis in Verbindung bringen. Es ist fast sicher, dass sich der Duke 1940 heimlich mit Heß in Lissabon getroffen hat, um eine Vereinbarung mit Hitler einzugehen, die ihn zurück auf den Thron bringen würde. Windsor war der Archetyp des privilegierten, russenfeindlichen, judenhassenden Briten mit einer Bewunderung für Hitler. Und ich bin mir sicher, dass Sie wissen, dass viele gut informierte Quellen glauben, dass der britische Geheimdienst letzten Monat Nummer Sieben in Spandau ermordet hat.«
»Ja. Aber ich habe da so meine Zweifel. Ich bin mir nicht sicher, ob die Briten in der heutigen Zeit für den Ruf der königlichen Familie töten würden. Er ist schon angeschlagen genug.«
»Wenn Windsor nur die Spitze des Eisbergs wäre«, überlegte Natterman, »könnten sie es durchaus gewesen sein. Viele Historiker glauben, dass Lord Halifax, der britische Außenminister während des Krieges, und möglicherweise bis zu 40 hochrangige Parlamentsmitglieder weiterhin versuchten, einen Deal mit Hitler auszuhandeln, lange nachdem Churchill erklärt hatte, niemals zu kapitulieren. Ich bezweifle, dass die angesehensten Familien Englands ihren Namen nach all den Jahren mit Adolf Hitler in Verbindung bringen wollen. Und kein Engländer, der bei klarem Verstand ist, würde wollen, dass Churchills Mythos von ›der besten Stunde‹ und die Kriegserklärung an Hitler beschmutzt werden. Denken Sie mal nach, Stern. Neville Chamberlain wird heute verachtet, dabei war er nur ein Beschwichtiger. Männer, die Hitler nach der Schlacht um England entgegenkommen wollten, wurden als Kollaborateure gebrandmarkt.« Natterman sah nachdenklich aus. »Es würde mich wundern, wenn einige dieser noblen englischen Stammbäume nicht auch ein paar Äste in Südafrika haben.«
»Äste«, murmelte Stern. »Ich bin an den Wurzeln interessiert, Professor. Und nicht die Wurzeln der Vergangenheit. Ich meine die Wurzeln der Konspiration in der Gegenwart. Das Hier und Jetzt. Dort liegt die Bedrohung für Israel.«
Nattermans Augenlider senkten sich zum Nachdenken. »Ich weiß nichts von einer Bedrohung Israels«, sagte er, »aber ich glaube, ich habe ein paar Informationen verdient, Stern.«
Der Israeli schüttelte langsam den Kopf. »Professor, was Sie mir bisher erzählt haben, ist in den Bibliotheken verfügbar. Ich will Ihre Analyse. Überraschen Sie mich mit den Früchten Ihrer jahrelangen Arbeit!«
Natterman sah zu Stern auf, seine Lippen waren blass vor Zorn. »Wenn Sie so viel wissen, warum führen wir dann dieses Gespräch?«
Als Stern nicht antwortete, sagte Natterman: »Also gut. Aber Sie sollten sich darauf einstellen, mir auch etwas entgegenzukommen.«
»Bittet, so wird euch gegeben, Professor.«
»Das ist aus dem Neuen Testament, Stern.«
»Was können Sie mir erzählen?«
Natterman wurde tatsächlich rot, als er seine nächsten Worte flüsterte. »Was ich Ihnen jetzt erzähle, Stern, habe ich mit … eher zweifelhaften Mitteln erfahren.«
Sterns Augen flackerten interessiert auf.
»Wie ich Ihnen schon sagte, arbeiten derzeit mehrere Historiker an dem Geheimnis von Heß. Zwei von ihnen sind an der Universität Oxford. Es ist Ihnen vielleicht nicht bewusst, Stern, aber Geschichte ist ein sehr umkämpftes Fach. Zumindest in den oberen Rängen. Und es zahlt sich aus, alles über Ihre Konkurrenz zu wissen.«
»Wollen Sie mir sagen, dass Sie Ihre eigenen Spione haben, Professor?«
Natterman wandte seine Augen ab. »Ich nenne sie lieber ›gute Freunde‹.«
Der Israeli gluckste. »Natürlich.«
»Einer dieser Freunde«, sagte Natterman, »hat es geschafft, einen genauen Blick auf die Heß-Forschung in Oxford zu werfen. Es scheint, als gäbe es einen sehr mysteriösen Mann, der im Fall Heß eine Rolle spielt. Ein bisher unbekannter Mann, der in der Nacht des 10. Mais 1941 etwas Schreckliches getan haben soll. In den Oxford-Papieren wird er als Helmut bezeichnet, aber …«
»Helmut?« Stern setzte sich auf. »Noch ein Deutscher auf englischem Boden in dieser Nacht?«
Natterman lächelte verschmitzt. »Der Oxford-Entwurf deutet darauf hin. Ich glaube jedoch, dass ›Helmut‹ nur ein Codename ist – ein Mittel, mit dem die Oxford-Historiker die wahre Identität dieser Person verschleiern wollen. Bei meinen Nachforschungen habe ich nie eine Person namens Helmut gefunden, die in irgendeiner Weise mit dem Fall Heß in Verbindung steht.«
»Sie wollen mir doch nicht sagen, dass Sie denken, dass ›Helmut‹ ein Deckname für den echten Heß ist?«
Natterman lächelte triumphierend. »In den Oxforder Papieren wird ›Helmut‹ ein besonders hervorstechendes Merkmal zugeschrieben, Stern. Ich denke, das wird Sie interessieren.«
»Was ist es?«
»Er hatte nur ein Auge.«
Stern schaute überrascht und dann nachdenklich. »Das könnte mit unserem Tattoo zusammenhängen«, gab er zu. »Aber ich denke nicht, dass Sie sich so darüber freuen sollten, denn Rudolf Heß hatte zwei sehr gute Augen.«
Natterman hob einen langen Zeigefinger. »Am 10. Mai war das tatsächlich der Fall. Aber wenn Heß diese Nacht überlebt hat – und ich glaube, das hat er –, blieb ihm noch reichlich Zeit, ein Auge zu verlieren. Er könnte es sogar noch in der Nacht seiner Flucht verloren haben!«
»Mit Ihrer Fantasie sollten Sie fürs Kino schreiben, Professor. Wissen Sie, wie viele Männer im Zweiten Weltkrieg ihre Augen verloren haben? Haben Sie vor, ganz Afrika nach einem einäugigen Mann zu durchsuchen, in der Hoffnung, dass er Sie zu ihrem Fantasie-Nazi führt?«
»Wir werden sehen, wie viel davon Fantasie ist«, murmelte Natterman.
»Warum kann es in jener Nacht im Mai keinen einzigen Deutschen namens Helmut in England gegeben haben?«, fragte Stern.
»Das wäre möglich gewesen«, gab Natterman zu. »Aber es gab keinen. Also – habe ich nun Ihre Hälfte der Geschichte verdient?«
»Ja, Professor, ich glaube, das haben Sie. Ich habe aber noch eine Frage. Waren die Sowjets in den Fall Heß verwickelt, soweit Sie das wissen?«
»Die Sowjets?« Natterman hielt inne. »In Heß’ ursprünglicher Mission? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken.«
»Bitte tun Sie das. Und denken Sie bitte an unsere Abmachung, wenn wir auf dem Boden sind. Keine Märchen über Rudolf Heß in Gegenwart anderer. So ein Gerede kann manche Juden sehr wütend machen.«
Natterman nickte feierlich.
»Meine Damen und Herren«, ertönte es aus den Lautsprechern. »Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Wir haben die Freigabe für den Anflug auf den Ben-Gurion-Flughafen erhalten.«
Ein kollektiver Seufzer der Erleichterung ging durch das Flugzeug. Stern gluckste und berührte Nattermans Ärmel. »Ich fürchte, mein Beitrag zu diesem Epos wird auf die zweite Etappe unserer Reise warten müssen.«
Natterman studierte das gebräunte, kantige Gesicht des Israelis. »Sie sagten, Informationen seien der erste Grund, warum Sie mich mitgenommen haben, Stern. Was war der zweite?«
Stern wandte den Blick vom Professor ab. Als er zurückblickte, waren seine Augen dunkel und hart. »Phoenix hat Ihre Enkelin entführt, Professor. Sie sind ihr engster Blutsverwandter. Das macht Sie zu meinem direkten Draht zu Phoenix. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich glaube, Sie könnten meine beste Waffe gegen sie sein.«
Natterman lehnte sich nachdenklich in seinem Sitz zurück, als der Pilot die Maschine in einen sanften Anflug neigte und eine fehlerfreie Landung auf der Hauptlandebahn vollzog. Am Ende eines langen Ganges wartete eine Sicherheitsschleuse mit Metalldetektoren und Röntgengeräten auf die Passagiere, aber als Stern dem leitenden Sicherheitsbeamten seine Brieftasche zeigte, wurden er und Natterman durchgewunken.
»Das ist wohl ein Privileg, was nicht jedem in diesem Land zuteilwird«, sagte Natterman. »Stimmt’s, Stern? Womit genau haben Sie Ihren Lebensunterhalt verdient, bevor Sie in Rente gegangen sind?«
Stern antwortete nicht. Seine Augen suchten die Halle nach etwas oder jemandem ab, den er hier erwartet hatte.
»Sie haben für den Mossad gearbeitet«, vermutete Natterman. »Das ist es, nicht wahr?«
Stern beobachtete weiter die Menge. »Ich weiß viel mehr als der Mossad, Professor. Da können Sie sich sicher sein.«
»Ja, aber ich wette, es ist etwas Ähnliches. Etwas ziemlich Unappetitliches.«
»Gadi!«, rief Stern.
Plötzlich bewegte sich der Israeli mit großer Geschwindigkeit durch die Halle, nicht rennend, sondern mit langen Schritten, die die Entfernung mühelos zu überbrücken schienen. Natterman versuchte, Sterns Ziel ausfindig zu machen, konnte es aber nicht, bis er wieder aus der Menge auftauchte und einen Arm liebevoll um einen dunkelhäutigen jungen Mann von etwa fünfundzwanzig Jahren legte.
»Professor Natterman«, sagte Stern, »das ist Gadi Abrams, mein Großneffe.«
»Es ist mir ein Vergnügen, Herr Professor«, sagte der junge Mann freundlich und streckte eine sonnengebräunte Hand aus.
»Guten Abend«, sagte Natterman und wandte sich an Stern. »Ist das eines der ›Pakete‹, die wir abholen wollten?«
»Ja, Professor, eines von dreien.«
Zwei lächelnde junge Männer tauchten hinter Gadi Abrams auf. Sie streckten Natterman ihre Hände entgegen, nickten höflich und umarmten Stern, als hätten sie den älteren Mann seit vielen Monaten nicht mehr gesehen.
»Aaron«, sagte Stern, »Yosef, das ist Professor Natterman von der Freien Universität Berlin.«
Die jungen Männer nickten höflich, sagten aber nichts. Beide schienen ungefähr in Gadis Alter zu sein, wenn nicht sogar jünger, und beide trugen Reisetaschen aus Segeltuch. Stern ging die Halle hinunter in Richtung einer Reihe teurer Restaurants und unterhielt sich leise mit seinem Neffen, während er ging. Natterman versuchte, nahe genug an den beiden dranzubleiben, um ihr Gespräch zu belauschen. Aaron und Yosef folgten ihnen in einem diskreten Abstand. Stern bog schließlich in ein Restaurant im Stil eines französischen Cafés ein – das einzige, das um diese Uhrzeit geöffnet hatte. Er winkte einen glatzköpfigen Kellner weg, der mit einem Stapel Speisekarten auf sie zukam.
»Was ist mit dem Flug, Gadi?«, fragte er auf Hebräisch. »Wie lange haben wir, bis wir starten?«
»Du wirst es nicht glauben, Onkel, aber in neunzig Minuten geht ein Flug nach Johannesburg.«
»Siz Bashert«, hauchte Stern. »So soll es sein. Direktflug?«
»Ein Zwischenstopp, Athen.«
»Gut genug.«
»Du scheinst nicht überrascht zu sein, Onkel. So kurzfristig einen Flug nach Südafrika zu ergattern? Ich konnte es nicht glauben.«
»Das war kein Glück, Gadi. Ich habe einen alten Freund aus der Luftwaffe angerufen und um eine kreative Umplanung gebeten.«
»Du machst Witze. Das können die?«
»Ich war mir wirklich nicht sicher, ob es klappen würde. Mein Glaube an die Menschheit ist wieder hergestellt.«
Gadi lachte ansteckend. »Es ist schön, dich wiederzusehen, Onkel. Fliegst du immer noch Erste Klasse?«
Professor Natterman konnte sich nicht länger zurückhalten. Seiner Meinung nach hatte das Gespräch eine plötzliche Wendung Richtung Mond genommen. »Stern«, unterbrach er. »Würden Sie mir bitte sagen, warum wir hier in diesem gottverlassenen Flughafen sitzen, während meine Enkelin in Südafrika in Lebensgefahr schwebt?«
Stern wechselte zurück ins Deutsche. »Professor, Ihre Manieren lassen zu wünschen übrig. Aber ich weiß Ihre Beweggründe zu schätzen. In neunzig Minuten gehen wir an Bord eines El-Al-Fluges nach Johannesburg, von wo aus wir unsere Suche nach Ihrer Enkelin beginnen werden. Wir sind nur einen Tag hinter Hauer und Apfel und kennen die Zeit und den Ort ihres Treffens mit den Entführern. Das Burgers Park Hotel, morgen um acht Uhr abends, erinnern Sie sich? Und vergessen Sie auch das nicht: Für Sie mag es eine glückliche Fügung des Schicksals sein, dass sich unsere Interessen zufällig überschneiden. Für mich bleibt das abzuwarten.«
Die Worte des Israelis machten Natterman wütend, aber da er wusste, dass Stern ihn auch einfach am Flughafen zurücklassen könnte, beschloss er zu schweigen.
»Jetzt«, sagte Stern, »schlage ich vor, dass wir zusammen etwas essen. Ich erwarte, dass alle den Flug für ein wenig Schlaf nutzen. Wenn wir erst einmal in Südafrika gelandet sind, werden wir nicht mehr viel Zeit dafür haben.« Mit einem Augenzwinkern signalisierte er dem Kellner, dass sie bestellen wollten, und jeder nahm sich eine der abgenutzten Menükarten aus Papier.
»Kopf hoch, Professor«, sagte Stern. »Sie und Gadi haben sich sicher viel zu erzählen. Er hat erst letztes Jahr seinen Abschluss in Geschichte gemacht.«
»Wirklich?«, sagte Natterman. »Für mich sieht er eher wie ein Soldat als ein Gelehrter aus.«
Gadi versteifte sich.
»Sie haben ein gutes Auge, Professor«, sagte Stern und warf seinem Neffen einen beruhigenden Blick zu. »Sie könnten ein größerer Gewinn sein, als ich dachte.«
Vier Tische weiter saß eine teuer gekleidete Frau mit silberblau gefärbtem Haar. Sie sah dünn aus für ihr Alter, das zwischen sechzig und siebzig liegen könnte, und sie war offensichtlich keine Israelin. Auf ihrem Tisch lag eine Handtasche von Louis Vuitton. Daneben stand ein Glas mit Orangensaft. Als der Kellner die Frau fragte, ob sie etwas zu essen bestellen wolle, lehnte sie höflich ab. Ihre Stimme war leise, aber der Kellner empfand sie als sehr angenehm. Im Stimmgewirr des Nahen Ostens hörte sich ihr klarer britischer Akzent besonders schön an. Als die Frau lächelte, nahm der Kellner an, es wäre für ihn bestimmt – doch er irrte sich. Es war für Jonas Stern.
Swallow hatte ihr Ziel anvisiert.
2:25 Uhr
Jan Smuts Airport, Johannesburg
Das Taxi war ein kleiner, klappriger Ford. Er hob sich deutlich von der kurzen Reihe der Rover und Mazdas ab, die größtenteils neu waren und denselben beiden Taxiunternehmen gehörten. Hauer zog das Taxi dem Shuttlebus vor, weil er schnell und ungestört sein wollte. Die 64 Kilometer lange Taxifahrt nach Pretoria würde unverschämt teuer sein, aber Geld war die geringste ihrer Sorgen. Er wählte den alten Ford, weil er einen Fahrer mit Charakter wollte – jemanden mit Geschäftssinn.
»Engländer?«, fragte der Fahrer mit einem starken indischen Akzent.
»Schweizer«, antwortete Hauer.
Der Fahrer wechselte in ein ungewöhnliches, aber fließendes Deutsch. Seltsamerweise hinderten die teutonischen Konsonanten den jungen Mann nicht daran, im Singsang seines Heimatlandes zu sprechen. »Und wo wollen Sie hin?«, trällerte er.
»Sie sprechen Deutsch?«, sagte Hauer erstaunt.
»Sehr gerne sogar, ja. Das hat mir ein Cousin mütterlicherseits beigebracht. Sein Vater war der Laufjunge des deutschen Botschafters in Neu-Delhi. Er kannte die Sprache gut und ich lernte sie ganz leicht, als sie zurück nach Kalkutta zogen. Ich lerne alle Sprachen leicht. Eine wunderbare Hilfe in meinem bescheidenen Beruf …«
Hannes ließ sich auf den Rücksitz des Fords sinken und lauschte dem Vortrag des Inders. Nach dem stundenlangen Flug genoss er die Stabilität des Autos.
»Hören Sie zu«, sagte Hauer und unterbrach den Redefluss des Inders, »wir müssen nach Pretoria. Mein Sohn und ich sind Börsenmakler. Wir sind nach Südafrika gekommen, um ein paar Geschäfte zu machen, aber auch, um ein bisschen Spaß zu haben, verstehen Sie?«
»Aber sicher, mein Herr«, sagte der Fahrer und witterte die Chance auf ein großzügiges Trinkgeld.
»Deshalb möchten wir, dass Sie uns in ein etwas billigeres Etablissement bringen, als Sie vielleicht erwarten – eine Absteige, könnte man sagen.«
»Ich verstehe sehr gut, mein Herr«, versicherte ihm der Fahrer und prüfte Hauer im Rückspiegel.
»Dann fahren Sie«, sagte Hauer. »Und behalten Sie die Augen auf der Straße.«
Der Ford sprang an und ordnete sich in den Strom der Taxis ein, die wie eine Reihe von Ameisen den Flughafen verließen.
»Mein Name ist Salil«, rief der Inder. »Zu Ihren Diensten.«
Hauer sagte nichts.
»Mein Herr?« Salil versuchte es erneut.
»Was denn?«
»Ich glaube, ich verstehe Ihre Anforderungen sehr gut. Aber darf ich vorschlagen, dass für Gentlemen wie Sie eine Absteige – wie Sie es so treffend nennen – genau der Ort ist, an dem Sie am schnellsten bemerkt werden? Warum nicht in einem der teureren Hotels? Wenn Sie das Geld haben, natürlich. Sie würden sofort ins Bild passen und niemand würde auf die Idee kommen, Fragen zu stellen. Die Privatsphäre ist an solchen Orten sehr wichtig.«
Hauer dachte darüber nach. »Irgendwelche Vorschläge?«, fragte er, und je mehr er darüber nachdachte, desto besser gefiel ihm die Idee.
»Das Burgers Park ist ein ausgezeichnetes Hotel.«
Hannes zuckte zusammen, als ob er einen Schlag bekommen hätte.
»Wo sonst noch?«, fragte Hauer schnell.
»Auch das Protea Hof wäre eine exzellente Wahl.« Salil warf einen verstohlenen Blick in den Rückspiegel.
»Zum Protea Hof.«
Während das Taxi in Richtung Norden fuhr, blickte Hauer auf die hochmoderne Skyline von Johannesburg, der Stadt des Goldes, hinaus. Dutzende von hell erleuchteten Wolkenkratzern ragten über ein dichtes Netz hochgelegener Autobahnen. Im Vergleich zu dieser futuristischen Metropole wirkte Westberlin verbraucht. Südafrika sah ganz anders aus, als Hauer es erwartet hatte. Er spürte bereits den Höhenunterschied und die riesige Weite um ihn herum.
»Mein Herr«, sagte Salil, als er Hauers Blick im Rückspiegel entdeckte.
»Ja?«
»Haben Sie bemerkt, dass uns jemand verfolgt?«
Hauer umklammerte Hannes’ Schulter, damit er sich nicht umdrehte. »Wissen Sie, wer das sein könnte?«, fragte er ruhig.
»Ja. Ich glaube, es sind britische Agenten. Sie sind seit dem Flughafen hinter uns.«
Hauer hörte ein scharfes Einatmen, als Hannes in seinem Sitz zurückrutschte. »Und woher wollen Sie das wissen?«, fragte er.
»Es gibt viele britische Agenten in Indien«, erklärte Salil. »Und ich habe dieses Auto schon häufig am Flughafen gesehen. Den jungen Mann, der es fährt, aber noch nie.«
Hauer rieb sich nachdenklich das stoppelige Kinn. Hannes wollte sich umdrehen, aber Hauer hielt ihn zurück. »Ich habe es mir anders überlegt, Fahrer«, sagte er. »Wir werden nun doch im Burgers Park einchecken.«
»Wie Sie wünschen.«
Hannes öffnete seinen Mund, um zu protestieren, aber Hauer flüsterte: »Dort gibt es bereits ein Zimmer auf deinen Namen. Wir können die Entführer genauso gut glauben lassen, dass du wirklich dort wohnst. Fahrer?«
»Ja?«
»Könnten Sie das Auto abschütteln, nachdem wir im Burgers Park eingecheckt haben? Es würde sich für Sie lohnen.«
»Jawohl!«, antwortete der Inder und ahnte, dass ein sehr gutes Trinkgeld auf ihn wartete. »Sie sind in den besten Händen!«
Das Taxi fuhr von der Flughafenstraße auf die nördliche Seite des Highway 21 – auf der linken Seite, wie Hauer feststellte, genau wie in England –, wo ein paar Lastwagen träge in Richtung Pretoria rumpelten. Hauer fragte sich, was er und Hannes in der Hauptstadt vorfinden würden. War Iris Apfel tatsächlich dorthin gebracht worden? Oder wartete sie immer noch irgendwo im verschneiten Berlin? War sie noch am Leben? Der Profi in Hauer bezweifelte es, aber ein tieferer Teil von ihm hegte noch Hoffnung. Um Hannes’ Willen, dachte er. Er drückte seine Handfläche gegen das Fenster des Taxis und spürte die Wärme. Seltsam, dieser plötzliche Wechsel der Jahreszeiten, dachte er. Aber er mochte ihn. Er fühlte sich gut und er wusste, dass er sich noch besser fühlen würde, wenn er dem Feind von Angesicht zu Angesicht begegnete.
»Dreißig Minuten bis Pretoria«, verkündete Salil.
»Keine Eile«, log Hauer und beobachtete Hannes genau. »Wir haben keine Eile.«
2. Kapitel
2:45 Uhr
Das nördliche Transvaal, Republik Südafrika
Iris wachte langsam auf, wie ein Taucher, der sich an die Oberfläche eines tiefen schwarzen Sees kämpft. Als sie endlich zu sich kam, fand sie sich in einem Bett unter Baumwollbettwäsche wieder. Sie war nackt. Die Rückstände des Klebebands, mit dem sie im Flugzeug gefesselt worden war, ließen die Laken an ihrer Haut kleben. Sie versuchte sich zu erinnern, wie sie ihre Kleidung verloren hatte, konnte es aber nicht. Ihre Augen huschten durch den Raum. Das Schlafzimmer war spärlich, aber teuer eingerichtet: eine antike Kommode, ein Stuhl, ein Beistelltisch und das Bett. Es gab keine Fenster, nur zwei Türen, von denen eine halb geöffnet war und zum Badezimmer führte, die andere war geschlossen. Kein Telefon. Nichts deutete darauf hin, wo sie sich befand oder was hinter den vier Wänden lag. Sie wickelte die Decke fest um sich, kletterte aus dem Bett und versuchte, die Tür zu öffnen. Sie war verschlossen. Einen Moment später fand sie den Zettel. Er lag auf der Teakholzkommode, beschwert von einem silbernen Handspiegel. Auf einer kleinen weißen Karte standen in deutscher Sprache die Worte:
Frau Apfel,
Willkommen im Horn House. Bitte machen Sie sich vorzeigbar. Beim Abendessen wird Ihnen alles erklärt.
Alfred Horn
Als Iris ihr Gesicht im Handspiegel sah, legte sie einen zitternden Finger an ihre Wange. Ihr feines blondes Haar hing in schütteren, schmutzigen Strähnen herunter und ihre sonst so strahlenden Augen sahen unter den geschwollenen Lidern grau und trüb aus. Der Schock, sich in einem solchen Zustand zu sehen, trieb sie in das angrenzende Badezimmer. Als sie vor einem langen Spiegel stand, ließ sie die Decke von ihren Schultern fallen und sah die Striemen, die das Klebeband hinterlassen hatte. Ihr Gesicht, ihr Hals, ihre Handgelenke und ihre Knöchel zeigten scharlachrote Flecken. Plötzliche Panik machte sich in ihrer Brust breit. Eine Gänsehaut stieg wie Stacheln auf ihren Armen und Oberschenkeln auf. Es gab noch andere Spuren: tiefblaue Flecken auf ihren Brüsten und Oberschenkeln. Sie erinnerten Iris an die Zeiten, in denen sie und Hannes etwas zu grob miteinander geschlafen hatten, aber … das hier war irgendwie anders. Sie sah aus, als hätte sie sich mit jemandem geprügelt. Hatte sie …? Oh Gott, dachte sie wild und erinnerte sich plötzlich. Der Polizeioberrat! Dieses arrogante Tier, das sich im Flugzeug vor ihr entblößt hatte! Er hatte sie betäubt! Iris erinnerte sich an die Nadel, die in ihren bewegungsunfähigen Arm gestochen wurde. Die Möglichkeit, dass sie vergewaltigt worden war, während sie bewusstlos war, traf sie wie eine heiße, ekelerregende Welle. Kaum in der Lage, ihr Gleichgewicht zu halten, stolperte sie in die Dusche und drehte das heiße Wasser auf, bis es sie fast verbrühte. Sie schrubbte sich die Haut ab, während die dampfende Gischt ihre Tränen verwischte. Was war das für ein Ort? Sie war lange Zeit in der Luft gewesen, das wusste sie. Ihr ganzer Körper schmerzte. Sie fühlte sich, als hätte sie mindestens dreißig Stunden geschlafen. Sie hatte noch vage Bilder davon im Kopf, wie das Flugzeug gelandet war – ein rüttelnder Aufprall, gefolgt von gemurmelten Stimmen, die sie nicht verstand –, aber die Maschine war erneut abgehoben und sie war wieder in eine schwarze Leere gerutscht.
Anstatt die Wassertemperatur Stück für Stück zu verändern, stellte Iris den Wasserhahn sofort auf die kälteste Stufe und ließ sich von der eiskalten Gischt in die Realität zurückholen. Sie schrie einmal, zweimal, aber sie ertrug den eisigen Strom, bis ihr Kopf vor Kälte pochte. Als sie das Wasser endlich abstellte, wickelte sie sich ein Handtuch um die Taille und trocknete sich mit dem anderen die Haare.
In der Schublade der Kommode fand sie etwas Lotion, die sie großzügig auf ihre geschwollenen Hand- und Fußgelenke auftrug. Die Luft im Schlafzimmer fühlte sich seltsam warm an. Sie ließ das Handtuch fallen und wollte nach ihren Kleidern greifen, bis ihr einfiel, dass sie keine hatte. Als sie sich bückte, um ihr Handtuch wieder aufzuheben, sah sie ihr Spiegelbild in einem Ankleidespiegel. Sie richtete sich auf und starrte auf ihren Bauch, der durch den Nahrungsmangel straff und flach geworden war. Mit ihrem Zeigefinger zog sie eine Linie von ihrem Schambein bis zu ihrem Bauchnabel. Wie lange?, fragte sie sich. Wie lange dauert es noch, bis du dich zeigst, Kleines? Eine seltsame Gelassenheit erwärmte langsam Iris’ Herz. Trotz der verzweifelten Lage spürte sie eine starke Überzeugung, dass sie jetzt nur eine einzige Verpflichtung hatte – zu überleben. Nicht für sich selbst, sondern für ihr Kind. Und mit dieser Erkenntnis kam ein Entschluss: Egal welche Schrecken oder Demütigungen ihr in den nächsten Stunden oder Tagen begegnen würden, sie würde nichts tun, was ihr Schaden zufügen könnte. Nicht einmal, wenn sie einfach nur noch sterben wollte. Jeder Schaden, den man ihr zufügte, würde man auch ihrem Baby zufügen, und das würde sie nicht zulassen. Ihr war immer noch übel, was sie wunderte, denn bisher hatte sie noch keine Morgenübelkeit verspürt. Dann erinnerte sie sich wieder an die Nadel im Flugzeug. Sie überkam ein Schauer. Oh nein, dachte sie schwindelig, ihr Mund war plötzlich trocken. Könnten die Drogen meinem Baby geschadet haben?
Ohne Vorwarnung knallte die Schlafzimmertür auf. Iris erstarrte vor Schreck. In der Tür stand eine schwarze Frau, mindestens 1,80 Meter groß. Sie hätte ebenso gut dreißig oder sechzig Jahre sein können. Ihre ebenholzfarbene Haut war glatt, aber ihre tiefen Augen leuchteten wie antike Onyxsteine.
»Madam wird sich anziehen«, sagte sie in gestelztem Deutsch. Sie trat vor und legte ein weiches Bündel auf den Rand des Bettes.
Iris erkannte ihre Kleidung. Sie war gewaschen und ordentlich gefaltet worden. »Wo bin ich?«, fragte sie. »Welcher Tag ist heute?«
»Madam wird sich bitte anziehen«, wiederholte die Frau mit einer tiefen, hallenden Stimme. Sie zeigte auf den kleinen Beistelltisch neben dem Bett. »Es ist fast drei Uhr. Ich komme in einer Viertelstunde. Dann gibt es Abendessen.«
Bevor Iris etwas sagen konnte, schlüpfte die riesige schwarze Frau wieder hinaus und schloss die Tür. Iris sprang nach vorne, aber der Türknauf ließ sich nicht drehen. Wieder allein, kämpfte sie gegen eine weitere Welle von Tränen an und griff nach ihren Kleidern.
Alfred Horn saß in seinem Rollstuhl im Arbeitszimmer, den Rücken zu einem kleinen Feuer gekehrt. Er beobachtete, wie sein afrikanischer Sicherheitschef ein rotes Telefon auflegte. »Nun, Pieter?«
»Linah sagt, Frau Apfel ist jetzt wach.«
»Sie hat so lange geschlafen«, sagte Horn besorgt. »Es macht mir natürlich nichts aus, mit dem Abendessen zu warten, sogar bis drei Uhr morgens. Aber es kommt mir sehr merkwürdig vor.«
Pieter Smuts seufzte müde. »Entschuldigen Sie, aber glauben Sie wirklich, dass Sie die Zeit haben, auf dieses junge Mädchen zu warten?«
»Pieter, Pieter«, mahnte Horn. »Es geht um viel mehr als das. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen, aber es ist schon so lange her, dass ich mit einem deutschen Gast gegessen habe. Und dann auch noch mit einer Frau. Sehen Sie mir diese kleine Sentimentalität nach.«
Smuts sah nicht überzeugt aus.
»Was ist Ihr Eindruck, Pieter? Sagen Sie es mir.«
»Sie ist ziemlich jung. Anfang zwanzig, würde ich schätzen. Und schön, muss ich zugeben. Groß und schlank mit heller Haut.«
»Ihr Haar?«
»Blond.«
»Augen?«
Smuts zögerte einen Moment lang. »Ich habe ihre Augen nicht gesehen. Sie war bewusstlos, als sie ankam.«
»Bewusstlos?«, fragte Horn scharf.
»Ich fürchte, ja.«
»Aber ich habe angeordnet, dass keinerlei Drogen verwendet werden dürfen.«
»Jawohl. Ich fürchte jedoch, Frau Apfel kam in einem ziemlich schlechten Zustand an. Sie hatte blaue Flecken an den Beinen und am Oberkörper. Ich habe den Arzt angewiesen, sie zu untersuchen. Sie wurde nicht vergewaltigt, aber er glaubt, dass der Polizist, der sie aus Berlin begleitet hat, wahrscheinlich ein intravenöses Schlafmittel benutzt hat, um sie ruhigzustellen.«
Vor Wut bebend, drehte sich Horn zum Feuer um. »Kann denn niemand Befehle befolgen!«, brüllte er. »Wo ist das Schwein?«
Smuts hörte den alten Mann keuchen, als ob ihm plötzlich der Sauerstoff ausgegangen wäre. »Er ist in einer der Kellerzellen. Haben Sie eine bestimmte Strafe im Sinn?«
Horn antwortete nicht, aber als er sich wieder umdrehte, hatte sein verzerrtes Gesicht seine Fassung wiedergewonnen. »Alles zu seiner Zeit«, murmelte er. »Helfen Sie mir, Pieter. «
Smuts bewegte sich hinter den Rollstuhl, aber der alte Mann schüttelte ungeduldig den Kopf. »Nein, kommen Sie vorne rum.«
»Wie bitte?«
»Helfen Sie mir auf«, forderte Horn.
»Auf?«
»Tun Sie es!«
Smuts beugte sich leicht vor und zog den alten Mann mit schlanken, aber kräftigen Armen aus dem Stuhl. »Sind Sie sicher?«, fragte er.
»Auf jeden Fall«, krächzte Horn und versuchte, den Schmerz in seinen zerstörten Beingelenken zu unterdrücken. »Die junge Frau soll einen normalen Menschen sehen, keinen Invaliden. Selbst nach den letzten zwei Jahren, Pieter, kann ich es immer noch nicht akzeptieren, dass ich, einst ein hervorragender Sportler, auf das hier reduziert werde. Das ist obszön.«
»Das geht uns allen so«, sagte Smuts mitfühlend.
»Das ist kein Trost. Ganz und gar nicht. Ist das Essen fertig?«
»Sobald Sie es sind!«
Horns dünne Beine zitterten. »Dann lassen Sie uns gehen.«
»Nehmen Sie meinen Arm.«
»Nur bis zum Flur, Pieter. Dann bin ich auf mich allein gestellt.«
Smuts nickte. Er wusste, dass der alte Mann große Schmerzen hatte, aber er wusste auch, dass, wenn Alfred Horn aus eigener Kraft zum Speisesaal gehen wollte, ihn niemand aufhalten könnte.
Iris saß bereits in dem riesigen Speisesaal und versuchte verzweifelt, die Panik zu verbergen, die ihren Magen verknotete. Sie spürte die Anwesenheit der hochgewachsenen schwarzen Frau hinter sich und ihren aufmerksamen Blick. Sie kämpfte gegen den Drang an, sich umzudrehen, und konzentrierte sich auf den gewaltigen Tisch. Noch nie zuvor hatte sie eine solche Pracht an einem Ort gesehen: Hutschenreuther Porzellan mit achtzehnkarätigem Goldrand, feines Bleikristall aus Dresden und antikes Silber aus Augsburg. Die Tatsache, dass jedes Stück aus deutscher Produktion stammte, beruhigte sie. Im Flugzeug hatte sie sich Sorgen gemacht, dass ihre Entführer sie aus dem Land bringen könnten. Jetzt hatte sie das Gefühl, dass Hannes nicht allzu weit weg sein konnte. Als sie zu dem funkelnden Kronleuchter hinaufstarrte, erschien Alfred Horn in der Tür und schritt mit langsamer Erhabenheit zum Kopf des Tisches.
»Guten Abend, Frau Apfel«, sagte er und neigte sein weißhaariges Haupt mit höflicher Anmut.
Iris’ Herz machte einen Sprung. In dem Moment, in dem sie den gebrechlichen alten Mann sah, wusste sie, dass er die Macht hatte, sie zu befreien. Trotz Horns fortgeschrittenem Alter brannte sein Blick mit einer Intensität, die Iris in ihrem Leben nur bei wenigen Männern gesehen hatte. Sie wollte aufstehen, aber die starken Hände der Bantu-Frau drückten sie fest auf ihren Platz zurück.
Mit großer Mühe, die Schmerzen seiner arthritischen Knie zu unterdrücken, setzte sich Alfred Horn. »Bitte«, sagte er, »erweisen Sie mir die Ehre, an meinem Tisch Platz zu nehmen, bevor wir die Einzelheiten dieser peinlichen Situation besprechen. Hier wird es keine Ketten oder Gummischläuche geben. Wenn Sie sich darauf einlassen, werden Sie vielleicht sogar einen angenehmen Abend erleben. Setzen Sie sich, Pieter.«
Smuts nahm den nächstgelegenen Stuhl zu Horns Linken.
»Erlauben Sie mir, mich vorzustellen«, sagte der alte Mann. »Ich bin Alfred Horn, der Herr dieses Hauses. Der Mann, der Ihnen gegenübersitzt, ist mein Sicherheitschef Pieter Smuts.« Horn blickte stirnrunzelnd auf eine große Holzuhr, die über dem Buffet zu seiner Rechten hing. »Und jeden Moment«, fügte er hinzu, »sollte ein junger Mann zu uns stoßen, der …«
Plötzlich ertönten Schritte in der Halle, die die Ankunft des verspäteten Gastes ankündigten. Ein junger Mann eilte herein und nahm ohne ein Wort den Platz neben Iris ein. Er sah ungefähr so alt aus wie Hannes, vielleicht ein paar Jahre älter. Sein Hals war kurz und dick, sein Kopf eine Nummer zu groß – überhaupt wirkten alle seine Gesichtszüge ein wenig überdimensioniert – und sein sandfarbenes Haar war zwar frisch gekämmt, aber nass. Unter seiner sonnenverbrannten Nase bemerkte Iris etwas, das sie nur allzu gut von den Partys in Berlin kannte: ein schleimiger, feuchter Schimmer, häufig ein Hinweis auf kürzlichen Kokainkonsum.
»Sie sind zu spät«, beschwerte sich Horn.
»Tut mir leid«, sagte der junge Mann ohne eine Spur von Schuldbewusstsein. »Im Fernsehen läuft gerade eine Wiederholung der Open Championship.« Er begutachtete Iris mit unverhohlenem Vergnügen. »Wer ist diese kleine Schnecke, Alfred?«
»Frau Apfel«, sagte Horn verärgert, »darf ich Ihnen Lord Grenville vorstellen? Er ist Engländer, falls Sie das noch nicht vermutet haben.«
»Wie geht es Ihnen, Mylady?«, fragte der junge Mann allzu höflich und bot seine Hand an.
Iris ignorierte es und richtete ihren Blick auf den weißhaarigen Mann am Kopfende des Tisches.
Horns Augen funkelten. »Frau Apfel ist nicht gerade positiv beeindruckt«, bemerkte er. Als er Iris’ unruhigen Blick bemerkte, milderte er seinen Tonfall. »Linah – die Bantu-Frau hinter Ihnen – bleibt nur, um uns alles aus der Küche zu bringen, was wir brauchen. Fragen Sie mich, was immer Sie wollen.«
Iris schluckte. »Heißt das, ich kann gehen, wenn ich will?«
Horn sah unbehaglich aus. »Nicht ganz, nein. Aber Sie können sich frei im Haus und auf dem Grundstück bewegen – mit gewissen Einschränkungen. Ich denke, Sie werden feststellen, dass es hier draußen in der Steppe nicht viel gibt, wohin man gehen kann. Jedenfalls nicht ohne ein Flugzeug.«
Während Iris über das Wort Steppe nachdachte, begann Horn seinen Salat zu essen. Linah brachte die großen Teller mit Erbsensuppe, Rotkohl und dunklem Pumpernickelbrot an den Tisch – alles klassische deutsche Gerichte. In der Mitte des Tisches befand sich ein riesiger Schinkenbraten, aber Horn ignorierte ihn. Er unterhielt sich zwischen zwei Bissen Kohl und wirkte dabei eher wie ein Patriarch in einer Versammlung von entfernten Verwandten als ein Entführer, der mit seiner Geisel spielte.
»Wissen Sie«, sagte er mit vollem Mund, »ich habe versucht, mich an die südafrikanische Küche zu gewöhnen – wenn man sie überhaupt so nennen kann –, aber sie ist einfach nicht mit dem deutschen Essen zu vergleichen. Natürlich ist sie herzhaft genug, aber furchtbar fade. Pieter liebt das Zeug. Aber er ist ja auch damit aufgewachsen.«
Südafrika …? Iris kämpfte gegen den Drang an, vom Tisch zu flüchten, und erinnerte sich an ihr Gelübde, sich so fügsam wie möglich zu verhalten. »Sie kommen also ursprünglich aus Deutschland?«, stammelte sie.
»Ja«, antwortete Horn. »Ich bin so etwas wie ein Expatriate.«
»Sind sie oft in der alten Heimat?«
Horn versteifte sich für einen Moment, dann nahm er das Essen wieder auf. »Nein«, sagte er schließlich. »Niemals.«
Mein Gott, dachte sie und ihr Gesicht wurde heiß. Afrika! Kein Wunder, dass es hier so warm ist. Als Horn sich am Tisch umschaute, bemerkte Iris, dass sich nur eines der Augen des alten Mannes bewegte. Das andere blickte steif in die Richtung, in die Horns Kopf zeigte. Als sie ihn anstarrte, erkannte sie eine schwache Narbe um das Auge herum, die wie ein grober fünfzackiger Stern geformt war. Mit einem Frösteln zwang sie sich, den Blick abzuwenden, aber nicht bevor Horn es bemerkte. Er lächelte verständnisvoll.
»Eine alte Kampfwunde«, erklärte er.
Lord Grenville gabelte sich eine große Scheibe Braten auf seinen Teller. »Und was hat eine schöne Frau wie Sie in einer schandbefleckten Stadt wie Berlin verloren?«, fragte er grinsend.
»Ich glaube, die junge Dame arbeitet für eine Vermögensberatung«, warf Horn ein.
Plötzlich wurden die Doppeltüren hinter Horn aufgestoßen. Ein junger schwarzer Mann kam mit einem Rollwagen herein und sammelte das benutzte Geschirr ein, um es dann wegzubringen. Ein Dienstmädchen folgte mit einem anderen Wagen, auf dem ein antiker russischer Samowar mit dampfendem Tee stand. Sie schenkte Horn eine volle Tasse ein. Smuts, Grenville und Iris lehnten ab.
»Ich nehme an, Sie fragen sich, wo genau Sie sind«, sagte Horn. »Sie sind jetzt in der Republik Südafrika, und wenn Sie fernsehen und Zeitung lesen, wissen Sie sicher, wo das ist.«
Iris umklammerte das Tischtuch, während sich ihr Magen drehte. »Tatsächlich«, sagte sie heiser, »unterhielt meine Firma enge Beziehungen zu einer südafrikanischen Firma, bevor wir die Spekulationen mit dem Krügerrand einstellten.«
»Sie wissen also etwas über unser Land?«, fragte Smuts.
»Ein wenig. Was man in den Nachrichten sieht, zeichnet ein ziemlich düsteres Bild.«
»Für manche«, sagte Smuts. »Aber nicht halb so schlimm, wie sie es darstellen.«
»Ich glaube, was Pieter meint«, sagte Horn sanft, »ist, dass … Rassenprobleme in einer Gesellschaft immer komplexer sind, als sie für einen Außenstehenden erscheinen. Sehen Sie sich die asiatische Frage an, der sich die Weißrussen bald stellen müssen. In zwanzig Jahren wird die Sowjetunion zu über 40 Prozent islamisch sein. Stellen Sie sich das vor! Schauen Sie sich Amerika an. Trotz all ihres Geredes über Gleichberechtigung haben die Amerikaner Missstände erlebt, die genauso schlimm sind wie überall. In Südafrika, Frau Apfel, tragen die Vorurteile keine Maske. Und das wird uns niemand verzeihen. Weil Südafrika etwas zugibt, was der Rest der Welt lieber verschweigen würde, hasst uns die Welt.«
»Ist das Ihre Ausrede?«
»Wir suchen nicht nach Ausreden«, murmelte Smuts.
»Nur eine Beobachtung«, sagte Horn und blickte Smuts an.
»Ist das nicht wunderbar?«, rief Lord Grenville. »Zwei Deutsche und ein verdammter Südafrikaner debattieren über die Feinheiten ethnischer Volksbeziehungen! Das ist mal was anderes.« Er schenkte sich einen zweiten Brandy aus einer Flasche ein, die er für sich beansprucht hatte.
»Glauben Sie, England ist besser?«, schnauzte Smuts. »Alles, was Sie je gesehen haben, sind öffentliche Schulen und Polofelder, Sie …«
»Pieter«, mischte sich Horn ein. Er wandte sich an Iris. »Herr Smuts ist das, was die Amerikaner einen Selfmademan nennen, meine Liebe. Er hält den Adel für eine überholte Klasse.«
»Das ist eine Ansicht, mit der ich sympathisiere.«
Der Afrikaner neigte respektvoll den Kopf, seinen wütenden Blick immer noch auf den Engländer gerichtet.
»Eigentlich«, sagte Horn, »schrecken sogar die Südafrikaner vor wirklich effektiven Maßnahmen in der Rassenfrage zurück.«
»Effektive Maßnahmen?«
»Staatlich geförderte Sterilisation, meine Liebe. Das ist die einzige Lösung. Wir können nicht erwarten, dass Kaffern oder mohammedanische Wilde ihre Fortpflanzungsgewohnheiten selbst regeln. Sonst könnte man das gleiche auch von Rindern erwarten. Nein, die staatlichen Gesundheitsdienste sollten einfach jede schwarze Frau nach der Geburt ihres ersten Kindes sterilisieren. Ein ganzes Spektrum von Problemen würde innerhalb einer einzigen Generation verschwinden.«
Während Iris verblüfft starrte, gab Horn der steinernen Linah ein Zeichen, ihm eine dicke Upmann-Zigarre zu bringen, die er ansteckte und anzündete. Er zündete sie an, ohne zu fragen, ob es jemanden störte, nahm ein paar Züge und stieß dann den Rauch in tiefblauen Wolken aus, die sanft über den Tisch waberten.
»Nun«, sagte er schließlich, »ich bin sicher, Sie haben viele Fragen. Ich werde versuchen zu beantworten, was ich kann.«
Iris hatte ihren Salat nicht einmal angerührt. Jetzt legte sie ihre zitternden Hände flach auf den Tisch und holte tief Luft. »Warum bin ich hier?«, fragte sie leise.
»Ganz einfach«, antwortete Horn, »wegen Ihres Mannes. Ich fürchte, Ihr Hannes ist über ein Dokument gestolpert, das einem Mann gehörte, den ich gut kannte – ein Dokument, das er den zuständigen Behörden hätte aushändigen sollen, es aber nicht tat. Pieter entschied, dass die schnellste Methode, das Eigentum wiederzuerlangen, über Sie laufen würde. Deshalb sind Sie hier. Sobald Ihr Mann eintrifft, wird die Angelegenheit geklärt sein.«
Iris spürte ein Aufflackern der Hoffnung. »Hannes kommt hierher?«
Horn schaute auf seine Uhr. »Er sollte jetzt auf dem Weg sein.«
»Weiß er, dass ich in Sicherheit bin?«
Smuts antwortete. »Er hat das Band gehört, das Sie aufgenommen haben.«
Iris zitterte, als sie sich an die Pistole erinnerte, die ihr der wildgewordene Leutnant Luhr an den Kopf gehalten hatte.
Horn blies einen Rauchring. »Ich versichere Ihnen, dass sich solche Unannehmlichkeiten nicht wiederholen werden. Der Mann, der Sie im Flugzeug unter Drogen gesetzt hat, sitzt jetzt in einer Zelle, 100 Meter unter Ihren Füßen.« Horn lächelte. »Wenn Sie erlauben, würde ich Sie jetzt gerne nach Ihrer Meinung zu dem Dokument fragen, das Ihr Mann im Spandauer Gefängnis entdeckt hat.«
Iris studierte ihre Hände. »Was ist damit? Für mich sah es wie ein Schwindel aus. Solche Dinge sind seit dem Krieg schon ein Dutzend Mal vorgekommen …«
»Bitte«, unterbrach Horn, sein Ton wurde härter, »strapazieren Sie nicht meine Geduld. Ihr Gespräch mit Polizeidirektor Funk hat gezeigt, dass Ihnen die Bedeutung der Papiere sehr wohl bewusst ist.«
»Nur, dass sie gefährlich sein könnten! Mir war klar, dass die Papiere von einem Kriegsverbrecher stammen mussten, immerhin hat Hannes sie in Spandau gefunden. Deshalb …«
»Entschuldigen Sie, Frau Apfel.« Horns einziges Auge richtete sich auf Iris’ Gesicht. »Wie würden Sie den Begriff ›Kriegsverbrecher‹ definieren? Ich bin neugierig.«
Iris schluckte. »Nun … ich nehme an, es bedeutet, dass jemand von den Gesetzen der Moral so radikal abgewichen ist, dass er die zivilisierte Welt schockiert, selbst in Kriegszeiten.«
Horn lächelte traurig. »Sehr wortgewandt, meine Liebe, aber völlig falsch. Ein Kriegsverbrecher ist lediglich ein mächtiger Mann auf der Seite, die zufällig den Krieg verloren hat. Nicht mehr und nicht weniger. War Cäsar ein Kriegsverbrecher? Nach Ihrer Definition, ja. Nach meiner? Nein. War Alexander der Große oder Stalin einer? 1944 vergewaltigte, mordete und plünderte sich die Rote Armee von Marschall Schukow ihren Weg durch Deutschland. War Schukow ein Kriegsverbrecher? Nein. Aber Hitler? Ja, natürlich! Der Antichrist! Sehen Sie? Das Etikett bedeutet nichts in absoluter Hinsicht. Es ist einfach eine relative Beschreibung.«
»Das ist nicht wahr. Was die Nazis in den Konzentrationslagern gemacht haben …«
»Hat die deutsche Kriegswirtschaft aufrechterhalten und die Forschung auf dem Gebiet der Medizin für die ganze Welt weitergebracht!«, beendete Horn ihren Satz. »Natürlich gab es Exzesse – das ist die menschliche Natur. Aber hat jemals jemand die Fortschritte erwähnt, die erzielt wurden?«
»Das ist falsch. Nichts rechtfertigt solche Grausamkeiten.«
Horn schüttelte den Kopf. »Ich kann sehen, dass die Zionisten die Schulen unseres Landes seit dem Krieg fest im Griff haben. Entnazifizierung«, schnaubte er. »Mein Gott, Sie klingen wie ein israelisches Schulkind. Wie können Sie so blind sein? 1945 griffen die alliierten Luftstreitkräfte Dresden an – eine schutzlose Stadt – und töteten 135 000 deutsche Zivilisten, hauptsächlich Frauen und Kinder. Präsident Truman löschte zwei japanische Städte aus. Und das ist nicht kriminell?«
»Warum ist es Ihnen dann so wichtig, die Spandauer Papiere zu verstecken?«, forderte Iris heraus. »Warum geben Sie sie nicht bekannt und vertreten Ihre Ansichten öffentlich?«
Horn blickte auf den Tisch. »Weil manche Kapitel der Geschichte am besten geschlossen bleiben. Der Fall Rudolf Heß hat die Beziehungen zwischen England, Deutschland und der Sowjetunion nachhaltig beeinflusst. Es ist im besten Interesse aller Beteiligten, schlafende Hunde nicht zu wecken.«
»Aber das ist es, was ich nicht verstehe. Was spielt es für eine Rolle, was vor fünfzig Jahren passiert ist?«
»Nationen haben ein sehr gutes Gedächtnis«, sagte Horn.
»Was ist mit Rudolf Heß passiert?«, fragte Iris plötzlich. »Der echte Heß.«
»Er ist gestorben«, sagte Horn. »In Paraguay, im Jahr 1947. Ich kannte ihn gut, und er starb als verbitterter Mann, weniger als zwei Jahre nach seinem geliebten Führer.«
»Geliebt?«, echote Iris entsetzt. »Aber der Mann in Spandau – wer war er?«
»Niemand«, sagte Horn. »Niemand. Der arme Narr war Teil eines gescheiterten außenpolitischen Schachzugs, das ist alles. Aber das Ergebnis dieses Fehlschlags war, dass er – wie Heß – für den Rest seines Lebens im Gefängnis bleiben musste. Das liegt alles in der Vergangenheit. Leider hat Ihr Mann diesen Fall wieder aufgerollt, und jetzt muss er wieder geschlossen werden. Nur ein kleines Ärgernis für mich, aber diese Details darf man nicht ignorieren. ›Aus Mangel eines Nagels‹ …«
»›War das Königreich verloren‹«, ergänze Iris nachdenklich. »Was ist ›das Königreich‹ in diesem Fall?«
Horn lächelte. »Meine Firma, natürlich. Phoenix AG.«
Iris sah nachdenklich aus. »Ich kann mich nicht erinnern, dass dieser Name an irgendeiner Börse gelistet ist.«
»Ich bin sicher, dass er das nicht ist. Es ist eine private Holdinggesellschaft. Wenn ich Ihnen aber eine Liste meiner weltweiten Tochtergesellschaften vorlegen würde, würden Sie sicher einige davon erkennen.«
Smuts lächelte über Horns Aussage.
Iris war aufrichtig neugierig. »Sie sind also ein multinationales Unternehmen. Wie groß sind Sie? Zwei-, dreihundert Millionen an Umsatz?«
Der junge Engländer kicherte.
»Dreihundert Millionen an Vermögenswerten«, korrigierte Horn leise.
Iris starrte ihn ungläubig an. »Aber dann hätten Sie über eine Milliarde Umsatz.«
Es herrschte Schweigen, bis Horn das Gespräch elegant wieder aufnahm. »Ich sehe, Sie haben einen Sinn für das Finanzielle. Warum entschuldigen wir nicht Pieter und Lord Grenville? Dann können wir beide unser Gespräch fortsetzen, ohne sie zu langweilen. Meine Herren?«
»Aber ich finde diese Diskussion äußerst interessant«, protestierte der Engländer.
»Trotzdem«, sagte Horn eisig.
»Wie wär’s mit Billard, Smuts?«, fragte der Engländer spielerisch und versuchte, die Illusion eines freien Willens zu bewahren.
Horns Blick befahl dem zögernden Afrikaner, die Einladung anzunehmen.
»Ich vermute, es spricht nichts dagegen, Sie um ein paar Rand zu erleichtern«, sagte Smuts und kicherte. Er besaß das spröde Lachen eines Mannes, der seinen Humor nur auf Kosten anderer fand. Als sie hinausgingen, verbeugte er sich tief vor Horn.
»Dieser Mann scheint Ihnen sehr zugetan zu sein«, bemerkte Iris.
»Herr Smuts ist mein Sicherheitschef. Seine Loyalität ist absolut.«
»Sind Sie denn in Gefahr?«
Horn lächelte. »Ein Mann in meiner Position macht sich Feinde, Frau Apfel.«
Plötzlich glitzerten Iris’ Augen feucht. Das Flehen, das sie tief in ihr Herz gepresst hatte, bahnte sich endlich einen Weg durch ihre Kehle. »Herr Horn, bitte, sehen Sie denn gar keine Möglichkeit, meinem Mann zu vergeben? Er hatte keine bösen Absichten! Wenn Sie ihn nur kennen würden, würden Sie es verstehen …«
»Frau Apfel! Reißen Sie sich zusammen! Wir werden die Angelegenheit nicht weiter besprechen, bis Ihr Mann eintrifft. Dann werde ich entscheiden, was zu tun ist – keinen Moment vorher. Ist das klar?«
Iris wischte sich die Augen mit ihrer Leinenserviette ab. »Ja … ja, es tut mir leid.«
»Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Frauen sind ihren Gefühlen ausgeliefert, das ist ihr biologischer Fehler. Wäre nicht diese bedauerliche Tatsache, wer weiß, was sie im Laufe der Geschichte alles erreicht hätten.«
Iris blieb still. Sie sah keinen Nutzen darin, ihren Entführer weiter zu verärgern.
»Frau Apfel«, sagte Horn, »der Grund, warum ich die anderen entschuldigt habe, ist, dass ich Sie einladen wollte, morgen Abend an einem Geschäftstreffen mit mir teilzunehmen. Die Herren, mit denen ich mich treffe, haben leider eine eher mittelalterliche Einstellung ihrem Geschlecht gegenüber, also müssten Sie sich als meine Sekretärin ausgeben. Aber ich bin mir sicher, dass Sie die Verhandlungen äußerst interessant finden würden.« Horn hob sein Kinn. »Es wird das erste Treffen dieser Art in der Geschichte sein.«
»Das klingt bedrohlich«, sagte Iris und versuchte, ihre Fassung wiederzuerlangen.
»Lassen Sie uns stattdessen ›bedeutsam‹ sagen. Es ist schließlich nur ein Geschäft. Ich bin sicher, dass diese Erfahrung für eine junge Frau, die eine Karriere in der Finanzwelt plant, von unschätzbarem Wert sein wird.«
Trotz ihrer gefährlichen Situation – oder vielleicht gerade deswegen – nahm Iris die Einladung an.
»Linah?«, rief Horn.
Die große Frau erschien sofort.
»Begleite Frau Apfel in den Billardraum.«
Iris stand auf, um zu gehen.
»Und Frau Apfel«, sagte Horn, »würden Sie Pieter bitten, zu mir zu kommen, wenn er sein Spiel beendet hat?«
Iris nickte.
»Sie werden mich nicht vor morgen Nachmittag sehen, vielleicht sogar erst morgen Abend. Pieter wird Ihnen am Morgen das Anwesen zeigen. Einige Räume sind verschlossen, aber ansonsten können Sie sich im Haus und auf dem Gelände frei bewegen. Bitte benutzen Sie das Telefon nicht, bis die Sache mit den Papieren geklärt ist.«
Wie auf Knopfdruck drehte Horn seinen Stuhl um den Tisch. »Darf ich Ihre Hand sehen?«
Verblüfft streckte Iris langsam ihre Hand aus. Bevor sie wusste, was geschah, hatte der verhutzelte alte Mann seinen Kopf gebeugt und küsste sie leicht. Sie spürte ein plötzliches Frösteln, aber ob aus körperlicher Abscheu oder einer tieferen Angst, konnte sie nicht sagen.
»Ich entschuldige mich für die Unhöflichkeit des jungen Engländers«, sagte Horn. »Ich sollte das nicht tolerieren, aber sein Großvater und ich haben während des Krieges zusammengearbeitet.« Horn lächelte wehmütig. »Sein Großvater war ein ganz besonderer Mann, und ich fühle mich für sein Erbe verantwortlich. Gute Nacht, meine Liebe.«
Die hochgewachsene Bantu-Haushälterin nahm Iris’ Ellenbogen und führte sie in die Halle, wo sie ihr die Führung überließ. Währenddessen beschlich Iris das Gefühl, dass der Arm der Frau nur ein paar Zentimeter hinter ihrem eigenen lag, bereit, sie zu ergreifen, wenn es nötig war. Die lange Halle öffnete sich zu einer großen Galerie, die wiederum zu zwei weiteren Räumen führte, die jeweils durch einen großen Bogen miteinander verbunden waren. Iris schnappte nach Luft. Soweit sie sehen konnte, waren die Wände mit Gemälden bestückt. Sie wusste ein wenig über Kunst, aber um die Werke zu schätzen, die sie im ersten Raum sah, war kein Kennerauge nötig. Die Pinselstriche der großen Meister sprachen einen Teil der Psyche an, der tiefer lag als das bewusste Denken, und hier handelte es sich um keine Reproduktionen. Jede Leinwand glühte vor immanenter Leidenschaft. Iris Augen tanzten staunend von Bild zu Bild.
»Mein Gott«, murmelte sie. »Wo sind wir?«
Linah ergriff Iris’ Arm und zerrte sie mit sich wie ein Kind. Sogar die Marmorböden trugen ihren Teil zu diesem Schatz bei. Klassische Skulpturen, einige über drei Meter groß, erhoben sich wie Marmorgespenster von Sockeln in der Mitte jedes Raumes. Iris fiel auf, dass kein Werk in diesen Räumen nach moderner Kunst aussah. Nichts davon besaß die asymmetrischen Verzerrungen von Picasso, die geometrischen Rätsel von Mondrian oder die radikal banale Hässlichkeit der »Skulpturen«, die in den Berliner Büroparks so üblich sind. Alles war weich, romantisch, tiefgehend. Wäre sie nicht so verblüfft gewesen, hätte sie vielleicht bemerkt, dass alle Kunstgegenstände – ägyptische und griechische Skulpturen, Gemälde aus Holland, Belgien und Frankreich – aus Ländern stammten, die in den 30er und 40er Jahren von der Wehrmacht geplündert wurden. Aber sie bemerkte es nicht. Sie starrte einfach vor sich hin, bis die schillernde Ausstellung endete und sie sich in dem dunklen, holzgetäfelten Billardzimmer wiederfand, in dem Pieter Smuts und der junge Engländer gerade ihre zweite Partie beendet hatten.
»Nun, dann nehmen Sie Ihren verdammten Gewinn!«, schnauzte Lord Grenville.
»Von mir aus gerne«, erwiderte Smuts und grinste. Er steckte die Fünfzig-Pfund-Note ein, die ihm der Engländer so lässig wie einen zerknitterten Fünfer überreichte.
»Herr Smuts?«, sagte Iris. »Herr Horn möchte, dass Sie sich ihm anschließen.«
Das Lächeln des Südafrikaners verblasste, als er in den Flur eilte.
»Lust auf ein Spiel, Fräulein?«, fragte der Engländer und neigte seinen Queue in Richtung Iris.
»Für Sie Frau Apfel«, korrigierte Iris kalt. »Und ich würde es vorziehen, in mein Zimmer zurückzukehren.«
Als Linah sich umdrehte, um sie hinauszuführen, hatte Iris den Eindruck, dass die Bantu-Frau ihre Entscheidung zu gehen guthieß. Doch als sie der Haushälterin nach draußen folgte, spürte sie plötzlich eine leichte Berührung an ihrem Arm.
»Warum bleiben Sie nicht einen Moment?«, flüsterte der Engländer. »Es könnte Wunder für die Gesundheit Ihres Mannes bewirken.«
Iris erstarrte. Ohne nachzudenken, sagte sie Linah, dass sie es sich anders überlegt hatte. Sie würde noch ein Spiel spielen, bevor sie sich zur Ruhe setzte.