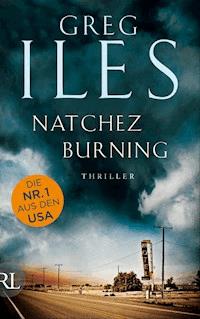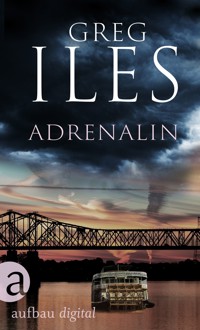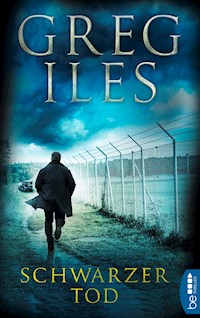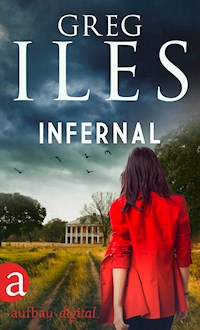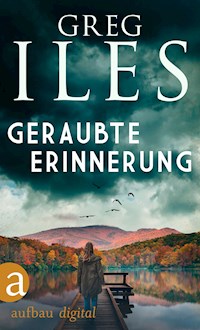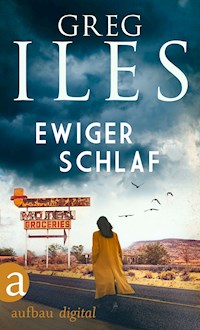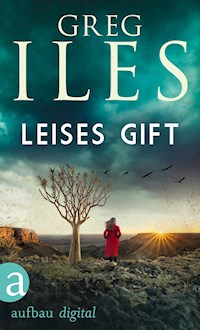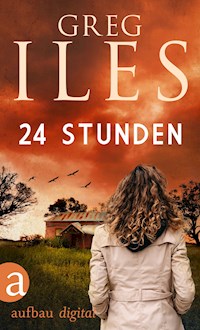
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Greg Iles Bestseller Thriller
- Sprache: Deutsch
24 Stunden - so lange dauern in der Regel die perfekt geplanten Entführungen eines eingespielten Profi-Kidnapper-Trios. Die schockierten Eltern zahlen das geforderte Lösegeld, und die geraubten Kinder gelangen wohlbehalten nach Hause. Doch im Fall der kleinen Abby Jennings verläuft nichts nach Plan: Denn das entführte Mädchen benötigt dringend ein lebensnotwendiges Medikament, und ihre Eltern gehören nicht zu der Sorte von Menschen, die sich einfach so widerstandslos geschlagen geben. Die Jagd nach den Kidnappern wird zu einem Kampf auf Leben und Tod ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Informationen zum Buch
24 Stunden - so lange dauern in der Regel die perfekt geplanten Entführungen eines eingespielten Profi-Kidnapper-Trios. Die schockierten Eltern zahlen das geforderte Lösegeld, und die geraubten Kinder gelangen wohlbehalten nach Hause. Doch im Fall der kleinen Abby Jennings verläuft nichts nach Plan: Denn das entführte Mädchen benötigt dringend ein lebensnotwendiges Medikament, und ihre Eltern gehören nicht zu der Sorte von Menschen, die sich einfach so widerstandslos geschlagen geben. Die Jagd nach den Kidnappern wird zu einem Kampf auf Leben und Tod ...
Über Greg Iles
Greg Iles wurde 1960 in Stuttgart geboren. Sein Vater leitete die medizinische Abteilung der US-Botschaft. Mit vier Jahren zog die Familie nach Natchez, Mississippi. Mit der »Frankly Scarlet Band«, bei der er Sänger und Gitarrist war, tourte er ein paar Jahre durch die USA. Mittlerweile erscheinen seine Bücher in 25 Ländern. Greg Iles lebt heute mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Natchez, Mississippi. Fünf Jahre hat er kein Buch herausgebracht, da er einen schweren Unfall hatte, nun liegen im Aufbau Taschenbuch seine Thriller „Natchez Burning“, „Die Toten von Natchez vor“ und "Die Sünden von Natchez" vor.
Mehr zum Autor unter www.gregiles.com
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Greg Iles
24 Stunden
Aus dem Amerikanischen vonKarin Meddekis
Dies ist ein Roman.
Namen, Personen, Schauplätze und Handlung
sind allein der Fantasie des Autors entsprungen.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder
verstorbenen Personen, Unternehmen,
Ereignissen oder Schauplätzen ist reiner Zufall.
Danksagungen
Aaron Priest, dem Menschen.
Phyllis Grann dafür, dass er den Weg geebnet hat.
David Highfill, der die Besessenheit des Schriftstellers ertragen hat.
Louise Burke, für ihre harte Arbeit und Unterstützung.
Für medizinische Ratschläge: Dr. Jerry Iles, Dr. William Daggett, Dr. Noah Archer, Dr. Michael Bourland.
Für Ratschläge aus der Luftfahrt: Mike Thompson, Justin Cardneaux, Stephen Guido.
Für andere Ratschläge: Lisa Erbach-Vance, Glen Ballard, Mimi Polk Gitlin, Jon Wood aus Hodder, Michael MacInnis, Rush und Leslie Mosby, Ken und Beth Perry, Susan Chambliss, Simmons Iles, Robert Royal, Brent Bourland, Caroline Trefler, Carrie, Madeline und Mark.
Für die Korrektur: Ed Stackler, Betty lies, Michael Henry, Courtney Aldridge.
Sollte ich jemanden nicht aufgeführt haben, bitte ich dieses Versehen zu entschuldigen. An allen Fehlern trage ich wie immer allein die Schuld.
Für
Geoff Iles,
der von Anfang an immer für mich da war (fast).
Derjenige, der Frau und Kinder hat,
ist eine Geisel des Glücks.
– FRANCIS BACON
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Danksagung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Impressum
1
Das Kind schaukelt die Sache. Das hab ich doch schon gesagt.«
Margaret McDill hatte diesen Mann gestern zum ersten Mal in ihrem Leben gesehen, und seitdem beherrschte er jede Sekunde ihrer Existenz. Er hatte zu ihr gesagt, sie könne ihn Joe nennen. Angeblich war das sein richtiger Name. Margaret nahm jedoch an, dass es ein Deckname war. Dieser dunkelhaarige, hellhäutige Mann um die 50 hatte tief liegende Augen und derbe Gesichtszüge, die mit Bartstoppeln übersät waren. Margaret schaffte es nicht, ihm in die Augen zu sehen. Es waren dunkle, wütende Tümpel, die das Leben aus ihr heraussaugten und ihr den Willen nahmen. Es war ihr unerträglich, was diese Augen mittlerweile alles über sie erfahren hatten.
»Ich glaube Ihnen nicht«, murmelte sie.
Tief in seinen dunklen Augen blitzte es gefährlich. »Hab ich dich bisher angelogen?«
»Nein. Aber ich … ich habe die ganze Nacht Ihr Gesicht gesehen. Sie werden mich nicht gehen lassen.«
»Ich hab doch gesagt, das Kind schaukelt die Sache. Kann nichts schief gehen.«
»Sie werden mich umbringen und meinen Sohn laufen lassen.«
»Denkst du etwa, ich knall dich am helllichten Tag vor diesem verdammten McDonald’s ab?«
»Sie haben ein Messer in der Tasche.«
Er warf ihr einen verächtlichen Blick zu. »Na und?«
Margaret schaute auf ihre Hände. Sie wollte Joe nicht ansehen, und sie hatte gleichzeitig Angst, ihr Gesicht zufällig in einem der Spiegel zu erblicken. Es war schlimm genug gewesen, was sie zu Hause im Spiegel gesehen hatte. Sie hatte ausgesehen wie eine frisch Operierte, die gerade aus der Narkose erwacht war. Über ihren Augen lag ein Schleier, und selbst eine dicke Schicht Make-up konnte den blauen Fleck auf ihrem Kinn nicht verdecken. Vier ihrer aufwändig gepflegten Fingernägel waren in der Nacht abgebrochen, und der Kampf gegen den Eindringling hatte einen langen Kratzer auf ihrem Unterarm hinterlassen. Margaret versuchte, sich zu erinnern, wann es passiert war, doch es gelang ihr nicht. Sie hatte kein Zeitgefühl mehr und konnte keinen klaren Gedanken fassen. Es war ihr schier unmöglich, auch nur einfachste Gedankengänge zu Ende zu denken.
Margaret konzentrierte sich auf ihre unmittelbare Umgebung, um nicht vollends die Nerven zu verlieren. Sie saßen in ihrem BMW auf einem Parkplatz an einer Einkaufsstraße, etwa 50 Meter von McDonald’s entfernt. Im Einkaufszentrum, bei Barnes & Nobel und auch in der Zoohandlung, in der sie sich oft seltene tropische Fische aussuchten, waren sie Kunden. Ihr Mann war Herzchirurg und hatte kürzlich für die Ärzteausbildung in seiner Klinik bei Circuit City einen Großbild-Fernseher gekauft. Jetzt kam es ihr so vor, als ob all das zum Leben einer anderen Person gehörte – so fern wie die helle Seite des Mondes für jemanden ist, der auf der dunklen Seite ausgesetzt worden war. Und ihr Sohn Peter … Nur Gott allein wusste, wo er war. Gott und der Mann neben ihr.
»Es ist mir egal, was Sie mit mir machen«, sagte sie mit fester Stimme. »Wenn Sie nur Peter leben lassen. Töten Sie mich, wenn Sie es tun müssen, aber lassen Sie meinen Sohn laufen. Er ist erst zehn Jahre alt.«
»Wenn du endlich den Mund halten würdest, könnte ich mir deinen Vorschlag überlegen«, entgegnete Joe gereizt.
Er schaltete die Zündung des BMWs und die Klimaanlage ein. Anschließend zündete er sich eine Camel an. Der kalte Luftstrom verteilte den Rauch im ganzen Wagen. Margarets Augen brannten vom stundenlangen Weinen. Sie drehte den Kopf zur Seite, um dem Rauch auszuweichen, doch es war unmöglich.
»Wo ist Peter?«, fragte sie so leise, dass es kaum zu verstehen war.
Joe zog an seiner Camel, ohne ihr eine Antwort zu geben.
»Ich möchte …«
»Hab ich nicht gesagt, du sollst den Mund halten?«
Margaret starrte auf die Pistole, die auf der Ablage zwischen den Sitzen lag. Sie gehörte ihrem Mann. Joe hatte ihr die Waffe gestern weggenommen; sie hatte die Erfahrung machen müssen, wie nutzlos eine Waffe für sie war. Zumindest solange sie Peter in ihrer Gewalt hatten. Am liebsten hätte sie nach ihr gegriffen, doch sie würde sie bestimmt nicht vor ihm zu fassen bekommen. Wahrscheinlich wartete er nur darauf. Joe war schlank, aber erstaunlich kräftig. Auch das hatte sie gestern Nacht erfahren. Und dieser Mann mit den harten Gesichtszügen kannte keine Gnade.
»Er ist tot, nicht wahr?«, hörte Margaret sich sagen. »Sie spielen nur ein Spiel mit mir. Er ist tot, und Sie werden mich auch töten …«
»Mein Gott!«, brummte Joe mit zusammengebissenen Zähnen. Er drehte seine Hand um und schaute auf seine Armbanduhr, die er auf der Innenseite des Handgelenks trug, sodass Margaret die Uhrzeit nicht erkennen konnte.
»Ich glaube, ich muss mich übergeben«, sagte sie.
»Schon wieder?« Er tippte eine Nummer in das Autotelefon des BMWs ein. Während er auf eine Antwort wartete, murmelte er: »Ich glaub, das waren die schlimmsten vierundzwanzig Stunden meines bisherigen Lebens. Und dazu gehört auch unsere kleine Party.«
Margaret zuckte zusammen.
»He«, sagte er ins Telefon. »Stehst du auf dem Parkplatz? … Okay. Warte noch eine Minute, und dann weißt du ja, was du zu tun hast.«
Margaret hob den Kopf, riss die Augen auf und starrte auf die Wagen, die in der Nähe standen. »O mein Gott! Peter! Peter!«
Joe nahm die Pistole in die Hand und drückte ihr den Lauf der Waffe in den Nacken. »Bis hierher hast du es geschafft, Maggie. Vermassle jetzt nicht alles. Erinnerst du dich an das, was wir besprochen haben?«
Sie schloss die Augen und nickte.
»Ich höre nichts.«
Über ihre Wangen rannen Tränen. »Ich erinnere mich.«
Etwa 100 Meter von Margaret McDills BMW entfernt saß Peter McDill mit fest geschlossenen Augen in einem alten grünen Pick-up. In dem Kleinlaster roch es seltsam. Gleichzeitig gut und schlecht. Eine Mischung aus frischem Gras, altem Motoröl und uraltem Fast Food.
»Du kannst die Augen jetzt aufmachen.«
Peter öffnete die Augen.
Sein Blick fiel sofort auf ein McDonald’s-Restaurant. Das beruhigte ihn nach dieser einsamen Nacht. Das Restaurant stand an einer Einkaufsstraße in einem Vorort mitten auf einem Parkplatz. Als Peters Blick über die Einkaufsstraße wanderte, erkannte er die Geschäfte wieder: Office Depot, Barnes & Noble, das Gateway 2000-Geschäft. In diesem Geschäft hatte er schon viele Stunden zugebracht. Es war nur wenige Meilen von seinem Zuhause entfernt. Er schaute auf seine Handgelenke, die mit Isolierband zusammengebunden waren.
»Können Sie das jetzt wegmachen?«
Er stellte seine Frage, ohne aufzublicken. Es war schwer für ihn, den Mann, der hinter dem Lenkrad des Kleinlasters saß, anzuschauen. Peter hatte Huey Cotton gestern zum ersten Mal gesehen. Nie zuvor hatte er von diesem Mann gehört, doch in den letzten 24 Stunden hatte er keinen anderen Menschen gesehen.
Huey war fast einen Kopf größer als sein Vater, und er wog bestimmt 300 Pfund. Er trug einen schmutzigen Arbeitsanzug und eine schwere, schwarze Plastikbrille. Peter hatte eine Brille mit so dicken Gläsern, die die Augen verzerrten, schon mal in alten Filmen gesehen. Huey erinnerte Peter an einen Darsteller aus einem Film, den er eines Abends im Satellitenfernsehen gesehen hatte, als er ins Fernsehzimmer geschlichen war. Seine Eltern wollten nicht, dass er sich den Film ansah. Der Typ in dem Film hieß Carl, und Carls Freund sagte, er würde sich anhören wie ein Motorboot. Carl war nett, aber er brachte auch Leute um. Peter glaubte, dass Huey wahrscheinlich auch so war.
»Als ich ein kleiner Junge war«, sagte Huey, während er nachdenklich durch die Windschutzscheibe des Pick-ups schaute, »fand ich diese goldenen Bögen besser als jedes andere Restaurant. Das ganze Restaurant sah aus wie ein Raumschiff.« Jetzt schaute er Peter wieder mit seinen reumütigen Augen an, die hinter der dicken Brille übergroß wirkten. »Es tut mir Leid, dass ich dich fesseln musste. Aber du solltest nicht weglaufen. Ich habe dir gesagt, dass du nicht weglaufen sollst.«
Peter konnte seine Tränen nicht zurückhalten. »Wo ist meine Mama? Sie haben gesagt, sie kommt hierher.«
»Sie kommt auch. Wahrscheinlich ist sie schon da.«
Peter starrte durch den Hitzeschleier über dem Asphalt auf das Meer der parkenden Wagen. Er schaute sich auf der Suche nach dem BMW seiner Mutter jeden Wagen an. »Ich kann ihren Wagen nicht sehen.«
Huey griff in die Brusttasche seines Overalls.
Peter rutschte instinktiv näher an die Tür des Pick-ups.
»Schau mal«, sagte Huey mit seiner tiefen, kindlichen Stimme. »Ich hab dir was gebastelt.«
Der Riese zog seine Hand aus der Tasche und öffnete sie. Auf seiner Handfläche lag eine geschnitzte Lokomotive. Peter hatte beobachtet, dass Huey gestern fast den ganzen Nachmittag geschnitzt hatte, doch er hatte nicht erkennen können, woran er gearbeitet hatte. Der kleine Zug sah auf der großen Handfläche aus wie ein Spielzeug aus einem teuren Geschäft. Huey legte das Holzspielzeug in Peters zusammengebundene Hände.
»Das hab ich fertig gemacht, als du geschlafen hast«, sagte er. »Ich mag Züge. Als ich klein war, bin ich mal mit einem gefahren. Von St. Louis, nachdem Mama gestorben war. Joey ist mit dem Zug gekommen und hat mich abgeholt. Wir sind zusammen zurückgefahren. Ich saß vorne bei den reichen Leuten. Das durften wir eigentlich nicht, aber Joey hat es irgendwie hingekriegt. Joey ist sehr clever. Er hat gesagt, es wäre ganz richtig so. Er sagt, ich bin so gut wie alle anderen auch. Keiner ist besser als der andere. Es ist gut, sich immer daran zu erinnern.«
Peter starrte auf die kleine Lokomotive. Sie hatte sogar einen winzigen Motor.
»Schnitzen ist auch sehr schön«, fuhr Huey fort. »Dann bin ich nicht so nervös.«
Peter schloss die Augen. »Wo ist meine Mama?«
»Es war schön, mit dir zu reden. Bevor du weggelaufen bist. Ich dachte, du wärst mein Freund.«
Peter schlug die Hände vors Gesicht und schaute Huey durch einen Schlitz zwischen den Fingern an. Er überlegte, ob er aus dem Wagen springen sollte. Jetzt wusste er ja, wo er war. Aber Huey war schneller, als er aussah.
Huey griff noch einmal in eine Tasche seines Overalls und zog ein Taschenmesser heraus. Als er die große Klinge herausklappte, presste sich Peter gegen die Beifahrertür.
»Was machst du da?«
Huey zog Peters Handfessel ein Stück von der Hand ab, schob das Messer schnell durch die Lücke zwischen Peters Unterarmen und schnitt das Isolierband durch. Dann beugte er sich über den Jungen und öffnete die Beifahrertür des Kleinlasters.
»Deine Mutter wartet auf dich. In der Spielecke. Bei McDonald’s.«
Peter schaute den Riesen ungläubig an.
»Geh zu ihr, Junge.«
Peter stieß die Tür des Kleinlasters auf, sprang auf den Bürgersteig und rannte sofort in Richtung McDonald’s davon.
Joe griff über Margaret McDills Schoß und öffnete die Beifahrertür des BMWs. Als sein nach Rauch stinkendes schwarzes Haar ihren Nacken streifte, zuckte sie zusammen. In der letzten Nacht hatte sie seinen grauen Haaransatz gesehen.
»Dein Sohn wartet in der Spielecke bei McDonald’s«, sagte er.
Margarets Herzschlag setzte für den Bruchteil einer Sekunde aus. Sie schaute von der geöffneten Tür zu Joe, der das lederbezogene Lenkrad streichelte.
»Ich wünschte, ich könnte diesen Schlitten behalten«, sagte er betrübt. »Hab mich schon dran gewöhnt. Ja, Sir.«
»Behalten Sie ihn.«
»Nein, das gehört nicht zum Plan. Und ich halte mich immer an den Plan. Darum bin ich auch noch immer auf freiem Fuß.«
Sie starrte ihn entgeistert an, als er die Fahrertür öffnete, ausstieg, die Schlüssel auf den Fahrersitz warf und davonging.
Margaret stockte der Atem. Sie war misstrauisch wie ein verletztes Tier, das in der Wildnis ausgesetzt worden ist. Eine Sekunde später sprang sie aus dem Wagen. Ihr ganzer Körper war verkrampft. Die Angst der letzten Stunden und ihre Erschöpfung forderten ihren Tribut. Dennoch rannte sie auf das McDonald’s-Restaurant zu. Unterwegs keuchte sie verzweifelt ein Mantra: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln … Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln … Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln …
Huey Cotton hielt mit quietschenden Bremsen neben seinem Cousin an. Zwei Männer, die unter dem überdachten Eingang von Barnes & Noble standen, hoben den Blick, als sie das Geräusch hörten. Sie sahen aus wie Penner, die hofften, als Kunden durchzugehen und den ganzen Morgen auf den Sofas in der Buchhandlung sitzen und Zeitung lesen zu können. Joe Hickey wünschte ihnen im Stillen viel Glück. Auch er war schon so tief unten gewesen. Jetzt öffnete er die Wagentür.
Als er in den Pick-up stieg, schaute Huey ihn an wie ein zweijähriger Junge, dem ein Stein vom Herzen fiel, weil seine Mutter endlich zurückkehrte.
»Hallo, Joey«, sagte Huey aufgeregt. Sein Kopf wackelte vor Erleichterung hin und her.
»Dreiundzwanzig Stunden und zehn Minuten«, sagte Hickey und tippte mit dem Finger auf seine Uhr. »Cheryl hat das Geld, niemand wurde verletzt, und vom FBI keine Spur. Ich bin ein echtes Genie, Junge. Der Meister des Universums.«
»Ich bin nur froh, dass es vorbei ist. Diesmal hatte ich ziemlich Schiss.«
Hickey lachte und strich Huey durch sein ungekämmtes Haar. »Wieder ein sorgenfreies Jahr, Kürbiskopf.«
Auf dem pausbäckigen Gesicht des Riesen breitete sich zögernd ein Lächeln aus. »Ja.« Er legte den Gang ein, fuhr langsam vor und fädelte sich in den Verkehr ein.
Peter McDill stand wie eine Statue inmitten eines Sturms in der Spielecke von McDonald’s. Kleine und große Kinder sausten auf Socken um ihn herum und sprangen ausgelassen auf dem Schaumstoff umher. Das Schreien und Lachen war ohrenbetäubend. Peter hielt mit tränenden Augen nach seiner Mutter Ausschau. Mit der rechten Hand umklammerte er die geschnitzte Lokomotive, die Huey ihm geschenkt hatte, doch dessen war er sich im Moment gar nicht bewusst.
Die Glastür des Restaurants wurde geöffnet, und eine Frau mit zerzaustem Haar und gehetztem Blick trat ein. Sie sah aus wie seine Mutter, aber nicht genau wie sie. Diese Frau sah irgendwie anders aus, älter als seine Mutter, und ihre Kleidung war zerrissen. Vor der Tür stieß sie zwei Kinder zur Seite, was seine Mutter niemals tun würde, und schaute sich hektisch in der Spielecke um. Ihr Blick wanderte von einem Kind zum anderen, blieb auf Peter haften, wanderte weiter und kehrte dann zu ihm zurück.
»Mama?«, rief er unsicher.
Im Bruchteil einer Sekunde fiel die ganze Anspannung der letzten Stunden von Margaret ab. Sie rannte auf Peter zu, schloss ihn in die Arme und presste ihn ungestüm an die Brust. Das hatte seine Mutter schon sehr, sehr lange nicht mehr getan. Als ein schreckliches Jammern aus ihrer Kehle drang, blieben die Kinder wie angewurzelt stehen.
»O mein Gott«, wimmerte Margaret. »Mein lieber, kleiner Schatz. Mein lieber, kleiner Schatz …«
Über Peters Wangen rannen heiße Tränen. Als seine Mutter ihn an sich presste, fiel ihm der kleine Holzzug aus der Hand. Ein kleines Kind hob ihn lächelnd vom Boden auf und stapfte mit dem Spielzeug davon.
EIN JAHR SPÄTER
2
Will Jennings überholte mit seinem Ford Expedition einen langsam fahrenden Tanklastwagen und fuhr anschließend wieder auf die rechte Spur der zum Flughafen führenden Straße. Das Flughafengelände war nur knapp eine Meile entfernt. Es gelang ihm nicht, seinen Blick von den Flugzeugen abzuwenden, die beim Start über den Bäumen in die Höhe stiegen. Es war fast ein Monat vergangen, seitdem er zum letzten Mal geflogen war, und er konnte es kaum noch erwarten, wieder in einem Cockpit zu sitzen.
»Schau auf die Straße«, sagte seine Frau, die auf dem Beifahrersitz saß.
Karen Jennings war 39 Jahre alt – ein Jahr jünger als ihr Ehemann –, doch in vielerlei Hinsicht viel älter als er.
»Daddy schaut sich die Flugzeuge an«, rief Abby, die auf dem Kindersitz auf der Rückbank saß, dazwischen. Obwohl das Mädchen erst fünfeinhalb war, mischte sie sich immer in ihre Gespräche ein. Will schaute in den Rückspiegel und lächelte seiner Tochter zu. Sie war Karen mit ihren rotblonden Locken, den durchdringenden grünen Augen und den hellen Sommersprossen rund um die Nase wie aus dem Gesicht geschnitten. Als er sie ansah, zeigte sie mit dem Finger auf ihre Mutter.
Will legte die rechte Hand auf Karens Knie. »Meine Mädchen möchten den alten Dad sicher begleiten.« In Gesellschaft von Abby nannte er sich oft Dad und Karen Mama, so wie es sein Vater gemacht hatte. »Ihr steigt einfach ins Flugzeug und vergesst für drei Tage alles.«
»Geht das, Mama?«, schrie Abby. »Geht das?«
»Und was sollen wir da anziehen?«, fragte Karen in schnippischem Ton.
»Ich kleide euch beide an der Küste neu ein.«
»Juhu!«, schrie Abby. »Schaut, der Flughafen!«
Der weiße Tower des Flughafens tauchte vor ihren Blicken auf.
»Wir haben außerdem kein Insulin bei uns, Will.«
»Daddy kann mir ein Rezept verschreiben!«
»Ich kann dir das Insulin verschreiben und dir ein Rezept ausstellen, Liebling«, korrigierte Will sie.
»Sie weiß eigentlich, wie es richtig heißt.«
»Ich will an den Strand!«
»Fängst du schon wieder an?«, sagte Karen leise. »Daddy geht überhaupt nicht an den Strand, Liebling. Bis Dad vor den ganzen anderen Ärzten seinen Vortrag gehalten hat, wird er sowieso unerträglich sein. Anschließend reden sie stundenlang über ihre Zeit an der medizinischen Fakultät. Und dann wird sich Dad seine Gelenke ruinieren, weil er unbedingt drei Tage an einem Stück Golf spielen muss.«
»Wenn ihr mitkommt«, sagte Will, »können wir rund um Ocean Springs nach unentdeckten Werken von Walter Anderson suchen.«
»Neiiin«, jammerte Abby. Sie hasste diese Suche nach Kunstgegenständen. Meistens bedeutete das, dass sie stundenlang in Kleinstädten durch Gassen liefen, und manchmal musste sie sogar ewig im Wagen warten. »Du spielst doch kein Golf, Mama. Du kannst mit mir an den Strand gehen.«
»Ja, Mama«, stimmte Will zu.
Karen funkelte ihn böse an. Ihre unterdrückte Wut spiegelte sich in ihren grünen Augen, die wie Leuchtfeuer blinkten. »Ich habe vor zwei Jahren eingewilligt, diese Blumenausstellung zu organisieren. Es ist das sechzigste Jubiläum der Junior League. Ich weiß nicht, wessen glorreiche Idee es war, aus dem Anlass eine Blumenausstellung zu veranstalten, aber das ist jetzt offiziell mein Problem. Ich habe alles bis zur letzten Minute aufgeschoben, und es kommen über vierhundert Aussteller.« Karen engagierte sich ehrenamtlich in diesem Wohltätigkeitsverband.
»Du hast doch schon längst alles organisiert«, sagte Will. Es bestand eigentlich kein Grund, darüber zu streiten, aber er hatte das Gefühl, sie überreden zu müssen. Seit einem halben Jahr hing der Haussegen schief, und dies sollte seit langer Zeit die erste Reise ohne Karen sein. Das Ganze hatte geradezu symbolischen Charakter. »Du wirst dich nur quälen, bis dieser ganze Zirkus am Montag losgeht. Vier schlaflose Nächte. Warum schaltest du bis dahin nicht einfach mal ab?«
»Es geht nicht«, sagte sie in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. »Vergiss es.«
Will seufzte und schaute auf die 727, die über den Bäumen zu seiner Linken in die Höhe stieg.
Karen beugte sich vor und schaltete den CD-Player ein, aus dem ein Teenyhit von Britney Spears drang. Abby sang sofort mit. »Hit me baby one more time …«
»Wenn du Abby mitnehmen möchtest, kannst du das gerne machen«, sagte Karen.
»Was hast du gesagt, Mama?«
»Du weißt, dass das nicht geht«, erwiderte Will gereizt.
»Du meinst, du kannst sie nicht mitnehmen und gleichzeitig mit deinen Kollegen Golf spielen, richtig?«
Will hatte plötzlich wieder das Gefühl, als lege sich eine Faust um seine Brust. »Es ist doch nur einmal im Jahr, Karen. Ich halte den Hauptvortrag, und die ganze Sache hat eine politische Dimension. Das weißt du doch. Wegen des neuen Medikamentes, das auf den Markt kommt, werde ich Stunden mit den Leuten von Searle verbringen …«
»Das brauchst du mir nicht zu erklären, mein Lieber. Du sollst mich nur nicht überreden, meine Verpflichtungen zu vernachlässigen, eine Sache, die dir doch gar nicht in den Sinn käme.«
Will lenkte den Expedition auf das Flughafengelände. Ein- und zweimotorige Flugzeuge standen auf dem Betonfeld. Sie waren an im Zement verankerten Ringen gesichert, und ihre Räder waren festgekeilt, damit sich der Wind nicht in ihnen verfangen und sie bewegen konnte. Schon allein beim Anblick der Flugzeuge wurde Will ganz warm ums Herz.
»Du hast doch immer gesagt, ich solle sozialer sein. Jetzt engagiere ich mich im Wohltätigkeitsverband, und das scheint dir auch nicht zu gefallen«, sagte Karen ein wenig bissig.
»Ich gehe nicht zur Junior League, wenn ich groß bin«, sagte Abby. »Ich werde Pilotin.«
»Ich denke, du wolltest Ärztin werden«, sagte Will.
»Fliegende Ärztin, Dummkopf.«
»Fliegende Ärztin zu werden ist bestimmt besser als Hausfrau zu sein«, sagte Karen sotto voce.
Will nahm die Hand seiner Frau in die seine, als er neben seiner Beechcraft Baron 58 anhielt. »Sie ist doch erst fünf, Schatz. Eines Tages wird sie verstehen, was du aufgegeben hast.«
»Sie ist fast sechs. Und manchmal verstehe ich es selbst nicht.«
Er drückte Karens Hand und schaute sie verständnisvoll an. Dann stieg er aus, löste Abbys Gurt und zog sie aus dem Kindersitz.
Die Baron war zehn Jahre alt, doch die technische Ausstattung entsprach dem neuesten Stand, und Will war der stolze Besitzer. Er hatte weder Zeit noch Unkosten gescheut, um die mit Continental-Zwillingstriebwerken ausgerüstete Maschine mit der neuesten Flugelektronik zu versehen und sie so sicher und flugtauglich wie die Gulfstream IV zu machen, die sich nur ein Milliardär leisten konnte. Sie war weiß mit blauen Streifen, und auf ihrem Heck stand N-2WJ. Das »WJ« entsprang einer Spur Stolz, doch Abby gefiel es, wenn sie die Controller übers Funkgerät November-Two-Whiskey-Juliet rufen hörte. Wenn sie zusammen flogen, ließ sie sich von Will manchmal Alpha Juliet nennen.
Während Abby zur Baron lief, nahm Will einen Kleidersack und einen großen Lederkoffer mit Medikamenten aus dem Kofferraum des Expeditions und stellte beides auf den Boden. Er war heute schon in der Mittagspause hierher gefahren und hatte das Flugzeug auf Herz und Nieren überprüft und außerdem seine Golfschläger ins Flugzeug gepackt. Als er nun noch einmal in den Wagen griff, um sein Notebook herauszuholen, nahm Karen den Koffer und den Kleidersack und trug beides zum Flugzeug. In der Baron befanden sich hinter dem Cockpit vier Passagiersitze, sodass ausreichend Platz zur Verfügung stand. Als sie das Gepäck ins Flugzeug legten, sagte Karen:
»Du hattest heute Schmerzen, stimmt’s?«
»Nein«, log er und schloss die Tür der Passagierkabine, als existierte der stechende Schmerz in seinen Händen nicht. Unter normalen Umständen hätte er den Flug abgesagt und den Wagen genommen, doch er konnte die Golfküste jetzt nur noch mit dem Flugzeug rechtzeitig erreichen.
Karen schaute ihm in die Augen. Sie wollte etwas sagen, schwieg dann aber. Stattdessen ging sie um die Tragflächen herum und half Abby dabei, die Maschine loszubinden, während Will noch einen letzten Check vornahm. Er sah zwischendurch kurz zu Abby hinüber. Sie war ihrer Mutter zwar wie aus dem Gesicht geschnitten, hatte jedoch seine schlanke Statur geerbt. Sie half gerne mit, um auf diese Weise dazuzugehören.
»Wie lange brauchst du bis zur Küste?«, fragte Karen, als sie sich zu ihm neben die Tragfläche stellte. »Fünfzig Minuten?«
»Bis zum Flughafen fünfunddreißig, wenn ich den Flieger richtig scheuche.« Will sollte seinen Vortrag im Beau Rivage Casino Hotel in Biloxi heute Abend um sieben Uhr halten und damit gleichzeitig das jährliche Treffen der Ärztevereinigung Mississippi einleiten. »Das ist ein wenig knapp«, gab er zu. »Durch die OP ist mir die Zeit davongelaufen. Ich rufe dich nach dem Vortrag an.« Er zeigte auf den Pieper an seinem Gürtel. »Wenn du mich während des Fluges sprechen möchtest, benutze SkyTel. Das ist neu. Digital. Es gibt kaum Funklöcher.«
»Mr. Hightech«, sagte Karen, um klarzustellen, dass sie diese Jungenspielzeuge nicht beeindruckten. »Brauche ich die Nachricht zu Hause nur einzutippen und wie eine E-Mail abzuschicken?«
»Richtig! Es gibt eine spezielle Website dafür. Wenn du Angst hast, etwas falsch zu machen, ruf einfach den Anrufservice an. Die Nachricht wird dann an mich weitergeleitet.«
Abby zog an Wills Hand. »Wackelst du nach dem Start mit den Flügeln?«
»Natürlich. Nur für dich. Und jetzt … wer bekommt den ersten Kuss?«
»Ich! Ich!«, schrie Abby.
Als Will sich zu ihr hinunterbeugte, drehte sie ihren Kopf zur Seite und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Er nickte, richtete sich wieder auf und ging zu Karen. »Sie hat gesagt, Mama bekommt heute den ersten Kuss.«
»Ich würde mir wünschen, Dad wäre auch so scharfsinnig.«
Er umfasste zärtlich ihre Taille. »Danke, dass du mir gestern Abend noch Zeit gelassen hast, den Film fertig zu machen. Sonst würden mich die Teilnehmer heute auslachen.«
»Du bist in deinem ganzen Leben noch nicht ausgelacht worden.« Karens Stimme klang jetzt etwas freundlicher. »Was machen deine Hände? Heraus mit der Sprache, Will.«
»Steif«, gab er zu. »Aber es ist nicht so schlimm.«
»Hast du etwas genommen?«
»Nur das Methotrexat.« Methotrexat, ein chemotherapeutisches Medikament, das gegen Krebs entwickelt worden war, wurde in kleiner Dosis auch gegen Wills Form der Arthritis eingesetzt. Selbst kleine Dosen konnten allerdings die Leber schädigen.
»Will«, drängte sie ihn.
»Okay, vier Aspirin. Aber das ist alles. Es geht mir gut. So gut, dass ich fliegen kann.« Er legte einen Arm um Karens Schultern. »Vergiss nicht, den Alarm einzuschalten, wenn du nach Hause kommst.«
Sie schüttelte kurz den Kopf und schaute ihn mit einem Blick an, in dem sich Sorge, Ärger, doch auch Liebe spiegelten. »Das vergesse ich nie. Sag Dad tschüss, Abby. Er ist spät dran.«
Abby umklammerte seine Hüfte, bis er sich zu ihr hinunterbeugte und ihr einen Kuss auf die Stirn gab. »Du passt auf Mama auf. Und sei brav, wenn sie dir die Spritzen gibt.«
»Wenn du mir die Spritzen gibst, tut es nicht so weh.«
»Du schwindelst. Deine Mama hat in ihrem Leben schon viel öfter Spritzen gegeben als ich.«
Er stöhnte leise, als er sie auf den Boden stellte und sanft zu ihrer Mutter schob. Abby ging rückwärts und schaute Will an, bis Karen sie auf den Arm nahm.
»Ach!«, rief Karen. »Ich hab ganz vergessen, es dir zu sagen. Microsoft fällt wieder. Als ich das Haus verlassen habe, standen sie bei zwölf Punkten.«
Will lächelte. »Vergiss Microsoft. Ab heute Abend geht’s mit Restorase los.« Restorase war der Handelsname eines neuen Medikamentes, das Will mitentwickelt hatte und das auch das Thema seines heutigen Vortrages war. »In dreißig Tagen kann sich Abby für Harvard startklar machen, und du kannst Haute-Couture-Klamotten tragen.«
»Ich denke Brown«, sagte Karen mit einem verstohlenen Lächeln.
Das war ein alter Scherz, den sie früher immer gemacht hatten, als sie so wenig Geld besaßen, dass ein Besuch bei Wendy’s Hamburgers schon ein Vergnügen war. Jetzt konnten sie sich tatsächlich solche Schulen leisten, aber der Scherz erinnerte sie an alte Zeiten, die in mancherlei Hinsicht vielleicht auch glücklicher gewesen waren.
»Wir sehen uns Sonntag wieder«, rief Will, als er in den Flieger kletterte. Er startete die Zwillingstriebwerke und überprüfte die Windverhältnisse über ATIS im Radio. Nachdem er Kontakt zur Bodenstation hergestellt hatte, winkte er durch die Plexiglasscheiben und rollte zur Startbahn.
Karen ging inzwischen mit Abby auf dem Arm zum Expedition zurück. »Komm, Schatz. Es ist heiß. Wir können auch im Wagen zuschauen, wie er abhebt.«
»Aber ich will, dass er mich sieht!«
Karen seufzte. »Okay.«
Will, der in der Baron saß und vom Tower die endgültige Starterlaubnis erhielt, löste die Bremsen und donnerte über die sonnige Startbahn. Die Baron schwebte wie ein freigelassener Falke in die Lüfte. Anstatt einfach nach links abzudrehen, um nach Süden zu fliegen, beschrieb Will eine Schleife, sodass er genau den schwarzen Expedition auf dem Boden überflog. Er sah Karen und Abby neben dem Wagen stehen. Als er in 600 Fuß Höhe über den Wagen hinweg flog, wippte er wie ein Jagdflieger, der die Kameraden der Bodentruppen grüßte, mit den Flügeln.
Abby schrie vor Freude. »Hast du das gesehen, Mama? Er hat es gemacht!«
»Ja sicher. Tut mir Leid, dass wir diesmal nicht mitfliegen konnten, Schatz«, sagte Karen und tätschelte ihre Schulter.
»Macht nichts«, sagte Abby und reichte ihrer Mutter die Hand. »Weißt du was?«
»Was denn?«
»Mir macht es auch Spaß, Blumen zu binden.«
Karen lächelte, setzte Abby in den Kindersitz und streichelte ihr über den Nacken. »Ich glaube, wir können das Dreifarben-Band gewinnen, wenn wir uns ein bisschen anstrengen.«
»Bestimmt können wir das!«, stimmte Abby freudig zu.
Karen setzte sich auf den Fahrersitz, startete den Wagen und lenkte ihn an den Flugzeugen vorbei zur Ausfahrt.
Fünfzehn Meilen nördlich des Flughafens fuhr ein zerbeulter grüner Kleinlaster mit einem Rasenmäher und zwei Laubsaugern auf der Ladefläche ratternd über die kurvenreiche Straße, die schon seit über hundert Jahren Crooked Mile Road hieß. Der Kleinlaster verlangsamte das Tempo und hielt neben einem schmiedeeisernen Briefkasten am Fuße eines hohen bewaldeten Hügels an. Ein verzierter Doppeldecker aus dem Ersten Weltkrieg war als Dekoration auf dem Briefkasten angebracht, auf dem in goldenen Buchstaben stand: Jennings, N° 100. Der Pick-up bog links ab und tuckerte langsam die steile Zufahrtsstraße hinauf.
Auf dem Hügel stand versteckt ein atemberaubend schönes Haus im viktorianischen Stil. Wedgwoodblau mit lebkuchenweißen Zierleisten und Buntglasfenstern in der ersten Etage, schien es mit dem Argwohn des Besitzers über den riesigen Rasen ringsumher zu wachen.
Als der Kleinlaster oben auf dem Hügel ankam, blieb er nicht sofort stehen, sondern fuhr noch etwa 20 Meter weiter über den gepflegten Rasen, bis er vor einem hübsch verzierten Gartenhäuschen anhielt. Das Gartenhaus, eine getreue Nachbildung des Wohnhauses, befand sich im Schatten von Kiefern und Eichen, die den Rasen säumten. Der Motor verstummte. Die folgende Stille durchbrach nur das Zwitschern der Vögel und das Klicken des erkaltenden Motors.
Die Fahrertür wurde aufgestoßen, und Huey Cotton stieg aus. Er trug seinen üblichen braunen Overall und seine dicke, schwarze Brille und starrte verwundert auf das Gartenhäuschen. Der Riese stieß mit dem Kopf fast ans Dach.
»Siehst du jemanden?«, rief eine Stimme aus dem Fenster der Beifahrertür des Pick-ups.
Huey konnte den Blick nicht von dem zauberhaften Häuschen abwenden. »Wie in Disneyland, Joey.«
»Mein Gott, sieh im Wohnhaus nach, okay?«
Huey ging um das Gartenhaus herum und erblickte vor dem Wohnhaus einen glitzernden blauen Swimmingpool. Aus zwei der vier Garagenbuchten schauten ein silberner Toyota Avalon und die weiße Nase eines Rennbootes hervor.
»In der Garage steht ein hübsches Boot«, sagte er zerstreut. Er drehte sich zu dem Gartenhaus um, beugte sich hinunter und schaute sich alles genau an. »Ich frage mich, ob in dieser Garage auch ein Boot steht.«
In dem Augenblick stieg Joe Hickey aus dem Kleinlaster. Er trug ein neues Ralph-Lauren-Polo-Shirt und eine khakifarbene Tommy-Hilfiger-Hose, doch die Kleidung passte irgendwie nicht zu ihm. Es war ihm anzumerken, dass er sich darin nicht besonders wohl fühlte. Die untere Hälfte einer Tätowierung schaute unter dem linken Ärmel seines Polo-Shirts hervor. Der Adler auf seinem Bizeps war zwar deutlich zu erkennen, doch die Tätowierung war nicht besonders gut gemacht.
»Schau dir das Wohnhaus an, Kürbiskopf. Siehst du unten das dritte Fenster von rechts? Das ist es.«
Huey richtete sich auf und blickte zum Wohnhaus hinüber. »Ich sehe es.« Er legte eine seiner riesigen Hände auf das Verandadach des Gartenhauses. »Ich würde mir echt wünschen, in dieses Haus hier zu passen. Ich wette, die Welt sieht von dort aus ganz anders aus.«
»Du wirst nie erfahren, wie groß der Unterschied ist.« Hickey griff auf die Ladefläche des Kleinlasters und zog einen verrosteten Werkzeugkasten hervor. »Komm, wir müssen uns um die Alarmanlage kümmern.«
Huey trottete hinter ihm zur offenen Garage.
Zwanzig Minuten später traten sie aus der Hintertür des Hauses auf die mit Natursteinen ausgelegte Veranda.
»Bring den Werkzeugkasten zum Wagen zurück«, sagte Hickey. »Dann wartest du hinter dem Gartenhaus. Sobald sie ins Haus gehen, läufst du zum Fenster. Kapiert?«
»Genau wie beim letzten Mal.«
»Beim letzten Mal gab es nicht so ein verrücktes Disneyland-Puppenhaus. Und es ist ein Jahr her. Ich will nicht, dass du da hinten Blödsinn machst. Wenn du hörst, dass die Garagentür geschlossen wird, setzt du deinen dicken Arsch in Bewegung und kommst zu diesem Fenster. Falls inzwischen ein neugieriger Nachbar auftauchen und dumme Fragen stellen sollte, sagst du, dass du den Auftrag hast, den Rasen zu mähen. Benimm dich so, als wärst du geistig etwas zurückgeblieben. Das dürfte dir ja nicht besonders schwer fallen.«
Huey wurde starr. »Sag nicht so was, Joey.«
»Wenn du im richtigen Moment vor dem Fenster wartest, werde ich mich bei dir entschuldigen.«
Huey schenkte ihm ein verzerrtes Lächeln und entblößte dabei seine gelben Zähne. »Ich hoffe, die hier ist hübsch. Hoffentlich kriegt sie nicht so schnell Angst. Das macht mich nervös.«
»Du bist ein richtiger John Dillinger, nicht? Mein Gott. Die haben Geld wie Heu. Versteck dich jetzt hinter dem Gartenhaus.«
Huey zuckte die Achseln und watschelte über die Veranda zu den Bäumen. Als er am Gartenhaus ankam, schaute er mit ausdrucksloser Miene zu Hickey und ging in die Hocke.
Hickey schüttelte den Kopf, drehte sich um und schritt durch die Hintertür ins Haus.
Karen und Abby, die auf der Interstate 55 Richtung Norden fuhren, sangen aus voller Kehle die Melodie von The Sound of Music, Abbys Lieblingsmusical. Die Jennings lebten westlich von Annandale in Madison County, Mississippi. Annandale war bekannt für den besten Golfclub des Staates, doch Golf war nicht der Grund, warum es sie in dieses Gebiet verschlagen hatte.
Die Angst vor Verbrechen und den Rassenunruhen in der Hauptstadt hatte viele junge Akademiker in die umzäunten Enklaven von Madison County vertrieben. Karen und Will waren aus anderen Gründen hierher gezogen. Wer von einem großen Grundstück träumte, musste nach Norden ziehen. Zum Haus der Jennings gehörten 20 Morgen Laub- und Nadelwälder. Es lag zwölf Meilen nördlich von Jackson-Mitte, und im abendlichen Berufsverkehr brauchte man 25 Minuten bis hierher heraus.
»… That will bring us back to doe, oh, oh, oh …«
Abby klatschte in die Hände und fing an zu lachen. Karen, der vom Singen die Puste ausgegangen war, beugte sich hinunter und tippte eine Nummer ins Handy ein. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie am Flughafen ein wenig unfreundlich zu Will gewesen war.
»Anästhesie«, sagte eine Frau, deren Stimme blechern durch den Hörer des Handys drang.
»Ist da der Anrufservice?«, fragte Karen.
»Ja, Madam. Die Klinik ist geschlossen.«
»Ich möchte eine Nachricht für Dr. Jennings hinterlassen. Hier spricht seine Frau.«
»Sprechen Sie bitte.«
»Wir vermissen dich schon. Hals- und Beinbruch heute Abend. Wir lieben dich, Karen und Abby.«
»Mit Sahnehäubchen und Küssen«, schrie Abby von ihrem Kindersitz.
»Haben Sie den letzten Satz auch verstanden?«, fragte Karen.
»Mit Sahnehäubchen und Küssen«, wiederholte die Stimme gelangweilt.
»Danke.«
Karen drückte auf ENDE und schaute in den Rückspiegel, der so eingestellt war, dass sie Abbys Gesicht sehen konnte.
»Daddy freut sich, wenn er Nachrichten von uns bekommt«, sagte Abby lächelnd.
»Natürlich, mein Schatz.«
Fünfzig Meilen südlich von Jackson hielt Will eine Flughöhe von 8000 Fuß. Unter ihm lag ein dicker, weißer Teppich aus Kumuluswolken und vor ihm ein Himmel, der so blau war wie ein arktischer See. Er hatte unbegrenzte Sicht. Als er sein Handgelenk krümmte, um das GPS-Gerät zu überprüfen, schoss ihm ein stechender Schmerz durch den rechten Unterarm. Es war schlimmer, als er Karen gegenüber zugegeben hatte, und das hatte sie gewusst. Ihr entging nichts. Sie wollte nicht, dass er weiterhin am Steuer eines Flugzeuges saß. Vor einem Monat hatte sie ihm angedroht, der Luftfahrtbehörde mitzuteilen, dass er »geschummelt« hätte, um die ärztliche Untersuchung zur Flugtauglichkeit zu bestehen. Er glaubte nicht, dass sie das tun würde, aber er war sich nicht ganz sicher. Wenn sie der Meinung wäre, dass das Fliegen aufgrund seiner Arthritis eine Gefahr für ihn und seine Familie darstellte, würde sie nicht zögern, alles daran zu setzen, ihn am Fliegen zu hindern.
Will wusste nicht, ob er damit klarkäme. Schon allein der Gedanke, nicht mehr fliegen zu dürfen, verdarb ihm die Stimmung. Für ihn war das Fliegen mehr als ein Freizeitvergnügen. Es war für ihn die Versinnbildlichung dessen, was er alles im Leben erreicht hatte, ein Symbol für den Lebensstil, den er sich und seiner Familie ermöglichte. Sein Vater hätte nicht einmal davon träumen können, ein Flugzeug im Wert von 300.000 Dollar zu besitzen. Tom Jennings hatte nie hinter dem Steuerknüppel eines Flugzeugs gesessen. Er selbst hingegen hatte seines bar bezahlt.
Dabei war Geld für Will nicht das Wichtigste. Es ging ihm um das, was er mit seinem Geld kaufen konnte: Sicherheit. Diese Lektion hatte er in seiner Jugend tausendfach gelernt: Geld war wie eine Rüstung. Es schützte die Menschen, die es besaßen, vor den täglichen Problemen, die andere quälten und sogar vernichteten. Und dennoch machte das Geld niemanden unverwundbar. Das hatte ihn seine Arthritis gelehrt. Andere Lektionen folgten.
1986 hatte er sein Medizinstudium an der Louisiana State University abgeschlossen. Anschließend begann seine Assistenzzeit in der Geburtshilfe der Universitätsklinik in Jackson. Dort lernte er eine OP-Schwester mit wunderschönen grünen Augen und rotblondem Haar kennen. Dieser Krankenschwester wurde nachgesagt, dass sie niemals Verabredungen mit Ärzten oder Medizinstudenten treffen würde. Nachdem er sich drei Monate in Geduld geübt und seinen Charme hatte spielen lassen, überredete Will Karen, mit ihm eines Mittags außerhalb der Klinik essen zu gehen. An jenem Tag erfuhr er den simplen Grund für ihre Zurückhaltung: Sie hatte schon zu oft erlebt, dass Krankenschwestern ihren Freunden finanziell während des Medizinstudiums unter die Arme gegriffen hatten, nur um später abgeschoben zu werden. Andere Schwestern ließen sich auf nervenaufreibende Dreiecksbeziehungen mit verheirateten Ärzten und ihren Frauen ein, und weder nach dem einen noch nach dem anderen stand dieser OP-Schwester der Sinn.
Trotz ihrer Einstellung traf sie sich in den nächsten zwei Jahren mit Will – zuerst heimlich und später in der Öffentlichkeit –, und nach einer einjährigen Verlobungszeit heirateten sie. Unmittelbar nach den Flitterwochen nahm Will seine Arbeit in einer Gemeinschaftspraxis mit anderen Ärzten aus dem Bereich der Geburtshilfe und Gynäkologie in Jackson auf, und der Beginn ihres Ehelebens gestaltete sich wie im Bilderbuch.
Während seines zweiten Berufsjahres in der Gemeinschaftspraxis spürte Will plötzlich Schmerzen in den Händen, Füßen und der unteren Rückenpartie. Er versuchte, die Schmerzen zu ignorieren, doch schon bald behinderten sie ihn bei der Arbeit. Daher suchte Will einen Freund in der Rheumatologie auf. Eine Woche später stand die Diagnose fest. Er litt unter Arthritis psoriatica, einer ernsten Krankheit, die oft zu Lähmungserscheinungen führt. Will konnte nicht mehr als Geburtshelfer arbeiten, und deshalb informierte er sich über Fachgebiete, die körperlich weniger anstrengend waren, wie zum Beispiel die Dermatologie und Radiologie. Ein alter Studienfreund schlug die Anästhesie vor – sein eigenes Fachgebiet. Eine dreijährige Ausbildung würde ausreichen, falls die Universität Wills Erststudium anerkannte und er das einjährige Praktikum überspringen durfte. Das war möglich, und 1993 nahm er in der Anästhesie der Universitätsklinik Jackson seine Arbeit als Assistenzarzt auf.
Im selben Monat kündigte Karen ihren Job als Krankenschwester und begann am nahe gelegenen Millsaps College eine Fortbildung, um sich auf das Medizinstudium vorzubereiten. Karen hatte sich als Krankenschwester immer unterfordert gefühlt. Will stimmte ihr zwar zu, aber ihre Entscheidung betrübte ihn, weil sie ihren Kinderwunsch dadurch einige Jahre zurückstellen mussten. Außerdem waren sie gezwungen, hohe Schulden zu machen, was Will Unbehagen bereitete. Doch er wollte, dass Karen glücklich war.
Während er sich in sein neues Fachgebiet einarbeitete und lernte, mit den Schmerzen seiner Krankheit zu leben, drückte Karen vier Semester lang die Schulbank und schloss mit hervorragenden Noten ab. Beim Zulassungstest zur Medizinischen Fakultät erreichte sie 96 Prozent. Will staunte nicht schlecht und war sehr stolz. Karen strahlte vor Glück. Es sah fast so aus, als wäre Wills Krankheit ein Ansporn gewesen.
Noch während des ersten Studienjahres an der Medizinischen Fakultät – Wills drittem Jahr als Assistenzarzt – wurde Karen schwanger. Sie hatte die Pille nie vertragen, und die weniger sicheren Methoden zur Empfängnisverhütung hatten schließlich versagt. Will war überrascht, aber glücklich. Karen war erschüttert. Sie glaubte, dass das Baby ihren Traum, Ärztin zu werden, zerstören würde. Will musste ihr gezwungenermaßen Recht geben. Drei qualvolle Wochen lang dachte sie über eine Abtreibung nach. Letztendlich entschied sie sich aufgrund ihres Alters von 33 Jahren dafür, das Baby zu behalten. Sie schaffte es, ihr erstes Studienjahr zu beenden, doch nach Abbys Geburt konnte sie das Studium nicht fortsetzen – sie hängte ihr Studium an den Nagel. Während Will nach Abschluss seiner Assistenzzeit die Arbeit in der Abteilung für Anästhesie, die sein alter Studienfreund leitete, aufnahm, saß Karen zu Hause, um sich auf ihre Mutterrolle vorzubereiten.
Sie nahmen sich vor, der Zukunft ohne Bedauern entgegenzusehen, was leider nicht gelang. Will war ungeheuer erfolgreich in seiner Arbeit, und er hätte es nie für möglich gehalten, dass Abby so viel Freude in ihr Leben bringen würde. Karen machte der Abbruch ihres Studiums jedoch sehr zu schaffen. Im Laufe der nächsten Jahre belastete ihre Unzufriedenheit allmählich ihre Ehe. Das machte sich bei den Gesprächen während des Essens und beim Sex bemerkbar, den es eigentlich gar nicht mehr gab. Will versuchte, mit ihr darüber zu sprechen, aber dadurch schien alles nur noch schlimmer zu werden. Schließlich konzentrierte sich Will nur noch auf seine Arbeit und auf Abby, und die restliche Energie verwendete er darauf, seine langsam fortschreitende Arthritis zu bekämpfen.
Er behandelte sich selbst, was aufgrund des herkömmlichen Wissens als verrückt bezeichnet werden konnte, doch er hatte seine Krankheit so intensiv studiert, dass er mehr darüber wusste als die meisten Rheumatologen. Das Gleiche galt für Abbys Jugenddiabetes. Da er sein eigener Arzt war, konnte er Dinge tun, die er normalerweise nicht hätte tun können, wie zum Beispiel fliegen. An guten Tagen behinderten ihn seine Schmerzen dabei nicht, und Will flog nur an guten Tagen. Aufgrund dieses Vorsatzes hatte er sich erlaubt, ein wenig zu mogeln. Er hatte Medikamente genommen, um die Untersuchung zur Flugtauglichkeit zu bestehen. Da nur wenige Berichte über seine Krankheit vorlagen, war es eher unwahrscheinlich, dass man seine Täuschung je aufdecken würde. Er hätte sich gewünscht, seine Eheprobleme wären auch so einfach zu lösen.
Plötzlich hörte er im Cockpit einen schrillen Piepton. Will fluchte, weil er die ganze Zeit mit seinen Gedanken woanders gewesen war. Als er die Instrumententafel nach dem Grund des Alarms überprüfte, regte sich Furcht in ihm, und seine Arme fingen an zu kribbeln. Er konnte nichts Ungewöhnliches entdecken, wodurch sich seine Angst noch steigerte. Er war ganz sicher, dass ihm etwas entgangen war. Plötzlich atmete er auf. Er griff an seine Taille, zog das neue SkyTel vom Gürtel und drückte auf die Empfangstaste. Der alphanumerische Pager zeigte eine Nachricht in leuchtend grünen Buchstaben:
WIR VERMISSEN DICH SCHON. HALS- UND BEINBRUCH HEUTE ABEND. WIR LIEBEN DICH, KAREN UND ABBY. MIT SAHNEHÄUBCHEN UND KÜSSEN.
Will lächelte und schwenkte die Flügel der Baron gegen den tiefblauen Himmel.
Karen hielt neben dem Briefkasten an und schüttelte den Kopf, als ihr Blick auf den bronzenen Doppeldecker auf dem Briefkasten fiel. Ihrer Meinung nach war die Dekoration ein wenig kindisch. Sie griff in den Briefkasten, zog eine Hand voll Umschläge und Zeitschriften heraus und sah die Post kurz durch. Es waren Rechnungen, Einladungen, Exemplare des Architectural Digest, Mississippi Magazine und des New England Journal of Medicine.
»Habe ich Post?«, fragte Abby aus dem Wagen.
»Na klar.« Karen reichte ihr einen puderblauen Umschlag. »Ich glaube, das ist eine Einladung zu Seths Geburtstagsparty.«
Abby öffnete den Umschlag, während Karen den steilen Hang hinauffuhr. »Und wie lange dauert es noch, bis ich Geburtstag habe?«
»Drei Monate. Sony, Kleine.«
»Es gefällt mir nicht, fünfeinhalb zu sein. Ich möchte sechs sein.«
»Nun hab es mal nicht so eilig. Du wirst schneller sechsunddreißig sein, als du ahnst.«
Als das Haus in Sicht kam, spürte Karen den Zwiespalt, den sie immer spürte, wenn sie das Haus betrachtete. Zuerst empfand sie Stolz. Sie und Will hatten das Haus entworfen, und sie hatte sich um alle Verträge gekümmert. Trotz der Bedenken ihrer Freunde – bezogen auf diese Einsamkeit – hatten ihr die Planungen Spaß gemacht. Doch als die Familie schließlich ins Haus eingezogen war, hatte sie mehr Enttäuschung als Erfüllung verspürt. Sie konnte sich des Gefühls nicht erwehren, sich ihr eigenes Gefängnis gebaut zu haben, einen goldenen Käfig, der den anderen auf der Crooked Mile Road ähnelte. In allen wohnten andere Mississippi-Versionen moderner Ehefrauen des neuen Millenniums.
Karen fuhr in die Garagenbucht, die neben dem Eingang zur Waschküche lag. Abby öffnete ihren Sicherheitsgurt selbst, wartete jedoch, bis ihre Mutter ihr die Tür aufmachte.
»Wir machen uns Eistee«, sagte Karen, als sie Abby auf die Erde stellte. »Wie geht es dir?«
»Gut.«
»Hast du heute Nachmittag schon oft Pipi gemacht?«
»Nein. Aber jetzt muss ich zum Klo.«
»Okay. Anschließend überprüfen wir deinen Zucker, und dann trinken wir Tee. Heute machen wir uns einen schönen Tag, Kleines. Nur wir Frauen.«
Abby grinste sie mit strahlenden Augen an. »Nur wir Frauen!«
Karen öffnete die Tür, die von der Waschküche zur begehbaren Speisekammer und zur Küche führte. Abby quetschte sich an ihr vorbei und lief ins Haus. Karen folgte ihr, blieb aber vor der digitalen Alarmtafel an der Wand der Waschküche stehen und tippte den Sicherheitscode ein.
»Alles in Ordnung«, rief sie, als sie durch die Speisekammer in die strahlend weiße Küche ging. »Möchtest du Cracker zum Tee essen?«
»Ich will Oreos!«
Karen legte eine Hand auf Abbys Schulter. »Du weißt, dass das nicht gut ist.«
»Ich kriege doch gleich meine Spritze, Mama. Du kannst mir diese neue Spritze ja auch sofort geben. Oder nicht?«
Abby war clever, wenn es um ihr eigenes Wohl ging. Übliche Formen des Insulins mussten eine halbe bis eine Stunde vor dem Essen gespritzt werden, wodurch Jugenddiabetes sehr schwer zu kontrollieren war. Wenn ein Kind plötzlich nach der Spritze keinen Appetit mehr hatte und sich weigerte, etwas zu essen – was bei Kindern häufig vorkam –, konnte der Blutzucker auf ein gefährliches Niveau sinken. Um dieses Problem zu lösen, war eine neue Form von Insulin, das Humalog, entwickelt worden, das fast augenblicklich von den menschlichen Zellen aufgenommen wurde. Es konnte vor einer Mahlzeit, während des Essens oder sogar erst unmittelbar nach dem Essen gespritzt werden. Will gehörte zu den Ärzten, die als erste Zugang zu dem Medikament hatten. Die Vorteile dieses neuen Medikamentes hatten das tägliche Leben von Familien mit an Diabetes leidenden Kindern revolutioniert. Das Humalog führte Kinder jedoch auch in Versuchung, ihre Ernährungsvorschriften zu übertreten, weil sie wussten, dass sofort ein »Gegenmittel« zur Hand war.
»Keine Oreos, Schatz«, sagte Karen streng.
»Okay«, nörgelte Abby. »Eistee mit Zitrone. Ich geh jetzt Pipi machen.«
»Wenn du wiederkommst, ist der Tee fertig.«
Abby blieb an der Tür stehen. »Kommst du mit?«
»Du bist schon ein großes Mädchen, und du weißt, wo der Lichtschalter ist. Ich mach in der Zwischenzeit den Tee.«
»Okay.«
Als Abby durch den Korridor stapfte, warf Karen einen Blick auf das New England Journal of Medicine. Wie immer, wenn sie greifbaren Symbolen des Berufes, den sie gezwungenermaßen hatte aufgeben müssen, gegenüberstand, stiegen Wut und Enttäuschung in ihr auf. Sie war insgeheim froh, dass ihr die Blumenausstellung eine Entschuldigung geliefert hatte, Will nicht zum Ärztekongress begleiten zu müssen. Bei derartigen Veranstaltungen schrieben ihr Männer, die ihr in der Chemievorlesung nicht das Wasser hatten reichen können, nur den Status der »Ehefrau eines Arztes« zu.
In diesem Magazin sollte im nächsten Monat Wills Forschungsarbeit über das neue Medikament veröffentlicht werden, während sie sich mit dem nächsten Projekt des Wohltätigkeitsverbandes beschäftigen würde. Sie schob die Zeitschrift mit der anderen Post zur Seite und öffnete den Kühlschrank aus rostfreiem Stahl.
In der Küche standen nur Küchengeräte von Viking. Diese hochwertigen Geräte wurden in Greenville, Mississippi, hergestellt. Seit Will die Epiduralanästhesie bei zwei Frauen des Unternehmens durchgeführt hatte, wartete das Haus der Jennings mit einer Küche auf, die aus dem Architectural Digest, der heute mit der Post gekommen war, hätte stammen können – natürlich zu einem günstigeren Preis. Karen war mit einem lauten, alten Coldspot-Kühlschrank von Sears aufgewachsen, und die Wäsche wurde damals noch zum Trocknen auf eine Leine gehängt. Obwohl sie Luxus schätzte, wusste sie, dass zum Leben mehr gehörte als ein wunderschönes Haus und Blumenausstellungen. Sie nahm die Teekanne aus dem Kühlschrank, stellte sie auf die Anrichte und schnitt eine Zitrone in Scheiben.
Abby ging langsam durch den dunklen Flur. Als sie an ihrem Zimmer vorbeikam, schaute sie durch die halb geöffnete Tür. Ihre Puppen und Stofftiere lagen am Kopfende ihres Himmelbettes, so wie sie sie heute Morgen hingelegt hatte. Barbies, Beatrix-Potter-Hasen und Beanie-Babys – kreuz und quer durcheinander wie eine große Familie. So gefiel es ihr am besten.
Abby stieg die fünf Stufen zum Badezimmer des Erdgeschosses hoch und stellte sich auf Zehenspitzen, um an den Lichtschalter zu kommen. Dann zog sie ihre Hose herunter und setzte sich auf die Toilette. Sie war froh, dass sie nicht so viel Pipi machen musste. Das bedeutete, dass ihr Zucker in Ordnung war. Nachdem sie sich wieder angezogen hatte, stieg sie auf den Hocker vor dem Waschbecken, wusch sich sorgfältig die Hände und trocknete sie ab. Anschließend machte sie sich sofort wieder auf den Weg in die Küche. Das Licht im Badezimmer ließ sie an, falls sie später noch einmal aufs Klo musste.
Als sie wieder am Kinderzimmer vorbeikam, bemerkte sie einen seltsamen Geruch. Ihre Puppen sahen alle glücklich aus, doch irgendetwas stimmte nicht. Sie wollte schon in ihr Zimmer gehen, um nachzusehen, als ihre Mutter rief, dass der Tee fertig war.
Abby drehte sich um, und in dem Moment flatterte auf einmal etwas Graues vor ihren Augen herum. Sie fuchtelte instinktiv mit den Händen durch die Luft, als hingen dort Spinnweben, doch ihre Hand traf hinter dem Grauen auf etwas Hartes. Das Graue war ein Handtuch, und in dem Handtuch steckte eine Hand. Die Hand presste das Handtuch auf ihre Nase, ihren Mund und ihre Augen, und der seltsame Geruch, der ihr vorhin aufgefallen war, drang mit jedem Atemzug in ihre Lungen.
Ihr stockte vor Entsetzen der Atem. Sie brachte keinen Ton heraus und versuchte, sich zu befreien, doch da legte sich ein Arm um ihren Körper und hob sie in die Luft, sodass sie vergebens auf dem breiten Korridor mit den Beinen strampelte. Das Handtuch, das ihr gegen das Gesicht gepresst wurde, war kalt. Im ersten Moment fragte sich Abby, ob ihr Vater vielleicht zurückgekommen war und ihr einen Streich spielte. Das war jedoch ausgeschlossen. Er saß ja im Flugzeug. Überdies würde er sie nie absichtlich erschrecken. Nicht wirklich. Und sie hatte einen mächtigen Schreck bekommen. So einen Schreck wie damals, als sie ins Koma gefallen war. Damals waren ihre Gedanken durch ihre Ohren geflogen, bevor sie sie zu Ende denken konnte, und ihre Stimme hatte Wörter gesprochen, die zuvor noch nie jemand gehört hatte.
Sie versuchte, gegen das Monster, das sie festhielt, anzukämpfen, doch je stärker sie kämpfte, desto schwerer wurde es. Plötzlich wurde alles dunkel, auch vor dem Auge, das bisher nicht verdeckt war. Abby konzentrierte sich, so gut sie konnte, darauf, ein Wort zu sagen, das einzige Wort, das ihr jetzt helfen konnte. Mit einem siegessicheren Gefühl sagte sie dieses Wort, doch es erstarb in dem nassen Handtuch.
»Mama …«
Huey Cotton, der vor dem Haus der Jennings stand, rieb nervös mit seinen Handflächen über die Hosenbeine seines Overalls und starrte durch Abbys Kinderzimmerfenster. Abby. Im Gegensatz zu anderen Namen konnte er sich diesen problemlos merken. Seine Mutter hatte ihm einst Briefe an eine Frau namens Abby laut vorgelesen. Liebe Abby, hatte sie immer in schleppendem Ton mit ihrer vom Rauchen rauen Stimme gesagt. Dabei hatte sie mit Lockenwicklern und im Morgenmantel am Küchentisch gesessen. Die Leute, die an diese Abby schrieben, unterzeichneten ihre Briefe nie mit ihrem richtigen Namen. Sie seien verlegen, hatte seine Mutter gesagt. Statt mit ihren Namen unterschrieben sie mit Fantasiewörtern und manchmal auch mit Orten wie Verwirrt in Omaha. Daran erinnerte er sich noch.
Huey hörte das Schlurfen von Schuhen auf einem Holzboden. Er hob den Kopf und sah seinen Cousin, der mit der kleinen Abby auf dem Arm durch das pinkfarbene Kinderzimmer schritt. Sie wehrte sich und strampelte wild mit ihren dünnen Beinen durch die Luft. Joey hielt sie fest, damit ihre Füße nicht gegen die Möbel oder die hohen Bettpfosten knallten. Das Strampeln wurde immer schwächer, bis die Beine wie bei einem schlafenden Hund, der von der Jagd träumt, nur noch leicht zuckten.
Das kleine Mädchen sah aus wie eine der zig Puppen, die wie schlafende Bewohner eines Märchenlandes in dem Zimmer lagen, nur dass sie größer war. Joey ging zu dem offenen Fenster und reichte Abby hindurch. Huey riss erstaunt den Mund auf, als er das Mädchen so behutsam wie einen verwundeten Vogel entgegennahm.
»Du bist ein Genie«, sagte Joey mit einem breiten Grinsen im Gesicht. »Ich entschuldige mich, okay? Sie ist für zwei bis vier Stunden außer Gefecht gesetzt. Zeit satt.«
»Du rufst mich an, ja?«, fragte Huey.
»Jede halbe Stunde. Du sagst nur hallo, es sei denn, ich frag dich was. Stell das Handy ab, wenn du da angekommen bist. Schalte es nur ein, wenn du meine Kontrollanrufe erwartest. Und denk an Plan B, okay?«
»Ja, mach ich.«
»Gut. Jetzt hau ab.«
Huey drehte sich um und ging los, blieb dann aber noch einmal stehen und drehte sich wieder um.
»Was ist denn noch?«, fragte Joey.
»Kann sie eine von ihren Puppen mitnehmen?«
Joey beugte sich durch das Fenster ins Kinderzimmer, nahm eine Barbie mit Kleidchen vom Bett und gab sie Huey, der sie zwischen Abbys Hüfte und seinen kleinen Finger klemmte.
»Schmeiß den Motor vom Wagen erst an, wenn du die Straße unten erreicht hast«, sagte Joey.
»Ich weiß.«
Huey, der Abby mit mütterlicher Sorge in die Arme schloss, drehte sich um und latschte zum Gartenhaus, hinter dem sie den Kleinlaster versteckt hatten. Das Lamekleid der Barbiepuppe flatterte hinter ihm her wie eine winzige Fahne.
Karen stand in der Küche vor der Anrichte und blätterte trotz ihres Unwillens die medizinische Fachzeitschrift durch. Zwei beschlagene Gläser, die mit Eistee gefüllt waren und auf deren Rändern Zitronenscheiben steckten, standen neben ihr. Neben den Gläsern lag das Plastikgerät, mit dem sie in Abbys Finger stechen musste. Es sah fast aus wie ein Kugelschreiber. Ohne den Blick von der Zeitschrift zu heben, rief Karen: »Abby? Alles in Ordnung, Schatz?«
Abby antwortete nicht.
Karen trank einen Schluck Tee und las weiter. Sie war dankbar für ein paar ruhige Minuten, ehe sie sich um die letzten nervenaufreibenden Details für die Blumenausstellung kümmern musste.
Unterhalb der hohen, wohl riechenden Kiefern hinter dem Gartenhäuschen öffnete Huey die Fahrertür des Pick-ups und schob den reglosen Körper über die Sitzbank zur Beifahrerseite. Abby lag bewusstlos da, wie ein schlafender Engel. Huey beobachtete sie eine Weile. Er stand gerne auf Kiefernnadeln. Es war so angenehm wie ein dicker Teppich. Er hätte sich gewünscht, barfuss zu sein.
Plötzlich musste er an seinen Cousin denken. Joey wäre wirklich verrückt, wenn er die Sache vermasseln würde. Huey griff in den Kleinlaster, legte den Leerlauf ein und schob ihn rückwärts um das Gartenhaus herum. Das kostete ihn nicht viel mehr Kraft, als würde er ein Motorrad schieben. Nachdem sie das Gartenhaus hinter sich gelassen hatten, blieb er stehen, presste sich mit seinem ganzen Gewicht gegen den Wagen, schob weiter und lenkte den Wagen über den Hof zu der steilen Auffahrt. Der Hof war etwas abschüssig, damit das Wasser abfließen konnte, und dadurch kam ihm nun die Schwerkraft zu Hilfe.
Als die Räder auf die betonierte Straße trafen, gewann der Kleinlaster an Fahrt, und Huey versuchte unbeholfen, in den Wagen zu steigen. Er stellte einen Fuß aufs Trittbrett, doch als er sich durch die geöffnete Tür ins Innere ziehen wollte, rutschte er aus und stolperte. Er kämpfte, um sein Gleichgewicht zurück zu gewinnen, während der alte Chevy den Hügel hinunterrollte. Es war nur der Kraft seiner riesigen Hände zu verdanken, dass er den Kontakt zum Pick-up nicht verlor, als er auf die Crooked Mile Road zuraste.
Auf den letzten Metern der Auffahrt verbog Huey seine Handgelenke so stark, dass bei einem normalen Menschen die Sehnen gerissen wären, doch er hievte sich mit äußerster Kraftanstrengung in den Wagen. Kurz bevor der Pick-up die Straße erreichte, trat er auf die Bremsen, und der Wagen kam zitternd zum Stehen. Abby wurde gegen das Armaturenbrett geschleudert, wachte aber nicht auf. Huey schob sie zurück auf die Bank und bettete ihren Kopf auf seinen Oberschenkel. Dann hielt er eine Hand vor ihren Mund, um zu überprüfen, ob sie atmete.
Nachdem er sich beruhigt hatte, zog er die Fahrertür zu, warf den Motor an und bog in die Crooked Mile Road ein, die zum Highway 463 und von dort zur Interstate 55 führte. Er hatte eine lange Nacht vor sich.
Karen horchte auf, als sie das Geräusch eines startenden Motors vernahm. Um diese Tageszeit war das ungewöhnlich. Die Nachbarhäuser waren zu weit entfernt, um derartige Geräusche hören zu können. Sie schaute durch das Küchenfenster, konnte aber wie erwartet nichts erkennen. Vom Haus aus war nur eine Kurve der Crooked Mile Road einzusehen, und der hohe Hügel verdeckte die Stelle, an der die Zufahrt in die Straße mündete. Vielleicht war es ein UPS-Fahrer, der spät dran war und in der Zufahrt gewendet hatte.
Sie schaute wieder zur Korridortür und rief: »Abby? Soll ich dir helfen, Schatz?«
Wieder keine Antwort.
Allmählich kroch Angst in Karen hoch. Sie musste unbedingt Abbys Zucker kontrollieren, und wenn sie es auch nicht gerne zugab, so lauerte die Panik immer unmittelbar unter ihrer vorgeblichen Gelassenheit. Sie legte die Zeitschrift aus der Hand und ging zum Korridor. Im gleichen Augenblick hörte sie Schritte auf dem Holzboden. Karen fiel ein Stein vom Herzen, und sie musste im Stillen über ihre Angst lachen. Doch dann kam ein dunkelhaariger Mann um die 50 mit hoch erhobenen Händen durch die Korridortür auf sie zu.