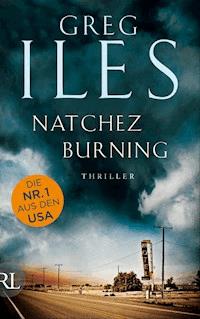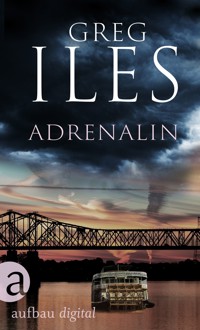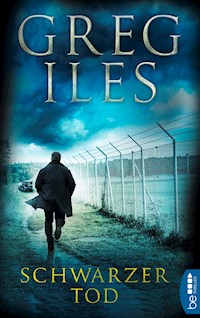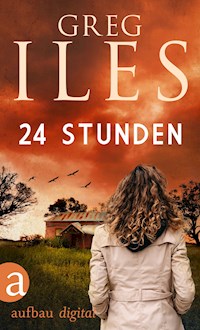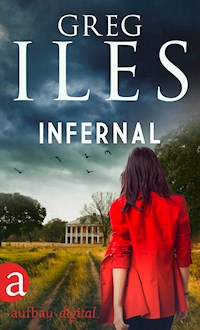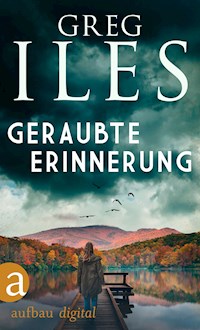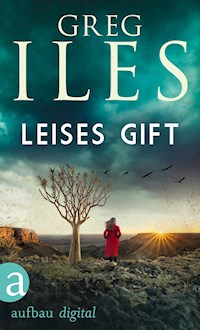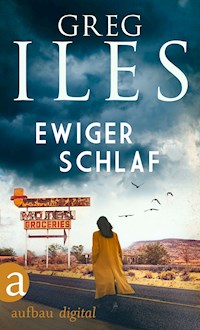
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Greg Iles Bestseller Thriller
- Sprache: Deutsch
Der Geologe John Waters führt ein glückliches Leben mit Frau und Kind in Natchez, Mississippi. Das war nicht immer so, denn Jahre zuvor drohte ihn die obsessive Affäre zu einer anderen Frau zu vernichten. Doch die Frau verschwand und fand einen schrecklichen Tod in New Orleans. Nun, zehn Jahre später, macht John die Bekanntschaft der attraktiven Immobilienmaklerin Eve Sumner, einer Frau, die offenbar jedes Detail aus seiner bewegten Vergangenheit zu kennen scheint. Als auch Eve ums Leben kommt, wird der Geologe in einen Strudel aus Hass und Gewalt verwickelt, der ihn an den Rand des Wahnsinns bringt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Informationen zum Buch
Der Geologe John Waters führt ein glückliches Leben mit Frau und Kind in Natchez, Mississippi. Das war nicht immer so, denn Jahre zuvor drohte ihn die obsessive Affäre zu einer anderen Frau zu vernichten. Doch die Frau verschwand und fand einen schrecklichen Tod in New Orleans.
Nun, zehn Jahre später, macht John die Bekanntschaft der attraktiven Immobilienmaklerin Eve Sumner, einer Frau, die offenbar jedes Detail aus seiner bewegten Vergangenheit zu kennen scheint. Als auch Eve ums Leben kommt, wird der Geologe in einen Strudel aus Hass und Gewalt verwickelt, der ihn an den Rand des Wahnsinns bringt...
Über Greg Iles
Greg Iles wurde 1960 in Stuttgart geboren. Sein Vater leitete die medizinische Abteilung der US-Botschaft. Mit vier Jahren zog die Familie nach Natchez, Mississippi. Mit der »Frankly Scarlet Band«, bei der er Sänger und Gitarrist war, tourte er ein paar Jahre durch die USA. Mittlerweile erscheinen seine Bücher in 25 Ländern. Greg Iles lebt heute mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Natchez, Mississippi. Fünf Jahre hat er kein Buch herausgebracht, da er einen schweren Unfall hatte, nun liegen im Aufbau Taschenbuch seine Thriller „Natchez Burning“, „Die Toten von Natchez vor“ und „Die Sünden von Natchez“ vor.
Mehr zum Autor unter www.gregiles.com
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Greg Iles
Ewiger Schlaf
Aus dem Amerikanischen vonBianca Güth
Diesen Roman widme ich meinen Lesern, die es mir ermöglicht haben, stets etwas Neues, Unbekanntes zu schreiben. Wir alle halten gern am Vertrauten fest, doch letztlich ist es für uns alle eine Bereicherung, neue Orte und Menschen kennen zu lernen. Vielleicht gefällt Ihnen nicht jedes Buch so gut wie Ihr Favorit, aber zumindest werden Sie sich nicht langweilen – und ich mich auch nicht. Dieser Roman ist ausgefallen und außergewöhnlich. Lesen Sie, und lassen Sie die Fantasie spielen! (Für alle, die mir schreiben, um nachzufragen: Kann sein, dass Sie hier und auch in Zukunft vertrauten Charakteren begegnen – wahrscheinlich immer dann, wenn Sie es am wenigsten erwarten.)
Der normale Mensch ist eine Fiktion.
– C. G. JUNG
»Cathy! Cathy!«
– HEATHCLIFF, Wuthering Heights
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Danksagung
Impressum
1
Eve Sumner erschien am ersten Herbsttag. Nicht am kalendarischen Herbstanfang – nichts an Eve war regelkonform-, sondern am ersten Tag, an dem die Luft so kalt war, dass sie durch den Stoff von John Waters’ Hemd drang. Es war kühl genug, um eine Jacke zu tragen, doch Waters verzichtete darauf, weil es so lange unglaublich heiß gewesen war, weil die Luft nach Metall schmeckte und sein Herz schneller schlug, angetrieben vom Temperaturumschwung und dem verringerten Druck auf seiner Haut, wie bei einem Höhenwechsel. Seine Schritte waren leichter, der Wind trug ihn vorwärts, und tief in seiner Brust regte sich etwas, so wie die Hirsche sich tief in den Wäldern regten und die Blätter an den Zweigen flatterten. Schon bald würden die Jäger den Hirschen zwischen den Eichen auflauern und sie erlegen, und die Blätter würden zu Haufen zusammengekehrt und verbrannt, doch am heutigen Tag war noch alles offen, verharrte in einem Augenblick der Erwartung oder einem Atemholen. Und mit dem ersten Ausatmen kam Eve Sumner.
Sie stand an der gegenüberliegenden Seitenlinie des Fußballfeldes, zu weit entfernt, als dass Waters sie richtig sehen konnte. Zunächst nahm er sie auf die gleiche Weise wahr wie all die anderen Väter: als Silhouette, die seinen Blick auf sich zog – weibliche Kurven und eine Mähne dunklen Haares, die bei den Müttern zu beiden Seiten des Fußballfelds irrationale Verärgerung hervorrief. Aber mehr bemerkte Waters nicht. Er hatte keine Zeit; er trainierte die Mannschaft seiner Tochter.
Die siebenjährige Annelise rannte über das Meer aus Gras und warf sich, die Blicke fest auf den Ball geheftet, zwischen achtjährige Jungen, die beinahe doppelt so groß waren wie sie. Waters trabte am Spielfeldrand neben den Mannschaften her und feuerte sein Team an. Er bewegte sich leicht und geschmeidig für sein Alter und seine Statur – er hatte vor einem Jahr die vierzig überschritten und war gut einsfünfundachtzig groß- und lief schnell genug, um am nächsten Morgen Muskelkater zu bekommen. Aber er mochte dieses Gefühl. Es zeigte ihm, dass er immer noch voller Schwung war. Stolz beobachtete er Annelise: Letztes Jahr war seine Tochter noch ein schüchternes kleines Mädchen gewesen, das sich fürchtete, dem Ball zu nahe zu kommen, doch seit diesem Jahr, seit ihr Vater Trainer war, hatte sie gewaltig an Selbstvertrauen gewonnen. So jung sie auch war – sie lernte jetzt schon Lektionen, von denen sie im späteren Leben profitieren konnte.
»Der Ball ist aus!«, rief Waters. »Blau hat den Ball.«
Während das gegnerische Team den Ball zum anderen Ende des Fußballfelds spielte, fühlte Waters fremde Blicke auf sich ruhen wie Finger auf der Haut. Er wurde beobachtet, und das nicht nur von den Kindern und deren Eltern. Als Waters zum gegenüberliegenden Spielfeldrand schaute, sah er direkt in die Augen der dunkelhaarigen Frau. Sie waren tief und dunkel wie ihr Haar, blickten klar und zielgerichtet. Waters wandte rasch den Blick ab, doch das Bild hatte sich in sein Hirn eingebrannt: dunkle, wissende Augen, die sich mit Männerseelen auskannten.
Noch stand es unentschieden, und Waters wusste, dass die Spielzeit bald um sein würde. Brandon Davis, der achtjährige Spitzenspieler seiner Mannschaft, führte den Ball mit den Fußspitzen, kontrollierte ihn geschickt, fädelte ihn sicher durch die Beine der Gegner. Waters sprintete an der Seitenlinie los, um zu Brandon aufzuschließen. Annelise lief dicht hinter Brandon und versuchte, sich in Position zu bringen, damit er sie anspielen konnte, sobald sie sich dem gegnerischen Tor näherten. Als Brandon einen kraftvollen Schuss aufs Tor abgab, sprintete Annelise instinktiv nach rechts. Der Ball prallte von den Schienbeinen des Torhüters ab, zurück zu Brandon. Er wollte schon ein zweites Mal schießen, als er Annelise auf der rechten Spielfeldseite sah. Er schlenzte den Ball in ihre Schusslinie – womit er zeigte, dass er zu den wenigen Jungen gehörte, die es auch genießen können, indirekt an einem Erfolg beteiligt zu sein. Annelise war beinahe zu überrascht von Brandons Selbstlosigkeit, um zu reagieren, doch im allerletzten Moment schoss sie den Ball am Torhüter vorbei ins Netz.
Ein Freudenschrei ging durch die Zuschauermenge. Waters hörte, wie die Stimme seiner Frau alle anderen übertönte. Er wusste, dass er Annelise eigentlich nicht bevorzugen sollte, aber er konnte nicht anders: Er rannte aufs Feld und drückte sie an seine Brust.
»Ich hab getroffen, Daddy!«, rief Annelise, und ihre Augen funkelten vor Stolz und Erstaunen. »Ich hab ein Tor geschossen!«
»Und was für eins.«
»Brandon hat mir den Ball zugespielt!«
»O ja.«
Waters merkte, dass Brandon hinter ihm stand. Er drehte sich halb um, ergriff die Hand des Jungen und hob dessen Arm zusammen mit dem Annelises in die Höhe, um auf diese Weise allen zu zeigen, dass das Verdienst am Treffer beiden gebührte.
»Okay, zurück in die Verteidigung!«, rief er.
Seine Mannschaft rannte zum eigenen Tor, um dort wieder Aufstellung zu nehmen, doch der Trainer der Gegenmannschaft schob sich die Pfeife zwischen die Lippen und blies hinein, und der schrille Pfiff beendete das Match.
Die Eltern von Waters’ Spielern strömten aufs Spielfeld, um den Kindern und deren Trainer zu gratulieren und den Sieg zu bejubeln. Waters’ Frau Lily trug die Kühlbox heran, in der sich die Leckerbissen für nach dem Spiel befanden: isotonische Getränke und Schokoladenkekse. Als Lily die Kiste auf den Boden setzte und den Deckel abhob, wirbelte ein Tornado aus Körpern um sie herum, der ihr die Flaschen und Tüten aus den Händen riss. Lily lächelte aus dem lärmenden Chaos ihren Mann an, zeigte ihm stumm ihren Stolz auf Annelise, während der glückliche Vater eines Jungen Waters auf die Schulter klopfte. Lilys Augen waren kornblumenblau, und ihr Haar, das ihr bis auf die Schultern fiel, glänzte golden. In Augenblicken wie diesem sah sie noch genauso aus wie an der Highschool, wo sie an Langstreckenläufen teilgenommen und die Konkurrenz weit hinter sich gelassen hatte. Ein Glücksgefühl erfüllte Waters inmitten dieser Collage aus erhitzten Gesichtern, Grasflecken, aufgeschürften Knien und dem abgebrochenen Zahn des kleinen Jimmy O’Brien, der jetzt wie ein Artefakt aus einer historischen Schlacht von Hand zu Hand gereicht wurde.
»Was für eine Saison, John!«, sagte Brandon Davis’ Vater. »Nur noch ein Spiel.«
»Heute war ein toller Tag.«
»Wie fandest du Brandons Pass zu deiner Tochter?«
»Brandon hat einen guten Riecher.«
»Kann man wohl sagen«, sagte Davis. »Der Junge hat eine große Zukunft. Warte nur, bis er alt genug fürs AYA-Team ist.«
Waters fühlte sich bei solchen Gesprächen unwohl. In Wahrheit kümmerte es ihn wenig, ob die Kinder siegten oder eine Niederlage einstecken mussten. In ihrem Alter ging es in erster Linie um den Spaß und das Gemeinschaftsgefühl – was vielen Eltern jedoch entging.
»Ich muss den Ball holen«, sagte Waters, um das Gespräch zu beenden.
Er lief zu der Stelle, wo der Ball beim Abpfiff liegen geblieben war. Eltern der gegnerischen Spieler nickten ihm auf dem Weg zu ihren Autos anerkennend zu, und ein Gefühl der Kameradschaft überkam ihn. Diese grüne, rechteckige Raseninsel mit den weißen Seiten-, Tor- und Mittellinien war jener Ort, an dem heute das Herz von Natchez schlug – einer Stadt mit 20.000 Einwohnern, geschichtsträchtig, aber ohne Zukunftsperspektiven. In Waters’ Jugend hatten in den Wohnsiedlungen in der Gegend weiße Fabrikarbeiter gelebt; heute waren hier fast ausschließlich Schwarze zu Hause, was diese Gegend vor zwanzig Jahren zur Tabuzone gemacht hätte. Heute jedoch spielten auch schwarze Kinder in Waters’ Fußballmannschaft – ein Zeichen für eine Veränderung, die so tief greifend war, dass nur Menschen, die sie miterlebt hatten, ihre Bedeutung wirklich verstanden.
Gedankenversunken ließ Waters den Blick in die Runde schweifen. Die Leere, die er dabei verspürte, erinnerte ihn an das Gefühl, als einmal ein prächtiger Vogel direkt vor seinem Bürofenster gelandet war: ein Kardinal. Als Waters sich das Tier genauer anschauen wollte, hatte er rasches Flügelschlagen gehört; dann war die Stelle vor dem Fenster leer gewesen. Jetzt hielt Waters Ausschau nach der dunkelhaarigen Frau, doch sie war fort.
Er hob den Ball auf und lief zurück zu seinem Team, das auf einen abschließenden Kommentar wartete.
»Ihr habt sehr gut gespielt«, sagte Waters und sah die Kinder an, während die Eltern jubelten. »Jetzt bleibt nur noch ein Spiel, und ich bin sicher, wir werden gewinnen. Doch ob wir nun siegen oder verlieren – ich nehme euch alle hinterher mit zu McDonald’s, auf ein Happy Meal und ein Eis!«
»Jaaa!«, riefen elf Stimmen zugleich.
»Und jetzt ab nach Hause. Macht eure Schularbeiten.«
»Buuuh!«
Die Eltern lachten und lotsten ihre Kinder zu ihren Vans, Pick-ups und Pkws.
»Zum Schluss hast du es total vermasselt, Dad«, sagte Annelise.
»So viele Hausaufgaben hast du doch gar nicht.«
»Aber die Drittklässler haben eine Menge.«
Waters drückte die Schultern seiner Tochter; dann nahm er seiner Frau die Kühlbox ab und sagte leise: »Hatten wir in der zweiten Klasse Hausaufgaben?«
Lily beugte sich zu ihm vor. »Wir hatten bis zur sechsten Klasse keine Hausaufgaben.«
»Wirklich? Na, da hatten wir wohl Glück.«
Waters nahm Annelises Hand und ging mit ihr und Lily zu seinem schlammbespritzten Land Cruiser. Eine frisch geschiedene Mutter namens Janie ging neben ihnen her. Waters seufzte leise, während Janie wie ein Wasserfall auf Lily einredete und ihre gewohnte Litanei von Klagen über ihren Ex-Mann losließ. Annelise rannte voraus zu einer anderen Familie, deren Wagen neben dem Land Cruiser parkte. Zum ersten Mal seit Stunden mit seinen Gedanken allein, atmete Waters die kühle Luft tief ein. Auf der anderen Straßenseite grillte jemand Fleisch, und der Geruch ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Waters schaute über die Schulter, warf einen letzten Blick aufs Spielfeld, um sich davon zu überzeugen, dass er nichts vergessen hatte. Als er wieder nach vorn blickte, sah er die dunkelhaarige Frau. Sie kam ihm entgegen und bewegte sich mit geschmeidiger Anmut, den Blick auf sein Gesicht gerichtet. Die Frau ging zurück auf das nun verlassene Fußballfeld, wobei sie Waters ein betörendes Lächeln schenkte.
Er fühlte eine Hitzewoge, die sich vom Gesicht bis in die Zehen ausbreitete. Das Lächeln der Frau war sexy, ihre Zähne makellos weiß, ihre Nasenflügel bebten in katzenhafter Erregung, und ihre Augen blitzten feurig. Waters wollte stehen bleiben, sie anschauen, mit ihr reden, doch er wusste es besser. Auch wenn es oft heißt, Blicke seien harmlos – keine Ehefrau ist wirklich dieser Meinung. Also nickte er bloß höflich, schaute wieder nach vorn und ging weiter, bis er an der Frau vorbei war. Doch seine Gedanken erholten sich nicht so schnell wie sein Körper. Als Lily sich zu Janie beugte, um ihr etwas zuzuflüstern, warf Waters einen Blick über die Schulter.
Auch die dunkelhaarige Frau hatte sich umgedreht. Ihr Lächeln war jetzt weniger strahlend, doch ihre Augen forderten ihn immer noch heraus. In dem Moment, bevor Waters sich abwandte, schlossen sich ihre Lippen und formten ein einziges Wort – lautlos zwar, aber ein Wort, das nicht zu verwechseln war.
»Bald«, sagte sie stumm.
John Waters blieb beinahe das Herz stehen.
Er gewann seine Fassung erst wieder, als er einen Kilometer vom Fußballplatz entfernt war. Annelise erzählte von den Handgreiflichkeiten zwischen zwei Jungs in der Halbzeitpause, und zum Glück schien Lily ihr gebannt zu lauschen.
»He, wir haben gewonnen«, sagte sie dann und knuffte ihren Mann. »Was ist mit dir? Du bist mit den Gedanken ganz woanders.«
Rasch ließ Waters sich eine plausible Ausrede einfallen. »Es ist wegen der Untersuchung durch die Umweltbehörde.«
Lilys Miene wurde angespannt, und ihre Neugier verflog, genau wie Waters es vorhergesehen hatte. Als selbstständiger Erdöl-Geologe war Waters an einem Unternehmen mit mehr als dreißig Ölquellen beteiligt, doch im Augenblick schwebte ein Damoklesschwert über seinem Kopf. Siebzehn Jahre erfolgreicher Arbeit waren gefährdet, weil aus einer der Quellen möglicherweise Salzwasser in die Felder eines Reisbauern in Louisiana gesickert war. Die Umweltbehörde versuchte seit zwei Monaten, das Leck zu lokalisieren. Die Lage war deshalb so bedrohlich – wenn nicht katastrophal –, weil Waters’ Geschäftspartner es versäumt hatte, die Haftpflichtversicherung zu bezahlen. Weil sie das Unternehmen gemeinsam besaßen, wäre Waters ebenso betroffen wie sein Partner, sollte die Umweltbehörde zu der Ansicht gelangen, sie hätten das Leck zu verantworten. Vielleicht bedeutete es ihren Ruin.
»Denk nicht darüber nach«, bat Lily.
Waters nickte. Er wollte über Belanglosigkeiten sprechen, doch ihm fiel nichts ein. Ein Lächeln und ein stummes Wort hatten ihn aus der Fassung gebracht. Schließlich sagte er so beiläufig er konnte: »Wer war eigentlich die Frau, die mich angeschaut hat, als wir gegangen sind?«
»Ich dachte, du hättest sie angeschaut«, sagte Lily und bewies damit wieder einmal, dass ihr nichts entging.
»Ach komm, Babe … sie kam mir bekannt vor.«
»Eve Sumner.« Kälte lag in Lilys Stimme. »Immobilienhändlerin.«
Jetzt erinnerte er sich. Cole Smith, sein Partner, hatte Eve Sumner einmal erwähnt. Im Zusammenhang mit Sex, wenn er sich recht entsann. Andererseits hatte fast alles, worüber Cole sprach, mit Sex zu tun oder besaß zumindest einen sexuellen Beiklang.
»Ich glaube, Cole hat sie mal erwähnt.«
»Da wette ich drauf. Evie kommt ziemlich herum, nach allem, was man so hört.«
Waters blickte auf seine Frau und wunderte sich über ihre Veränderung. Vor ein paar Jahren hatte sie niemals solche Kommentare abgegeben … oder vielleicht doch, und es war nur ihr Tonfall, der sich verändert hatte. In ihrer Stimme schwang eine Bitterkeit mit, die zu ihrer herben, ja strengen Miene passte. Vor vier Jahren war das lächelnde, mädchenhafte Aussehen, das Lily sich bis zum Alter von 35 bewahrt hatte, praktisch über Nacht verschwunden, und ihre hellen Augen hatten sich zu einem fast düsteren Blau getrübt. Waters hatte sogar das Datum im Kopf, obwohl er sich nicht gern an den Grund für die Veränderung erinnerte.
»Wie alt ist sie?«, fragte er.
»Wie alt schätzt du sie?«
Vorsicht, Minenfeld. »Ich würde sagen … zweiundvierzig?«
Lily prustete. »Eher zweiunddreißig. Wahrscheinlich will sie uns das Haus unterm Hintern weg verkaufen. Das macht sie immer so.«
»Unser Haus ist nicht zu verkaufen.«
»Leute wie Eve Sumner sind der Meinung, alles hat seinen Preis.«
»Hört sich nach Cole an.«
»Ich bin sicher, die beiden haben viel gemeinsam.« Lily warf ihm einen Blick zu, der besagte: Ich bin sicher, Cole hat mit ihr geschlafen. Was ein Problem für Waters darstellte, da sein Geschäftspartner – zumindest nominell – ein glücklich verheirateter Vater von drei Kindern war. Doch an dieses Problem war er gewöhnt. Cole Smith hatte seine Frau betrogen, seit die Flitterwochen vorüber waren, aber er hatte seine Affären nie zu einem ehelichen Konflikt ausarten lassen. Coles chronische Schürzenjägerei war offenbar vor allem ein Problem für Waters, der sich selbst häufig gezwungen sah, einen Freund und Partner decken zu müssen, dessen Tun er verurteilte. An einem anderen Tag hätte er Lilys Vermutung vielleicht mit einem skeptischen Grunzen beantwortet, doch in letzter Zeit war Waters’ Geduldsfaden für seinen Partner merklich dünner geworden.
Auf dem Highway 61 überholte er einen langsamen Holztransporter und versuchte, Klarheit in seine Gedanken zu bringen. Da war ein leichtes Summen tief in seinem Hirn, ein sorgenvolles Summen, ausgelöst durch Eve Sumners Lächeln. Dieses Lächeln schien direkt aus Waters’ Vergangenheit zu kommen, und das eine Wort, das sie lautlos gesprochen hatte, hallte in einem dunklen Winkel seines Herzens wider. Bald …
»Verdammt«, murmelte er vor sich hin.
»Was?«, fragte Lily.
Er blickte auffällig auf seine Armbanduhr. »Die Jackson-Point-Quelle. Cole hat angerufen und gesagt, es könnte um drei Uhr morgens so weit sein. Wahrscheinlich muss ich die Quelle heute Abend loggen.« Das Loggen war eine der wichtigsten Aufgaben eines Erdöl-Geologen: das Lesen und Auswerten komplexer Messdaten, die ein spezielles Instrument vom Grund einer frisch gebohrten Quelle übermittelte, um festzustellen, ob es dort Öl gab. »Ich muss noch ein paar Dinge im Büro erledigen, bevor ich zum Bohrturm rausfahre.«
Lily seufzte. »Warum fährst du nicht jetzt dort vorbei und holst deine Karten und die Aktentasche? Dann kannst du deine Anrufe von zu Hause aus erledigen.«
Waters wusste, dass sie diesen Vorschlag ohne große Hoffnung gemacht hatte. Es war für ihn eine Art Ritual, seine Zeit alleine zu verbringen, bevor er eine Quelle loggte. Die meisten Geologen hielten es so, und heute war Waters dankbar dafür.
»Ich bin höchstens eine Stunde fort«, sagte er und verspürte einen Stich der Schuld. »Ich setze euch beide ab und komme nach Hause, so schnell ich kann.«
»Oh, Daddy!«, protestierte Annelise. »Du musst mir bei den Hausaufgaben helfen.«
Waters lachte. Seine Tochter brauchte keine Hilfe bei den Hausaufgaben; sie hatte es nur gern, wenn er in der Stunde, bevor sie ins Bett musste, bei ihr saß. »Ich bin zurück, ehe du dich versiehst.«
»Ich weiß, was das heißt.«
»Ich verspreche es.«
Annelises Gesicht hellte sich auf. Ihr Vater hielt seine Versprechen.
Lily und Annelise winkten Waters hinterher, als er von Linton Hill losfuhr – dem Haus, das nicht zum Verkauf stand. Es war ein Haus aus der Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, das Waters fünf Jahre zuvor vom Erlös einer Quelle in Franklin County gekauft hatte. Linton Hill war kein Palast wie Dunleith oder Melrose, aber es hatte fast 400 Quadratmeter Wohnfläche, einstige Sklavenunterkünfte, die getrennt vom Haupthaus standen und die Waters als Zweitbüro benutzte, sowie viele kleine, architektonisch bedeutsame Details. Seit sie eingezogen waren, hatte Lily einen Feldzug geführt, um das Haus in die Liste denkmalgeschützter Gebäude aufnehmen zu lassen, und der Sieg schien kurz bevorzustehen. Waters, der in einem Schindelhaus knapp einen Kilometer von Linton Hill entfernt aufgewachsen war, betrachtete sein Zuhause normalerweise voller Stolz. Doch als er heute in den Innenspiegel blickte, nahm er das Haus kaum wahr. Sobald Lily mit Annelise die Treppe hinaufstieg, eilten seine Gedanken dorthin, wohin es sie seit zehn Minuten zog.
»Alles nur Einbildung«, murmelte Waters.
Doch der alte Schmerz war wieder erwacht. Er schlummerte seit zwei Jahrzehnten, überlebte aber hartnäckig, wie ein Tumor, der weder Metastasen bildet noch sich auflöst. Waters trat aufs Gaspedal des Land Cruiser und fuhr in Richtung Innenstadt – nach Norden, wo die Eichen über ihm aufragten wie die Wände eines Tunnels. Die meisten Gebäude waren viktorianische Lebkuchenhäuser, doch es gab auch schlichte Schindeldach-Gebäude, sogar regelrechte Schuppen. Dieser Teil von Natchez ähnelte sehr New Orleans: Villen im Wert von einer halben Million Dollar standen nur einen Steinwurf weit entfernt von baufälligen Reihenhäusern, die nicht einmal dreißigtausend einbringen würden.
Waters bog nach rechts in die Linton Avenue ab, eine schattige, von wohlhabenden Weißen mittleren Alters bewohnte Straße, die in der Nähe des Kleinen Theaters endete. Von hier stieg die Maple Street bis zu dem Steilhang an, der über dem Mississippi aufragte. Dort würde er das Einbahnstraßen-Labyrinth verlassen und in das letzte natürliche Licht dieses Tages eintauchen. Wie biblischer Regen fällt das Sonnenlicht auf Gerechte und Ungerechte gleichermaßen, und in dieser trügerisch schläfrigen Stadt am Fluss fielen die letzten Strahlen stets auf die Touristen, die auf dem Steilhang standen, auf die Trinker, die im Under-the-Hill Saloon an ihrem Whisky nippten, und auf die Toten.
Im Jahre 1822 war der alte Stadtfriedhof aus dem Schatten der St. Mary’s Cathedral auf den hohen Steilhang nördlich der Stadt verlegt worden, ein halber Quadratkilometer hügeliges Gelände. Im Laufe des nächsten Jahrhunderts entwickelte er sich zu einem der schönsten und einzigartigsten Friedhöfe der Südstaaten. Durch die Tore dieses Friedhofs lenkte John Waters nun seinen Land Cruiser und verlangsamte die Fahrt auf Schritttempo. Einige der Grabsteine, an denen er vorbeifuhr, sahen neu aus, andere schienen bereits ein, zwei Jahrhunderte zuvor gemeißelt worden zu sein; wahrscheinlich war es tatsächlich so. Überreste des alten Friedhofs waren ausgegraben und nach hier verbracht worden, sodass Grabsteine aus dem 18. Jahrhundert keine Seltenheit waren. Waters parkte den Land Cruiser auf dem Hügelkamm von Jewish Hill, stieg aus und blickte hinunter auf sechs atemberaubende Flusskilometer.
Schon lange hatten die Toten in Natchez einen schöneren Blick als die Lebenden. Die Aussicht von Jewish Hill berührte jedes Mal irgendetwas tief in Waters’ Innerem. Der Fluss ließ keinen unberührt, der in seiner Nähe lebte; Waters hatte schon ungebildete Bohrarbeiter mit unbeholfener Beredtheit von der mystischen Anziehungskraft des Mississippi sprechen hören. Dennoch betrachtete er den schlammigen Fluss anders als die meisten Menschen. Der Mississippi war ein uralter Strom, doch er hatte sein bisheriges Leben nicht damit verbracht, sich in den Kontinent zu graben wie der Colorado. Der Mississippi hatte das Land, das ihn nun einzuengen versuchte, selbst geschaffen. Vor 250 Millionen Jahren war dieser Teil Amerikas – von der Golfküste bis nach St. Louis – ein Meer gewesen, das man Mississippi Embayment nannte. Doch irgendwo nördlich von Memphis hinterließ der namenlose Proto-Mississippi zu dieser Zeit bereits Millionen Tonnen Ablagerungen in diesem vorzeitlichen Meer und schuf so ein riesiges Delta. Dieser Prozess setzte sich so lange fort, bis das Meer gefüllt war und 12.000 Meter Sedimente die Felssohle bedeckten. Es waren die oberen Schichten dieser Ablagerungen, von denen Waters seine Familie ernährte: das ölhaltige Stratum, das nur ein paar tausend Fuß unter der Erdoberfläche zu finden war. Heute Abend würde er knapp 50 Kilometer flussabwärts Bohrproben hinaufholen, die einen winzigen Teil jener Geschehnisse preisgeben würden, die sich hier vor 60 Millionen Jahren abgespielt hatten. Verglichen mit solchen zeitlichen Dimensionen war die viel gepriesene Geschichte seiner Heimatstadt – sie reichte die nach menschlichen Maßstäben respektable Zahl von immerhin dreihundert Jahren zurück – ein Wimpernschlag.
Doch selbst aus der Sicht eines Geologen war Natchez einzigartig. Der Steilhang, auf dem die Vorkriegs-Stadt stand, war nicht durch den Fluss, sondern durch den Wind geschaffen worden. Äolische Ablagerung nannte man das: Lössboden. Natchez teilte dieses seltene Phänomen mit Gegenden in China und Österreich und zog Wissenschaftler aus der ganzen Welt an. Manchmal, nach starkem Regen, glitten ganze Abschnitte des Steilhangs wie Erdrutsche auf den Fluss zu, und im Laufe der letzten paar Jahre hatten Pioniere der Armee einen massiven Kampf gefochten, den Hang zu befestigen. Die Bürger, die entlang diesem von Kudzu-Pflanzen bewachsenen Abhang lebten, hielten hartnäckig an ihren Häusern fest, wie die Randfiguren eines Krieges – menschliche Metaphern für den Glauben, der die Stadt in guten wie in schlechten Zeiten am Leben gehalten hatte.
Waters wandte sich vom Fluss ab und ließ den Blick über das Reich aus weißen Obelisken, Mausoleen, Statuen und Grabsteinen schweifen, die sich über die sanften Hügel ausbreiteten. Man hätte mühelos eine Woche damit verbringen können, dieses Reich zu erkunden, ohne die zahllosen Geschichten, die zu den Gräbern gehörten, auch nur zu erahnen. Die Nachnamen auf den Steinen waren in der Stadt immer noch verbreitet; manche reichten sieben Generationen zurück. Natchez war die älteste Siedlung am Mississippi, und obwohl die Stadt Zeugin vieler Veränderungen geworden war – die Namen waren gleich geblieben. Inmitten der Grabmäler, jedes ein Prüfstein der Erinnerung, überwältigte Waters wieder einmal die Einsicht, wie inzestuös kleine Städte im Allgemeinen und Natchez im Besonderen waren.
Auf seinen Schultern bildete sich Gänsehaut. Er ging von Jewish Hill hinunter zum protestantischen Teil des Friedhofs und ließ dabei den Blick über die Grabsteine wandern. Er stieg einen steilen Hügel hinunter und durchquerte eine Reihe knorriger Eichen. Sein Blick fand beinahe sofort, was er suchte. Ihr Stein war leicht auszumachen: schwarzer Alabama-Marmor, mit gräulichem Weiß geädert. Er überragte die umliegenden Steine um gut einen Meter. Tief eingemeißelt in seine spiegelglatte Oberfläche waren große römische Lettern, die aussahen, als könnten sie schon tausend Jahre dort sein.
MALLORY GRAY CANDLER
Miss Mississippi 1982
Als Waters sich dem Stein näherte, wurden die kleineren Buchstaben deutlich erkennbar.
* Natchez, Mississippi, 5. Februar 1960
† New Orleans, Louisiana, 8. August 1992
»Das Licht, das doppelt so hell brennt,
brennt nur halb so lange.«
Er blieb stehen und stand schweigend vor der schwarzen Tafel. Er besuchte den Friedhof ziemlich oft, aber an diesem Grab war er noch nie gewesen. Bei der Familie war er unerwünscht, und er selbst hatte nicht das Bedürfnis, hierher zu kommen. Seinen Abschied von Mallory Candler hatte er längst schon genommen, und es hatte ihn beinahe das Leben gekostet. Deshalb überraschte ihn jetzt die Inschrift. Das Zitat stammte aus Blade Runner, einem Film, den Mallory mit Waters zusammen gesehen hatte. Der Satz hatte ihr so gut gefallen, dass sie ihn in ihr Tagebuch geschrieben hatte. Wahrscheinlich hatte ihre Familie ihn dort nach ihrem Tod entdeckt und beschlossen, dass er ihre Persönlichkeit traf – und so war es auch. Dass Mallory Candler sich provokative Filme wie Blade Runner angesehen hatte, während ihre Altersgenossinnen bei Endless Love dahinschmolzen oder die Tänze aus Flashdance übten, sprach Bände über sie; es war eine ihrer Eigenschaften, die nur wenige gekannt hatten. Mallory spielte die typische Südstaatenschönheit so perfekt, dass Waters seines Wissens der Einzige war, der die vielschichtige Frau hinter dieser Fassade kennen gelernt hatte. Er war sich fast sicher, dass ihr Ehemann sie nicht wirklich gekannt hatte.
In dem Jahr, als Mallory die Krone der Miss Mississippi trug, sagte sie zu Waters, sie fühle sich manchmal wie die schöne Androidenfrau in Blade Runner – perfekt ausgebildet, erfahren und scheinbar makellos, sodass ihr eigener Realitätssinn sie verließ. Übrig blieb ein Automat, der durch das Auf und Ab des Lebens ging, ohne etwas zu fühlen, und der sich fragte, ob womöglich sogar seine Erinnerungen erfunden waren. Einige Pflichten ihres Amts hatten Mallory wirklich etwas bedeutet – die Krankenhäuser, die Heime für geistig behinderte Kinder, die wahren Dinge –, doch die Feiern zur Eröffnung von Läden und Autohäusern ließen sie ungerührt, ja, deprimierten sie.
Waters kniete am Rand des Grabs und legte die rechte Hand flach aufs Gras. Keine zwei Meter unter seiner Handfläche lag der Körper, mit dem er hunderte Male geschlafen hatte, manchmal sanft, manchmal wild und mit einer verzweifelten Leidenschaft, die sich nicht stillen ließ. Wie konnte dieser Körper jetzt kalt und reglos dort liegen? Waters war 41, Mallory wäre jetzt 42. Ihr Körper war 42, wurde ihm bewusst, doch das Verstreichen der Zeit bedeutete für sie jetzt nur noch Verfall. Morbide Gedanken, aber wie konnte er sonst an sie denken, hier, unter dem ausdruckslosen und unbarmherzigen Starren dieses Steins? Vor zwanzig Jahren hatten sie sich oft hier auf dem Friedhof geliebt. Sie hatten einander durch die Tunnel im hohen Gras gejagt, weglose Pfade, von einer Armee alter schwarzer Männer mit Rasenmähern geschaffen, und waren einander in die Arme gefallen, unter der hellen Sonne und begleitet vom Summen der Grashüpfer, das Leben bejahend inmitten des Todes.
»Zehn Jahre tot …«, murmelte er.
In der emotionalen Talsohle, in die ihn diese unerwartete Trauer versetzte, stiegen unzählige Bilder wie Luftblasen aus seinem Unterbewusstsein empor. Die ersten ließen ihn erschauern, denn es waren die gewohnten, lebendigen Bilder voller Gewalt und Blut. Normalerweise verschloss sich Waters vor diesen Bildern und unterdrückte damit auch alle anderen Erinnerungen. Aber heute leistete er keinen Widerstand, denn hier, im Schatten dieses Steins, war die Realität unübersehbar: Mallory Candler war tot. Hier konnte er sich den furchtbaren Erinnerungen stellen, die er sonst im Verborgenen hielt, da sie ihn an die Gefahr erinnerten. Daran, dass Mallory zweimal versucht hatte, ihn zu töten – und es vielleicht wieder versucht hätte. Oder, schlimmer noch, dass sie seiner Frau etwas angetan hätte, wie sie ihm gedroht hatte.
Doch an diesem ruhigen Ort stiegen auch weniger blutrünstige Erinnerungen in ihm auf. Er konnte Mallory sehen, wie er sie am Anfang gekannt hatte. Am deutlichsten erinnerte er sich an ihre Schönheit und ihren elan vital, denn beides war untrennbar verbunden. Das Erste, das man wahrnahm, war ihr Haar: eine prachtvolle, mahagonifarbene Mähne, schimmernd und geschmeidig und akzentuiert von einer glänzenden kupferfarbenen Strähne, die vom Scheitel bis zu den Schulterblättern reichte. Jeder, der diese Strähne sah, hielt sie für gefärbt, doch sie war natürlich gewesen, in Mallorys Genen angelegt, ein gottgegebenes Zeichen für die Unberechenbarkeit ihrer Natur. In einer Menschenmenge war Mallory nicht zu übersehen. Im Wäldchen des Ole Miss College konnte sie von hundert Verbindungsschwestern umgeben sein – die Sonne würde sich genau diese flammende Haarsträhne ausersehen, die cremefarbene Haut, die rosa Lippen und die grünen Augen, und würde Mallory aus den anderen hervorheben wie ein Scheinwerfer die Primaballerina eines Balletts. Hoch gewachsen, ohne unbeholfen zu sein, üppig, ohne rundlich zu sein, und stolz, ohne arrogant zu wirken, zog Mallory Menschen mit einer mühelosen, aber unerbittlichen Macht an. Waters fragte sich oft, wie er in der gleichen Stadt wie Mallory hatte aufwachsen können, ohne sie vorher bemerkt zu haben. Doch sie hatten verschiedene Schulen besucht, und eine Einwohnerzahl von 25.000 (die Stadt war damals größer gewesen) machte es gerade eben möglich, einige Menschen nicht zu kennen, die das Kennenlernen wert gewesen wären. Darüber hinaus besaß Mallory eine Eigenschaft, die sie mit sehr wenigen Frauen ihrer Generation teilte: ein majestätisches Auftreten. Sie bewegte sich mit so vollkommener Körperbeherrschung und Selbstsicherheit, als wäre sie am Hofe eines Königs aufgewachsen – und dies veranlasste Männer und Frauen, sie mit Achtung zu behandeln.
Als Waters an ihre Anmut dachte, konnte er sie beinahe vor sich sehen. Er war schon immer der Meinung gewesen, dass William Faulkner seine bedeutendsten Worte nicht in einem seiner Romane niedergeschrieben, sondern in einem in Paris geführten Interview gesagt hatte: Die Vergangenheit ist niemals tot; sie ist nicht einmal vergangen. Jeder aus Mississippi verstand das. Vielleicht wurde jeder Mann in einem gewissen Maße von seiner ersten großen Liebe verfolgt. Für Marcel Proust war es ein Geruch gewesen, der wie eine Zeitmaschine wirkte und die Vergangenheit plötzlich in die Gegenwart katapultierte. Für Waters waren es ein Lächeln und ein Wort. Bald …
Er starrte auf den Grabstein und hatte das Gefühl, der Stein sähe irgendwie schwärzer aus, bis ihm klar wurde, dass die Dämmerung eingesetzt hatte. Er blickte über die Schulter auf die Kudzu-Pflanzen, von denen einige Bäume entlang der Friedhofsstraße stranguliert wurden. Ein halbrunder Mond stand bereits hoch am violetten Himmel; bald würde die Sonne unter den Rand des Steilhangs sinken. Die Pforten des Friedhofs wurden in der Regel um 19 Uhr geschlossen, aber das war keine feste Zeit. Wenn man sich in der Dämmerung noch innerhalb der Friedhofsmauern befand, sah man stets das rostige Auto der schwarzen Frau, die für das Schließen der Tore verantwortlich war; die Frau selbst saß geduldig auf dem Fahrersitz oder stand neben einem der gemauerten Torpfosten, bediente sich aus ihrem Schnupftabakbeutel und beobachtete die Autos und Laster, die gelegentlich auf der Friedhofsstraße vorüberrollten. Waters wusste, dass sie am »ersten« Tor auf ihn warten würde, wo einst das alte Charity Hospital gestanden hatte. Heute erinnerte nur noch eine große Betonplatte an das alte Krankenhaus, doch bevor es abgebrannt war, hatte das wuchtige Gebäude mit seinen rohrförmigen Feuerleitern den Friedhof überragt und Anlass zu geschmacklosen Scherzen über Ärzte gegeben, die die Leichen der Armen dort hinunterrutschen ließen wie Abfall in einem Müllschlucker.
Waters seufzte und richtete den Blick wieder auf den Grabstein: Gestorben in New Orleans, Louisiana. Er hatte oft über Mallorys Tod nachgedacht und fragte sich, ob die Frau, die einst gesagt hatte, sie verzweifle am Leben, und die mehrmals versucht hatte, Selbstmord zu begehen, gegen den Tod angekämpft hatte. Sein Gefühl sagte ihm, dass es der Fall gewesen war. Die Polizei von New Orleans hatte Haut unter ihren Fingernägeln gefunden. Aber die Familie hatte kein Interesse gehabt, ihm weitere Einzelheiten mitzuteilen, und auch niemand anders aus Natchez erfuhr Näheres. Die Candlers gehörten zu den Familien, die von Äußerlichkeiten krankhaft besessen waren. Typisch für sie, dass sie der Meinung gewesen waren, die Vergewaltigung und Ermordung ihrer Tochter könnte ein schlechtes Licht auf sie werfen, oder auf Mallory selbst – wie die Adligen des Mittelalters, die glaubten, körperliche Makel seien ein Zeichen für Sünde. Waters merkte, dass er mit den Zähnen knirschte. Auch jetzt hatte der Gedanke an Mallorys Eltern noch diese Wirkung auf ihn.
Nun fiel sein Blick zum ersten Mal auf den kleineren Grabstein rechts von dem Mallorys. Er war knapp halb so hoch und schien aus einem billigen Steingemisch zu bestehen; daher war Waters überrascht, den Namen Benjamin Gray Candler darauf zu lesen. Ben Candler war Mallorys Vater. Noch überraschender war, dass der Stein offenbar mit einem schweren Werkzeug, einer Brechstange vielleicht, verunstaltet worden war. Waters ging auf das Grab zu, um es genauer anzuschauen, blieb jedoch stehen, bevor er es erreicht hatte. Der Geruch von Urin schien die Luft um den Grabstein zu durchdringen, als ob dort ein Hund routinemäßig jeden Tag sein Territorium markierte. Es gibt also doch Gerechtigkeit, dachte er. Mallorys Vater hatte einen besonderen Platz der Verachtung in Waters’ Seele, doch jetzt, als er den Stein anblickte, sah Waters nur einen selbstgefälligen Mann vor sich, der mehr als nur eine kleine Schwäche für seine Tochter hatte, der sie penetrant mit seiner allgegenwärtigen Kamera verfolgte und jedes gesellschaftliche Ereignis, egal wie unbedeutend, für die Nachwelt festhielt.
Auf der Straße hörte Waters einen Lieferwagen mit Industrieholz quietschend zum Stehen kommen. Er sah auf die Uhr: Viertel nach sechs. Er war schon zu lange geblieben; seine Frau und seine Tochter warteten zu Hause auf ihn. Auf der anderen Seite der Stadt füllte Cole Smith zwei wichtige Investoren mit Bourbon und Scotch ab, bevor er sie hinunter zur Quelle bringen würde, um Zeugen eines Augenblicks zu werden, der, wie Cole und Waters hofften, ihnen allen einen Haufen Geld einbrachte. Und fünfzig Kilometer weiter südlich, auf einer Sandbank im Mississippi, drillten ein Bohrtechniker und ein Team von Arbeitern einen Bohrer mit Diamant-Spitze die letzten paar Hundert Meter in die Erde, in eine Formation hinein, die Waters vor fünf Monaten vermessen hatte. Sie alle bezogen ihren Lebensunterhalt aus Waters’ Traum. Heute Abend stand eine Menge auf dem Spiel. Dennoch konnte er sich nicht dazu durchringen, das Grab zu verlassen.
Bald …
Mallory und er hatten dieses Wort am College als eine Art Code benutzt, als sie ein Paar geworden waren – beinahe sofort, nachdem sie sich kennen gelernt hatten. Sie hatten jede freie Minute zusammen verbracht, doch im gesellschaftlichen Gefüge des Ole Miss College bedeutete »zusammen« nicht immer »miteinander«. Wann immer sie getrennt, aber dennoch in Sichtweite waren – auf Partys, in den Pausen oder in der Bibliothek-, bildete einer von ihnen das Wort mit den Lippen – bald –, um dem anderen zu sagen, dass es nicht mehr lange dauerte, bis sie einander wieder in den Armen hielten. Bald war ein heiliges Versprechen in der abgöttischen Religion, die sie miteinander gegründet hatten und deren Riten sie in der Dunkelheit von Waters’ Studentenwohnheim, in Mallorys Verbindungshaus oder auf dem College-Parkplatz vollzogen, neben den Autos der anderen, die keinen bequemeren Ort hatten, an den sie gehen konnten.
Bald … Dieses geheime Versprechen von den Lippen einer Fremden geformt zu sehen – einer schönen Frau zwar, aber doch einer Fremden –, hatte Waters bis ins Innerste erschüttert. Im verblassenden Tageslicht kniete er nieder und versuchte sich selbst davon zu überzeugen, dass er Eve Sumners stummes Wort missverstanden hatte. Schließlich hatte sie ja nicht wirklich etwas gesagt; sie hatte nur ein Wort mit den Lippen geformt. Und vielleicht hatte sie ja nicht einmal das getan. Ihr Lächeln allerdings war der offensivste Flirt gewesen, den Waters seit Jahren erlebt hatte. Doch das Wort … war es wirklich bald gewesen? Oder etwas anderes? Was sonst könnte Eve Sumner in diesem Moment gesagt haben? Etwas ganz Banales? Vielleicht war es gar kein Wort gewesen. Jetzt, wo er darüber nachdachte, hatte die Bewegung ihrer Lippen sehr danach ausgesehen, als habe Eve sie bloß gespitzt. Vielleicht hatte sie ihm einen Kuss zugeworfen …? Vielleicht war er zu dumm gewesen, die Geste als das zu erkennen, was sie war.
Evie kommt ziemlich herum, hatte Lily gesagt. Vielleicht war ein gehauchter Kuss Teil von Eve Sumners Annäherungsversuch. Vielleicht hatte sie einem Dutzend Männer in der Stadt dasselbe Lächeln geschenkt, ihnen denselben Kuss zugeworfen. Waters schämte sich plötzlich und kam sich wie ein Trottel vor. Dass etwas so Nichtssagendes ihn veranlasst hatte, zum Friedhof zu fahren und nach den Geistern der Vergangenheit zu suchen … vielleicht litt er zu sehr unter dem Druck der Umweltuntersuchung.
Eigentlich war er nicht der Typ, der leicht etwas missverstand. Er konnte seinen Augen und seiner Intuition trauen. Als er Eves Verhalten noch einmal überdachte, gellte ein langer, klagender Ton über den Friedhof. Er ignorierte ihn, doch das Geräusch wiederholte sich, als wärme ein Hornist sich für den Zapfenstreich am Ende des Tages auf. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel. Waters begriff, dass der vermeintliche Hornist eine Autohupe war: die Frau an der Pforte.
Er stand auf und klopfte sich die Erde von der Hose. In Gedanken war er schon wieder auf dem Rückweg in Richtung Jewish Hill. Aber er stand immer noch am gleichen Fleck. Er konnte Mallorys Grab nicht verlassen ohne … etwas zu tun. Mit einem Gefühl der Leere in der Brust wandte er sich wieder dem schwarzen Stein zu.
»Ich war vorher noch nie hier«, sagte er, und seine Stimme klang merkwürdig in der stillen Dunkelheit. »Und du weißt, dass ich nicht daran glaube, dass du mich hören kannst. Aber … es hätte für dich nicht so enden sollen.« Er hob eine Hand, als könne es irgendwie helfen, dem unbeschreiblichen Kummer in seinem Innern Ausdruck zu verleihen – aber das konnte nichts auf der Welt, und er ließ die Hand wieder fallen. »Du hast etwas Besseres verdient als das hier. Du hast etwas Besseres verdient.«
Er hatte das Gefühl, dass er weiter sprechen sollte, doch seine Stimme versagte, sodass er sich von Mallorys Grabstein abwandte und zwischen den Eichen hindurch zum Jewish Hill und zu seinem Land Cruiser hinaufging, während von der Friedhofspforte die Hupe erschallte wie ein Fanfarenstoß, der ihn zurück in die Gegenwart holte.
2
Auf dem Heimweg vom Friedhof hielt Waters kurz am Büro, um seine geologischen Karten und seine Aktentasche zu holen. Zu Hause erwähnte er seinen kleinen Ausflug Lily gegenüber nicht. Er saß mit Annelise am Küchentisch und studierte die Pläne, von denen er hoffte, dass sie die Bodenstrukturen rund um die Quelle erläuterten, die er heute loggen würde. Während er jeden Schritt seiner geologischen Analyse erneut überprüfte, löste Annelise auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches Rechenaufgaben für die zweite Klasse. Hin und wieder lachte sie über Waters’ ernstes Gesicht, und er lachte mit ihr. Die beiden teilten einen verschwörerischen Sinn für Humor, der Lily manchmal außen vor ließ. Waters fragte sich, ob die Ähnlichkeiten auf genetische Veranlagung oder auf Erziehung zurückzuführen waren. Lily war Diplom-Betriebswirtin mit herausragenden mathematischen Fähigkeiten, doch Annelises Gedanken schienen ihre eigenen verworrenen Wege zu gehen, genau wie die ihres Vaters, wie Lily oft genug hervorhob.
Während Waters und Annelise arbeiteten, saß Lily in ihrer Büronische, wo sie die Haushaltsrechnungen ordnete und einen Brief ans Innenministerium tippte – eine weitere Schlacht in ihrem Feldzug, Linton Hill unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Waters bewunderte ihre Hartnäckigkeit, legte selbst aber keinen großen Wert darauf, eine Messingplakette neben der Eingangstür seines Hauses anbringen zu dürfen. Er hatte Linton Hill gekauft, weil es ihm gefiel, nicht als Symbol für den beinahe feudalen Status, der für große Teile der wohlhabenden Gesellschaft von Natchez so wichtig zu sein schien.
Um halb neun gingen sie nach oben, um Annelise ins Bett zu bringen. Waters kam als Erster wieder herunter, wartete aber am Fuß der Treppe auf Lily, wie jedes Mal. Er machte sich keine Illusionen darüber, was als Nächstes passieren würde: Lily würde ihn steif und ohne Blickkontakt umarmen und dann in ihre Nische zurückkehren, um ihren Brief zu Ende zu schreiben.
Wie an unzähligen Abenden zuvor stand Waters allein in der Diele und fragte sich, was er als Nächstes tun solle. Meist ging er hinaus ins alte Sklavenquartier, das ihm als Büro diente, und arbeitete am Computer, um gegen die Frustration anzukämpfen, die sich seit mehr Jahren, als er sich eingestehen mochte, in ihm aufbaute. Immerhin war diese Frustration zu einer einträglichen Triebkraft geworden; um sie abzubauen, hatte Waters in seiner Freizeit geologische Kartografie-Software entwickelt, die ihm jährlich rund 70.000 Dollar Tantiemen einbrachte. Dies gab ihm das Gefühl, sich zu verwirklichen, doch das zugrunde liegende Problem löste er dadurch nicht.
An diesem Abend fühlte er sich nicht danach, Computercodes zu schreiben oder Investoren anzurufen, wie er es seinem Partner versprochen hatte. Die Begegnung mit Eve Sumner am Nachmittag hatte ihn aufgewühlt. Es war fast unmöglich, die Energie, die sie in ihm freigesetzt hatte, zu unterdrücken. Am liebsten hätte Waters die innere Spannung gelöst, indem er mit seiner Frau schlief. Das war sicher nicht die uneigennützigste Motivation für ehelichen Sex, aber so war nun einmal die Realität. Zugleich aber wusste er, dass es nicht dazu kommen würde, jedenfalls nicht auf annähernd befriedigende Art. Das war schon seit vier Jahren nicht mehr so gewesen. Und auf einmal wusste Waters, dass er die Situation nicht länger ertragen konnte. Die Mauer aus Nachsicht und Geduld, die er so gewissenhaft errichtet hatte, brach zusammen.
Er verließ die Diele und trat durch die Hintertür hinaus auf die Veranda, doch er begab sich nicht zum Sklavenquartier, sondern stand da in der Kühle des Abends, blickte die alte Zisternenpumpe an und dachte darüber nach, wie Lily und er in diese Sackgasse geraten waren. Rückblickend schien die Abfolge der Ereignisse das Gewicht der Unausweichlichkeit zu besitzen. Annelise war 1995 geboren; Schwangerschaft und Geburt waren normal verlaufen. Im darauf folgenden Jahr versuchten sie es noch einmal, und Lily wurde sofort schwanger. Dann, im vierten Monat, erlitt sie eine Fehlgeburt. Es geschah auf einer Party, und die Nacht im Krankenhaus war lang und schrecklich. Der Fötus war männlich gewesen, was Lily besonders hart getroffen hatte, weil sie das Kind nach ihrem Vater hatte nennen wollen, der damals schon schwer krank gewesen war. Drei Monate nach der Fehlgeburt starb er. Lily litt unter Depressionen und Schwermut und wurde mit Zoloft behandelt. Sie hatten weiterhin gelegentlich Sex, doch Lilys Leidenschaft war dahin. Waters sagte sich, dass es eine Nebenwirkung der Medikamente sei, und Lilys Arzt gab ihm Recht. Nach zwei schwierigen Jahren erklärte sie, dass sie bereit sei, es noch einmal zu versuchen. Sie setzte die Medikamente ab, begann Sport zu treiben und gut zu essen, und sie schliefen jede Nacht miteinander. Drei Wochen später war sie schwanger.
Alles schien in Ordnung zu sein – bis ein Labortest zeigte, dass Lilys Blut Antikörper gegen das Blut des Embryos bildete. Lily war Rhesus negativ, das Baby Rhesus positiv; es war eine so schwere Unverträglichkeit, dass Lilys Blut das ihres Babys mit gefährlicher Geschwindigkeit zu zerstören begann. Die Schwangerschaft mit Annelise hatte Lily gegenüber Rhesus-positivem Blut sensibilisiert, doch erst in den darauf folgenden Schwangerschaften hatte die Krankheit ihr zerstörerisches Potenzial voll entwickelt, und es wurde jedes Mal schlimmer. Die Injektion eines Medikaments namens RhoGAM hätte die Rhesusfaktor-Krankheit bei späteren Schwangerschaften verhindern sollen, doch aus irgendeinem unbekannten Grund war es fehlgeschlagen.
Lily und Waters fuhren wieder und wieder die 160 Kilometer zum University Hospital in Jackson, um Mutter und Fötus behandeln zu lassen, erst mit einer erschöpfenden Menge von Fruchtwasserentnahmen und schließlich mit einer intrauterinen Transfusion, um das Baby, das ums Überleben kämpfte, mit frischem Blut zu versorgen. Diese erstaunliche Prozedur funktionierte zwar, brachte aber nur einen Aufschub von wenigen Wochen. Wenn das Baby die Schwangerschaft überleben sollte, waren weitere Transfusionen nötig – bis zu fünf. Als Lily sich bei ihrer nächsten Ultraschalluntersuchung auf den Behandlungstisch legte, blickte der Arzt auf den Computerbildschirm und horchte auf die Herztöne des Babys; dann legte er den Ultraschall-Stab hin und sah Waters mit bedeutungsvollem Blick in die Augen. Waters stockte das Herz.
»Was ist?«, fragte Lily. »Stimmt was nicht?«
Der Arzt drückte sanft ihren Oberarm; dann sagte er im mitfühlendsten Tonfall, den John Waters jemals aus dem Mund eines Mannes gehört hatte: »Lily, Sie werden das Baby verlieren.«
Lilys Körper verkrampfte auf dem Untersuchungstisch. Dem Arzt stand der Schmerz ins Gesicht geschrieben, er wusste, wie viel Gefühl Lily in das Kind investiert hatte. Und eine weitere Schwangerschaft war medizinisch unmöglich.
»Was reden Sie da?«, fragte Lily. »Woher wissen Sie das?« Plötzlich wich alle Farbe aus ihrem Gesicht. »Sie meinen … er ist schon tot? Jetzt?«
Der Arzt sah Waters Hilfe suchend an, doch Waters hatte keine Ahnung, was für Notfall-Prozeduren es gab. Er wusste, dass sie sich in einer jener Situationen befanden, auf die ein Medizinstudium nicht vorbereitete.
»Der Herzschlag des Fötus verlangsamt sich«, sagte der Arzt. »Das Baby leidet bereits unter Hydropsie.«
»Was ist das?«, fragte Lily mit zitternder Stimme.
»Herzversagen.«
Lily rang nach Atem. Waters drückte ihre Hand; Furcht und Hilflosigkeit schnürten ihm die Kehle zu. Er hatte mehr Angst um Lily als um das Baby.
»Tun Sie doch etwas!«, schrie Lily den fassungslosen Arzt an. Dann wandte sie sich an ihren Mann. »Tu etwas!«
»Er kann nichts tun«, sagte der Arzt mit sanfter Stimme, die Waters verriet, dass er soeben eine schmerzliche Lektion über die Grenzen seines Berufsstandes lernte.
Lily starrte auf das unscharfe Bild auf dem Monitor; in ihren Augen war jetzt mehr Weiß als Farbe zu sehen. »Sitzen Sie nicht einfach da, verdammt! Tun Sie etwas! Entbinden Sie jetzt gleich!«
»Er kann außerhalb Ihres Körpers nicht überleben, Lily. Seine Lungen sind noch nicht entwickelt. Und in Ihrem Körper kann er ebenfalls nicht überleben. Es tut mir Leid.«
»Holen … Sie … ihn … RAUS!«
In den vier Jahren seit diesem Tag hatte Waters nicht gewagt, darüber nachzudenken, was anschließend passiert war – nicht mehr als ein oder zwei Mal jedenfalls. Lilys Mutter, die im Flur gesessen und eine Zeitschrift gelesen hatte, kam hereingestürmt, als Lily zu schreien begann. Der Arzt bemühte sich nach Kräften, die Situation zu erklären, und Lilys Mutter tat, was sie konnte, um ihre Tochter zu trösten. Doch in den zehn Minuten, die es dauerte, bis das Herz von Waters’ ungeborenem Kind zu schlagen aufhörte, zerbrach auch das Herz seiner Frau. Dieser Anblick hatte ihn damals jeder Manneskraft beraubt – und so war es auch heute noch, wenn er der Erinnerung an diese Stunden freien Lauf ließ. Auf diese Weise hatte er die letzten vier Jahre ohne sexuelle Intimität überlebt: indem er das Grauen dieses Tages niemals ganz aus seinen Gedanken verbannte. Lily war so schwer verwundet worden wie ein Soldat, dem man in die Brust geschossen hatte, auch wenn die Wunde nicht sichtbar war, und es war Waters’ Pflicht als ihr Mann, mit den Folgen zu leben.
Das Klingeln des Telefons drang schwach durch die Verandatür. Dann hörte er Lily seinen Namen rufen, ging in den Anbau und hob den Hörer ab.
»Hallo?«
»Verdammt noch mal, John Boy!«
Niemand außer Cole Smith durfte Waters so nennen, und Cole hörte sich an, als hätte er bereits eine Menge Scotch intus.
»Wo bist du?«, fragte Waters.
»Billy Guidraux und Mr Hill Tauzin sitzen mit mir in meinem Lincoln Continental. Wir sind fünfzehn Kilometer südlich von Jackson Point. Glaubst du, diese vierrädrige Luxusjacht schafft es unbeschadet bis zum Bohrturm?«
»Es hat seit ein paar Tagen nicht mehr geregnet. Du dürftest keine Schwierigkeiten haben. Falls du doch stecken bleibst, sind Dooleys Jungs nahe genug, um dich herauszuziehen.« Dooleys Trupp war das Bulldozer-Team an der Ölquelle.
»Das dachte ich auch. Wann kommst du?«
Waters antwortete nicht gleich. Normalerweise wartete er immer, bis der Bohrtechniker anrief und ihm sagte, dass die Endtiefe erreicht war und sie damit begannen, den Bohrer nach oben zu ziehen; erst dann machte Waters sich auf den Weg zum Bohrturm. Auf diese Weise musste er weniger Zeit damit verbringen, Dinge zu tun, die er ungern tat. In den Logging-Nächten – jedenfalls in den letzten paar – redete Cole normalerweise viel dummes Zeug, während die Investoren herumstanden und Waters nervöse Blicke zuwarfen, in der Hoffnung, der einzige Geologe in der Gruppe konnte ihnen bestätigen, dass sie ihre Dollars bei dem Geschäft nicht zum Fenster hinausgeworfen hatten. Doch heute Abend wollte Waters nicht allein in seinem stillen Haus sitzen und warten.
»Ich fahre jetzt gleich los«, sagte er Cole.
»Sehr gut!«, rief Cole erfreut. »Der Felsmann bricht mit Gewohnheiten. Das ist ein Zeichen. Du musst eine Vorahnung haben, was diese Quelle betrifft.«
»Felsmann« oder »Rock« – Waters hasste diese Spitznamen, doch viele Geologen waren solchen Namen ausgeliefert, und wenn Cole betrunken war, gab es nichts, was Waters dagegen tun konnte. Es hatte eine Zeit gegeben, als Cole sich nicht in die Karten hatte schauen lassen, aber damals hatte er den Alkohol noch viel besser vertragen. Oder er trank jetzt mehr als früher. So sehr der Druck der Umweltuntersuchung auf Waters lastete – seinem Partner war die Sache verdammt an die Substanz gegangen.
»In einer Dreiviertelstunde bin ich da«, sagte er kurz angebunden.
Bevor er auflegen konnte, hörte er raues Gelächter durch den Continental klingen, dann senkte Cole die Stimme auf halbe Lautstärke.
»Was glaubst du, John? Kannst du mir irgendwas sagen?«
»Im Augenblick weiß ich genauso viel wie du. Es ist dort, oder ist es nicht. Und wenn es dort ist, dann …«
»… dann ist es seit zwei Millionen Jahren dort, oder ist es eben nicht«, beendete Cole genervt den Satz. »Verdammt, du bist langweilig.« Plötzlich sprach er wieder in seiner üblichen Tonlage. »Entspann dich, Felsmann. Komm hierher, und trink einen mit uns.«
Waters legte auf; dann sammelte er seine Karten, die Messbücher und seine Aktentasche zusammen. Er küsste Lily auf den Scheitel, während sie arbeitete. Ihre einzige Reaktion war ein gedankenverlorenes Achselzucken.
Er ging hinaus zum Land Cruiser und ließ den Motor an.
Als Waters noch sieben Kilometer von der Bohrstelle entfernt war, sah er den Turm vor dem Nachthimmel aufragen wie ein hohes, schlankes Raumschiff, das in der Dunkelheit neben dem größten Strom des Landes gelandet war. Der Stahlturm ragte mehr als 30 Meter in die Höhe, seine gigantischen Streben waren mit blauweißen Lichtern besetzt. Darunter befand sich der metallene Unterbau, wo Männer mit freiem Oberkörper und Schutzhelmen mit Ketten arbeiteten, die sie in einer einzigen unachtsamen Sekunde in Stücke reißen konnten. Der Boden unter der Plattform war ein Meer aus Schlamm und Holzplanken, durch das sich hydraulische Rohre schlängelten, und ein wenig abseits stand die »Hundehütte«, das mobile Büro des Bohrtechnikers. Die ganze Szenerie war in ein unwirkliches Zwielicht getaucht, und das brüllende Lärmen der Pumpen und Generatoren rollte über die Sandbank und den kilometerbreiten Fluss hinweg wie Pattons Panzer, als sie zum Rhein gerollt waren.
Waters’ Herz schlug höher, als er sich dem Bohrturm näherte. Dies war seine sechsundvierzigste Ölquelle, aber der Nervenkitzel war nicht verflogen. Der Bohrturm vor ihm war ein greifbares Symbol für seine Willensstärke. Früher hatte es siebzig Ölfirmen in Natchez gegeben, jetzt gab es noch sieben. Hinter dieser schlichten Statistik verbargen sich mehr Seelenqual und zerbrochene Träume, als Worte es beschreiben konnten – sie resümierte den Niedergang einer Stadt. Herbe Rückschläge waren eine Art Lebensstil in der Ölbranche, aber die letzten acht Jahre waren besonders hart gewesen. Nur die zähesten Unternehmer hatten überlebt, und Waters war stolz, dass er zu ihnen gehörte.
Er lenkte den Wagen auf eine Straße aus frisch aufgehäufter Erde, die vor zehn Tagen noch nicht existiert hatte. An dieser Stelle hatte man nichts weiter hören können als die Grillen und den Wind, nichts weiter sehen können als das Mondlicht, das sich im Fluss spiegelte. Vielleicht hatte eine lange Reihe flacher Lastkähne, die hier den Fluss entlang geschoben wurden, die weiße Gischt sanft ans Ufer getrieben, und das Land hatte noch so unberührt gewirkt wie in jenen längst vergangenen Zeiten, als es noch keine Menschen auf Erden gab. Vor sieben Tagen jedoch waren die Bulldozer gekommen – auf Waters’ Geheiß. Und die Männer. Jedes Tier im Umkreis von vielen Kilometern wusste, dass etwas geschah. Die Dieselmotoren, von denen die riesenhaften Maschinen am Bohrturm angetrieben wurden, waren angelassen worden und seither nicht mehr verstummt, während Männer rund um die Uhr daran arbeiteten, den Bohrkopf weiter und weiter hinunterzutreiben, bis in jene Tiefe, in der John Waters ihn haben wollte.
Eine Ölquelle anzubohren bedeutete unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Menschen. Selbst für Waters, der über zahllosen Karten und Büchern mit Messdaten gebrütet und die versteckten Sandvorkommen kartografiert hatte, hatte es unterschiedliche Bedeutungen. Zunächst einmal war es Wissenschaft. Zweieinhalbtausend Meter unter diesem Land gab es Öl, doch eine einfache Möglichkeit, herauszufinden, wo genau sich dieses Öl befand, gab es nicht – nicht einmal mithilfe der unbezahlbaren Technologie, die Firmen wie Exxon oder Oxy Petroleum zur Verfügung stand. Letztlich musste immer noch jemand ein Loch durch zahllose Schichten aus Erde, Sand, Schiefer, Kalkstein und Braunkohle bohren – bis hinunter zu dem weichen Sand, der manchmal das ansonsten wandernde Öl einschloss, das vor sechzig Millionen Jahren das Oberflächenleben des Planeten gewesen war. Und zu wissen, wo man dieses Loch bohren musste, war eine Lebensaufgabe.
In den Vierziger- und Fünfzigerjahren war es nicht so schwer gewesen. Damals war in Adams County reichlich Öl vorhanden, und es gab viele Burschen, die mehr Mut als Verstand besaßen; sie hatten bloß Geld zusammengekratzt, an irgendeiner Stelle gebohrt, bei der sie »so ein Gefühl« hatten, und nicht selten das große Los gezogen. Aber diese Zeiten waren vorüber. Adams County hatte jetzt mehr Löcher als das Nadelkissen einer Großmutter, und die ergiebigsten Ölfelder waren bereits entdeckt und ausgebeutet worden. Das zumindest besagte das konventionelle Wissen. Waters und ein paar andere waren jedoch der Ansicht, dass es noch ein oder zwei bedeutende Felder gab. Keine wirklich großen Vorkommen nach saudischen Maßstäben oder im Vergleich zu dem, was man vor der Küste der USA finden konnte, aber doch ausreichend, um einem Jungen aus Mississippi mehr Geld einzubringen, als er jemals in seinem Leben ausgeben könnte. Genug, um seine Erben und Nachfolger für alle Ewigkeiten zu versorgen. Aber diese Ölfelder – falls sie existierten – waren nicht leicht zu finden. Kein Wildcat-Ölbohrer würde seine F-150 parken, in einem Sojabohnenfeld Wasser lassen und dann plötzlich mit religiöser Inbrunst rufen Hier ist es!, bevor die ganz große Quelle zu sprudeln begann. Man brauchte dafür Wissenschaftler wie Waters, und das war einer der Gründe, warum er weitermachte.
Seine andere Motivation war simpler, aber auch ein wenig peinlich einzugestehen: eine jungenhafte Faszination für die Schatzsuche. Denn an einem gewissen Punkt endete die Wissenschaft, und man musste sich auf sein Gefühl verlassen: Man malte einfach ein X auf eine Karte und ging los, um etwas auszugeben, das dort wartete, seit auf diesem Planeten Dinosaurier umherwanderten. Andere Männer versuchten, den gleichen Schatz zu finden, mit den gleichen Mitteln; manche von diesen Männern waren feine Kerle, andere waren Piraten wie diejenigen, die in der Karibik immer noch ihr Unwesen trieben.
Waters’ Land Cruiser rumpelte über ein paar zerbrochene Holzbalken, dann bog er in den offenen Bereich der Bohrstelle ab. Er parkte ein Stück von den anderen Fahrzeugen entfernt; dann stieg er mit seiner Aktentasche und seiner Kartenröhre aus dem Wagen und lief auf den silbernen Lincoln zu, der neben dem Schlumberger Messgeräte-Truck parkte. Das Innenlicht des Wagens beleuchtete drei Personen: zwei vorn, eine auf der Rückbank. Cole Smith saß am Steuer. Sobald er Waters entdeckte, würde die Autotür aufspringen, eine Dunstwolke aus Bier und Whiskey würde ins Freie strömen, und der Zirkus konnte beginnen. Im Gehen atmete Waters die verschiedensten Gerüche ein: Flusswasser, Schlamm, Kudzu, Pipeline-Rohre und Dieselkraftstoff. Kein angenehmer Geruch, aber er stimulierte die Sinne, wenn man wusste, wofür er stand.
Plötzlich flog die Fahrertür des Lincoln auf, und die Stoßdämpfer hoben den Wagen ein gutes Stück, als Cole Smith in Khakihose, Polohemd und Baseballmütze ausstieg. Cole war am College Sportler gewesen, doch in den Jahren, die seither vergangen waren, hatte er auf üppige hundertzwanzig Kilo zugelegt. Ihm stand das Gewicht – manche Frauen fanden ihn immer noch attraktiv. Doch wenn Waters in sein Gesicht blickte, sah er Coles Gesundheit in Besorgnis erregendem Tempo schwinden. Der Alkohol hatte seinen Tribut gefordert, und in seinen Augen lag ein dunkles Leuchten, ein gehetzter Ausdruck, der vor fünf Jahren noch nicht da gewesen war. Früher hatte ansteckender Optimismus aus diesen Augen gestrahlt, eine unwiderstehliche Kraft, die besonnene Männer dazu brachte, Risiken einzugehen, von denen sie normalerweise nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Aber etwas – oder die Kombination mehrerer Dinge – hatte Cole verändert.
»Hier ist Rock, der Felsmann, Jungs!«, rief Cole und klopfte mit seiner fleischigen Hand auf Waters’ Schultern. »Hier ist der Medizinmann!«
Das müssen die Landeier sein, dachte Waters, als die beiden hohen Besucher Cole aus dem Lincoln folgten. In der Regel war er niemals abfällig gegenüber Investoren, aber diese beiden sahen aus, als hätten sie es verdient. Es hatte eine Zeit gegeben, als Cole und er nur guten Freunden erlaubt hatten, sich in ihre Ölquellen einzukaufen, aber das Geschäft war zu hart geworden, um wählerisch zu sein. Heutzutage verließ er sich darauf, dass Cole das Geld auftrieb, um die Bohrungen zu finanzieren, und Coles Finanzquellen waren zu zahlreich – und manchmal zu nebulös –, um genauer darüber nachzudenken. Die Ölbranche zog jede Art von Investoren an, von Zahnärzten über Mafiosi bis hin zu Milliardären. Gemeinsam war ihnen allen der Traum vom leicht verdienten Geld – und das war der Unterschied zwischen ihnen und Cole Smith auf der einen Seite und Waters auf der anderen. Trotzdem schüttelte Waters den Investoren die Hände, zwei dunkelhaarige Männer in den Fünfzigern, die mit Cajun-Akzent sprachen und schielten, und prägte sich ihre Vornamen ein, wenn auch nur für diesen Abend.
»Wir fühlen uns alle großartig«, sagte Cole, und das Lächeln war in seinem Gesicht festgefroren. »Wie fühlst du dich, John Boy?«
Waters zwang sich, nicht zusammenzuzucken. »Wir haben eine reale Chance. Deshalb sind wir hier.«
»Was ist das Maximum?«, fragte einer der Cajuns, ein Bursche namens Billy.
»Nun, wie Sie in unserem Prospekt lesen können …«
»Ach, zur Hölle«, unterbrach Cole. »Wir loggen dieses Baby in ein paar Stunden, Rock. Sag schon, was könnte als Maximum herauskommen?«
Es war kein Gespräch, das man vor Investoren führen sollte, und Waters setzte sein Pokerface auf. In zwei Stunden würden sie möglicherweise auf die Messergebnisse eines trockenen Bohrlochs blicken, und Zorn und Enttäuschung der Investoren würde in direkt proportionalem Verhältnis dazu stehen, wie hoch man ihre Hoffnungen geschraubt hatte.
Waters beschränkte sich vorsichtig darauf, über die geologische Struktur zu sprechen. »Wenn wir Glück haben, könnte es ein bedeutendes Vorkommen sein. Aber genauer kann ich es Ihnen nicht sagen. Schließlich suchen wir etwas, das bisher niemand gefunden hat.«