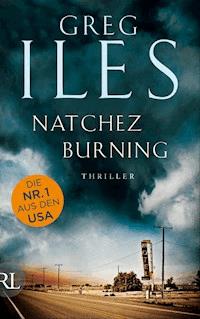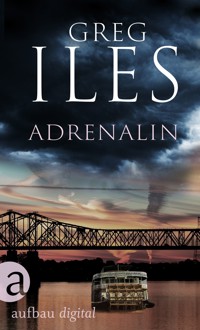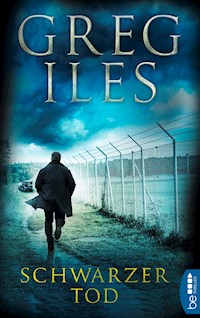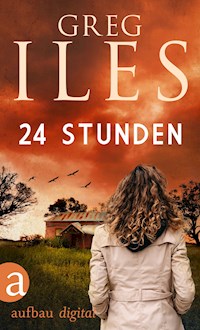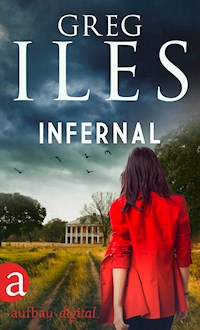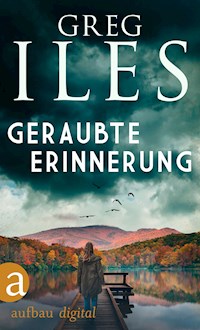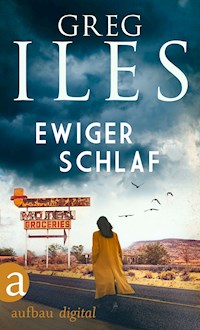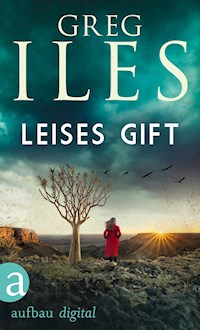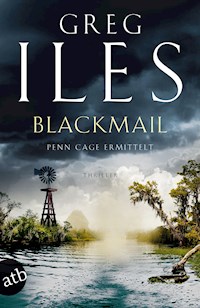4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Penn Cage Thriller!
Penn Cage kennt den Tod wie seine Westentasche: Als Staatsanwalt in Houston hat er sechzehn Menschen in die Todeszelle gebracht. Doch nach dem plötzlichen Tod seiner Frau sehnt er sich nach Ruhe und Frieden.
Mit seiner kleinen Tochter begibt er sich in die Stadt seiner Kindheit, um den Schatten der Vergangenheit zu entfliehen. Doch Natchez, Mississippi, ist nicht der Ort, um seine Trauer zu begraben. Ein dunkles Geheimnis umgibt diese Stadt im Süden der USA, ein Geheimnis, das mit den Rassenunruhen der 60er Jahre verknüpft ist. Niemand interessiert sich für dessen Aufdeckung, doch Penn Cage ist ein zu integrer Staatsanwalt, um ungesühnte Verbrechen dem Vergessen anheimzustellen - erst recht nicht, wenn diese bis in die höchsten Kreise des amerikanischen Establishments reichen. Eine junge und attraktive Journalistin unterstützt Cage bei den Recherchen - und schon bald schweben beide in großer Gefahr ...
Penn Cages erster Fall - ein spannender Justizthriller für Leserinnen und Leser von Ethan Cross und Lars Kepler.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 926
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Danksagungen
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Epilog
Weitere Titel des Autors
Schwarzer Tod
Adrenalin
@E.R.O.S.
12 Stunden Angst
Über dieses Buch
Ein fesselnder Penn Cage Thriller!
Penn Cage kennt den Tod wie seine Westentasche: Als Staatsanwalt in Houston hat er sechzehn Menschen in die Todeszelle gebracht. Doch nach dem plötzlichen Tod seiner Frau sehnt er sich nach Ruhe und Frieden.
Mit seiner kleinen Tochter begibt er sich in die Stadt seiner Kindheit, um den Schatten der Vergangenheit zu entfliehen. Doch Natchez, Mississippi, ist nicht der Ort, um seine Trauer zu begraben. Ein dunkles Geheimnis umgibt diese Stadt im Süden der USA, ein Geheimnis, das mit den Rassenunruhen der 60er Jahre verknüpft ist. Niemand interessiert sich für dessen Aufdeckung, doch Penn Cage ist ein zu integrer Staatsanwalt, um ungesühnte Verbrechen dem Vergessen anheimzustellen - erst recht nicht, wenn diese bis in die höchsten Kreise des amerikanischen Establishments reichen. Eine junge und attraktive Journalistin unterstützt Cage bei den Recherchen - und schon bald schweben beide in großer Gefahr …
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Über den Autor
Greg Iles wurde in Deutschland geboren, da sein Vater damals die medizinische Abteilung der Amerikanischen Botschaft leitete. Er verbrachte seine Jugend in Natchez, Mississippi. 1983 beendete er sein Studium an der University of Mississippi. Danach trat Greg Iles zunächst als Profi-Musiker auf, bevor er sich der Schriftstellerei widmete. Seine Bücher erscheinen inzwischen in 25 Ländern. Der überaus produktive Autor pflegt außerdem eine Leidenschaft für Filme. Der Autor lebt mit Frau und zwei Kindern in Natchez, Mississippi.
Greg Iles
UNTERVERSCHLUSS
Aus dem amerikanischen Englisch von Bianca Güth
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1999 by Greg Iles
Titel der amerikanischen Originalausgabe: The Quiet Game
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Dutton, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2001/2015/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © oraziopuccio/AdobeStock; f11photo/Shutterstock
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1029-9
be-ebooks.de
lesejury.de
FürMadeline und Mark,die immer meine besten Werke sein werden.
UndAnna Flowers,die mich lehrte, was Klassein jeder Hinsicht bedeutet.
Danksagungen
Mein Dank gilt:
Aaron Priest, der mich auf die nächst höhere Ebene hob.
Phyllis Grann, für ihr Vertrauen und ihre Weitsicht.
David Highfill, für seine großartige Lektoratsarbeit.
Clare Ferraro, Rich Hasselberger und der Gang bei Dutton für ihre erstklassige Arbeit.
Courtney Aldridge, der beste Kumpel, den ein Schriftsteller sich wünschen kann.
Senior Special Agent (i. R.) Ronald Baughan, BATF, Certified Explosives Specialist.
Recherche und Waffenkunde: Keith Benoist.
Historische Fachberatung: Ron Miller.
Juristische Fachberatung: Michael Henry, District Attorney Ronnie Harper, Kevin Colbert, Chancery Judge George Ward, Circuit Judge Lillie Blackmon Sanders.
Medizinische Fachberatung: Dr. Jerry W. Iles, Dr. Michael Bourland.
Kultur und Folklore: Mildred Lyles, Georgia Ware, Peter Rinaldi.
Schließlich geht mein Dank an jene Personen, die den Roman vor dem Erscheinen gelesen haben: Ed Stackler, Natasha Kern, Courtney Aldridge, Mary Lou England, Betty Iles, Michael Henry, Dianne Brown.
Bei allen, die ich an dieser Stelle vergessen habe, möchte ich mich vielmals entschuldigen.
Sämtliche Fehler gehen auf meine Kappe.
Täuscht euch nicht:
Gott läßt keinen Spott mit sich treiben;
denn was der Mensch sät,
wird er ernten.
– GALATER 6,7
1
Ich stehe in der Schlange vor der Disneyworld-Attraktion »It’s a Small World«, halte meine vierjährige Tochter auf den Armen und versuche ihr die Zeit zu vertreiben, während sich die serpentinenförmige Reihe wartender Eltern und Kinder langsam vorwärts bewegt. Ziel sind die flachen Boote, die zu den Klängen einer endlosen Musikschleife aus einer Grotte auftauchen. Plötzlich richtet Annie sich in meinen Armen auf und zeigt auf einen Punkt in der Menge.
»Daddy! Ich hab Mommy gesehen! Schnell!«
Ich schaue nicht hin. Ich frage nicht, wo. Und zwar deshalb nicht, weil Annies Mutter seit sieben Monaten tot ist. Ich stehe reglos in der Schlange und schaue wie alle anderen Leute hier – sieht man von den Tränen ab, die mir jetzt in den Augen brennen.
Annie deutet immer noch in die Menschenmenge; sie wird immer aufgeregter. Sogar in Disneyworld, wo Gefühlsausbrüche zum Tagesgeschäft gehören, zieht sie Blicke auf sich. Ich drücke ihren strampelnden Körper an mich und bahne mir einen Weg zurück durch die Wartenden, worauf Annie vollständig in Panik gerät. Die grünen Metallgeländer verlaufen zickzackförmig umeinander, sodass den Wartenden der Eindruck vermittelt wird, sie seien schon fast am Ziel. Ich schiebe mich an zahllosen Familien vorbei und erreiche schließlich den halbwegs offenen Platz zwischen Karussell und Dumbo.
Ich drücke Annie noch fester an mich, wiege sie und drehe sie sanft im Kreis, wie ich es getan habe, als sie noch ein Baby war. Eine große Gruppe Teenager strömt zu beiden Seiten an uns vorbei wie ein Fluss an einem Felsen – und sie schenken uns ebenso wenig Beachtung. Ein beklemmendes Gefühl der Sinnlosigkeit überwältigt mich, ein Gefühl, das ich vor der Krankheit meiner Frau nie kannte, das mich jetzt aber immer wieder überkommt und wie ein bösartiger Schatten mein Leben verdüstert. Ohne zu zögern, würde ich zehntausend Dollar für einen Hubschrauber bezahlen, der uns schnellstmöglich zurück ins Polynesian Resort Hotel bringt. Aber hier gibt es keinen Hubschrauber. Nur uns. Oder das, was seit Sarahs Tod von uns übrig ist.
Unser Urlaub ist zu Ende. Zeit, nach Hause zu fahren. Nur – wo ist zu Hause? Technisch gesehen in Tanglewood, einem Vorort von Houston. Doch Houston ist keine richtige Heimat mehr für uns. Unser Haus dort scheint jetzt so schrecklich leer – eine Leere, die sich von Zimmer zu Zimmer zieht.
Die meisten Menschen, die Penn Cage kennen, wären verblüfft, ihn so hilflos zu sehen. Ich bin jetzt 38 Jahre alt und habe 12 Männer und Frauen in die Todeszelle geschickt. Neun von ihnen habe ich sterben sehen. Ich habe getötet, um meine Familie zu verteidigen. Ich habe eine erfolgreiche Karriere abgebrochen, um eine zweite zu beginnen, die noch erfolgreicher war. Ich werde von meinen Freunden bewundert, von meinen Feinden gefürchtet und von den Menschen geliebt, die mir wichtig sind. Aber ich bin ohnmächtig angesichts der Trauer meines Kindes.
Ich atme tief ein, hebe Annie noch ein Stück höher und trete den langen Marsch zurück zur Monorail-Bahn an. Wir sind nach Disneyworld gekommen, weil Sarah und ich vor einem Jahr – noch vor der Diagnose – mit Annie hier waren und den schönsten Urlaub unseres Lebens verbrachten. Ich hatte gehofft, dass ein weiterer Besuch Annie ein bisschen Frieden schenken würde. Doch das Gegenteil ist geschehen: Sie wacht mitten in der Nacht auf und tapst ins Bad, um Sarah zu suchen; sie läuft mit ruhelos blickenden Augen durch die Themenparks und hält ständig nach dem verschwundenen Gesicht ihrer Mutter Ausschau. Annie glaubt, dass Sarah in dieser magischen Disney-Welt ebenso gut um die Ecke spazieren könne wie Cinderella. Als ich ihr geduldig erklärte, warum das nicht geschehen würde, erinnerte sie mich daran, dass Schneewittchen und Jesus beide von den Toten auferstanden seien. Im Denken einer Vierjährigen eine Tatsache, an der sich nicht rütteln lässt. Wir brauchen bloß Mommy zu finden, damit Daddy sie küssen und wieder aufwecken kann.
Ich sinke erschöpft auf einen Sitz in der Monorail, neben uns ein halbes Dutzend japanischer Touristen. Annie schluchzt leise an meiner Schulter. Der silberne Zug beschleunigt auf Reisegeschwindigkeit und saust gleich darauf durch Tomorrowland, den Park der Anachronismen, mit Raketen à la Jetsons und Restaurants im Art-Deco-Stil. Als Inkarnation der glitzernden Zukunftsvisionen der 50er Jahre wurde »Das Land von morgen« schneller von der Realität überflügelt, als der gute Walt Disney sich hätte träumen lassen. Der Park wurde zur kitschigen Parodie auf die Träume der Eisenhower-Ära und steht als stummes, aber beredtes Zeugnis für die Unfähigkeit der Menschheit, vorherzusagen, was kommen wird.
Mich muss man nicht daran erinnern.
Als die Monorail in eine lange Kurve geht, erspähe ich die überkreuzten Dachbalken des Polynesian Resort Hotels. Gleich werden wir zurück in unserer Suite sein, allein mit der Leere, die uns jeden Tag verfolgt. Auf einmal aber reicht mir das nicht mehr. Mit erschreckender Klarheit höre ich plötzlich eine Stimme in meinem Inneren – Sarahs Stimme.
Du kannst es nicht alleine schaffen, sagt sie.
Ich schaue auf Annies Gesicht hinunter, das im Schlaf engelhaft ruhig wirkt.
»Wir brauchen Hilfe«, sage ich laut und ernte dafür die irritierten Blicke der japanischen Touristen. Noch bevor die Monorail zischend am Hotel hält, weiß ich, was ich zu tun habe.
Zuerst rufe ich Delta Airlines an und reserviere einen Flug nach Baton Rouge – nicht unser eigentliches Ziel, aber der nächste große Flughafen. Allein dieser Anruf löst ein wildes Hämmern in meiner Brust aus. Annie wacht auf, als ich einen Mietwagen buche; wahrscheinlich hat sie sogar im Schlaf die unbedingte Entschlossenheit in der Stimme ihres Vaters wahrgenommen.
Sie sitzt ruhig neben mir auf dem Bett, und ihre linke Hand liegt auf meinem Bein – ihre Versicherung, dass ich nicht ohne sie fortgehen kann.
»Gehen wir wieder in ein Flugzeug, Daddy?«
»Ja, Engelchen«, antworte ich, während ich eine Nummer in Houston wähle.
»Zurück nach Hause?«
»Nein, wir fahren zu Oma und Opa.«
Ihre Augen werden groß. »Oma und Opa? Jetzt?«, fragt sie erfreut.
»Ich hoffe es. Einen Moment.« Meine Sekretärin Cilla Daniels meldet sich am anderen Ende der Leitung. Sie hat offenbar den Namen meines Hotels auf dem Telefon-Display gesehen und gleich zu reden begonnen, als sie den Hörer abnahm. Ich unterbreche sie, bevor sie richtig in Fahrt kommt. »Hör zu, Cil. Ich möchte, dass du mir einen Lagerraum mietest, der groß genug für alles im Haus ist.«
»Im Haus?«, wiederholt sie. »Dein Haus? Meinst du mit ›alles‹ die Möbel?«
»Ja, ich verkaufe das Haus.«
»Du verkaufst das Haus! Penn, was ist passiert? Stimmt irgendwas nicht?«
»Nichts ist passiert. Ich bin bloß zur Vernunft gekommen. Annie wird es in diesem Haus niemals besser gehen. Und Sarahs Eltern trauern immer noch so sehr, dass sie alles nur noch schlimmer machen. Ich ziehe für eine Weile wieder nach Hause.«
»Nach Hause?«
»Nach Natchez.«
»Natchez.«
»In Mississippi. Wo ich gelebt habe, bevor ich Sarah heiratete. Wo ich aufgewachsen bin.«
»Ich weiß, aber …«
»Mach dir keine Sorgen wegen deines Gehalts. Ich werde dich mehr denn je brauchen.«
»Ich mache mir keine Sorgen wegen meines Gehalts. Ich mache mir Sorgen um dich. Hast du mit deinen Eltern gesprochen? Deine Mutter rief gestern an und fragte nach der Nummer deines Hotels. Sie klang ziemlich aufgeregt.«
»Ich telefoniere gleich mit ihr. Wenn du den Lagerraum hast, ruf bitte eine Spedition an und organisiere den Umzug. Sarahs Eltern können aus dem Haus alles haben, was sie möchten. Und dann ruf Jim Noble an und bitte ihn, das Haus zu verkaufen. Und ich meine nicht, dass er es auf die Liste setzen soll. Er soll es verkaufen.«
»Die Immobilienpreise sind zur Zeit ziemlich im Keller. Besonders ein Haus in der Preislage wie deines.«
»Ist mir egal, auch wenn ich nur die Hälfte vom Wert bekomme – leg los.«
Ein seltsames Schweigen. Dann sagt Cilla: »Darf ich dir ein Angebot für das Haus machen? Ich tue es nicht, wenn du nie wieder an dieses Haus erinnert werden willst.«
»Nein … das ist eine gute Idee. Du musst raus aus diesem Apartment. Kannst du einen annähernd realistischen Preis zahlen?«
»Ich habe noch ein bisschen von meiner Scheidungsabfindung. Du kennst mich.«
»Mach mir kein Angebot. Ich mache dir eins. Lass das Haus schätzen und ziehe 20 Prozent ab. Keine Maklergebühren, keine Anzahlung, nichts dergleichen. Erstelle einen Zahlungsplan über zwanzig Jahre zu einem Zinssatz von, sagen wir, sechs Prozent. So haben wir einen Grund, in Verbindung zu bleiben.«
»O Gott, Penn, ich kann doch deine Situation nicht so ausnutzen.«
»Das ist jetzt beschlossene Sache.« Ich atme tief ein und spüre, wie die unsichtbaren Fesseln sich von mir lösen. »Das wäre wohl alles.«
»Warte! Die Welt bleibt nicht stehen, nur weil du nach Disneyworld flüchtest.«
»Was liegt denn noch an?«
»Ich habe zwei Nachrichten. Eine schlechte und eine andere, die gut, aber auch schlecht sein könnte.«
»Lass mich die zweite zuerst hören.«
»Arthur Lee Hanrattys letzter Antrag auf Aussetzung des Urteils wurde soeben vom Obersten Gerichtshof abgelehnt. Die CNN-Nachrichten bringen es alle halbe Stunde als Topthema. Die Hinrichtung wurde auf Samstag angesetzt, um Mitternacht – in fünf Tagen.«
»Für mich ist das eine gute Nachricht.«
Cilla seufzt, und mir wird klar, dass ich mich irre. »Mr. Givens hat vor ein paar Minuten angerufen.« Mr. Givens und seine Frau sind die engsten Verwandten der schwarzen Familie, die von Hanratty und seinen geisteskranken Brüdern abgeschlachtet wurde. »Und Mr. Givens will Hanratty nie wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Er und seine Frau möchten, dass du an ihrer Stelle der Hinrichtung beiwohnst. Ein Zeuge, dem sie vertrauen können – du kennst den Vorgang.«
»Nur zu gut.« Die Todesspritze im Staatsgefängnis von Texas in Huntsville, besser bekannt als The Walls. Siebzig Meilen nördlich von Houston, der siebte Kreis der Hölle. »Diesmal möchte ich das wirklich nicht mitmachen, Cil.«
»Ich weiß. Was soll ich dir sagen …?«
»Was für Neuigkeiten hast du noch?«
»Ich habe gerade mit Peter telefoniert.« Peter Highsmith ist mein Verleger, ein wahrer Gentleman und ein sehr kluger Mann, aber nicht die Person, mit der ich im Augenblick sprechen möchte. »Er würde nie etwas sagen, aber ich glaube, der Verlag macht sich Gedanken wegen Nichts als die Wahrheit. Der ursprüngliche Termin war vor fast einem Jahr. Peter macht sich mehr Sorgen um dich als um das Buch. Er will nur wissen, ob es dir gut geht.«
»Was hast du ihm gesagt?«
»Dass du eine sehr schwere Zeit hattest, aber langsam wieder Fuß fasst. Dass du mit dem Buch fast fertig bist und dass es mit Abstand das Beste ist, das du je geschrieben hast.«
Ich lache laut auf.
»Wie weit bist du denn? Als ich dich das letzte Mal gefragt habe, warst du erst halb fertig.«
Ich setze schon zu einer Lüge an, besinne mich aber. »Seit Sarah tot ist, habe ich keine vernünftige Seite geschrieben.«
Cilla schweigt.
»Und die erste Hälfte des Manuskripts habe ich an dem Abend verbrannt, bevor wir gefahren sind.«
Sie schnappt nach Luft. »Das hast du nicht!«
»Sieh im Kamin nach.«
»Penn, ich glaube, du brauchst Hilfe. Ich sage das als deine Freundin. Es gibt gute Leute hier in der Stadt. Diskret.«
»Ich brauche keinen Seelenklempner, ich muss mich um meine Tochter kümmern.«
»Na ja … was immer du tust, sei vorsichtig, okay?«
»Und was soll das bringen? Sarah war der vorsichtigste Mensch, den ich kannte.«
»Ich habe nicht gemeint …«
»Ich weiß. Hör zu, ich möchte nicht, dass auch nur ein Journalist herausfindet, wo ich bin. Ich will mit diesem Hinrichtungs-Zirkus nichts zu tun haben. Das ist jetzt Joes Problem.« Joe Cantor ist der Bezirksstaatsanwalt von Harris County, mein ehemaliger Vorgesetzter. »Bis zum Zeitpunkt der Hinrichtung weißt du nur, dass ich in Urlaub bin.«
»Nie etwas anderes gehört.«
»Ich muss los. Wir sprechen uns bald wieder.«
»Das will ich sehr hoffen.«
Als ich auflege, kniet Annie sich mit leuchtenden Augen neben mich. »Fahren wir wirklich zu Oma und Opa?«
»Das wissen wir in einer Minute.«
Ich wähle die Nummer, die ich schon als Vierjähriger auswendig gelernt habe und lausche dem Freizeichen. Eine heisere Frauenstimme meldet sich in breitestem Südstaaten-Slang. Einen solchen Akzent hört man in keinem Film, weil die Produzenten fürchten, das Publikum würde kein Wort verstehen. Und diese Frau arbeitet für einen Telefonservice.
»Anschluss Dr. Cage.«
»Hier spricht Penn Cage, sein Sohn. Können Sie mich bitte durchstellen?«
»Natürlich kann ich das, Honey, bleiben Sie dran.«
Nach fünf Klingeltönen höre ich ein Klicken. Dann spricht eine tiefe männliche Stimme zwei Worte, in denen mehr Emotion mitschwingt, als die meisten Männer in mehreren Sätzen vermitteln können: Ruhe, Würde, ein Wissen um die wirkliche Bedeutung der Dinge.
»Doktor Cage«, sagt die Stimme meines Vaters.
Sie beruhigt mein Gemüt augenblicklich. Diese Stimme hat im Laufe der Jahre Tausende von Menschen beruhigt und vielen anderen gesagt, dass ihnen weniger Tage auf Erden verbleiben, als sie gehofft hatten. »Dad, was machst du denn um diese Zeit zu Hause?«
»Penn, bist du das?«
»Ja.«
»Was ist los, mein Sohn?«
»Ich bringe Annie zu euch nach Hause.«
»Wunderbar. Kommst du direkt von Florida?«
»Kann man sagen. Wir kommen heute noch.«
»Heute? Ist Annie krank?«
»Nein. Nicht körperlich jedenfalls. Dad, ich verkaufe das Haus in Houston und ziehe für eine Weile wieder zu euch. Was danach kommt, überlege ich mir noch. Habt ihr Platz für uns?«
»Du liebe Güte, mein Sohn. Warte, ich hole deine Mutter.«
Ich höre meinen Vater rufen, dann das Klappern von Absätzen und schließlich die Stimme meiner Mutter. »Penn? Kommst du wirklich nach Hause?«
»Wir sind heute Abend da.«
»Gott sei Dank! Wir holen euch vom Flughafen ab.«
»Nein, nicht nötig. Ich miete ein Auto.«
»Äh … na gut. Ich … ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin.«
Irgendetwas in der Stimme meiner Mutter lässt eine Alarmglocke in mir klingeln. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber ich höre es zwischen ihren Worten heraus, so wie fast jeder bemerkt, wenn innerhalb der Familie irgendetwas nicht stimmt. Was es auch sein mag, es ist ernst. Peggy Cage sorgt sich nicht um Kleinigkeiten.
»Mom, was ist los?«
»Nichts. Ich freue mich nur, dass du nach Hause kommst.«
Niemand lügt schlechter als ein Mensch, der sein Leben lang die Wahrheit gesagt hat. »Mom, versuch nicht …«
»Wir reden, wenn du hier bist. Bring dein kleines Mädchen erst einmal hierher, wo es hingehört.«
Ich erinnere mich an Cillas Eindruck, dass meine Mutter aufgeregt war, als sie am Tag zuvor anrief. Aber es ist sinnlos zu versuchen, das am Telefon zu klären. In ein paar Stunden werde ich Mutter gegenüberstehen. »Wir sind heute Abend bei euch. Bis dann.«
Meine Hand zittert, als ich den Hörer auf die Gabel lege. Für einen verlorenen Sohn ist eine Reise zurück in die Heimat nach achtzehn Jahren eine Art Wallfahrt. Ich war zwar einige Male zu Weihnachten oder Thanksgiving zu Hause, aber das hier ist etwas anderes. Als ich zu Annie hinunterschaue, trifft mich ein heftiger Schlag des Wiedererkennens, wie es seit der Beerdigung häufig geschehen ist. Oft schaut Sarahs Gesicht so deutlich aus Annies Zügen hervor, als hätte ihr Geist für kurze Zeit von dem Kind Besitz ergriffen – auf eine durch und durch gütige und wohlwollende Weise. Annies haselnussbraune Augen fixieren die meinen mit einem Blick, der mir stets unendlich viel Ruhe gab, wenn er von Sarah kam. Du tust das Richtige, scheint dieser Blick zu sagen.
»Ich hab dich lieb, Daddy«, sagt Annie sanft.
»Ich hab dich noch viel mehr lieb«, antworte ich unserem Ritual entsprechend. Dann fasse ich Annie unter den Armen und schwinge sie hoch in die Luft. »Lass uns packen! Wir müssen zum Flugzeug.«
2
Eines der Dinge, die ich an Erste-Klasse-Flügen liebe, ist der sofortige Getränkeservice. Noch bevor unser Anschlussflug vom Hartsfield Airport in Atlanta abhebt, steht ein Glas Scotch auf dem Tischchen vor mir. Ich trinke niemals harten Alkohol, wenn Annie dabei ist, nun aber liegt sie auf dem Sitz neben mir und schläft. Ihr kleiner Arm hängt über der gepolsterten Armlehne, und ihre Hand berührt meinen Oberschenkel – ein Frühwarnsystem, das selbst im Schlaf funktioniert. Welcher Teil ihres Gehirns hält wohl diese Hand an ihrem Platz? Ob Neandertaler-Kinder so geschlafen haben? Ich nippe an meinem Whisky, streichle ihr übers Haar und schaue mich vorsichtig im Flugzeug um.
So viele Vorteile Erste-Klasse-Flüge haben, so haben sie auch ihre Nachteile, jedenfalls für mich. Ich werde oft erkannt, denn in der ersten Klasse sitzen viele Bücherleser. Und viele Anwälte. Heute ist die Kabine zwar so gut wie leer, doch auf der anderen Seite des Gangs sitzt eine Frau Ende zwanzig in einem blauen Köstum, das sehr nach Anwältin aussieht, und liest einen Penn-Cage-Roman. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich erkennt. Vielleicht aber auch nicht, wenn ich Glück habe. Ich trinke noch einen Schluck Scotch, lehne mich im Sitz zurück und schließe die Augen.
Das erste Bild, das mir durch den Kopf geht, ist das Gesicht von Arthur Lee Hanratty. Ich habe vier Monate lang an der Verurteilung dieses Hundesohns gearbeitet. Doch sogar in Texas, wo wir es mit der Todesstrafe ernst meinen, kostet es Zeit, durch sämtliche Berufungsinstanzen zu gehen. Jetzt, acht Jahre nach seiner Verurteilung, scheint es möglich, dass er tatsächlich durch die Hand des Staates sterben wird.
Ich kenne Staatsanwälte, die gern eine Tagesreise unternehmen würden, um die Hinrichtung eines Mannes zu sehen, dessen Verurteilung sie durchgesetzt haben – lächelnd und voller Vorfreude auf die politischen Früchte, die dieses Ereignis ihnen einbringt. Andere wiederum gehen nicht einmal dann zu einer Hinrichtung, wenn man sie darum bittet. Ich persönlich habe es stets als moralische Verpflichtung betrachtet, der Strafe beizuwohnen, die ich im Namen der Gesellschaft beantragt hatte. Darüber hinaus halte ich es für wichtig, die Familien der Opfer von Kapitalverbrechen durch die lange Tortur des Prozesses zu begleiten. Tatsächlich baten mich die Familienmitglieder in jedem einzelnen Fall, sie als Zeugen der Hinrichtung zu vertreten. Nachdem das Gesetz dahingehend geändert worden war, dass die Familien der Opfer selbst anwesend sein durften, wurde ich gebeten, sie in den Zuschauerraum zu begleiten, und ich war froh, ihnen Beistand leisten zu können.
Diesmal ist es anders, denn mein Verhältnis zum Tod hat sich grundlegend geändert. Den Tod meiner Frau erlebte ich aus einer sehr viel näheren Perspektive mit, als ich sie vom Zuschauerraum in The Walls gekannt hatte, und so schmerzvoll diese Erfahrung war, sie ist mir heilig. Ich habe nicht das geringste Bedürfnis, diese Erinnerung durch den Anblick einer weiteren Hinrichtung – durchgeführt mit der kühlen Sachlichkeit eines Tierarztes beim Einschläfern eines tollwütigen Hundes – trüben zu lassen.
Ich leere den Rest meines Scotchglases und genieße das erdige Brennen in der Kehle. Wie immer lässt mich die Erinnerung an Sarahs Tod an meinen Vater denken. Seine Stimme am Telefon zu hören hat das Bild noch stärker werden lassen. Während die 727 zu ihrer Flughöhe aufsteigt, scheint der Whisky in meinem Hirn eine Schleuse zu öffnen, und die Erinnerung strömt über meine Gedanken hinweg wie eine Flut. Ich weiß aus Erfahrung, dass es sinnlos ist, dagegen anzukämpfen. Ich schließe die Augen und gebe mich ihr hin.
Sarah liegt im M.D. Anderson Hospital in Houston. Die Krankheit, deren Namen sie nicht mehr laut ausspricht, hat sie in einen Schatten ihrer selbst verwandelt. Sarah ist nicht abergläubisch, doch den Namen der Krankheit zu nennen scheint dieser mehr Kraft zu verleihen. Ihre Ärzte stehen vor einem Rätsel: Das Ende hätte schon vor langer Zeit kommen müssen. Die Diagnose wurde sehr spät gestellt, die Aussichten waren mehr als kläglich. Inzwischen wiegt Sarah nur noch knapp über 40 Kilo, aber sie kämpft mit der Beharrlichkeit einer jungen Mutter um ihr Leben. Es ist ein aussichtsloser Kampf, der Minute um Minute gegen körperliche Qualen und emotionale Verzweiflung gefochten wird. Manchmal spricht sie von Selbstmord – in den schlimmsten Nächten der einzige Trost.
Wie die meisten Ärzte haben auch ihre Onkologen zu viel Angst vor möglichen rechtlichen Folgen und der Anti-Drogen-Behörde, um Schmerzen angemessen zu behandeln. In meiner Verzweiflung rufe ich meinen Vater an, der mir rät, Sarah aus dem Krankenhaus zu holen und nach Hause zu bringen. Sechs Stunden später steht er vor unserer Tür, umgeben von Zigarrengeruch, in der Hand eine schwarze Tasche mit genügend starken Schmerzmitteln, um einen Grizzlybären zu narkotisieren. Zwei Wochen lang lebt er gegenüber von Sarahs Zimmer, pflegt sie wie eine Krankenschwester und bringt jeden zum Schweigen, der sein Handeln in Frage stellt. Er hilft Sarah zu schlafen, wenn sie Schlaf braucht, und befreit sie lange genug von ihren Leiden, damit sie Annie zulächeln kann, wenn sie sich stark genug fühlt, das Mädchen zu sehen.
Irgendwann verlieren die Medikamente ihre Wirkung. Der schmale Grat zwischen Wachsein und Todesqualen verschwindet. Eines Abends bittet Sarah uns, sie alleine zu lassen, damit sie besser schlafen könne. Kurz vor Mitternacht ruft sie mich in das Schlafzimmer, in dem wir früher gemeinsam mit Annie lagen und von der Zukunft träumten. Sie kann kaum sprechen. Ich nehme ihre Hand. Für einen Augenblick teilen sich die Wolken, die ihre Augen überschatten, und enthüllen eine erstaunliche Klarheit. »Du hast mich glücklich gemacht«, flüstert sie. Ich habe geglaubt, keine Tränen mehr zu haben, aber jetzt fließen sie in Strömen. »Sorge für mein Baby«, sagt sie. Ich schwöre aus tiefstem Herzen, dass ich es tun werde, bin aber nicht sicher, ob Sarah mich hört. Dann fragt sie mich zu meinem Erstaunen nach Vater. Ich laufe über den Flur und wecke ihn, dann setze ich mich auf sein warmes Bett.
Als ich aufwache, ist Sarah tot. Sie starb im Schlaf, friedlich, wie mein Vater mir versichert. Als Sarahs Eltern aufwachen, sagt er ihnen, dass sie gestorben sei. Nacheinander gehen sie zu ihm und nehmen ihn in die Arme. Ihre Augen sind feucht, voller Dankbarkeit und Vergebung. »Sie war eine Kämpferin«, sagt mein Vater mit brüchiger Stimme. Es ist das höchste Lob, das meine Frau jemals bekommt.
»Entschuldigung, sind Sie Penn Cage? Der Schriftsteller?«
Ich blinzle und reibe mir die Augen in der plötzlichen Helligkeit, dann wende ich mich nach rechts. Die junge Frau auf der anderen Seite des Ganges schaut mich an, und eine leichte Röte färbt ihre Wangen.
»Ich möchte Sie nicht belästigen, aber ich sah Sie trinken und schloss daraus, dass Sie wach sein müssen. Ich lese gerade dieses Buch und … Sie sehen genauso aus wie das Foto auf dem Rücken.«
Sie spricht leise, um Annie nicht zu wecken. Ein Teil von mir ist immer noch bei Sarah und meinem Vater, tief unten in einer dunklen Spirale der Sinnfrage, aber ich reiße mich zusammen. Die Frau, die sich als Kate vorstellt, ist sehr attraktiv, mit feinem, zusammengebundenem Haar, heller Haut und meergrünen Augen – eine ungewöhnliche Kombination. Ihr marineblauer Anzug scheint maßgeschneidert zu sein, und das zurückgesteckte Haar lässt sie mehrere Jahre älter aussehen, als sie vermutlich ist – unter jungen Anwältinnen ein sehr verbreiteter Kunstgriff. Ich lächle unbeholfen, bestätige, dass ich Penn Cage bin und frage sie, ob sie Anwältin ist.
Sie lächelt. »Ist das so offensichtlich?«
»Für andere Angehörige dieser Sippe, ja.«
Sie lächelt wieder, doch diesmal ist es ein Lächeln wie über einen Scherz. »Ich bin auf Berufungsfälle spezialisiert«, erzählt sie.
Ihr Akzent ist eine Mischung aus Bostoner Eliteuniversität und etwas Sanfterem. Eine höhere Tochter, die ihr Studium in Radcliffe absolvierte, aber die Sommer weit von dort entfernt verbrachte. »Klingt interessant«, sage ich.
»Ist es manchmal auch. Aber nicht so interessant wie das, was Sie tun.«
»Sie irren sich, da bin ich sicher.«
»Das bezweifle ich. Eben gerade, am Flughafen, habe ich Sie auf CNN gesehen. Es ging um die Hanratty-Hinrichtung. Und darum, dass Sie seinen Bruder getötet haben.«
Na also, die Show hat begonnen. »Das gehört nicht gerade zu meinem Berufsalltag. Nicht mehr jedenfalls.«
»Es hörte sich so an, als gäbe es einige ungeklärte Fragen in Bezug auf die Schießerei.« Kate errötet wieder. »Sie haben es wahrscheinlich satt, danach gefragt zu werden, nicht wahr?«
Ja, ich habe es satt. »Vielleicht wird die Hinrichtung das Gerede zum Verstummen bringen.«
»Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht ausfragen.«
»Natürlich nicht.« An jedem anderen Tag hätte ich sie abgewimmelt. Aber sie liest einen meiner Romane, und abgesehen davon ist selbst der Fall Texas gegen Hanratty ein angenehmeres Thema als das, worüber ich nachdachte, als sie mich unterbrach. »Ist schon in Ordnung. Wir alle möchten den Dingen auf den Grund gehen.«
»In der Sendung Beweislast wurde gesagt, dass der Fall Hanratty oft als Beispiel für den juristischen Disput zitiert wird, ob staatliche Behörden oder Bundesämter zuständig sind.«
Ich nicke, sage aber nichts. »Disput« ist ziemlich vorsichtig ausgedrückt. Arthur Lee Hanratty war ein weißer Rassist, der gegen mehrere frühere Kumpane aussagte und dafür Immunität und einen der begehrten Plätze im staatlichen Zeugenschutzprogramm erhielt. Drei Monate nachdem er das Programm begonnen hatte, erschoss er in Compton einen Schwarzen; der Grund war eine Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Er floh aus Los Angeles, tat sich mit seinen beiden geistesgestörten Brüdern zusammen und tauchte schließlich in Houston auf, wo die drei eine schwarze Familie ermordeten. Als sie festgenommen wurden, erschoss Arthur Lee eine Polizistin und ermöglichte seinen Brüdern dadurch die Flucht. Das alles machte sich nicht sehr gut im Lebenslauf von John Portman, dem Bundesanwalt, der Hanratty Immunität gewährt hatte, sodass dieser beschloss, seinen ehemaligen Kronzeugen vor dem Bundesgericht in Los Angeles anzuklagen. Mein Vorgesetzter und ich (mit der Unterstützung des damaligen Präsidenten und gebürtigen Texaners George Bush) behielten Hanratty in Texas, wo eine reelle Chance bestand, dass er für seine Verbrechen sterben würde. Unser Sieg im Streit um die Gerichtsbarkeit beraubte Portman seiner Gelegenheit zur Rache, aber mit seiner Karriere ging es dennoch steil bergauf. Er wurde erst Bundesrichter und stieg dann in die Führungsebene des FBI auf, an dessen Spitze er mittlerweile steht.
»Ich erinnere mich«, sagt Kate. »Die Compton-Schießerei, meine ich. Ich hatte in dem Sommer in Los Angeles gearbeitet, wo man der Sache sehr viel Aufmerksamkeit schenkte. Für die eine Hälfte der Medien waren Sie ein Held, für die andere Hälfte ein Ungeheuer. Es hieß, Sie hätten … Sie wissen schon.«
»Was?«, frage ich, um herauszufinden, wie weit sie geht.
Sie zögert; dann wagt sie den Sprung ins kalte Wasser. »Es hieß, Sie hätten ihn erschossen und Ihr Baby als Rechtfertigung für die Tat benutzt.«
Ich kann die Verärgerung von Kriegsveteranen über diese Art der Neugier inzwischen gut verstehen. Normalerweise begegne ich ihr mit einem steinernen Blick oder gar mit offener Feindseligkeit. Aber heute ist es anders. Ich befinde mich in einem Übergangsstadium. Die bevorstehende Hinrichtung hat alte Geister wiederauferstehen lassen, und ich bin bereit zu sprechen. Nicht, um die Neugier dieser Frau zu befriedigen, sondern um mich selbst daran zu erinnern, dass ich es überstanden habe. Dass ich das Richtige getan habe. Das einzig Richtige, versichere ich mir selbst und schaue auf die schlafende Annie neben mir. Ich trinke meinen Scotch und lasse zu, dass ich mich an die Ereignisse erinnere, die sonst immer anderen passiert zu sein scheinen: einem prominenten Anwalt, der vom rechten politischen Flügel heilig gesprochen und von den Linken verteufelt wird.
»Nach seiner Verhaftung hat Arthur Lee Hanratty geschworen, mich zu töten. Er sagte es Dutzende Male im Fernsehen. Ich nahm seine Drohungen hin, wie ich sie alle hinnahm, cum grano salis. Doch Hanratty meinte es ernst. Vier Jahre später bestätigte der Oberste Gerichtshof sein Todesurteil. Meine Frau und ich lagen schon im Bett und sahen es in den Spätnachrichten. Sie war im Halbschlaf, und ich ging gerade mein Eröffnungsplädoyer für einen anderen Mordfall durch. Mein Chef hatte wegen des Urteilsspruchs einen Beamten zur Bewachung meines Hauses abgestellt, aber ich glaubte nicht, dass irgendeine Gefahr bestand. Als ich das erste Geräusch hörte, glaubte ich mich geirrt zu haben. Dann war das Haus wieder ruhig. Plötzlich erneut ein Geräusch. Ich fragte Sarah, ob sie es auch gehört hätte. Hatte sie nicht. Sie sagte, ich solle das Licht ausmachen und schlafen. Beinahe hätte ich’s getan, so knapp war’s. Das ist der Grund für meine Albträume.«
»Warum sind Sie dann doch aufgestanden?«
Die Stewardess kommt vorbei, und ich bestelle noch einen Scotch. »Ich weiß es nicht. Irgendwas tief in meinem Unterbewusstsein sagte mir, dass etwas nicht stimmte. Ich nahm meine .38er aus dem Waffenschrank und löschte die Leselampe. Dann öffnete ich die Schlafzimmertür und ging über den Flur zum Zimmer meiner Tochter. Annie war erst sechs Monate alt, aber sie schlief die Nächte immer durch. Als ich die Tür geöffnet hatte, hörte ich sie nicht atmen, aber das machte mir keine Sorgen. Manchmal muss man sich direkt neben sie stellen, wissen Sie. Ich ging zur Wiege und beugte mich darüber, um ihren Atem zu hören.«
Kate hört gebannt zu, beugt sich über den Gang zu mir. Ich nehme meinen Scotch aus der Hand der Stewardess und trinke einen großen Schluck. »Die Wiege war leer.«
»O Gott!«
»Der Beamte stand vor der Haustür, also rannte ich zum Hintereingang. Dort aber sah ich nichts als den leeren Hof. Ich fühlte mich, als wäre ich einen Abgrund hinuntergestürzt. Irgendetwas veranlasste mich, nach links zu blicken. Ein Mann stand nahe der Hintertür im Esszimmer, etwa sieben oder acht Meter von mir entfernt. Er trug ein winziges Bündel in den Armen, wie einen Laib Brot in einer Decke. Er starrte mich an und griff nach der Türklinke. Ich konnte seine Zähne im Dunkeln leuchten sehen – er lächelte! Ich richtete meine Pistole auf seinen Kopf, und er wollte rückwärts durch die Tür verschwinden, wobei er Annie als Schutzschild benutzte, indem er sie vor seine Brust hielt. Es war dunkel, und meine Hände zitterten. Jeder vernunftgesteuerte Gedanke befahl mir, nicht zu schießen. Aber ich musste es einfach tun.«
Ich nehme noch einen tiefen Schluck Scotch. Rund um die grüne Iris ist das Weiße von Kates Augen deutlich zu sehen, was ihr ein leicht hyperaktives Aussehen verleiht. Ich strecke die Hand aus, um sie Annie auf die Schulter zu legen. Teile dieser Geschichte kann ich immer noch nicht aussprechen. Als ich die Zähne des Kidnappers gesehen hatte, spürte ich, wie maßlos überlegen der Mann sich mir gegenüber fühlte – der Triumph des Raubtiers. Nichts in meinem Leben hat mich je so hart getroffen wie die Angst in diesem Moment.
»Er war schon halb aus der Tür, als ich den Abzug drückte. Die Kugel schleuderte den Mann in den Hof. Als ich nach draußen ging, sah ich Annie auf dem Beton liegen, über und über voller Blut. Ohne einen Blick auf den Mann zu werfen, riss ich sie in meine Arme, hielt sie ins Mondlicht und zerrte ihr den Strampelanzug herunter, um die Einschusswunde zu suchen. Sie gab keinen Laut von sich. Dann, plötzlich, schrie sie wie ein kleines Tier. Es war ein Wutschrei, kein Schmerzensschrei. In diesem Moment wusste ich, dass es ihr wahrscheinlich gut ging. Und Hanratty … die Kugel hatte ihn ins Auge getroffen. Er lag im Sterben. Und ich rührte keinen Finger, um ihm zu helfen.«
Kate blinzelt endlich, eine Reihe von blitzschnellen Wimpernschlägen wie bei jemandem, der aus einer Trance erwacht. Sie deutet auf Annie. »Sie ist das Baby? Sie ist Annie?«
»Ja.«
»Gott.« Sie berührt das Buch auf ihrem Schoß. »Jetzt ist mir klar, warum Sie aufgehört haben, zu arbeiten.«
»Einer ist immer noch da draußen.«
»Was meinen Sie?«
»Wir haben den dritten Bruder nie gefasst. Ich bekomme hin und wieder Postkarten von ihm. Er schreibt, dass er sich darauf freut, Zeit mit unserer Familie zu verbringen.«
Sie schüttelt den Kopf. »Wie leben Sie nur damit?«
Ich zucke die Achseln und wende mich wieder meinem Drink zu.
»Ihre Frau reist nicht mit ihnen?«, fragt Kate.
Sie müssen immer fragen. »Nein. Sie ist vor kurzem verstorben.«
Kates Gesicht durchläuft die kaum merkliche Abfolge von Gesichtsausdrücken, die ich in den letzten sieben Monaten tausendfach beobachten konnte: Bestürzung, Verlegenheit, Mitleid und ein ganz kleines bisschen Befriedigung darüber, dass das scheinbar so perfekte Leben doch nicht ganz so perfekt ist.
»Das tut mir leid«, sagt sie. »Der Ehering … ich dachte …«
»Schon gut. Sie konnten es ja nicht wissen.«
Sie senkt den Blick und nimmt einen Schluck von ihrem Softdrink. Als sie wieder aufschaut, ist ihr Gesicht beherrscht wie zuvor. Sie fragt, um was es in meinem nächsten Buch geht, hört aber nicht richtig zu. Auch das ist mir vertraut: Die Reaktion auf einen jungen Witwer – ganz besonders auf einen, der offenbar wohlhabend und nicht abstoßend hässlich ist –, ist so natürlich und berechenbar wie ein Sonnenaufgang. Ein leichter Glanz des Flirtens geht von Kate aus wie ein mittelalterlicher Zauber, aber es ist ein Zauber, für den ich zur Zeit unempfänglich bin.
Annie erwacht, während wir uns noch unterhalten, und es gelingt Kate erstaunlich gut, sie gleich in das Gespräch mit einzubeziehen. Die Zeit verfliegt, und nur wenig später schütteln wir uns am Flugsteig in Baton Rouge zum Abschied die Hände. Annie und ich treffen Kate noch einmal am Gepäckband, und als sie in ihren Reeboks einem Taxi hinterher spurtet, bemerke ich, wie gebannt Annies Blick sie verfolgt. Es tut weh, zu sehen, wie groß die Anziehungskraft einer jungen Frau auf meine Tochter ist.
Mit gezwungener Fröhlichkeit schwinge ich Annie auf meinen Arm und trotte zum Hertz-Schalter. Dort muss ich erst einmal mit einem Angestellten diskutieren, warum das Auto, das ich reserviert habe, nicht zur Verfügung steht (aber für nur zehn Dollar mehr am Tag kann ich ein anderes Modell bekommen) und wie lange ich auf den Kindersitz warten muss. Meine Stimmung schlägt gerade von leichter Gereiztheit in offenen Ärger um, als ein großer Mann mit weißem Haar und einem sorgfältig gestutzten weißen Bart zu der Glastür hereinkommt, durch die Kate gerade verschwunden ist.
»Daddy!«, quietscht Annie. »Daddy, Opa ist hier!«
»Dad? Was machst du denn hier?«
Er lacht und kommt auf uns zu. »Du glaubst doch nicht im Ernst, dass deine Mutter zulässt, dass ihr Sohn ein Auto mietet und 80 Meilen fährt, um nach Hause zu kommen. Gott behüte!« Er schnappt Annie unter den Armen, hebt sie hoch und drückt sie an seine Brust. »Hallo, Kaulquappe! Wie war’s in Disneyworld?«
»Ich habe Arielle gesehen! Und Schneewittchen hat mich in den Arm genommen!«
»Natürlich hat sie das! Wer würde einen kleinen Engel wie dich nicht in den Arm nehmen wollen?« Er schaut über ihre Schulter zu mir herüber. Ein paar unangenehme Sekunden lang ruht der durchdringende Blick eines Mannes auf mir, der vierzig Jahre Erfahrung darin hat, Anzeichen von Krankheiten zu erkennen. Seine Wahrnehmung ist wie die Wärme, die eine Lampe ausstrahlt. Ich nicke langsam, um Mir geht’s gut, Dad zu signalisieren und suche gleichzeitig in seinem Gesicht nach Hinweisen auf den Grund für die Besorgnis meiner Mutter. Doch Dad versteht sich gut darauf, seine Gefühle zu verbergen – eine weitere Eigenart, die der Beruf des Mediziners mit sich bringt.
»Ist Mom auch gekommen?«, frage ich.
»Nein, sie ist zu Hause und kocht ein so großartiges Abendessen, dass du’s erst glauben wirst, wenn du es siehst.« Für einen Moment sehe ich einen Hauch von etwas Beunruhigendem hinter seinen Augen, der aber sofort verschwindet, als er Annie verschwörerisch anlächelt. »Los geht’s, Kaulquappe! Wir verschwenden wertvolles Tageslicht!«
3
Mein Vater war in den 60er Jahren als Armeearzt in Westdeutschland tätig und brachte von dort seine Vorliebe für dunkles Bier und schnelle Autos mit. Seit er es sich leisten kann, fährt er bmw, und er fährt schnell. Innerhalb von vier Minuten sind wir außerhalb des Flughafengeländes und donnern auf dem Highway 61 Richtung Norden. Annie sitzt in einem Kindersitz in der Mitte der Rückbank und bestaunt das Display im Armaturenbrett, das die Größe eines Fernsehers hat. Dad führt die verschiedenen Funktionen wieder und wieder vor, entzückt von jedem fröhlichen Glucksen, das er damit hervorruft.
Das Einkommen meines Vaters hat sich vor einigen Jahren aufgrund seiner Herzprobleme drastisch verringert, sodass ich ihm im vergangenen Jahr – an seinem sechsundsechzigsten Geburtstag – von den Tantiemen für meinen dritten Roman einen schwarzen BMW 740i kaufte. Ich fühlte mich ein wenig wie Elvis Presley, als ich den Scheck ausfüllte – ein gutes Gefühl. Meine Eltern begannen ihr Leben mit gar nichts. Mit harter Arbeit und Verzicht lebten sie innerhalb einer Generation den Amerikanischen Traum, wie man ihn einst unentschuldbarerweise nannte. Sie verdienen hin und wieder ein wenig Unterstützung.
Die flachen braunen Felder von Louisiana verwandeln sich schon bald in grüne, bewaldete Hügel. Irgendwo links von uns, hinter dem dichten Wald, fließt der große braune Fluss. Noch rieche ich ihn nicht, aber ich kann ihn fühlen: eine kleine Unregelmäßigkeit im Magnetfeld der Erde, eine flüssige Macht, die das Land und die Menschen rundherum prägt. Ich kurble das Fenster hinunter und atme tief den Geruch der mächtigen Bäume, der kleinen Bäche, der Sträucher voller Wildblumen und der heißen Erde ein. Die verschiedenen Düfte wetteifern miteinander und verschmelzen zu einem berauschenden Aroma, das man in Houston selbst dann nicht finden könnte, würde man jeden Zentimeter der Stadt auf Händen und Füßen absuchen.
»Bei offenem Fenster funktioniert die Klimaanlage nicht«, beschwert sich Dad.
»Tut mir leid.« Ich schließe das Fenster. »Es ist so lange her, dass ich diesen Ort gerochen habe.«
»Verflucht lange!«
»Opa hat ein böses Wort gesagt«, quietscht Annie und kichert.
Dad lacht und greift hinter sich, um ihr einen sanften Klaps aufs Knie zu geben.
Die vertraute Landschaft zieht am Fenster vorbei wie Schauplätze eines Films: St. Francisville, wo John James Audubon seine Vögel malte und das jetzt ein Atomkraftwerk beherbergt, dann die Abfahrt zur Strafvollzugsanstalt Angola und schließlich die Staatsgrenze, gekennzeichnet durch ein großes blaues Schild mit der Aufschrift WILLKOMMENINMISSISSIPPI! DERMAGNOLIENSTAAT.
»Was läuft denn so in Natchez?«
Dad wechselt auf die linke Spur und zieht an einem langen, mit Bauholz beladenen Truck vorbei. »Zur Abwechslung mal eine ganze Menge. Sieht so aus, als bekämen wir eine neue Fabrik. Und das ist gut so, denn das Batteriewerk steht vor der Pleite.«
»Was für eine Fabrik?«
»Ein Chemiewerk. Sie wollen es im neuen Industriegebiet am Fluss bauen, südlich der Papierfabrik.«
»Ist das schon sicher?«
»Ich glaube erst daran, wenn ich Rauch aus den Schornsteinen aufsteigen sehe. Bis dahin ist alles nur Gerede. Genau wie mit den Casino-Schiffen: Alle zwei Monate sagt eine neue Firma, sie wolle noch ein Boot eröffnen, aber es gibt nach wie vor nur das eine.«
»Was gibt es sonst Neues?«
»Eine große Wahl steht an.«
»Was wird gewählt?«
»Der Bürgermeister. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt gibt es einen schwarzen Kandidaten, der eine echte Chance hat, zu gewinnen.«
»Im Ernst? Wer ist es denn?«
»Shad Johnson. Er ist etwa in deinem Alter. Seine Eltern sind Patienten von mir. Du kennst ihn nicht, weil er als Kind eine Privatschule im Norden besuchte. Anschließend studierte er an der Howard University. Noch ein verdammter Anwalt, genau wie du.«
»Und er will Bürgermeister von Natchez werden?«
»Unbedingt. Er ist extra hierher gezogen, um anzutreten. Und wie gesagt, es könnte sein, dass er gewinnt.«
»Wie ist denn das Zahlenverhältnis zwischen Schwarzen und Weißen im Augenblick?«
»Registrierte Wähler? Etwa 51 Prozent Weiße und 49 Prozent Schwarze. Die Wahlbeteiligung unter den Schwarzen ist normalerweise ziemlich niedrig, aber bei diesen Wahlen könnte sich das ändern. Aber auf jeden Fall ist Johnson auf Stimmen von Weißen angewiesen, und es ist gut möglich, dass er einige bekommt. Man hat ihn gebeten, Mitglied des Rotary-Clubs zu werden.«
»Des Rotary-Clubs von Natchez?«
»Die Zeiten ändern sich. Und Shad Johnson ist klug genug, um das für sich zu nutzen. Du wirst ihn sicher bald kennen lernen. Die Wahlen sind schon in fünf Wochen. Verdammt, er wird bestimmt um deine Unterstützung bitten, so prominent wie du jetzt bist.«
»Opa hat schon wieder ein böses Wort gesagt!«, mischt Annie sich ein. »Aber nicht so schlimm.«
»Was hab ich denn gesagt?«
»V-E-R-D-A-M-M-T. Man soll verflixt sagen.«
Dad lacht und gibt ihr wieder einen Klaps aufs Knie.
»Ich möchte möglichst unerkannt bleiben«, sage ich ruhig. »Das ist eine rein private Reise.«
»Da hast du schlechte Chancen. Kurz bevor ich losfuhr, hat schon jemand für dich angerufen.«
»War es Cilla, meine Sekretärin?«
»Nein, es war ein Mann. Er wollte wissen, ob du schon angekommen wärst. Als ich nach seinem Namen fragte, legte er auf. Seine Nummer ist leider nicht auf dem Display erschienen. Er hat von zu weit weg angerufen.«
»Wahrscheinlich ein Reporter. Sie werden den ganzen Süden auf den Kopf stellen, um mich zu finden – wegen der Hanratty-Hinrichtung.«
»Wir werden tun, was wir können, damit du unerkannt bleiben kannst, aber der neue Zeitungsverleger hat schon viermal angerufen, um ein Interview mit dir zu bekommen. Jetzt, wo du hier bist, wirst du so was nicht vermeiden können. Jedenfalls nicht, ohne dass die Leute sagen würden, du hieltest dich für etwas Besseres.«
Ich lehne mich zurück und verarbeite, was ich gerade gehört habe. In meiner Heimatstadt Zuflucht zu finden könnte schwieriger werden, als ich gedacht hatte. Aber es wird immer noch besser sein als in Houston.
Natchez ist anders als alle anderen Städte in den Vereinigten Staaten. Die Uhren scheinen hier anders zu gehen, und das ist genau, was Annie und ich brauchen. Irgendwie scheint Natchez nicht einmal richtig zu Mississippi zu gehören. Es gibt keinen Platz, über den die Statue eines einsamen Konföderierten-Soldaten wacht, keinen endlosen Horizont über einem flachen Mississippi-Delta und keinen provinziellen Puritanismus. Natchez, die älteste Stadt am Mississippi, erhebt sich weiß und unberührt auf der Spitze eines siebzig Meter hohen Felsens – ein Juwel in der Krone der Schaufelraddampfer-Ära des 19. Jahrhunderts. So lange ich mich erinnern kann, lag die Einwohnerzahl der Stadt konstant bei 25.000, doch weil sie nacheinander von Indianern, Franzosen, Briten, Spaniern, Konföderierten und Amerikanern regiert wurde, ist sie weltoffener als so manche Stadt von der zehnfachen Größe. Manche Teile von New Orleans erinnern mich an Natchez, aber wirklich nur einige Ecken. Das moderne Leben hat schon vor langer Zeit Einzug in die Stadt des Halbmondes gehalten und sie für immer verändert. Zweihundert Meilen weiter flussaufwärts liegt Natchez in einem kleinen Zeitwirbel, der die Stadt auf irgendeine Weise vor den homogenisierenden Einflüssen der Gegenwart bewahrt hat.
Im Jahre 1850 gab es in Natchez mehr Millionäre als in jeder anderen amerikanischen Stadt mit Ausnahme von New York und Philadelphia. Ihr Vermögen gründete sich auf die Baumwolle, die wie weißes Gold von hier in die Spinnereien Englands strömte. Die Plantagen erstreckten sich über viele Meilen an beiden Seiten des Mississippi, und die Pflanzer, die sie verwalteten, bauten sich Villen, die Margaret Mitchells Tara wie eine bescheidene Hütte aussehen ließen. Während ihre Sklaven auf den Feldern schufteten, schickten die Prinzen dieser neuen Aristokratie ihre Söhne nach Harvard und ihre Töchter an die Königshäuser Europas. Auf dem Gipfel des Felsens tanzten sie Kotillons, eröffneten Bibliotheken und entwickelten neue Baumwollarten; siebzig Meter tiefer, im berüchtigten Viertel Under the Hill, veranstalteten sie Pferderennen, verkauften Sklaven, tranken, hurten und spielten – und etablierten so eine Tradition der Freizügigkeit, die bis heute überlebt hat und die den Status der Stadt als schwarzes Schaf in einem ansonsten als prüde bekannten Staat festigte.
Durch ein topographisches Missgeschick blieb Natchez vom Bürgerkrieg verschont. Der hohe Felsen ließ eher auf einen geraden Verlauf des Flusses als auf eine Biegung schließen, sodass Vicksburg zum kritischen Manövrierpunkt für die Schiffe der Konföderierten wurde und diese Stadt zu Belagerung und Zerstörung verurteilte. Das wehrlose Natchez dagegen machte das Beste aus der Besetzung durch die Unionstruppen. So bildet die Stadt mit Savannah und Charleston ein charmantes Trio durch und durch südlicher Städte, die den Krieg völlig intakt überlebten, ohne Einbußen ihrer Schönheit.
Der Baumwollkapselkäfer schaffte, was der Krieg nicht vermocht hatte und verursachte nach der Jahrhundertwende eine Wirtschaftsdepression in Natchez. Die Stadt lag brach, ihre Villen verfielen, bis die Damen der feinen Gesellschaft in den 30er Jahren damit anfingen, ihre einstmals prächtigen Häuser in einem alljährlichen »die Pilgerfahrt« genannten Ritual der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das so eingenommene Geld erlaubte es ihnen, den Villen wieder ihren einstigen Glanz zu verleihen, und schon bald strömten Yankees und Europäer in Scharen herbei, um das lebende Museum des Alten Südens zu besichtigen.
Als 1948 praktisch direkt unter der Stadt eine Ölquelle entdeckt wurde, setzte ein zweiter Boom ein. Das schwarze Gold trat an die Stelle des weißen, und auf den azaleengesäumten Straßen stolzierten nun wieder über Nacht zum Millionär gewordene Leute auf und ab, die so sehr in ihrem Reichtum schwelgten, als wären sie einem Roman von Scott Fitzgerald entsprungen. Ich wuchs inmitten dieses Booms auf und profitierte von dem Wohlstand, den er der Stadt brachte. Doch noch bevor ich mein Studium beendet hatte, endete der Ölboom so schnell, wie er begonnen hatte, und Natchez war wieder auf Einkünfte aus dem Tourismus und auf staatliche Subventionen angewiesen. Für die stolzen Einwohner der Stadt, die es niemals nötig gehabt hatten, der Industrialisierung des Nordens nachzueifern oder den Staat, dem sie nominell angehörten, um Unterstützung zu bitten, war diese Umstellung schwer zu verkraften.
»Was ist das?«, frage ich und zeige auf ein großes Wohnhaus, das weit südlich der mir bekannten Wohngebiete erbaut wird.
»Die Flucht der Weißen«, antwortet Dad. »Alles bewegt sich Richtung Süden – Wohnsiedlungen, der Country Club. Schau, da ist noch eine.«
Ein weiteres Wohngebiet taucht hinter einer schmalen Reihe von Eichen und Pinien auf. Es ähnelt den Vororten Houstons weit mehr als der romantischen Stadt meiner Erinnerung. Dann entdecke ich Mammy’s Cupboard, und ein beruhigendes Gefühl der Vertrautheit erfasst mich. Mammy’s ist ein Restaurant in Form einer Negermama mit rotem Reifrock und Bandanna, die aussehen soll wie Hattie McDaniel aus Vom Winde verweht. Sie steht auf ihrem Hügel wie eine riesige Puppe und lädt alle Vorbeifahrenden ein, in dem gemütlichen Raum unter ihren weiten Röcken zu essen. Jeder, der dieses Restaurant zum ersten Mal sieht, verlangsamt automatisch seine Fahrt, um es zu bestaunen. Das berühmte Brown Derby in Los Angeles wirkt im Vergleich zum Mammy’s fantasielos.
Unser Auto erreicht den höchsten Punkt eines Bergrückens, und wir blicken auf ein Meer von Baumwipfeln, das sich nach Westen bis in die Unendlichkeit fortzusetzen scheint. Hinter dem Fluss liegt die große, fruchtbare Ebene von Louisiana – so weit unterhalb der Höhe von Natchez, dass nur die Rauchwolke der Papierfabrik das Vorhandensein menschlicher Zivilisation verrät. Wir überqueren den Grat und beginnen den langen Abstieg in die Stadt, vorbei an St. Stephens, meiner früheren, rein weißen Schule, und einem Dutzend Geschäfte, die noch genauso aussehen wie vor zwanzig Jahren. Am Kreuz zwischen den Highways 61 und 84 steht das Jefferson Davis Memorial Hospital. Offiziell trägt es jetzt einen politisch korrekten Namen, aber für die Ärzte der Generation meines Vaters und für Hunderte von Menschen – schwarze wie weiße –, die in diesem Krankenhaus arbeiteten oder dort geboren wurden, wird es immer das »Jeff« bleiben.
»Alles sieht noch genauso aus wie früher«, murmle ich.
»Irgendwie ist auch alles beim Alten geblieben«, antwortet mein Vater. »Andererseits aber auch wieder nicht.«
»Wie meinst du das?«
»Du wirst schon sehen.«
Meine Eltern wohnen immer noch in dem Haus, in dem ich aufwuchs. Während andere beruflich erfolgreiche junge Leute in neuere Siedlungen umzogen, viktorianische Kitschbauten oder Kolonialvillen in der Stadtmitte restaurierten, hielt mein Vater eigensinnig an der eschengetäfelten Bibliothek in seinem 1963 gekauften Vororthäuschen fest. Immer wenn meine Mutter den Wunsch äußerte, in ein standesgemäßeres Haus zu ziehen, baute er an und verschaffte ihr so den zusätzlichen Platz, den sie sich wünschte, und einen neuen Raum, den sie dekorieren und dem sie ihre kreativen Energien widmen konnte.
Als der BMW in die Einfahrt einbiegt, stelle ich mir vor, wie meine Mutter im Haus wartet. Sie hatte mir den Erfolg draußen in der Welt immer gewünscht, aber es brach ihr das Herz, als Sarah und ich uns in Houston niederließen. Sieben Stunden Fahrt sind zu viel für regelmäßige Besuche, und Mom fliegt nicht gern. Trotzdem sind die Bande zwischen uns nach wie vor so stark, dass die Entfernung nur wenig Bedeutung hat. Als ich noch ein Junge war, sagten die Leute immer, dass ich Dad sehr ähnlich sei und »die Intelligenz vom Vater« habe. Aber es ist Mutters seltene Kombination aus Herz und Verstand, die ich glücklicherweise geerbt habe.
Dad stellt den Motor ab und befreit Annie aus dem Kindersitz. Als ich unser Gepäck aus dem Kofferraum hole, sehe ich einen regungslosen Schatten hinter dem geschlossenen Vorhang des Esszimmers. Meine Mutter. Dann bewegt sich ein zweiter Schatten hinter dem Vorhang. Wer kann das sein? Nicht meine Schwester: Jenny gibt gerade eine Gastprofessur am Trinity College in Dublin, Irland.
»Wer ist denn noch da?«
»Wart’s ab«, sagt Vater geheimnisvoll.
Ich trage zwei Koffer auf die Veranda und gehe zurück zum Auto, um Annies Tasche zu holen. Als ich die Veranda zum zweiten Mal erreiche, steht meine Mutter in der offenen Tür. Bevor sie sich auf die Zehenspitzen stellt und mich in ihre Arme zieht, sehe ich mit einem raschen Blick, dass sie sich die Haare nicht mehr färbt, und das Grau jagt mir einen kleinen Schrecken ein.
»Willkommen zu Hause«, flüstert sie mir ins Ohr. Sie tritt zurück, ihre Hände greifen meine Oberarme, und sie schaut mich fest an. »Du isst immer noch nicht. Geht es dir gut?«
»Ich weiß nicht. Annie scheint einfach nicht darüber hinwegzukommen, was passiert ist. Und ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann.«
Sie drückt meine Arme mit der ihr eigenen Kraft, die ich noch nie habe versagen sehen. »Dafür sind Großmütter schließlich da. Alles wird gut – von diesem Moment an.«
Mit ihren 63 Jahren ist meine Mutter immer noch eine schöne Frau. Allerdings besitzt sie nicht die zerbrechliche Schönheit, die man aus so vielen Südstaaten-Romanen kennt. Unter der gebräunten Haut und dem Donna-Karan-Kleid stecken der Körper und der Humor eines Mädchens, das bei seinem sozialen Aufstieg seine Wurzeln nicht vergessen hat. Sie könnte mit Mitgliedern des Königshauses Tee trinken, ohne einen Fauxpas zu begehen, und mit der gleichen Mühelosigkeit einer Henne den Hals umdrehen, einem Schwein die Borsten abziehen oder einer wütenden Giftschlange mit einer Hacke den Kopf abschlagen. Es ist diese Zähigkeit, die mir jetzt Sorgen macht.
»Mom, was ist los? Am Telefon …«
»Pst. Wir reden später.« Sie blinzelt ein paar Tränen fort, dann schiebt sie mich ins Haus und nimmt Annie aus Dads Armen. »Da ist ja mein kleiner Engel! Jetzt gibt es Abendessen, ganz ohne ekligen Brokkoli!«
Annie quietscht vor Aufregung.
»Drinnen wartet jemand darauf, dir guten Tag zu sagen, Penn«, sagt Mom.
Ich trage die Koffer ins Haus. Eine breite Tür führt von der Diele ins Esszimmer, und ich erstarre, als ich sehe, wer hier ist. Neben dem langen Tisch steht eine schwarze Frau, so groß wie ich und etwa fünfzig Jahre älter. Sie lächelt, und ihre Augen glitzern vor Freude.
»Ruby!«, rufe ich, setze die Koffer ab und gehe auf sie zu. »Was in aller Welt …?«
»Heute ist ihr freier Tag«, erklärt Mom hinter mir. »Ich rief sie an, um zu fragen, wie es ihr geht. Als sie hörte, dass du kommst, bestand sie darauf, dass Tom sie abholt, damit sie dich sehen kann.«
»Und das Enkelchen«, sagt Ruby und deutet auf Annie in Peggys Armen.
Ich umarme die alte Frau zärtlich. Sie fühlt sich an wie ein Bündel Stöcke. Ruby Flowers begann 1963 für uns zu arbeiten. Bis auf ein einziges Mal, als sie lebensgefährlich erkrankte, verpasste sie nicht einen Arbeitstag. Erst dreißig Jahre später zwang ihre Arthritis sie, kürzer zu treten. Sogar dann bat sie meinen Vater um Injektionen von Steroiden, damit sie weiterhin ihre »schweren« Arbeiten wie Bügeln und Schrubben verrichten könnte. Er weigerte sich. Stattdessen zahlt er ihr weiter ihren vollen Lohn, erlaubte ihr aber nur noch, Socken zu stopfen, hin und wieder eine Maschine Wäsche zu waschen und sich Soaps im Fernsehen anzuschauen.
»Tut mir sehr leid, das mit deiner Frau«, sagt Ruby. »Neben dem Verlust eines Kindes kann einem wohl nichts Schlimmeres passieren.«
Ich drücke sie noch einmal.
»Jetzt lass mich das Baby sehen. Komm her, Kleine.«
Ich frage mich, ob Annie sich noch an Ruby erinnert und ob sie Angst vor der alten Frau hat. Ich hätte es besser wissen müssen. Nichts an Ruby Flowers’ Ausstrahlung könnte ein kleines Kind erschrecken. Sie ist wie eine gütige Hexe aus einem afrikanischen Märchen. Annie geht ohne das geringste Zögern zu ihr.
»Ich habe deinem Daddy sein Leibgericht gekocht«, sagt Ruby und nimmt Annie fest in die Arme. »Und ab heute Abend wird es auch dein Leibgericht sein!«
In der Mitte des Tisches steht ein großer, mit goldbraun gebratenem Hühnchen voll gehäufter Teller. Ich habe Ruby tausendmal bei der Zubereitung dieses Hühnchens zugeschaut. Mit nichts anderem als Salz, Pfeffer, Mehl und Crisco kreiert sie einen unglaublichen Geschmack und eine Konsistenz, an die Harland Sanders mit seinem besten Schnellkochtopf nicht herankommt. Ich schnappe mir einen Flügel und nehme einen Bissen von dem weißen Fleisch, das außen knusprig und innen saftig ist und meinen Mund mit einem köstlichen und wohlvertrauten Geschmack füllt.
»Hau deinem Daddy auf die Finger!«, ruft Ruby, und Annie gehorcht ihr blitzschnell. »Setz dich hin und iss anständig. Ich hole den Eistee.«
»Ich hol den Tee schon«, sagt Mom und läuft in die Küche, bevor Ruby es tun kann. »Bedien dich, Ruby, heute bist du unser Gast.«
Unsere Familie spricht nur an Thanksgiving und zu Weihnachten ein Tischgebet, und auch zu diesen Anlässen ist es eher eine Formalität. Doch weil Ruby mit am Tisch sitzt, wagt keiner, zur Gabel zu greifen.
»Möchtest du das Dankgebet sprechen, Ruby?«, fragt Dad.
Die alte Frau schüttelt den Kopf, ihre Augen leuchten verschmitzt. »Ich wünschte, Sie würden es tun, Dr. Cage. Sie sprechen so schöne Tischgebete.«
Achtunddreißig Jahre medizinischer Praxis haben meinen Vater aus der harten religiösen Schale befreit, die ihm in den Baptistenkirchen seiner Jugend übergestülpt wurde. Doch wenn man ihn drängt, kann er ein Gebet sprechen, das aus so langen, gewundenen Sätzen und blumig ausgeschmückten Details besteht, dass so mancher Prediger daneben verblassen würde. Er scheint im Begriff zu sein, eines von diesen Gebeten für uns zu sprechen – speziell für mich mit einigen ironischen Untertönen versehen. Doch meine Mutter bremst ihn mit einer leichten Berührung. Sie senkt den Kopf, und alle am Tisch folgen ihrem Beispiel.
»Vater«, sagt sie, »es ist zu viel Zeit vergangen, seit wir in diesem Haus das letzte Dankgebet gesprochen haben. Heute Abend möchten wir dir danken, dass unser Sohn, der so lange fort war, zu uns zurückgekehrt ist. Wir danken dir auch für unser wunderhübsches Enkelkind Anna Louise Cage und beten, dass wir ihr so viel Glück zurückgeben können, wie sie uns jeden Tag schenkt.« Sie hält inne, eine kurze Zäsur, mit der sie unsere Konzentration sammelt. »Wir bitten dich, dass du dich der Seele von Sarah Louise Cage annimmst und dass sie auf ewig in deinem Schoß ruhen darf.«
Ich greife unter den Tisch, um Annies Hand zu drücken.
»Wir behaupten nicht, dass wir den Tod verstehen«, fährt Mom sanft fort. »Wir bitten dich nur, dass du die Wunden dieser jungen Familie verheilen und sie den Verlust verschmerzen lässt. Dies ist ein Haus der Liebe, und wir bitten demütig um deine Gnade. Amen.«
»Amen«, wiederholen wir, und Dad und ich schauen uns über den Tisch hinweg an. Die Leidenschaft meiner Mutter hat uns bewegt, nicht aber das Objekt dieser Leidenschaft. Was die Religion betrifft, bin ich ganz und gar meines Vaters Sohn. Ich glaube nicht an einen gerechten Gott – oder überhaupt an irgendeinen Gott –, wenn ich um vier Uhr morgens wachgerüttelt und danach gefragt werde. Es gab Zeiten, da hätte ich alles darum gegeben, glauben zu können – an eine göttliche Gerechtigkeit, die irgendwo im Universum existiert. Ohne einen solchen Glauben mit Sarahs Tod konfrontiert zu werden, war eine existenzielle Feuertaufe. Der Trost, den der Glaube an ein Leben nach dem Tod geben kann, war in den Warteräumen des Krankenhauses und der Chemo-Stationen sehr offensichtlich. Patienten oder Familienangehörige fragten mich oft unverblümt, ob ich bekehrt sei. Ich lächelte dann immer und nickte, um eine philosophische Diskussion zu vermeiden, von der niemand profitieren würde. Ob diese Frage wohl typisch für die Krankenhäuser der Südstaaten ist? Im Nordwesten, am Pazifik, werden einem vermutlich Kristalle oder Listen von Alternativ-Heilern angeboten. Ich bedaure es aber nicht, dass Sarah Annie kirchlich erzogen hat. Manchmal ist die Vorstellung, dass ihre Mutter jetzt im Himmel ist, alles, was sie vor der Verzweiflung bewahrt.
Während Dad Senfgemüse, Käsehappen und Bierbiskuits weiterreicht, stellt sich eine weitere ungebetene Erinnerung ein. In einer kalten Stunde neben Sarahs Krankenhausbett, kurz vor der Morgendämmerung, fiel ich auf die Knie und bat Gott, sie zu retten. Die Worte bildeten sich ohne mein Zutun und fügten sich zu Sätzen von seltsam barocker Formalität: Ich, der ich seit meiner Kindheit nicht geglaubt habe, der ich seit meinem dreizehnten Lebensjahr keine Kirchenschwelle mehr übertreten habe, um zu beten, der ich mein ganzes Erwachsenenleben lang an nichts Größeres geglaubt habe als an den Menschen und die Natur, ich bitte dich in aller Demut, dass du das Leben dieser Frau verschonst. Ich bitte nicht für mich selbst, sondern für das Kind, das allein zu erziehen ich mich nicht imstande sehe