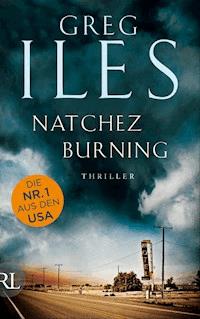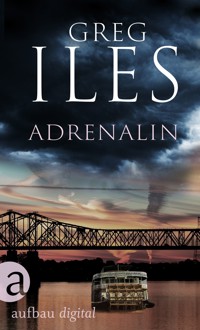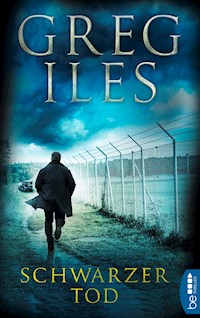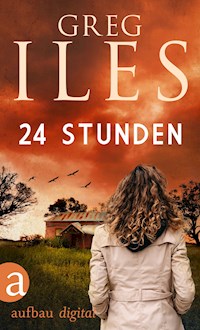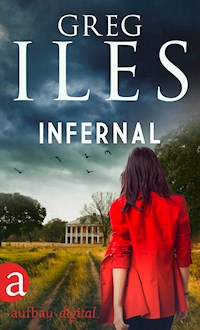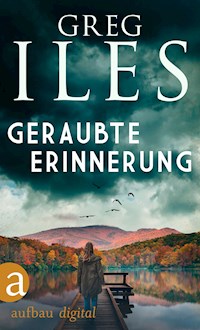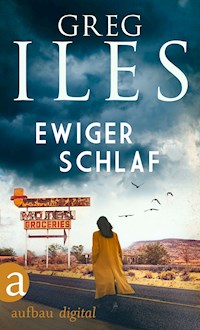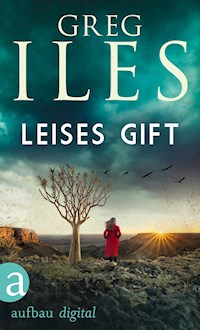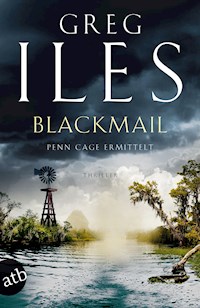11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ich hatte nie vor, meinen Bruder zu töten.
Ich hatte nie die Absicht, meinen Vater zu hassen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich meinen eigenen Sohn beerdigen würde. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich den Kindheitsfreund betrügen würde, der mir das Leben rettete, oder dass ich für eine Lüge den Pulitzerpreis bekommen würde.
All diese Dinge habe ich getan, und doch würden mich die meisten Leute, die mich kennen, als ehrenwerten Mann bezeichnen. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich versuche, ein guter Mensch zu sein, und ich glaube, dass es mir meistens gelingt. Wie ist das nur möglich? Wir leben in komplizierten Zeiten.
Und es ist nicht einfach, ein guter Mensch zu sein.
»Ein großartiges Werk von herausragender Bedeutung, voller Kraft und von großer Ernsthaftigkeit.«
Washington Post über die Natchez-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1137
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
HarperCollins®
Copyright © 2019 für die deutsche Ausgabe by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
Copyright © 2019 by Greg Iles Originaltitel: »Cemetery Road: a novel« Erschienen bei: William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, US
Published by arrangement with HarperCollins Publishers L.L.C., New York
Covergestaltung: bürosüd, München Coverabbildung: Mike Hollingshead / Getty Images, www.buerosued.de unter Verwendung von: Henryk Sadura, Pictureguy / Shutterstock Lektorat: Thorben Buttke E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959678834
www.harpercollins.de
Widmung
Für all die Erwachsenen,
die nach Hause zurückkehren,
um eine Schuld aus der Kindheit zu begleichen,
und die feststellen,
dass sie nie wirklich fortgegangen sind.
Hört zu, solange ihr noch könnt.
Zitat
Ein Geheimnis ist nicht etwas, das nicht erzählt wird.
Es ist etwas, das nicht erzählt werden kann.
Terence McKenna
KAPITEL 1
Ich hatte nie vor, meinen Bruder zu töten. Ich hatte nie die Absicht, meinen Vater zu hassen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich meinen eigenen Sohn beerdigen würde. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich den Kindheitsfreund betrügen würde, der mir das Leben rettete, oder dass ich für eine Lüge den Pulitzerpreis bekommen würde.
All diese Dinge habe ich getan, und doch würden mich die meisten Leute, die mich kennen, als ehrenwerten Mann bezeichnen. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich versuche, ein guter Mensch zu sein, und ich glaube, dass es mir meistens gelingt. Wie ist das nur möglich? Wir leben in komplizierten Zeiten.
Und es ist nicht einfach, ein guter Mensch zu sein.
KAPITEL 2
Buck Ferris war auf die Knie gesunken und zog eine Kugel aus gebranntem Ton aus dem sandigen Boden neben dem Mississippi, erhob sich stöhnend auf die Füße und kletterte aus der Grube neben dem Grundpfeiler. Im Mondlicht war es schwierig, das Alter des Fundes sicher zu bestimmen, und Buck konnte es nicht riskieren, Licht anzumachen – nicht hier. Und trotzdem … war er sich sicher. Die Kugel in seiner Hand hatte man ein paar Jahrhunderte vor der Zeit gebrannt, als Moses mit den Kindern Israels in die Wüste aufbrach. Ferris war seit sechsundvierzig Jahren Archäologe, aber noch nie hatte er etwas dergleichen entdeckt. Er hatte das Gefühl, als vibrierte die kleine Kugel in seiner Hand. Der letzte Mensch, der diesen Ton berührt hatte, hatte vor beinahe viertausend Jahren gelebt – zwei Jahrtausende bevor Jesus von Nazareth durch den Sand Palästinas schritt. Sein Leben lang hatte Buck darauf gewartet, dieses Artefakt zu finden; dieser Fund stellte alles in den Schatten, was er je getan hatte. Wenn er recht hatte, war der Boden, auf dem er stand, die wichtigste bisher unentdeckte archäologische Stätte in ganz Nordamerika.
»Was hast du denn da, Buck?«, ertönte eine Männerstimme.
Bläulich-weißes Licht stach Ferris in die Augen. Fast hätte er sich vor Schreck bepisst. Er hatte geglaubt, auf dem riesigen, niedrig gelegenen Gelände des Industrieparks allein zu sein. Eine Viertelmeile weiter westlich floss der ewige Mississippi vorüber, nichtsahnend.
»Wer sind Sie?«, fragte Ferris und hob die Linke, um seine Augen abzuschirmen. »Wer ist da?«
»Man hat dich gewarnt, diesen Boden nicht anzurühren«, sagte der Mann hinter dem Licht. »Das ist Privateigentum.«
Der Sprecher hatte einen gebildeten Südstaatenakzent, der Buck irgendwie bekannt vorkam. Doch er konnte ihn niemandem zuordnen. Zu seiner Verteidigung konnte Buck auch nicht viel vorbringen. Im Lauf der letzten vierzig Jahre hatte er sieben Mal die Erlaubnis beantragt, auf diesem Gelände zu graben, und war jedes Mal abgewiesen worden. Aber vor fünf Tagen hatte die Bezirksverwaltung die Trümmer der Galvanisierfabrik forträumen lassen, die hier seit dem Zweiten Weltkrieg gestanden hatte. Und in zwei Tagen würde ein chinesisches Unternehmen anfangen, an ihrer Stelle eine neue Papierfabrik zu bauen. Wenn jemand herausfinden sollte, was unter dieser Erde lag, dann jetzt – und zum Teufel mit den Konsequenzen.
»Wo kommst du denn her?«, fragte Buck. »Ich habe niemand gesehen, als ich eingetroffen bin.«
»O Buck … Du warst immer so ein braver Junge. Wieso konntest du die Sache nicht auf sich beruhen lassen?«
»Kenn ich dich?«, fragte Ferris, der sich sicher war, dass er die Stimme schon einmal gehört hatte.
»Anscheinend nicht.«
»Ich glaube nicht, dass du verstehst, welchen Wert das hier hat«, sagte Ferris mit vor Aufregung schriller Stimme.
»Du hast da gar nichts«, erwiderte die Stimme. »Du bist nicht einmal hier.«
Da begriff Buck in groben Zügen, und in seinem Magen begann etwas zu surren wie ein straff gespannter Draht, der fest gezupft wird. »Warte, hör zu«, brachte er vor, »dieser Boden, auf dem du stehst … das ist eine viertausend Jahre alte Indianersiedlung. Vielleicht fünf- oder sechstausend Jahre alt, je nachdem, was wir finden, wenn wir tiefer graben.«
»Du hoffst wohl auf eine Fernsehserie im PBS?«
»Großer Gott, nein. Verstehst du nicht, was ich dir erkläre?«
»Klar doch. Du hast irgendwelche Indianerknochen gefunden. Die Sache ist die: Das ist eine schlechte Nachricht für alle.«
»Nein, hör doch zu. Fünfzig Meilen von hier entfernt in Louisiana gibt es eine Stätte genau wie diese hier. Die heißt Poverty Point. Das ist eine Welterbestätte der UNESCO. Da kommen jedes Jahr Tausende von Touristen hin.«
»Da war ich schon. Ein paar Dreckhügel, und das Gras müsste mal wieder gemäht werden.«
Schließlich begriff Buck, dass er genauso hätte versuchen können, einem Hillbilly was von Bach zu erzählen. »Das ist doch lächerlich. Du …«
»Eine Milliarde Dollar«, fuhr der Mann dazwischen.
»Wie bitte?«
»Eine Milliarde Dollar. So viel könntest du diese Stadt kosten.«
Buck versuchte, sich auf das Gespräch zu konzentrieren, aber die Kugel in seiner Hand schien immer noch zu vibrieren. Sie war unter dem Namen »Poverty-Point-Artefakt« bekannt, und die Indianer hatten sie benutzt, um im Schlamm Fleisch zu garen. Gott allein wusste, was sonst noch im Lössboden unter ihren Füßen lag. Keramik, Speerspitzen, Schmuck, religiöse Gegenstände, Knochen. Wie konnte jemand nicht verstehen, was es bedeutete, auf diesem Boden zu stehen und zu wissen, was er wusste? Wie konnte das jemandem egal sein?
»Das muss doch eure Abmachung nicht zunichtemachen«, sagte er. »Situationen wie diese werden doch ständig zur Zufriedenheit aller beteiligten Parteien irgendwie geregelt. Der Denkmalschutz kommt dazu, bewertet die Stätte, und sie entfernen Artefakte, falls das überhaupt nötig ist. Um sie zu schützen. Das ist alles.«
»Hätten die den ganzen Poverty Point fortgeschafft, um eine Papierfabrik zu bauen, Buck?«
Nein, dachte er. Das hätten sie nicht.
»Eine Milliarde Dollar«, wiederholte der Mann. »In Mississippi. Das entspräche in der großen weiten Welt eher zehn Milliarden. Und da reden wir noch nicht mal davon, was es mich persönlich kosten könnte, wenn wir die Papierfabrik verlieren.«
»Könntest du das Licht aus meinen Augen nehmen?«, fragte Buck. »Können wir uns nicht wie zivilisierte Menschen unterhalten?«
»Mach’s«, sagte die Stimme.
»Was?«, fragte Buck. »Was soll ich machen?«
»Ich habe dein Gitarrenspiel immer sehr gemocht«, sagte der Mann. »Du hättest dabeibleiben sollen.«
Buck hörte, wie sich hinter ihm etwas bewegte, konnte sich jedoch nicht schnell genug umdrehen, um zu sehen, wer da war, oder um sich zu schützen. Auf seiner Netzhaut brannte noch ein weißes Nachbild, und aus diesem Weiß tauchte ein dichtes schwarzes Rechteck auf.
Ziegelstein.
Er riss die Hände in die Höhe, aber es war zu spät. Der Ziegelstein krachte auf seinen Schädel und verzerrte seine Wahrnehmung. Er spürte nur Schmerz und torkelnde Übelkeit, als er in die Dunkelheit stürzte. Das Gesicht seiner Frau flackerte vor seinem Auge, bleich vor Sorgen, als er sie am Abend verlassen hatte. Während er auf die Erde prallte, dachte er an Hernando de Soto, der 1542 nicht weit von hier in der Nähe des Mississippi gestorben war. Er fragte sich, ob diese Männer ihn neben dem Fluss begraben würden, den er so lange schon liebte.
»Schlag ihn noch mal«, sagte die Stimme. »Schlag ihm das Hirn zu Brei.«
Buck versuchte, seinen Kopf zu schützen, aber seine Arme wollten sich nicht bewegen.
KAPITEL 3
Ich heiße Marshall McEwan.
Mit achtzehn bin ich zu Hause weggelaufen. Ich bin nicht vor dem Staat Mississippi weggelaufen – sondern vor meinem Vater. Ich habe mir damals geschworen, dass ich niemals zurückgehen würde, und habe mein Versprechen sechsundzwanzig Jahre lang gehalten, mit Ausnahme einiger kurzer Besuche bei meiner Mutter. Es war kein leichter Weg, aber schließlich war ich einer der erfolgreichsten Journalisten von Washington, D. C. Die Leute meinten, ich hätte die Druckerschwärze im Blut; mein Vater war in den 1960er Jahren ein legendärer Chefredakteur und Zeitungsherausgeber – die New York Times hat ihn einmal als »das Gewissen von Mississippi« bezeichnet –, aber ich habe mein Geschäft nicht von Duncan McEwan gelernt. Mein Vater war eine Legende, die zum Säufer wurde und wie die meisten Säufer auch einer blieb. Trotzdem verfolgte er mich wie ein zweiter Schatten an meiner Seite. Also war es wohl unvermeidlich, dass sein Tod mich nach Hause zurückbringen würde.
Oh, er ist noch nicht tot. Sein Tod rückt näher wie ein einsames schwarzes Schiff, das sich durch die Wellen ankündigt, die es vor sich herschiebt, dunkle Wellen, die einen einst so scharfen Verstand stören und die über die schützenden Grenzen einer Familie hinwegrollen. Angetrieben wird dieses schwarze Schiff von komorbiden Störungen, wie die Ärzte es nennen: Parkinson, Herzversagen, Bluthochdruck, Säuferleber. So lange ich konnte, habe ich die Situation ausgeblendet. Ich habe schon gesehen, wie brillante Kollegen – die meisten zehn oder fünfzehn Jahre älter als ich – zu kämpfen haben, um in den kleinen Städten der Republik ihre kränklichen Eltern zu pflegen, und in allen Fällen hat ihre Laufbahn darunter gelitten. Durch Zufall oder Karma erlebte meine Karriere 2016 nach der Wahl von Trump einen kometenhaften Aufstieg. Und ich hatte nicht die geringste Lust, von meinem Kometen herunterzuspringen und wieder in Mississippi zu landen, um dort bei einem Vierundachtzigjährigen den Babysitter zu spielen, zumal der seit meinem vierzehnten Lebensjahr so getan hatte, als existierte ich nicht.
Schließlich gab ich mich geschlagen, weil mein Vater so krank war, dass ich meine Mutter nicht mehr aus tausend Meilen Entfernung bei der Pflege unterstützen konnte. Dad war in den letzten drei Jahrzehnten immer tiefer in Wut und Depression versunken, machte dabei alle in seiner Umgebung unglücklich und ruinierte seine Gesundheit. Doch da ich im Herzen ein braver Südstaatenjunge bin, war es nicht mehr relevant, dass seit über dreißig Jahren ein unüberbrückbarer Graben zwischen ihm und mir klaffte. Hier unten ist es ein ungeschriebenes Gesetz: Wenn dein Vater im Sterben liegt, gehst du nach Hause und hältst mit deiner Mutter die Totenwache. Außerdem verfiel unser Familienunternehmen – der Bienville Watchman (gegründet 1865) – unter Dads zunehmend unberechenbarer Leitung zusehends, und da er sich die letzten beiden Jahrzehnte starrköpfig geweigert hatte, diesen Dinosaurier von einer Zeitung zu verkaufen, musste ich den Laden am Laufen halten, bis wir das, was davon übrig war, nach seinem Tod an jemanden zum Ausschlachten verkaufen konnten.
Das redete ich mir jedenfalls ein.
In Wirklichkeit war mein Motiv komplizierter. Wir handeln kaum je logisch, wenn wir in unserem Leben vor wichtigen Entscheidungen stehen. Damals konnte ich meinen Selbstbetrug nicht erkennen. Ich befand mich immer noch in dem lang anhaltenden Schockzustand nach einer Ehe, die eine Tragödie überstanden – oder vielmehr nicht überstanden – hatte und dann, als meine berufliche Laufbahn in die Stratosphäre abhob, in eine Scheidung trudelte. Doch jetzt begreife ich es.
Ich bin wegen einer Frau nach Hause gekommen.
Sie war noch ein Mädchen, als ich von zu Hause wegging, und ich war ein verwirrter Junge. Aber ganz gleich, wie unerbittlich das Leben versuchte, die Weichheit aus mir herauszuprügeln und mich in den harten, spröden Panzer des Zynismus zu hüllen, so blieb in mir doch etwas Reines erhalten, lebendig und wahr: Das Mädchen, halb aus Jordanien, halb aus Mississippi, das mir die geheimen Freuden des Lebens enthüllte, hatte sich so tief in meine Seele eingegraben, dass keine andere Frau je an sie heranreichte. Achtundzwanzig Jahre Trennung hatten nicht ausgereicht, um meine Sehnsucht nach ihr abzutöten. Manchmal fürchte ich, dass meine Mutter mein geheimes Motiv von Anfang an kannte (oder vielleicht nur spürte und betete, dass sie sich irrte). Ganz gleich, ob sie es weiß oder ob sie so unwissend geblieben ist wie ich an dem Tag, als ich endlich klein beigab, jedenfalls ließ ich mich von meinen Jobs in Presse und Fernsehen beurlauben, packte das Nötigste ein und fuhr mit vor Anspannung weißen Knöcheln in den Süden, um den berühmtesten Ausspruch von Thomas Wolfe zu testen.
Natürlich kannst du wieder nach Hause gehen, antwortete mein Stolz. Zumindest für kurze Zeit. Du kannst deine Sohnespflicht tun. Denn welcher Mann, der sich für einen Gentleman hält, würde das nicht tun? Und sobald die Pflicht erfüllt ist und er tot ist, kannst du vielleicht deine Mutter dazu überreden, mit dir nach Washington zu kommen. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich wusste ich, dass es eine müßige Hoffnung war. Doch sie gab mir etwas, das ich mir einreden konnte, damit ich nicht zu sehr über das unlösbare Problem nachdenken musste. Nein, nicht die Lage meines Vaters. Das Mädchen. Sie ist natürlich jetzt eine Frau, eine Frau mit einem Ehemann, der vielleicht mein bester Kindheitsfreund ist. Sie hat auch einen zwölfjährigen Sohn. Und während dieser Knoten in unserem Zeitalter der allgegenwärtigen Scheidungen vielleicht nicht viel von einem gordischen Knoten hat, sorgen doch andere Faktoren dafür, dass es wirklich einer ist. Die Misere meines Vaters hingegen … wird sich zwangsläufig irgendwann erledigen.
Das klingt vielleicht eiskalt.
Ich sage nicht, dass Dad die Schuld an seiner Situation selbst trägt. Er hat, Gott weiß, seinen Teil Leiden erduldet – genug, um ihn lebenslang von der Religion zu heilen. Zwei Jahre ehe er meine Mutter heiratete, verlor er bei einem Autounfall seine erste Frau und die gemeinsame kleine Tochter. Und als wäre das nicht genug, kam mein achtzehnjähriger Bruder, als ich in der neunten Klasse war, auch bei einem Unfall ums Leben, bei einer Tragödie, die wie eine Bombe aus unsichtbarer Höhe auf unsere Stadt herabstürzte. Vielleicht hat es meinen Vater gebrochen, zwei Kinder nacheinander zu verlieren. Ich könnte das verstehen. Als mein Bruder Adam starb, war es für mich, als hätte Gott den Arm ausgestreckt und das Licht der Welt ausgeknipst, und ich stolperte wie ein Erblindeter, der sich nicht mit seinem neuen Leiden zurechtfindet, durch die nächsten zwei Jahre.
Aber »Gott« war mit mir noch nicht fertig. Zwanzig Jahre nach Adams Tod verlor ich meinen zweijährigen Sohn – mein einziges Kind – bei einem stinknormalen Haushaltsunfall. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn einen das Schicksal bricht.
Aber ich funktioniere noch.
Ich melke meine Informanten, ich schreibe Artikel, ich kommentiere auf CNN und MSNBC die Themen des Tages. Ich kann sogar Reden zu 35.000 Dollar das Stück halten (vielmehr konnte ich das, ehe ich wieder in meinen Drittweltstaat gezogen bin und damit meinen journalistischen Marktwert in einen irreversiblen Sturzflug katapultierte). Ich habe gelitten, aber ich habe weitergemacht. Das wurde mir so beigebracht – natürlich von meiner Mutter, nicht von meinem Vater. Und von Buck Ferris, dem Archäologen und Pfadfinderführer, der, nachdem mein Vater seine väterlichen Pflichten aufgegeben hatte, an seine Stelle trat und sein Möglichstes tat, um einen Mann aus mir zu machen. Nach all meinen Erfolgen meinte Buck, er hätte das wohl geschafft. Ich war mir nie so ganz sicher. Wenn ich es mir eines Tages doch beweisen könnte, würde er es nie erfahren. Denn irgendwann letzte Nacht wurde Buck Ferris ermordet.
Bucks Tod scheint der natürliche Anfang für diese Geschichte zu sein, denn so fangen diese Dinge gewöhnlich an. Ein Tod stellt eine praktische Demarkationslinie dar, triggert den vertrauten Dreiklang von Ermittlung, Schuldzuweisung, Bestrafung. Aber Anfänge sind kompliziert. Es kann Jahrzehnte dauern, bis die genaue Kette von Ursache und Wirkung feststeht, die zu einem einzigen Ergebnis geführt hat. Das habe ich bei meinem Uniabschluss in Geschichte gelernt, wenn auch sonst nicht viel. Aber ich kann keine zwanzig Jahre warten, bis ich diese Ereignisse anspreche. Denn im Augenblick bin ich zwar gesund – und habe getan, was ich konnte, um mich zu schützen –, doch es gibt Menschen, denen es lieber wäre, wenn ich nicht so gesund wäre. Am besten bringe ich alles jetzt gleich zu Papier.
Doch während wir diese vertrauten Schritte miteinander tanzen, vergessen Sie bitte nicht, dass nichts so ist, wie es scheint. Der Mord an Buck ist zwar ein natürlicher Anfangspunkt, aber diese Geschichte begann eigentlich, als ich vierzehn Jahre alt war. Die Leute, deren Lebenswege sich mit fatalen Folgen ineinander verschlingen sollten, lebten damals noch, und einige liebten sich bereits. Um diese Geschichte zu verstehen, müssen Sie zwischen zwei Zeiten schwimmen wie jemand, der sich zwischen Wachen und Schlaf hin und zurück bewegt. Die Natur unseres Geistes ist so angelegt, dass wir die Träume im Schlaf für die Vergangenheit halten, nie ganz präzise in der Erinnerung, immer so geschaffen, dass sie unseren Begierden dienen (außer wenn sie uns wegen unserer Sünden heimsuchen). Und die wache Gegenwart … nun, auch die birgt ihre Gefahren.
Als ich dreizehn war, sah ich einmal im Wald eine Virginiawachtel auf einem Baumstamm hocken. Eine zweite Wachtel lag zu ihren Füßen. Sie schien tot zu sein, aber ich kniete mich sehr nahe hin und beobachtete beide eine halbe Minute lang. Eine blieb reglos, die andere machte fragende Bewegungen, als wartete sie ungeduldig darauf, dass ihr Partner aufstünde. Erst nachdem meine Augen, vielleicht weil sie überanstrengt waren, nicht mehr scharf sahen, bemerkte ich die Klapperschlange, die zwei Fuß entfernt aufgerollt lag und sich zum Angriff anspannte. Die schwere Diamant-Klapperschlange war vier Fuß lang und konzentrierte sich auf mich, nicht auf den Vogel.
Ich überlebte an diesem Tag und lernte eines: Wenn man nah genug ist, um zu sehen, ist man nah genug, um zu töten.
KAPITEL 4
Als ich erfuhr, dass eine Leiche im Mississippi trieb, hatte der Sheriff bereits das Rettungsboot des Bezirks ausgesandt, um sie zu bergen. Normalerweise würde ich einen Reporter losschicken, um darüber zu berichten, aber weil mein Informant sich ziemlich sicher war, dass der Tote Buck Ferris war, weiß ich, dass ich selbst hinmuss. Was Probleme verursacht. Für mich sind Wasser und Tod unauflösbar miteinander verbunden. Ich gehe nie zum Fluss hinunter – fahre nicht einmal auf der hohen Brücke darüber –, es sei denn, ich habe keine andere Wahl. Das kann das Leben in einer Stadt am Fluss ziemlich beschwerlich machen.
Heute habe ich keine andere Wahl.
Ehe ich das Büro des Watchman verlasse, rufe ich bei Quinn Ferris, Bucks Ehefrau, an. Quinn hat mich wie einen Sohn behandelt, wenn ich bei ihnen zu Hause war, was früher oft und lange war. Obwohl ich nun achtundzwanzig Jahre von Bienville fort war (außer den letzten fünf Monaten), sind wir uns doch so nah, dass ich weiß, sie würde die tragische Nachricht lieber von mir als von der Polizei oder dem amtlichen Leichenbeschauer hören. Wie ich befürchtet hatte, war die Neuigkeit schon zu ihr vorgedrungen – der Fluch der Kleinstadt. Sie rennt in ihrem Haus herum und versucht, die Schlüssel zu finden, damit sie zum Fluss hinunter kann. Weil sie fünfzehn Meilen auf dem Land draußen lebt, will Quinn unbedingt in Richtung Stadt aufbrechen, aber irgendwie überrede ich sie dazu, zu Hause zu warten, bis ich anrufe, um das zu bestätigen, was bisher nur ein Gerücht ist.
Mein SUV habe ich auf dem Mitarbeiterparkplatz hinter dem Zeitungsgebäude abgestellt. Wir sind nur vier Häuserblocks von der Klippe entfernt, wo die Front Street den zweihundert Fuß hohen Hang in einem Vierzig-Grad-Winkel durchschneidet. Ich biege in die Buchanan Street ein und gehe noch einmal durch, was mir mein Informant am Telefon mitgeteilt hat. Etwa um 8:40 Uhr hat ein pensionierter Kajakfahrer einen Mann entdeckt, den er für Buck Ferris hielt. Er war in der Astgabel eines Pappelstumpfs im Mississippi eingeklemmt, vierhundert Yard südlich des Landestegs von Bienville. Der Kajakfahrer kannte Buck nicht gut, hatte aber ein paar seiner archäologischen Vorträge im Indianerdorf besucht. Jeder, der den Mississippi kennt, weiß, dass diese Geschichte einem Wunder gleichkommt. Wäre Buck nicht zufällig in die Astgabel dieses Baumes geraten, er wäre die ganze Strecke bis Baton Rouge oder New Orleans getrieben, ehe man ihn entdeckte, wenn er überhaupt gefunden worden wäre. Viele Menschen ertrinken im Mississippi, und die meisten werden zwar irgendwann wiedergefunden. Manchmal jedoch weigert sich der Flussgott, seine Toten wieder herzugeben.
Furcht macht sich in meinem Magen breit, als ich die abschüssige Front Street nach Lower’ville herunterfahre – wie die Einwohner kurz für Lower Bienville sagen, das die Handelskammer allerdings als Riverfront bezeichnet. Selbst für den Frühling führt der Mississippi schon viel Wasser, und eine steife Brise peitscht weiße Schaumkronen auf seiner breiten schlammigen Oberfläche auf. Ich wende mühsam die Augen vom Wasser und konzentriere mich auf die Autos, die entlang des Holzgeländers geparkt sind, das den jähen Hang zum Fluss abblockt. Aber das hilft mir kaum, meine Furcht zu dämpfen. Ich versuche nun schon über dreißig Jahre, diese sicherlich krankhafte Angst vor diesem Fluss loszuwerden, aber es ist mir nicht gelungen.
Ich werde mich wohl durchbeißen müssen.
Zwei schmale Straßen sind alles, was noch von Lower’ville übrig geblieben ist, dem Sündenpfuhl der Halbwelt, die hier im 19. Jahrhundert im Schatten der Klippe von Bienville lebte. Vor zweihundert Jahren bot diese berühmt-berüchtigte Landestelle den Besatzungen der Plattbodenschiffe und Dampfer alles Mögliche an, vom Glücksspiel und leichten Mädchen bis zum besten Whiskey und ausleihbaren Duellpistolen. In Lower’ville wurde auch alles Mögliche rasch umgeschlagen, von langstapeliger Baumwolle bis zu afrikanischen Sklaven, und dieser Handel bereicherte die Nabobs, die in den glitzernden Palästen oben an der Klippe wohnten und deren Geld wieder als Bezahlung für exquisite Laster in den Bezirk zurückfloss.
Heute hat sich all das geändert. Der erbarmungslose Fluss hat Lower’ville auf zwei parallele Straßen und die sie verbindenden fünf kurzen Gassen zusammenschmelzen lassen, von denen die meisten von Touristenbars und Restaurants gesäumt sind. Die Sun King Gaming Company unterhält hier ein kleines Büro und eine Haltestelle für den Shuttlebus, der ihr eine Meile flussaufwärts gelegenes schrilles Kasino im Stil Ludwig des Vierzehnten anfährt. Ein ortsansässiger Unternehmer bietet von hier aus Fahrten in offenen Bussen an, und ein Whiskey-Brenner übt sein Handwerk in einem alten Lagerhaus aus, das sich an den Fuß der Klippe schmiegt. Sonst gibt es hier nur noch überteuerte Geschäfte. Keine Huren mehr, keine Dampferkapitäne, keine messerschwingenden Plattbodenbootfahrer, keine Duelle mit Pistolen. Heutzutage finden Duelle in Bucktown statt, und die Waffen der Wahl sind Glock und AR-15. Für Glücksspiele muss man mit dem Shuttlebus flussaufwärts zum Sun King fahren. Ich besuche diesen Stadtteil beinahe nie, und wenn sich die seltene Gelegenheit ergibt, dass ich gezwungen bin, mich mit jemandem in einem der Restaurants zu treffen, die auf den Fluss hinausgehen, setze ich mich mit dem Rücken zum Panoramafenster, damit ich nicht auf das große Wasser schauen muss.
Heute werde ich es mir nicht leisten können, meinem Stressfaktor aus dem Weg zu gehen. Ich parke meinen Ford Flex ein paar Fuß vom Flussufer entfernt und entdecke das Rettungsboot des Bezirks, das eine Viertelmeile südlich des Landestegs hundert Yard vom Ufer entfernt in der Strömung vor Anker liegt. Einige Menschen stehen in lockerer Reihe da und beobachten die halbherzigen Aktivitäten auf dem Wasser. Eine Dreiviertelmeile jenseits des im Wasser tanzenden Boots schwebt das niedrige Ufer von Louisiana über dem Fluss. Bei dem Anblick aus dieser Perspektive überkommt mich eine Welle der Übelkeit, teils wegen des Flusses, aber auch weil ich langsam die Wirklichkeit verarbeite, dass Buck Ferris gestern Nacht unseren Planeten verlassen haben könnte, während ich im Bett lag und schlief. Ich wusste, dass er vielleicht in Gefahr sein könnte, aber wo immer er gestern Abend hingegangen ist, ist er allein hingegangen.
Ich zwinge mich, die Augen vom gegenüberliegenden Ufer abzuwenden, gehe von den Gaffern ein Stück flussabwärts, um einen freien Blick auf das Boot zu bekommen. Ohne Feldstecher kann ich nicht viel sehen, aber die beiden Deputys an Bord scheinen zu versuchen, auf der anderen Seite des Bootes etwas aus dem Wasser zu zerren.
Im Fluss gibt es drei Arten von Fallen, die alle in den Zeiten von Mark Twain so manchen Dampfer kentern lassen konnten und auch kentern ließen. Die schlimmste ist der »Planter«: wenn ein ganzer vom Fluss entwurzelter Baum sich im Flussbett verkantet und von dem angespülten Treibsand stabilisiert wird. Diese riesigen Bäume sind oft nur als ein, zwei Fuß Holz über der Wasseroberfläche zu sehen, treiben sanft in der Strömung auf und ab und warten darauf, tödliche Scharten in die Schiffsrümpfe von Booten zu reißen, die von unvorsichtigen Lotsen gesteuert werden. Angesichts der eindeutigen Schwierigkeiten der Deputys denke ich mir, dass sie sich damit abmühen, die Leiche aus einer halb versenkten Astgabel in einem Planter zu befreien. Selbst nachdem sie das geschafft haben, müssen sie immer noch seine Leiche über das Dollbord des Rettungsbootes hieven, was keine leichte Sache ist. Während ich über ihre Probleme nachdenke, schießt mir die offensichtliche Frage durch den Kopf: Wie stehen die Chancen, dass ein Mann, der in einen meilenbreiten Fluss fällt, ausgerechnet auf eines der wenigen Hindernisse zutreibt, die ihn daran hindern könnten, in Richtung Golf von Mexiko gespült zu werden?
Als ich noch die schweißgetränkten Rücken der Deputys betrachte, bewegt sich ein Surren wie von einem Hornissenschwarm über meinen Kopf und lenkt meine Aufmerksamkeit vom Boot ab. Doch als ich aufschaue, erblicke ich eine kleine Vier-Rotoren-Drohne – vom Typ DJI, glaube ich –, die etwa in hundert Fuß Höhe auf das Wasser hinausfliegt und Kurs auf das Boot des Sheriff’s Department nimmt. Die Drohne steigt rasch auf, als sie sich dem Schiff nähert; wer immer sie steuert, hofft offensichtlich, die Deputys nicht zu verärgern. So wie ich das Sheriff’s Department von Tenisaw County kenne, wird der Pilot wohl kaum so viel Glück haben.
Ein Deputy hat die Drohne bereits bemerkt. Er fuchtelt wütend in den Himmel, hebt den Feldstecher an die Augen und beginnt, das Flussufer nach dem Piloten abzusuchen. Ich folge seiner Blickrichtung, sehe aber nur ein paar Stadtpolizisten, die dasselbe wie ich machen: Sie suchen in der Reihe der Gaffer nach jemandem, der eine Steuereinheit in der Hand hält.
Nach dreißig erfolglosen Sekunden komme ich zu dem Ergebnis, dass der Pilot die Drohne von oben auf der Klippe hinter uns steuern muss. Wenn er sie von der Klippe aus lenkt, die zweihundert Fuß über dem Fluss aufragt, war es sehr schlau, so niedrig auf das Rettungsboot zuzufliegen. Das vermittelt den Deputys das Gefühl, dass er oder sie vom Ufer aus arbeitet. Ohne den Kopf in den Nacken zu legen, mustere ich den Eisenzaun oben an der Klippe. Ich brauche nicht lange, um hundertfünfzig Yard südlich vom Landesteg eine schmale Gestalt zu entdecken, die in gespannter Aufmerksamkeit am Zaun steht und etwas in den Händen hält.
Aus dieser Entfernung kann ich zwar weder Gesichtszüge noch Geschlecht ausmachen, doch der Anblick triggert eine Erinnerung. Ich kenne einen Jungen, der Talent dafür hat, mit seiner Luftbildkamera nachrichtenwerte Ereignisse einzufangen: der Sohn einer meiner Mitschülerinnen aus der Highschool. Obwohl Denny Allman erst vierzehn ist, ist er ein Genie im Umgang mit Drohnen. Ich habe bereits einige seiner Filme auf der Webseite unserer Zeitung gepostet. Die meisten Kids hätten gar keine Möglichkeit, während der Schulzeit an einem Dienstagmorgen auf die Klippe zu gelangen, aber Denny wird zu Hause unterrichtet, was bedeutet, dass er aus dem Haus kann, wenn er auf dem Polizeiscanner, den er sich von seiner Mutter zum letzten Weihnachtsfest erbettelt hat, etwas von, sagen wir mal, einer Leiche im Fluss hört.
Während ich noch die Gestalt auf der Klippe beobachte, kommt der Wagen des amtlichen Leichenbeschauers die Front Street heruntergerumpelt. Es ist ein uralter Chevy-Kastenwagen aus den sechziger Jahren. Der Fahrer hält nicht wie ich an der Wendestelle an, sondern fährt auf den harten Schlamm und weiter flussabwärts am Ufer entlang, bis er schließlich etwa dreißig Yard von mir entfernt stehenbleibt. Byron Ellis, der amtliche Leichenbeschauer des Bezirks, steigt aus und kommt zu mir herüber, um den Gaffern zu entgehen, die ihn mit Fragen bestürmen.
Man muss nicht Arzt sein, um in Bienville für den Posten des amtlichen Leichenbeschauers ausgewählt zu werden. Byron Ellis ist ehemaliger Krankenwagenfahrer und Sanitäter, der sich, als sein sechzigster Geburtstag näher rückte, entschlossen hat, der erste Afroamerikaner zu werden, der sich diesen Posten sichert. Byron und ich haben einander in den letzten fünf Monaten gut kennengelernt, und zwar aus einem tragischen Grund. Bienville erlebt eine Welle von Gewaltverbrechen, die sich zu hundert Prozent auf die schwarze Gemeinde beschränkt. Etwa sechs Monate vor meiner Rückkehr haben schwarze Teenager angefangen, sich gegenseitig aus Hinterhalten und bei Schießereien umzubringen, was die Bürger der Stadt, ob schwarz oder weiß, in Angst und Schrecken versetzt hat. Trotz der besten Bemühungen der Gesetzeshüter und des engagierten Einschreitens von führenden Persönlichkeiten in Kirche, Schule und Stadtbezirk hat sich der Teufelskreis der Vergeltung nur noch gesteigert. Byron und ich haben schon gemeinsam neben zu vielen Kids gestanden, die von Kugeln durchlöchert waren, und der unbestreitbaren Tatsache ins Auge geblickt, dass unsere Gesellschaft verrückt geworden ist.
»Wer ist das da draußen, Marshall?«, fragt Byron, als er näher kommt.
»Ich habe gehört, es soll Buck Ferris sein. Weiß es noch nicht sicher. Ich hoffe verdammt noch mal, dass er’s nicht ist.«
»Geht mir wie dir.« Byron klatscht meine Hand ab, die ich ihm hingestreckt habe. »Der Mann hat nie auch nur ’ner Fliege was zuleid getan.«
Ich schaue wieder zu den Deputys, die sich auf dem Boot abmühen. »Ich hätte gedacht, dass du vor mir hier ankommst.«
»Hab’ wieder einen Jungen im Wagen. Hab’ mir heute schon den Arsch abgearbeitet.«
Ich drehe mich überrascht zu ihm hin. »Ich hab’ gar nichts von einer Schießerei letzte Nacht gehört.«
Er zuckt mit den Achseln. »Niemand hat den Jungen vermisst gemeldet, bis seine Mama zu ihm reingegangen ist und ihm seine Frühstücksflocken bringen wollte und merkte, dass er nicht im Bett lag. Ein Sträflingsteam im Straßenbau hat ihn draußen, wo die Cemetery Road den Highway 61 kreuzt, in einem Graben gefunden. Hat achtzehn Schuss abgekriegt, was ich so zählen konnte. Ich habe eine .223-Kugel aus einer Wunde auf seinem Rücken gezogen, die beinahe eine Austrittswunde war.«
»Verdammt noch mal, Byron. Das läuft ja völlig aus dem Ruder.«
»Oh, das ist es schon lange, Bruder. Wir sind jetzt ein Kriegsgebiet. Da ist ein ertrunkener Archäologe vergleichsweise harmlos, oder?«
Ich brauche all meine Willensanstrengung, um das Gesicht nicht zu verziehen. Byron hat keine Ahnung, dass Buck Ferris für mich wie ein Vater war, und es bringt auch nichts, ihm jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen, indem ich es ihm sage. »Vielleicht«, murmele ich. »Es würde mich allerdings überraschen, wenn das ein Unfall war. Ich habe das Gefühl, dass etwas sehr Ernstes dahintersteckt. Und ein paar mächtige Leute.«
»Ach ja? Na, das klingt ganz so, als wäre es was für deine Abteilung.« Byron lacht leise, ein tiefes Rumpeln in seinem üppigen Bauch. »Schau dir doch die Chaostruppe da draußen an. Deputy Dawg, Mannomann. Die Drohne da macht die ja schon fast verrückt.«
»Ich ruf dich später an«, sage ich zu ihm. »Ich hab’ jetzt zu tun.«
»Klar, Mann. Lass mich ruhig hier draußen in der Sonne stehen. Mach dir um mich keine Sorgen.«
Byron zwinkert, als ich spöttisch salutiere.
Sobald ich wieder in meinem Flex sitze, drücke ich den Anlasserknopf und fahre die Foundry Road hoch, die spiegelverkehrt zur Front Road die Klippe hinaufführt. Während mein Motor sich auf der Steigung abmüht, kracht ein Pistolenschuss über den Fluss und hallt von der Klippe wider. Ich fahre auf meinem Sitz zusammen, völlig verdattert von der idiotischen Unverantwortlichkeit eines Deputys, der in einem Gebiet, in dem sich Menschen befinden, einfach in die Luft schießt, um eine Drohne herunterzuholen. Unterhalb von mir knallt ein weiterer Schuss. Ich kann nur hoffen, dass sie kein Gewehr an Bord des Rettungsbootes haben. Wenn doch, dann können sie das kleine Fluggerät vielleicht wirklich abschießen, das laut Gesetz eine Registriernummer tragen muss. Und da der Sheriff von Bienville ein echtes Arschloch ist, wird der Pilot jede Menge Ärger bekommen. Wenn der Pilot der ist, den ich vermute, möchte ich über diese Geschichte nicht in der Zeitung berichten müssen.
Ich bete nicht, aber den ganzen Weg bergauf bettele ich das Universum an, mir inmitten all seiner täglichen Schöpfung und Zerstörung eines zu gewähren: Mach, dass diese Leiche jemand anderer ist. Mach, dass es nicht der Mann ist, der mich, als ich vierzehn war, davon abgehalten hat, mich umzubringen.
Mach, dass es nicht Buck ist.
KAPITEL 5
Oben auf der Klippe von Bienville kann man nicht näher als dreißig Yard von der Kante entfernt parken. Im Stadtgebiet hat man eine Pufferzone aus Grünflächen zwischen Battery Row und dem Eisenzaun angelegt, die Kinder, Jugendliche und Betrunkene daran hindert, sich im Tagesrhythmus hier umzubringen. Wie ich gehofft hatte, stellt sich heraus, dass die schmale Gestalt beim Zaun der vierzehnjährige Denny Allman, der Sohn meiner Schulfreundin, ist. Denny hat sicher meinen Flex erkannt, als ich dort geparkt habe – sonst wäre er abgehauen.
Ich hebe zum Gruß die Hand, als ich mich ihm nähere. Denny quittiert das mit einer Kopfbewegung, ehe er sich wieder zum Fluss wendet, die Hände stets an der Steuereinheit der Drohne. Selbst wenn er mit dem Rücken zu mir steht, kann ich an seiner Körperhaltung seine Mutter erkennen. Dixie Allman war in der Highschool sportlich und attraktiv. Sie war eine ziemlich schlechte Schülerin, hauptsächlich, weil sie so faul war, hatte jedoch einen flinken Verstand. Ihr Problem war, dass sie sich seit ihrem zehnten Lebensjahr nur darauf konzentriert hat, männliche Aufmerksamkeit zu erregen. Mit achtzehn heiratete sie – schwanger – und wurde mit fünfundzwanzig geschieden. Dennys Vater war ihr dritter Ehemann, der sie verließ, als Denny fünf oder sechs Jahre alt war. Dixie hat sich alle Mühe gegeben, den Jungen gut zu erziehen, und das ist einer der Gründe, warum ich ihn ermutigt habe, indem ich sein Material auf unserer Webseite veröffentlicht habe.
»Haben die auf deine Drohne geschossen?«, rufe ich ihm zu.
»Scheiße, ja! Vollidioten!«
Ich ringe mir ein Lachen ab und gehe zum Zaun hinauf. Für einen Achtklässler hat Denny ein gepfeffertes Vokabular, aber das hatten meine Freunde und ich in dem Alter auch. »Die haben vielleicht einen Streifenwagen herbeordert, der dich suchen soll.«
»Haben sie, aber der ist zum Fluss runtergefahren. Ich habe ein bisschen mehr Höhe gewonnen und bin weiter südlich hinter ein paar Bäumen gelandet. Die versuchen gerade, da hinzukommen. Die schaffen es nie im Leben durch das Kopoubohnen-Gestrüpp.«
Die Drohnensteuerung in seinen Händen verbindet ein iPad Mini mit einem Joystick-Element. Denny hat einen Sonnenschutz auf sein iPad montiert, ich kann also bei einem flüchtigen Blick den Bildschirm gar nicht sehen. Als ich über den Zaun schaue, erblicke ich das Rettungsboot des Bezirks unten auf dem Fluss. Es ist jetzt unterwegs zum Dock. Die Deputys haben wohl endlich ihre Ladung an Bord gehievt.
»Konntest du die Leiche gut sehen?«, frage ich.
»Live nicht«, antwortet Denny und konzentriert sich auf seinen Bildschirm. »Ich musste die Deputys im Auge behalten, während ich gefilmt habe.«
»Können wir jetzt mal gucken?«
Er zuckt mit den Achseln. »Klar. Wieso die Eile?«
»Hast du je Dr. Ferris draußen bei den Indianerhügeln getroffen?«
»Ja. Der ist ein paarmal in meine Schule gekommen. Ich …« Denny wird blass. »Das ist er da draußen im Wasser? Der alte Dr. Buck?«
»Könnte sein.«
»O Mann! Was ist dem passiert?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er Pfeilspitzen oder so was gesucht und ist auf einer Sandbank zu weit rausgelaufen. Die sacken manchmal unter Leuten zusammen.«
Der Junge schüttelt heftig den Kopf. »So was würde Dr. Buck nicht machen. Er ist immer an Flüssen und Bächen langgelaufen, um Zeug zu suchen, fast immer nach Gewittern und Stürmen. Der hat jede Menge Indianerzeug gefunden, sogar Mastodonknochen. Du solltest die Sachen im Museum in Jackson sehen, die er gefunden hat.«
»Das habe ich.«
»Dann weißt du auch, dass er nie im Leben einfach in den Mississippi gefallen ist. Es sei denn, er hatte einen Herzanfall oder so was.«
»Vielleicht ist es so passiert«, sage ich, obwohl ich es nicht glaube. »Oder er hatte einen Hirnschlag. Buck war über siebzig. Mit ein bisschen Glück kriegen wir raus, wo er reingefallen ist. Und vielleicht auch, was er da gemacht hat.«
Ich sehe, dass Denny in Gedanken rechnet. »Ich muss die DJI da unten lassen, bis die Polente weg ist«, sagt er. »Aber ich kann von hier auf die Datei zugreifen. Das braucht allerdings den größten Teil von meinem monatlichen Datenvolumen auf.«
»Das zahle ich dir.«
Seine Miene hellt sich auf. »Super!«
Er tippt auf den Bildschirm des iPads und winkt mich näher. Dank des Sonnenschutzes habe ich nun einen blendfreien Blick auf die Aufnahmen, die Denny vor wenigen Minuten gemacht hat. Auf dem Bildschirm versuchen zwei Deputys, die keinerlei Erfahrung mit der Bergung von Leichen aus dem Fluss haben, genau das. Von dem Toten sehe ich nur eine Seite seines Gesichts mit dem grauen Fleisch und einen dünnen Arm, der in der schlammigen Strömung treibt. Dann dreht sich der Kopf in der Strömung, und eine Welle der Übelkeit schwappt über mich hinweg. Mein Mund wird trocken.
Es ist Buck.
Ich kann nicht seinen ganzen Kopf sehen, aber es sieht aus, als wäre die andere Seite seines Schädels irgendwie aufgeplatzt. Als ich mich anstrenge, mehr zu sehen, sinkt der Kopf wieder ins Wasser. »Schnellvorlauf«, dränge ich Denny.
Der ist schon dabei. Mit dreifacher Geschwindigkeit flitzen die Deputys auf dem Deck des Rettungsboots hin und her wie in einem Trickfilm, lehnen sich gelegentlich über das Dollbord und versuchen, Bucks Leiche aus der Astgabelung zu befreien, die ihn im Wasser festhält. Plötzlich blickt einer von ihnen zum Himmel und fängt an, mit den Armen zu fuchteln. Dann fängt er an zu schreien, zieht die Pistole und feuert auf die Kamera, die unter der Drohne hängt.
»Was für ein beschissener Idiot«, murmelt Denny, als der Deputy noch einmal schießt.
»Begreift der nicht, dass diese Kugeln irgendwo runterkommen müssen?«, frage ich.
»Ist wohl in Physik durchgefallen.«
»Unterrichten die in der Grundschule keine Schwerkraft mehr?«
Nachdem der Deputy seine Pistole wieder ins Halfter gesteckt hat, stapft er zu einer Luke im Heck und zieht etwas hervor, das wie ein Wasserskiseil aussieht. Er knüpft eine Schlinge mit dem Seil, lehnt sich über das Dollbord und fängt an, das Lasso, das er gemacht hat, über Bucks Leichnam zu werfen.
»Nein, verdammt noch mal!«, brülle ich. »Hab’ doch ein bisschen Respekt, Scheiße!«
Denny schnaubt bei dieser Vorstellung.
»Der soll sich selbst das Seil um den Bauch binden«, murmele ich, »und ins Wasser gehen, um die Leiche loszumachen.«
»Davon kannst du nur träumen«, sagt Denny mit der Stimme eines Chorknaben vor dem Stimmbruch. »Der wird die Leiche mit dem Lasso einfangen, den Motor auf volle Touren bringen und bis zum Dock eine breite Heckwelle hinter sich herziehen.«
»Und dabei Bucks Leiche in zwei Stücke reißen.«
»War das bestimmt Buck?«, fragt er. »Ich konnte das nicht erkennen.«
»Ja. Er ist es.«
Denny beugt den Kopf über den Bildschirm.
Es dauert eine Weile, aber schließlich bekommt der Deputy das Seil um Buck, und er benutzt tatsächlich die Kraft seines Motors, um Buck aus der Umklammerung durch den Baum zu befreien. Zum Glück scheint die Leiche ganz zu bleiben, und als das Boot wieder angehalten hat, zerren die Deputys sie langsam über den Heckbalken.
»O Mann!«, murmelt Denny.
»Was?«
»Schau dir seinen Kopf an! Die Seite. Ganz zermatscht.«
Man muss kein Analyst der CIA sein, um zu sehen, dass irgendetwas die linke Seite von Buck Ferris’ Schädel eingeschlagen hat. Das Gewölbe seiner Schädeldecke hat ein Loch von der Größe einer Orange. Jetzt, da er aus dem Wasser ist, wirkt sein Gesicht seltsam zusammengesunken. »Ich hab’s gesehen.«
»Was war das?«, fragt Denny. »Ein Baseballschläger?«
»Vielleicht. Könnte auch ein Gewehrschuss gewesen sein. Schusswunden sehen nicht so aus wie im Fernsehen, nicht mal wie in den Filmen. Aber vielleicht war es doch ein stumpfer Gegenstand. Ein großer Stein hätte es auch sein können. Vielleicht ist er irgendwo hingefallen, ehe er in den Fluss gestürzt ist.«
»Wo?«, fragt Denny ungläubig. »Hier sind doch kaum Steine. Und selbst wenn man von der Klippe fällt, trifft man nicht auf Felsbrocken. Kein Vulkangestein. Da müsste man schon auf Beton oder so was stürzen.«
»Vielleicht ist er auf Schüttsteine geprallt«, vermute ich und meine damit die großen grauen Felsbrocken, mit denen das Pionierkorps die Flussufer bedeckt hat, um die Erosion zu verlangsamen.
»Vielleicht. Aber die sind ganz unten beim Wasser und nicht unterhalb der Klippe.«
»Und auf die müsste er aus großer Höhe fallen, um sich so den Schädel einzuschlagen.« Trotz meines emotionalen Schockzustands überlege ich mir plötzlich, welche juristischen Folgen Dennys Drohnenausflug haben könnte. »Du weißt, dass du eigentlich dieses Filmmaterial dem Sheriff übergeben musst?«
»Es ist kein Filmmaterial, Mann. Es ist eine Datei. Und die gehört mir.«
»Der Bezirksstaatsanwalt würde das wahrscheinlich anzweifeln. Hast du überhaupt eine Lizenz, dass du diese Drohne aufsteigen lassen darfst?«
»Ich brauche keine Lizenz.«
»Doch, für kommerzielle Arbeit schon. Und wenn ich das auf unsere Webseite hochlade oder die Rechnung für dein Datenvolumen zahle, hast du mir die Drohne vermietet.«
Denny schaut finster in meine Richtung. »Dann bezahl mich eben nicht.«
»Darum geht es nicht, Denny.«
»Doch. Ich kann den Sheriff nicht leiden. Und den Polizeichef noch weniger. Die machen mir die ganze Zeit Ärger. Bis sie mich brauchen, natürlich. Damals als sie nach einem Unfall ein Autowrack in einer Schlucht beim Highway 61 hatten, da haben sie mich gebeten, ich sollte da hinfliegen und nachsehen, ob noch jemand lebte. Da haben sie sich gefreut, mich zu sehen. Und bei dem Aufstand im Gefängnis auch. Obwohl sie da meine Mikro-SD-Karten geklaut und kopiert haben. Aber zu allen anderen Zeiten sind sie nur Riesenarschlöcher.«
»Ich habe gehört, dass die jetzt eine eigene Drohne haben.«
Wieder schnaubt Denny verächtlich.
»Weißt du, was ich glaube?«, frage ich.
»Nö.«
»Als Nächstes müssen wir rausfinden, wo Bucks Wagen ist. Er fährt einen alten GMC-Pick-up. Der muss irgendwo flussaufwärts von der Stelle stehen, wo man Buck gefunden hat – es sei denn, hier ist etwas nicht so, wie es scheint.«
Denny nickt. »Soll ich die Ufer abfliegen und nach seinem Pick-up suchen?«
»Scheint sinnvoll, oder? Hast du noch genug Akku?«
»Zwei sind einer, einer ist keiner.«
»Wie bitte?«
»Motto der Navy SEALs. Das soll heißen, ich habe Ersatz dabei.« Denny lehnt sich über den Zaun und schaut den steilen Abhang der Front Street hinunter. »Sieht so aus, als würden sie ihn in den Wagen des Leichenbeschauers laden. Wenn die Deputys weg sind, fliege ich mit der Drohne wieder hier hoch, wechsele die Akkus und fange an, die Ufer abzusuchen.«
»Klingt gut. Lass es uns zuerst auf der Mississippi-Seite versuchen.«
»Jawohl.«
Wir stehen zusammen am Zaun, blicken auf Lower’ville hinunter, das an beinahe jedem Morgen praktisch menschenleer ist (außer im März, der touristischen Hochsaison in unserer Stadt). Doch an diesem Maimorgen hat der Tod eine Menschenmenge angelockt. Obwohl sie aus unserer Perspektive fast wie Strichmännchen aussehen, erkenne ich doch Byron Ellis, der den Deputys hilft, den mit einer Plane abgedeckten Leichnam von der Trage in seinen alten Chevy zu schieben. Während ich zuschaue, wie sie mit Bucks Totgewicht kämpfen, höre ich einen Musikfetzen: Robert Johnson spielt »Preachin’ Blues«. Ich drehe mich zur Straße um und suche nach einem vorüberfahrenden Auto, sehe aber keines. Da begreife ich, dass die Musik in meinem Kopf erklungen ist. »Preachin’ Blues« war einer der ersten Songs, den mir Buck auf der Gitarre beigebracht hat. Der harmlose Mann, der da mit eingeschlagenem Schädel unter der Plane des Leichenbeschauers liegt, hat mein junges Leben gerettet. Die Erkenntnis, dass man ihn umgebracht hat – vielleicht auf dem Fluss –, ist so unwirklich, dass ich sie mit Gewalt in einen unzugänglichen Teil meiner Gedanken verbannen muss.
»Hey, alles gut bei dir?«, fragt Denny zögerlich.
Ich wische mir die Augen und drehe mich wieder zu ihm hin. »Ja. Buck und ich, wir waren uns damals nah, als ich noch hier wohnte. Als ich ein Junge war.«
»Oh. Darf ich dich was fragen?«
Er wird mich nach dem Tod meines Bruders fragen, denke ich und überlege mir verzweifelt, wie ich das Thema umgehen kann. Dass ich gesehen habe, wie Buck aus dem Fluss gezogen wurde, hat mich schon völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich will nicht auch noch über den Albtraum nachdenken müssen, der mir den Fluss vergiftet hat.
»Sicher«, antworte ich, alles andere als sicher.
»Ich hab’ gewusst, dass du einen Pulitzerpreis und so gekriegt hast, als du in Washington warst. Aber ich habe nicht gewusst, wofür der war. Letzte Woche hab’ ich im Internet gesehen, dass es für was war, was du darüber geschrieben hast, als du als eingebetteter Journalist im Irak warst. Warst du da bei den SEALs oder so was? Delta Force?«
Die Frage eines Vierzehnjährigen. »Manchmal«, antworte ich ihm, während mich Erleichterung überkommt. »Ich war vor dem Irak auch in Afghanistan, da war ich bei den Marines. Im Irak war ich aber bei privaten Sicherheitsfirmen. Weißt du, was das ist?«
»Wie Blackwater und so?«
»Genau. Die meisten, die solche Arbeit in Afghanistan machen, sind ehemalige Soldaten: Rangers, Delta, SEALs. Aber im Irak waren viele im bürgerlichen Leben einfach Polizisten gewesen, ob du’s glaubst oder nicht. Und viele kamen aus den Südstaaten. Die gehen des Geldes wegen da hin. Es ist die einzige Möglichkeit, wie sie je solche Gehaltsschecks kriegen können. Sie verdienen viermal so viel wie die normalen Soldaten. Mehr als Generäle.«
»Das ist aber nicht fair.«
»Nein, das ist es nicht.«
Denny denkt darüber nach. »Und wie ist das so? In echt. Ist das wie Call of Duty?«
»Nicht mal annähernd. Aber ehe du selbst mal da gewesen bist, kannst du das nicht wirklich verstehen. Und ich hoffe, du kommst nie in die Lage. Nur ein paar Sachen im Leben sind so.«
»Zum Beispiel?«
»Das ist ein anderes Gespräch. Eines für dich und deine Mom.«
»Ach, komm schon. Erzähl mir was Cooles darüber.«
Ich versuche, eine Minute lang wieder wie ein Vierzehnjähriger zu denken. »Man kann erkennen, aus welchen Einheiten die Sicherheitsleute kommen, wenn man sich ihre Sonnenbrillen anschaut. Oakleys für die Delta Force. Die SEALs tragen Maui Jims. Die Special Forces Wiley X.«
»Ach was! Und keine Ray-Bans?«
»Da drüben? Nur Punks und Angeber. So eine trage ich da drüben.« Ich schaue auf meine Armbanduhr. »Ich muss jetzt Bucks Frau anrufen, Denny.«
»Klar, okay. Aber sag mal, wie hast du dir so einen Job geangelt? Ich meine, so als eingebetteter Journalist?«
»Ein Typ, der mit mir auf der Highschool war, hat mir geholfen. Der war vor langer Zeit bei den Army Rangers, während des Zweiten Golfkriegs. Er hat mir da drüben auch das Leben gerettet. Damit habe ich den Pulitzerpreis gewonnen, mit diesem Auftrag. Mit dem, was ich da drüben gesehen habe.«
Denny nickt, als verstände er all das, aber ich habe das Gefühl, dass er heute Nachmittag online mein Buch kaufen wird.
»Spar dir das Geld«, rate ich ihm. »Ich schenk dir ein Exemplar.«
»Cool. Wer war der Typ? Dein Freund?«
»Paul Matheson.«
Er macht große Augen. »Kevin Mathesons Dad?«
»Genau.«
»Der Typ ist reich. Echt reich.«
»Ich denke schon, ja. Paul ist aber nicht des Geldes wegen rübergegangen. Es hat für ihn als eine Art Hemingway-Trip angefangen. Weißt du, was ich damit meine?«
»Eigentlich nicht.«
»So eine Macho-Sache. Er hatte Probleme mit seinem Vater. Er hatte das Gefühl, er müsste was beweisen.«
»Das verstehe ich.«
Jede Wette.
»Hey«, sagt Denny, und seine Stimme ist auf einmal ganz hell. »Wir sollten zum Suchen in den Friedhof rauf. Der liegt so ungefähr vierzig Fuß höher als das hier, wenn man die Hügel mitzählt. Da haben wir eine viel bessere Sicht, und ich habe es leichter mit dem Steuern.«
Der Gedanke an den Friedhof von Bienville weckt die Furcht von vorhin wieder in mir auf. »Wir machen es einfach von hier aus, okay? Mein Terminkalender ist heute Morgen echt voll.«
Der Junge wirft mir einen seltsamen Blick zu. »Was musst du denn machen?«
»Um elf ist der erste Spatenstich bei der neuen Papierfabrik. Da muss ich hin.«
Er lacht. »Das Wunder von Mississippi? Das glaube ich erst, wenn die Fabrik fertig dasteht.«
Es klingt so, als zitierte Denny jemand. »Wo hast du denn den Spruch her?«
Er schaut verlegen. »Von meinem Onkel Buddy.«
Dennys Onkel ist ein größtenteils arbeitsloser Bauarbeiter, der seine Tage damit verbringt, sich vor dem Fernseher zu bekiffen. »Diese Papierfabrik, die ist das einzig Wahre. Die Chinesen haben das Geld. Mit einer Investition von einer Milliarde könnte die Stadt die nächsten fünfzig Jahre lang wieder schwarze Zahlen schreiben.«
Denny sieht schon weniger skeptisch aus. »Meine Mom hofft irgendwie auch, dass sie da Arbeit kriegt.«
»Das glaube ich gern. Das Durchschnittsgehalt wird um die sechzigtausend Dollar im Jahr sein. Und deswegen«, denke ich laut, »fürchte ich, dass die neue Papierfabrik vielleicht was mit Bucks Tod zu tun hat.«
Dennys Kopf fährt zu mir herum. Selbst ein Vierzehnjähriger kann sich das zusammenreimen. »Ich habe deinen Artikel über den Gegenstand gelesen, den Buck gefunden hat. Würde das irgendwie der Papierfabrik Steine in den Weg legen?«
»Möglich. Die meisten Leute in der Stadt hat es jedenfalls zu Tode erschreckt. Eigentlich im ganzen Bezirk.«
»Meinst du, jemand würde Buck deswegen umbringen?«
»Im Augenblick fallen mir etwa sechsunddreißigtausend Tatverdächtige ein.«
»Echt?«
»In dieser Stadt bringen sich die Kids gegenseitig wegen Handys um, Denny. Was glaubst du, was die Leute wohl für eine Milliarde Dollar tun würden?«
»Eine Milliarde Dollar?«
»So viel investieren die Chinesen hier, mal abgesehen von all den Millionen, die mit der neuen Brücke und der Fernstraße in den Ort kommen.«
»Wow. Jetzt begreife ich, was du meinst. Na ja …« Er blickt erneut über den Zaun. »Der Leichenbeschauer haut grade ab. Ich hole die Drohne wieder hoch und fange mal an, die Flussufer abzusuchen.«
Ich recke den Daumen nach oben. »Ich gehe eben ein Stück den Zaun entlang und erledige ein paar Anrufe. Ruf mich, wenn du was siehst.«
»Mach ich.«
Eine Sekunde lang überlege ich, ob ich ihn in Gefahr bringe, wenn ich ihn nach Bucks Pick-up suchen lasse, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie. Ich wende mich ab, gehe ein Stück nach Norden am Zaun entlang und schaue auf das Dach des Wagens, in dem Bucks sterbliche Überreste zum letzten Mal vom Fluss hochgefahren werden. Eigentlich habe ich nur ein Telefonat zu tätigen, denn den einzigen Anruf, den ich machen möchte, kann ich nicht machen. Erst in ein paar Stunden. Den Anruf, den ich tätigen muss, würde ich um alles in der Welt lieber vermeiden.
Ich ziehe mein iPhone aus der Tasche und wähle Bucks Nummer zu Hause. Es klingelt nicht einmal richtig, ehe seine Frau ans Telefon gestürzt kommt.
»Marshall?«, fragt Quinn Ferris atemlos.
»Er war es«, teile ich ihr mit, denn ich weiß, dass jede Verzögerung die Sache nur schlimmer machen würde. »Buck ist tot.«
Zwei Sekunden lang herrscht die Stille des tiefsten Weltraums, ehe Quinn mit winzigem Stimmchen fragt: »Bist du sicher?«
»Ich habe sein Gesicht gesehen, Quinn.«
»O Gott, Marshall … was mach ich jetzt? Geht es ihm gut? Liegt er bequem? Ich meine …«
»Ich weiß, was du meinst. Sie behandeln ihn respektvoll. Byron Ellis hat ihn abgeholt. Ich denke, sie bringen Buck für kurze Zeit ins Krankenhaus. Es wird wohl eine Autopsie in Jackson gemacht werden müssen.«
»Oh … nein. Sie schneiden ihn auf?«
»Daran führt leider kein Weg vorbei.«
»Es war also kein Unfall?«
Hier kann ein bisschen Beschönigung nicht schaden. Jedenfalls kurzfristig nicht. »Sie wissen es noch nicht. Aber bei jedem Toten, der nicht in ärztlicher Behandlung war, muss eine Autopsie gemacht werden.«
»Du lieber Gott. Ich versuche immer noch, das alles zu begreifen.«
»Ich glaube, du solltest noch eine Weile zu Hause bleiben, Quinn.«
»Das kann ich nicht. Ich muss ihn sehen. Marshall, sieht er gut aus?«
»Er war im Fluss. Das macht niemanden hübscher. Ich glaube wirklich, du solltest noch ein bisschen zu Hause bleiben. Ich komme in ein paar Stunden.«
»Nein. Nein, ich fahre in die Stadt. Ich halte das schon aus. Er war mein Mann.«
»Quinn, hör zu. Jetzt frage ich dich etwas, nicht die Polizei. Weißt du, wo Buck gestern Abend war?«
»Natürlich. Er wollte noch mal zum Industriepark raus und versuchen, Knochen zu finden.«
Ich unterdrücke ein Stöhnen. Der Industriepark ist der Standort der neuen Papierfabrik, wo in zwei Stunden der erste Spatenstich gemacht werden soll. Buck war schon einmal fünf Stunden im Gefängnis, nachdem er zum ersten Mal dort gebuddelt und man ihn wegen unbefugten Betretens des Geländes angeklagt hatte. Es war ihm klar, dass er nur weitere Schwierigkeiten bekommen würde, wenn er dorthin zurückging. Wichtiger noch: Dieses Gelände liegt flussabwärts von der Stelle, wo Buck gefunden wurde.
»Haben die ihn umgebracht?«, fragt Quinn. »Haben ein paar von diesen raffgierigen Schweinehunden wegen ihrer dämlichen Papierfabrik meinen Mann ermordet?«
»Ich weiß es noch nicht, Quinn. Aber ich krieg’s raus.«
»Wenn du es nicht schaffst, werden wir es nie erfahren. Ich traue keinem von diesen Scheißkerlen im Sheriff’s Department. Die großen Bonzen hier haben die doch alle in der Tasche. Du weißt schon, wen ich meine.«
Ich knurre, sage aber nichts.
»Ich meine den gottverdammten Bienville Poker Club.«
»Da könntest du recht haben. Aber wir wissen es nicht.«
»Ich weiß es. Denen ist doch alles außer Geld völlig egal. Geld und ihre Herrenhäuser und ihre verzogenen Scheißblagen und – oh, ich weiß nicht, was ich sage. Es ist einfach nicht richtig. Buck war so … ein guter Mensch.«
»Das war er«, stimme ich ihr zu.
»Und niemand kümmert sich einen Scheiß drum«, sagt sie mit trostloser Stimme. »All das Gute, was er getan hat, all die Jahre lang, und am Schluss geht es ihnen nur ums Geld.«
»Sie glauben, dass die Fabrik der Stadt das Überleben sichert. Dass es dann wieder aufwärts geht.«
»Diese Stadt soll verdammt sein!«, ruft sie wild. »Wenn sie meinen Mann umbringen mussten, damit sie ihre Papierfabrik kriegen, hat Bienville das Überleben nicht verdient!«
So ist es.
»Du musst bei Jet Matheson anrufen«, sagt sie. »Die ist die Einzige, die den Mumm hat, dem Poker Club entgegenzutreten. Nicht dass du nicht auch ein paar Sachen gemacht hättest. Ich meine, du hast Artikel veröffentlicht und überhaupt. Aber Jets eigener Schwiegervater ist in dem Club, und trotzdem hat sie sich wie ein Pitbull auf ein paar von denen gestürzt. Sie hat Dr. Warren Lacey vor Gericht gezerrt und ihn um ein Haar für immer seine Zulassung gekostet.«
Quinn hat Jet während unserer Abschlussklasse in der Highschool kennengelernt, viel besser dann wohl während der Jahre, in denen ich nicht hier war. »Jet ist heute Morgen nicht in der Stadt«, erkläre ich ihr. »Sie nimmt für einen Fall eine Aussage auf. Ich rede mit ihr, wenn sie wieder zurück ist.«
»Gut.«
Quinn schweigt, aber ich kann beinahe hören, wie ihre Gedanken wirbeln, wie sie verzweifelt nach etwas sucht, das sie von der unmittelbaren, furchtbaren Wirklichkeit ablenken kann. Ich warte, aber die frisch verwitwete Frau sagt nichts mehr, hat wahrscheinlich begriffen, dass ihr Mann tot ist und bleibt, ganz gleich was ich, Jet Matheson oder sonst wer tut.
»Quinn, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ich schau bald bei dir vorbei, versprochen. Ruf mich an, wenn du heute mit irgendjemand oder irgendwas Probleme bekommst.«
»Ich komme schon klar, Marshall. Ich bin ein zähes altes Mädel. Komm später hier raus, wenn du kannst. Das Haus wird mir ziemlich leer vorkommen. Du erinnerst mich an bessere Zeiten. Als all meine alten Eagle-Pfadfinder rund um meinen Tisch saßen. Na ja, eigentlich waren es die von Buck.«
Quinn und Buck haben Anfang der vierziger Jahre geheiratet, und sie konnte nie selbst Kinder bekommen. Bucks Pfadfinder bekamen von Quinn immer eine Extraportion mütterlicher Zuwendung, die einige bitter nötig hatten.
»Auch deine, Quinn!«
»Ja, das waren sie. Und die viele Musik! Herrgott, du und Buck, ihr habt so manche Nacht bis zum Morgengrauen durchgespielt. Ich bin immer wütend geworden, weil ich wusste, dass wir am nächsten Tag aufstehen mussten, aber ich hab’ nie was gesagt. Das war alles so unschuldig. Mir war damals schon klar, was für ein Glück wir haben.«
Da kommen mir die ersten Tränen. »Ich erinnere mich aber dran, dass du dich ein, zwei Mal doch beschwert hast«, sage ich zu ihr.
»Na, irgendjemand musste doch vernünftig sein.« Sie lacht leise, senkt die Stimme zu einem vertraulichen Flüstern. »Ich weiß, dass du verstehst, was ich durchmache, Marshall. Wegen Adam.«
Ich schließe die Augen, und die Tränen rollen mir über die Wangen. »Ich muss los, Quinn.«
»Ich wollte nicht, dass … O, Teufel noch eins. Der Tod ist einfach scheiße.«
»Ich ruf dich heute Nachmittag an.«
Ich beende das Gespräch und gehe mit schnellen Schritten die Klippe entlang, weg von Denny Allman, der mich nicht weinen sehen soll. Dennys Vater hat die beiden vor langer Zeit verlassen, und es ist zwar vielleicht gut, wenn er sieht, wie erwachsene Männer auf den Tod reagieren, aber ich will jetzt nicht erklären müssen, dass der Verlust, der mich aus der Fassung gebracht hat, nicht der von gestern Nacht war, sondern einer vor einunddreißig Jahren.
Ein Vierzehnjähriger braucht nicht zu wissen, dass Trauer so lange anhalten kann.
KAPITEL 6
Während Denny Allman seine Drohne zur Klippe hinaufsteuert, damit er den Akku auswechseln und mit der Suche nach Bucks Pick-up beginnen kann, gehe ich in nördlicher Richtung am Zaun entlang und versuche, mich wieder in den Griff zu bekommen. Das ist schwierig, solange der Mississippi mein Gesichtsfeld beherrscht. Als ich beobachtet habe, wie Buck tot aus dem Wasser gefischt wurde, hat das eine Tür aufgestoßen: zwischen dem Mann, der ich jetzt bin, und dem Jungen, der ich mit vierzehn war, in dem Jahr, als das Schicksal mein Leben gewaltsam umgekrempelt hat. Diese Tür ist mehr Jahre, als ich zu denken bereit bin, fest zugesperrt gewesen. Anstatt sich dieser dunklen Öffnung zu stellen, suchen meine Gedanken jetzt nach etwas, das sie von diesem Blick in die Vergangenheit ablenken könnte.
Es juckt mich in den Fingern, den unmöglichen Anruf zu machen, doch die Person, mit der ich reden möchte, kann ihn im Augenblick nicht entgegennehmen. Zweimal in meinem Leben habe ich mit verheirateten Frauen geschlafen. Das erste Mal war in meinen Zwanzigern, und die Frau war Französin – meine Professorin in Georgetown. Ich wusste am Anfang nicht einmal, dass sie verheiratet war. Ihr Mann lebte den größten Teil des Jahres in Frankreich. Während dieser Affäre gab es nie ein höheres Risiko als die Möglichkeit einer peinlichen Begegnung in einem Restaurant, die anschließend zu ein paar heftigen Worten geführt hätte, allerdings an sie, nicht an mich gerichtet. Die Frau, mit der ich jetzt schlafe, hat einen Mann, der durchaus fähig wäre, mich umzubringen, wenn er von unserer Affäre erführe. Würde ich sie jetzt anrufen, so könnte sie versuchen, das als geschäftliches Telefonat auszugeben, doch selbst Leute von eher geringer Intelligenz können vertraute Töne in einer Stimme heraushören. Ich habe nicht die Absicht, mein Leben auf den Kopf stellen – oder gar beenden – zu lassen, nur weil ein neugieriger Assistent eine unvorsichtig geäußerte Silbe richtig deutet. Natürlich könnte ich ihr eine SMS schicken, aber die hinterlassen digitale Spuren.
Im Augenblick muss ich wortlos leiden.
Aus der Ferne nähert sich eine Gruppe von Frauen, die einen Power-Walk an der Klippe entlang machen. Ein asphaltierter Weg – der Mark Twain Riverwalk – verläuft zwei Meilen an der Klippe entlang, und am frühen Morgen und abends ist hier ziemlich viel los. Zum Glück haben sich um halb zehn die meisten ernsthaften Power-Walker bereits in die Cafés oder ihre SUVs verzogen, um ihre morgendlichen Besorgungen zu machen. Auf den ersten hundert Yard halte ich die Augen nach rechts gerichtet, schaue auf die Gebäude, die an der Battery Row stehen. Ich komme an dem alten Uhrturm vorbei, am Planters’ Hotel, an zwei Herrenhäusern aus der Zeit vor dem Sezessionskrieg. Dahinter ragt das höchste Gebäude der Stadt auf, das Aurora Hotel. Als Nächstes kommt der Brunnen, der an die 173 gefallenen Soldaten der Konföderierten erinnert. Er liegt nur einen Steinwurf von den Stellungen entfernt, von denen die 32-Pfünder-Kanonen während des Sezessionskriegs den Mississippi abgedeckt haben. Gegenüber vom Brunnen gibt es noch ein paar Bars und Restaurants, ein weiteres Wohnhaus aus der Zeit vor dem Sezessionskrieg und das neue Amphitheater, das mit Kasinogeld gebaut wurde.