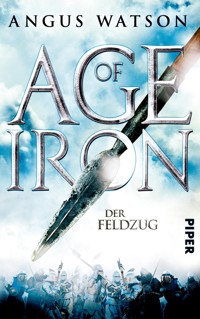12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Römer sind da. Und es sind viele, sehr viele. Nicht nur Soldaten, sondern auch Kriegselefanten – und Kämpfer, die von schwarzer Magie gelenkt werden. Keine einfachen Gegner für Lowa und Spring, die tapferen Heldinnen aus der Eisenzeit. Denn auch wenn die britischen Stämme langsam endlich kapieren, auf wessen Seite sie zu kämpfen haben, wird es sicher kein Zuckerschlecken, die mächtigen Feinde zurückzuschlagen. Aber Lowa und Spring wären nicht Lowa und Spring, wenn sie mit Mut, Witz und Raffinesse nicht auch diese Aufgabe anpacken würden … Mit diesem dritten Band führt Angus Watson seine spannende Dark-Fantasy-Reihe zu einem großartigen Ende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Für David, Penny, Camilla und Christo
Übersetzung aus dem Englischen von Marcel Aubron-Bülles
ISBN 978-3-492-97475-2
November 2016
© Angus Watson 2015
Titel der englischen Originalausgabe: »Reign of Iron«, Orbit, Little Brown Group, London 2015
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: www.buerosued.de und Arcangel/Collaboration IS
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Prolog: Ägäisches Meer, 85 v. Chr.
Im Laufe der Geschichte hatte es schon viele Schiffbrüche gegeben, und dieser war wenig spektakulär. Die beiden Kerle im Ausguck stritten sich darüber, ob der Riesenhai hundert Schritt steuerbord größer war als der Riesenhai, den sie vor einigen Stunden gesehen hatten. Leider übersahen sie deswegen den granitenen Felsbrocken, der nur wenige Handbreit unter der schäumenden Wasseroberfläche verborgen lag, das Überbleibsel einer vom Meer schon vor langer Zeit verschlungenen Stadt. Das Frachtschiff nahm auf einer sanften Welle Anlauf, landete krachend auf dem Fels, kratzte einige schreckliche Herzschläge an ihm entlang und segelte dann weiter. Hundert Schritt später neigte sich das Deck unnatürlich zur Seite und der Kapitän gab den Befehl, die Segel zu reffen. Wasser schlug steuerbord über die Seite, die Fracht unter Deck fluchte und flehte und das Schiff neigte sich weiter. In der Nähe befand sich eine Insel, doch unter den am Ufer anbrandenden Wellen tauchten immer wieder Klippen auf.
Trotzdem begriff der junge Titus Pontius Felix nicht, dass es diesmal ein größeres Problem als sonst geben sollte. Die Fracht brüllte immer und die verschiedensten Kindermädchen hatten ihm erzählt, dass Schiffe in Stürmen untergingen. Heute aber war ein sonniger Tag und daher war er sicher, dass alles in Ordnung sei und die Erwachsenen das Problem lösen würden. Erst als eine Stimme unter Deck in gebrochenem Latein zu brüllen begann, wurde dem Sechsjährigen, der später König Zadars und Julius Caesars Druide werden sollte, klar, dass etwas im Argen lag: »Ketten! Nehm Ketten ab! Belenosverdammte Arschkrampen! Sinken wir! Sinken! Sinken wir jetzt!«
»Besatzung und Passagiere in die Beiboote!«, rief der iberische Kapitän, die Fäuste in die Seiten gestemmt. Ein breites Grinsen, das einige schwarze Zähne entblößte, lag auf seinem Gesicht. »Das Ding leckt so sicher wie ein römischer Schüler seinen Privatlehrer!«
Felix wusste nicht, was er damit meinte, aber ihm gefiel der Tonfall des Mannes nicht. Bei einem Schiffsuntergang sollte man doch ernster sein. Sein Vater schien seine Auffassung zu teilen. »Das Ding leckt nicht!«, rief er mit kurzen, wedelnden Armen, als er versuchte, sich auf dem schiefen Deck gerade zu halten. »Wir können nicht absaufen. Hast du überhaupt eine Ahnung vom Wert der Fracht?«
»Habe ich. Ich kann dir den exakten Preis für deine Ware nennen«, sagte der Iberer. Er war fast doppelt so groß wie Felix’ Vater. »Wenn man den aktuellen Marktpreis einrechnet, unsere momentane Lage und den Zustand der Ware, wird die gesamte Fracht einen fürstlichen Betrag einbringen … nämlich rein gar nichts. Niemand kauft ertrunkene Sklaven.«
»Wir sinken nicht. Wir können nicht sinken. Mein gesamtes Geld steckt in diesem Frachtraum. Mein gesamtes Leben! Bring uns doch bitte an einen Strand oder in einen Hafen oder … bitte!«
Der Kapitän lachte. »Das Meer gehört Poseidon und seine Launen bestimmen unser Schicksal. Heute hat er offensichtlich eine Scheißlaune. Passiert halt. Das Schiff wird untergehen. Wir könnten deine Fracht rauslassen, aber es sind verdammt viele, sie sind verdammt verzweifelt und wir haben keinen Platz für sie in den Beibooten. Es ist für alle das Beste, wenn sie angekettet bleiben.« Der Kapitän brüllte noch lauter, um die Schreie unter Deck zu übertönen. »Reiß dich zusammen, Mann, du wirst einfach neues Geld verdienen! Das Leben ist immer wertvoller als die Fracht.«
Felix’ Vater tobte, bis er blau anlief, und ging dann den anderen nach. Felix folgte ihm an die Schiffsseite und sah zu, wie er in ein Beiboot stieg. Da das Schiff sich gefährlich zur Seite neigte, war der Weg hinab zum Wasser noch weiter als sonst und das kleine, schwankende Boot krachte im Rhythmus der Wellen gegen die rutschig wirkende, entblößte Unterseite des Schiffs. Felix wusste nicht, wie er da hinunterkommen sollte, und hatte Angst. Der Kapitän bemerkte seine Notlage, kletterte zurück an Bord und half ihm hinab.
Als sie sich mit schnellen Ruderschlägen vom Schiff entfernten, sah sein Vater aus, als ob ihm übel werden würde. »Mein ganzes Geld«, sagte er, während das Schiff vor seinen Augen unterging und ihm Tränen vom Kinn tropften. Die anderen fanden das ziemlich witzig und Felix hasste sie dafür.
Kurze Zeit später entdeckten sie eine Lücke zwischen den Klippen. Als sie ihre Boote an einer Stelle an Land gezogen hatten, die mit zertrümmerten weißen Felsen und knorrigen, verkümmerten Bäumen gesäumt war, tauchten ein paar Dutzend furchterregende Männer und Frauen aus ihrem Versteck auf und schlachteten die Neuankömmlinge mit Klingen und Keulen ab, abgesehen von Felix, seinem Vater, zwei Frauen und dem Kapitän. Die drei Letztgenannten schienen mit den Angreifern befreundet zu sein. Sie alle richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Römer.
»Tötet mich nicht! Nehmt den Jungen!«, jammerte Felix’ Vater und versuchte sich hinter seinem Sohn zu verstecken. Ein Mann, dessen Gesicht hauptsächlich aus Schnurrbart zu bestehen schien, zerrte Felix von ihm fort und hielt ihn fest, während andere seinem Vater die Toga und seine Sandalen herunterrissen. Sie alle amüsierten sich köstlich dabei und stießen den frisch entkleideten Römer in Richtung einer Frau mit eiskaltem Blick, langem dunklem Haar und bronzefarbener Haut. Sie schälte sich aus ihrem Kleid und griff dann an. Felix’ Vater versuchte ihr wegzulaufen, doch sie stellte ihm ein Bein und sprang auf ihn, während um sie herum die Piraten johlten. Sein Papa griff nach ihren Beinen, mit denen sie ihn am Boden festhielt, und schlug mit seinen kleinen Fäusten auf ihren Körper ein. Seine Angriffe beeindruckten sie wenig und sie schlug ihm so lange ins Gesicht, bis sich seine Nase in einen formlosen Hautlappen verwandelt hatte und er wehrlos stöhnend da lag. Dann würgte sie ihn, bis er kurz wie ein gefangener Fisch zappelte und sich dann nicht mehr bewegte.
Felix folgte den Piraten in ihren Hafen. Er wusste nicht, was er sonst tun sollte. Sie ignorierten ihn, ließen ihn aber von ihrem Essen abhaben. Er suchte sich in einem Zelt einen Platz zum Schlafen, in dem schon vier andere Kinder untergebracht waren, die es anscheinend nicht störte, dass er nun bei ihnen wohnte, doch sie redeten nicht mit ihm.
Er verbrachte seine Zeit damit, auf der Insel umherzustreifen, Insekten, Echsen und andere Tiere zu töten, die er fangen konnte. Das Töten ließ ihn sich wohlfühlen.
Eines Tages kletterte er an einem niedrigen Kliff auf einen Strand hinab, der im Osten der Insel lag, und entdeckte dort mehrere große Felstümpel. Er zerbrach einige Nacktschnecken, um die Krabben aus ihren sicheren kleinen Höhlen hervorzulocken, und versuchte dann herauszufinden, wie viele Beine sie verlieren mussten, bevor sie nicht mehr gehen konnten. Er war so in sein Experiment vertieft, dass er das kleine Holzboot mit dem weißen Segel erst bemerkte, als es die Küste fast schon erreicht hatte. Er sah zu, wie sich sein Bug in den Sand schob und kleine Wellen an das Heck schlugen.
Der kleine Felix konnte niemanden an Bord sehen. Also ließ er seine Krabben in Ruhe und schlenderte zum Boot hinüber, um herauszufinden, was das geheimnisvolle Gefährt beinhaltete. Es beinhaltete eine tote Frau. Er schrie.
Er erholte sich rasch und fragte sich, ob seinen beinlosen Krabben wohl menschliches Fleisch zusagte. Er legt eine auf ihre Brust, die andere auf ihr Gesicht. Ihr Kopf bewegte sich. Sie war gar nicht tot! Sie schnappte sich die Krabbe mit dem Mund und durchbiss ihre Schale. Ein Wuuusch!, das Felix mehr spürte als hörte, floss aus der Frau heraus und über ihn hinweg wie Wasser, nur war es kein Wasser. Es prickelte auf seiner Haut, war aber weder heiß noch kalt. Er hatte noch nie dergleichen gespürt, aber das Gefühl war ihm dennoch vertraut.
Die Frau stöhnte, setzte sich hin, nahm die Krabbe von ihrer Brust und schlug sie gegen die Bootsseite. Das schien ihr neue Kraft zu verleihen. Sie stand auf, schlug sich getrockneten Möwenkot von ihrem salzverkrusteten schwarzen Gewand, sprang aus dem Boot und sah ihn an. Sie war sehr alt – so alt wie sein Vater gewesen war –, hatte lockige schwarzsilbrige Haare, volle, aber vom Salz rissige Lippen und eine Nase wie eine unförmige Birne.
»Vielen Dank, kleiner Mann«, sagte sie dann, obwohl sie nicht viel größer war als er. »Sind deine Eltern in der Nähe?«
Er wusste nicht, was er antworten sollte.
Sie starrte ihn an und er fühlte sich unbehaglich. Dann sagte sie: »Keine Eltern? Ist auch egal, Mütter und Väter haben noch nie jemandem groß geholfen. Erzähl mir einfach alles, was du über diesen Ort weißt, und sag mir bitte, dass wir nicht auf einer Insel sind.«
»Wir sind auf einer Insel.«
»Ach, Katzenpisse«, sagte sie und Felix kicherte. »Erzähl mir dann, was du über diese Insel weißt. Wie groß ist sie? Wer ist sonst noch hier? Warum bist du hier?«
Felix erzählte ihr alles. Er fragte sie, woher sie stamme, doch sie sagte ihm nur, dass sie Thaya heiße, und fragte ihn, ob er einen Platz kennen würde, an dem sie vor den Piraten sicher wäre und wo sie sich erholen könnte. Er sagte, dass er unter einem Wasserfall im Süden der Insel eine verborgene Höhle entdeckt habe, in der Nähe des zerstörten Zyklopentempels. Sie bat ihn, sie dorthin zu führen, und er tat es.
Sie warf ihm kurz einen seltsamen Blick zu, als sie den kleinen Haufen Tierkadaver auf einem Felsen am Eingang zur Höhle sah, sagte aber nichts.
Er erzählte niemandem von Thaya, aber nicht, weil es ein Geheimnis war, sondern weil er nie mit jemandem sprach. Am nächsten Tag brachte er ihr Essen und am übernächsten und am Tag danach, bis er merkte, dass sie nichts davon angerührt hatte. Er ging sie aber auch weiterhin besuchen. Er hatte sonst nichts zu tun und er war froh, wenn er von den anderen wegkam.
Eines Tages brachte sie ihm bei, mit Magie umzugehen.
Sie zeigte ihm, wie er einen Frosch zerquetschen und mit der Kraft seines Verstands die schwindende Lebenskraft dazu benutzen konnte, einen Vogel zu töten. Einige Tage später zeigte sie ihm, wie er in ein wildes Schwein greifen, sein Herz zerquetschen und seine Lebenskraft dazu benutzen konnte, ein anderes Schwein zu einer mordlüsternen Raserei anzustacheln.
Etwa einen Monat später bat Thaya Felix, ihr zwei der Kinder zu bringen. Das tat er, indem er ihnen Kuchen in der Höhle versprach.
Zu viert kehrten sie zum Hafen der Piraten zurück. Die Piraten scharten sich um sie. Thaya griff in die Brust eines der Kinder und drückte zu. Die Piraten begannen einander anzugreifen. Bald waren sie alle tot, abgesehen vom rotbärtigen iberischen Kapitän. Er stolperte auf sie zu, aus mehreren Wunden blutend, eine Keule in der Hand, und er grinste wie damals, als sein Schiff untergegangen war. Felix musste nicht zweimal gebeten werden, als Thaya ihm das verbliebene Kind anbot. Er stieß seine Hand in die Brust des Mädchens und drückte zu, nachdem seine kleinen Finger die zarte Außenhülle ihres Herzens durchstoßen hatten. Er spürte, wie ihre Lebensenergie durch seinen Arm floss, verdrehte sie in seinem Kopf, schob sie zum anderen Arm hinaus und jagte sie dem Kapitän entgegen. Das Grinsen schwand von seinem rotbärtigen Gesicht. Er krachte zu Boden, tot, und nun war es an Felix zu grinsen.
Thaya sagte, dass sie sehr müde sei, und trug ihm auf, Vorräte für eine längere Bootsreise zusammenzusuchen. Felix wartete, bis sie laut schnarchte, suchte nach einem großen Stein, hob ihn so hoch, wie er konnte, und ließ ihn auf ihren Schädel krachen. Er nutzte ihre freigesetzte Lebenskraft, um ein gutes Dutzend kreisender Seemöwen zum Platzen zu bringen, lud sich dann ein Boot mit Vorräten voll und stach in See.
Als die Insel hinter ihm verschwand, kaute er an Thayas Herz, das er mit dem Entermesser des iberischen Kapitäns aus ihrer Brust geschnitten hatte. Es war widerlich – knorplig, sehnig –, aber eine leise Stimme in seinem Kopf sagte ihm, dass es genau richtig war, es zu essen.
TEIL EINS
Britannien und Gallien 56 und 55 v. Chr.
Kapitel 1
Nach einiger Zeit wich die Riesenwelle wieder zurück und Spring eilte den Hügel von Frogshold hinab. Auf dem steilen Abhang knirschten ihre Kniegelenke, aber sie bemerkte es nicht einmal. Leute riefen ihr hinterher, aber sie hörte sie kaum. Sie hörte aber noch, wie Lowas Stimme den anderen befahl, sie in Ruhe zu lassen. Tief in ihrem Inneren war sie dafür dankbar, doch dies wurde von der alles verschlingenden Wut überlagert, die ihren Verstand in seine Einzelteile zu zersprengen drohte. Das war alles Lowas Schuld! Wenn sie Lowa nur nie getroffen hätten! Sie und Dug könnten jetzt gemeinsam durch die Gegend reisen, Abenteuer erleben, aber nein, dank Lowa hatte Spring die einzige Person töten müssen, die sie je geliebt hatte, abgesehen von ihrer Mutter. Er hatte sich um sie gekümmert und tausend Dinge für sie getan, ohne je etwas von ihr zu erwarten. Im Gegenzug hatte sie nie etwas für ihn getan und dann hatte sie ihn getötet.
Dugs Kriegshammer lehnte an einem Trümmerhaufen, der vielleicht eine Lagerhütte gewesen war, der Hammerkopf halb vergraben. Sie zog ihn mit einem satten Schmatzen aus dem feuchten Schlamm, warf ihn sich über die Schulter und ging. Sie suchte nicht nach seiner Leiche, denn es gab keine. Als die Welle sich ins Meer zurückzog, hatte sie alle mit sich genommen, vermutlich um den Fischen und Vögeln als Festschmaus zu dienen. Sie bemerkte den Nieselregen kaum, als er begann, aber auch nicht den Wolkenbruch, der sich wie die Tränen Tausender Trauernder über sie ergoss und den Schlamm vom geschundenen Land und vom Hammerkopf wusch.
Zuerst folgte sie Küstenpfaden, aber die Zerstörung, die sie mit der Flut angerichtet hatte, war zu grauenvoll. Die wenigen Überlebenden wühlten in den Trümmern nach Nützlichem und bejammerten ihre zahllosen Verluste, was sie landeinwärts gehen ließ. Sie ging den ganzen Tag, die ganze Nacht, den nächsten Tag und so weiter. Sie aß nichts, trank nichts und schlief nicht. Sie hatte so viele getötet, dass sie keinen Trost verdient hatte. Das Einzige, was sie stets vor sich sah, war der Pfeil, der Dugs Stirn durchstieß. Das Einzige, was sie hören konnte, war der Schrei Zehntausender Männer und Frauen, die von der Riesenwelle zerquetscht wurden. Sie spürte nicht, wie sich die Blasen an ihren Füßen bildeten, aufplatzten und zu bluten begannen. Sie spürte nicht, wie der Stiel des Kriegshammers durch das Material ihres Überwurfs und die Haut auf ihrer Schulter scheuerte.
Nach mehreren Nächten – weder wusste sie noch interessierte es sie, wie viele es gewesen waren – trat sie bei Morgendämmerung aus einem Wald heraus auf einen grasbedeckten Hang und brach auf taubenetztem Gras zusammen, um zu sterben. Sie spürte jemanden in ihrer Nähe und sah auf. Ihr Vater, König Zadar, beugte sich über sie und schüttelte den Kopf. Sein sonst so regloses Gesicht drückte Missfallen aus. Er öffnete den Mund, um sie zu verhöhnen, wurde aber von Hundegebell zum Schweigen gebracht. Sadist und Schweinestecher, die Hunde, die Dug nach dem Sieg über Zadars Champion Tadman geerbt hatte, kamen mit heraushängenden Zungen auf sie zugestürmt. Sie bissen mit ihren geisterhaften Mäulern nach Zadars zunehmend körperlos werdender Gestalt, bis er sich in Luft auflöste. Als sie den Tyrannen vertrieben hatten, bedachten die Hunde sie mit tumbem Blick, während ihnen der Speichel aus den Mäulern troff und sie wie wild mit dem Schwanz wedelten. Sadist hastete zu ihr, um sie abzulecken.
»Bei Fuß, Sadist, sie mag es nicht, geleckt zu werden«, sagte jemand mit dem Akzent des hohen britannischen Nordens. Dug Sealskinner tauchte hinter seinen Hunden auf. Springs Pfeil steckte ihm immer noch in der Stirn und die Befiederung erzitterte mit jedem Schritt.
»Du lebst!« Springs Müdigkeit und Trauer lösten sich in Luft auf. Für einen Augenblick kehrte all ihre Energie in ihren Körper zurück, nur um ihn sofort wieder zu verlassen, als ihr klar wurde, was Dugs Auftauchen bedeutete.
»Ich bin also tot?«
»Nein, nein.«
»Du sprichst mit mir aus der Anderswelt, weil ich gleich sterben werde?«
»Nein, nein, nichts dergleichen. Ich bin einfach nur in deinem Kopf, sonst nirgendwo. Tatsächlich redest du mit dir selbst.«
»Ich verstehe. Aber wenn ich sterbe, werde ich dich dann bald sehen?«
»Ich würde es bevorzugen, wenn du am Leben bleibst.«
»Warum? Ich habe dich getötet. Ich habe es nicht verdient zu leben.«
»Stimmt vermutlich, aber jemand muss sich um meine Hunde kümmern.«
Schweinestecher bellte, Sadist stierte vor sich hin. Spring hätte fast gelächelt.
»Wenn ich mich um sie kümmern muss, dann ändere ich ihre Namen.«
»Nein. Wir haben das bereits besprochen. Du kannst den Namen eines Hundes nicht ändern. Ich weiß nicht, warum Tadman ihnen diese Namen gegeben hat, aber er hat es getan und damit hat es sich.«
»Du bist tot. Warum sollte ich tun, was du sagst?«
»Weil du das getan hast, du kleines, dummes Stück.« Dug drehte den Kopf, um ihr das spitze Ende zu zeigen, das aus seinem Hinterkopf herausragte.
»Es tut mir leid! Aber das ist alles Lowas Schuld!«
Dug seufzte. Waren seine Augen größer und brauner, jetzt, da er tot war? »Nein, Spring«, sagte er und schüttelte den Kopf, »es war nicht Lowas Schuld. Sie hat all diese Armeen zusammengebracht, um uns alle zu retten, indem du mich tötest und sie dadurch alle vernichtet werden konnten. Nun ja, euch alle zumindest.«
»Wenn wir sie nie getroffen hätten, dann würdest du noch leben.«
»Vielleicht, aber eine Menge anderer guter und hilfloser Leute wären jetzt tot und eine Menge beschissener Leute würden plündernd durch das Land ziehen, um den Rest umzubringen. Du darfst sie nicht dafür verantwortlich machen. Und das weißt du auch genau, weil ich ohnehin nur ein Teil deines Verstandes bin, der mit dir redet.«
»Scheiß drauf. Wenn du ein Teil meines Verstandes bist, dann bist du der dumme Teil. Es war allein Lowas Schuld.«
»Na gut. Ich werde nicht versuchen, dich zu überreden, aber könntest du mir wenigstens mit den Hunden helfen? Immerhin hast du mir einen Pfeil durch den Kopf gejagt und meine kleinen Hundileins sind jetzt ganz allein.«
Spring seufzte. »Na gut. Aber an diesen Hunden ist nichts ›klein‹, und ich will in Zukunft nichts mehr von diesem ›Du hast mir einen Pfeil durch den Kopf gejagt‹ hören.«
»Ich nehme an, du willst mich wiedersehen?«
»Du sagtest doch, du seist in meinem Kopf.«
»Ja?«
»Dann werde ich dich immer dann wiedersehen, wenn ich dich sehen will.«
»Nicht wenn du jetzt stirbst, und es sieht ziemlich schlecht für dich aus. Du hättest eigentlich gestern oder vorgestern verdursten sollen, und das mit dem Hunger hilft auch nicht gerade. Beeil dich also gefälligst und such dir was zum Trinken und anschließend was zum Essen, oder die Hunde müssen allein zurechtkommen. Am Fuß dieses Abhangs fließt ein Bach vorbei. Versuch dorthin zu kommen.«
»Klar, zaubere mich einfach dorthin und ich werde trinken. Oder könntest du mir nicht jetzt und hier einen Krug Bier reichen?«
»Dich irgendwo hinzaubern? Nein, nein, nein. Hast du nicht verstanden, was du getan hast?«
»Wovon redest du?«
Dug schüttelte den Kopf. »Und du sollst die Schlaue von uns beiden sein? Deine Magie stammte von mir und du hast mich getötet. Ich mache dir keinen Vorwurf, denn du musstest es tun, um genügend Macht zu beschwören, um eine riesige, am Arsch der Welt gelegene Insel zu versenken und eine Flutwelle zu erschaffen, mit der Lí Ban oder jeder andere Meeresgott jahrhundertelang angegeben hätte. Aber jetzt bin ich nicht mehr und das war es dann für dich mit dem Thema Magie. Ein für alle Mal. Du musst zum Bach gehen, wie alle anderen auch, und ohne dich zu beklagen.«
Der Gedanke, gehen zu müssen, ließ Spring beinahe ohnmächtig werden. »Ich glaube nicht, dass ich gehen kann.«
»Dann musst du dich dorthin schlängeln. Du schaffst das!« Dug zwinkerte ihr zu und verschwand.
Spring öffnete die Augen. Die Sonnenstrahlen stachen ihr ins Gehirn. Als sie wieder halbwegs sehen konnte, wenn auch noch reichlich umwölkt, erkannte sie die Bäume in einiger Entfernung. Sie würde sich lieber ins eigene Fleisch schneiden, als sich den Hang hinunterzuschlängeln. Das wäre unter ihrer Würde. Sie würde kriechen.
Mit Mühe stützte sie sich auf ihre Hände und machte sich auf den Weg.
Der rationale Teil ihres Verstandes flehte sie an aufzugeben, sich einfach zu Boden fallen zu lassen und zu sterben. Doch sie kroch den Hang hinab, rutschte auf Händen und Knien über das feuchte Gras. Als sie die Bäume erreichte, wurde es langsam dunkel. Einen verwirrten Moment lang dachte sie, es wäre wieder Nacht geworden, doch dann verstand sie, dass ihr Sehvermögen rapide nachließ. Ihr Bewusstsein kämpfte gegen die Niederlage. Ihre Hände rutschten weg, die Arme gaben nach, sie klatschte mit dem Gesicht ins Gras und schloss die Augen. Die Erleichterung war unglaublich. Sich kurz zu erholen konnte doch nicht schaden, oder? Was wäre schon dran, wenn sie starb? Die Hunde würden es verstehen und außerdem waren sie doch groß genug, um auf sich selbst aufzupassen. Hässlich genug waren sie ja …
»Wach auf, Spring!«, rief eine Stimme mit dem Akzent des Nordens und schreckte sie auf.
Na los, ermahnte sie sich. Sie versuchte wieder zu kriechen, kam aber nicht hoch. Tja, dachte sie, muss ich mich wohl doch zum Ziel schlängeln.
Sie grub ihre Ellbogen und Füße in den weichen Boden, schob sich in den kühlen Schatten der Äste und weiter durch herabgefallene Blätter und Zweige. Sie schaffte es, den Kopf zu heben, und entdeckte eine Amsel, die sie mit neugierigem Blick von einem Baumstamm aus betrachtete. Sie wollte gerade den Mund aufmachen, um ihr zu sagen, dass sie ihr entweder helfen oder sich verpissen möge, als ihr auffiel, dass ihre Kehle viel zu trocken war und sie nur ein raues Krächzen hervorbrachte.
Schließlich erreichte sie die flache Bachrinne.
Sie purzelte die niedrige Böschung hinunter, schlaff wie ein entbeintes Eichhörnchen, und platschte mit dem Gesicht voran ins Wasser. Schlamm füllte ihren Mund und verstopfte ihre Nase.
Oh, dachte sie. Wie passend! Das Mädchen, das Tausende mit einer Riesenwelle umgebracht hat, ertrinkt in einem flachen Bach. Doch sie schaffte es, ihren Kopf zur Seite zu drehen, bis er nur noch zur Hälfte unter Wasser lag. Sie schlabberte kaltes, köstliches, schlammiges Wasser. Bald schon hatte sie wieder die Kraft, den Rest ihres Körpers in den Bach rutschen zu lassen, um sich hinzuknien und Wasser mit den Händen zu schöpfen.
Ein wenig später schaffte sie es aufzustehen. Sie zitterte vor Kälte und die Anstrengung ließ sie erschauern, doch sie stolperte trotzdem zu einem Brombeerstrauch.
Zwei Tage später erklomm die junge Bogenschützin die Hügelkuppe, von der aus sie auf Dugs Bauernhof hinabblicken konnte. Mit dem Kriegshammer über ihrer linken Schulter, dessen Stiel sie mit Moos und Stoff umwickelt hatte, um erneutes Wundscheuern zu verhindern, ging sie den Weg hinab. Ihre rechte, wund geriebene Schulter hatte sie mit einem Umschlag versehen, um die Schmerzen zu lindern.
Dugs Schafe kamen an den Zaun gelaufen und blökten vorwurfsvoll, doch von den Hunden war keine Spur zu sehen. Sie hatte eigentlich erwartet, dass die dummen, riesigen Tiere ihr auf dem Weg entgegenkämen, um sie mit fröhlichem Gebell zu begrüßen, doch sie konnte Schweinie und Sadie nirgendwo sehen. Vielleicht hatte sich ja jemand aus dem nächsten Dorf um sie gekümmert.
Sie bog um die Ecke in Dugs Innenhof. Dugs Innenhof … Die Last ihrer unsäglichen Trauer drohte sie zu erdrücken, doch sie atmete tief durch und richtete sich auf. Trauern konnte sie später. Jetzt lag Arbeit vor ihr. Sie musste die Hunde suchen, die Hühner füttern, den Honig ernten, die Schafe beruhigen und –
»Ähm.« Hinter ihr hüstelte jemand gekünstelt.
Es waren fünf Männer, die britannische Überwürfe und Tartanhosen trugen, die ihnen nicht ganz passten – als ob sie sie geborgt oder gestohlen hätten. Zwei der Überwürfe wiesen Löcher und Blutflecken auf; der Beweis, wie Spring vermutete, was mit ihren vorherigen Besitzern geschehen war. Die Männer trugen ihre Haare kurz geschnitten römisch, was aber nicht ungewöhnlich war, weil in letzter Zeit ziemlich viele Britannier die Römer nachäfften. Alle trugen das kurze, zweischneidige Schwert eines Legionärs am Gürtel, was schon ungewöhnlicher, aber auch nicht vollkommen unbekannt war. Die Leute liebten es, die Römer nachzuahmen. Aber alles an ihnen sah fremdländisch aus – ihre Haut, ihre Augen, ihre Haltung, ihre Münder –, und Spring war ziemlich sicher, dass sie tatsächlich Römer waren. Aber was, bei allen verschissenen Dachsärschen dieser Welt, hatten fünf Römer vor Dugs Hütte zu tun?
Sie wirkten ziemlich hart, abgesehen vom Kerl in der Mitte, der einfach nur seltsam wirkte, sie an den Druiden Maggot erinnerte und sich damit einen Ehrenplatz in der Truppe der komischsten Käuze verdiente, die Spring jemals gesehen hatte. Er war absolut riesig, massig, doch sein Kopf war unwahrscheinlich klein. Schwarze Nadelkopfaugen starrten ihr aus einem braun gebrannten, faltigen Gesicht entgegen. Ganz im Gegensatz zu seinem lächerlichen Äußeren schien er ein Mann zu sein, der sich sehr ernst nahm. Seine Haare, die für jemanden seines Alters verdächtig kohlrabenschwarz waren, hatte er eingeölt und von seiner ledrigen Stirn nach hinten zu einem kleinen, kecken Pferdeschwanz geflochten.
Sie sah sich um. Schweinie und Sadie waren nirgendwo zu sehen. Selbst die Hühner, die sich normalerweise scharrend durch Dugs Innenhof bewegten, obwohl er versucht hatte, es ihnen auszutreiben, hatten sich verdünnisiert. Sie würden sie erwischen, bevor sie sich durch die Tür oder eins der Fenster in Sicherheit bringen konnte, und sie versperrten ihr den Weg aus dem Innenhof. Sie war gefangen und sie konnte keine Hilfe erwarten.
Mit fünfen konnte sie es nicht aufnehmen. Wenn sie den Anstand besessen hätten, sie aus mehreren Hundert Schritt Entfernung auf einem offenen Feld anzugreifen, und hätte sie ihren Bogen und ein paar Pfeile dabeigehabt, dann hätte sie sie alle ohne Probleme erledigt, aber den Bogen hatte sie in Frogshold zurückgelassen und sie standen direkt vor ihr. Das Einzige, was sie hatte, war Dugs Kriegshammer, den sie kaum heben und schon gar nicht benutzen konnte. Einer allein wäre ihr schon zu viel. Aber fünf … Nun, aus dieser Situation konnte sie sich nur mit einigen schlauen Worten retten.
»Zuallererst solltet ihr wissen«, sagte sie, lächelte und dachte, dass sie Britannisch vermutlich gar nicht verstanden, »dass ihr wie ein Haufen erstklassiger Arschlöcher ausseht. Ich habe schon gehört, dass Römer hässlich sind, aber wenn ich Schweine besäße, die so wie ihr aussehen, dann würde ich ihnen Gesichter auf den Arsch malen und sie rückwärts auf den Markt laufen lassen.«
Vier von ihnen zeigten keine Regung, aber die Augen des großen Kerls wurden zu schmalen Schlitzen. Er hob sein Schwert.
»Und zweitens«, fügte Spring schnell hinzu, »ergebe ich mich euch vollkommen. Wenn ihr hier seid, um zu stehlen, dann mal los. Stehlt so viel ihr wollt. Wenn ihr auf Sklavenjagd seid, dann werde ich eure allerbeste Sklavin sein – gehorsam, glücklich und fleißig, das verspreche ich. Wenn ihr stehlen und mich versklaven wollt, dann bitte schön. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Ich bin mir sicher, dass schlaue Römer wie ihr wissen, dass ihr vielmehr Geld für mich bekommt, wenn ich unverletzt bin.«
Der große Fette lächelte hinterhältig. Die Angst, die sich eben noch in ihrem Magen gesammelt hatte, rutschte hinauf in ihre Kehle.
»Wir sind nicht hier, um dich auszurauben oder gefangen zu nehmen«, sagte er auf Gallisch, das dem Britannischen ziemlich ähnelte. Allerdings sprach er mit einem Akzent, der sich so anhörte, als ob ein Mann sich die Nase zuhielte und gleichzeitig versuchte, knallhart zu wirken.
»Nun, das ist ja wunderbar«, sagte Spring. »In diesem Fall kann ich euch gerne etwas zu essen anbieten und dann könnt ihr mir ja helfen, nach den Hunden zu suchen –«
»Wir sind hier, um dich zu töten«, unterbrach sie der große Kerl.
Spring schluckte schwer. »Ich verstehe. Aber warum?«
»Das weiß ich nicht«, sagte der Mann, »aber wir sind sehr gut bezahlt worden und wir bekommen noch mehr, wenn wir deine Leiche vorzeigen. Viel mehr.«
»Wo müsst ihr meine Leiche vorzeigen?« Spring packte den Kriegshammer ein wenig fester. Dug hätte mit dieser Waffe zehn solche Kerle erledigen können. Hilf mir, Dug, flehte sie leise. Sie erhielt keine Antwort.
»Wir werden sie nach Gallien bringen.«
»Wer will sie haben?«
»Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Jemand, der sehr reich und sehr wichtig ist, denn nur die Mächtigen verwenden Mittelsmänner und nur die Reichen können sich mich leisten.«
»Mein Körper wird in wesentlich besserem Zustand sein, wenn ihr mich bis Gallien leben lasst«, versuchte es Spring. »Ich verspreche euch, ihn gut zu pflegen und mich mit ihm nicht allzu sehr herumzutreiben.«
Der große Mann lachte leise. »Glaub mir, ich würde dich gerne ein wenig länger leben lassen. Du bist witzig und du erinnerst mich an meine Töchter. Aber wenn wir dich hier töten, dann ist deine Chance auf eine Flucht erheblich geschmälert.«
»Tja, ich verstehe, was du damit sagen willst …« Springs Gedanken rasten. Sie zog den Kriegshammer von ihrer Schulter. Bei Teutates’ Blitzen, war der schwer. »Dann müssen wir wohl kämpfen, oder? Ich sollte euch allerdings warnen, dass ich hiermit ziemlich gut umgehen kann. Ich schlage euch vor, euch zu verabschieden. Ich schwöre, dass ich niemandem erzählen werde, dass ihr hier wart oder dass ihr den Schwanz eingezogen habt. Euer Geheimnis ist bei mir sicher.«
Der Anführer lächelte und gab den zwei Männern zu seiner Rechten ein Zeichen. Sie hoben die Schwerter und griffen sie an.
Kapitel 2
Ragnall Sheeplord erreichte das Befehlszelt, das durch Julius Caesars Rückkehr von Decimus Junius Brutus’ unangenehmer Präsenz befreit worden war. Ernst dreinblickende, schwarz gekleidete Prätorianer geleiteten ihn hinein. Caesars Augen wurden kurz ein wenig größer, was bedeutete, dass er ihn bemerkt hatte. Der seit Kurzem ex-britannische Römer wusste das Zeichen zu deuten – er sollte warten.
Caesar schien auf absurde Weise ungerührt im Angesicht der Tatsache, dass die große Welle seine Invasionsflotte vollständig zerstört hatte. Er hatte einfach den gallischen Schiffsbauern und ihren Sklaven befohlen, eine neue, größere Flotte zu bauen, und behauptet, dass er ohnehin nie vorgehabt hatte, in diesem Jahr nach Britannien in See zu stechen, sondern erst im nächsten. Daraufhin hatte er seine Legionen ausgesandt, das nordwestliche Gallien zu durchsuchen und jeden Veneter gefangen zu nehmen und zu versklaven, der die Seeschlacht überlebt hatte – Männer, Frauen und Kinder. Wer Widerstand leistete, wurde getötet.
Ragnall stellte sich an eine Seite des riesigen Zelts und hörte zu, wie der General seinen Tagebuchschreibern die offizielle Darstellung zur Seeschlacht und den folgenden Ereignissen diktierte. Es hatte weder eine Windstille noch eine große Welle gegeben. In Caesars Version hatte Brutus dank scharfer Wurfhaken die Takelage der gallischen Segelboote zerschnitten und sie mit überlegener Strategie besiegt. Nach der Schlacht hatte er, so berichtete er seinen Schreibern, die Anführer der aufständischen Veneter getötet, um ihnen die Konsequenzen eines solchen Aufstands vor Augen zu führen, und den Rest versklavt.
Wie sonst auch lag in Caesars Worten mehr die Absicht, die Unterstützung Roms zu garantieren, als die Wahrheit zu berichten. Am Anfang hatte sich Ragnall daran noch gestört, doch jetzt war er fest davon überzeugt, dass es nichts Besseres und Wichtigeres gab, als die römische Zivilisation in die ganze Welt zu tragen. Wenn das voraussetzte, die Menschen in der Heimat, die den Krieg nicht verstanden, zu belügen und Mittel einzusetzen, die extrem anmuteten, vielleicht sogar brutal – einschließlich des Einsatzes schwarzer Magie –, dann sollte es so sein. Wo gehobelt wird, da fallen Späne.
Nachdem er seine Tagebucheinträge beendet hatte, teilte der Befehlshaber den Anwesenden mit, dass er die Wachen an den Vorposten kontrollieren werde, und bedeutete Ragnall, ihm zu folgen.
»Erzähle Caesar erneut«, sagte Caesar, als sie mit schnellen Schritten das Zelt verließen, »von deinem Vater.«
Sie erklommen eine flache Anhöhe und Ragnall musste immer wieder einige Schritte laufen, um mit den langen Beinen Caesars gleichzuziehen. Er erzählte erneut die Geschichte, wie er seinen Vater Kris Sheeplord, König von Boddingham, seine gesamte Familie und seinen Stamm tot vorfand, ermordet von König Zadar von Maidun. Er wollte gerade darauf zu sprechen kommen, wie hart ihn das getroffen und wie es ihn von einem Jungen in den Mann verwandelt hatte, der die Ziele des Generals weitaus besser verstand als die meisten, doch Caesar fiel ihm ins Wort.
»Also bist du König von Boddingham?«
»Äh –«
»Die Herrschaft über den Stamm von Boddingham ist erblich und wird über die männliche Stammlinie vererbt?«
»Nun, männlich oder weib –«
»Und du bist der letzte überlebende Nachkomme Sheeplords?«
»Ja …«
»Dann bist du der rechtmäßige König Boddinghams. Und der Mann, der über den Stamm herrschte, der deine Leute umgebracht und sich eure Ländereien einverleibt hat, dieser König Zadar – seine Nachfolgerin ist eine Königin Lowa?«
»Nun, sie ist nicht wirklich seine Nachfolgerin. Sie hat ihn getötet, aber sie wollte keine Königin sein. Doch die Leute –«
»Beantworte meine Frage, Ragnall. Ist Lowa die Herrscherin über den Stamm von Maidun?«
»Ja.« Maidun war genau genommen kein Stamm. Wie bei den Armorikern handelte es sich um einen Zusammenschluss verschiedener Städte, Dörfer und Stämme, doch Ragnall wusste, dass Caesar sich jetzt nicht für Details interessierte. Es gab Augenblicke, in denen er sich für sie faszinieren konnte – selbst für die kleinsten Einzelheiten. Doch Ragnall hatte bereits vor einiger Zeit beschlossen, dass er die Launen Caesars lesen und sich anpassen musste, um sich mit ihm gut zu stellen. Und natürlich mit allem einverstanden zu sein, was er sagte.
»Und es handelt sich bei dieser Königin Lowa um diejenige, die diese drei Britannier entsandt hat, um den aufständischen Galliern zu helfen … wie hießen sie noch gleich?«
»Atlas Agrippa, Carden Nancarrow und Chamanca … Ihren wahren Namen kenne ich nicht. Ich glaube, sie heißt nur Chamanca.« Es war zwecklos, Caesar zu sagen, dass zwei von ihnen eigentlich gar nicht aus Britannien stammten.
»Dann hat Maidun, der Stamm, der deine Familie getötet und deine Ländereien widerrechtlich an sich gerissen hat, außerdem grundlos Truppen nach Gallien entsandt, um Rom und seine gallischen Verbündeten anzugreifen. Wenn man diese beiden Punkte verbindet, Ragnall, dann hast du starke Argumente, um die Hilfe Roms bei der Rückeroberung deiner Ländereien zu erbitten.« Caesar blieb neben einem hohen Baum stehen, sah zu der Aussichtsplattform hinauf, die sich weit oben auf den entlaubten Ästen befand, nickte und machte sich wieder auf den Weg. »Nach deiner unverzichtbaren Hilfe bei unseren Siegen in Gallien glaube ich, dass sich Rom verpflichtet fühlen wird, Boddingham zu Hilfe zu eilen. Ja, du bist der entthronte britannische König, der Rom mit offenen Armen empfangen und den germanischen Unterdrücker Ariovistus getötet hat. Die Rettung zahlreicher römischer Soldaten ist deinem scharfen Verstand zu verdanken, als du bei den Nerviern die Falle des Feinds gegen ihn eingesetzt hast. Außerdem wollen die Götter mit Gewissheit Königin Lowa für ihre Verbrechen bestrafen. Sie haben ihr eine kurze Zeit des Erfolgs und der Straflosigkeit zugestanden, um sie ihre nahende Niederlage noch deutlicher, noch schmerzhafter fühlen zu lassen. Hinzu kommt außerdem die Tatsache, dass viele Anführer der aufständischen Gallier nach Britannien geflohen sind –«
»Sind sie das?«
»Ich habe guten Grund zu dieser Annahme. Haben wir nicht bereits britannische Krieger an der Seite der Gallier gesehen? Wie viele werden noch kommen? Die Angriffe auf Römer zu rächen, weitere Übergriffe auf unser Territorium zu verhindern und die Wiedereinsetzung des rechtmäßigen Königs Britanniens anzustreben – der Rom ein Freund ist –, all das wird in Rom bei Senat, Tribunat und den Bürgern auf Unterstützung treffen. Vielen Dank, Ragnall! Lass Caesar jetzt allein, aber bleib in der Nähe. Caesar wird bald nach Rom zurückkehren und du wirst ihn begleiten.«
Ragnall sah zu, wie Caesar sich schnellen Schritts entfernte, und lächelte. Zurück nach Rom – hoffentlich für sehr lange. Nachdem er den letzten Winter im gefährlichen und dreckigen Gallien verbracht hatte, wäre die Rückkehr an den Ort, an dem er sich am glücklichsten und zu Hause fühlte, eine wunderbare Sache.
Er kehrte ins Lager zurück. Caesar hatte natürlich recht gehabt; Ragnall konnte überhaupt nicht verstehen, warum er nicht selbst schon draufgekommen war. Er war immer davon ausgegangen, dass nach Zadars Zerstörung von Boddingham auch das Recht seines Vaters auf sein Königreich und Ragnalls Anspruch auf sein Erbe erloschen war. Aber das war natürlich nicht der Fall. Er hatte die Ländereien für Maidun gestohlen und Maidun hätte sie zurückgeben müssen, als Zadar getötet worden war. Anders ausgedrückt hätte Lowa ihm Boddingham zurückgeben müssen. Warum war ihm das nicht früher klar geworden? Vielleicht hatte sie ihn deswegen nach Rom geschickt: damit er keinen Anspruch auf sein Erbe erhob. Tatsächlich hatte Lowa nicht den geringsten Anspruch auf irgendeine Krone. In ihren Adern floss kein königliches Blut, denn sie war nur eine einfache Kriegerin. Nach Zadars Tod wäre Ragnall selbst die beste Wahl gewesen, um nicht nur Boddingham zurückzufordern, sondern auch den Anspruch auf Maidun zu erheben! Lowa mochte zwar nur Kriegerin sein, aber sie war auch sehr clever …
Nun, das war jetzt unwichtig, dachte er. Es würde sich schon alles klären. Man würde sie schon von ihrem hohen Ross herunterholen, nur wenige Stunden nach der Landung der Römer in Britannien, Ragnall wäre der König Boddinghams und, wenn er es geschickt anstellte, nicht nur das.
Kapitel 3
Der Römer von ganz links stürzte sich auf Spring und schlug mit seinem Schwert nach ihrem Hals.
Sie schrie auf, hielt sich eine Hand schützend vors Gesicht und ließ gleichzeitig den Hammerkopf auf den Boden plumpsen, sodass sein Griff nach oben zeigte. Der Römer hielt inne, genoss ihr Entsetzen, lachte und holte erneut aus. Spring duckte sich, rammte ihm den hölzernen Griff in den Unterleib, riss ihn wieder zurück und schwang den Hammerkopf nach oben. Er traf krachend auf den Kiefer und zerschmetterte Kinn und Zähne. Der Mann ging zu Boden. Sie nutzte den Schwung des Kriegshammers, änderte seine Laufbahn aber geschickt durch ein Drehen der Handgelenke und ließ ihn von oben auf den Kopf des nächsten Legionärs krachen. Als er zusammenbrach, lenkte sie die Bahn der Waffe in einen Rückhandangriff um. Ihr Anführer war schnell und sein Schwert zischte bereits auf sie zu, doch der Kriegshammer schlug es ihm aus der Hand, landete in seinem Gesicht und auch er ging zu Boden.
Der Kriegshammer war doch gar nicht so schwer, dachte Spring, wenn es um kämpfen oder sterben ging.
Die beiden verbliebenen Römer starrten sie mit großen Augen an. Einer ließ sein Schwert fallen. Als er sich bückte, um es wieder aufzuheben, machte Spring einen Schritt auf ihn zu und hob den Hammer wieder hoch. Er verzichtete auf sein Schwert, drehte sich auf dem Absatz um und gab Fersengeld.
»Nur noch du und ich«, sagte Spring zu dem letzten Römer und täuschte einen Angriff mit dem Kriegshammer an. Er war wirklich verdammt schwer. Sie würde ihn jetzt jeden Augenblick fallen lassen müssen.
Er sah sich um und starrte auf seine getöteten Kameraden.
»Wie hast du dich so schnell bewegen können?«, fragte er.
»Greif mich an, dann zeige ich es dir.« Spring zwinkerte ihm zu, ließ den Hammerkopf auf den Boden fallen und versuchte es so aussehen zu lassen, als ob das Absicht gewesen wäre – und nicht, weil sie ihn nicht mehr halten konnte. Einen Herzschlag lang schien der Legionär darüber nachzudenken, ob er sie angreifen sollte, nun, da sie jede Deckung aufgegeben zu haben schien, und dann wäre sie am Arsch gewesen. Doch er warf einen kurzen Blick auf seinen besiegten Anführer, änderte seine Meinung und floh auch. Er folgte seinem überlebenden Freund auf dem Weg, der zur Anhöhe oberhalb des Kliffs führte.
»Du solltest lieber in die andere Richtung flüchten«, rief Spring ihm hinterher, »auf dem Weg –«
Sie wurde durch lautes Gebell unterbrochen. Sadie und Schweinie brachen aus dem Unterholz hervor und rannten den Männern hinterher.
Sie setzte sich auf den arg mitgenommenen Baumstumpf, den Dug zum Holzhacken benutzt hatte. Das Leben ist seltsam, dachte sie. Sie saß hier vor Dugs Haus, auf den Kerben, die seine wuchtigen Schläge hinterlassen hatten, um sich herum drei tote Römer, und hätte zutiefst traurig sein sollen. Doch stattdessen war sie mit sich im Reinen. Was sie gerade mit dem Kriegshammer vollbracht hatte, war außergewöhnlich. Es hatte sich nicht um Magie gehandelt oder zumindest hatte es sich nicht wie ihre alte Magie angefühlt; vielmehr schien sie von jemand anderem eine Fähigkeit geerbt zu haben und dabei musste es sich um Dug handeln. Außer ihm hatte sie niemanden kennengelernt, der mit einem Kriegshammer kämpfte. Also lebte ein Teil von ihm in ihr weiter und das machte sie glücklich. Doch als sie die toten Römer betrachtete, kehrte die Traurigkeit zurück. So viele verlorene Menschenleben! All diese Leute – die Armeen im Westen und Römer – hatten sie und die Menschen, die sie liebte, angegriffen und nach ihrem Leben getrachtet. Sie hatten nur das bekommen, was sie verdient hatten … aber warum blieben sie nicht einfach zu Hause und genossen den Lauf der Welt? Sie könnten nützliche Dinge bauen, sich um ihre Tiere kümmern, Dörfer gründen und gedeihen lassen, in den Wäldern spazieren gehen, Wildschweine jagen und dem Vogelgezwitscher lauschen – all dies und Tausende andere Dinge waren den ständigen Schlachten, dem ständigen Sterben vorzuziehen.
Sie ging ins Haus und fragte sich, was sie mit den Leichen machen sollte. Sie stellte den Kriegshammer ab und ging in das Zimmer, das Dug für sie eingerichtet hatte. Sie blieb in der Tür stehen. Dug hatte vor seiner letzten Schlacht noch eine neue, gemusterte Decke auf ihr Bett gelegt und anschließend das Töpferrad benutzt, von dem sie gedacht hatte, dass er es nie anfassen würde. Er hatte ihr eine Schale für das Regal unter ihrem Fenster gemacht, um sie mit getrockneten Blumen zu füllen. Ihr Blick wanderte zwischen Decke und Schale hin und her. Sie stellte sich Dug vor, wie er die Blumen ausgesucht hatte, die sie so gern mochte, wie er sie pflückte, zum Trocknen auslegte. Etwas in ihr zerbrach und sie zerfloss in Tränen.
Lowa verdrückte einige Tränen. Sie war in ihre Hütte gegangen, hatte bemerkt, dass sie noch nach Dug duftete, und das hatte diese Emotionen ausgelöst. Es lag an der Schwangerschaft, ermahnte sie sich, dass sie solch kindische Gefühle empfand. Außerdem musste sie sich häufig übergeben, was mindestens genauso unangenehm war. Ihre Brüste waren angeschwollen und schmerzten. Dass sie größer wurden, verstand sie noch, denn das hatte mit der Milch zu tun, aber warum das Erbrechen? Wie konnte es der Entwicklung des Babys dienlich sein, sich die ganze Zeit schlecht zu fühlen und übergeben zu müssen? Die Pickel, die Rückenschmerzen, dieses ständige Gefühl lähmender Müdigkeit – hatten die etwa alle eine mysteriöse, babyfördernde Funktion? Welcher Gott auch immer Frauen und Babys erfunden hatte, so dachte sich Lowa, schien Frauen nicht sonderlich gemocht zu haben.
Sie schüttelte den Kopf. Sie war gerade erst nach Burg Maidun zurückgekehrt und musste eigentlich sofort wieder losziehen, um die Ländereien Maiduns zu besichtigen und ihre Verbündeten zu besuchen. Die Welle war an Britanniens Südküste bei Weitem nicht so hoch gewesen wie im Westen und das Wasser hatte sich erst zurückgezogen, bevor es wuchtig wiedergekommen war. Das hatte den Leuten und ihren Tieren genügend Zeit gegeben, sich in Sicherheit zu bringen. Doch die Ernte und ihre Hütten hatte es hinweggefegt und sie brauchten Hilfe. Die Vorräte im Land mussten erfasst und mit den Küstengebieten geteilt werden.
Außerdem musste sie ihre Armee neu aufbauen. Drei Viertel ihrer Infanterie hatten sie an Eru und die Fassiten verloren, was bedeutete, sich um viele neue Rekruten und ihre Ausbildung kümmern zu müssen, denn die Römer waren auf der Seite des Meeres in Armorika und warteten nur darauf, nach Britannien einzumarschieren. Wer ihr geblieben war, hätte Schwierigkeiten, eine Kneipenschlägerei unter Kontrolle zu bekommen, geschweige denn eine Armee zu besiegen, die die vielfältigen, kriegerischen Stämme Galliens in nur zwei Jahren niedergerungen hatte. Aber sie musste es versuchen.
Auf dem Weg nach draußen erblickte Lowa Springs Bogen neben der Tür. Sie hatte ihn aus Frogshold mitgebracht. Sie hatte Spring seit dem Tag der großen Welle nicht mehr gesehen, aber sie ging davon aus – sie hoffte –, dass sie auf Dugs Bauernhof war. Sie war jung und sie hatte Zehntausende getötet, was vermuten ließ, dass ihr das Kopfzerbrechen bereitete – wenn es sie nicht sogar aus der Bahn warf. Lowa hätte das nicht gestört – diese Wichser hatten es allesamt verdient –, doch Spring war sensibler. Alle in Maidun sprachen über die Spring-Flut, die entsetzliche, riesige Welle, die die Armeen der Dumnonier, Fassiten, Murkaner und auch die aus Eru hinweggefegt hatte. Es war einhellige Meinung unter allen Klatschbasen Maiduns, dass das Mädchen sie herbeibeschworen hatte, indem sie Dug tötete, und es war wahrscheinlich am besten, wenn Spring eine Zeit lang auf dem Bauernhof blieb, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen.
Lowa entschloss sich, sofort jemanden mit dem Bogen zu ihr zu schicken, um ihr zu zeigen, dass sie an sie dachte und sie nicht für Dugs Tod verantwortlich machte. Sobald sich die Gelegenheit bot, wollte sie ihr so schnell wie möglich selbst einen Besuch abstatten. Sie wäre in diesem Augenblick gerne sofort losgezogen, um ihre Freundin zu trösten – oder vielmehr ihre Ersatztochter –, doch das ging einfach nicht. Sie war die Königin, und sie musste ihr Volk ernähren, ihm ein Dach über dem Kopf bieten und ihre Armee wieder aufbauen.
Das Handelsschiff stieß endlich gegen die Kaimauer. Chamanca erkannte, dass die Welle auch Britannien getroffen hatte, und das mindestens genauso hart wie Gallien. Die steinernen Ufermauern hatten sie überstanden, auch einige der Boote, doch die Stadt selbst war dem Erdboden gleichgemacht worden. Die prachtvollen Holzhäuser am Ufer waren Zeugen des Sklavenhandels unter Zadars Herrschaft gewesen und zwischen ihnen hatte sich die riesige Holzstatue der Meeresgöttin Lí Ban erhoben. Alles hatte »Schaut, wie reich wir sind!« geschrien und all das war vom Erdboden hinweggefegt worden. Einige Lagerhäuser aus Stein und nicht mehr genutzte eiserne Sklavenkäfige hatten die Welle überstanden, auch wenn die Lagerhausdächer verschwunden waren und aus einem ein großes Boot herausragte. Die Küstenbewohner hatten um diese robusteren Gebäude mit dem Wiederaufbau ihrer Stadt begonnen, doch bisher handelte es sich nur um einige baufällige Anbauten, zwischen denen man ein Stück Ledersegel aufgespannt hatte. Der Geldsegen hatte in dem Augenblick sein Ende gefunden, als Lowa die Sklaverei verboten hatte. Es war daher unwahrscheinlich, dass die Stadt jemals wieder so wohlhabend aussehen würde wie früher. Aber das war wahrscheinlich gut so, dachte die Ibererin. Sie empfand kein Mitleid für Sklaven – wer so dumm war, sich versklaven zu lassen, hatte es verdient, mit den Folgen zu leben –, aber mit dem Reichtum zu protzen, den der Verkauf ihrer Mitmenschen ermöglichte, war in ihren Augen eine Finn-verfluchte Schande.
»Kapitän? Kapitän Jervers?«, rief eins der Besatzungsmitglieder in ihrer Nähe. »Wo ist der Kapitän?«
»Ich glaube, er ist in seiner Kabine!«, brüllte jemand anders.
Chamanca verstand das als ihr Zeichen, über die Reling zu springen und in der Menge unterzutauchen. Sie würden nicht lange brauchen, um Jervers zu finden. Er war in seiner Kabine, er war bewusstlos, ihm fehlten einige Zähne und vielleicht auch ein wenig Blut. Als sie in Sichtweite des Hafens gewesen waren, wollte sie ihn für die Überfahrt bezahlen, doch der fette Narr hatte mehr verlangt und sie, als sie sich geweigert hatte, mit einem Entermesser angegriffen. Was Chamanca sehr gefreut hatte, denn sie war unheimlich hungrig gewesen.
Sie machte sich nicht die Mühe, nach einem Pferd Ausschau zu halten. Es war ein strahlender Spätsommertag, eine leichte Brise wehte und nach ihrer Mahlzeit strotzte sie nur so vor Energie. Die Vorstellung, nach einem Tag und einer Nacht auf See zu Fuß nach Maidun zu gehen, gefiel ihr sehr.
Als sie die Stadt verließ, wurde sie eine Zeit lang von einem Jungen begleitet. Der kleine, gesprächige Kerl schien entschlossen, ihr alles über die Schlacht von Frogshold und die Spring-Flut zu erzählen, die die bösen Armeen zerstört und Maidun gerettet hatte.
»Spring-Flut?«, fragte Chamanca.
»So nennen sie die große Welle. Eine mächtige Magierin namens Spring hat sie heraufbeschworen.«
Sie hörte sich an, was der Junge zu erzählen hatte, und reichte ihm dann eine Münze, damit er sich verzog. Sie wollte mit ihren Gedanken allein sein, während sie die letzten Meilen nach Maidun hinter sich brachte. Sie fühlte sich hin- und hergerissen. Der Gedanke, von Carden Nancarrows Tod zu berichten, bereitete ihre keine Freude. Er war beliebt gewesen und das aus gutem Grund. Er war ein guter Mann und er war gestorben, um ihr die Flucht zu ermöglichen. Seine Mutter, die Schmiedin Elann, würde dies hart treffen, auch wenn sie es ganz bestimmt nicht zeigen würde. Chamanca hatte ihren anderen Sohn Weylin getötet – auf Zadars Befehl, also war das nicht ihre Schuld –, aber sie war einfühlsam genug, um zu verstehen, dass die Mutter sie nicht nur für seinen, sondern auch Cardens Tod verantwortlich machen konnte. Der verquere Zorn einer trauernden Mutter hätte Chamanca normalerweise nicht im Geringsten gestört, aber Elann war eigenartig. Sie sprach kaum ein Wort, zeigte noch seltener Gefühle und stellte dennoch die besten Waffen und andere Schmiedearbeiten her, die die Ibererin jemals gesehen hatte. Und da war noch mehr – eine stille Macht schien dieser Frau zu entströmen, ähnlich der unerträglichen Hitze ihrer Schmiedefeuer.
Es bereitete ihr kein Behagen, mit ihr sprechen zu müssen. Außerdem hatte sie festgestellt, dass sie Atlas Agrippa immer mehr vermisste. Bei ihrer letzten Reise nach Gallien war sie nur mit Carden unterwegs gewesen und sich den langweiligen, weil vernünftigen Befehlen des Afrikaners nicht mehr unterwerfen zu müssen, hatte ihr gutgetan. Doch es hatte Augenblicke gegeben, da hatte sie ihn sich an ihrer Seite gewünscht. Nicht um ihr gegen die Römer zu helfen – sie war durchaus in der Lage, allein gegen diese unscheinbaren kleinen Kerle zu bestehen –, aber … nun, sie war sich da nicht sicher. Sie hatte ihn einfach vermisst.
Kapitel 4
Anscheinend war die Geburt eine schnelle Angelegenheit gewesen, auch wenn es Lowa nicht so vorgekommen war. Die meisten Frauen, mit denen sie sich unterhalten hatte, warnten sie, dass die Geburt kein Zuckerschlecken sei, aber einige behaupteten, es wäre ein erfrischend natürliches Erlebnis und der Schmerz lebensbejahend. Sie hatte gehofft, dass die kleinere Gruppe recht behielt, doch nun wusste sie, dass sie sie entweder angelogen oder sich selbst betrogen hatten. Diesen kleinen Bastard aus ihr herauszupressen, während ihre Vagina die ganze Zeit zu zerreißen drohte, hatte aber auch gar nichts Gutes an sich gehabt – und die einzige Bestätigung, die sie erfahren hatte, war, dass sie Schmerzen nicht ausstehen konnte. Die Erfahrung war nicht so schlimm wie die Folter gewesen, die ihr Pomax, die Murkanerin, hatte angedeihen lassen, aber ziemlich nah dran.
Schlimm und fast genauso unangenehm war die Tatsache, dass sie all das vor den Augen Maggots hatte durchstehen müssen. Es gab niemand anderen, den sie sonst bei ihrer Geburt hätte dabeihaben wollen, doch jetzt, wo er sie von ihrer schlechtesten Seite erlebt hatte – brüllend, grunzend, fluchend –, war sie sich nicht sicher, ob sie ihm jemals wieder in die Augen sehen konnte.
»Alle glücklich?«, fragte Maggot, als er in die warme, gut beleuchtete Hütte hereinkam. Draußen war es eiskalt, doch er trug wie sonst auch nichts außer seiner gemusterten Hose, der Lederweste und genügend Schmuck, um ein kleines Handelsschiff zu versenken.
Lowa dachte kurz nach. Nein, sie war nicht glücklich. Alles an ihr war wund und sie verspürte nicht sonderlich viel Zuneigung zu dem kleinen menschlichen Wesen, das in Decken eingewickelt auf ihrer Brust lag. Das hatte sie übrigens auch von den lebensbejahenden Idiotinnen gehört – dass sie die Liebe zu ihrem Kind praktisch vom ersten Augenblick an überwältigen würde. Nun, vielleicht logen sie in diesem Fall ja nicht, vielleicht hatten sie sich ja sofort in ihre Babys verliebt, aber das einzige Gefühl, das sie hier und jetzt empfand, war Enttäuschung, dass sie in ihrer Hütte eingesperrt war, während sie eigentlich ihre Armee ausbilden sollte.
»Ich kann mich nicht erinnern, in meinem Leben jemals so fröhlich gewesen zu sein«, antwortete sie.
Maggot zwinkerte ihr zu. »Du hast dich gut geschlagen. Hast ihn ordentlich rausgequetscht, schnell und ohne viel Aufhebens zu machen. Ich habe eine Menge Babys gesehen und der wird richtig hübsch. Weißt du schon, wie du ihn nennen willst?«
»Ich habe da eine Idee«, sagte sie.
Kapitel 5
Ragnall ging schwungvoll durch die Menschenmassen auf der Via Sacra und gaffte die bemalten Statuen an, die von den Tempeldächern auf ihn herabblickten. »Niemand in Rom schaut mehr nach oben und dadurch entgeht ihnen alles«, hatte jemand vor ein paar Nächten in Clodia Metellis Haus zu ihm gesagt. Seitdem sah er nach, jedes Mal, wenn er sich an diese Worte erinnerte, und er war froh darüber. Die Gebäude waren viel aufwendiger verziert, als ihm jemals klar gewesen war, und das nicht nur bis ganz nach oben zu den Dächern, sondern auch in unglaublicher Schönheit. Selbst die schlichteste Skulptur am unauffälligsten Gebäude der Stadt war beeindruckender als jede Kunst, die er je in Britannien erblickt hatte. Die größten, aufwendigsten Kunstwerke – Massenszenen mit Göttern und Menschen und mythischen Bestien – ließen ihn stehen bleiben, blinzeln und das Atmen vergessen.
Rom erfüllte ihn mit Freude. Er hatte die ersten zwanzig Jahre seines Lebens in Britannien verbracht, aber diese Stadt war seine wahre Heimat. Der Augenblick seiner Ankunft fühlte sich so an, als ob sich seine Seele wohlig seufzend in ein warmes, duftendes Bad hatte gleiten lassen. Es fühlte sich gut an, es war gut. Je schneller der Rest der Welt die römische Lebensart annahm, umso besser für alle. Es würde immer Leute geben, die von sich sagten, sie wollten nicht wie die Römer leben, aber das waren in der Regel dumme, ältere Leute, die gegen jede Form des Wandels waren. »Darf ich Ihnen dieses halb verweste Eichhörnchen vom Gesicht nehmen?«, könnte man sie fragen und ihre Antwort würde lauten: »Nein, vielen Dank, ich mag es so, wie es ist.«
Er umging eine Frau mit einer Frisur, die einem wackligen Turm aus gepuderten Pfauen ähnelte, und wich einer Gruppe junger Männer mit modischen Bärten aus, deren lässig getragene Togen von einem Gürtel nur locker zusammengehalten wurden, genau wie bei ihrem Helden Caesar. Seit die Stadt mit der Kriegsbeute Julius Caesars überschwemmt wurde und der Senat zwanzig Tage kontinuierlicher Feierlichkeiten für seine Erfolge in Gallien gewährt hatte, war sein Name in aller Munde und der charakteristisch lockere Gürtel wurde von allen jungen Männern getragen.
»He, Ragnall! Alter Hurensohn!« Die gutmütige Beleidigung stammte von einem Trupp Legionäre, die Ragnall aus Gallien kannte und die Caesar in die Stadt hatte verfrachten lassen, damit seine Kumpane Pompeius und Crassus dieses Jahr zum Konsul gewählt wurden. Die Soldaten würden für die Kandidaten stimmen und wer das nicht tat, konnte sich auf eine Tracht Prügel gefasst machen.
Dass sie ihm Aufmerksamkeit schenkten, gefiel Ragnall. Draußen im Feld, in Gallien, würden sich die Soldaten keine Mühe machen, einem kleinen Verwaltungsbeamten wie ihm einen Gruß zuzurufen. Doch zu Hause schien sich die Kameraderie des gemeinsamen Feldzugs wie eine ansteckende Krankheit zu verbreiten, denn hier waren die Jungs die besten Freunde, bloß weil man irgendwann zur selben Zeit an denselben Ort marschiert war.
»Du wirkst unerträglich fröhlich. Ich würde zu gern wissen, was du gerade denkst«, ertönte eine wohlklingende Stimme hinter ihm. Ragnall drehte sich um. Es war Marcus Tullius Cicero, den alle einfach nur Cicero nannten. Ragnall und Drustan hatten ihn in der Nacht kennengelernt, als Drustan getötet worden war. Vor einigen Jahren war Cicero gewählter Konsul gewesen, er galt als Roms bester Jurist und wurde oft als der intelligenteste Mann im gesamten Imperium bezeichnet. Seit Ragnall ihn getroffen hatte, war er ins Exil geschickt und nach Hause zurückbeordert worden, nur um sich mit Caesar zu zerstreiten und wieder zu versöhnen. Ragnall wusste das alles, weil sie in Clodias Haus oft über Cicero sprachen; dem Haus, in dem Ragnall wieder mit offenen Armen empfangen worden war (und nicht nur mit offenen Armen.) Clodia schien Ehrfurcht vor ihm zu empfinden, trotz der Tatsache – oder vielleicht deswegen –, dass Cicero ihren Bruder erfolglos des Inzests mit ihr angeklagt hatte. Aus Rache hatte Clodius Cicero ins Exil schicken lassen.
»Ich freue mich, wieder in Rom zu sein«, antwortete Ragnall.
»Das verstehe ich. Mein erzwungener Aufenthalt in Griechenland hätte mich fast in den Selbstmord getrieben, obwohl das mehr über Griechenland als über Rom aussagt.« Cicero sprach sehr laut, sodass Passanten ihn hören konnten, und lächelte ein »Habe ich nicht gerade etwas unheimlich Schlaues gesagt?«-Lächeln. »Es überrascht mich aber, dass dir Rom so gut gefällt«, fuhr er mit wesentlich leiserer Stimme fort. »Aber du bist und bleibst ein wandelnder Gegensatz, nicht wahr, Ragnall?«
Ragnall war zugleich geschmeichelt und verunsichert, dass sich eine so berühmte Persönlichkeit nach nur einem Treffen vor vielen Jahren noch an ihn erinnerte und sich auch dazu herabließ, eine Meinung über ihn zu haben. »Ich glaube nicht, dass ich ein Gegensatz bin …?«, sagte er daher, denn er wusste nicht, was dieser große Mann sagen wollte.
»Du warst ein Barbar, jetzt bist du Römer. Dein neuer Herr ist der Mann, der deinen alten umgebracht hat, den Druiden Drustan. Ich möchte behaupten, dass nur wenige so gegensätzlich sind.«
»Caesar hat Drustan nicht umgebracht, das war Felix. Und außerdem …« Ragnall sah sich um. Keiner der Fußgänger in ihrer Nähe schien an ihrem Gespräch Interesse zu zeigen und die Legionäre waren schon längst wieder verschwunden. »… hatte er nicht ganz unrecht damit, uns als Spione zu verdächtigen.« Das hätte er vermutlich nicht sagen sollen, aber er mochte es nicht, wenn Zweifel an Caesar geäußert wurden.
Cicero lächelte und schluckte, was den Belenosapfel in seinem langen, dürren Hals wie eine Maus in einer Wurstpelle auf und ab hüpfen ließ. »Du bist dem Zauber Caesars verfallen«, sagte er. »Das macht nichts, das ist bei den meisten der Fall. Ich erwarte nicht, dass du auf diese Worte hörst, Ragnall, aber du solltest dir klarmachen, was mit dir geschehen ist. Du und viele andere junge Männer sind wie Herbstlaub hinter dem galoppierenden Streitwagen dieses neuen Helden aufgewirbelt worden. Vielleicht solltest du fortfliegen, bevor du auf die harte Straße aufschlägst.«
Vor einigen Jahren, vielleicht sogar noch im letzten Jahr, hätte Ragnall unterwürfig genickt, doch heute würde er diesen Unsinn nicht mehr einfach hinnehmen, auch wenn er von einem angesehenen Mann wie Cicero stammte. Vielleicht hatte ihn der Krieg abgehärtet. Was immer auch der Grund war, er schüttelte den Kopf und sagte: »Caesar ist der größte Mann der Welt und ich bin stolz, ihm zu dienen. Das sollten Sie auch sein.«
Cicero lächelte freundlich. »Wohl gesprochen, junger Mann, wohl gesprochen! Warum begleitest du mich nicht und erzählst mir, was dich und den großen Anführer als Nächstes auf eurer Kampagne erwartet?«
Das launenhafte Verhalten des verdienten Staatsmanns verwirrte Ragnall, aber weder wollte er die Gelegenheit verstreichen lassen, mit Caesars Erfolgen anzugeben, noch wollte er die Chance verpassen, mit dieser angesehenen Persönlichkeit gesehen zu werden.
Als sie an den verkohlten Überresten einer vor Kurzem niedergebrannten Hütte vorbeikamen, in der armselige Leute nach etwas Wertvollem oder Essbarem suchten, begann Ragnall zu erzählen: »Gallien ist praktisch erobert. Das sagten alle schon letztes Jahr, aber es stimmte nicht. Es wäre unmöglich gewesen, das in einem Jahr zu schaffen. Es hätte auch unmöglich sein sollen, es in zwei Jahren zu schaffen, aber Caesar hat es getan. Der letzte aufständische Stamm, die Armoriker, sind geschlagen, und die Stämme nördlich von ihnen – die Menapier – sind mehr oder weniger besiegt. Wir haben sie noch nicht auf dem Schlachtfeld geschlagen, aber die meisten sind geflohen. Sie könnten uns noch Ärger bereiten, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie ernst zu nehmenden Widerstand leisten. Sollten sie eine ansehnliche Armee zusammenbringen, dann wird Caesar wie immer triumphieren, wie auch schon gegen wesentlich mächtigere Feinde.«
»Das ist, was bereits geschehen ist«, sagte Cicero, der einer Schar Senatoren mit roten Ledersandalen und Togen mit breiten Purpurstreifen auswich, »doch sag mir, was steht als nächste Eroberung des mächtigen Generals an?«
»Britannien«, sagte Ragnall. »Sobald die Flotte wieder aufgebaut ist, ich meine gebaut, wird die Armee das Meer überqueren und die wunderbaren Vorzüge der römischen Lebensart nach Britannien bringen.«
»Und wirst du eine Rolle im neuen Britannien spielen?«
Ragnall sah sich um und dann wieder Cicero an. Der Mann war fast genauso groß wie er selbst, ungewöhnlich für einen Italiener. »Ich werde König sein.«
Der Redner starrte ihn mit großen Augen an. »König? Das ist wundervoll. Ich bin mir sicher, dass du dich als guter und gerechter Herrscher erweisen wirst. Doch sag mir, warum du?«