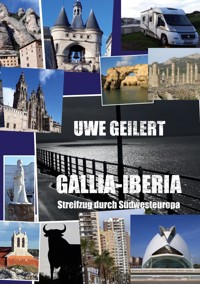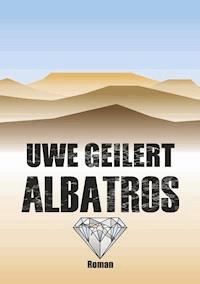
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diamanten in der Kapprovinz gefunden! Von dieser Meldung elektrisiert macht sich der junge, unzufriedene Missionar Heinrich Cohrs auf den Weg zu den Fundstätten, quer durch den Kontinent. Sein Schüler Lucas Nkumalo begleitet ihn. Drei Jahre graben sie sich mit tausenden anderer Schürfer tief in die Erde und hinterlassen das Große Loch von Kimberley. Sie kehren erfolgreich zurück, Lucas kann seine Jugendliebe Nandi heiraten. Das südliche Afrika befindet sich mitten in den Wirren der Kolonialzeit. Lucas gerät in den Zulukrieg. Sein Sohn Thabisa löst durch einen Zufall den Diamantenrausch in Deutsch Südwestafrika aus. Burenkrieg und Rassentrennung werden sein weiteres Leben prägen, wie auch den Werdegang von dessen Sohn Johannes. Erst sein Sohn Phineas, Lucas' Urenkel, wird das Ende der Apartheid erleben. Die Diamanten haben die Lebensläufe dieser vier Männer und ihrer Frauen einschneidend beeinflusst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Anlass
Vor 150 Jahren, im Jahr 1866, werden auf der Farm der Brüder de Beer im heutigen Südafrika durch Zufall die ersten Diamanten gefunden. Das Diamantenfieber, das die Nachricht auslöst, ist mit dem Gold Rush in Kaliforniern oder dem am Klondyke in Alaska vergleichbar.
Die Handlung
Diamanten in der Kapprovinz gefunden!
Von dieser Meldung elektrisiert macht sich der junge, unzufriedene Missionar Heinrich Cohrs auf den Weg zu den Fundstätten, quer durch den Kontinent. Sein Schüler Lucas Nkumalo begleitet ihn. Drei Jahre graben sie sich mit Tausenden anderer Schürfer tief in die Erde und hinterlassen das Große Loch von Kimberley. Sie kehren erfolgreich zurück, Lucas kann seine Jugendliebe Nandi heiraten.
Das südliche Afrika befindet sich mitten in den Wirren der Kolonialzeit. Lucas gerät in den Zulukrieg. Sein Sohn Thabisa löst durch einen Zufall den Diamantenrausch in Deutsch Südwestafrika aus. Burenkrieg und Rassentrennung werden sein weiteres Leben prägen, wie auch den Werdegang von dessen Sohn Johannes. Erst sein Sohn Phineas, Lucas' Urenkel, wird das Ende der Apartheid erleben. Die Diamanten haben die Lebensläufe dieser vier Männer und ihrer Frauen einschneidend beeinflusst.
Der Autor
lebte sechzehn Jahre im südlichen Afrika und gewann einen Einblick in den Diamantenbergbau. Er lernte Menschen aller Hautfarben, vieler Ethnien, Glaubensbekenntnisse und Überzeugungen kennen. In diesem Roman erzählt er die Schicksale von vier Generationen der Familie Nkumalo. Der Autor lebt heute am Niederrhein.
Sämtliche Handlungen, Charaktere und Dialoge in diesem
Buch sind rein fiktiv. Ähnlichkeiten mit noch lebenden Personen sind zufällig und unbeabsichtigt. Die Namen von Personen, Firmen, Orten und Straßen wurden zum Teil verändert.
Umschlaggestaltung: Autor
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Epilog
Glossar
1
Lucas Johannes Nkumalo erhob sich von seiner Schlafmatte, reckte sich, gähnte. Verschlafen erinnerte er sich, dass in der Nacht Regen auf das Reetdach seiner Rundhütte getrommelt hatte. In der Türöffnung füllte er die Lungen mit frischer Luft, die gut nach feuchter Erde roch. Die Wolken hatten sich verzogen, die Sonne stand bereits eine Handbreit über dem Horizont. An den Enden der Reethalme hatte der Regen Wassertropfen hinterlassen, in denen sich wie in kleinen, klaren Lupen die Landschaft spiegelte. Lucas trat nahe an einen der Tropfen heran und fokussierte seinen Blick schielend auf jede Einzelheit. Heinrich hatte ihm die Linsenwirkung erklärt und die Lichtbrechung auf ein Blatt Papier gezeichnet. Seitdem war ihm klar, warum das Abbild auf dem Kopf stand.
Lucas liebte seine gewellte, grüne Heimat mit den verstreuten Rundhütten und den kleinen Feldern, auf denen sie Mais und Gemüse anbauten, und Sorghum für das Bier. Die einsetzende Morgenbrise wehte das Muhen der Rinder herüber, das Meckern der Ziegen und dazwischen die Rufe von Kindern. Manchmal hörte er Ermahnungen oder Scherze einer Männerstimme. Heute am Sonntag waren die Väter zu Hause.
Er dachte an den Streit mit seinem Vater vor vielen Wochen zurück, als es darum ging, was er nach dem Ende der Schule mit seinem Leben anfangen sollte. Schon zehn Jahre vor Lucas' Geburt hatten die Briten das Gebiet südlich des Königreichs der Zulus als ihre Kolonie Natal annektiert.
›Sie nennen es liebevoll Land der tausend Hügel‹, dachte Lucas.
›Als wäre es ihr Eigentum. Aber immerhin haben sie die allgemeine Schulpflicht eingeführt.‹
In den ländlichen Gegenden war sie jedoch nie ernstlich durchgesetzt worden. In der Gegend um Hermannsburg hatte es die Kolonialverwaltung den deutschen Missionaren überlassen, eine Schule zu bauen, so lange dort auch Englisch unterrichtet wurde. Lucas' Neugier hatte ihn immer wieder nach Hermannsburg getrieben, und so wurde er der erste seiner Sippe, der Lesen und Schreiben gelernt hatte. Seinen Vater hatte das wenig beeindruckt. Für ihn galt es als ausgemacht, dass sein ältester Sohn den Erhalt und die Vermehrung der Rinderherde zum Lebensinhalt machen würde. Er war aus allen Wolken gefallen, als Lucas sich weigerte.
»Du trittst unsere Traditionen mit Füßen! Rinder sind unser Leben. Sie sind alles, was wir haben. Als guter Zulu übernimmst du die Herde und kümmerst dich gefälligst darum. Niemals hätte ich dich auf diese Schule schicken sollen. Dort haben sie dir nichts als Flausen in den Kopf gesetzt.«
Lucas widersprach seinem Vater. »Wofür habe ich Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt? Ich kann jetzt Zulu, Englisch, Deutsch und ein wenig Afrikaans, die Sprache der Buren. Ich kann zeichnen. Lieber will ich ein Handwerk lernen und mit Holz arbeiten. Ich will etwas bauen, etwas Nützliches hinstellen wie Baas Heinrich. Ich will nicht deinen Rindern tagein, tagaus auf den Arsch gucken. Ich will meinen Kopf gebrauchen und Geld verdienen.«
Kgabu Nkumalo war wütend auf seinen Sohn.
»Du führst Widerrede gegen deinen Vater? Du willst, du willst? Du tust, was ich dir sage! Das war immer so gewesen, bei meinem Vater und dessen Vater und dessen Vater. So ist das Leben eines Zulu, Basta! Wenn du dich nicht fügst, musst du mein Land verlassen.«
Lucas war zusammengezuckt. Das war die Höchststrafe! Sein Vater drohte den eigenen Sohn fortzujagen! Er fühlte sich gedemütigt und erpresst. Das galt bei Zulus als unwürdig. Er zögerte lange, bevor er sich endlich einem der Ältesten anvertraute.
»Ich respektiere meinen Vater. Aber wenn wir uns weiterentwickeln wollen, müssen wir von den Europäern lernen. Sonst bleiben wir Zulus ein rückständiges Volk. Das kann keiner wollen. Ich schon gar nicht. Ich fühle, dass eine neue Zeit angebrochen ist, und wir Zulus sollten daran teilhaben. Meinst du nicht auch?«
Der Älteste war nachdenklich. Er hatte schweigend zugehört, ohne Lucas zu kommentieren. Beim nächsten Stammespalaver sprach er den Punkt vor der ganzen Runde an und geriet sofort mit Kgabu Nkumalo aneinander.
»Du wagst es, dich in dieser Runde in meine Privatgelegenheiten einzumischen? Verdammt, das geht nur Lucas und mich etwas an!«
Er wusste, wie stur Kgabu Nkumalo sein konnte und erwiderte, das sei sehr wohl eine Stammesangelegenheit.
»Wir können nicht unsere Söhne davonjagen, nur weil sie Lesen und Schreiben lernen und in der neuen Zeit einen Beruf ergreifen wollen. Dies ist sehr wohl etwas, das uns alle angeht. Wir verlieren unsere besten Männer.«
In der großen Runde hoffte er auf Zustimmung von anderen. Sie kamen vorerst zu keinem Entschluss, und so blieb das Thema über drei Monate auf der Tagesordnung. Am Ende hatte ihm der Vater diese Hütte zugewiesen und gesagt, er sollte fortan selber klarkommen. Er würde Lucas zwar nicht von seinem Land jagen, aber er solle sich den Lebensunterhalt selber verdienen. Lucas war erleichtert. Immerhin, er durfte bleiben. Er schnippte mit den Fingern gegen die Reethalme. Die Tropfen fielen auf die Erde und hinterließen runde, dunkle Flecken.
Heinrich Cohrs war der jüngste der Missionare, jünger als Lucas' Vater, aber mit einem Schatz an Kenntnissen und Wissen, der dem jungen Zulu stets freiwilligen Respekt abforderte. Er hatte immer ein Stündchen Zeit. Seine älteren Kollegen waren Institution und strahlten Autorität aus. Sie waren die Männer der ersten Stunde, die Gründer. Heinrich war erst vor gut einem Jahr angekommen. Lucas hatte den feinen Unterschied zwischen ihm und den Alten gespürt. Den Älteren ging man aus dem Weg, Heinrich war nahbar.
Einmal hatte Lucas ihn gefragt, warum er seine Heimat verlassen hatte, um nach Afrika zu kommen. Da schlug Heinrich sein Neues Testament auf und las:
Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.
Dann erzählte er Lucas die Geschichte dieser Mission.
»Lange vor deiner Geburt waren die ersten Hermannsburger aus Deutschland losgesegelt. Der anfängliche Plan der sechzehn Missionare und Kolonisten, in Äthiopien zu siedeln, war misslungen. Man wollte sie dort nicht. Enttäuscht zogen sie weiter nach Süden und landeten mit ihrem Schiff im Hafen Port Natal. Ihr neues Ziel war jetzt das unabhängige Königreich Zululand. Hier wollten sie sich niederlassen und mit ihrer Mission beginnen. Der mächtige König Mpande verwehrte ihnen den Zugang zu seinem Reich. Diese merkwürdige neue Lehre mit Nächstenliebe und Feindvergebung passte ihm nicht. Er war durch und durch Krieger und beabsichtigte sein Reich weiter auszudehnen. Das ging nun mal nicht ohne Unterwerfung und Gewalt. Wieder mussten die Missionare den Rückzug antreten.«
»Wovon haben die dann gelebt?«
»Am Ende haben sie gehungert. Ihre Ersparnisse waren verbraucht. Bei den Briten fanden sie schließlich Gehör und Duldung. In deren neuen Kolonie Natal durften sie siedeln. Die hatten die Missionsarbeit als ein Instrument staatlicher Kolonialpolitik begriffen. Hier konnten sich Missionsgesellschaften unter staatlichem Schutz betätigen. Im Jahr 1854 kauften sich die Missionare eine Farm nahe der Grenze zum Reich der Zulu und bauten sie zu einem Dorf aus. Zwei Jahre später gründeten sie die Deutsche Schule für ihren Nachwuchs, aber auch für die Kinder der Zulus in ihrer Gemeinde.«
Diese Schule durfte Lucas schließlich nach langem Bitten bei seinem Vater und einem Gespräch mit den Missionaren besuchen. Er entwickelte sich zu einem gelehrigen Schüler und bekam bei der Entlassung ein schönes Zeugnis. Er wurde getauft, konfirmiert und war fortan vollwertiges Mitglied der Hermannsburger Gemeinde.
Lucas gefiel besonders, dass alle gemeinsam in die Kirche gingen, egal welche Hautfarbe sie hatten. Er hatte seinem Vater vor kurzem geholfen, Rinder nach Kranskop zu treiben, um sie zu verkaufen. Dort lebten nur Buren. Bei denen war das ganz anders. Die folgten der Lehre Calvins und legten ein paar Stellen aus den Büchern Mose und Josua für ihre Zwecke aus. Sie teilten die Menschen in Herren und Knechte ein. Und die Knechte hatten in der Kirche der Herren nichts verloren. Lucas fand das schade, weil die Schwarzen schöne, kräftige Stimmen hatten und gut singen konnten. Die Knechte hatten aber kein Geld, um sich eine eigene Kirche zu bauen. Deshalb mussten die Schwarzen in Kranskop ihre Gottesdienste unter freiem Himmel abhalten.
Die Hermannsburger sahen sich bald einem Problem gegenüber. Die Gemeinde wuchs rasch. Zwar war ihre Kirche vier Jahre nach dem Kauf der Farm fertig. Aber schon nach weiteren acht Jahren war sie zu klein geworden. Das Gedränge war nicht mehr zu ertragen. Die Schwarzen auszuschließen kam nicht infrage, so beschloss der Rat der Ältesten, eine neue, größere Kirche zu bauen.
Heinrich Cohrs war Zimmermann von Beruf und gläubiger Christ, Lutheraner. Er war in Niedersachsen aufgewachsen. Mit einem Freund hatte er aus purer Neugier und Interesse das alljährliche Missionsfest in Hermannsburg besucht, dessen Motto lautete ›Die Welt hinter dem Gartenzaun‹. Im Freien unter dem Schatten uralter Bäume hatte er den Vorträgen und Berichten der Missionare gelauscht, die aus aller Welt zum Fest gekommen waren, aus Australien, Neuseeland, Brasilien, Persien und Nordamerika. Sie hatten von ihrer Arbeit und ihren Erlebnissen erzählt, über die Länder, die Menschen, die Landschaften und das Klima. Er war fasziniert gewesen und beschloss, selbst Missionar zu werden. Er bewarb sich beim Seminar und wurde angenommen. Drei Jahre drückte er die Schulbank und lernte Theologie, Rhetorik, Sprachen und Völkerkunde. Nach der Ernennung und dem feierlichen Abschlussgottesdienst harrte er der Dinge, die da kommen sollten. Wohin würden sie ihn senden?
Und dann rief ihn der Seminarleiter zu sich. In Natal brauchten sie dringend einen Zimmermann für den Bau des Dachstuhls und des Turmes ihrer neuen Kirche. Er war ernüchtert. Hatte er drei lange Jahre Missionar gelernt, um doch wieder in seinem alten Beruf zu arbeiten? Wenn er jetzt ablehnte, wie lange würde er auf eine neue Berufung warten müssen? Vielleicht zögen sie einen anderen vor, und er würde ewig warten müssen. Kurz entschlossen sagte er zu. Er packte seine Sachen und sein Werkzeug und schiffte sich in Bremen ein.
Sie holten ihn mit einem Pferdegespann im Hafen von Port Natal ab, denn die Vorsteher der Gemeinde hatten eine Familie mit Sack und Pack erwartet. Eine zweirädrige Kutsche hätte gereicht, der Neue war allein gekommen. Als sie nach drei Tagen in Hermannsburg ankamen, war die Begrüßung eher kühl. Wo sollte der Neue in Natal eine weiße Frau finden und eine Familie gründen? Der Ältestenrat hegte gemischte Gefühle. Der würde sich doch nicht mit einer Schwarzen einlassen? Das war zwar nicht verboten, aber unschicklich. Die Frauen fürchteten, ein solches Beispiel könnte Nachahmer finden, und manche hübsche Zulufrau würde Gefallen daran finden, ihren weißen Männern die Köpfe zu verdrehen. Doch was wollten sie tun? Jetzt war er da. Und er wurde gebraucht. Man würde sehen.
Heinrich begann sofort mit der Arbeit, und Lucas fühlte sich von der Baustelle magisch angezogen. Anfangs lungerte er als neugieriger Zuschauer herum. Irgendwann ergab sich das Erfordernis, einmal kurz mit anzupacken, was sich immer häufiger wiederholte. Lucas brauchte nur abzuwarten, bis Heinrichs Kopf mit einem Nicken signalisierte: ›Fass mal an.‹ Aus dem puren Schleppen von Balken wurde bald das Festhalten des Metermaßes, Hilfe beim Sägen und beim Bohren der Dübellöcher. Als der Dachstuhl aufgerichtet wurde, war Lucas volltags beschäftigt. In den Pausen teilte Heinrich seine belegten Brote und brachte eine Extrakanne Tee mit. Lucas wurde sein wichtigster Helfer beim Aufsetzen der Dachbalken für St. Peter-Paul. Zwischen beiden entstand ein Vertrauensverhältnis.
Kurz vor dem Richtfest betrachteten sie das Werk noch ein letztes Mal kritisch und fanden es gut. Sie saßen entspannt auf einer niedrigen Mauer, als Lucas fragte: »Warum hast du keine Frau aus Deutschland mitgebracht?«
Heinrich zögerte, es entstand eine lange Pause. Lucas biss sich auf die Lippen, er bereute seine indiskrete Frage, aber nun war sie in der Welt.
»Eigentlich war das so geplant. Sie heißt Annelie. Wir waren verlobt und wollten hier in Afrika heiraten. Aber im letzten Augenblick hat sie sich anders entschieden. Da waren meine Sachen schon gepackt und die Passage war bezahlt. Sie mussten mich allein fahren lassen. Wenn Ihr keinen Zimmermann gebraucht hättet, wäre bestimmt ein anderer gekommen. Die Mission will nicht, dass wir uns einheimische Frauen nehmen. Wir sollen uns vermehren, aber nicht vermischen.«
»Kommt sie nach?«
»Nein.«
»Was ist passiert?«
»Sie hat sich in einen Anderen verliebt, sagte sie. Vielleicht liebte sie mich nicht wirklich, oder sie hatte einfach Angst vor dem Neuen, vor dem Abenteuer Afrika. Ich werde es nie genau wissen.«
Lucas sah ihm an, dass es ihn noch immer schmerzte und wechselte das Thema.
»Ob nun mit Frau oder ohne, du bist als Missionar gekommen, aber sie beschäftigen dich als Zimmermann. Jetzt ist der Dachstuhl fertig. Wirst du nun als Missionar arbeiten? In deinem richtigen Beruf?«
»Wie schön, dass du dir meinen Kopf zerbrichst, Lucas, aber mach dir keine Sorgen. Hier gibt es viel zu tun. Ich habe noch andere Talente. Du wirst sehen.«
Er stand auf. Für ihn war das Gespräch beendet.
»Jetzt feiern wir erst einmal Richtfest. Danach wird das Dach eingedeckt, die Kirche muss innen fertig werden, der Altar aus der alten Kirche muss wieder aufgestellt werden, und das Wichtigste ist: wir bekommen eine gebrauchte Orgel aus Deutschland. Über die mache ich mich her. Die muss wieder klingen! Du wirst deinen kleinen Zulu-Ohren nicht trauen. Wart's ab.«
Lucas trat aus seiner Hütte und holte einen großen Krug Wasser vom Brunnen für seine Morgenwäsche. Heute war Kirchweihe. Die wollte Lucas auf keinen Fall versäumen. Bis zum letzten Tag hatten sie an der Orgel gearbeitet. Heinrich hatte ein stabiles Gerüst aus schweren Balken gezimmert, dann die nummerierten Einzelteile aus den Kisten geholt, ausgewickelt und das Instrument wieder zusammengesetzt. Am längsten hatte das Stimmen der Pfeifen gedauert. Lucas saß seitlich hinter dem Prospekt und trat den Blasebalg auf Kommando, während ein Anderer eine Taste betätigte und Heinrich sich an den Pfeifen zu schaffen machte. Für Lucas war es eine langweilige Arbeit. Sie hatten am Ende nicht einmal Zeit, ein komplettes Stück zu spielen, um das Ergebnis zu prüfen. Die Spannung war groß, wie wohl der erste Choral klingen würde.
Noch mehr freute sich Lucas darauf, die süße Nandi Nkosi dort zu treffen. Familie Nkosi lebte in der Nachbarsiedlung Ahrens, von wo Nandi die sechs Kilometer jeden Schultag zu Fuß zurücklegte. Sie war vor zwei Wochen zu Verwandten in die Hauptstadt Pietermaritzburg gefahren, um sich nach einer Ausbildung umzusehen. Sie beide hatten dieselbe Klasse besucht und das begehrte Abschlusszeugnis bekommen. Jetzt wollten sie einen richtigen Beruf lernen und ihr eigenes Geld verdienen. Das war ihrer beider Ziel. Der Unterschied war, dass Nandis Familie sie dabei nach Kräften unterstützte, obwohl oder gerade weil sie Analphabeten waren. Nandi hatte versprochen, rechtzeitig zurück zu sein. Er hatte heute zwei gewichtige Gründe, seine besten Sachen anzuziehen.
Zwischen Heinrich Cohrs und Lucas entwickelte so etwas wie eine väterliche Freundschaft. Heinrich wusste viel und konnte gut erklären. Lucas erfuhr Dinge, von denen er noch nie gehört hatte. Im Gegenzug musste ihm Lucas alles über sein Land erzählen. Das war 1869. Heute würde man das eine Win-Win-Situation nennen. Eines Tages saßen sie an Heinrichs Küchentisch.
»Ich will dir etwas zeigen.«
Heinrich stellte mehrere Holzkästen auf den Tisch und öffnete sie.
»Dies ist meine Leidenschaft. Du bist der erste Hermannsburger, dem ich sie zeige.«
Die Kästen waren in kleine quadratische Fächer unterteilt, in denen bunte Steine lagen. Jedes Fach war sauber beschriftet. Jaspis, Achat, Amethyst, gelbes und blaues Tigerauge, Azurit, Jadeit, Rosenquarz, Karneol, Malachit, Pyrit und andere.
»Wo hast du die aller her«, fragte Lucas beeindruckt.
»Gesucht, ausgegraben, aus dem Felsen geschlagen, gekauft oder getauscht. Sind sie nicht faszinierend?«
»Und was machst du damit? Das sieht wunderschön aus, aber die Kästen stehen doch nur herum, oder?«
»Ich studiere ihre chemische Zusammensetzung, ihre Herkunft und ihre Entstehung. Ich will die besten Exemplare haben, die es gibt. Die weniger guten werden gegen bessere Steine getauscht, bis ich die beste Sammlung zusammen habe, die Cohrs-Sammlung. Wenn sie vollständig ist, werde ich sie einem Museum vermachen, damit alle sie ansehen können. Aber jetzt werde ich hier auf die Suche gehen. Kommst du mit?«
Von da an begleitete ihn Lucas und lernte, die Halbedelsteine zu finden, zu unterscheiden, zu waschen und zu polieren. Heinrich zeigte ihm Bücher und führte ihn in die geheimnisvolle Welt der Mineralogie ein.
Wochen später kam Heinrich von einem Besuch in Pietermaritzburg zurück. Er hatte einen Mineralogen und Sammlerkollegen getroffen und war völlig aufgeregt, fast euphorisch.
»Lucas, ich muss mit dir reden. Der zeigte mir eine alte Zeitung. In Griqualand in der Nähe des Oranje-Flusses wurden vor zwei Jahren Diamanten gefunden. An der Oberfläche! Farmkinder hatten mit den Steinen gespielt.«
»Ja und? Wir finden unsere Steine doch auch an der Oberfläche.«
»Wir finden Halbedelsteine. Meine ganze Sammlung besteht aus Halbedelsteinen, aber der Diamant ist der König der Edelsteine! Das härteste, klarste und teuerste Mineral der Welt. Und stell dir vor, vor einem Jahr hatte der Schafhirte Swartboy am Nordufer des Oranje auf der Farm von Mijnheer Waterboer einen 83-Karäter gefunden! So groß wie eine Pflaume! Unglaublich! Er hatte den Stein zuerst versteckt, aus Angst, dass er ihn dem Grundeigentümer aushändigen müsste. Er hat gekündigt und ist zur Farm Zandfontein gewechselt. Erst dann wagte er seiner Familie von dem Fund zu erzählen. Sie beauftragten Willem Piet, einen Freund der Familie, den Stein zu verkaufen. Auf der Farm de Kalk fand er einen Käufer und tauschte den Diamanten für 500 Schafe, zehn Rinder und ein Pferd. Ein lächerlich niedriger Preis, die haben ihn kräftig über den Tisch gezogen, aber für Swartboy war es ein unglaublicher Reichtum.«
»Dann lass uns hier auch nach Diamanten suchen.«
»Da kannst du graben, bis dir die Arme abfallen. Wenn es die hier gäbe, hätten wir längst einen gefunden. So weit ich weiß, wurden die bisher nur in Indien gefunden. Diamanten in Afrika! Mann, ich bin elektrisiert.«
Der Fund hatte sich bald herumgesprochen. Alle Zeitungen berichteten darüber. Von da an ließ das Thema Heinrich nicht mehr los. Er hatte sich mit dem Diamantenfieber angesteckt. Die folgenden Wochen sammelte er alle einschlägigen Berichte, beugte sich über Karten, schmiedete Pläne, verwarf sie wieder und gab darüber die Suche nach Halbedelsteinen in der Umgebung völlig auf. Er vergrub sich in seiner Wohnung und traf auch Lucas nicht.
Endlich, nach Wochen, rief er ihn zu sich. Unter dem Versprechen der Verschwiegenheit erzählte er ihm von seinen geheimen Plänen, selbst nach Diamanten zu suchen. Nur ein paar Jahre. Vielleicht würde er reich zurückkommen.
Für Lucas brach eine Welt zusammen. Er wollte von Heinrich das Handwerk des Zimmermanns lernen. Er wollte so vieles andere von ihm erfahren und die Welt verstehen lernen. Seinem Vater wollte er beweisen, dass sein Weg der bessere wäre; und dass er stolz auf seinen Sohn sein könnte. Und nun wollte sein Lehrmeister fortgehen! Alles hatte so gut angefangen. Und nun? Aus der Traum. Enttäuscht zog er sich in seine Hütte zurück. Nandi kam ihm in den Sinn. Er wollte sie heiraten und mit ihr zusammen Kinder haben. Aber nicht in dieser kleinen Lehmhütte. Er wollte ein richtiges Steinhaus haben. Doch um sie heiraten zu können, musste er vorher die Lobola für ihre Familie aufbringen. Aber wovon? Seinen Vater zu fragen kam nicht in Betracht. Der würde ihn wieder Rinder hüten lassen. Es war ein Teufelskreis.
In der Nacht hatte er einen bösen Traum. In der Mittagshitze war er, auf seinen langen Hirtenstab gestützt, eingedöst. Die Herde graste um ihn herum. Sein Hütehund lag neben ihm, als unerwartet einer der Jungbullen aus der Herde ausbrach und auf ihn zuraste, die Hörner zum Angriff gesenkt, Schaum um das breite Maul, schnaubend und mit donnernden Hufen. Er hatte das Gesicht seines Vaters. Zu spät hatte er das blindwütige Tier bemerkt, um auszuweichen. Er spürte den Stoß der Hörner im Unterleib, wurde hoch in die Luft gewirbelt und saß senkrecht hellwach auf seiner Schlafmatte, mit Schweißperlen auf seiner Stirn. Am Morgen danach ging Lucas nach Hermannsburg hinunter und suchte Heinrich Cohrs.
»Ich komme mit. Du wirst Hilfe brauchen.«
»Wegen deines Vaters? Wegen Nandi?«
»Beides.«
»Eine kluge Frau, eine schöne Frau.«
»Zu jung für dich. Und schwarz.«
»Diese Frau muss man sich leisten können. Und wenn ich ihr in die Augen schaue, sehe ich die Hautfarbe nicht mehr. Die inneren Werte sind es, was zählt, mein Lieber. Das, was zwischen den Ohren sitzt.«
Lucas schwieg und sah Heinrich lange nachdenklich an.
›Sieh an, Heinrich hat sich entschieden. Er hängt seinen Beruf als Missionar an den Nagel. Und er hat ein Auge auf Nandi. Wie komme ich zu Geld für die Lobola, wenn mein Lehrmeister weg ist?‹
»Nimmst du mich mit?«
Heinrich wusste jetzt, dass Lucas es ernst meinte.
Heinrich stellte in den folgenden Monaten die nötige Ausrüstung zusammen. Alle Einzelheiten besprach er mit Lucas und machte ihn zu seiner rechten Hand. Unter den jungen Zulus wählten sie gemeinsam drei verlässliche Helfer aus. Bongani, der kochen konnte, Petrus und Longile. Alles unter strenger Geheimhaltung. Keiner durfte seinen Angehörigen etwas erzählen.
»Ihr helft mir bei der Arbeit, und ich ernähre euch. Die gefundenen Diamanten verkaufen wir. Eine Hälfte des Erlöses teilt ihr euch, die andere Hälfte ist für mich. Regelmäßigen Lohn kann ich euch nicht zahlen. Es geht nicht anders. Seid ihr einverstanden?«
Die drei nickten.
An einem Samstag des Jahres 1871 quittierte er den Dienst beim Rat der Ältesten. Sie versuchten, ihn umzustimmen, denn er war nicht nur er ein guter Zimmermann, er spielte auch die Orgel. Er meisterte die Tücken des Instruments im feuchtwarmen Klima Natals. Noch bitterer würden sie aber seine Konzerte vermissen, die er stets zu festlichen Anlässen gab. Wer sonst spielte im südlichen Afrika Werke von Bach, Telemann, Buxtehude, Scheidemann, Böhm und Pachelbel? Wer sollte den Kirchenchor künftig leiten? Der Rat brauchte dringend Ersatz. Jetzt erst wurde ihnen bewusst, wie wertvoll Heinrich für die Gemeinde war, aber es war zu spät. Heinrich war von seinem Plan nicht mehr abzubringen. Die Neuigkeit verbreitete sich wie ein Lauffeuer.
Die Ausrüstung und die Vorräte hatte Cohrs auf einer Schottschen Karre mit Plane und zwei großen Rädern verstaut und in einer alten, verlassenen Hütte am Ortsrand verborgen. Am Morgen der Abreise spannte er sein gesundes, kräftiges Maultier Max an und stellte den Karren vor Beginn des Sonntagsgottesdienstes auf dem Vorplatz vor St.-Peter-Paul ab. Er spielte noch einmal die Orgel und dirigierte den Chor. Bevor er die Gemeinde in den Tag entließ, verabschiedete Pastor Severin die vier offiziell und wünschte ihnen Gottes Segen.
Die Hermannsburger traten mit gemischten Gefühlen durch das Portal mit dem Spitzbogen ins Freie. Sie standen nicht in einer Traube um den Wagen, sondern hielten Abstand. Sie bildeten einen großen Kreis um die fünf Männer und ihr Gefährt. Missionare verließen die Station, das war für sie nichts Ungewöhnliches. Einige waren versetzt worden, andere kehrten nach Deutschland zurück. Aber keiner war abtrünnig geworden. Einige schüttelten nur die Köpfe, andere warfen Heinrich insgeheim die Sucht nach dem schnöden Mammon vor. Nur wenige bewunderten ihren Mut und wünschten ihnen wortlos Glück.
»Diese Chance hat man nur einmal im Leben«, sagte einer leise.
Aber er meinte wohl:
›Soviel Mut hat man nur einmal im Leben. Ich habe den schon lange nicht mehr‹.
Vielleicht war er neidisch. So eine Gelegenheit hatte er nie gehabt. Jetzt war er in sein Leben eingebunden, in seine Familie, in sein Dorf, seine Kirchengemeinde. Er hatte seinen festen Platz. Den konnte er nicht aufgeben. Die anderen wollten sich auf ihn verlassen.
Nandi trat aus dem Kreis und ging mit schüchtern gesenktem Kopf in die Mitte zu Lucas. Sie hielt ihm einen Strauß Feldblumen hin und küsste ihn scheu vor allen Leuten. Er nahm sie in den Arm und hielt sie lange fest.
»Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Baas Heinrich weiß es auch nicht. Aber ich komme zurück.«
»Ich warte auf dich.«
Heinrich beobachtete die beiden aus den Augenwinkeln und schnalzte Max zu. Der kleine Treck setzte sich in Bewegung. Heinrich sah die Steinkirche mit dem Wellblech auf seinem Dachstuhl und dem spitzen Turm kleiner werden. Lucas drehte sich noch einmal um. Die Leute standen unbeweglich im Kreis, und in der Mitte, wo die Karre gestanden hatte, stand Nandi allein und winkte ihm lange nach. Auch Heinrich sah zurück.
›Nandi wird auf ihn warten. So ein Glückspilz!‹
Bald verschwand die Kirchturmspitze hinter den tausend Hügeln. Sie waren auf sich selbst gestellt. Ihre Route führte sie quer durch das südliche Afrika. Neunhundert Kilometer. Heinrich Cohrs führte das Maultier, seine Helfer gingen zu Fuß neben dem Wagen her. Noch waren die Wege gut. Um Max zu schonen, legten sie alle zehn Meilen eine Rast ein. Allmählich wurden die Wege schlechter, die Besiedelung immer dünner. In großen Abständen besuchten sie burische Farmer, um frische Lebensmittel zu kaufen oder auf ihrem Gelände zu übernachten. Die Buren waren gastfreundlich. Sie boten Heinrich an, im Haus zu schlafen.
»Maar nie die kaffers nie.«
Aber nicht die Schwarzen. Die mussten draußen bleiben. Heinrich lehnte höflich ab und schlief ebenfalls draußen. Lucas hatte es gehört und dachte sich seinen Teil.
›Warum sollten sie uns besser stellen als ihre Schwarzen? Die hatten ihre eigenen Hütten hinter dem Haus.‹
Sie passierten kleine Dörfer, die erst vor zwanzig, dreißig Jahren gegründet worden waren, wie Greytown, Müden, Weenen, Colenso und querten in Ladysmith den Tugela-Fluss, der in den Drakensbergen entsprang.
Sie waren jetzt zwei Wochen unterwegs. Die Wege wurden noch schlechter, sie waren kaum benutzt und holprig. Der Abstand zwischen den Farmen wuchs. Die Quathlambaberge kamen näher, drohend und scheinbar unüberwindlich. Erst zur Dämmerung erreichten sie die nächste Farm. Am Gatter der Umzäunung hing das Blechschild mit dem ungelenk geschriebenen Namen des Eigentümers: W van Niekerk. Heinrich klopfte an der Tür. Sie wurde einen Spaltbreit geöffnet. Aus dem dunklen Innern ragte der Doppellauf einer Schrotflinte, direkt auf Heinrichs Unterleib gerichtet. Darüber schimmerte das Weiß eines Augenpaares.
»Was willst du?«
Eine Frauenstimme. Heinrich sagte, dass er mit vier Helfern auf dem Weg zu den Diamantenfeldern wäre und darum bitte, auf dem Farmgelände übernachten zu dürfen. Die Frau trat heraus, die Flinte gesenkt. Forschend betrachtete sie zuerst ihn, dann seine vier Helfer.
»Kommen da noch mehr?«
»Wir sind zu viert.«
»Sag deinen Männern, sie sollen die leere Hütte dort nehmen. Du kannst hereinkommen, ich mache Kaffee.«
Heinrich gab die Anweisung an Lucas weiter.
»Ich bin gleich wieder da.«
Sie ließ die Tür offen stehen und machte sich am Herd zu schaffen. In der Mitte, über dem Tisch hing eine Petroleumlampe, die ihr bestes gab, um den Raum zu beleuchten. Sie brachte zwei gefüllte Tassen schwarzen Kaffee, einen Teller mit Spiegeleiern für Heinrich und setzte sich ihm gegenüber.
»Willem ist auch dort.«
»Dein Mann?«
»Vor sechs Wochen ist er losgezogen. Ich bin Marijke.«
»Heinrich.«
Er machte sich über die Spiegeleier her. Marijke van Niekerk sah ihm dabei aufmerksam zu.
»Betest du nicht vor dem Essen?«
»Schon erledigt. Ich bete still, wenn der Tischherr das nicht laut und deutlich tut.«
Sie schwieg.
»Vor sechs Wochen, sagst du. Und? Hat er welche gefunden?«
»Er hat mir noch nicht geschrieben. Erzähl von dir. Du bist kein Südafrikaner? Heinrich heißen nur Deutsche, stimmt's?«
Heinrich sah sie an und erzählte. Sie hörte schweigend zu, jedes Wort in sich aufsaugend. Dieser Fremde öffnete ihr ein Fenster in die weite Welt. Das war der Preis für die Spiegeleier und den Kaffee. Und er konnte gut erzählen, sein Afrikaans hatte einen angenehmen Akzent.
»Hast du eine Frau?«
Diesen Punkt hatte er ausgespart. Es tat gut, sich ihr anzuvertrauen, die Gedanken zu ordnen, und erzählte von Annelie. Dabei wurde ihm bewusst, wie viel Distanz er schon gewonnen hatte, wie weit das alles zurück lag. Und nun hatte sich Nandi dazwischen geschoben. Doch das erwähnte er nicht. Marijke war Burin.
Er dachte darüber nach, wie einsam sie sein musste hier draußen, abgeschottet von der Welt. Er hatte das Maisfeld gesehen, die Schafe und ein paar Rinder. Ihre Boys schliefen wohl schon.
›Sie muss eine starke Frau sein, um das durchzuhalten. Für seinen Traum vom Reichtum hatte Willem van Niekerk seine junge Frau auf dieser einsamen Farm zurückgelassen, und sie wartet geduldig auf seine Rückkehr. Heute bringe ich etwas Abwechslung in ihr tristes Dasein, indem ich von der Welt da draußen erzähle.‹
»Warum ist Willem fortgegangen? Hier gibt es doch genug zu tun.«
Sie antwortete nicht, sondern stand auf, räumte das Geschirr ab und fing an zu spülen. Dabei wandte sie ihm den Rücken zu. Nach einer Weile sagte sie über die Schulter hinweg, ohne ihn dabei anzusehen: »Wir müssen die Farm abbezahlen. Die Erträge sind mager, und die Kreditzinsen drücken schwer. Ich bete, dass Willem nichts zugestoßen ist. Ich warte jeden Tag auf Post.«
Mit dem Handrücken wischte sie sich über das Gesicht. Heinrich beobachtete sie schweigend und ein wenig verlegen.
›Ich hätte das nicht fragen sollen. Sie ist verletzlicher als ich dachte.‹
Als sie mit dem Geschirr fertig war, drehte sie sich herum und sah Heinrich lange an. Dann, als gäbe sie sich einen Ruck, holte sie eine Flasche Kapwein und zwei Gläser aus dem Schrank. Sie schob einen Stuhl heran und setzte sich neben ihn an den Tisch. Ihre Schultern berührten sich. Er erzählte, bis die Flasche ausgetrunken war. Sie hatte ihren Kopf an seine Schulter gelegt, suchte Geborgenheit. Sie spürte das Vibrato seiner dunklen Stimme. Diese Nacht schlief Heinrich nicht bei seinen Männern.
Als er am nächsten Morgen aufwachte, war das Bett neben ihm leer. Marijke van Niekerk war bei ihren Farmhelfern, teilte ihnen die Arbeit ein und beorderte Lucas, ihr beim Frühstück zu helfen. Als Heinrich aus dem Schlafzimmer kam, hantierten die beiden in der Küche. Es roch nach Kaffee und gebratenem Speck. Sie hatte den Tisch für sechs gedeckt. Petrus, Longile und Bongani kamen ins Haus und grinsten sich verstohlen an.
Als sie gegessen hatten, ging sie mit nach draußen und beschrieb ihnen den Weg über die Berge.
»Vor achtzig Jahren hatte Napoleon die Niederlande besetzt, das Mutterland von uns Buren. Die Briten, raffiniert wie sie sind, nutzten diese Gelegenheit für sich und besetzten das Kap. Die neuen Herren brachten neue Ideen mit, und britische Siedler. Vielen der Buren passte das nicht. Sie verließen das Kap und wanderten in mehreren Trecks nach Norden und Nordosten. Einer der Trupps hatte das fruchtbare Natal im Auge. Sie mussten recht ratlos am unwegsamen Steilhang gestanden haben, Willems Vater war auch dabei. Ihr Anführer Frans van Reenen hatte nach langem Suchen eine gangbare Stelle entdeckt, um ins fruchtbare Tiefland zu kommen. Es gelang ihnen, und von da an hieß die Stelle Van Reenen's Pass. Im trockenen Hochfeldwinter trieben sie ihr Vieh den steilen Weg hinunter, im Sommer wieder rauf aufs Hochland, wenn unten Hitze und Mücken ihrem Vieh zusetzten. Der steinige Weg windet sich in einer Scharte den Abhang hinauf, die müsst ihr finden.«
Marijke van Niekerk redete und redete, als hätte sie Angst vor der Stille, die nach Heinrichs Aufbruch eintreten würde, als wollte sie den Abschied hinauszögern. Sie erklärte ihm, worauf er zu achten hatte.
»Zweitausend englische Fuß höher dehnt sich das Hochland nach Westen. Dort müsst ihr hinauf. Einen besseren Weg gibt es nicht. Ihr braucht ein zweites Maultier, oder ihr schiebt euren Karren selber. Auf halber Höhe spaltet sich der Weg für eine Meile. Die Rinder nehmen den oberen für den Aufstieg, den unteren für den Abstieg. Ihr müsst euch rechts halten.«
»Danke, Marijke, und Voerspoed. Auf geht's, Männer.«
Lange stand Marijke van Niekerk vor dem Haus und winkte ihnen nach. Die plötzliche Ruhe dröhnte in ihrem Kopf. Sie und Heinrich hatten kaum geschlafen. Trotzdem fühlte sie sich leicht und belebt. Dann war die kleine Gruppe mit dem Karren und dem Maultier hinter einem Hügel verschwunden, und die Einsamkeit kroch wieder in ihr hoch. Und die Angst um Willem.
›Schick mir ein Lebenszeichen! Ich brauche dich.‹
Der Pfad war schwierig. Max schaffte die schwere Ausrüstung nicht allein. Sie griffen in die Speichen und drückten mit den Schultern am Karren, während Cohrs vorn zog und das Maultier führte. Es dauerte den ganzen Tag. Schweißnass kamen sie auf der Hochebene an. Sie gönnten sich einen Tag Ruhe und genossen den Ausblick auf das weite Natal unter ihnen, das sich bis zum Indischen Ozean im Osten ausdehnte. Im Süden sahen sie die blassblaue Silhouette der Drakensberge mit ihren Dreitausendern. Dort lag das Königreich der Sotho.
»Jetzt sind wir in der Transvaalschen Republik. Der direkte Weg zu den Diamantenfeldern wäre quer durch das Bergland«, sagte Heinrich.
»Aber das würde Max nicht schaffen, wegen der dünnen Höhenluft. Damit kommen nur Basutoponys zurecht, aber die kann man nicht vor einen Wagen spannen, weil sie nicht als Zugpferde taugen. Außerdem pflegen die Sothos zu euch Zulus innige Zwietracht, weil der berühmte Shaka Zulu Krieg gegen sie führte. Er wollte sie unterwerfen und versklaven. Sie riefen die Briten zu Hilfe und wurden gerettet. Heute sind sie Teil der Kapprovinz. Ihr wärt in großer Gefahr, nachts abgestochen zu werden.«
Er breitete eine Landkarte auf dem Boden aus.
»Wir ziehen nördlich an Lesotho vorbei über Clarens, Fouriesburg und Ficksburg in Richtung Bloemfontein, der Hauptstadt des Oranje Freistaats. Das müssten wir in drei bis vier Wochen schaffen. Danach sind es noch zwei Wochen bis zu den Diamantenfeldern. Wir haben ein Drittel des Weges hinter uns.«
Heinrich sah sich seine kleine Expedition an.
»Max ist fit, wir sind fit, aber ihr braucht neue Schuhe. Wir müssen zuerst nach Harrismith, einen Schuhmacher suchen.«
Heute wurde Max von Longile geführt. Petrus und Bongani gingen neben ihm her. Heinrich und Lucas hatten sich zurückfallen lassen. Sie betrachteten die Karre, an der hinten an einem kräftigen Haken der bauchige, schwarze und schwere Eisentopf baumelte. Sie hatten ihn unterwegs von einem Buren gekauft. Potjie nannten die das Gerät. Die Reste der Mahlzeiten wurden darin für den nächsten Tag aufbewahrt, nichts wurde weggeworfen. Frische Zutaten wurden zerkleinert hinzugefügt und zusammen aufgekocht. Häufig sammelte Longile entlang des Weges essbare Kräuter, die er dem Pott zufügte. Er war Meister des intuitiven Kochens. An abwechslungsreicher Ernährung fehlte es ihnen nicht, keine Mahlzeit schmeckte wie die andere.
»Die Pötte haben die Buren auf ihrem Großen Treck benutzt, habe ich mir sagen lassen«, bemerkte Heinrich.
Lucas nutzte die Gelegenheit für eine persönliche Frage.
»Hast du deinen Beruf als Missionar nun endgültig aufgegeben? Kannst du so einfach mit einer wildfremden Frau in die Kiste steigen? Sie ist schließlich verheiratet.«
»Sie ist verzweifelt. Die Farm gehört praktisch der Bank, und sie hat Mühe, die Zinsen zu bezahlen. Von ihrem Mann weiß sie nichts, er hat nicht ein einziges Mal geschrieben, seit er fort ist. Werde jetzt nicht moralisch, Lucas. Sie hat Angst, und ganz sicher hat sie an ihn gedacht, während ich bei ihr war. Ich bin kein geweihter Priester, und wir als Lutheraner kennen keinen Zölibat. Hätte ich sie wegstoßen sollen? Ich bin auch nur ein gewöhnlicher Mann.
Und was den Missionar angeht, das ist kein gewöhnlicher Beruf, das ist eine Berufung. Den ersten machst du mit dem Kopf, die zweite mit dem Herzen. Ich wurde ausgebildet, Menschen das Evangelium zu verkünden, sie an das Licht unseres Glaubens zu führen, ihnen die ethischen und moralischen Werte des Christentums zu vermitteln. Aber ich stellte fest, unser Hermannsburg ist durchmissioniert. Da gibt es nichts mehr zu missionieren. Unsere Vorsteher sahen in mir den Zimmermann, den Chorleiter, den Musiker, den Organisten. Das war nicht mein Ziel. Die Peter-Paul-Kirche ist nur noch der Verwalter des Glaubens, und ich war der Handwerker für die praktische Arbeit. Ich wäre in keinem Fall dort auf ewig geblieben. Es wurde mir zu eng. Ich stellte mir ein Leben wie das von Robert Moffat vor, der seine eigene Missionsstation in Griquastad aufbaute, zwischen den zerstrittenen Stämmen vermittelte und sie unter dem Zeichen des Kreuzes zu einigen und zu befrieden suchte.«
»Da kommst du ein paar Jahre zu spät. Die Kapverwaltung hat das Heft in die Hand genommen, und Moffat genießt seinen Ruhestand.«
»Den Missionaren folgen immer die Politiker und drängen sie in die zweite Reihe. Dann kommt das Kapital und drängt sie in die dritte.«
»Bist du verbittert?«
»Ja und auch nein. Der Mensch ist nun mal ein Geschöpf Gottes, aber mit widersprüchlichen Eigenschaften. Wahrscheinlich hat Er das in seiner unendlichen Weisheit so gewollt. Mit dieser Frage plage ich mich schon eine Zeitlang herum. Antworten habe ich bis heute nicht. Ehrlich gesagt, die Diamantensuche ist für mich eine Art Flucht. Flucht vor mir selbst, Flucht vor dem geordneten Leben in Hermannsburg, Flucht aus dem täglichen Einerlei. Vielleicht suche ich auch nur das Abenteuer. Annelie hat das möglicherweise gespürt und ist deshalb in Deutschland geblieben.«
»Schreibst du ihr?«
»Denkbar, dass ich das tun sollte. Gute Idee. Dann weiß sie, dass sie richtig gehandelt hat und hat ihren Seelenfrieden.«
›Er liebt sie immer noch‹, dachte Lucas. ›Sie würde sicher gut nach Hermannsburg passen, besser als Heinrich.‹
»Wie auch immer, eins muss ich dir sagen, Lucas. Ich fühle mich auf wundersame Weise frei. Wir marschieren zu Fuß quer durch Afrika auf der Suche nach dem schönsten, härtesten und teuersten Mineral der Welt, auf uns selbst gestellt und niemandem hörig. Schau dich mal um! Wir sind allein in Gottes Natur. Vielleicht werde ich eines Tages wieder Missionar, vielleicht auch nicht.«
Nachdem sie Bloemfontein erreicht hatten, wussten sie, dass sie nicht mehr allein waren.
»Schaut euch diese abenteuerlichen Gestalten an. Die wollen alle dahin, wohin wir auch wollen. Die Stadt ist voll von denen.«
»Wir sehen auch nicht besser aus. Schau dich an, Heinrich.«