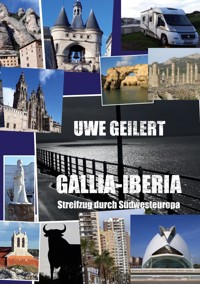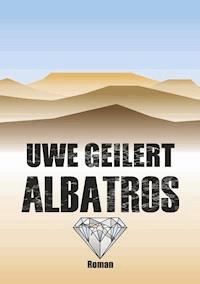Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jorge Beltrán geht in Las Arenas an der Nordküste Perus dem uralten Handwerk der Totorafischer nach. Sie paddeln ihre wendigen, aus Schilfbinsen gebundenen Boote rittlings auf den fischreichen Pazifik hinaus wie zahlreiche Generationen vor ihnen. Traditionsbewusst und stolz erzielen sie mit archaisch anmutenden Methoden ein karges Einkommen und erfreuen sich ihrer Freiheit und Unabhängigkeit. Doch die motorisierte Fischerei wird zu einer ernsthaften Konkurrenz. Durch das Überangebot verfallen die Preise an den Märkten. Ihre Existenzen sind bedroht. Als dann das Klimaphänomen El Niño besonders heftig auftritt, bleiben ihre Fänge aus. Ihr uraltes Handwerk steht vor dem Ende. Jorges Liebe zu Isabel bringt weiteres Ungemach. Ihre Eltern verbieten die Beziehung kategorisch. Sie fühlen sich als Nachkommen der Inka und Opfer der conquista. Für sie ist Jorge Abkömmling der spanischen Invasoren. Jorges Mutter missbilligt die Verbindung aus Gründen, über die sie schweigt. Als Isabel schwanger wird, heiraten die beiden gegen den Willen ihrer Familien. Jorge muss dringend für geregeltes Einkommen sorgen. Sein einfaches Leben steht vor einem dramatischen Einschnitt. Er ist im modernen Peru angekommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sämtliche Handlungen, Charaktere und Dialoge in diesem Buch sind rein fiktiv. Ähnlichkeiten mit noch lebenden Personen sind zufällig und unbeabsichtigt. Die Namen von Personen, Firmen, Orten und Straßen wurden teilweise verändert.
Umschlaggestaltung: Autor
Jorge Beltrán stand auf einem flachen Steinhügel oberhalb der Bucht und suchte mit zusammengekniffenen Augen die Wasserlinie ab. Von hier hatte er einen guten Überblick. Er war groß und kräftig. Sein blonder Haarschopf war vom Meerwasser verkrustet. Wo sein Hemd erst nass geworden und dann wieder getrocknet war, zeigten sich weiße Salzringe. Seine ausgefransten Hosenbeine reichten ihm gerade bis an die Waden. Die Mittagshitze wurde erbarmungslos vom Sand zurückgeworfen. Seine Fußsohlen brannten. Der auflandige Wind hatte eingesetzt. Die über dem Land erhitzte Luft stieg in die Höhe und zog Seeluft an. Fliegende Sandkörner prallten schmerzend gegen seine Beine. Das weiße Schaumband der Wellen blendete seine Augen. Am Horizont berührte der helle Himmel die dunkle scharfe Linie des sanft gekrümmten Ozeans. Mittags, wenn die Sonne hoch stand, wirkte das Wasser schwarz.
Wieder einmal musste er Raúls kleine Totora suchen. Immer vergaß der faule Bengel, sein Schilfboot hoch genug auf den Strand zu ziehen, damit es die nächste Tide nicht holte. Jorge war zornig auf den zwölf Jahre jüngeren Bruder und brummig auf seine Mutter, weil sie bei Raúl so viel durchgehen ließ. Jorge war zehn gewesen, als der Vater nicht wiederkam. So wuchs Jorge in die Rolle des Brotverdieners hinein, Raúl aber blieb Mutters Nesthäkchen. Jorge fühlte sich wie ein Bursche, der dem jungen Herrn das Spielzeug nachräumen muss.
Er musste sich beeilen, denn zwei bis drei Stunden würden genügen, um die Totora in der Brandung am Felsen zu Stroh zu zerfetzen. Geld für neues Binsenschilf war nicht da. Sie mussten es bei Bauern im nächsten Flusstal kaufen und nach Las Arenas transportieren, bevor er es mit den anderen Fischern zu einer Totora binden konnte. Die anderen wären nicht erfreut, nur wegen der Vergesslichkeit des verzogenen Jungen Stunden ihrer freien Zeit mit dem Bau einer Kindertotora zu verbringen. Jorge würde seine Kumpel mit einer oder zwei Extraflaschen Bier, besser drei, überzeugen müssen. Welcher Luxus! Eine Totora für ein Kind! Entweder bist du groß genug für eine echte Totora, oder du bist kein Fischer. Aber Mutter bestand darauf, dass Raúl das Handwerk schon früh erlernte. Und das begann nun mal mit dem Reiten auf dem Totora-Pferdchen. Nach Rückkehr vom Meer wurden sie zu dritt oder zu viert aufrecht aneinander gestellt, damit sie austrocknen konnten und das Schilf nicht faulte. Doch die anderen Jungen hatten keine Totoras, die sie mit Raúls bündeln konnten, so ließ der seine gedankenlos am Strand liegen.
Um seine Augen zu erholen, ließ er sie über die weichen Formen der Sicheldünen gleiten. Die entstanden nicht weit vom Strand im stetigen Passatwind an kleinen Hindernissen, wuchsen langsam und wanderten landeinwärts. Bald wurden Millionen Sandkörnchen vorn hinauf geblasen und rollten hinten wieder hinunter. Sie wurden viele Meter hoch. Die Jungen hatten kleine Stöckchen in den Boden gesteckt, um zu messen wie viele Zentimeter die Düne an jedem Tag vorwärts kam. Es gab nichts Langsameres! Sie wanderten hinauf an die geteerte Fernstraße. Dort hörten sie auf, denn die fanden keine Haftung. Sie wehten als dünner Schleier davon. Die Straße hatten sie zur Zeit seines Großvaters durch den ganzen Kontinent gebaut, von Alaska bis nach Feuerland. Das hatte er ihm erzählt. Denn er hatte sich als Bauarbeiter an der Carretera Panamericana verdingt, damals, als er noch ein junger Kerl war. Der war auch Fischer gewesen, und die ließen keine Gelegenheit aus, sich etwas dazuzuverdienen.
Jorge nahm die Suche wieder auf. Seine Gedanken schweiften zum Dorf und zu seinem Vater. Die Leute munkelten, er wäre abgehauen, einfach so. Doch er und seine Mutter bestanden darauf, dass sein Vater dort draußen beim Fischen ertrunken war. Jorge glaubte ihr und hielt an seinem Seemannstod fest, weil er es so wollte. Die anderen Fischer sahen das anders und wollten es ihm ausreden. In ihren Augen hatte Jorges Vater die richtige Entscheidung getroffen und ein besseres Leben gesucht und, so hofften sie, auch gefunden. Der hatte den Mut dazu gehabt. Da aber die Beweise fehlten, blieb ein Geheimnis um den Vater. Vielleicht hatte er entdeckt, dass die Mutter mit einem anderen Mann herumgemacht hatte und war deshalb abgehauen. Gerüchte waren schon immer wohlfeil in Las Arenas.
Die Fischer fuhren immer in Gruppen aufs Meer, wegen der Sicherheit. Keiner der Fischer hatte bemerkt, dass dem Vater etwas zugestoßen war, sie wären ihm sofort zu Hilfe geeilt. Und seine verlassene Totora, seine Ausrüstung und sein Fang wurden nie gefunden. Irgendetwas stimmte nicht, argumentierten sie. Doch Jorge hatte sie jedes Mal hartnäckig zurechtgewiesen, wenn sie an seiner Darstellung zweifelten. Irgendwann waren sie es leid, und es wurde nie wieder darüber gesprochen. Ja, ja, die Fischer aus dem Dorf Las Arenas. Eine merkwürdige Gesellschaft. Und rund herum Sand, Sand, Sand. Überall. Gelb und grau, trocken und unfruchtbar. Daher hatte es seinen Namen.
Jorge bildete sich ein, sein Vater wäre auch für ihn ertrunken, fühlte sich nicht nur verpflichtet, sondern stolz darauf, die Tradition der Totorafischer fortzusetzen. Es war ein alter, ehrwürdiger Beruf, fand er damals. Er gab ihm Freiheit, aber auch ein Gefühl von Verantwortung gegenüber den Kreaturen des Meeres, und er genoss die wohltuende Geborgenheit in Gemeinschaft mit den anderen Fischern. Sie trafen sich im weichenden Dunkel des frühen Morgens bei ihren aufrecht zusammengestellten Totoras, sie brachten sie zu Wasser, und dann paddelten sie hinaus. Je früher die Frauen mit dem Fang auf dem Markt waren, desto höhere Preise konnten sie fordern. Wenn später die Sonne erst hoch stand und grelle Speere durch die Löcher des rostigen Daches der Markthalle von Virú bohrte und helle Streifen in die stickige Luft zeichnete, wurde es schnell heiß. So heiß, dass der Gestank der Fischabfälle unerträglich wurde, denn die Frauen nahmen den Fisch noch lebend vor den Augen der Kunden aus und ließen die Abfälle in offene Eimer unter den Ständen glitschen.
Die frühen Kunden waren die besten. Es waren die Köche der besseren Restaurants und die Haushälterinnen der Reichen, die zum Markt geschickt wurden, während sich die Señoras herrichteten oder die Kinder zur Schule chauffierten. Sie suchten sich die besten Stücke heraus und zahlten gute Preise. Wenn diese Kunden gegangen waren, machten die Frauen der Fischer, darunter Jorges Mutter, zwischen dem Morgen und dem Vormittag eine Pause, um sich für die zweite Phase zu stärken. Reihum kaufte eine der Frauen im Café gegenüber eine Runde Espresso und trug das Tablett mit den vielen kleinen Tassen erhobenen Hauptes von Stand zu Stand. Diese Pause war ihnen heilig, denn sie wussten, was danach kam. Die Fischfrauen harrten der Morgenbrise, die bald einsetzen würde, jeden Tag, verlässlich zur selben Stunde. Dann sprang der Wind an. Er kam vom Meer herauf und blies den Mief aus der Halle.
Danach begann die harte Stunde der Pfennigfuchser, der schlitzohrigen Besitzer billiger Restaurants und der Hausfrauen mit dem kleinen Geldbeutel, die selbst einkaufen mussten. Es begann die Zeit des gnadenlosen Meckerns und harten Feilschens. Denen war nichts gut genug, obwohl sie wussten, wie frisch der Fisch war. Aber sie wussten auch, dass die besten Stücke jetzt verkauft waren und begannen ihre eiserne Jagd nach Schnäppchen.
»Die Ware muss nach Meer duften, nicht nach Fisch stinken. Nicht so wie eure hier!«
Das war einer ihrer dämlichsten Sprüche, denn nicht der Fisch stank, sondern der Abfall vom Morgen.
Jorge konzentrierte sich wieder auf die Suche.
›Condenado rapaz!‹, schnaubte er.
›Raúl wird nie ein Fischer werden, dieser verfluchte Lausbub. Wie der mit seinem Boot umgeht, ist nicht einzusehen. Das tut kein richtiger Fischer.‹
Sie nannten sie caballitos del mar, weil sie auf den Wellen bockten wie ein schlecht gezähmtes Pferd. Doch sie liebten und pflegten sie. Dafür hatte Raúl keinen Draht, das lag ihm nicht. Für ihn war es ein Spielzeug für sein Vergnügen, für Jorge ein Werkzeug zum Geldverdienen. Raúl interessierte sich dagegen für jedes kleine Skelett, jede Muschel, besonders gefärbte Steine. Er bewunderte die Kormorane, wenn sie im Sturzflug mit angelegten Flügeln wie Pfeile ins Meer stürzten und sah ihnen nach, bis sich ihre Blasenspur in der Tiefe verlor. Er zählte die Sekunden bis zum Auftauchen und verglich die Zeiten. Er erkannte die Kormorane an der Farbe ihrer Schnäbel oder an fehlenden Federn in den Schwingen. Für seine sechs Jahre hatte er ganz besondere Interessen.
Außerdem wurde in Las Arenas über Raúls späte Geburt viel spekuliert, aber hinter vorgehaltener Hand. Mit wem hat seine Mutter ein Verhältnis, fragte man sich. Sein bester Freund Alejandro berichtete, dass auch bei ihm zuhause darüber geredet wurde. Öffentlich wurde nie darüber gesprochen, so als habe man Angst vor dem großen Unbekannten. Ein Fischer kann es nicht sein, die Neigungen Raúls waren der Beweis. Aber Mutter gab den Namen von Raúls Vater nicht preis.
So sehr Jorge seine Augen zusammenkniff, das Boot war nirgends zu entdecken. Er beschloss zum Wasser zu gehen, um die Bucht systematisch von einem Ende zum anderen abzulaufen. Er musste die verdammte Totora finden. Aus den Augenwinkeln entdeckte er, dass zwischen den Sicheldünen jemand auf das Meer zuging, in der Hitze des Mittags! Niemand hielt sich zu dieser Zeit im Freien auf. Außer man suchte ein Boot wie er. Bald erreichte die Person den nassen Streifen, den die auflaufenden Wellen unterhalb des sonnensatten Sandes erzeugten und kam langsam in seine Richtung. Es musste eine Frau sein. Der Wind presste ihr Kleid an den Körper und ließ es auf der Leeseite heftig flattern. In einer Hand trug sie ihre Sandalen.
Die hohe Gestalt erinnerte ihn an Isabel Yupanqui. Sie war größer als die anderen Mädchen, hatte helle Haut und nicht das strähnige, blauschwarze Haar und den gedrungenen Körper der Indios. Für ihn war sie ein Ideal, die eine Sorte Frau, von der er träumte. Die Frau, von der er hoffte, sie würde sich eines Tages für ihn entscheiden.
Die andere Sorte Frauen, von denen er träumte, war für seine Begierden und seine Fantasien. Sie entsprangen den billigen Magazinen, die er selten genug zu Gesicht bekommen hatte, sie waren die Mädchen seiner Nachtträume. Wie oft hatte er sie im Schlummer umarmt, gestreichelt, wild geküsst und dann beim Aufwachen den nassen Fleck im Bett entdeckt.
Jorge hatte kein Mädchen. Sein Tag war angefüllt mit Arbeit. Für den einzigen Mann in der Familie gab es immer zu tun. Am Wochenende wurde die Totora geflickt, neues Schilf eingezogen und verfaultes entfernt, das Wurfnetz repariert, oder die Speere wurden geschliffen. In seinen Tagträumen wünschte er Isabel als Braut an seiner Seite vor dem Altar, obwohl er die Kirche nur dann besuchte, wenn es unvermeidbar war, wie zu Allerseelen, um seines Vaters zu gedenken oder zu Weihnachten, wegen der feierlichen Stimmung.
Er war zerrissen zwischen seiner Verliebtheit und der rauen Realität. Sein Verstand sagte ihm, dass sich sein Traum nie erfüllen würde. Die Yupanquis hielten sich für etwas Besseres und machten das in Las Arenas immer wieder deutlich. Geschickt verbreiteten sie, dass sie von den Inkas abstammten, dem letzten Herrschergeschlecht, bevor die Spanier kamen. Mit der Zeit glaubten ihnen das die meisten. Angeblich gingen ihre Vorfahren auf Manco Capac zurück, der einige Jahre nach der Landung Pizarros eine blutige Rebellion gegen die Spanier angezettelt hatte. Doch die nahmen ihn gefangen und brachten ihn um. Geschickt lenkte der alte Yupanqui, Isabels Vater, das Gespräch immer wieder auf dieses Thema. Er hatte sich die Geschichte der Eroberung eingeprägt und glänzte mit seinem Wissensvorsprung. Allmählich sammelte er Gleichgesinnte um sich, die sich einer romantischen Nostalgie hingaben und die Erstellung der alten Ordnung herbeiwünschten, der alten Werte, die sogar das Quetschua zur offiziellen Landessprache erklären wollten.
Ovidio, einer von Isabels Brüdern musste mitbekommen haben, dass sich zwischen Jorge und Isabel etwas anzubahnen schien. In der Markthalle von Virú hatte er beobachtet, wie Isabel im Gewühl blitzschnell Jorges Hand ergriff und ihn ansah. Ehe Jorge begriff, was geschah, war sie wieder in der Menge verschwunden. Er war wie erstarrt stehengeblieben und hatte einen rostigen Geschmack im Mund gespürt. Wochen später traf Jorge zufällig auf Ovidio und dessen älteren Brüder. Im Vorbeigehen raunte er Jorge hochnäsig und deutlich zu, seine dreckigen, stinkenden Fischerfinger von Isabel zu lassen, sonst würde etwas passieren. Er schien sich im Schutz seines älteren Bruders sehr sicher zu fühlen.
»Was soll schon passieren, du Hosenpisser«, parierte Jorge.
Ovidio reagierte mit einer eindeutigen Fingerbewegung quer über den Hals und grinste frech zurück.
»Rutsch doch über deine Mutter, du Hurensohn. Die ist einsam, seit dein Vater abgehauen ist. Sie wird sich freuen.«
Das war in Lateinamerika eine Beleidigung zu viel. Den Bruchteil einer Sekunde später lag Ovidio mit blutender Nase am Boden. Der ältere Bruder war so verdutzt, dass er sich zuerst um Ovidio kümmerte. Dieser Jorge schien gut durchtrainiert, und er wollte weiteren Schaden vermeiden. Zudem waren beide Schimpfworte hijo de puta und concha tu madre in einem Atemzug ziemlich starker Tobak. Er beendete den Streit, indem er seinem Bruder aufhalf und ihn von der Szene entfernte. Natürlich sannen sie auf Rache. Ein paar Tage später lauerten sie Jorge auf, dieses Mal zu dritt. Er hatte nicht den Hauch einer Chance und wurde tüchtig verprügelt.
Jorge suchte Verbündete. Doch er bekam nicht genügend Furchtlose zusammen. Seine Revanche musste warten. Die Yupanquis waren reich und hatten Einfluss in der Ansiedlung. Keiner wollte sich mit ihnen anlegen. Isabels Familie besaß das einzige Steinhaus von Las Arenas. Niemand wusste, womit ihr Vater so viel Geld verdiente, aber es war eben so. Das Haus stand nahe an der Panamericana, die anderen Leute wohnten in Hütten, die sie aus Baumstämmen, Zweigen und Brettern zusammengebaut hatten. Sie standen unterhalb der Straße und deshalb näher zum Meer und den aufrecht abgestellten Totoras. Die kurze Begegnung mit Isabel auf dem Markt hatte sich fest in seinem Kopf eingegraben, und jedes Mal, wenn er an sie dachte, spürte er diesen Geschmack in der Kehle.
Er ließ die Erinnerung los und kümmerte sich wieder um die Suche nach Raúls verdammter Totora. Er musste sich sputen. Aus seinem Augenwinkel bemerkte er, dass die Frau näher gekommen war. Er drehte seinen Kopf herum. Es war tatsächlich Isabel! Er verlangsamte seine Schritte und ließ sie aufholen, ging einfach weiter und spielte den Gleichgültigen. Die Prügel von ihren drei Brüdern waren nicht vergessen, und er verspürte keine Lust auf Wiederholung. Vielleicht lauerten die Kerle bereits in Überzahl hinter einer Düne. Also gebot er seiner Freude Einhalt und unterdrückte sein Glücksgefühl. Isabel kam mit festen Schritten auf ihn zu und blieb auf gleicher Höhe mit ihm stehen.
»Hallo Jorge, wo willst du hin?«
Er hatte einen Kloß im Hals und schwieg.
»Wenn du wieder einmal Raúls Totora suchst, am Cabo de Lobos habe ich eine treiben sehen. Komm, ich führ dich hin.«
Sie nickte seitlich mit dem Kopf in die Richtung und lief los. In zwei Metern Abstand ging er neben ihr her.
»Musst du wieder der Büttel deines Bruders sein?«
Ihr Necken verdrängte die Angst vor ihren Brüdern. Er lief ins flache Wasser und spritzte sie nass. Lachend lief sie vor ihm weg, und sie lieferten sich eine spielerische Hetzjagd, mal den Strand hinauf, dann wieder durch die flachen Wellen, dass das Wasser durch die Luft perlte. Er jagte sie durch den Sand, blieb aber immer hinter ihr zurück, um ihren Körper und ihre Bewegungen sehen zu können. Keuchend hielt sie ein und setzte sich in den Sand. Endlich war er mit ihr allein und konnte mit ihr reden. Doch plötzlich fand er die Worte nicht mehr, die er sich für diesen Augenblick vorsorglich zurechtgelegt hatte. Er blieb stumm und sah sie mit offenem Mund an. Mit einer überraschenden Frage brach sie sein unbeholfenes Schweigen.
»Warum bist du eigentlich blond und nicht so schwarzhaarig wie die anderen Jungen? Warum hast du blaue Augen?«
Jorge zog die Schultern hoch, er hatte keine Erklärung, nur eine vage Erinnerung, dass sein Vater mal sagte, als er noch lebte, er stammte von den Spaniern ab, die Trujillo gegründet hatten. Da wäre ein Beltrán dabei gewesen, in dem war noch Blut von den Westgoten, hatte er gesagt. Das sollen nordische Menschen gewesen sein, die in grauen Vorzeiten auf die iberische Halbinsel gezogen waren. Mehr wusste er nicht.
»Dann bist du kein Albino?«
»--«
Er wusste weder, warum sie das fragte, noch was ein Albino war und drängte zum Aufbruch. Sie gingen nebeneinander im harten, feuchten Sand oberhalb der Wellen. Ihre Hand glitt in seine. Er dachte wieder an die Prügel und blickte sich suchend um, ob ihm ihre Brüder auflauerten. Aber sie hatte seine Gedanken erraten.
»Meine Brüder sind in der Stadt, um sich für das colegio anzumelden. Sie sollen das Abitur machen, genau wie Vater.«
›Ich würde auch gern das Abitur haben‹, dachte er.
»Wirst du auch zum Colegio gehen?«
»Gern würde ich, aber meine Eltern sagen, das ist nur was für Jungen.
Für die Küchenarbeit und die Kindererziehung braucht man kein Colegio.«
Schweigend gingen sie weiter. Draußen segelte eine Formation Pelikane in schräger Flugstaffel tief über die Wellen, immer auf der Suche nach etwas Fressbarem und immer elegant der Wellenkontur folgend. Er sah ihnen nach und wünschte, auch so fliegen zu können. Plötzlich trat sie vor ihn und hielt ihn fest. Lange und wortlos sah sie ihm in die Augen, so als wolle sie in ihn hinein sehen, als forschte sie ihn aus.
Dann sagte sie diesen einen Satz.
»Jorge Beltrán, ich bin für dich.«
In seinen Adern raste das Blut, in seinem Kopf war ein Rauschen. Er konnte nicht sprechen, in seinem Hals saß ein Pfropfen. Tausend Gedanken zuckten durch sein Hirn. Noch vorhin war er völlig ohne Hoffnung gewesen, sie jemals für sich gewinnen zu können, und nun diese Erklärung, die klang wie ein Entschluss. Er wollte etwas erwidern, doch sie legte ihren Zeigfinger auf seine Lippen und verschloss seinen Mund.
»Ich habe alles gesagt.«
Am Ende der Bucht hing das Schilfboot schräg am Felsen. Mit jedem Auf und Ab der Dünung schabte es kratzend am rauen Stein, war aber zum Glück noch kaum beschädigt. Isabel watete mit ihm in das brusttiefe Wasser und half die kleine Totora zu bergen. Er nahm ihre Hände und küsste ihre Finger. Dann schwang er sich auf das Boot, bis er es rittlings in seiner Gewalt hatte und paddelte durch die Brandung in die ruhige Dünung. Er sah Isabel mit nassem Kleid den Strand hinauf gehen. Er sah ihr nach, bis sie hinter der nächsten Düne verschwunden war.
Im ausladenden Bogen der Bucht fanden sie eine verborgene Stelle für ihre heimlichen Treffen, weit genug vom Dorf entfernt. Eine Gruppe großer Felsen bot Deckung und Ausblick zugleich. Niemand konnte sich diesem Ort nähern, ohne entdeckt zu werden. Nach jedem Hochwasser blieben Tümpel von Seewasser zurück, die von der Sonne schnell erwärmt wurden. Stein, Sand und Wasser wurden für die nächsten Wochen ihr gehüteter Garten von Eden. So oft sie sich unbemerkt von zuhause fortstehlen konnten, trafen sie sich dort. Sie planschten herum, schworen sich ewige Liebe, oder lagen mit verschränkten Händen im warmen Sand und sahen den Pelikanen zu. Sie fühlten sich losgelöst von der Welt um sie herum, sie wähnten sich auf einer Insel der Glückseligkeit.
Jorge erzählte ihr vom Fischfang, wie er und die anderen Männer am frühen Morgen mit den Totoras hinaus paddelten, um den Tagesfang an Land zu bringen, wie sie am Nachmittag die Netze reparierten. Er erzählte ihr von den Kormoranen und Robben, die ihnen den Fang streitig machten oder von der Strömung, die sie oft weit hinaus trieb bis zu den Guano-Inseln, auf denen die Vögel nisteten. Er sprach stolz von seinem uralten gefährlichen Handwerk, mit dessen Hilfe sie etwas vom Überfluss der Natur abzweigten, um sich und die Menschen zu ernähren. Zukunftsängste hatte er nicht. Fischer würde es geben, solange es Menschen gab, die Fisch verzehrten. Er war ein guter Fischer. Oft führte er eine Gruppe an die ergiebigen Schwärme heran, denn er konnte ihre Zugrichtung ›lesen‹. Meistens waren sie die ersten, die mit reicher Beute wieder an Land gingen.
Sie liebkosten sich gegenseitig. Jorge empfand einen unwiderstehlichen Reiz darin, ihren schönen Körper zu diesem kraftvoll rhythmischen Aufbäumen zu bringen. Wenn ihre Erschöpfung gewichen war, beugte sie sich halb über ihn, um ihn zu streicheln und liebevoll zu massieren und beobachtete dann fasziniert seinen Erguss. Sie vermieden, wenn auch mit großer Mühe, es ›zum Äußersten‹ kommen zu lassen. So ging das viele Wochen. Dann stellte sie ihm diese Frage.
»Jorge, wirst du mir immer treu sein? Wirst du immer für mich sorgen? Und für unsere Kinder?«
Insgeheim hatte er diese Frage befürchtet und in mehreren Anläufen versucht, sie sich selbst zu beantworten. Ohne Ergebnis. Schließlich hatte er das Thema verdrängt und sich einfach der Vorfreude auf das nächste Stelldichein hingegeben. Was sollte er ihr sagen? Warum fragte sie überhaupt? Nach ihm hätte es ewig so weitergehen können. Jedenfalls im Augenblick. Er hatte genug um die Ohren mit seinem Beruf, seiner Mutter und Raúl.
Isabel dachte weiter. Irgendwann käme es heraus. Entweder sie würde sich vor ihren Freundinnen verplappern, oder ihre Mutter würde Verdacht schöpfen. Irgendwann wollte sie die Geheimnistuerei beenden, sich offen zu Jorge und ihre Liebe zu ihm bekennen. Sie sehnte sich nach der vollkommenen Vereinigung mit Jorge. Doch zuerst wollte sie seiner sicher sein.
»Ich begehre deine Nähe, deine Wärme und deine Stimme. Ich brauche deinen Schutz, Jorge, mi amor. Du bist mein Leben. «
Jorge schwieg nachdenklich. Natürlich würde er für sie sorgen, aber er hatte keinen Plan. Ihre beiden Familien waren tutiefst verfeindet. Für ihn war seine Mutter die größte Hürde. Und die schwierigste.
Die Unterhaltung mit seiner Mutter bereitete ihm Unbehagen. Über Schlägereien mit Isabels Brüdern machte er sich keine Sorgen. Wenn es um sein Mädchen ging, würden alle seine Fischer hinter ihm stehen, und sie waren in der Mehrzahl. Mit den Fäusten war das Problem also nicht zu lösen. Sein bisher schlichtes Leben war mit einem Schlag hoch kompliziert. Er musste für sich und Isabel eine Hütte bauen, aber Mutter und Raúl weiter versorgen. Isabel müsste ihr angenehmes Steinhaus verlassen und das Leben einer Fischerfrau führen, Fisch ausnehmen und auf dem Markt in Virú verkaufen. Doch der Gedanke Isabel zu verlieren und sie womöglich an der Seite eines Anderen zu sehen war ihm unerträglich.
»Wir werden beide kämpfen müssen. Aber wir stehen das durch.«
Sie schmiegte sich ganz fest an ihn. Er küsste ihr Gesicht, ihren Hals, ihre Schultern, seine Hände glitten an ihrem Körper hinunter. Sie ließ geschehen, dass er ihr Kleid abstreifte, und bald lagen sie verschlungen und mit Pazifiksand paniert zwischen den Felsen. Die Zeit stand still, als er sich aufbäumte und dann zur Seite rollte. Das konnte es nicht gewesen sein, was sie sich in ihren Träumen vorgestellt hatte. Mit enttäuschtem Blick suchte sie sein schlafendes Gesicht, dann barg sie ihren Kopf an seiner Schulter.
Als er aus seinem Schlummer erwachte, fühlte er sie tropfnass auf sich sitzen. Ihr Körper fühlte sich kalt und fest an. Sie hatte im Meer gebadet. Er hielt seine Augenlider geschlossen und stellte sich schlafend. Er genoss ihre ruhigen, sanften und ausdauernden Bewegungen und spürte in seinen Körper hinein und durch seinen Körper in ihren. Mit geschlossenen Augen, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, steigerte sie stetig ihren Rhythmus, bis das ewige Raunen der Wellen ihren hellen Vogelschrei verschluckte.
Isabel legte sich neben ihn und weinte plötzlich. Er hielt sie fest im Arm. Nach einer Weile brach es aus ihr heraus. Ihre Mutter hatte sie zur Rede gestellt. Ihr war nicht entgangen, dass sie sich heimlich trafen, und sie hatte gefordert, dass dies aufhörte. Sie hatte Isabel Ihre Ablehnung gegen Jorge in deutlichen Worten klargemacht. Sie wiederholte, was ihre Mutter gesagt hatte.
›Diese Beltráns sind Spanier, Eroberer, Diebe, Mörder und Verbrecher. Eher nimmst du dir einen Indio aus den Bergen als einen godo. Diese Menschen haben unserem Volk alles genommen, Würde, Freiheit, Reichtum und Frieden. Wir Yupanquis stammen von den Inka ab, wir gehören hierher, die nicht! Unsere Vorfahren haben dafür gesorgt, dass alle Essen und Kleidung hatten, auch in Notzeiten. Sie haben die Arbeit geteilt, aber auch die Früchte ihrer Arbeit und das Vergnügen. Ja, du hast Recht, das ist lange her, aber sieh, was aus diesem Land geworden ist! Sie haben es unter sich aufgeteilt. Früher gehörte das Land allen, jetzt nennen sie es ihr Eigentum, und wir dürfen es für sie bestellen. Und was haben wir davon? Ein bisschen Geld, das nichts wert ist, dessen Wert sie bestimmen. Nein, ein Beltrán kommt nicht in dieses Haus. Und ich sage dir, eines Tages wird er dich verlassen. Erst wird er dich schwängern, und bevor du es ausgetragen hast, wird er zu einer anderen gehen.‹
Jorge wurde klar, ihre Mutter wollte ihn vor Isabel erniedrigen. Niemals würden die Yupanquis ihn als Ehemann für Isabel und als Mitglied ihrer Familie akzeptieren. Isabel stand die Auseinandersetzung mit ihrem Vater noch bevor, und sie fürchtete sich davor. Jorge fühlte sich hilflos. Er hatte keine Chance. Mit einem Mal wurde ihm deutlich, wie tief die Hassgefühle auf die europäischen Eindringlinge bei einigen Menschen saßen, fünfhundert Jahre danach. Er bekam Angst, Isabel würde ihre Beziehung zu ihm als gehorsame Tochter abbrechen. Aber was sollte er machen? Er schwieg.
An den folgenden Tagen erschien Isabel nicht am Treffpunkt. Sie hatte auf keins der vereinbarten Zeichen geantwortet. Jorge fühlte sich gedemütigt, verschmäht und gleichzeitig liebeskrank bis zur Übelkeit. Er wagte nicht, Isabel aufzusuchen. Immer wieder ging er zu ihrem Treffpunkt in der Hoffnung, sie dort zu finden, doch sie kam nicht. Nach fast zwei Wochen sah er sie am Strand stehen und mit dem Meer sprechen. Sie liebte das Meer, sie war eine geschickte, ausdauernde Schwimmerin und konnte tief und lange tauchen. Wasser war für sie ein zweiter Lebensraum neben der Erde. Zum Meer hatte sie ein besonderes Verhältnis. Mit ihm hielt sie Zwiesprache, vertraute ihm ihre Freuden, Sorgen, Ängste und Fragen an. Manchmal hatte sie das Gefühl, das Meer würde ihr antworten. Das tiefe Brummen der Brandung und das gurgelnde Zurückweichen der im Sand verendenden Wellen waren für sie Töne einer Sprache, die nur sie verstand. Auch jetzt wieder. Er hörte sie murmeln, verstand aber ihre Worte nicht. Es kam ihm ein wenig unheimlich vor. Manchmal glaubte er, sie stünde unter der Wirkung eines geheimen Zaubers. Als er sich näherte, erschrak sie und kam ihm vor wie aus einer Trance erwacht. Dann berichtete sie vom Gespräch mit ihrem Vater oder vielmehr von dessen Monolog.
›Du bist mein Nesthäkchen‹, hatte er ihr gesagt.
›Ich möchte dich vor einem großen Irrtum bewahren. Schau dir Las Arenas an, es hat keine Zukunft. Alle Fischer werden verarmen und verhungern. Es sei denn, sie gehen fort und suchen Arbeit. Doch zu mehr als Tagelöhnern werden sie es nicht bringen. Was haben die denn gelernt? Für das Colegio reicht ihnen weder das Geld noch der Verstand. Und wenn die Kerle erwachsen sind, lernen sie ein Mädchen kennen und machen ein Kind nach dem anderen. Dann ist es mit dem Lernen ganz vorbei. Die kommen nie weiter. Am schlimmsten sind die Fischer dran. Die großen Gesellschaften beherrschen jetzt schon den Markt mit ihren billigen Konserven. Sie fahren auf die hohe See, wo der Fisch reichhaltiger und vielseitiger ist und verarbeiten ihren Fang bereits auf dem Meer. Jorge könnte natürlich auf einem Fischdampfer anheuern. Aber wenn er nach drei oder vier Wochen ausgehungert an Land geht, wird er das schwer verdiente Geld mit seinen Kameraden in den Hafenkneipen Callaos versaufen und mit billigen Mädchen durchbringen, verlass dich drauf. Was dann noch übrig bleibt, wird nicht reichen, um eine Familie zu ernähren.‹
Ihr Vater hatte sie beschworen, zu warten bis der richtige Mann käme. Er würde ihr dabei helfen. Sie wäre noch so jung und hätte noch so viel Zeit. Was sie berichtete, klang als ob die Yupanquis auf die Gelegenheit warteten, die Spanier wieder aus dem Land zu jagen und für Isabel den Mann ihrer Wahl zu suchen. Für ihren Vater war Jorge einer der Blutsauger und ein dummer Trottel dazu, der mit längst überholten Methoden Fische fing. Kein Wort davon, dass sie längst Peruaner waren, die das Joch der spanischen Krone aus eigener Kraft abgeschüttelt hatten, so wie man es in der Schule lernt, wenn die Lehrer über die Heldentaten von Bolívar und San Martín unterrichteten.
›Die Liebe kommt und geht, Isabel‹, hatte er gesagt.
›Ein guter Kamerad bleibt, auch wenn die Liebe abgekühlt ist. Der nicht! Wird er zu dir und euren Kindern stehen, wenn ihr finanzielle Probleme habt? Nein! Wovon wollt ihr leben? Isabel, ich werde nie und nimmer einem Beltrán helfen. Ni un centavo! Nicht einen Cent.‹
Isabel fühlte sich verlassen, sie sehnte sich nach Schutz, Trost und Zärtlichkeit. Jorge wurde plötzlich übel vor Angst, sie zu verlieren.
Dann kam die Zeit der großen Sardellenschwärme. Jorge trat aus der Hütte und entfernte mit dem Nagel des kleinen Fingers die Reste der Tortilla zwischen den Zähnen, den seine Mutter zum Frühstück gebacken hatte. Er zog die brüchige Tür hinter sich zu. Auch die anderen Fischer kamen wie verabredet aus ihren Hütten, sie bildeten kleine Gruppen und gingen gemächlich zum Strand. So war es jeden Morgen, wie ein Ritual. Außer an den Sonntagen und Feiertagen, dann hatten Fische und Fischer Ruhe. Einige der Männer gingen mit ihren Familien zur kleinen Kirche, wenn gelegentlich ein Priester vorbeikam, denn einen eigenen konnten sie sich in Las Arenas nicht leisten. Die Kirche war mehr ein Bethaus ohne Turm und ohne Glocke. Sie war aus Adobe gebaut, diesem beigefarbenen Gemisch aus Lehm und Gräsern, und war früher von einem einsamen Fischer bewohnt gewesen, der es der Kirche vererbt hatte. Die Risse der letzten Erdbeben waren nie repariert worden. Auch dazu fehlte es an Geld. Trotzdem hatte Padre Arsenio aus Trujillo das Häuschen geweiht und zum Haus des Herrn erklärt.
Es war ein trüber, warmer Morgen, das Meer schien zu dampfen. Der Passatwind wehte viel schwächer als sonst und trieb träge, neblige Schwaden den Strand herauf und über die Fischer hinweg ins Land. Jorge hoffte, dass sich der Nebel draußen lichten würde, so dass er einen großen Schwarm entdecken konnte. Die zusammengestellten Totoras tauchten jetzt wie graue Gespenster vor ihnen auf. Schweigend griff sich jeder sein Boot. Der Geruch von Guano hing schwer in der Luft. Er kam von den Inseln vor der Küste.
Jorge war in Gedanken bei Isabel. Sie trafen sich wieder, wenngleich mit noch größerer Umsicht. Ihre Familie blieb unerbittlich. Seltener als zuvor gelang es ihr, sich von Zuhause wegzustehlen. Doch ihr Ziel, Isabel und Jorge zu trennen, erreichten sie nicht. Das Gegenteil war der Fall. Ihre Zuneigung wurde durch ein Gefühl des Trotzes nur noch gestärkt. Die langen Abstände zwischen ihren Treffen steigerten ihre Sehnsucht ins Unermessliche. Sie fühlten sich für einander bestimmt, und keine Macht der Erden würde sie auseinanderbringen.
Jorge hatte noch keine Erfahrung mit Mädchen sammeln können. Für Sonntagsspaziergänge, bei denen mit der Angebeteten vorsichtig angebändelt wurde, ließen ihm seine Pflichten keine Zeit. Außerdem wurden die von ihren Brüdern streng bewacht, oder sie gaben sich bewusst spröde und abweisend. Es wurde von ihnen erwartet, bis zur Heirat jungfräulich zu bleiben. Schwanger zu werden galt als Katastrophe. Dann wurde schleunigst geheiratet. Die Näherinnen im Dorf brachten manchmal wahre Wunder zustande, um die zarten Rundungen unter den Brautkleidern durch Rüschen und Falten zu verbergen. Immerhin war danach die Beziehung legalisiert und die Welt in Ordnung. Die zugänglicheren Mädchen wurden von den jungen Männern durch Flüsterpropaganda weiterempfohlen. Die brüsteten sich gern und ausführlich mit ihren Liebesabenteuern. Im Nu war der Ruf dieser Mädchen als puta gefestigt. Für ihre Dienste waren kleine Geschenke üblich, und die konnte sich Jorge nicht leisten.
Isabels Liebe war kompromisslos. Sie wollte Jorge, und sie wollte ihn ganz. Sie war herzlich und anschmiegsam und immer zu Zärtlichkeiten bereit. Aber nur für ihn. Auch Jorge fühlte so, und er fühlte sich gut dabei. Er empfand sich anerkannt, erwachsen. Aber die Leute im Dorf blickten zur Seite, wenn sie ihm begegneten. Die Auseinandersetzung Isabels mit ihren Eltern war ihnen nicht verborgen geblieben. Vielleicht war die Neuigkeit auch bewusst gestreut worden. Und nun warteten alle gespannt, wie die Sache weitergehen würde. Ein Beltrán mit einer Yupanqui? Unmöglich! Die Leute tuschelten. Natürlich hatte auch seine Mutter Wind bekommen und ihn zur Rede gestellt. Sie war wütend gewesen.
›Du lässt die Finger von dieser Person! Ich will mit dieser Familie nichts zu tun haben. Dies ist mein letztes Wort, und mehr wird hierüber nicht mehr gesprochen.‹
Nicht einmal der Name Yupanqui kam über ihre Lippen. Immer nur ›diese Familie‹ oder ›diese Leute‹. Ihr Gesicht verriet Abscheu und Ekel, wenn das Gespräch auf die Yupanquis kam, als wenn sie sich an irgendeinen Vorfall erinnerte, von dem Jorge nichts wusste, den nur sie kannte.
Die nächste Welle verscheuchte seine trüben Gedanken. Während sie glucksend im Sand verlief, schob er die Totora ins Wasser, sprang hinauf und paddelte mit aller Kraft auf die Brandung zu. Das vordere spitze Ende schnitt durch drei oder vier große, sich schäumend überschlagende Wellen, dann war er draußen in der ruhigen, langen Dünung. Er ließ seine Füße an beiden Seiten ins Wasser hängen. Normalerweise würde er nach kurzer Zeit an den Füßen frieren, denn das Wasser des Humboldtstroms kam von der Antarktis und war kalt. Doch heute meinte er, es sei wärmer als sonst. Die Strömung hatte nach Süden umgeschlagen, das wärmere und daher leichtere Wasser des El Niño hatte sich über das kalte Antarktiswasser geschoben. Um ihn herum paddelten die anderen jungen Männer des Dorfes und feuerten sich gegenseitig an.
»Das Wasser ist heute wärmer, findest du nicht?«
Jorge sah Alejandro an, der sich ihm grinsend zuwandte. Er war sein bester Freund. Sie kannten keine Geheimnisse. Er hatte ihm auch von Isabel erzählt. Dabei hatte sich Alejandros Miene verändert. Er begann, anzügliche Bemerkungen zu machen. Von da an hielt Jorge ein. Er fühlte eine Grenze, an der seine Offenheit endete. Alejandro sollte nicht an seinen Gefühlen teilhaben. Aber der bohrte nach, am liebsten hätte er Einzelheiten über ihren Sex gehört, er bemerkte in Alejandros Augen eine Lüsternheit, wenn der das Gespräch auf diesen Punkt steuerte. Doch Jorge blieb verschlossen. Das waren Dinge, die nur Isabel und ihn angingen. Von da an zog sich Alejandro zurück. Die Freundschaft kühlte ab. Jorge nahm das nicht ernst und dachte, wenn auch er eine Freundin haben würde, könnte es wieder sein wie vorher. Doch er sollte sich gründlich irren.
»Jedes Mal wenn du in letzter Zeit mit uns Fischen gehst, ist der Ozean zwei Grad wärmer. Ganz schön verliebt, was? Aber heute hast du Recht, kommt mir auch wärmer vor.«
Jorge versuchte, das Thema auf das Fischen zu lenken, aber Alejandro blieb hartnäckig.
»Man sieht es dir an.«
Jorge tat, als verstünde er nicht.
»Was sieht man mir an?«
»Na was wohl. Isabel, deine Flamme.«
»Achte lieber auf den Schwarm, sonst entwischt dir die Beute.«
»Ich würde deinen Schwarm gern mit dir teilen, Jorge.«
Alejandro grinste frech. Jorge schwieg.
»Hast du schon mit ihr geschlafen? Wie ist sie denn so?«
Seitdem Alejandro es erfahren hatte, begann er Jorge zu hänseln. Er suchte ein Ventil für seinen Neid, denn auch er hatte schon länger ein Auge auf Isabel geworfen. Er fand sie beispiellos gut gebaut, nicht so kurz und gedrungen wie die cholas oder die Indiomädchen. Und ihr Vater hatte Geld. Auf diese Weise würden sich seine Umstände schlagartig verbessern. Alejandro sah stets seinen Vorteil in allem was er tat. Nun hatte Isabel Jorge vorgezogen. Verdammtes Pech für ihn. Doch Alejandro wusste auch von der Einstellung Yupanquis zu den Fischern allgemein und zu den Beltráns im besonderen.
»Hast du mit deinem Schwiegervater schon einen gehoben?«
Jorge ging auf die Provokation nicht ein. Aber jetzt wusste er, Isabel und er, die Yupanquis und die Beltráns waren Gesprächsthema im Dorf. Es hatte sich herumgesprochen. Sie beide waren im Blickpunkt der Leute. Es wurde mal wieder eine Sau durchs Dorf getrieben. Jetzt werden sie sich die Mäuler zerreißen.
»Was geht dich das an, du Klatschweib. Ich dachte immer, du bist mein Freund. Auf wessen Seite stehst du?«
»Immer auf meiner. Aber ich kann euch gern meine Hütte vermieten. Ihr Armen müsst es ja unten am Meer treiben. Sind deine Knie nicht schon ganz aufgescheuert?«
Jorge war außer sich. Offenbar wurden ihre gemeinsamen Stunden auch noch heimlich beobachtet. Vielleicht sogar durch Alejandro selbst. So ging es nicht weiter. Er musste Isabels und seine Würde schützen. Mehrere Fischer waren beim Hinauspaddeln in Hörweite geblieben und hatten die Unterhaltung mitbekommen. Manolo, der Älteste der Fischer, paddelte heran.
»Alejandro, halt endlich dein dreckiges Maul. Hast du kein Ehrgefühl? Jorge ist unser Kumpel, wir müssen hinter ihm stehen. Besonders du als sein Freund, oder bist du das nicht mehr? Wir wurden fast alle unehelich gezeugt. War eben Liebe zwischen unseren Eltern. Aber davon hast du keine Ahnung. An dir ist noch keine ordentliche Frau hängengeblieben, weil du sie nur bumsen willst. Für dich sind sie nur Objekte. Bleib bei deinen putas und lass die beiden in Frieden. Du solltest langsam wissen, dass sich Frauen ihre Gefährten auswählen und nicht umgekehrt. Und Jorge ist eine gute Wahl. Merk dir das. Für dich wäre Isabel viel zu schade. Und jetzt geh endlich deiner Arbeit nach.«
Damit war das Thema für die Fischer beendet.
Die Sonne brach durch den Dunst und trocknete ihre Hemden. Ein neuer Salzstreifen entstand im verwitterten Gewebe. Über dem Nebel, der die Küste noch verhüllte, tauchte die lange Gipfelkette der Anden auf. Jorge liebte diesen majestätischen Anblick, und sein Herz füllte sich mit Stolz und Freude. Er verdrängte den Nachgeschmack der Provokationen durch Alejandro. Als die Sonne die restlichen Nebel aufgelöst hatte, waren sie ganz dicht am Schwarm. Jorge nahm ihn ins Visier, paddelte schneller und überlegte, wie sie ihre Beute am besten einkreisen könnten.
»Was ist das?«, rief einer und deutete ins Wasser.
»Schaut doch mal! Da unten ist es ja ganz rot!«
Das Wasser hatte nicht die marineblaue Farbe wie sonst, sondern ein dunkles Purpur.
»Sieh mal, die Fische dort an der Oberfläche.«
Sie waren bei den Sardellen angelangt. Jetzt hatten auch die älteren Männer aufgeschlossen. Viele Fische trieben leblos und aufgedunsen in den Wellen. Sprachlos starrten sie auf den Schwarm unter der Oberfläche, das Rot im Wasser und die vielen Kadaver. Einer der älteren griff einen toten Fisch und brach ihn auf.
»Da seht mal, seine Innereien!«
Er zeigte den Fisch herum.
»Die sind alle krank. Mein Vater hat mir einmal erzählt, sie hätten vor vielen Jahren rotes Plankton gehabt, das komme nur alle dreißig bis vierzig Jahre vor oder so. Damals wären Millionen Fische verendet, und trieben stinkend an Land, hat er gesagt. Angeblich sind sie vom roten Plankton vergiftet.«
Alejandro fing einen äußerlich gesunden Fisch und brach ihn auf. Aber auch der war krank. Ratlos dümpelten sie in der leichten Dünung und berieten, was zu tun wäre. Manolo erinnerte sich, dass auch er das als junger Mann schon einmal erlebt hatte.
»Das muss der warme Meeresstrom vom Norden sein, der immer im Dezember kommt, kurz vor Weihnachten, weshalb sie ihn ›el niño‹ nennen, das Christkind«, gab einer der Alten zu bedenken.
»Er kommt nur ganz selten so weit nach Süden zu uns herunter. Aber wenn er kommt, stirbt das Kaltwasserplankton ab und verwest, es verfärbt sich rot. Die Fische haben Hunger und fressen es trotzdem und vergiften sich. Wir haben erst Ende Oktober, El Niño ist viel zu früh, Leute. Das werden karge Wochen.«
Die Totoras schaukelten im trägen Rhythmus der langen Dünung. Die Männer ließen die Köpfe hängen. Jorge überlegte, dass sicher auch die größeren Fische ausbleiben würden, die sich von den Sardellen ernährten. Die waren das gute Geschäft. Die nächsten Wochen würden schlimm. Enttäuscht traten sie die Rückfahrt an. Jorge sah die mächtigen Schneegipfel nicht mehr. Er sorgte sich um seine Zukunft und um die gemeinsamen Pläne mit Isabel. Mit hängendem Kopf zog er seine Totora den Strand hinauf. Er ging ins Dorf zum alten Pedro und suchte Rat. Der war früher auch Fischer gewesen, konnte aber die Totora nicht mehr reiten. Er kannte sich aus. Er sah die toten Fische und machte ihm keine Hoffnung. El Niño würde nicht vor Ende Dezember verschwinden.
Jorge fragte ihn, was die Fangschiffe machten.
»Die fahren einfach weiter nach Westen aufs offene Meer. Da gibt es das nicht, El Niño ist ein Küstenstrom. Und sie fischen in größerer Tiefe, wo das Wasser kalt und nährstoffreich ist.«
»Wie weit draußen?«, fragte Jorge.
»Zweihundert Meilen.«
»Zu weit für uns.«
Jetzt war ihm klar, er brauchte Arbeit.
Das Motorboot näherte sich dem Anleger des Felseneilandes Macabí, das fünfzig Meter aus dem Pazifik ragte. Jorge und die anderen Männer mit ihren Spitzhacken und Schaufeln machten sich zum Aussteigen bereit. Auf dem schweren Ausleger, an dem der Landesteg angehängt war, hockten Pelikane dicht nebeneinander mit leicht geöffneten Schnäbeln. Die durchscheinenden, faltigen Schnabelsäcke fächelten im Wind. Gelangweilt sahen die Tiere dem Anlegemanöver des Bootes zu. Die Felsenkante hoch über ihnen war besäumt mit Kormoranen, Möwen und anderen Seevögeln. Am Fuß der Insel hatte die ewige Brandung Höhlen ausgewaschen, in denen sich Kolonien von Seelöwen und Robben angesiedelt hatten. Die Brandung rauschte in den Kieseln.
Das Boot war eine Stunde über den dunkelblauen Pazifik getuckert. Jetzt stiegen die Männer aus und kletterten die schmale Holztreppe hinauf. Oben bot sich ihnen ein atemberaubender Ausblick auf das Meer, die helle Küste und die Bergkette der Anden im Dunst. Das Eiland war unbewohnt, sah man von den Millionen Vögeln ab, die hier rasteten, sich das Gefieder pflegten, brüteten, verdauten und ihren Kot ausschieden. Fast unbewohnt, denn auf der dem Meer zugewandten Seite stand die Hütte des Inselwärters. Selbst deren Dach war unter Vögeln versteckt, die in Schnabelweite ihre unordentlichen Nester verteidigten. Ihre Jahrhunderte alten Hinterlassenschaften türmten sich als dicker steinharter Belag auf dem Felsen, mehrere Meter mächtig. Obwohl es war hochwertiger Dünger war, wuchs auf der ganzen Insel kein Baum, kein Strauch, kein Halm. Hier gab es keinen Mutterboden und nie Regen.
Wie die Fischer besorgten sie sich ihre Nahrung aus dem kalten Meer. Und dann entdeckte Jorge, dass auch sie nicht von El Niño verschont worden waren. Tausende verendeter Vögel lagen herum. Ihre Kadaver stanken. Sie mussten zuerst weggeräumt werden, um an das ›weiße Gold‹ zu kommen. Die Männer warfen die toten Körper über die Felsenkante ins Meer.
Das Zeug war hart wie Kalkstein, trotzdem wirbelten die Spitzhacken beim Abbau große Wolken Staub auf. Er beleidigte Jorges Sinne, er brannte in den Augen, dass ihm die Tränen flossen, er brannte in der Nase, stank gemein, knirschte zwischen den Zähnen und schmeckte bitter. Er zog die Feuchtigkeit aus der Haut, machte sie trocken, bis sie aufriss und er den stechenden Schmerz in den kleinen Wunden spürte, wenn er sich mit Schweiß vermischte. Dazu kam das unablässige Geschrei und Gekrächze der Vögel. Ihm klangen die Ohren.
Die Katastrophe El Niño hatte seine Ersparnisse aufgebraucht. Seine Mutter, sein Bruder und er hungerten. Er hatte dem Anwerber nachgegeben und sich von der Düngergesellschaft als Tagelöhner auf dieser gottverdammten Insel einstellen lassen. Er, ein stolzer freier Totorafischer!
Er liebte das Meer. Doch hier in diesem Vogelinferno war sein Gefühl weniger freundlich. Das Naturereignis El Niño war nicht neu, es kam selten, das hatten auch die Vorfahren überlebt. Er machte dem Meer keinen Vorwurf, auch wenn es ab und zu rotes Plankton oder gar kein Plankton heranschleppte. Doch dieses Mal war es anders. Acht Wochen schon! So viel Geld hat kein Fischer auf der hohen Kante. Beim Schwingen der Hacke überdachte er seine Lage. es gab Tage, an denen sie so wenig Fisch anzubieten hatten, dass sie die Standmiete des Marktes nicht bezahlen konnten. Viele Frauen gingen schon nicht mehr hin. Er dachte an die besseren Tage. Damals setzten die Frauen den Erlös in papas um, die süßen Andenkartoffeln, oder Gemüse, Fleisch und Brot. War noch Geld übrig, kauften sie für ihre Männer Tabak und die eine oder andere Flasche chicha, den sie selbst gern tranken, die Weiber. Das war ihr Leben, ihre heile Welt, so lange sich die Alten erinnern konnten. Und die hatten es von ihren Vorfahren erzählt bekommen. So war es seit Hunderten von Jahren gewesen, denn auch die Verzierungen der Ruinen von Chan Chan erzählen diese Geschichte.
›Mal ehrlich: Guano hacken ist für mich als Fischer unter jeder Würde. Wofür haben wir das harte Handwerk des Fischens von unseren Vätern erlernt? Als Tagelöhner unter der Fuchtel eines Aufsehers zu schuften, ist total gegen meinen Sinn von Freiheit und Selbstbestimmung. Doch ich brauche nun mal Geld und bin bereit, für eine begrenzte Zeit meinen Stolz mit dem Guanostaub hinunterzuschlucken und auf diese zu Stein gehärtete Vogelscheiße einzuhacken. Es muss aber ein Ende in Sicht sein. Und das ist es leider nicht.‹
Denn es gab noch einen viel gefährlicheren Feind, den er fürchtete. Seitdem die neuen Dieselboote immer größere Mengen frischen Fisch in den Häfen anlandeten, wurde das Angebot auf den Märkten reichlicher, und die Preise für seine Fänge fielen und fielen. Auf den Schiffen fingen sie viel mehr Thunfisch, Makrelen und Bonito als die Totorafischer. Bei den Totorafischern waren diese Edelfische ein willkommener Zufall, selten und entsprechend teuer. Den Motorfischern waren Sardellen nur lästiger Beifang. Dann entdeckten sie, dass man Sardellen zu Fischmehl verarbeiten konnte, um es als proteinhaltiges Tierfutter zu verkaufen. Tierfutter! Er schüttelte sich. Er spuckte aus und fluchte auf die großen compañías pescadoras in Callao. Alles schien hoffnungslos. Yupanqui hatte also Recht!
Die Arbeit war hart und schmutzig, das Abbauen des hellgrauen und steinharten Naturdüngers war obendrein ungesund und schlecht bezahlt. Doch das nahm er in Kauf, jedenfalls vorerst. Er brauchte Geld, um die pacha manca zu bezahlen und den pisco und all das Bier für das große Fest. Auch der sacerdote, den Priester, den er aus Trujillo bestellen müsste, um in der kleinen Dorfkapelle eine würdige Hochzeitsmesse zu halten, wollte bezahlt werden, und die Musikkapelle und die Heilige Kommunion und der Blumenschmuck. Für Isabel und ihn sollte die Hochzeit das Fest ihres Lebens werden.
Isabel hätte ihm nie verziehen, wenn er in die Hauptstadt oder in den Hafen von Callao gegangen wäre, obwohl es dort immer Arbeit gab. So hatten sie jedenfalls im Las Arenas erzählt. Isabel hatte ihn an die Vorbehalte ihres Vaters erinnert. So hatte er ihr nachgegeben und die einzige Chance ergriffen, die sich in dieser kargen Region bot. Doch hier beschloss er, nach der Hochzeit nach Callao an Bord eines Schiffes zu gehen, um richtiges Geld zu verdienen, auch gegen den Widerstand Isabels, seiner Mutter und der Yupanquis. Es musste sein, trotz ihrer ständigen Unkenrufe.
›Sieh dir Ramos an, was ist aus ihm geworden? Ein Hurenbock und Trinker. Und Carlos, he? Man hat ihn im Streit abgestochen. Callao ist ein böser Sumpf, ein Höllenpfuhl!‹
So hatten sie ihn immer wieder gewarnt.
›Nicht ich‹, schwor er sich.
›Nicht ich!‹
Plötzlich tauchte der Kapo auf und schrie herüber.
»Wir zahlen dich nicht fürs Träumen, Jorge! Mach weiter!«
Murrend und zornig holte er mit seiner Spitzhacke weit aus. Unten am Anleger wartete bereits der Lastkahn, um den kostbaren Guano ans Festland zu bringen zu den großen Haziendas. Blitzend sauste die Hacke durch die Luft. Er stieß die verbrauchte Luft fauchend durch die Nasenlöcher aus und kämpfte gegen den Gestank. Morgen war Zahltag.
Maldito guano!
Der Vorarbeiter war wieder verschwunden. Jorge war heute nicht in Stimmung für harte Arbeit. Die Sorgen über seine Zukunft, vor allem über die finanzielle Lage nagten an ihm. Isabels Vater hatte im Dorf verbreitet, die Zeit des Guanos sei bald vorüber. Die Deutschen würden Kunstdünger herstellen, der besser und trotz der langen Seereise billiger wäre als Guano. Und er müsste nicht wie Guano vor dem Mahlen von den Kadavern befreit werden, damit die Mühlen nicht verstopften. Kunstdünger hätte gleichbleibende Qualität, wäre viel besser als Guano und könnte mit Maschinen auf den Feldern verteilt werden.
›Die gute Nachricht ist: das Ende ist also absehbar. Die schlechte ist, danach habe ich wieder keine Arbeit. Callao muss sein‹, grübelte er missgelaunt.
Das Geschrei der Vögel ging ihm auf die Nerven. Gedankenverloren stützte er sich auf seine Spitzhacke und sah zum Festland hinüber. Das helle Gelb des Strandes stand in scharfem Kontrast zum tiefen Blau des Wassers. Die quadratischen Schatten in der Wüste konnte er eher erahnen als er sie sah. Sein Großvater hatte ihn vor Jahren dorthin mitgenommen. Er war noch klein, aber er konnte sich erinnern, wie schrumpelig und gebeugt sein Opa war.
›Warum gehst du so krumm, Opa?‹
So unverblümt hatte er ihn damals gefragt. Heute würde er das nicht mehr tun, würde er noch leben. Kinder haben eine offene, verletzend direkte Art zu fragen. Sie wollen eine simple Wahrheit hören, die sie auch verstehen.
›Weil ich hier gearbeitet habe, mit Hacke und Schaufel.‹
Opa war schleppend mit ihm durch die versandeten Wege und Straßen gegangen, die er von früher kannte, und die sich die Wüste längst wieder geholt hatte. Die wenigen, übrig gebliebenen Randsteine waren zugeweht. Grün gab es nicht, kein Baum, kein Strauch, nicht einmal das graugrüne Steppengras wuchs hier. An den Häusern fehlten die Türen und Fensterläden, die Zimmer waren halb voll Sand. Der ewige Wind hatte die Mauern mit den kleinen Sandkörnern abgestrahlt. Manchmal stand nur noch der Mörtel, weil der härter war als die Ziegelsteine. Es sah gespenstisch aus. Auf dem Wellblech der Dächer war die Verzinkung längst weggerostet, viele hingen nur noch an ein paar Nägeln. Der Wind zauste an ihnen, sie schaukelten hin und her und machten quietschende Geräusche. Auf einem schiefen Telefonmast hockte ein Geier mit nacktem Hals und krummem Schnabel.
›Was hast du gemacht?‹
›Salpeter abgebaut.‹
›Was ist das?‹
›Es ist ein Stein unter dem Sand. Ganz früher war es mal Guano, der sich in Nitrat verwandelt hat. Wir mussten ihn mit Spitzhacken abschlagen, dann wurde er gemahlen und in Säcke gefüllt. Schiffe brachten ihn nach Europa. Daraus wurde Schießpulver gemacht für ihre Gewehre. Damit haben sie sich gegenseitig tot geschossen.‹
›Wo steht dein Haus?‹
›Ich hatte kein Haus. Ich lebte mit meinen Kameraden in einer langen Baracke. Aber die ist vor einigen Jahren eingestürzt.‹
›Wo gehen wir hin?‹
›Ich hab dir gesagt, ich will hier meine alten Freunde besuchen, einmal jedes Jahr.‹