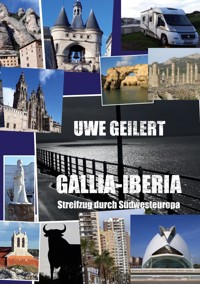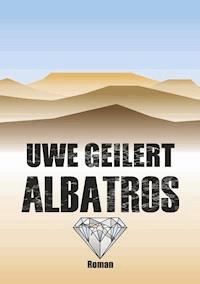Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Valencia, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Süden des Königreiches Aragón, 1747 post Christum natum. Doña Estela Ginart y March bestimmt in ihrem beim Notar Guillermo Aparicio hinterlegten Testament die Lieblingsnichte Doña Vicenta Darder de Borja y Ginart zur alleinigen Erbin. Sie hinterlässt ein veritables Vermögen. Außer Vicenta weiß niemand, dass damit erdrückend viel Arbeit verbunden ist. Obwohl ihr bewusst ist, dass eine fordernde Lebensaufgabe vor ihr liegt, tritt sie das Erbe an. Von dessen immensem materiellem Wert geblendet, fühlen sich ihr bürgerlicher Ehemann und die katholische Kirche in der Person des Bischofs von Valencia durch die Erblasserin um ihren Anteil geprellt. Sie schmieden einen listigen Plan. Doña Vicenta gerät in große Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Anlass
Vor über vierzig Jahren stach mir auf einem rastro, einem Trödelmarkt in Spanien, eine Handschrift im Rahmen hinter Glas ins Auge. Die musste ich haben! Die kunstvoll verschnörkelte Signatur allein rechtfertigte den Kaufpreis. Der Bilderrahmen ging den Weg aller Souvenirs dieser Welt in die »Ablage Dachboden«. Vor kurzem tauchte die Schrift wieder auf und wurde aus dem Rahmen genommen. Sie entpuppte sich als ein notarieller Pachtvertrag aus dem Jahr 1758 im damals gebräuchlichen Kastilisch. Wo der Schreiber stärker aufgedrückt und die Eisengallustinte zu großzügig aufgetragen hatte, waren feine Ätzrisse im handgeschöpften Amtspapier entstanden. Behutsam wurde das fragile Dokument in modernes Spanisch übertragen.
Vierzehn Personen werden im Text mit Namen benannt. Sie alle hatten auf die eine oder andere Weise mit der Pachtsache zu tun. Wie standen sie zueinander? Was verband sie, was trennte sie? Welche Schicksale könnten sich hinter dem nüchternen Vertragstext verborgen haben? Solche Fragen beflügeln unabwendbar die Phantasie, oder?
Die Erzählung
Der Ort des Geschehens ist Valencia, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Süden des Königreiches Aragón, wo auch der Pachtvertrag abgeschlossen wurde.
Doña Estela Ginart y March hatte ihr Testament beim Notar Guillermo Aparicio hinterlegt. Sie hatte ihre Lieblingsnichte Doña Vicenta Darder de Borja y Ginart zur alleinigen Erbin eines veritablen Vermögens bestimmt. Außer Vicenta wusste jedoch niemand, dass damit erdrückend viel Arbeit und eine fordernde Lebensaufgabe verbunden waren. Dennoch trat die junge Frau das Erbe an.
Von dessen immensem materiellem Wert geblendet fühlten sich ihr bürgerlicher Ehemann und die katholische Kirche in Person des Bischofs von Valencia durch die Erblasserin um ihre erwartete Teilhabe geprellt. Sie schmiedeten einen listigen Plan.
Doña Vicenta geriet in große Gefahr.
Orte der Handlung
Sämtliche Handlungen, Charaktere und Dialoge in diesem Buch sind rein fiktiv. Ähnlichkeiten zwischen den im Pachtvertrag genannten Personen und den in der Erzählung handelnden Charakteren sind zufällig und völlig unbeabsichtigt. Namen von Personen, Orten und Straßen wurden zum Teil verändert.
Umschlagbild
Francisco Goya, Señora Sabasa García
mit freundlicher Genehmigung:
National Gallery of Art
Washington
Meiner Frau Ute ein großes Danke für ihre unermüdliche Mitwirkung bei Recherchen in Valencia und bei der Gestaltung des Manuskripts.
Es schien, als wären alle Bewohner Valencias auf den Beinen. Die Plaza de la Virgen war voll mit Menschen. Von der Calle Navellos bis zum Apostelportal am Nordende der Kathedrale hatten sie für die heranrollenden Kutschen eine enge Gasse freigelassen. Die eleganten, gefederten Kaleschen fuhren mit offenem Verdeck. Ihre weinrote, grüne oder dunkelblaue Lackierung glänzte in der Sonne des jungen Morgens. Hoch auf den Böcken saßen Kutscher mit flachen Zylindern in grauer Livree, deren einreihige Röcke mit sechs blanken Knöpfen vorn und vier hinten verziert waren. In der linken Hand führten sie das Zaumzeug aus geschmeidigem schwarzem Leder, in der rechten die Bogenpeitsche. An den viereckigen polierten Messingleuchten fächelten Streifen von Trauerflor sanft im Fahrtwind. In den lackierten Speichen der Räder tanzten flinke Reflexe des Sonnenlichts. Bunte Familienwappen prangten auf den elegant geschwungenen Türen der Karossen. Die Farbenpracht der Gespanne wurde durch das Schwarz der Trauergäste noch unterstrichen.
Die Menge auf dem Platz begaffte die hohen Herrschaften, die wie durch ein Spalier an ihr vorbeiglitten. Das Getrappel der Hufe echote von den Häuserwänden und vereinte sich mit dem Geläut der Glocken, dem Plätschern des Neptunbrunnens und dem Getuschel aus tausenden von Mündern zu einer kakophonischen Klangmischung, die über dem Platz waberte. Die Glocken riefen zur Totenmesse für Doña Estela Ginart y March, die vor drei Tagen nach vierundsiebzig ausgefüllten Lebensjahren entschlafen war.
Vor den Stufen zum Portal halfen die vornehmen Herren den Damen mit den schwarzen, kunstvoll gestickten Mantillas auf den Köpfen und den abánicos in den Händen galant beim Aussteigen. Ihre Mienen waren ernst. Paarweise traten sie durch die wuchtige, weit geöffnete Eichenholztür ins Dunkel des Gotteshauses.
Das Bogenfeld über der Tür wurde durch ein Tympanon aus Sandstein mit einer Steinmetzarbeit der sieben Heiligen ausgefüllt. Auf den beiden Seiten der gotischen Staffelbögen breitete sich eine filigrane Galerie mit den zwölf Aposteln aus. In der Fassade darüber leuchtete die riesige Rosette aus hellem Sandstein mit dem Symbol des Davidssterns, die in einem flachen Sims endete.
Gut zwanzig Fuß neben dem Portal stand Guillermo Aparicio zwischen den Schaulustigen. Entspannt lehnte er an einem Pfeiler der dreistöckigen Säulenarkade, einem Überrest des römischen Tempels, der hier gestanden hatte. An ihm mussten alle ganz nah vorbei, um in das Gotteshaus zu gelangen. Aparicio war Anwalt, und seine Klientel bestand aus den Reichen und Mächtigen, die sich seine Dienste leisten konnten. Es war die Gelegenheit, dem einen oder anderen sein Gesicht in Erinnerung zu rufen. Dies war der erste Grund für sein Kommen.
Der zweite Grund war, sich darüber zu informieren, wer zum Kreis der geladenen Gäste gehörte und wer nicht. Wer war etwa in Ungnade gefallen? Wer war in den Kreis der Notabeln aufgerückt? Unbemerkt notierte er Namen für seine Kartei möglicher Mandanten. Die Wappen an den Karossen zeigten ihm an, aus welcher Region sie stammten und zu welcher Familie sie gehörten.
Der dritte Grund, der ihn aus der Kanzlei hierher gelockt hatte, war das seltene Schauspiel, den gesamten Hochadel des Königreichs Aragón so vollzählig und so einträchtig versammelt betrachten zu können. Er gestand sich ein, ein wenig Neugier war schon auch dabei.
Sein vierter Grund war, sich von Doña Estela auf seine Weise zu verabschieden. Er war zuvor geschickt in die Kathedrale geschlüpft und hatte am Altar vor dem Sarg kniend ein kurzes Gebet gesprochen. Sie war seine Mandantin gewesen, und er hatte seinen Vorsatz in die Tat umgesetzt, ihr für die vielen Jahre einträglicher Dienstleistungen ein Dankgebet zu sprechen.
Doña Estela war nicht irgendeine ältere Dame. Sie stammte aus dem berühmt-berüchtigten katalanischen Geschlecht der Borja, das sich über die Stadtgrenze hinaus einen Namen gemacht hatte. Das bewiesen nicht zuletzt die zahlreichen adligen Trauergäste, die aus allen Ecken und Winkeln Aragóns angereist waren, um ihren Respekt zu bezeugen, bei der heiligen Messe gesehen zu werden, alte Kontakte aufzufrischen, im Anschluss an die Trauerfeier das eine oder andere Geschäft zu erledigen, oder sie wollten sich einfach wieder einmal dem Volk zeigen. Sie verbanden das Notwendige mit dem Nützlichen.
Die reinste Form der Trauer zeigten die einfachen Leute, deren Schicksal die Verstorbene mit wohltätiger Hilfe zu lindern versucht hatte. Ihr Gatte Luis Ignacio de Borja Aragón y Castelles, Graf von Gandia, war vor sieben Jahren verstorben und hatte ein gigantisches Vermögen hinterlassen, das sie geschickt anzulegen verstand. Aus den Erträgen hatte sie mildtätige Projekte zu Gunsten von Behinderten, Blinden, Leprösen und Armen finanziert. In deren Kummer über den Tod ihrer Wohltäterin mischte sich jetzt die bange Frage, wie es wohl weitergehen würde. Würden die Erben Doña Estelas die gewohnte Fürsorge im gleichen Sinne, und vor allem mit ähnlichen Beträgen und derselben Hingabe fortführen? Wer würde das große und schwierige Erbe antreten? Nichts war bisher verlautbart worden.
Nur die nächsten Angehörigen waren darüber informiert, dass Doña Estela ihren letzten Willen durch Guillermo Aparicio hatte verfassen und in seiner Kanzlei hinterlegen lassen. Jetzt, nach ihrem Tod, kannte nur noch er dessen Inhalt. Und er wusste, dass sie es wussten. Auf dem kurzen Weg von ihren Kutschen zum Portal mussten sie ihn entdecken, kaum vier Schritte weit weg. Er erwiderte ihre Blicke ruhig und konzentriert, er versuchte, in ihren Gesichtern zu lesen. Einige grüßten verhalten, der Traurigkeit des Anlasses angemessen, andere sahen ohne Regung zu ihm herüber. Alle sahen der Einladung zur Testamentseröffnung ungeduldig entgegen, obwohl sie wussten, dass die Pietät einen gebotenen zeitlichen Abstand verlangte.
›Das wird eine gewaltige Überraschung geben! Ich kann Eure langen Gesichter erahnen. Doña Estela werdet Ihr nicht vergessen. In Euren Köpfen wird sie weiterleben. Die meisten von Euch werden nicht erfreut sein und lange an sie denken. Eigentlich alle. Das hat die alte Dame maliziös eingefädelt.‹
Durch die Ankunft der nächsten Kutsche wurde Aparicio jäh aus seinen Gedanken gerissen.
›Das muss Doña Vicenta sein, Estelas Nichte! Die Erbin.‹
Eine junge, schöne Frau schritt vorbei, ihre feuchten Augen auf den Boden gerichtet, sorgsam auf jeden Schritt achtend. Sie war die einzige unter den Trauergästen, die ehrlichen Kummer zu empfinden schien. Sie trug nicht den einstudierten Gesichtsausdruck der an die Öffentlichkeit gewöhnten Zelebritäten zur Schau. Ihr Ehemann stützte sanft ihren Arm. Aparicio kannte sie nur aus den Verhandlungen mit Doña Estela, er war ihr bisher nicht persönlich vorgestellt worden. Er warf einen prüfenden Blick auf das Wappen an ihrer Kutsche.
›In der Tat. Sie ist es. Welche Perle zwischen all diesen Kieseln! Doña Vicenta Darder de Borja y Ginart. Ich kann kaum erwarten, sie kennenzulernen.‹
Aparicio erinnerte sich an den letzten Termin mit Doña Estela vor einem knappen Jahr. Das Testament war unterzeichnet und durch Antonio Sequer y Pertusa, einen Notarkollegen, beglaubigt worden. Sie hatte darauf bestanden, ihn persönlich in der Kanzlei zu besuchen, um dort die Beurkundung zu prüfen.
»Das ist das letzte Mal, dass ich Ihre verdammten Treppen hinauf- und wieder hinunterkraxeln muss«, hatte sie grienend gestöhnt.
»Gut, dass Lastenia mich begleitet, meine kräftige Zofe. Ein jeder Besuch bei Ihnen fällt mir schwerer. Mein Kopf sagt mir, dass der Körper nachlässt. Ich frage mich manchmal, was besser ist. Wenn es im Kopf neblig wird, bekommt man die schwindende Physis nicht mehr mit. Ist man klar im Kopf, wird einem das stete Nachlassen des Körpers immer deutlicher. Doch mein Haus ist nun geordnet. Ich kann gelassen darauf warten, dass ER mich zu sich ruft.«
Dabei hatte sie mit dem Zeigefinger nach oben gedeutet
»Demnächst plane ich die Trauerfeier in der Kathedrale. Alles muss durchdacht sein. Das wird ein gesellschaftliches Ereignis, sage ich Ihnen. Ich werde Sie auf die Liste der Trauergäste setzen, und ich werde durch die Wände meiner Kiste sehr genau beobachten, ob Ihre Tränen echt sind, mein lieber Aparicio.«
Er war erschrocken. Nein, nicht das! Er wollte auf gar keinen Fall am Requiem teilnehmen! Mit Mühe überzeugte er sie, ihn nicht auf die Liste zu setzen.
»Hoheit, meine Arbeit für Euch ist rein professioneller Natur. Niemand aus dem Kreis Eurer Angehörigen soll einen abweichenden Eindruck bekommen, besonders mit Blick auf die minimale Zahl der Begünstigten. Es wird Gerede geben. Ich will vermeiden, dass man mir etwas unterstellt. Außerdem, vergesst bitte nicht, mein Vater war einfacher, rechtschaffener Buchhalter, er zählte noch nicht einmal zum untersten Adel …«
»Wollen Sie andeuten, dass Adel nicht rechtschaffen ist?«
»Um Himmels willen, nein. Ihr seid das beste Beispiel. Es ist nur, dass ich mir unter all den Erlauchten deplatziert vorkommen würde. Ich verspreche Euch, ich werde mich in geziemender Form von Euch verabschieden. Dazu brauche ich weder Weihrauch noch bischöflichen Segen. Und meine Tränen, Hoheit, die werden echt sein. Ihr wisst um die Wirkung gemahlenen Pfeffers. Er vollbringt Wunder.«
Sie mochte seine entwaffnende, scherzhafte Offenheit und nahm die Bemerkung mit einem Lächeln zur Kenntnis.
»Gut, mein treuer Aparicio. Dann machen wir das eben so. Aber setzen Sie den Pfeffer nicht auch noch auf die Rechnung!«
Er hatte sie danach nicht wieder getroffen.
Der helle Sandstein der Kathedrale leuchtete in der Maisonne. In den Duft der verschiedenen Parfums mischte sich, langsam strenger werdend, der Ammoniakgeruch von frischem Pferdemist. Aparicio steckte seinen Block mit den Notizen in die Tasche. Die letzte Kutsche war inzwischen vorgefahren. Allmählich kam das Geläut zur Ruhe. Die Menge zerstreute sich, die Menschen gingen nun wieder ihrem gewohnten Tagwerk nach. Die schwere Eichentür wurde geschlossen. Aparicio verließ seinen Standplatz, ging am Seitenschiff entlang in Richtung des achteckigen Glockenturms, den die Valencianer liebevoll El Miguelete nannten. Sein Grundriss erinnerte an das Minarett, das die Mauren nach dem Sieg über die Westgoten beim Bau ihrer Moschee auf die römischen Fundamente aufgesetzt hatten.
Miguel Mayoral Alonso de Ponce war nun schon neun Jahre der Bischof von Valencia, der südlichsten Provinz Aragóns, und die Hauptstadt Zaragoza war weit weg. In seiner bisherigen Amtszeit hatte er eine solch exklusive Totenmesse noch nicht erlebt. Als er die Liste der Trauergäste studierte, wurde ihm deutlich, dass der gesamte Hochadel und viele Würdenträger anwesend sein würden.
›Die Crème Aragóns wohnt dem Requiem bei. Sie verbeugt sich vor der toten Doña Estela und geht wieder. Welch Aufwand! Für eine Stunde habe ich sie alle in meiner Kathedrale. Was für eine einmalige Gelegenheit. Die Totenmesse läuft nach einem festen Schema ab, in der ich keine Rolle habe. Die wickeln meine Priester ab. Schade um die verlorene Chance, mich bei den Honoratioren Aragóns in Erinnerung zu bringen. Denn der Stuhl des Erzbischofs von Zaragoza ist vakant, und bisher wurde kein Kandidat benannt. Ich sollte diesen Augenblick nutzen, schlussendlich winkten das Kardinalspurpur, der Titel Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis und die Anrede Eminenz.‹
Er beschloss, die Folge des Requiems abzuändern und eine Wortpredigt einzufügen, die er zweifelsohne selbst halten würde. Seine Selbsteinschätzung sagte ihm, dass es keinen besser geeigneten Kandidaten für den begehrten Posten gäbe als ihn. Nach der Predigt sollten es alle Anwesenden begriffen haben.
Die Zeit drängte, denn er hatte nicht mehr als zwei Tage, um an seinem Manuskript zu feilen. Am Vorbild der Verstorbenen wollte er der Trauergemeinde ihre mildtätigen Pflichten ins Bewusstsein rufen. Er nahm sich vor, Doña Estelas Edelmut den Schwachen, Armen und Kranken gegenüber in den höchsten Tönen zu preisen, nicht ohne die fürsorglich segnende und klug lenkende Hand des Bistums und auch seinen persönlichen Einfluss in möglichst positivem Licht erscheinen zu lassen.
Er würde geschickt verschweigen, dass Doña Estela Ginart y March zu ihm ein Verhältnis tiefer Abneigung gepflegt hatte. Wieder und wieder hatte sie ihm zu verstehen gegeben, dass sie ihn für ihre uneigennützige Tätigkeit so wenig duldete wie ein cimarrón, ein wilder Hengst, einen Reiter auf dem Rücken. Sie hatte ihn gehasst, und er wusste, warum. Insgeheim war er erleichtert, dass Doña Estela ihr delikates Wissen mit ins Grab genommen hatte. Es wäre seiner steilen Karriere alles Andere als nützlich gewesen. Nun gab es nur noch zwei Menschen, die seine Ziele durchkreuzen könnten. Diesem Problem wollte er sich später widmen. Jetzt galt es, die geeigneten Formulierungen für seine Ansprache zu finden.
Er kannte die Ängste seiner Schäfchen zum Fortbestand Doña Estelas wohltätiger Projekte, und als Hirte teilte er ihre Befürchtungen. Eine Reduzierung oder gar der komplette Wegfall der finanziellen Unterstützung wäre eine Katastrophe. Sein Bistum verfügte weder über die Mittel noch über das Organisationstalent der Verstorbenen. Doña Estela hinterließ ein Vakuum, das gefüllt werden musste, sollten all die Vorhaben nicht im Laufe der Zeit in sich zusammenfallen oder im Sande versickern. Das musste auf jeden Fall verhindert werden.
›Meine Worte müssen sich an die Erben richten. Aber wer sind die? Sie sitzen verstreut in der Gemeinde, vielleicht sogar ohne es zu wissen. Hat sie ihr Testament vollendet? Was beinhaltet es? Wann wird es eröffnet? Fragen über Fragen. Ich muss allgemein bleiben. Doch Halt! Da ist noch diese Nichte, die Doña Estela in den letzten Jahren zur Seite stand, Vicenta, die ich vor Jahren als Kind im Internat unterrichtete. Würde sie die Aufgaben ihrer Tante übernehmen? Doch zuerst brauche ich Klarheit über die Bestimmungen des Testaments. Zu gegebener Zeit werde ich ihren Ehemann auf die Seite nehmen.‹
Bevor es eröffnet war, wollte er weder mutmaßen, noch seine Sorgen in der Predigt erwähnen. Er wollte auf keinen Fall negative Töne einfließen lassen!
Langsam formte sich der Text.
Doña Vicenta hatte sich an das Halbdunkel des Gotteshauses gewöhnt und sich flink die Tränen abgetupft. Am Arm ihres Gatten schritt sie den Mittelgang hinab zur ersten Reihe, deutete einen Knicks an, schlug das Kreuzeszeichen und nahm ihren Platz ein. Sie konnte die Blicke im Nacken spüren, hörte das Flüstern der adligen Damen in den Reihen hinter ihr, aber sie verstand die getuschelten Worte nicht.
Seit dem Konzil von Trient im Jahre 1545 war der genaue Ablauf der Totenmesse festgelegt, dem die Kirche Aragóns weitgehend folgte. Zum Introitus wurde das Requiem aeternam dona eis gesungen und in der Graduale von der Gemeinde wiederholt. Das Halleluja war durch den Tractus mit dem Absolve domine ersetzt worden. Zum Beginn des nun folgenden Offertoriums wurden der Wein und das Brot zum Altar gebracht. Doch anstatt mit der üblichen Gabenbereitung fortzufahren, betrat nun Bischof Miguel Mayoral Alonso de Ponce die Kanzel. Der Bischof persönlich! Das hatte es bisher noch nicht gegeben. Ein fast unhörbares, erstauntes Raunen ging durch die Trauergemeinde.
In gesetzten Worten ermahnte der Bischof die Trauernden an die hehre Pflicht der christlichen Nächstenliebe, die Doña Estela in so vorbildlicher Weise erfüllt hatte, wofür sie am Jüngsten Tag gewiss mit einem Platz zur Seite des Herrn werde rechnen dürfen. Sie sei ein Vorbild gewesen. Bei diesen Worten suchte er den Blickkontakt zu Doña Vicenta.
Vicenta spürte die Blicke des Bischofs auf sich gerichtet, doch sie sah nicht zur Kanzel hinauf. Sie wollte ihm jetzt nicht ins Gesicht schauen. Sie mochte ihn schon lange nicht mehr. Als sie später Phelipe heiratete, hatte sie sich gewehrt, gerade von ihm die Ehesakramente empfangen zu müssen. Irgendein Priester wäre ihr lieber gewesen. Doch die Familie hatte darauf bestanden, und sie hatte sich gefügt.
Ihre Augen wanderten jetzt vom Sarg, den Blumengebinden und Kandelabern zu den sechs großen Ölgemälden über dem Altar. Sie blickte scheinbar durch sie hindurch auf einen imaginären Punkt im Unendlichen. Sie hörte die anerkennenden Worte des bischöflichen Nachrufs nicht. In ihrem Kopf liefen die erfüllten Jahre mit ihrer Tante Doña Estela ab, die Besuche in Armenhäusern und Hospitälern, die sie am Anfang erschreckt hatten, der Anblick von unheilbar Kranken, vor allem der Leprösen, der bei ihr Ekel aufkommen ließ. Estelas Mitleid war echt gewesen, aber es hatte ihren klaren Blick nicht verstellt. Sie packte an. Sie wollte etwas bewegen. Vicenta hatte den unbeugsamen Optimismus ihrer Tante bewundert, ihre sorgfältige Planung und ihre Fähigkeit, mit kleinem Einsatz große Wirkung zu erzielen. Estela war eine Rarität in der spanischen Oberschicht. Jetzt, wo sie tot war, spürte Vicenta Beklommenheit.
›Wird die Familie jetzt von mir erwarten, die riesige Lücke zu füllen, die Doña Estelas Tod gerissen hatte? Sie war so souverän in allem, was sie tat. Ich bin noch lange nicht so weit. Ich würde Jahre brauchen, um Tante Estela auch nur annähernd das Wasser reichen zu können.‹
Estela hatte ihrer Nichte die Augen geöffnet, hatte sie aus dem Kokon ihrer behüteten Welt hinausgeführt in die Realität des harten Lebens der gemeinen Leute. Vicenta musste entdecken, dass jenes Universum größer war als der kleine Kosmos ihres Daseins im Bannkreis von Großfamilie, Kirche und ihrer Ehe mit Phelipe. Sie war stets eine aufmerksame, wissensdurstige Schülerin ihrer Tante gewesen. Die Einzige aus der weit verzweigten Sippe.
Sie konnte mit ihrer Tante über alles reden. Bis auf dieses eine Thema: Ihre Ehe. Doña Estela hatte weder Verständnis für Vicentas Wahl ihres Ehemanns, noch dafür, dass ihre Eltern das zugelassen hatten, ja, sogar unterstützten. Phelipe sah zwar sehr gut aus, war sportlich und konnte hervorragend reiten und fechten, aber musste es ein Bürgerlicher sein? Ohne klangvollen Namen? Das hatte ihr großes Unbehagen bereitet. Vicentas Eltern kannten ihre Tochter kaum. Sie befanden sich fast das ganze Jahr in Madrid am Hofe des spanischen Königs. Fast war es Estela erschienen, als wären sie erleichtert, Vicenta endlich unter der Haube zu haben.
Phelipes Familie hatte im Handel mit der Neuen Welt viel Geld verdient, aber es war junges Geld, das sich erfahrungsgemäß genauso geschwind verflüchtigen konnte, wie es erworben worden war. Hinter ihrem Vermögen standen nicht die Sicherheiten von Landbesitz und Titeln, nicht der Schutz einer verzweigten Sippe mit Beziehungen zum königlichen Hof und zum Klerus. Der Auserwählte war in Estelas Augen ein Neureicher, ein Emporkömmling, ein Niemand.
›Man kann sich eine Frau kaufen, auch einen falschen Titel, aber nicht Adel. Gott sei gepriesen, dass er dir noch keinen kleinen Bastard eingepflanzt hat‹, hatte Doña Estela boshaft bemerkt.
Allmählich hielt ihn Vicentas Familie auch noch für impotent, weil sich nach sechs Jahren Ehe keine Schwangerschaft ankündigte. Sie hasste die mitleidigen Blicke ihrer Familie und die neugierigen Fragen ihrer Freundinnen.
Während sie die Liturgie automatisch verfolgte, betete sie um Erhörung ihres sehnlichsten Wunsches. Ein Kind würde ihre Familie dazu bewegen, Don Phelipe endlich als ein vollwertiges Mitglied zu akzeptieren. Doch dann meldete sich arglistig ihr Verstand. Für eine Schwangerschaft bedurfte es der fleischlichen Leidenschaft. Damit hatte sie seit ihrer Schulzeit ein Problem, sie schien ihr schmutzig und lüstern. Aber auch Phelipes Verlangen war mit den Jahren merklich abgeklungen. Er kam immer häufiger spät nach Hause oder nächtigte bei Freunden, wie er sagte.
Tief in Gedanken und eingelullt vom Widerhall der Stimme des Bischofs im hohen Kirchenschiff und vom betörenden Aroma des Weihrauchs hatte sie vom Sinn der Predigt nichts mitbekommen und ihr Ende verpasst. Erst als die Stimme verstummte und der Bischof von der Kanzel gestiegen war, schenkte sie dem Requiem wieder ihre Aufmerksamkeit. Jetzt folgten die Gabenbereitung, das Lavabo und das Gabengebet. Im Anschluss wurde die Kollekte gesammelt. Die Communio beendete die Messe. Langsam leerte sich die Kathedrale, die Trauergäste bestiegen ihre Kutschen und gingen ihren Geschäften nach.
Ein Hilfspriester hatte bekanntgegeben, dass Beisetzung und Aussegnung von Doña Estelas Leichnam im Mausoleum der Familie ausschließlich einem strikt festgelegten engen Kreis der Familie ohne Öffentlichkeit vorbehalten war. So hatte es die Verstorbene bestimmt. Doña Vicenta gehörte dazu, Don Phelipe nicht.
Don Phelipe war außer sich vor verletztem Stolz. Drei Tage und Nächte blieb er dem Stadtpalais fern, das die Familie seiner Frau und ihm am Ufer des Turia zur Verfügung gestellt hatte. Am vierten Tag fuhr er wieder vor. Es war früher Abend. Der Stallbursche hörte das Geräusch der Hufe auf der gepflasterten Einfahrt unter den hohen Palmen und kümmerte sich um Kutsche und Pferd. Der Mayordomo kam aus dem Haus, grüßte ehrerbietig und nahm seinem Herrn Hut und Mantel ab. Don Phelipe bestellte beim Küchenmädchen einen Tee und setzte sich in den kühlen, dämmrigen Salon. Die geschlossenen Jalousien hatten die Hitze des Tages ferngehalten. Doña Vicenta hatte die Kutsche aus der oberen Etage vorfahren sehen und schritt die Treppe herunter.
»Schön, dich wiederzusehen. Wo warst du?«
»Bei Kunden auf dem Land.«
Vicenta wartete, bis das Mädchen den Tee abgestellt hatte und hinausgegangen war.
»Bitte lüg mich nicht an! In dieser Kalesche bist du noch nie überland gefahren. Du nimmst stets die größere Kutsche. Hast du kein Gepäck? Und an der Kalesche ist kein Staub wie von einer langen Fahrt über Landstraßen und Wege.«
»Mein Bursche hat sie geputzt.«
Er sagte es wenig überzeugend und sah sie abwartend an. Sie wusste, dass es gelogen war.
»Du bist in der Stadt gesehen worden.«
»Wer sagt das?«
»Die Leute reden.«
»Die Leute reden immer. Und sie haben allen Grund dazu. Dass ihr mich von der Beisetzung deiner Tante ausgeschlossen habt, ist mehr als nur ein Affront, ich empfinde es als Beleidigung. Was ich mir alles anhören musste …«
»Du Armer!« Vicenta spöttelte und wurde wieder sachlich.
»Es war Doña Estelas Wille, den haben wir zu respektieren. Die Leute geht es doch gar nichts an, es ist eine Angelegenheit der Familie. Gescheite Menschen verstehen das und geben keine unpassenden Bemerkungen ab.«
»Ihr lasst also zu, dass sie mir aus dem Sarg heraus noch eine Ohrfeige gibt? Wofür? Ich habe ihr nichts getan. Dass sie mich nicht mochte, beruht auf Gegenseitigkeit. Aber das ist kein Grund, mich auch noch öffentlich zu demütigen. Ihr hättet ihren Wunsch, sagen wir … übersehen können. Nun haben wir das Gerede der Leute, und ich stehe da wie ein cojón.«
»Du warst in Begleitung einer … Dame.«
Phelipe sah seine Frau an.
»Wer behauptet das?«
»Die Leute.«
»Sag mir den Namen.«
»Den der Dame?«
»Nein, von wem du das hast.«
»Und wenn ich dir den Namen nennen würde, würdest du dich wegen einer Kurtisane duellieren? Das wäre denkbar unangemessen, denn offenbar ist sie in deinen Kreisen einschlägig bekannt.«
»Wie schön du das sagst, ›in deinen Kreisen‹. Hast du jetzt die Absicht, mir wieder einmal deinen Adelsnamen um die Ohren zu schlagen?«
»Nicht im Geringsten. Immerhin hat meine Familie dir den Titel eines Chafreon y Dassi verschafft. Also verhalte dich auch so und nicht wie ein Amoros, der du einmal warst.«
»Deine Mutter hat in diese Sippe eingeheiratet, also bist du keine echte Borja. Und was sich einige eurer Angehörigen unter dem Namen Borgia in Italien geleistet haben, ist kein Ruhmesblatt.«
»Bleibe bitte sachlich, Phelipe. Ich bin eine Ginart, ich heiße nur Borja. Du weißt sehr genau, dass wir es in Sachen Bildung und Kultur mit den Borjas mehr als aufnehmen können. Wir sind wohl weniger machthungrig, aber dafür umso angesehener. Was deinen Vergleich mit Papst Alexander VI. betrifft, Rodrigo war ein echter Borja, weiß Gott, wenngleich aus einer katalanischen Nebenlinie.«
»Aha, ein Katalane zweiter Klasse? Umso mehr musste er sich in Rom profilieren, nicht wahr? Willst du Euch in Schutz nehmen?«
»Geschichte nimmt niemanden in Schutz. Wie lange ist das her? Er ging im August 1492 als Sieger aus dem Konklave hervor. Eine Woche zuvor hatte Columbus für seine Reise über den Atlantik Segel gesetzt. Über zweihundertfünfzig Jahre. Phelipe, du wärmst nur alte Geschichten auf! Du bist doch sonst nicht so rückwärts gewandt. Wir leben in einer neuen Zeit, und wir leben in Spanien. Keiner kann sich heute noch hinter den früheren Verfehlungen von Papst Alexander VI. verstecken. Immerhin hat er mindestens drei Kinder gezeugt.«
»Daher weht der Wind! Du machst mir zum Vorwurf, dass wir keine Kinder haben? Vielleicht bist du der Grund.«
»Woher willst du wissen, dass es an mir liegt? Wenn du andere Frauen bevorzugst, ist die Sache klar. Du bist es, der seine Pflichten nicht erfüllt. Und noch etwas: Du solltest deine Eskapaden mit einem pietätvolleren Abstand zum Tod Estelas ausleben. Was du tust, ist einfach geschmacklos. Warum bist du nicht konsequent und ziehst zu ihr? Aber nein, das würde sie nicht wollen. Sie hat schließlich noch andere ›Kunden‹. Du würdest sie nur stören.«
»Von wem redest du eigentlich?«
»Phelipe, ich rede von dir und dieser Dame. Ich kenne ihren Namen. Sie hat dunkelrotes Haar.«
Sie vermied, den Namen zu nennen.
»Spionierst du mir nach?«
»Um Himmels Willen! Das ist gar nicht nötig. Du benimmst dich so plump und unvorsichtig, dass es jeder sieht, der Augen im Kopf hat. Ich kenne zu viele Leute, die mich vor dem plötzlichen Erwachen schützen wollen ...«
»… um ihren Vorteil daraus zu ziehen.«
»Möglich.«
»Hast du einen Verehrer?«
»Spiel jetzt nicht den eifersüchtigen Ehemann! Mache dich nicht lächerlich. Verehrer? Einen? Viele! Aber keinen Liebhaber, wenn du das fragen wolltest. Ich kann mich gut beherrschen, ich mache mich, … uns, nicht zum Gespött der Leute, die doch nur darauf warten, mir etwas nachreden zu können. Aber du hast es in Windeseile geschafft, mein Bester. Felicitaciones! Chapeau!«
Sie machte eine ironische Verbeugung.
»Du solltest dir eine Stadtwohnung kaufen. Zeige Format, Don Phelipe Chafreon y Dassi! Diszipliniert gehen wir unseren offiziellen und gesellschaftlichen Verpflichtungen unverändert nach, nur teilen wir das Bett nicht mehr. Es gibt genügend andere, die das ebenso handhaben.«
Sie erhob sich. Auf dem Weg zur Küche fragte sie Phelipe über die Schulter: »Soll ich jetzt das Abendessen auftragen lassen? Belieben der Herr mit mir zu speisen?«