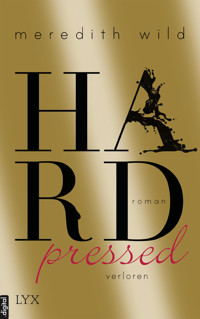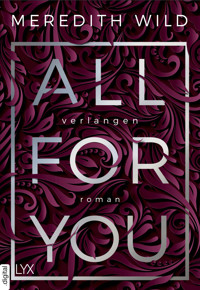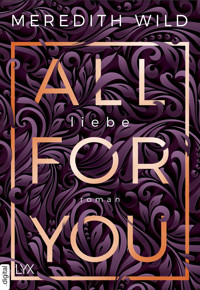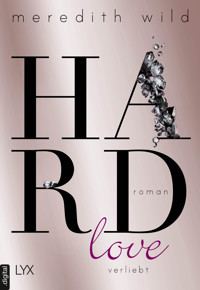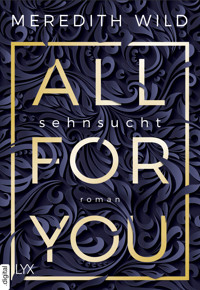
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bridge Reihe
- Sprache: Deutsch
Du bist alles für mich - das Gute, das Schlechte und jeder einzelne Augenblick dazwischen
Als Maya Jacobs und Cameron Bridge sich nach fünf Jahren zum ersten Mal wieder begegnen, ist es, als ob die Welt um sie herum zum Stillstand kommt. Damals waren sie ein Paar gewesen, verliebt und so glücklich. Aber als Cameron um Mayas Hand anhielt, musste sie die schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen - und Nein sagen. Als sie sich jetzt erneut gegenüberstehen, sind die Gefühle von damals augenblicklich wieder da. Und auch die Leidenschaft. Doch kann es für ihre Liebe eine zweite Chance geben, wenn ihre gemeinsame Vergangenheit so voller Schmerz ist?
Nach HARD - die neue Reihe von Spiegel-Bestseller-Autorin Meredith Wild!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. KapitelEpilogDanksagungDie AutorinMeredith Wild bei LYXImpressumMEREDITH WILD
All for You
Sehnsucht
Roman
Ins Deutsche übertragen von von Stefanie Zeller
Zu diesem Buch
Maya Jacobs’ Welt kommt zum Stillstand, als sie Cameron Bridge zum ersten Mal seit fünf Jahren gegenübersteht. Damals waren die beiden ein Paar, hatten sich gebraucht wie die Luft zum Atmen. Doch auch wenn Cameron ihr alles bedeutete, gab es etwas, das Maya nicht mit ihm teilen konnte, etwas, das sie vor ihm und dem Rest der Welt geheim hielt – und das sie dazu zwang, die schwerste und schmerzhafteste Entscheidung ihres Lebens zu treffen: Denn als Cameron um ihre Hand anhielt, hatte sie keine andere Wahl, als Nein zu sagen – und ihrer beiden Herzen zu brechen. Von Männern hält Maya sich seither fern. Sie ist nach New York gezogen, wo sie niemanden kennt, und wenn sie nicht arbeitet, feiert sie zu lang und zu viel, alles, um die Leere in ihrem Innern wenigstens ein bisschen zu verdrängen. Doch jetzt ist Cameron plötzlich wieder in ihrem Leben, und innerhalb eines Sekundenbruchteils sind die Gefühle von damals wieder da. Und auch die Sehnsucht. Noch immer schafft er es, ihr mit einem einzigen Blick den Atem zu rauben. Aber kann es für ihre Liebe eine zweite Chance geben, wenn ihre gemeinsame Vergangenheit so schmerzhaft ist – und Mayas Geheimnis nach wie vor zwischen ihnen steht?
Für alle Kämpfernaturen
Prolog
Ich brauchte seine Liebe wie die Luft zum Atmen, aber das wurde mir erst bewusst, als er fort war. Von da an bestanden meine Tage bloß noch aus Zeit, die es herumzubringen galt. Nur erträglich, weil jeder vergangene Moment uns einem Wiedersehen näherbrachte.
Ich warf einen Blick auf die Uhr, den einzigen Gegenstand von Interesse in einem ansonsten tristen Zimmer, das ich mit meiner nun abwesenden Mitbewohnerin teilte. Das Licht des späten Nachmittags fiel durch die Erkerfenster. Sie waren der Blickfang dieses Raums, doch auf dem alten Campus gab es zig Häuser wie das, in dem ich wohnte, und Räume wie diesen. Schon seit Jahrzehnten, im Grunde sogar seit Jahrhunderten, beherbergten sie die Sprösslinge der Elite Neuenglands.
Seit einigen Tagen war das Unigelände wie leer gefegt. Ein seltsames Gefühl. Ich hatte keine Seminare mehr und überall, wo sonst reges Treiben herrschte, war es nun ungewöhnlich ruhig. Das machte das Warten auf Cameron fast unerträglich. Ich vermisste ihn ganz schrecklich. Und heute, ohne jede Aufgabe oder Ablenkung, war es am schlimmsten.
Ich sehnte mich so sehr nach ihm, dass ich die Minuten herunterzählte, bis er wieder bei mir war. Doch die Träumereien davon, wie ich in seinen Armen versank, wurden immer wieder überschattet von Unruhe und Unsicherheit, weil ich länger nichts von ihm gehört hatte. Womöglich waren seine Gefühle für mich nach all der Zeit nicht mehr dieselben? Ich hatte gehört, dass die Grundausbildung die Menschen veränderte. Eine Handvoll Briefe, ein paar kurze Anrufe, mehr hatte ich nicht als Beweis, dass er immer noch der alte Cameron war.
Immer wenn diese Sorge drohte übermächtig zu werden, hielt ich mir vor Augen, dass ich die erste und einzige Person war, die er in seinem Urlaub von der Armee sehen wollte. Seitdem hielt ich mich an meinen Erinnerungen fest, wenn die Angst, ihn zu verlieren, zu groß wurde. Ich betete darum, dass uns noch genug verband, dass uns genug gemeinsame Zeit vergönnt war, um auch die Wochen der Trennung, die uns noch bevorstanden, zu überstehen.
Ich schrak zusammen, als es plötzlich klopfte. Das konnte nur er sein. Ich blickte erneut auf die Uhr. Er war früh dran. Darauf war ich nicht eingestellt. Ich erhob mich vom Bett und warf das Buch zur Seite. Mein Herz schlug schneller, als ich mein weißes Sommerkleid richtete, das einzige halbwegs annehmbare Kleid, das ich besaß. Dann zog ich mir das Gummi aus dem Pferdeschwanz, sodass mir die Haare offen den Rücken hinunterfielen. So zupfte ich noch weiter an mir herum, bis er ein zweites Mal klopfte. Aufgeregt holte ich tief Luft, bevor ich die Tür öffnete.
Da stand er, so umwerfend, als wäre er nicht von dieser Welt. Ich ließ den Türknauf los und verschränkte die zitternden Finger. Er sah anders aus. Die blauen Augen, die sich jetzt in mich bohrten, waren mir vertraut, doch die Texassonne hatte seine olivfarbene Haut dunkler gemacht. Er schien zehn Kilo leichter zu sein. Die markanten Züge seines Kinns und seiner Wangenknochen waren nun noch schärfer, und sein fast schwarzes Haar war kurz geschoren. Er wirkte älter. Obwohl ich auf äußerliche Veränderungen gefasst gewesen war, dämpfte auf einmal eine irrationale Sorge die Gefühle, die mich bei seinem Anblick überkamen.
Empfand er immer noch genauso für mich? Hatte er sich auch innerlich verändert?
Auf der Suche nach den richtigen Worten öffnete ich schon den Mund, aber da verzogen sich seine Lippen zu einem kleinen Lächeln, das ich erleichtert erwiderte. Er trat ein, ergriff meine unruhigen Hände und strich mit den Daumen über die weißen Knöchel, bis ich mich entspannte. Die Wärme in seinen Augen ließ auch meine letzten Zweifel dahinschmelzen. Ich atmete zittrig aus.
»Komm her«, flüsterte ich, weil ich immer noch Angst hatte, die Stille zu durchbrechen, und schlicht überwältigt war von der Tatsache, dass er mir nun tatsächlich gegenüberstand.
Ich machte einen Schritt zurück und zog ihn herein. Er legte den Arm um meine Taille und drückte mich an sich. Ich schmiegte mich an seine harte Brust. Mein Atem ging schnell, mein ganzer Körper reagierte auf seine Nähe. Sein Blick hielt meinen fest. Als er mir mit dem Daumen über die Lippen strich, schwand sein Lächeln.
»Ich habe dich so vermisst, Maya. Jeden Tag …«
So wie früher umfasste ich seinen Nacken mit einer Hand, und für einen flüchtigen Moment verspürte ich Traurigkeit, weil mir nicht mehr seine langen Locken durch die Finger glitten. Doch das war jetzt unwichtig. Er war hier. Sein Herz, sein warmer Körper, der sich an mich presste. Es fühlte sich an wie ein Traum. Vielleicht hatte ich es mir so lange und so inständig gewünscht, dass es schließlich wahr geworden war. Die Trennung war fast unerträglich gewesen. Ich konnte – wollte – mir nicht vorstellen, wie wir das noch einmal durchstehen sollten.
»Ich kann nicht glauben, dass du wirklich da bist.« Meine Stimme brach.
Beruhigend strich er mit den Fingerspitzen über meine Wangen. Ich atmete vorsichtig aus und wollte ihn küssen, doch bevor meine Lippen auf seine trafen, hielt er mich zurück, indem er sanft mein Gesicht umfasste.
»Ich liebe dich«, flüsterte er. Sein weicher Atem tanzte über meine Lippen.
Mein Herz zog sich zusammen, mit jedem Schlag pulsierte ein bittersüßer Schmerz durch meine Brust. Wir hatten es uns so oft geschrieben, so oft gesagt. Zu oft schon. Doch als er es jetzt erneut laut aussprach, traf mich die Bedeutung dieser Worte mit voller Wucht. Mich überkam der unbändige Drang, ihm zu beweisen, wie sehr auch ich ihn liebte, und ich ging auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Unsere Lippen trafen sich, dann unsere Zungen, erst vorsichtig, dann leidenschaftlicher.
Bis er sich plötzlich von mir losriss. »Maya«, keuchte er.
»Was?« Ich verlor mich in seinen Augen. Ich wollte nicht, dass es endete. Nie hatte ich ihn mehr geliebt. Meine Seele war übervoll mit Gefühlen für diesen Mann.
Er zögerte und schien genauso nach Worten zu suchen wie ich vorhin. Bevor ich nachfragen konnte, zog er mich zu einem weiteren stürmischen Kuss an sich. Ich stöhnte und vergaß alles, als sich unsere Körper aneinanderrieben. Seine Hand glitt meinen Oberschenkel hinunter und wieder hinauf, umfasste meinen Po unter dem dünnen Baumwollstoff des Slips und spielte einen Moment lang mit dem Saum, bevor er ihn mir über die Hüften zog. Er rutschte mir bis zu den Knien hinunter, dann schüttelte ich ihn komplett ab.
Er schob mir die dünnen Träger über die Schultern, und das Kleid fiel zu Boden. Bisher hatte sein Blick meinen nicht losgelassen, doch nun wanderte er über meinen nackten Körper. Meine Haut brannte unter seiner Berührung, als er mir zärtlich über den Arm streichelte, über die Rundung meiner Hüfte und meinen Hintern, um mich dann wieder fest an sich zu pressen.
Ich strich über seinen harten Bauch und konnte es nicht erwarten, alles von ihm zu sehen und zu spüren. Deshalb schob ich sein Shirt hoch, und er zog es aus. Gott, er war wunderschön, noch muskulöser, straffer und schlanker. Ich fuhr mit den Fingern über die Wölbungen seines Abdomens, über seine Brust und die angespannten Muskeln seiner Arme. Ich biss mir auf die Lippen, konnte mein Lächeln aber nicht verbergen.
»Gefällt dir, was du siehst?«
»Du bist wie ein anderer Mensch.« Körperlich zumindest. Er war auch vorher schon sehr durchtrainiert gewesen, aber das hier war die Glasur auf der Torte … mit einer Kirsche obendrauf.
»So anders bin ich gar nicht«, murmelte er.
»Das hoffe ich.« Und ich wollte nichts mehr, als mich selbst davon zu überzeugen. Jetzt, sofort, und so lange wie möglich. Ich drückte ihm einen Kuss auf die Brust und strich mit der Zunge über die harten Muskeln, die sich unter seiner straffen Haut anspannten. Langsam ging ich auf die Knie. Als ich zu ihm aufblickte, machte das Verlangen in seinen Augen mir Mut. Ich öffnete seine Hose und zog sie tiefer, um seine harte Erektion in voller Länge zu befreien, die sich unter seiner Boxershorts deutlich abzeichnete.
Unter dem Baumwollstoff zuckte es. Ich blies meinen heißen Atem darauf und fuhr die Spitze mit der Zunge nach. Doch als ich die Finger in den Bund hakte, sagte er: »Warte.« Seine Stimme klang mühsam beherrscht.
»Ich will dich.«
Er packte mich an den Haaren. »Es ist zu lange her. In deinem Mund halte ich es nicht lange aus. Komm her.«
Er ließ sich neben mir auf den Boden nieder, den Rücken zum Bett, und zog mich rittlings auf sich. Kurz überkam mich Verlegenheit, als ich so nackt mit weit gespreizten Beinen auf ihm saß.
Seine Lippen teilten sich. Sein Blick wanderte über meine Rundungen, gefolgt von seinen Händen. »Mein Gott, Maya. Du bist so schön.«
Meine Wangen wurden heiß. »Das sagst du nur, weil du monatelang hungern musstest und gefoltert wurdest.«
»Nein, das sage ich, weil ich nie etwas Schöneres als dich gesehen habe.« Er lehnte sich vor, nahm mich in die Arme und küsste mich. »Hmm, wie ich diese süßen Lippen vermisst habe.« Dann strich er über meine Rippen hoch zu den Brüsten, drückte sie und zupfte an den empfindlichen Spitzen. »Und die auch.«
Seine Augen verdunkelten sich. Plötzlich spürte ich seine heiße Hand zwischen den Schenkeln. Nur ganz leicht, als wollte er mich auf die Folter spannen, glitten seine Finger durch meine Locken und über meine nassen Schamlippen.
»Und das habe ich auch vermisst«, flüsterte er und leckte sich über die Unterlippe.
Ich schnappte nach Luft, wollte mehr. Ich kam seiner Hand entgegen, bis sich unsere Oberkörper berührten und ich seine Haut an meiner fühlte. Dann schlang ich die Arme um ihn und küsste ihn stürmisch.
»Ich will dich in mir spüren.« Meine Hüften zuckten, eine stumme Bitte an ihn. Brennende Hitze durchströmte mich, meine Lippen kribbelten von unseren drängenden Küssen.
»Mehr.« Ich wollte so viel mehr.
Er fügte einen weiteren Finger hinzu und massierte mich sanft von innen, bis ich immer nachgiebiger wurde. Er rieb die Feuchtigkeit über meine Klitoris, um dann sofort wieder in mich zu gleiten. Flammen der Lust leckten über meine Haut. Seine Bewegungen waren mir zu langsam, meine Hüften beschleunigten den Rhythmus.
»Cam, bitte. Ich werde verrückt.«
»Ich will, dass du bereit für mich bist.«
»Ich bin seit Wochen bereit.«
Er hob mich leicht an und schob Hose und Boxershorts tiefer, wobei er den dicken Schwanz entblößte, der unzählige Male der Mittelpunkt meiner Fantasien gewesen war. Wäre Sex mit Cameron eine Droge, hätte ich liebend gern eine Überdosis. Nie hatte ich etwas so sehr gewollt.
Ein Schauder der Vorfreude überlief mich, als ich seinen heißen Schaft mit beiden Händen umfasste und massierte. An der Spitze schimmerte ein Tropfen. Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Ich wollte ihn schmecken. Doch dazu war später noch Zeit. Wenn ich ihn nicht bald in mir spürte, würde ich den Verstand verlieren.
Als er scharf die Luft einsog, wusste ich, dass er genauso ungeduldig war wie ich. Ich hob das Becken an, führte die dicke, glatte Spitze an meine Öffnung und begann, mich herabzusenken.
Er packte meine Hüften und hielt mich fest. Seine kühlen blauen Augen waren geweitet, doch er sah mich ernst an. »Langsam. Ich will dir nicht wehtun.«
Also fügte ich mich und bekämpfte den Drang, mich einfach fallen zu lassen und ihn sofort ganz in mich aufzunehmen. Nach und nach drang er in mich ein, ohne dass sein Blick meinen auch nur eine Sekunde losließ. Auf meine Lust folgte Erleichterung, dann Schmerz, dann erneut wildes Verlangen. Ich hielt nichts zurück, und er beobachtete mich dabei, wie ich langsam unsere Körper vereinigte.
Zärtlich drückte er seine Lippen auf meine und atmete meine leisen Seufzer, mein Keuchen ein. Mein Körper dehnte sich, damit ich ihn bis zur Wurzel in mich aufnehmen konnte. Ich verspannte mich kurz, als ich einen scharfen Schmerz spürte und zugleich den Impuls, ihn hart und schnell zu reiten, damit er verging.
Seine Hände wanderten meinen Brustkorb hinauf und wieder hinunter zu der Stelle, an der mein Po auf seine Oberschenkel traf. Dort drückte er sanft zu.
»Perfekt«, murmelte er. »Du hast keine Ahnung, wie fantastisch du dich anfühlst.«
»Wir passen einfach zusammen«, wisperte ich, strich mit der Zunge über die Außenseite seines Ohrs und leckte ihm über den Hals. Seine Haut schmeckte salzig. Tief sog ich seinen männlichen Moschusduft ein, berauschte mich daran.
Wieder hob und senkte er mich langsam und nahm mir damit die schwere Entscheidung ab, wie und wann ich mich bewegen sollte. Ich wimmerte, weil die Empfindung, nach so langer Zeit wieder ausgefüllt zu sein, überwältigend war. So wunderbar. Ich klammerte mich an seine Schultern, in der Hoffnung, sie könnten mir in dem nun folgenden Sturm Halt geben.
Unsere Körper fielen in einen regelmäßigen Rhythmus. Das Flackern der Lust, das tief in meinem Unterkörper begann, wurde mit jedem Stoß heftiger. Ich küsste ihn wie eine Verhungernde.
Er kam mir mit dem Becken entgegen, damit ich ihn tiefer in mich aufnehmen konnte. Ich warf den Kopf zurück und schrie auf. Meine Brüste waren auf einmal schwer und empfindlich. Die Spitzen richteten sich auf, als er daran saugte. Nach Luft schnappend zog ich mich um ihn herum zusammen, was die Reibung seiner Stöße noch intensivierte.
Er schob mich über seinen Schwanz, bis die Realität mir entglitt. Ich wollte, dass es noch länger dauerte, für beide von uns, doch er trieb meinen Körper immer weiter, bis an den Rand der Explosion. Ein feiner Schweißfilm trat auf meine Haut.
Ich stöhnte. Ich brauchte den Orgasmus jetzt wie meinen nächsten Atemzug. Daher kam ich seinen Stößen entgegen, um ihn tiefer in mich aufzunehmen. Ich war so nass, dass er leicht und schnell in mich hinein- und wieder hinausglitt. Schneller, härter. Mein Verstand war verloren in stummem Bitten und Flehen. Ich musste ihm noch näher sein.
»Maya, sieh mich an.« Er holte mich zurück, indem er mir mit gespreizten Fingern durchs Haar fuhr.
Unsere Blicke trafen sich. Unser beider Atem ging stockend und unregelmäßig. Etwas in seinen halb geschlossenen Augen und dem energischen Zug um seinen Kiefer durchbrach mein unbedingtes Bedürfnis zu kommen, während er sich weiter in mich trieb. Sein nächster Stoß war so heftig, dass er mir den Atem raubte. Mein Mund öffnete sich zu einem lautlosen Schrei. Ich dachte, mein Herz müsste explodieren, wenn er mich noch länger so hielt, doch ich konnte mich ihm nicht entziehen. Und wollte es auch nicht.
»Cam.« Sein Name klang beinahe flehend aus meinem Mund, als ich losließ. Um ihm nun alles zu geben. Meinen Körper, mein Herz, mein Vertrauen.
»Ich bin da.« Seine raue Stimme ließ meine Haut kribbeln.
Cameron vögelte mich nicht nur. Er liebte mich mit jeder Berührung, streichelte meine Lippen mit seinen, lenkte meine Bewegungen mit seiner starken Hand an meiner Hüfte, versenkte sich in mir mit einer Unnachgiebigkeit, die mich am Rande des Rausches hielt, und befriedigte so meine tiefsten Bedürfnisse, körperlich und seelisch.
Er leckte sich über den Daumen und ließ ihn geschickt und leicht über meine Klitoris kreisen. Ich wand mich hin und her, griff nach ihm, als die Spannung in mir stieg.
»Oh mein Gott«, rief ich.
»Ja, bleib bei mir.« Er umschlang mich fest und zwang mich, ihn anzusehen und all meine Energie auf seine eindringlichen dunklen Augen zu konzentrieren.
»Ich komme … Oh, Gott.« Ich kniff die Augen zusammen, unfähig, noch etwas anderes wahrzunehmen. Ich konnte nur noch fühlen.
Und ich fühlte alles.
Wir drängten uns aneinander und umklammerten uns, als könnte uns etwas Wertvolles entgleiten, wenn wir es nicht mit aller Kraft festhielten. Sein pochender Schwanz wurde länger und härter, während er ihn machtvoll in mich stieß. Wie von Sinnen grub ich die Fingernägel in seine Haut und kratzte über seine Brust, als die Erlösung nahte und mir die Sinne raubte.
»Fuck«, knurrte er.
Ich riss die Augen auf. Sein Anblick, als er schließlich doch die Beherrschung verlor, gab mir den Rest. Der Orgasmus, die lange Trennung, unsere Liebe und die übermächtige Sehnsucht nach ihm – das alles schlug über mir zusammen wie eine Flutwelle. Lust und Erleichterung quälten meinen heftig zitternden Körper. Ich schrie. Kraftlos fasste ich nach der Matratze und packte den Stoff des Lakens in dem Versuch, mich zu erden, während mein Körper im Rausch abhob.
»Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr.« Ich unterdrückte ein Schluchzen. Tränen brannten in meinen Augenwinkeln, als ich langsam wieder runterkam.
Doch er hielt den Moment fest, hob die Hüften hoch, weil auch er die Erlösung suchte – und da kam ich noch einmal. Meinen letzten Schrei erstickte er mit einem verzweifelten Kuss. Er stöhnte wild in meinen Mund, erstarrte, dann merkte ich, wie seine Hitze in mich strömte.
Erschöpft lehnte ich mich zurück gegen seine angewinkelten Knie und ließ alle Anspannung von mir abfallen. Seine Arme hielten mich an der Taille, seine feuchte Stirn lag zwischen meinen sich hebenden und senkenden Brüsten, während ich um Atem rang.
Ich drückte ihn an mich. Ich empfand Dankbarkeit – für alles. Für Cameron, für diesen Moment, für das Wunder, das ihn in mein Leben gebracht hatte. Ich schluckte gegen den schmerzhaften Knoten in meiner Kehle an. Ich fühlte mich entblößt. Am liebsten hätte ich geweint. Ich wollte mich von den vielen Ängsten und Zweifeln und Sorgen befreien, die mich bis heute belastet hatten. All das wollte ich hinter mir lassen und nur unsere Liebe festhalten.
Er hob den Kopf.
»Herrgott, Maya. Das war …«
»Toll«, beendete ich den Satz für ihn. Obwohl »toll« nicht annähernd das beschrieb, was gerade zwischen uns passiert war. »Unglaublich« und »weltbewegend« würde wohl besser passen. Und es hatte uns Teppichbrand beschert, dachte ich, als ich merkte, dass meine Knie brannten. Doch das war mir egal.
Ich ließ die Finger ganz leicht über seine Haut gleiten, immer noch trunken von unserer Leidenschaft, aber wie ein wahrer Süchtiger wollte ich schon wieder mehr. Er hob die Hände, um mich zu küssen. Unsere sanften, trägen Küsse wurden schnell drängender und entfachten das Feuer erneut. Er schwoll in meinem Inneren an.
»Noch mal, bitte«, sagte er mit rauer Stimme.
Diese Woche blieben wir für uns. Mehr brauchten oder wollten wir nicht.
Während meine Wohnheimkollegen sich in den Frühlingsferien an den Stränden im Süden vergnügten, verbrachten wir unsere Tage im Bett. Abends gingen wir in die Stadt, aßen zu Abend und tranken uns einen Schwips an. Dann beeilten wir uns, nach Hause zu kommen, um uns zärtlich zu lieben oder wild und laut zu vögeln. Unsere ungehemmten Sexgeräusche hallten durch die – glücklicherweise – leeren Flure des Wohnheims.
Wir genossen jede kostbare Minute und sprachen stundenlang über unsere gemeinsame Zukunft: Hochzeit, Babys und glücklich bis an unser Lebensende. Vor uns lag so viel Zeit, so viel Unbekanntes, dass wir anfingen zu träumen und uns das Leben ausmalten, das wir führen könnten. Ich hatte keine Ahnung, wann oder wie diese Zukunft tatsächlich Gestalt annehmen würde, doch ich betete, dass ich ihm alles geben konnte, was er wollte, wenn die Zeit kam.
Nach einigen Tagen wurden unsere Küsse länger und intensiver, und der wilde Sex wurde zärtlicher, ruhiger. Schließlich ließ ich meinen Tränen freien Lauf, und er küsste sie fort, ohne je nach dem Grund zu fragen. Er hielt mich, liebte mich und half mir zu vergessen, dass unsere Zeit ablief, und sei es nur für einen kurzen Moment.
Doch auch wenn wir uns langsamer liebten, konnten wir das Verrinnen der Zeit nicht aufhalten. Während wir über den Campus spazierten, versuchte ich nicht daran zu denken, dass schon bald sein Flug ging und ich zu meinem monotonen, arbeitsreichen Leben als Studentin zurückkehren würde. Ich lehnte mich an seine Schulter und wünschte, ich könnte die Zeit einfrieren oder ihn mit Gewalt festhalten. Meine Mitbewohnerin hätte sicher nichts dagegen.
An der Flussmündung funkelte das Wasser im Mondlicht. Cameron blieb stehen, wandte sich zu mir und nahm meine Hände. Ich blickte zu ihm auf, fasziniert von seinen Augen, die im Halbdunkeln glitzerten. Er war so schön. Perfekt. Und er gehörte ganz mir, zumindest jetzt gerade.
»Alles okay?«
»Alles bestens«, log ich. Ich wollte keine Zeit damit verschwenden, über das Unausweichliche zu reden.
»Ich will auch nicht gehen«, sagte er und sprach damit meine Gedanken aus.
Ich blickte auf den Boden zwischen uns. »Ich will nicht mal dran denken.«
»Wir schaffen das schon. Wenn ich erst mal meine Ausbildung fertig habe, wird alles einfacher, das verspreche ich.«
Mir blutete das Herz bei dem Gedanken, noch eine weitere längere Trennung ertragen zu müssen. »Es ist ja nicht mehr lang bis zum Sommer«, sagte ich.
Ein Hoffnungsschimmer. Trotzdem kämpfte ich gegen die Tränen an, fest entschlossen, erst wieder zu weinen, wenn er fort war. Ich wollte nicht unsere letzten Tage verderben, weil ich wegen etwas traurig war, dass sich sowieso nicht vermeiden ließ.
»Was das angeht …«
Fragend hob ich den Blick. Plötzlich wirkte seine Haltung verkrampft. Mit angespanntem Kiefer sah er hinunter auf unsere verschränkten Hände. Er holte tief Luft.
»Was? Was ist?« Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Hatte er bis jetzt gewartet, um mir schlechte Nachrichten beizubringen?
»Ich weiß, dass du vorhast, dir im Sommer hier einen Job zu suchen.«
Ich nickte. »Zusammen mit meinem Stipendium kann ich dann meine Unterkunft finanzieren. Es ist nur vernünftig.«
»Ich weiß, aber statt mich dort zu besuchen, wo ich stationiert sein werde, könntest du doch den Sommer über bei mir wohnen.«
Ich runzelte die Stirn. »Aber du hast gesagt, du dürftest nicht außerhalb der Basis wohnen. Das kann ich mir nicht leisten, Cameron.« Über meine finanziellen Probleme redete ich nur höchst ungern. Solche Sorgen waren ihm immer erspart geblieben.
»Das stimmt, im Moment muss ich auf der Basis bleiben, aber es gäbe da eine Möglichkeit …«
Ich versuchte mir vorzustellen, wie der Satz enden könnte. Mit den Feinheiten der militärischen Regeln kannte ich mich nicht aus. Ich wusste nur, dass es unvorstellbar viele Vorschriften gab.
»Welche?«
»Wir könnten heiraten.«
Ich riss die Augen auf und sog scharf die kühle Nachtluft ein. »Heiraten?« Ich erkannte meine eigene Stimme kaum wieder. Sie klang angestrengt, schrill und verriet meine Panik. Dabei hatten wir doch noch vor wenigen Stunden von einem gemeinsamen Leben geträumt.
»Wenn wir heiraten, darf ich mir außerhalb der Basis eine Wohnung suchen. Wir könnten zusammen sein. Ich verdiene genug für uns beide, bis du wieder auf die Uni gehst. Und danach natürlich auch.«
Das Feuer, das eben noch zwischen uns gelodert hatte, erlosch mit einem Schlag, als ich begriff, was er da gerade gesagt hatte. Ich wollte ihm antworten, doch meine Lippen bewegten sich nur stumm. Die Panik packte meine Lunge mit eisernem Griff. Mir fiel das Atmen schwer.
Einen Heiratsantrag von Cameron hatte ich mir völlig anders vorgestellt. Da waren wir älter, mein Leben war sehr viel gefestigter als jetzt, und ich lächelte und weinte und sprang hoch, um ihn zu küssen, während ich immer wieder »Ja, ja, ja!« rief. Doch nun kämpfte ich gegen eine Welle der Übelkeit an. Mein Blick verschwamm. Die leisen Geräusche um uns herum wurden von wirren Gedanken gedämpft, die plötzlich meinen Kopf fluteten.
»Ich verstehe nicht, was du damit sagen willst«, erwiderte ich schließlich. Tatsächlich war ich von seinem Antrag völlig überrumpelt.
Er packte meine Hände fester. Mir kam der flüchtige Gedanke, dass meine Handflächen feucht waren, doch ich war zu verwirrt, um deswegen verlegen zu sein.
»Maya, ich will dich heiraten.«
Die Sanftheit in seiner Stimme wich Entschlossenheit. Er betrachtete mich eindringlich. Er meinte es ernst. Ich bekam Angst. Schreckliche Angst.
»Ja, das Militär bringt Einschränkungen mit sich, aber das ist nicht so wichtig. Mir ist nur wichtig, dass ich mit dir verheiratet sein will. Diese gemeinsame Woche … So soll es für immer weitergehen. Ich will sicher sein, dass uns das niemand nehmen kann.«
»Aber …« Ich stolperte über meine eigenen Worte und hoffte, dass ich nicht so erschrocken aussah, wie ich mich fühlte. »Bist du … Meinst du, jetzt gleich?«
Er antwortete nicht sofort. »Wir könnten es dieses Wochenende tun, vor meiner Abreise. Nur du und ich. Wir brauchen niemanden sonst.«
Ich entzog mich seinem Griff, in dem ich einen kleinen Schritt zurückwich, in der Hoffnung, dann leichter atmen zu können. Meine Brust hob und senkte sich angestrengt. Mein Verstand erwachte aus dem Liebeskoma der letzten Tage. Ich liebte ihn so sehr, und doch hätte ich nicht schockierter sein können.
»Einen Ring habe ich nicht …« Seine Schultern sackten nach unten.
Mein Unbehagen wuchs nur noch, als ich seinen fragenden Blick sah.
»Ich muss keinen Ring haben, Cameron, aber das kommt so plötzlich. Bist du dir im Klaren, um was du mich da bittest?«
»Das weiß ich ganz genau. Vertrau mir, ich denke seit Wochen an kaum etwas anderes. Schon im ersten Moment, als ich dich wiedersah, wollte ich dir einen Antrag machen.«
Mein Blick schoss zwischen dem Boden und den Gebäuden in der Ferne hin und her. Ich brauchte etwas, an dem ich mich festhalten konnte, weil meine Gedanken Amok liefen.
Die Zukunft, über die wir gesprochen hatten, schien für ihn sehr viel näher zu sein, als mir klar gewesen war. Jetzt, da unsere gemeinsamen Träume Wirklichkeit werden konnten, fühlte ich mich nur völlig verwirrt. Die warme Decke der vergangenen Tage war mir weggerissen worden, und mir blieb nur der Schock über seinen Antrag.
»Warum jetzt?«
»Warum warten?«
»Ich kann nicht einfach weglaufen. Ich habe Dinge zu erledigen. Hier.«
Er reagierte mit einem verwirrten Stirnrunzeln. »Was denn?«
»Keine Ahnung. Arbeit.« Ich suchte Zuflucht in der Halbwahrheit, weil ich ihm nicht die wahren Gründe nennen konnte, warum es für mich unmöglich war, einfach im kommenden Mai mit meinem zukünftigen Ehemann die Stadt zu verlassen.
»Du findest doch da, wo ich dann sein werde, auch einen Job. Oder nimm dir einfach den Sommer frei. Ich kann genug für uns beide verdienen.«
Als ob irgendetwas je so einfach sein könnte.
Ich war wie erstarrt. Fieberhaft überlegte ich, wie ich ihn davon überzeugen konnte, dass es übereilt war. Zu früh. »Ich weiß nicht, Cameron«, murmelte ich. »Ich glaube, ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken.«
Ich wagte einen Blick in seine Augen. Er hatte die Zähne aufeinandergebissen, und seine ganze Haltung war angespannt.
»Willst du mich heiraten oder nicht?« Seine Stimme war nur ein Flüstern.
Ich hatte um Bedenkzeit gebeten, doch hier ging es nicht darum, Bedingungen auszuhandeln. Dieser Moment verlangte eine Antwort, keine Entschuldigung.
Feiner Nebel strich über meine Haut, und ich kämpfte erneut gegen die Übelkeit an. Ich konnte es nicht. Es war zu viel. Zu schnell. Auch wenn ich jemand war, der sich gern Hals über Kopf in etwas stürzte – wir beide waren so –, schreckte ich nun doch zurück. Eines Tages, ja. Aber ich konnte nicht sagen, wann das sein würde. Er wollte sich um mich kümmern, doch er würde niemals wirklich verstehen, an welcher Last ich trug.
»Ich will dich heiraten, Cameron. Ganz ehrlich, eines Tages, aber nicht … heute. Wir sollten nichts überstürzen.«
»Überstürzen? Ich war zwei Monate von dir getrennt, und es hat mich beinahe umgebracht. Ich dachte, du würdest genauso fühlen.«
Ich verschränkte fest die Finger ineinander, um das Zittern meiner Hände unter Kontrolle zu bekommen. Mit jedem Wort entglitt er mir mehr, das spürte ich. Ich starrte an ihm vorbei zum See. Der Campus lag nun im Dunkel unter dem Nachthimmel. Dies war mein Leben, und ich hatte nie wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, wie es sein würde, wenn wir unsere Träumereien wahrmachten. Jetzt wollte er all die Versprechen, die wir uns gegeben hatten, tatsächlich einfordern, und ich machte einen Rückzieher.
Ich liebte Cameron. Wenn ich mit ihm zusammen war, konnte ich daran glauben, dass alles möglich war, dass alles gut werden würde. Aber er wusste nicht alles. Er würde nie verstehen, welche Last mich niederdrückte, welche Schlachten ich schlug, von denen selbst meine Freunde hier nichts wussten. Er lebte ein privilegiertes Leben, kannte es nicht anders. Sicherheit, Normalität, eine Familie, die wohl die meisten als perfekt bezeichnen würden, erst recht verglichen mit meiner.
Hin und wieder hatte ich angedeutet, dass es ein Problem mit meiner Mutter gab, aber die peinlichen Details darüber, wie ich aufgewachsen war, oder wie ihr Leben endgültig den Bach runtergegangen war, nachdem ich mein Zuhause verlassen hatte, um zu studieren, hatte ich nie preisgegeben. Welche Chance hätte ich noch bei ihm, wenn er wüsste, wer ich wirklich war?
»Ich will mit dir zusammen sein, Cam.« Ich betete, dass ihm das genug war.
»Dann heirate mich. Für mich wird es nie eine andere geben. Du bist es.« Die Liebe in seinen Augen, dieser Blick, den ich schon so viele Male zuvor gesehen hatte, ließ keinen Zweifel daran.
»Heiraten?« Ich schüttelte den Kopf und flehte ihn im Stillen an, diesen einen Traum, den ich ihm nicht erfüllen konnte, vorerst aufzugeben.
Er verzog das Gesicht. »Du sagst das Wort, als würde es dir Übelkeit verursachen, Maya.«
»So ist es auch. Mir ist übel.« Ich wandte mich halb ab und schlang die Arme um mich, zum Schutz vor der abendlichen Kälte. Er drängte mich zu sehr. Alles, was ich sagte, enttäuschte ihn, verletzte ihn. Ich fühlte mich schrecklich. Dieses ganze Gespräch war schrecklich. Ich wollte nur nach Hause und in seinen Armen einschlafen und dann aufwachen, als hätten wir es nie geführt.
Die tiefe Kränkung in seinen Augen versetzte mir einen Stich. Mir wurde das Herz schwer.
»Dann sagst du also Nein.«
Ich schüttelte den Kopf, während mir das Herz brach. Mir blieb keine andere Wahl, doch ich würde ihm niemals meine Gründe verständlich machen können. »Ich kann nicht.«
»Was war dann diese Woche für dich?« In seiner Stimme lag Schmerz und Frustration.
Ich zuckte die Achseln. Warum konnten wir das nicht einfach alles vergessen, die Zeit zurückdrehen bis zu dem Moment, an dem wir einfach glücklich gewesen waren, uns zu haben, ohne dass Erwartungen an mich gestellt wurden, die ich nie würde erfüllen können? »Wir hatten uns, waren zusammen. So wie immer.«
»Es ist so viel mehr als vorher. Das weißt du. Was bedeute ich dir eigentlich wirklich? Was bedeutet dir unsere Beziehung, wenn du doch schon damit rechnest, dass sie irgendwann einmal zu Ende gehen wird?«
»Du bedeutest mir alles, Cameron.«
Sein Lachen schnitt durch mich hindurch wie ein Messer. »Offenbar nicht.«
»Hör auf damit.« Meine Stimme klang weinerlich. Meine Gewissensbisse wichen der Verzweiflung, und ich fühlte mich schwach und machtlos, weil das Gespräch mir entglitt.
»Was bin ich dann für dich?«
»Du bist mein Geliebter, mein Freund. Ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr ohne dich überstanden hätte.« Cameron hatte mir Hoffnung gegeben, etwas, auf das ich mich jedes Wochenende gefreut hatte, bevor er zur Armee gegangen war. Unsere unbedingte Liebe barg das große Versprechen auf alles, wonach ich mich sehnte.
»Dann bin ich also eine Krücke für dich? Jemand, auf den du dich emotional stützen kannst, mit dem du aber keine ernsthafte Beziehung willst?«
Ich atmete scharf aus. Meine Augen brannten von ungeweinten Tränen. »Nein.«
»Was dann? Erklär es mir.«
»Das ist doch verrückt. Du bist verrückt, wenn du das von mir verlangst. Man heiratet doch heutzutage gar nicht mehr.«
»Was andere tun, ist mir scheißegal.« Er rieb sich die Stirn, während er hörbar durch die zusammengebissenen Zähne atmete. »Dann war es das also?«
Mein Herz hämmerte gegen meine Brust. »Was meinst du?«
»Das war’s, Maya. Ich kann nicht …« Er schüttelte den Kopf und wich meinem Blick aus. »Du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Ich habe nur an dich und an diesen Moment gedacht. Aber wenn du wirklich so empfindest, sollten wir nicht weiter unsere Zeit verschwenden.«
Ich schnappte nach Luft. Panik flutete meinen Körper. »Nein.«
Ich streckte die Hand nach ihm aus, doch er trat zurück und hob die Hände in einer kapitulierenden Geste.
»Lass uns darüber reden.« Er entglitt mir. Ich durfte ihn nicht verlieren.
Noch während ich nach Worten suchte, um ihn zum Bleiben zu bewegen, kamen mir die Tränen.
»Cameron, warte. Bitte.«
Ich unterdrückte ein Schluchzen, als er sich umwandte und ohne ein weiteres Wort ging.
1. Kapitel
Fünf Jahre später
Maya
Maschinen summten, Papier raschelte, Finger tippten auf Tastaturen. Jeden Tag um die Mittagszeit herum lag plötzlich etwas in der Luft: die Aussicht auf Freiheit, auf sechzig Minuten, die nur einem selbst gehörten, fort von diesem Ort. Es war 11:55 Uhr, und ich wühlte nervös in meiner Handtasche, um mich zu vergewissern, dass ich auch alles für meinen Sprint dabeihatte. Punkt zwölf eilte ich zu den Aufzügen. Mithilfe meiner riesigen Tasche bahnte ich mir meinen Weg durch die Meute bis ganz nach vorne. So war es an jedem verdammten Tag. Sie ließen uns alle zur selben Zeit raus, wie Vieh.
Ich ignorierte die erbosten Blicke, die mich trafen, weil ich noch zu verkatert von Vanessas Geburtstagsparty gestern Abend war. Ganz sicher würde ich nicht fünf kostbare Minuten meiner Pause damit verschwenden, rücksichtsvoll zu sein. Nicht heute. Und wenn ich es recht bedachte, auch an den meisten anderen Tagen nicht.
So war ich nicht immer gewesen.
Ich schob den Gedanken beiseite, als ich durch die Drehtür nach draußen trat. Als die eisige Winterluft mich traf, blieb ich stehen. Kurz darauf rempelte mich jemand von hinten an, sodass ich vorwärtsstolperte. Ich fing mich und ging weiter, ohne einen Blick zurück auf das Arschloch zu werfen, das mich beinah umgerannt hätte. Schließlich war ich gerade eben selbst so ein Arschloch gewesen.
Ich steckte die bloßen Hände in die Manteltaschen und verfluchte die Kälte. Zum Delaney’s war es ein Stück zu gehen, und schon ein paar Häuserblocks weiter waren sehr viel weniger schwarze Businessmäntel auf der Straße zu sehen. In der dunklen, muffigen Bar angekommen, kletterte ich auf einen Hocker und blieb erst einmal so sitzen, bis mir allmählich wärmer wurde. Dann erst zog ich den Mantel aus und ließ ihn auf den leeren Platz neben mir fallen. Währenddessen erschien Jerry. Er begrüßte mich mit einem Nicken und rief jemandem im hinteren Bereich meine übliche Bestellung zu.
»Was gibt’s Neues, Maya?« Er nahm sich einen Lappen und wischte über die bereits saubere Theke.
»Jeden Tag dieselbe Scheiße.« Ich fuhr mir mit den Fingern durchs Haar, um die statische Aufladung loszuwerden.
»Das Gleiche wie immer?«
»Ja, bitte.«
Er nickte und kam mit einem großen Glas Cola light und einem kleineren Glas mit Jameson Whiskey zurück.
Allein der Anblick bewirkte, dass sich mein Körper entspannte. Meine zwei besten Freunde: Koffein und Alkohol. Keine Ahnung, wann genau ich angefangen hatte, während der Arbeitszeit zu trinken. Bisher war ich noch nicht erwischt worden, und aus meinem Büro würde sich niemand zum Mittagessen hierher verirren.
Diesen Sommer war ich fünfundzwanzig geworden. Seit fast vier Jahren hockte ich nun in dieser Bürozelle und fraß Zahlen. Nachdem das staatliche Rettungspaket nicht gegriffen hatte und die Wirtschaft den Bach runterging, war die Arbeit in der Finanzbranche nicht mehr so glamourös wie früher. Abgesehen vom Geld natürlich. Noch immer galt, dass auch in Zukunft Gier unser Finanzsystem aufrechterhalten würde und dass die Menschen, die es in die Tat umsetzten, dabei nach wie vor reich werden konnten. Das war Grund genug für mich, die ich immer knapp bei Kasse gewesen war, den Job anzunehmen.
Frisch vom College so viel Geld zu verdienen war ein fantastisches Gefühl gewesen. Endlich hatte ich es geschafft, und die ganze harte Arbeit zahlte sich aus. Doch der Glanz der Wall Street war sehr viel schneller verblasst, als ich erwartet hatte. Denn irgendwann begriff ich, dass sehr viel mehr nötig war, um voranzukommen, als nur einen guten Job abzuliefern.
Nichts war jemals einfach. Zumindest für mich nicht. Irgendetwas gab es immer, das mir das Leben schwermachte. Aber ich hatte es weit gebracht und war fest entschlossen, mich nicht unterkriegen zu lassen.
Ich kippte den Whiskey in einem Zug und spürte das Brennen, als die Flüssigkeit hinunter in meinen leeren Magen lief. Mein Inneres zog sich protestierend zusammen, entspannte sich jedoch rasch, als der Alkohol absorbiert wurde. Ein Konterschnaps gegen den Kater.
Stella saß am anderen Ende der Theke. Sie war ein Stammgast. Ihr Haar war genauso lang wie meins, aber struppig und bis auf die herausgewachsenen blondierten Spitzen grau. Es war vermutlich Jahre her, dass sie sie das letzte Mal gefärbt hatte. Was konnte sich nicht alles innerhalb von wenigen Jahren ändern. Ihr bleiches Gesicht leuchtete in der schummrigen Bar. Schwaches Licht fiel durch die Fenster von der Seite auf sie und zeichnete Falten des Alters und der Erfahrung auf ihre Haut.
»Na, wie läuft’s, Stella?«, rief ich ihr zu. Einige der vertrauten Gesichter sahen zu mir herüber, bevor sie sich wieder dem zuwandten, was immer sie gerade taten – Zeitung lesen, Fernsehen gucken, in ihre Biere starren und dort nach Antworten suchen.
»Sehr gut, Liebes. Sehr gut.«
Wie es aussah, hatte sie heute früh angefangen. Ihre Augen waren glasig, und sie schenkte mir ein schiefes Lächeln. Wenn man genau hinsah, konnte man noch erkennen, dass sie früher jung und schön gewesen war, doch jetzt war ihr Gesicht verlebt und verhärmt von zu vielen langen Tagen und zu vielen kalten Nächten. Oder vielleicht waren es auch kalte Tage und lange Nächte. Ich wusste nur wenig über sie, nur dass die Person vor mir nichts mehr mit ihrem früheren Ich gemeinsam hatte. Niemand beachtete sie. Obwohl die meisten der Leute in dieser schäbigen Bar auch nicht viel besser aussahen, wurde Stella selbst von denen übersehen.
Ich wollte sie jedoch nicht ignorieren. Gerne hätte ich sie gefragt, ob sie Familie hatte, tat es aber nicht, weil ich wusste, dass eine solche Frage mehr wehtun konnte als helfen.
Jerry kam mit meinem Essen. Hähnchensticks und Pommes, mein Leibgericht. Ich ernährte mich immer noch wie damals, als ich ein Kind war, von Fastfood und – wenn Mom mal wieder knapp bei Kasse war – Instantnudeln, aber ich hatte mich nie beschwert, weil es mir geschmeckt hatte und immer noch schmeckte. Dank meiner schlechten Ernährungsgewohnheiten und der vorwiegend sitzenden Bürotätigkeit hatte ich die fünfzehn Pfund, die ich mir im College angefuttert hatte, immer noch nicht wieder runter, sondern sogar noch ein paar zusätzliche zugelegt. Es störte mich zwar, aber auch nicht so sehr, dass ich etwas dagegen unternommen hätte.
»Danke, Jerry.«
»Kein Problem. Sag Bescheid, wenn du noch etwas willst.«
»Bringst du bitte Stella auch was? Schreib es einfach auf meine Rechnung.« Ich legte meine Kreditkarte auf den Tresen, um zu bezahlen, damit ich gleich schnell aufbrechen konnte.
»Bist du sicher?« Er hob die Augenbrauen, als wäre es ein hoffnungsloser Fall wie Stella nicht wert, dass man zehn Dollar für ihn ausgab.
»Ich bin mir sicher.« Meine Stimme war härter als zuvor.
Er ging zu ihr und warf eine Speisekarte vor sie hin.
»Such dir was aus, Schätzchen. Deine kleine Freundin dort drüben spendiert dir wieder ein Mittagessen. Was darf’s denn sein?«
»Oh, Liebes. Das musst du nicht tun. Spar dein Geld.« Sie winkte mir zu und stieß dabei fast das halb leere Bierglas um.
»Kein Problem.«
Sie schenkte mir ein trauriges Lächeln, das mir sagte, sie wünschte, sie könnte ablehnen oder den Spieß umdrehen und mir stattdessen ein Mittagessen ausgeben. Keine Ahnung, wann sie das letzte Mal eine anständige Mahlzeit zu sich genommen hatte. Sie vertrank ihr ganzes Geld. Das wusste ich, weil sie spindeldürr war. Die alten Klamotten, die sie trug, rutschten ihr fast vom Leib. Wenn sie die Wahl hatte, entschied sie sich für Alkohol statt für Essen, jedes Mal. Deswegen schüttelten Menschen wie Jerry den Kopf über sie.
Er nahm ihre Bestellung auf und brüllte wieder etwas nach hinten.
Die Hähnchensticks hatte ich schon alle verschlungen, und mit den Pommes ließ ich mir jetzt Zeit. Ich befand mich mit meinem leichten Kater in einem Stadium, wo Nahrung ein Heilmittel war. Ich brauchte etwas im Magen, um die Übelkeit für den Rest des Tages in Schach halten zu können.
Ich warf einen Blick auf die Uhr. Es blieb mir immer noch reichlich Zeit. Ich gehörte nicht zum Rest der Viehherde, die eine halbe Stunde in der Schlange stand, um sich dann neben einem völlig Fremden Kantinenfutter reinzustopfen. Der lange Fußweg zu Delaney’s war es immer wert.
Ich griff in meine Tasche und holte mein Notizbuch heraus. Die Handtasche war eine von diesen unglaublich unpraktischen Designerdingern, voll mit Gott weiß was für Zeug, das ich ganz sicher nicht jeden Tag mit mir herumschleppen müsste. Schließlich fand ich es und klappte es bei einer leeren Seite auf. Ich klickte ein paarmal mit dem Kugelschreiber und setzte dann die Spitze auf das Blatt.
Ich schrieb über Stella, brachte die Gedanken zu Papier, die mir zu ihr gekommen waren. Darunter auch Dinge, die bloß meiner Fantasie entsprangen, denn woanders als hier an ihrem Stammplatz an der Theke war ich ihr nie begegnet. Und doch hatte ich irgendwie Angst, ich könnte sie bereits besser kennen, als mir lieb war. Als die Seite voll war, schrieb ich weiter, blätterte hin und her, suchte nach Worten, bis ein Gedicht entstand, an dem ich dann noch mal feilte.
Stella
grau
ein Baum, geknickt, verkümmert
Arme verzweigen sich vor ihrem Gesicht
kalt
eine Mutter, leblos, fruchtlos
ihre Seele sehnt den Frühling herbei
Etwas an der schroffen Kargheit des Gedichts beruhigte mich. Wabi-sabi oder seine minimalistische Unvollkommenheit, vielleicht auch das simple Wissen, dass niemand außer mir es verstehen würde. Das war mir nur recht, ja sogar lieber. Ich hatte mich damit abgefunden, dass die meisten Menschen mich nie wirklich kennen würden.
Wieder warf ich einen Blick auf meine Armbanduhr. Zeit zu gehen. Ich packte zusammen und verabschiedete mich. Auf dem Weg nach draußen winkte ich Stella zum Abschied, doch sie sah mich nicht.
Bevor ich wieder raus in die Kälte trat, zündete ich mir eine Zigarette an. Menthol. Nach einem Zug protestierte mein Magen schon wieder. Zu viele Zigaretten gestern Abend. Ich sollte wirklich damit aufhören. Dennoch war mir jetzt warm, ich fühlte mich ein wenig gelöst und bereit, die zweite Hälfte des Tages in Angriff zu nehmen. Halbzeit. Noch zwei Tage bis zum Wochenende. Und was dann? Vielleicht schaffte ich es ja endlich mal, mich aufzuraffen und ins Fitnessstudio zu gehen. Mal sehen, wie es läuft, dachte ich.
Versunken in meiner Fitnessfantasie und der Aussicht auf einen strafferen Hintern überhörte ich es beinahe, als mein Name gerufen wurde. Die Gegend, in dem ich damit rechnen musste, erkannt zu werden, hatte ich noch nicht erreicht. Es lag noch ein gutes Stückchen vor mir.
»Maya?«
Ich blieb wie angewurzelt stehen und hob den Blick. Eine hübsche junge Frau mit braunem Haar, das offen ihr Gesicht umrahmte, stand vor mir. Ihre durchdringenden blauen Augen trafen meine.
»Olivia. Hallo. Wie geht es dir?«
»Gut.« Knappe Antwort, knappes Lächeln.
Wir umarmten uns nicht, weil das immer seltsam wirkte, wenn man sich lange nicht gesehen hatte, aber in diesem Moment wirkte es noch seltsamer, dass wir darauf verzichteten. So als hätten wir einen guten Grund, es nicht zu tun. Sie hatte ganz gewiss einen, das stand fest.
Schließlich brach sie das unbehagliche Schweigen. »Ich wusste gar nicht, dass du jetzt hier lebst.«
»Ja, seit meinem Abschluss. Ich arbeite an der Wall Street als Analystin.« Ich trat meine Zigarette aus, die mir plötzlich peinlich war. Keine Ahnung, warum. Es war ja nicht so, dass ich sie beeindrucken musste. Aber ein Teil von mir wollte ihr den Eindruck vermitteln, dass ich mein Leben jetzt im Griff hatte. Abgesehen von der leichten Whiskeyfahne sah ich gut aus: teures Kostüm, teurer Mantel, lächerlich teure Schuhe. Ich strich mir das lange Haar – ein stylisher, sorgfältig geglätteter Stufenschnitt – hinters Ohr.
»Was ist mit dir?«
»Ich bin gerade hergezogen und versuche immer noch, mich zurechtzufinden. Ich dachte, ich drehe mal eine Runde durch Manhattan. Freunde von mir wohnen hier ganz in der Nähe.«
»Da hast du dir ja einen guten Tag ausgesucht.«
»Ja, wirklich, es ist ganz schön kalt.« Sie wippte einige Male vor und zurück, den Blick fest zu Boden gerichtet.
Etwas sagte mir, dass sie mir wegen Cameron immer noch nicht verziehen hatte.
»Ich muss los, zurück zur Arbeit.«
Sie blickte hoch. »Richtig. Es war schön, dich wiederzusehen, Maya. Es freut mich, dass es dir gut geht.«
»Danke, gleichfalls«, erwiderte ich verlegen. Dann fiel mir auf, dass ich sie gar nicht gefragt hatte, was sie jetzt so machte. Gott, ich war solch ein egozentrisches Arschloch geworden. Das fand sie sicher auch.
»Okay, man sieht sich.« Sie nickte mir kurz zu und huschte an mir vorbei, in die Richtung, aus der ich gekommen war.
Als ich zurück im Büro war, konnte ich immer noch nicht wieder klar denken. Ich steckte mir zehn Minzbonbons in den Mund und machte mich an die Arbeit.
Gott sei Dank gab es reichlich zu tun, da sich ein paar der Kollegen heute krankgemeldet hatten. Doch nach einigen Stunden war auch das erledigt, und ich war wieder allein mit meinen Gedanken, bis die Märkte schlossen.
Cameron
»Du errätst nie, wer mir heute über den Weg gelaufen ist.«
Olivia blickte auf mich herunter, während ich die Gewichte rhythmisch hochpresste. Es war ein langer Tag gewesen, und in der Nacht zuvor hatte ich wenig Schlaf bekommen. Die Ablenkung kam mir gelegen, solange sie mich wach hielt, doch an Klatsch war ich nicht interessiert.
»Wer?«, grunzte ich und zählte im Stillen weiter.
»Maya.«
Mein Griff verrutschte leicht, aber ich bekam die Stange wieder in die richtige Position, bevor ich sie zurück auf den Ständer hob und mich aufsetzte. Der Name hallte in meinem Kopf wider und beschwor ein Bild herauf, das ich in den letzten Jahren zu vergessen versucht hatte. Meine Maya?
»Maya Jacobs?«
Sie lehnte sich gegen die verspiegelte Wand vor mir und antwortete mit einem kurzen Nicken.
In den Spiegeln sah ich, wie sich das Studio mit Mitgliedern füllte, die nach der Arbeit herhetzten, um die besten Laufbänder und Crosstrainer zu ergattern. Die entspannten Mütter, die während des Tages kamen, machten den Berufstätigen Platz. Gewöhnlich versuchte ich mein Training zwischen diesen beiden Gruppen zu absolvieren, wenn es nicht so hektisch war. In dieser Stadt hatte man es stets eilig, daran hatte ich mich auch nach einem Jahr immer noch nicht gewöhnt.
»Wo hast du sie gesehen?« Ich versuchte beiläufig zu klingen, dabei brachte mich die Neugier um.
Sie hob die Augenbrauen. »Ein paar Straßen entfernt von der Wall Street. Da arbeitet sie jetzt, glaube ich.«
»Sie arbeitet an der Wall Street? Echt?«
Olivia fixierte mich mit schmalen Augen, als würde sie versuchen meine Reaktion einzuschätzen. »Bitte sag mir, dass du nicht immer noch von ihr besessen bist, nach allem, was sie dir angetan hat.«
Ich drückte mich von der Bank hoch und schnappte mir mein Handtuch, um mir den Schweiß vom Gesicht zu wischen. Dann legte ich es mir um den Hals. »Ich bin nur neugierig. Das ist alles so lange her. Welchen Eindruck macht sie auf dich?«
Olivia sah an mir vorbei, anscheinend war sie abgelenkt von dem Typen auf der Bankpresse. Ich folgte ihrem Blick. Der kam regelmäßig. Ich runzelte die Stirn und nahm mir vor, ihn im Auge zu behalten.
Sie seufzte leise. »Sie hat sich verändert.«
»Das sagt mir nicht viel.«
»Vielleicht triffst du sie ja mal und siehst es dann selbst.«
»In dieser Stadt wohnen acht Millionen Leute. Das ist nicht sehr wahrscheinlich.«
»Außerdem ist sie ja wohl der letzte Mensch, dem du begegnen willst. Seit eurer Trennung habt ihr euch doch nicht mehr …?«
»Nein, haben wir nicht.« Ich hatte keine Lust, an die Trennung von Maya zurückzudenken, erst recht nicht unter Olivias prüfendem Blick. Sie hatte das Ganze beinahe genauso schwergenommen wie ich und war heute immer noch nicht gut auf Maya zu sprechen. »Hör zu, ich muss duschen und noch Papierkram erledigen. Wir sehen uns zu Hause zum Abendessen, okay?«
»Klar. Ich hab auch noch einiges zu tun.«
Ich musterte sie argwöhnisch. »Du ordnest aber nicht meine Hemden nach Farben oder so?«
Sie lachte. »Heute nicht. Aber ich bekomme deinen Haushalt schon organisiert, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.«
»Ich habe mein eigenes System. Hör auf, alles umzuräumen.«
»Jaja, viel Glück dabei, eine Frau zu finden, wenn sie erst mal mitbekommt, wie gut du organisiert bist.«
Ich scheuchte sie mit einem Handwedeln fort und machte mich auf den Weg in den hinteren Teil des Gebäudes, wo mein Büro hinter einer weiteren Spiegelwand versteckt lag. Doch nachdem ich mich an meinem Schreibtisch niedergelassen hatte, starrte ich nur gedankenverloren auf die Papierstapel vor mir.
Olivia hatte vielleicht recht. Die Umgestaltung meiner Junggesellenbude – einer dreigeschossigen, teilweise renovierten Eigentumswohnung – war eine Sache, doch das Fitnessstudio begann mir über den Kopf zu wachsen. Olivias Angebot, mir zu helfen, hatte ich angenommen, weil ich wusste, dass sie es ebenso eilig hatte, von meinen Eltern wegzukommen wie ich damals. Bei dem Gedanken, für meinen Vater zu arbeiten und ihnen so eine gewisse Macht über einen Teil meines Lebens zu verleihen, verzog ich das Gesicht. Denn genau das hatten sie mit Olivia vor. Darren und mich hatten sie glücklicherweise schon aufgegeben.
Ich war froh, dass ich Olivia Starthilfe für das neue Kapitel in ihrem Leben geben konnte, aber sie war erst seit zwei Tagen in der Stadt und machte mich schon wahnsinnig. Dazu kamen die vielen schlaflosen Nächte. Ich konnte kaum geradeausschauen.
Die Tür schwang auf, und Darren kam herein. »Was steht an, Alter?«
»Nicht viel. Papierkram.«
»Brauchst du Hilfe?«
Ich überlegte, ob ich sein Angebot annehmen sollte, war jedoch im Moment zu abgelenkt. »Nein, danke, ich spring schnell unter die Dusche und kümmere mich morgen früh darum. Wir sehen uns dann morgen.«
»Okay. Alles in Ordnung?«
»Ja. Warum?«
Er zuckte die Achseln. »Du bist so komisch. Hast du deine Tage?«
»Leck mich«, brummte ich.
Lachend stopfte er seine Jacke in einen Spind und tauschte das Shirt der Feuerwehr gegen eines mit dem Logo des Studios. Ich hatte ihn gebeten, ein paar Trainerschichten zu übernehmen, um mich zu entlasten. Dafür bezahlte ich, indem ich seine tägliche Dosis Sarkasmus tolerierte. Schon oft hatte ich mich gefragt, ob wir überhaupt verwandt waren.
»Hey, wollen wir uns dieses Wochenende auf ein paar Bier treffen? Du bist schon eine Weile nicht mehr rausgekommen.«
Ich zögerte, während meine Gedanken zu Maya wanderten. Ihr Name war wie ein alter Song, dessen Text mir nicht mehr einfiel. Warum tat ich mir das an? Als hätte ich nicht schon genug quälende Erinnerungen.
»Komm schon, Mann, du kannst doch nicht immer nur zu Hause sitzen. Du führst dich auf wie ein alter Mann. Trink was, lern ein paar Frauen kennen, schalt mal ab.«
Darren war der Älteste von uns. Er ging auf die dreißig zu und hatte ein deutlich regeres Sozialleben als Olivia oder ich. Die Frauen kamen in Scharen, weil sie darauf hofften, mit ihm zu trainieren. Wir wussten beide, was sie außerdem noch wollten, aber bisher hatte er größere Dramen bei der Arbeit erfolgreich vermeiden können.
»Ich denk drüber nach, okay?«
Er bedachte mich mit einem skeptischen Lächeln. »Sag einfach Ja, Mann.«
»Okay, na gut, wir gehen ein Bier zusammen trinken.«
»Cool.«
Ich entspannte mich ein bisschen, froh, dass er nicht weiter nachbohrte. Die nächste Frage überlegte ich mir gut. »Kannst du morgen ein paar Stunden für mich übernehmen? Ich muss vielleicht einige Dinge erledigen.«
»Klar, ich habe morgen frei.«
»Danke.«
Ich nahm eine lange Dusche und freute mich auf den Feierabend. Mein nasses Haar gefror, sobald ich nach draußen trat. Obwohl es immer noch schneite, ging ich zu Fuß. Man wusste nie, was einen auf den Straßen von New York erwartete, auf wen oder was man vielleicht traf. Jeder Tag eröffnete neue Möglichkeiten, das galt für den heutigen ganz besonders.
Den Entschluss, mich in New York niederzulassen, hatte ich schon während eines längeren Aufenthalts hier nach einem Einsatz in Übersee gefasst. Und nach weiteren vier Jahren und drei Einsätzen war es dann soweit: Ich hatte genug. Olivia hatte sich Sorgen gemacht, unsere Eltern lebten in ständiger Angst. Ich hatte alles versucht, um Maya in der Wüste zu vergessen, doch irgendwann war die Zeit gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen.
Maya. Bei jeder langhaarigen Blondine sah ich zweimal hin. Laut Olivia hatte sie sich verändert. Wie? Würde ich sie überhaupt wiedererkennen? Möglicherweise waren wir uns schon einmal irgendwo über den Weg gelaufen, ohne dass ich sie bemerkt hatte.
Nein. Ihr Gesicht würde mir immer und überall auffallen.
Unfassbar, dass sie Olivia nach all der Zeit in die Arme gelaufen war. Das hieß nicht nur, dass sie irgendwo da draußen in der Welt ihr Leben lebte, sondern dass sie ganz in der Nähe war.
Nah genug, um sie zu finden.
2. Kapitel
Maya
Beinahe wäre ich auf dem Holzboden ausgerutscht, als ich die Wohnung betrat. Leichter Schneefall hatte eingesetzt, und für den kurzen Weg von der U-Bahn nach Hause waren meine Manolos nicht gerade das passende Schuhwerk.
Ich fing mich gerade noch und streifte sie ab, dankbar, endlich zu Hause und im Warmen zu sein.
»Trautes Heim, Glück allein!«, sang Eli aus dem Wohnzimmer, das hinter einem Raumtrenner nur einen halben Meter entfernt lag. »Willst du Wein, Süße?«
»Selbstverständlich.«
Daraufhin sprang er von der Couch auf. Wie immer trug er ausgeblichene schwarze Skinny-Jeans und ein T-Shirt von einem der vielen Konzerte, die er in seinem illustren und empörend schlecht bezahlten Job als freier Musikjournalist besucht hatte. Er verschwand in dem kleinen Einbauschrank, von dem unser Vermieter behauptete, es sei eine Küche.