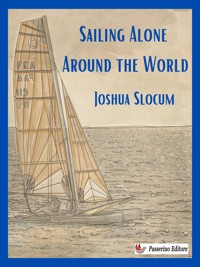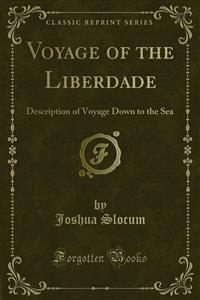Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie würden Sie reagieren, wenn sich ein Besatzungsmitglied plötzlich rühmt, jemand "die Kehle von Ohr zu Ohr" durchgeschnitten zu haben und mit einem Messer vor Ihnen steht? Was der für seine schnellen Reisen weithin bekannte Segelschiffskapitän Joshua Slocum in dieser Situation tat – es ist bezeichnen für das, was ihn zu einer Legende machte: Der erste Mensch zu sein, der in einem – nach heutiger Anschauung – völlig seeuntüchtigen Schiff allein die Welt umrundete. Geschichten gibt es zahlreiche darüber. Wie war denn das eigentlich mit dem abgekochten Wecker als Navigationshilfe? Oder das mit den Reißzwecken? Mit den längst ausgestorbenen Feuerland-Indianern? Man hat wohl hier und dort irgendwann mal etwas davon gehört. Doch Genaues weiß man nicht. Bis jetzt. Hier lesen Sie – endlich auch als E-Book, vom Stammvater aller Solosegler, von Slocum selbst erzählt, wie es wirklich war. Die Maritime E-Bibliothek von Delius Klasing Alte Schätzchen neu aufgelegt: Aus einer Zeit, in der es noch keine E-Books gab, stammen die meisten der Titel der Maritimen E-Bibliothek von Delius Klasing. Nun erhalten Sie diese – inzwischen nicht mehr lieferbaren – Bücher auch als E-Books. Direkt zum Download, direkt zum Loslesen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joshua Slocum
Alleinum die Welt
Er wagte es als erster
Deutsche Übersetzung:Jürgen Hassei
DELIUS KLASING VERLAG
1. Auflage
First published in the United States by Sheridan House, Inc., Dobbs Ferry, New York U.S.A.Licensed by arrangement with The Rowman & Littlefield Publishing Group.All rights reserved.Titel der englischen Originalausgabe: Sailing Alone Around the World: By Captain Joshua Slocum“
Die Rechte für die deutsche Ausgabe liegen beimVerlag Delius Klasing & Co. KG, Bielefeld
Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:ISBN 978-3-667-10596-7 (PDF)ISBN 978-3-667-10597-4 (Epub)
Deutsche Übersetzung: Jürgen Hassel
Umschlaggestaltung: Felix Kempf, www.fx68.deDatenkonvertierung E-Book:HGV Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice, München
Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf dasWerk, auch Teile daraus, nicht vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.
www.delius-klasing.de
INHALTSVERZEICHNIS
ALLEIN UM DIE WELT
Vorwort
Die Wiedergeburt der SPRAY
Erste Erfahrungen als Einhandsegler
Zu den Azoren
Der Steuermann der PINTA
Von Gibraltar nach Pemambuco
Strandung
Einfahrt in die Magellanstraße
Sturm bei Kap Hoorn
Zum zweitenmal durch die Magellanstraße
Auf den Pazifik
Robinsons Insel
Auf Samoa
Nach Australien
Im großen Barrier-Riff
Durch die Torresstraße
Keeling Cocos und Rodriguez
Von Mauritius nach Südafrika
Um das Kap der Guten Hoffnung
St. Helena
Zu den Westindischen Inseln
Der letzte Schlag
Die SPRAY – Technisch gesehen
DIE REISE DER LIBERDADE
Ein Hurrikan, der Passat und ein Pampero
Die ”Bombelia“
Cholera
Ein ruinöser Handelskrieg
Gemischte Fracht
Nächtlicher Überfall
Die Pocken und keine Hilfe
Das Ende der AQUIDNECK
Der Bau der LIBERDADE
Stürmische Jungfernfahrt
Besuch bei Cabo Frio
Unter der Küste von Brasilien
Im Kielwasser von Kolumbus
Von Bahia nach Barbados
Landfall in Nordamerika
In heimatlichen Gewässern
Das weitere Schicksal der LIBERDADE
VORWORT
Joshua Slocum gilt als der Vater aller Einhandsegler. Und wenn er auch nicht der erste Einhandsegler überhaupt war, so war er doch der erste, der allein um die Welt segelte – und darüber schrieb∗. Es gibt kaum ein Buch eines Einhandseglers oder über das Einhandsegeln, in dem nicht irgendwo sein Name oder der seines Fahrzeugs, der SPRAY, auftaucht. In den USA wurde 1944 eines der Liberty-Schiffe JOSHUA SLOCUM getauft. Bernard Moitessier nannte sein vorläufig letztes Schiff JOSHUA – heute bereits Typenbezeichnung einer französischen Werft. Eine ganze Reihe von Bootsbauern und Amateuren versuchte sich im Nachbau der SPRAY∗∗. Und inzwischen gibt es auch eine Slocum-Gesellschaft mit Sitz auf Hawaii, die vor allem Daten über Einhandsegler und ihre Reisen sammelt.
Slocums Leben ist erforscht. Sein ältester Sohn Victor, der im folgenden als Steuermann der AQUIDNECK und Mitglied der kleinen Familiencrew der LIBERDADE auftauchen wird, schrieb 1950 die erste Biographie∗∗∗, Walter M. Teller ließ 1956 eine zweite folgen∗∗∗∗, die auch die weniger liebenswerten Züge des Helden, seinen Verfall im Alter nach der Weltumseglung auf der SPRAY, nicht verschweigt.
Er wurde am 20. Februar 1844 auf der kanadischen Halbinsel Neuschottland geboren. Schon früh paddelte er mit Freunden in kleinen Booten auf dem Wasser herum, lernte aber nie schwimmen. Als er acht Jahre alt war, zog seine Familie nach Briar’s Island: er verließ die Schule und mußte auf der Farm seines Vaters mithelfen. Im Alter von zwölf Jahren wurde er dabei erwischt, wie er im Keller ein Schiffsmodell schnitzte statt Kartoffeln zu sortieren, bekam eine Abreibung, floh von zu Hause und trieb sich die nächsten Jahre als Koch und Schiffsjunge unter den Fischern der Bay of Fundy herum. Mit 16 segelte er vor dem Mast auf einem Vollschiff von St. John’ s auf der Neuschottland gegenüberliegenden Seite der Bay of Fundy nach Dublin. Er hatte sein Ziel erreicht.
Offensichtlich war er weder ein Träumer noch ein Faulenzer, wie das Bild des modellschnitzenden Jungen im Kartoffelkeller suggerieren könnte. Er segelte auf allen möglichen Schiffen unter verschiedener Flagge nach Australien, in die Südsee, rundete zweimal Kap Hoorn und arbeitete sich allmählich empor. Sein erstes Kommando erhielt er 1869 im Alter von 25 Jahren, einen Schoner, der Korn und Kohle zwischen San Francisco und Seattle transportierte. Ein Jahr später ging er als Kapitän mit der Bark WASHINGTON von San Francisco nach Australien und weiter nach Alaska zum Lachsfang. Erst 1867 hatten die Amerikaner Alaska von den Russen gekauft, und so war die WASHINGTON eines der ersten amerikanischen Schiffe in diesen Gewässern. In Sydney hatte Slocum auch seine erste Frau Virginia kennengelernt und geheiratet, und sie begleitete ihn nun auf die 6000 Meilen weite Reise.
Von Australien nahm er auch Holz mit und baute unterwegs an Bord der Bark zwei Dories für den Fischfang. Diese Vorbereitung erwies sich nicht nur als nützlich, sondern wurde bitter nötig. Denn kaum hatte die WASHINGTON Alaska erreicht – die Mannschaft war noch dabei, die Gerätschaften an Land zu bringen –, als sie auch schon in einem Sturm ihren Anker über Grund schleppte und, da sie nur unter Ballast lief, so hoch auf den Strand gesetzt wurde, daß keine Hoffnung bestand, daß sie je wieder aufschwimmen könnte. Dies war wohl die erste gefährliche Situation, in der Slocum seine Qualitäten bewies. Jedenfalls gab er nicht auf, schaffte alles Notwendige an Land und setzte eine Saison lang mit angeheuerten Indianern den Lachsfang erfolgreich fort. Die Fische blieben in Fässern eingesalzen an Ort und Stelle, während Slocum und seine Mannschaft in den beiden Fischerdories und einem neugebauten 35 Fuß langen Walfänger durch die Tiden zum nächsten Hafen kreuzten. Dort fanden sie auch zwei Schoner, die den Fisch zum Verkauf herbeiholten. Wenn die Eigner der WASHINGTON den Verlust ihres Schiffes auch bedauerten, so waren sie mit ihrem Kapitän dennoch zufrieden, denn sie gaben ihm sofort ein neues Schiff, die Barkantine CONSTITUTION, mit der er zwischen San Francisco, Sydney und den Südseeinseln herumsegelte.
Von einer der Reisen der CONSTITUTION wird auch ein Vorfall berichtet, der die Leser dieses Buches interessieren dürfte. Auf der Fahrt von Honolulu nach San Francisco zerbrach der Schiffschronometer. Slocum hätte umkehren oder doch wenigstens mit großer Verspätung rechnen müssen. Aber er verließ sich auf die alte Methode der Zeitberechnung nach Monddistanzen; er war ohnehin gewohnt, die Genauigkeit seines Chronometers durch Mondbeobachtungen zu überprüfen. So machte er eine ungewöhnlich schnelle Reise, und die Eigner der CONSTITUTION dankten ihm mit einer goldenen Uhr. Wer heute die Nautischen Almanache aufschlägt, findet keine Tabellen mehr für Monddistanzen. So bleibt ihm vielleicht auch unverständlich, daß Slocum auf seiner Reise um die Welt mit der SPRAY mit einem Blechwecker auskam, der schließlich auch noch seinen Minutenzeiger verlor und nur die Stunden anzeigte, nachdem er ihn ”gekocht“ hatte – vermutlich um das Salz, das sich in der Seeluft angesetzt hatte, herauszudestillieren. Für ihn waren das alles Selbstverständlichkeiten, aber wir bedauern heute, daß er in diesen und anderen Punkten, die Navigation und Seemannschaft betreffen, in seinen Büchern so wenige Einzelheiten berichtet hat.
1873 segelte er auf der Bark BENJAMIN AYMAR zwischen San Francisco, Australien und Shanghai, bis sie in Manila verkauft wurde. Gleich an Ort und Stelle unterzeichnete er den Kontrakt für den Bau eines Dampfers. Wer schon Dories und einen 35 Fuß langen Walfänger gebaut hatte – das schien überhaupt seine bevorzugte Länge zu sein: die LIBERDADE war 35 Fuß und die SPRAY nur wenig länger –, der konnte sich auch an ein Dampfschiff von 150 Tonnen wagen. Er baute es – aus dem frischen Holz des Urwaldes, 60 Meilen von Manila entfernt; die Familie hauste solange in einer selbstgezimmerten Hütte am Strand, gegen den Widerstand und die Intrigen der einheimischen Schiffszimmerleute. Nach dem Stapellauf bekam er als Bezahlung für die Arbeit einen Schoner von 90 Tonnen, die PATO. Man könnte glauben, die Figur des Kapitäns Slocum sei einem der Romane Joseph Conrads entsprungen, der etwa anderthalb Jahrzehnte später ja auch als Steuermann und Kapitän der OTAGO in diesen Gewässern kreuzte.
Mit der PATO übernahm Slocum sogleich die schwierige und abenteuerliche Aufgabe, die kostbare Ladung einer britischen Bark zu retten, die420 Meilen vor Manila auf einem Riff gestrandet war. In zwei Wochen schaffte er drei Fahrten zwischen Manila und dem Wrack; bei der vierten Fahrt drehte der Wind, und das Wrack rutschte vom Riff in die Tiefe. Er segelte die PATO nach Hongkong. Ein paar Fischereigeräte, die er dort in einem der Schapps des Schiffs fand, erinnerten ihn an alte Zeiten, und er fuhr die 2900 Meilen bis nach Petropawlowsk auf der Kamtschatka-Halbinsel, um im Ochotskischen Meer Kabeljau zu fischen. Von dort ging es über weitere 2900 Meilen bis nach Victoria an der kanadischen Westküste. Dann wieder kreuzte die PATO in der Südsee. Als in Honolulu das Postschiff einen Sack mit Post auf dem Kai vergessen hatte, schnappte ihn sich Slocum und segelte hinter dem schnellen Schoner her. Was außer ihm niemand für möglich gehalten hatte, er holte ihn ein und übergab die Post. Mit schnellen Reisen unter Segel konnte man sich damals einen Namen machen wie heute vielleicht nur mit einer Olympia-Medaille oder dem Gewinn des Fastnet-Race. Slocum verkaufte die PATO ”für einen Beutel Gold“.
Mit dem Gold wurde er Anteilseigner an einer alten Bark von 400 Tonnen, der AMETHYST. Er transportierte mit ihr Holz von den Philippinen nach China, Kohle von Nagasaki nach Wladiwostok, Eis von Hakodate nach Hongkong, Schießpulver von Shanghai nach Hainan usw., bis er sie schließlich verkaufte; sie wurde dann noch als Walfänger eingesetzt und ging in der Arktik verloren.
Nach 1880 segelte er als Anteilseigner eine Zeitlang das Vollschiff NORTHERM LIGHT, ”das schönste Segelschiff der amerikanischen Handelsflotte“. Und schließlich kaufte er die kleine, aber schnelle Bark AQUIDNECK. Mit ihr segelte er von den USA nach Südamerika, wo 1885 seine erste Frau Virginia im Alter von 34 Jahren starb. Knapp zwei Jahre später heiratete er wieder. Henrietta Elliot, eine entfernte Verwandte, 24 Jahre alt; Slocum war damals 42.
Die AQUIDNECK war sein letztes Kommando. Mit seiner jungen Frau, seinem 14 Jahre alten Sohn Victor als Steuermann und dem fünf Jahre alten Garfield – beide wie Slocums alle vier Kinder auf See oder in einem fremden Hafen geboren – segelte er am 28. Februar 1886 von New York nach Südamerika. Es ist die ereignisreiche Reise, die er in seinem ersten Buch, der ”Reise der Liberdade“ (hier als zweites abgedruckt), beschreibt∗∗∗∗∗. Sie endete mit dem Schiffbruch der AQUIDNECK und dem Bau der LIBERDADE, einem sehr flachgehenden Boot von 35 Fuß Länge, das dem Typ nach irgendwo zwischen einem Cape-Ann-Dory und einem chinesischen Sampan lag. Über fast 6000 Meilen segelte er die LIBERDADE mit seiner Familie von der Baia de Paranaguá nach Hause; am 27. Dezember 1888 traf sie in Washington ein.
Die ”Reise der LIBERDADE“, in der ja zum größeren Teil die Reise mit der AQUIDNECK beschrieben wird, gibt einen guten Einblick in Slocums Leben als Kapitän der Handelsschiffahrt, wenn es wohl auch nicht immer in solcher Aneinanderreihung von Katastrophen bestanden hatte. Die Selbstverständlichkeit und Ausdauer, mit der er diese Unglücksfälle erträgt – Krankheit, Meuterei, Raub, Schiffbruch – und mit der er sich sofort nach der Strandung der AQUIDNECK an den Bau eines neuen Bootes macht, ist bezeichnend für seinen Charakter. Nach der Rückkehr lebte er noch eine Zeitlang auf der LIBERDADE und stellte sie in verschiedenen amerikanischen Häfen aus; sein ganzes Vermögen war ja mit der AQUIDNECK in den Wassern des Paranaguá versunken. Das Boot wurde schließlich in der berühmten Smithsonian Institution in Washington ausgestellt, und Slocum schrieb seinen lebendigen Bericht.
Ein neues Kommando fand er nicht wieder – die Zeit der großen Segelschiffe war allmählich vorbei. Doch als er 1892 die alte SPRAY auf einem Feld bei Fairhaven sah, kam ihm wohl der Gedanke, eine ähnliche Fahrt zu wiederholen und damit auch den Erfolg seiner ersten Veröffentlichung – ein Motiv, das sich bei Einhandseglern nicht gerade selten findet. Es wurde die erste Weltumseglung allein in einem kleinen Schiff.
Die SPRAY, die er sah, war eine verrottete Hulk, die wahrscheinlich schon kurz nach 1800 an der amerikanischen Ostküste als Austernfischer Dienst getan hatte. Mit ihren 36 Fuß 9 Zoll Länge über Deck war sie klein wohl nur im Vergleich zu den Vollschiffen und Barken, die er vorher gesegelt hatte. Sie war schwer gebaut, immerhin fast 15 Fuß breit (was einem Längen-Breiten-Verhältnis von 2,6 entspricht), hatte ein unhandliches Bugspriet, einen schweren, langen Baum und ein entsprechend riesiges Großsegel. Ihr Hauptvorteil war ihre Kursstabilität, auf die Slocum auch nicht wenig stolz war. Aber ihre Segeleigenschaften am Wind und bei wenig Wind müssen nicht besonders gut gewesen sein. Zwar war sie auf Grund der enormen Breite recht steif, aber verglichen mit einer modernen Segelyacht hatte sie nur eine geringe Endstabilität; sie hatte keinerlei Ballast unter dem Kiel. Kein vernünftiger Mensch würde sich heute in einem solchen Boot auf eine Reise um die Welt wagen. Selbst Kenneth E. Stack, ausgewiesener Bewunderer der SPRAY, schreibt, daß sie neben der modernen Yacht als ”langsam, plump und unhandlich“ erschien: ”Ein solches Fahrzeug in den überfüllten Häfen und an den von Dampfern nur so wimmelnden Küsten von heute zu segeln, erfordert viel mehr Geschicklichkeit, als sie der normale Eigner besitzt. Und schließlich gibt es unter uns nur wenige, die sich darin mit Kapitän Slocum messen können.“
Slocum war von den Qualitäten seiner SPRAY überzeugt, und die Unkompliziertheit seiner Reise gab ihm dazu wohl auch ein gewisses Recht, obwohl wir heute eher seine Seemannschaft, sein Können und seine Vorsicht, dafür verantwortlich machen möchten. Trotz allen Lobes für das Fahrzeug kürzte er das Bugspriet, den Mast und den Baum und setzte schließlich auch noch einen Besanmast, machte aus dem Kutter- ein Yawlrigg und unterteilte damit die große Segelfläche.
Er selbst bezeichnete die SPRAY allerdings vor und nach der Umwandlung hartnäckig als Slup. Slup nennen wir eigentlich ein Fahrzeug mit einem Mast, Großsegel und Stagfock. Die SPRAY hatte aber zunächst neben dem Großsegel und dem Stagsegel noch einen Klüver und setzte dazu gelegentlich noch einen Außenklüver oder Flieger; damit war sie eindeutig als Kutter ausgewiesen. Mit dem kleinen Heckmast, dem Treiber oder Besan, hatte sie ein Yawlrigg. Die Begriffsverwirrung löst sich freilich auf, wenn man weiter nachforscht. Schon Frederick af Chapman hatte in seiner ”Architectura Navalis Mercatoria“ von 1769 den Segelriß einer ”Slup“ mit drei Vorsegeln (und dazu zwei Rah-Toppsegeln) wiedergegeben. John Leather geht in seinem schönen Buch über das Gaffelrigg∗∗∗∗∗∗ auf die Entwicklung der Begriffe ”Slup“ und ”Kutter“ im 19. Jahrhundert ein. An den englischen Küsten und an der amerikanischen Ostküste wurde demnach mit Slup ein Schiff bezeichnet, das breiter, langsamer und flacher war als der Kutter, obwohl sich beide im Rigg ähnlich sein konnten. Bei der Slup wurden lediglich Stagsegel und Klüver an festen Stagen gefahren, die zugleich den Mast abstützten; das Bugspriet war ein fester Baum. Beim Kutter hingegen wurden die Vorsegel fliegend gefahren, das heißt sie wurden praktisch am Vorliek gesetzt; das Bugspriet konnte infolgedessen eingerannt werden. Der Unterschied im Rigg scheint allerdings nicht so wichtig gewesen zu sein wie der in den Linien des Rumpfes: Slups dieser Art waren vor allem Fischereifahrzeuge, Kutter zunächst vor allem Zollsegler, die schneller sein mußten als ihre Gegner, die Schmuggler. Nichts hindert uns also daran, anzunehmen, daß Slocum den Begriff ”Slup“ einfach als Typenbezeichnung für ein kleines, einmastiges Fischereifahrzeug gebrauchte, das ziemlich breit und relativ flach war. Daß er diese Bezeichnung auch nach dem Umbau zur Yawl beibehielt, erklärte er selbst: Der Besan war nur als vorübergehende Einrichtung gedacht.
Joshua Slocum segelte mit seiner ”Slup“ SPRAY am 24. April 1895 von Boston ab – er war damals 51 Jahre alt – und ankerte nach etwas mehr als drei Jahren am 27. Juni 1898 wieder vor Newport. Die erste Einhandreise um die Welt war vollbracht.
Bald erschien die Geschichte der Reise kapitelweise im ”Century Magazine“ – was ein aufmerksamer Leser dem Buch heute noch anmerkt – und etwas später als Buch. Auf einer Reise durch die amerikanischen Häfen, in denen er Vorträge hielt und die SPRAY ausstellte, sammelte er Anerkennung und Geld für seinen Lebensunterhalt, kaufte schließlich in der Nähe von Martha’s Vineyard eine Farm, die allerdings nie genug für den Lebensunterhalt abwarf; seine Familie konnte dort leben, während er ruhelos auf dem Wasser blieb und die SPRAY an der Küste entlangsegelte, im Winter mehrmals bis in die Karibik. 1906 bekam er Ärger, als die Eltern eines zwölf Jahre alten Mädchens ihn wegen Notzucht anklagten; der Fall wurde nie aufgeklärt, die Anklage später fallengelassen, aber Slocum hatte 42 Tage in Haft gesessen. Ob dieser Vorfall seine Zielstrebigkeit und Widerstandskraft brach, oder ob er schon lange über den ”point of no return“ hinaus war? Ein Yachtsegler, der ihn kannte, beschrieb den alternden Slocum als ”einen fähigen, aber einsamen und unglücklichen Mann“.
Im Alter von 65 Jahren ging er auf eine neue weite Reise – sein Ziel war Südamerika, er wollte den Orinoko hinauf bis zu den Quellen des Amazonas. Eine andere Version ist, daß er nur plante, die kalte Jahreszeit auf den wärmeren Westindischen Inseln zu verbringen, ”einfach nur, um keinen Wintermantel kaufen zu müssen“, soll er gesagt haben. Am 4. November 1909 segelte er die SPRAY aus Vineyard Haven hinaus und wurde nie wieder gesehen.
Es gab und gibt natürlich eine ganze Menge Theorien darüber, was ihm passiert sein könnte. Sein Sohn Victor rechnete aus, daß er mehrere Dampfer-Tracks kreuzte; er hielt es für wahrscheinlich, daß die SPRAY von einem Dampfer überrannt wurde, als Slocum unter Deck war, kochte, las oder schlief und sein Schiff sich wie gewöhnlich selbst steuern ließ. Andere haben nachgewiesen, daß er gleich nach dem Auslaufen in einen schweren Sturm geriet. Zwar hatte Slocum schon Stürme jeder Art gemeistert, und die SPRAY war auch noch nicht besonders alt; aber sie war aus frischem, unabgelagertem Holz gebaut worden und hatte in den letzten Jahren schon oft repariert werden müssen. So leuchtet vielleicht die Erklärung, die D.H. Clarke gibt, am meisten ein∗∗∗∗∗∗∗:
”Slocum war 65, die SPRAY nur 15 Jahre alt seit ihrer Wiedergeburt, aber wahrscheinlich waren beide gleich wenig seetüchtig. Der Kapitän litt bisweilen an Ohnmachtsanfällen, vielleicht als Folge eines Schlags an den Kopf aus dem Jahre 1896; die SPRAY litt unter nur gelegentlicher, fast nicht vorhandener Pflege: Sie war ’ziemlich verkommen‘, um nur einen Kommentar zu zitieren. … Er hatte seine Berühmtheit genossen und lechzte nach mehr Anerkennung. Doch sein Vertrauen in seine Fähigkeit und die seines Schiffes, alle Gefahren der See zu überleben, stimmte nicht mehr mit der Wirklichkeit überein; wir werden nie wissen, wer von beiden in diesem letzten Kampf gegen die Elemente versagte.“
∗ ”Sailing Alone Around the World“ erschien als Buch zuerst in den ”Blue Ribbon Books“, New York 1899.
∗∗ Kenneth E. Slack: In the Wake of the SPRAY. Rutgers University Press, New Brunswick, N.J., 1966, gibt eine liebevoll-genaue Untersuchung der SPRAY und ihrer Nachbauten.
∗∗∗ Victor Slocum: Captain Joshua Slocum. Sheridan House, New York 1950.
∗∗∗∗ Walter M.. Teller: The Search for Captain Slocum. Charles Scribner’s Sons, New York 1956.
∗∗∗∗∗ ”Voyage of the LIBERDADE“ erschien als Buch zuerst im Jahre 1894.
∗∗∗∗∗∗ John Leather: Gaff Rigg. Adlard Coles, London 1970.
∗∗∗∗∗∗∗ D. H. Clarke: An Evolution of Singlehanders. Stanford Maritime, London 1976.
ALLEINUM DIE WELT
DIE WIEDERGEBURT DER SPRAY
Die Vorfahren: Blaujacken mit Neigung zum Yankeetum – Jugendliche Liehe zur See – Kapitän der Northern Light – Schiffbruch mit der Aquidneck – Heimreise mit der Liberdade – Ein ”Schiff“ als Geschenk – Der Neubau der Spray – Rätsel um die Finanzierung und das Kalfatern – Der Stapellauf der Spray.
Im schönen Neuschottland, einer kanadischen Küstenprovinz, gibt es einen Bergrücken, North Mountain genannt, von dem man zur einen Seite auf die Bay of Fundy und zur anderen auf das fruchtbare Annapolistal hinabschauen kann. An seinem Nordhang wächst die widerstandsfähige Rottanne, deren Holz unter dem Namen Spruce gut für den Schiffbau geeignet ist. Die Menschen von dieser Küste, ebenso widerstandsfähig, robust und stark, spielen im Handel der Welt durchaus eine Rolle, und es spricht nicht gegen den Schiffsführer, wenn in seinen Papieren als Geburtsort Neuschottland steht. Ich wurde an einem kalten 20. Februar in einer kalten Ecke, da wo es im North Mountain am kältesten ist, geboren, obwohl ich Bürger der Vereinigten Staaten bin – ein naturalisierter Yankee, wenn man nicht überhaupt die Neuschottländer als Yankees im wahrsten Sinne des Wortes bezeichnen will. Auf beiden Seiten meiner Familie gab es Seeleute; und wenn ein Slocum nicht zur See fährt, so schnitzt er doch wenigstens Schiffsmodelle oder träumt von weiten Reisen. Mein Vater war ein Mensch, der an einer einsamen Insel Schiffbruch erleiden konnte und doch immer den Weg nach Hause gefunden hätte, vorausgesetzt, er besaß ein Taschenmesser und fand einen Baum. Er hatte einen guten Blick für Schiffe, doch die alte Lehmfarm, an die er zu seinem Unglück geraten war, hielt ihn fest wie ein Anker. Er hatte keine Angst vor einer Mütze voll Wind, und er verdrückte sich auch nie nach hinten bei einer Zeltmission oder einer der guten, altmodischen Versammlungen der Erweckungsbewegungen.
Was mich selbst betrifft – die wunderbare See bezauberte mich von Anfang an. Schon mit acht Jahren schaukelte ich – mit guter Aussicht zu ertrinken – mit anderen Jungen auf der Bucht herum. Als junger Bursche übernahm ich den wichtigen Posten des Kochs auf einem Fischschoner. Doch ich stand nicht lange in der Kombüse, denn die Mannschaft meuterte beim Anblick meines ersten Puddings und setzte mich an die Luft, bevor ich mich als Kochkünstler hervortun konnte. Der nächste Schritt zum Gipfel meines Glücks führte mich vor den Mast eines Vollschiffes auf großer Fahrt. So kam ich schließlich von der Back und nicht aus der Offiziersmesse zu einem Schiffskommando.
Mein bestes Kommando war die prachtvolle NORTHERN LIGHT, an der ich Miteigner war. Ich hatte Grund, stolz auf sie zu sein, denn zu jener Zeit – in den achtziger Jahren – war sie das schönste Segelschiff der amerikanischen Handelsflotte. Später besaß und segelte ich die AQUIDNECK, eine kleine Bark, die mir von allen Schöpfungen aus Menschenhand dem Ideal der Schönheit am nächsten zu kommen schien und die bei gutem Wind auch so schnell war, daß sie es mit Dampfschiffen aufnehmen konnte. Ich war fast zwanzig Jahre lang Schiffsführer gewesen, als ich mit ihr an der brasilianischen Küste strandete. Die Heimreise machte ich zusammen mit meiner Familie in dem Kanu LIBERDADE – ohne jeden Zwischenfall.
Meine Reisen gingen alle in die Ferne. Ich segelte als Händler in der Trampschiffahrt hauptsächlich nach China, Australien und Japan und zu den Gewürzinseln. Mir gefiel das Leben nicht, bei dem man erst lange seine Leinen an Land aufschießen mußte – Sitten und Gebräuche, die ich schließlich auch ganz vergessen hatte. Und als dann die Zeiten für Frachtsegler schlecht wurden und ich die Seefahrt aufgeben wollte – was gab es da für einen alten Seebären zu tun? Ich war im Seewind geboren, hatte wie kaum ein anderer die See durchforscht und dabei alles andere vernachlässigt. Nach der Seefahrt zog mich eigentlich nur der Schiffbau an. Ich wollte Meister in beiden Berufen werden, und in kleinem Maßstab erfüllte sich mit der Zeit auch dieser Wunsch. In den schwersten Stürmen hatte ich an Deck stolzer Schiffe Berechnungen angestellt, wie groß und von welchem Typ ein Schiff sein müßte, das bei jedem Wetter und jeder See sicher sein sollte. So war die Reise, über die ich hier berichte, nicht nur ein natürliches Ergebnis meiner Abenteuerlust, sondern auch meiner lebenslangen Erfahrung.
Es war an einem Mittwintertag des Jahres 1892 in Boston, wo mich ein oder zwei Jahre zuvor der alte Ozean an Land gespült hatte. Ich zögerte noch, ob ich mich um ein Kommando bewerben und mein Brot wieder auf See verdienen oder ob ich zum Arbeiten auf die Werft gehen sollte. Da traf ich einen alten Bekannten, einen Walfangkapitän, der zu mir sagte: ”Komm nach Fairhaven, ich gebe dir ein Schiff. Aber“, fügte er hinzu, ”es muß etwas überholt werden.“ Nach ein paar näheren Angaben war ich mehr als zufrieden mit dem Angebot. Es schloß alle Hilfe mit ein, die ich brauchte, um das Fahrzeug seetüchtig zu machen. Ich schlug freudig ein, denn ich hatte schon herausgefunden, daß ich auf der Werft nur dann Arbeit erhalten würde, wenn ich zuvor SO Dollar an eine Gesellschaft bezahlte. Und was ein Schiffskommando anging – es gab nicht mehr genug Schiffe. Fast alle unsere großen Schiffe waren abgeriggt und in Kohlenhulks umgewandelt worden und wurden jetzt von Hafen zu Hafen geschleppt, während viele ehrenwerte Kapitäne sich aufs Altenteil zurückgezogen hatten.
Am nächsten Tag landete ich in Fairhaven und stellte fest, daß mein Freund sich einen Spaß erlaubt hatte. Das Schiff, sieben Jahre lang in seinem Besitz, erwies sich als eine ziemlich antiquierte Slup mit dem Namen SPRAY, die nach Meinung der Nachbarn etwa im Jahre 1 gebaut worden war. Sie stand sorgfältig aufgebockt auf freiem Feld in einiger Entfernung vom Salzwasser und war mit einer Persenning abgedeckt. Die Leute aus Fairhaven sind sparsam und neugierig. Sieben Jahre lang hatten sie sich gefragt, was wohl Kapitän Eben Pierce mit der alten SPRAY anfangen würde. Mein Erscheinen gab dem Geklatsche neuen Auftrieb. Endlich war jemand gekommen und begann auch tatsächlich, an der alten SPRAY zu arbeiten. ”Er schlachtet sie aus, denk’ ich mir.“ ”Nein, er baut sie um!“ Die Verwunderung war groß. ”Wird sich das bezahlt machen?“ war die Frage, auf die ich ein Jahr lang immer wieder antwortete, ich würde schon dafür sorgen.
Mit meiner Axt fällte ich in der Nähe eine stämmige Eiche für den Kiel, die mir der Farmer Howard gegen ein kleines Entgelt zusammen mit genug anderem Holz für den Spantbau heranschleppte. Ich riggte einen Dampfkasten und einen Topf als Kessel. Für die Spanten verarbeitete ich Frischholz; sie wurden ausgelaugt und gedämpft, bis sie schmiegsam waren, und dann über einem Klotz gebogen, wo sie bis zum Einbau blieben. Irgend etwas war jeden Tag zu tun, und die Nachbarn machten die Arbeit zu einem geselligen Unternehmen. Es war ein großer Tag auf der SPRAY – Werft, als der neue Vorsteven aufgestellt und an dem neuen Kiel befestigt wurde. Walfangkapitäne kamen von weit her, um die Arbeit zu begutachten. Ihr einstimmiges Urteil war: ”Eins A“ und ”Damit kann man Eis brechen.“ Der älteste Kapitän schüttelte mir herzlich die Hand, als die Bugbänder eingesetzt wurden, und erklärte, er sehe keinen Grund, warum die SPRAY sich nicht sogar mit einem Grönlandwal einlassen sollte. Das so hochgelobte Stevenholz stammte vom unteren Stamm einer kräftigen Steineiche. Später, auf Keeling Island, zersplitterte es einen Korallenstock und bekam nicht einmal einen Kratzer ab. Es gibt kein besseres Holz für ein Schiff. Die Bugbänder und alle Spanten waren aus diesem Holz.
Es ging schon weit in den März hinein, als ich ernsthaft mit der Arbeit begann; das Wetter war kalt, aber meine ”Inspektoren“ erschienen noch recht zahlreich, um mich mit Rat zu unterstützen. Wenn ein Walfangkapitän in Sicht kam, ruhte ich mich eben eine Zeitlang auf meiner Krummaxt aus und hielt ein Schwätzchen mit ihm.
New Bedford, die Heimat der Walfangkapitäne, ist mit Fairhaven über eine Brücke verbunden, und so lag mein Arbeitsplatz für sie gerade in der Reichweite eines kleinen Spaziergangs. Für mich blieben sie nie zu lange. Und ihr amüsantes Garn über den Walfang in arktischen Gewässern inspirierte mich auch dazu, die Bugbänder der SPRAY doppelt so stark zu machen, damit sie vielleicht sogar Eis beiseite schieben konnte.
Die Jahreszeiten vergingen schnell während meiner Arbeit. Vor der Apfelblüte standen kaum die Spanten. Bald blühten Gänseblümchen und Kirschen. Dicht neben dem Platz, wo sich die alte SPRAY jetzt allmählich auflöste, ruhte die Asche von John Cook, einem der verehrten Pilgerväter. Vom Deck aus konnte ich Kirschen pflücken, die über dem kleinen Grab wuchsen. Bald konnte ich auch die Planken des neuen Schiffs aufbringen; sie bestanden aus 1½ Zoll dicker Georgiakiefer. Das Aufplanken war zeitraubend, doch das Kalfatern wurde dann um so leichter.
Nach außen waren die Nähte für die Kalfaterung leicht offen, aber nach innen standen die Plankengänge so dicht aneinander, daß ich kein Tageslicht zwischen ihnen hindurchschimmern sehen konnte. Alle Planken waren fest mit den Spanten verbolzt und verschraubt, so daß ich von daher keinen Ärger zu erwarten hatte. Insgesamt verarbeitete ich etwa tausend Schraubbolzen und Muttern in der gesamten Konstruktion. Ich wollte ein stämmiges und widerstandsfähiges Schiff haben.
Nun gibt es bei Lloyd’s eine Bestimmung, die besagt, daß die JANE selbst dann noch die JANE bleibt, wenn vor lauter Überholen und Reparieren kein ursprüngliches, altes Teil mehr an ihr ist. Die SPRAY verwandelte sich so allmählich, daß man kaum sagen konnte, wann die alte starb und die neue geboren wurde, und im übrigen war das auch egal. Die Schanzkleidstützen machte ich aus weißer Eiche, 14 Zoll hoch, und deckte sie mit ⅞ Zoll dickem Kiefernholz. Die Stützen, die durch das 2 Zoll dicke Schandeck genutet waren, dichtete ich mit dünnen Keilen aus Zedernholz ab. Bisher sind sie immer dicht geblieben. Das Deck fertigte ich aus Kiefernplanken von 1½ × 3 Zoll, die ich auf die 6 × 6 Zoll dicken Decksbalken nagelte, die aus gelber oder Georgiakiefer bestanden und im Abstand von jeweils 3 Fuß verlegt waren. Es gab einen Decksaufbau von 6 × 6 Fuß über dem Hauptluk für eine Kombüse und einen zweiten von 10 × 12 Fuß weiter achtern für eine Kajüte. Beide hatten eine Höhe von etwa 3 Fuß über Deck und reichten so tief in den, Schiffsraum hinunter, daß ich Stehhöhe hatte. Seitlich von der Kajüte baute ich unter Deck eine Koje und Borde für kleinere Ausrüstungsgegenstände ein, wobei ich auch einen Platz für die Bordapotheke nicht vergaß. Mittschiffs, also zwischen Kajüte und Kombüse, war unter Deck genügend Raum für Wasser, Pökelfleisch und anderen Proviant, mit dem ich viele Monate auskommen konnte.
Als nun der Rumpf meines Fahrzeugs so fest zusammengebaut war, wie es mit Holz und Eisen eben ging, und die verschiedenen Räume unter Deck abgeteilt waren, machte ich mich an das Kalfatern. Einige meiner ”Inspektoren“ hatten schwerwiegende Bedenken, daß ich an diesem Punkt scheitern könnte. Ich hatte auch schon überlegt, das Kalfatern einem professionellen Bootsbauer zu überlassen. Beim ersten Schlag mit dem Kalfateisen auf die Baumwolle, wie ich ihn für richtig hielt, erklärten mir denn auch andere, ich machte es ganz falsch. ”Sie wird herausgedrückt!“ rief ein Mann aus Marion, als er mit einem Korb voll Muscheln auf dem Rücken vorbeiging. ”Sie wird herausgedrückt!“ rief ein anderer aus West Island, als er sah, wie ich Baumwolle in die Nähte stemmte. Bruno wedelte einfach nur mit dem Schwanz. Selbst Mr. Ben J., eine bekannte Autorität auf Walfangschiffen, dessen Ansichten allerdings, wie man sagte, schralten wie der Wind, fragte ganz im Vertrauen, ob ich nicht glaubte, daß sie herausgedrückt würde. ”Wie schnell wird sie herausgedrückt?“ schrie mein alter Kapitänsfreund, der schon von so manchem leibhaftigen Pottwal in Schlepp genommen worden war. ”Sag uns, wie schnell, damit wir rechtzeitig in den Hafen kommen.“ Doch ich trieb über die Baumwolle einen Strang geteertes Werg in die Naht, wie ich es von Anfang an beabsichtigt hatte. Und Bruno wedelte wieder mit dem Schwanz. Die Baumwolle wurde nie ”herausgedrückt“. Als das Kalfatern beendet war, klatschte ich zwei Schichten Kupferfarbe auf das Unterwasserschiff und zwei Schichten Bleiweiß auf das Überwasserschiff und das Schanzkleid. Dann hängte ich das Ruder ein, malte es, und am folgenden Tag lief die SPRAY vom Stapel. Als sie vor ihrem alten, rostigen Anker schwoite, lag sie auf dem Wasser wie ein Schwan.
Die Abmessungen der SPRAY waren 36 Fuß 9 Zoll Länge über alles, 14 Fuß 2 Zoll Breite und 4 Fuß 2 Zoll Tiefgang; ihr Nettoraumgehalt betrug 9 tons und ihr Bruttoraumgehalt 12, 7 tons.
Dann setzte ich den Mast aus kräftigem New-Hampshire-Spruce und brachte all die kleinen Dinge an, die für eine kurze Küstenfahrt nötig waren. Die Segel wurden angeschlagen, und die SPRAY flog mit Kapitän Pierce und mir an Bord auf ihrer Jungfernfahrt über die Buzzard’s Bay. Das einzige, was meine Freunde entlang der Küste jetzt noch beunruhigte, war die Frage: ”Wird sie sich auch bezahlt machen?“ Die Kosten für mein neues Fahrzeug betrugen 553,62 Dollar für Materialien; hinzu kamen 13 Monate eigener Arbeit. Freilich blieb ich ein paar Monate länger in Fairhaven; denn ab und zu bekam ich unten im Hafen Gelegenheitsarbeit bei der Ausrüstung eines Walfängers.
ERSTE ERFAHRUNGEN ALS EINHANDSEGLER
Mißerfolg als Fischer – Eine Reise um die Welt wird geplant – Von Boston nach Gloucester – Ausrüsten für den Ozean – Ein halbes Dory als Beiboot – Von Gloucester nach Neuschottland – Durchgeschüttelt in heimischen Gewässern – Unter alten Freunden.
Eine Saison lang versuchte ich mich mit meinem neuen Boot in der Küstenfischerei – um herauszufinden, daß ich nicht geschickt genug war, einen Köder an den Haken zu bekommen. Doch schließlich war es an der Zeit, ankerauf und ernsthaft auf große Fahrt zu gehen. Ich hatte beschlossen, eine Reise um die Welt zu machen. Und als der Wind am Morgen des 24. April 1895 günstig war, lichtete ich um die Mittagszeit den Anker, setzte Segel und schlich mich von Boston fort, wo die SPRAY den ganzen Winter über sicher vermurt gelegen hatte. Die Zwölf-Uhr-Sirenen heulten gerade auf, als die Slup unter Vollzeug ihre Reise antrat. Auf Steuerbordbug machte ich einen kurzen Schlag quer über den Hafen, und nach der Wende hielt ich hinaus auf See, das Groß weit nach Backbord ausgebaumt, mit leichter Krängung vorbei an den Fähren. Ein Fotograf machte auf der Außenpier in East Boston ein Bild, als die SPRAY mit wehender Flagge in der Piek an ihm vorbeirauschte. Mein Herz schlug bis zum Hals. Leichtfüßig lief ich in der frischen Luft an Deck herum. Ich fühlte, daß es kein Zurück gab und daß ich mich auf ein Abenteuer eingelassen hatte, über dessen Bedeutung ich mir völlig im klaren war. Ich hatte jeden guten Rat in den Wind geschlagen, denn ich hatte ein Recht auf meine eigene Meinung in allem, was die See betraf. Daß die besten Seeleute mehr Pech haben konnten als ich als Einzelgänger, wurde mir kaum eine Meile vor den Bostoner Docks klar, wo ein großes Dampfschiff mit voller Mannschaft, Offizieren und Lotsen gestrandet war. Es war die VENETIAN. Über einem Riff war sie in zwei Teile auseinandergebrochen. So bekam ich in der ersten Stunde meiner einsamen Reise den Beweis, daß die SPRAY zumindest diesem vollbemannten Dampfschiff überlegen war; denn ich war ja immerhin schon etwas weiter gekommen. ”Nimm die Warnung ernst, SPRAY, und gib acht“, rief ich meinem Schiff laut zu, als es feenhaft leise die Bucht hinuntersegelte.
Der Wind frischte auf, und die SPRAY rundete Deer Island problemlos mit sieben Knoten Fahrt.
Dann lief sie vor raumem Wind direkt auf Gloucester zu, wo ich mir noch ein paar Dinge für den Fischfang beschaffen wollte. Die Wellen tanzten lebhaft über die Massachusetts Bay und zerstieben in Myriaden glänzender Tropfen, wenn die Slup mit ihrem Bug in eine See einschnitt. Der Tag war wunderbar, die Sonne schien klar und stark. Jeder Wassertropfen verwandelte sich in der Luft in einen Edelstein, und so fing sich die SPRAY immer wieder ein neues Geschmeide aus der See auf und warf es ebenso rasch wieder ab. Wir alle haben gelegentlich schon den Miniaturregenbogen am Bug eines Schiffes gesehen, doch an diesem Tag erschuf sich die SPRAY einen eigenen Regenbogen, der sie ganz einhüllte, wie ich ihn nie zuvor gesehen hatte. Ihr Schutzengel war mit auf die Reise gegangen: so las ich es aus der See.
Bold Nahant lag bald querab, dann ließen wir Marblehead achteraus. Andere Fahrzeuge gingen hinaus, aber keines überholte die SPRAY, die allein auf ihrem Kurs entlangflog. Ich hörte die Warnglocke von Norman’s Woe, als wir vorbeizogen; und wir liefen dicht an dem Riff vorbei, auf dem der Schoner HESPERUS gestrandet war. Die ausgebleichten ”Knochen“ eines Wracks lagen dicht bei dicht auf dem Strand. Da der Wind noch weiter auffrischte, holte ich die Klau des Großsegels ein wenig nieder, um das Ruder zu entlasten; denn mit dem vollen Groß konnte ich die Slup kaum auf dem Ruder halten. Ein Schoner voraus barg alle Segel und lief vor Topp und Takel in den Hafen. Als die SPRAY an dem Fremden vorbcijagte, sah ich, daß er in einer Bö ein paar Segel verloren hatte und viel zerrissenes Zeug in seinem Rigg hing.
Ich lief in die Bucht von Gloucester ein, um die SPRAY ebenso wie die gesamte Reise und meine Gedanken und Gefühle noch einmal durchzumustern. Die Bucht war federweiß, als mein kleines Fahrzeug in einer Wolke von Schaum hineingeschossen kam. Es war das erstemal, daß ich allein auf einem Schiff einen Hafen anlief. Alte Fischer rannten herunter an den Kai, auf den die SPRAY zuhielt, vermutlich in der Annahme, daß sie sich den Schädel daran einstoßen würde. Ich weiß kaum, wie ein Unfall vermieden wurde. Das Herz schlug mir jedenfalls fast bis zum Hals, ich ließ das Ruder los, rannte rasch nach vorn und riß den Klüver herunter. Die Slup schoß natürlich in den Wind und legte sich nach kurzem Auslauf so sanft an einen Festmachepfahl an der Luvseite des Kais, daß sie nicht einmal ein Ei zerbrochen hätte. Sehr gemächlich schlang ich ein Ende um den Pfahl, und sie war vertäut. Darauf erscholl aus der kleinen Versammlung auf dem Kai ein Beifallsgeschrei. ”Das hätten Sie nicht besser machen können“, rief ein alter Schiffer, ”selbst wenn Sie eine ganze Tonne wiegen würden!“ Nun, ich wog etwas weniger als den fünfzehnten Teil einer Tonne, doch ich sagte nichts, warf ihm nur einen sorglosen, nichtssagenden Blick zu, der ausdrücken sollte: ”Oh, das ist noch gar nichts.“ Denn einige der fähigsten Seeleute der Welt schauten mir zu, und ich wollte vor ihnen nicht grün aussehen, weil ich ein paar Tage in Gloucester bleiben wollte. Hätte ich ein Wort gesagt, ich hätte mich sicher verraten; denn ich war noch immer aufgeregt und außer Atem.
Ich blieb etwa zwei Wochen in Gloucester und rüstete mich mit den verschiedensten Dingen für die Reise aus, die dort leicht zu erhalten waren. Die Besitzer des Kais, an dem ich lag, die zugleich Eigner einer Fischereiflotte waren, brachten Stockfisch in Hülle und Fülle an Bord, auch ein Faß Öl, um damit im Sturm die See glätten zu können. Sie waren selber alte Schiffer und zeigten großes Interesse für die Reise. Sie machten der SPRAY auch eine spezielle Fischerlaterne zum Geschenk, die ein helles und weitreichendes Licht gab. Wer ein Schiff mit solchem Licht an Bord niederrannte, würde wohl ebensogut in ein Feuerschiff laufen. Eine Harpune, ein Handnetz und ein ”Eimer“, die ein alter Fischer als unbedingt notwendig für die Reise erklärte, kamen ebenfalls an Bord. Dann schenkte man mir auch noch von der anderen Seite der Bucht eine Kiste mit Kupferfarbe, einem bekannten Antifouling, das mir später noch gut zustatten kam. Ich malte den Boden der SPRAY zweimal mit dieser Farbe, als sie bei Ebbe hoch und trocken auf dem festen Strand lag.
Als Beiboot schnitt ich ein ausgemustertes Dory in der Mitte auseinander und baute ein neues Heck ein. Dieses halbe Dory konnte ich leicht an Bord hieven und zu Wasser lassen, indem ich das Klaufall in ein eigens dafür vorgesehenes Auge einpiekte. Ein ganzes Dory wäre für einen Mann zu schwer und zu unhandlich gewesen. Außerdem war nur für das halbe Dory Platz auf Deck. Doch schließlich war dies besser als gar kein Boot; für einen allein war es groß genug. Ich begriff bald, daß dieses neuartige Boot, mittschiffs quer aufgestellt, auch gut als Wasch- und Badezuber dienen konnte. In der Tat erlangte mein rasiertes Dory gerade für den ersten Zweck unterwegs ein solches Ansehen, daß meine Waschfrau auf Samoa darauf versessen war. Sie erkannte auf den ersten Blick, daß das eine neue Erfindung war, die alles in den Schatten stellte, was die Missionare aus dem Yankeeland auf die Inseln gebracht hatten. Und so mußte sie es einfach haben.
Jetzt brauchte ich nur noch einen Chronometer für die Reise. Nach unserer neumodischen Vorstellung von Navigation setzen wir voraus, daß ein Seemann ohne Chronometer seinen Weg nicht findet. Und auch ich hatte mich zu diesem Denken verstiegen. Mein guter, alter Chronometer war lange nicht mehr in Gebrauch gewesen. Ihn zu reinigen und zu justieren, sollte 15 Dollar kosten. Fünfzehn Dollar! Aus begreiflichen Gründen ließ ich dieses Uhrwerk dort, wo der Fliegende Holländer seinen Anker gelassen hatte. Ich hatte ja die große Laterne! Und eine Lady aus Boston schickte mir außerdem das Geld für eine große Kajütlampe mit zwei Brennern, die bei Nacht die Kajüte erleuchtete und mit ein paar Handgriffen tagsüber in einen Ofen verwandelt werden konnte.
So ausgerüstet, war ich zum zweitenmal bereit, in See zu gehen, und am 7. Mai setzte ich denn auch wieder Segel. Der Raum zum Manövrieren war sehr eng, und so kratzte die SPRAY, als sie Fahrt aufnahm, einem alten Schönwettersegler im Fahrwasser, der gerade für eine Sommertour gespachtelt und gemalt wurde, ein wenig Farbe ab. ”Wer bezahlt das?“ knurrten die Maler. ”Ich“, sagte ich. ”Ja, mit der Großschot“, echote der Kapitän der dicht daneben liegenden BLUEBIRD, womit er sagen wollte, daß ich auf und davon war. Es ging wohl um höchstens 5 Cent Farbe, aber zwischen dem alten Pott und der BLUEBIRD, die nun für mich eintrat, entfachte sich solch ein Krach, daß der eigentliche Anlaß völlig vergessen wurde. Jedenfalls bekam ich keine Rechnung nachgeschickt.
Am Tage meiner Abfahrt aus Gloucester war das Wetter mild. Als die SPRAY aus der Bucht hinaussegelte, zeigte sich auf der Landspitze ein hübsches Bild: Die ganze Front einer großen Fabrik war ein einziges Gewinke mit Taschentüchern und Mützen. Freundliche Gesichter schauten aus allen Fenstern vom Dach bis zum Erdgeschoß, und alle lächelten mir bon voyage zu. Einige riefen mich an, wohin und warum allein. Warum? Als ich so tat, als ob ich auf sie zuhalten wollte, streckten sich mir hundert Arme entgegen: ”Komm!“ Aber das Ufer war zu gefährlich. Die Slup boxte sich gegen einen leichten Südwestwind aus der Bucht heraus und passierte um die Mittagszeit Eastern Point, wo sie noch einen herzlichen Salut empfing – die letzte von vielen freundlichen Gesten, die ihr Gloucester entgegenbrachte. Vor der Landzunge frischte der Wind auf, und mit gemächlicher Fahrt hatte die SPRAY bald das Feuer von Thatcher’s Island achteraus. Dann legte ich sie auf Ostkurs und steuerte nach dem Kompaß, weil ich Cashes Ledge und die Amen Rocks nördlich passieren wollte. Ich setzte mich und dachte die ganze Sache noch einmal durch. Erneut fragte ich mich, ob es überhaupt sinnvoll war, über das Riff und die Felsen hinaus zu segeln. Ich hatte nur gesagt, daß ich auf der SPRAY um die Welt segeln wollte, ”alle Gefahren der See ausgeschlossen“, wie es in der Versicherungssprache heißt; aber ich mußte es doch wohl mit großem Ernst gesagt haben. Die ”Charterreise“ mit mir selber als Chartergast schien mich zu binden, und so segelte ich weiter. Gegen Abend legte ich die Slup am Rande von Cashes Ledge in den Wind und warf auf 30 Faden eine Angel aus. Mit einigem Erfolg landete ich bis zum Abend drei Kabeljaus, zwei Schellfische, einen Hechtdorsch und, was das Beste war, einen kleinen Heilbutt auf Deck, alle rund und munter. Dies, dachte ich, wäre wohl der geeignete Ort, mich über das hinaus zu verproviantieren, was ich schon an Bord hatte. So brachte ich einen Seeanker aus, der das Schiff mit der Nase in den Wind hielt. Der Strom lief nach Südwest, gegen den Wind, und so war ich ziemlich sicher, daß ich die SPRAY auch am Morgen noch auf der Bank oder in ihrer Nähe finden würde. Dann gab ich dem Seeanker Leine, hängte meine große Laterne ins Rigg und legte mich hin, zum erstenmal allein auf See, nicht zum Schlafen, sondern zum Dösen und Träumen.
Irgendwo hatte ich schon von einem Fischschoner gelesen, der seinen Anker in einen Wal gepickt hatte und mit ziemlich viel Fahrt eine weite Strecke fortgezogen worden war. Eben dies passierte der SPRAY – in meinem Traum! Ich konnte ihn nicht ganz abschütteln, als ich aufwachte und merkte, daß der Wind und die inzwischen höher gehende See meine kurze Ruhe gestört hatten. Eine Windwolke flog vor dem Mond vorbei. Ein Sturm braute sich zusammen; eigentlich war es schon stürmisch. Ich reffte die Segel, holte meinen Seeanker ein und setzte alles Tuch, das die Slup tragen konnte. Dann nahm ich Kurs auf Monhegan-Feuer, das ich noch vor Tagesanbruch am Morgen des 8. Mai ausmachte. Vor raumem Wind lief ich weiter bis Round Pond, einem kleinen Hafen östlich von Pemaquid. Hier ruhte ich mich einen Tag aus, während der Wind durch die Kiefern am Ufer jaulte. Doch schon der folgende Tag war wieder schön genug, daß ich in See gehen konnte. Vorher jedoch trug ich mein Logbuch von Cape Ann an nach und vergaß auch nicht einen genauen Bericht über mein Abenteuer mit dem Wal.
Die SPRAY lief über eine ruhige See zwischen den vielen Inseln vor dieser Küste hindurch auf Kurs Ost. Am Abend desselben Tages, des 10. Mai, stand sie bei einer größeren Insel, an die ich immer nur als die Insel der Frösche denken werde; denn die SPRAY wurde von einem millionenfachen Froschgequake empfangen. Von der Insel der Frösche zogen wir zur Insel der Vögel, Gannet Island genannt und manchmal auch Gannet-Felsen. Auf ihr steht ein starkes unterbrochenes Leuchtfeuer, das über das Deck der SPRAY hinwegwischte, als sie unter seiner Hell- und Dunkelphase an der Küste entlangzog. Von dort nahm ich Kurs auf Briar’s Island und geriet am folgenden Nachmittag auf den westlichen Fischgründen mitten unter eine Anzahl von Fahrzeugen. Ein Fischer, der vor Anker lag, gab mir auf meine Frage einen falschen Kurs an, so daß die SPRAY im schlimmsten Tidenstrom der Bay of Fundy direkt über das Südwestriff segelte. Ich erreichte schließlich den Hafen von Westport in Neuschottland, wo ich als Junge acht Jahre meines Lebens zugebracht hatte.
Der Fischer mochte wohl Ostsüdost gesagt haben, und das war der Kurs, den ich steuerte, als ich ihn anrief. Doch ich glaubte Ostnordost verstanden zu haben, und dahin änderte ich natürlich meinen Kurs. Bevor er sich überhaupt zu antworten entschloß, nutzte er die Gelegenheit, seine eigene Neugier zu befriedigen und zu erfahren, woher ich kam und ob ich allein war und ob ich denn ”keen Haund un keen Kat“ an Bord hätte. Zum erstenmal in meinem ganzen Leben auf See wurde mir eine Bitte um Auskunft mit einer Frage beantwortet. Ich glaube, der Bursche kam von den Foreign Islands. Jedenfalls war ich mir sicher, daß er nicht nach Briar’s Island gehörte, denn er wich einer überkommenden See aus. Und während er sich das Wasser aus dem Gesicht wischte, ließ er einen feinen Kabeljau sausen, den er gerade an Bord holen wollte. Meinen Inselfreunden wäre das nicht passiert. Einer von Briar’s Island weicht einer See nie aus, gleich ob er einen Fisch am Haken hat oder nicht. Er hält seine Leinen fest und holt sie ein oder ”versupt“. Habe ich nicht sogar mit eigenen Augen gesehen, wie mein alter Freund, der Diakon W. D., ein echter Mann dieser Insel, während der Predigt in der kleinen Kirche auf dem Hügel die rechte Hand über seine Kirchenstuhltür hinausstreckte, als ob er Fischfutter im Seitenschiff ausstreuen wollte? Natürlich hatten die jungen Leute ihren Spaß daran, denn sie begriffen noch nicht, daß zu einem guten Fischfang auch ein guter Köder gehört – und das schien dem Diakon nun gerade das Wichtigste zu sein.
Ich freute mich, daß ich Westport erreicht hatte. Tatsächlich hätte ich mich über jeden beliebigen Hafen gefreut, nachdem ich auf dem Südwestriff so schlimm gebeutelt worden war. Doch das Beste war, daß ich mich jetzt unter alten Schulkameraden wiederfand. Es war der 13. des Monats, und die 13 ist meine Glückszahl – eine Tatsache, die schon lange feststand, bevor Fridtjof Nansen mit einer Crew von 13 Mann zum Nordpol lossegelte. Vielleicht hatte er davon gehört, daß ich mit ebensoviel Mann Besatzung ein ganz besonderes Schiff erfolgreich nach Brasilien gebracht hatte. Ich genoß sogar das Wiedersehen mit den Steinen auf Briar’s Island, und ich kannte sie alle. Der kleine Laden an der Ecke, den ich 35 Jahre lang nicht gesehen hatte, war noch immer derselbe; er kam mir nur etwas kleiner vor. Er trug dieselben Dachschindeln – da war ich sicher; denn auf diesem Dach hatten wir als Jungen Nacht für Nacht eine schwarze Katze gejagt, der man in einer dunklen Nacht das Fell abziehen mußte, um damit einen armen lahmen Mann heilen zu können. Schneider Lowry hatte da gewohnt, als Jungen noch Jungen waren. Solange er lebte, war er stolz auf sein Gewehr. Das Pulver trug er immer lose in der hinteren Tasche seines Rocks. Gewöhnlich hatte er auch eine kurze Tonpfeife im Mund. Doch in einem bösen Augenblick steckte er die angezündete Pfeife in die Tasche zu dem Pulver. Mr. Lowry war ein wunderlicher Kauz.
Auf Briar’s Island überholte ich die SPRAY noch einmal und untersuchte auch die Nähte zwischen den Plankengängen, fand jedoch, daß selbst die schwere See ihnen nichts hatte anhaben können. Da draußen schlechtes Wetter und viel Gegenwind vorherrschten, hatte ich keine Eile, Cape Sable schon jetzt zu runden. Mit ein paar Freunden machte ich einen kleinen Ausflug nach St. Mary’s Bay, einem alten Segelrevier. Und als ich dann lossegelte, mußte ich gleich am nächsten Tag wieder vor Nebel und Gegenwind nach Yarmouth hinein flüchten. Dort verbrachte ich ein paar angenehme Tage, nahm für die Reise noch ein wenig Butter über, auch ein Faß Kartoffeln, füllte sechs Fässer mit Wasser und verstaute alles unter Deck. In Yarmouth erstand ich auch meinen berühmten Blechwecker, den einzigen Zeitmesser, den ich auf der ganzen Reise an Bord hatte. Er sollte eineinhalb Dollar kosten, doch da die Front beschädigt war, ließ ihn mir der Händler für einen Dollar.
ZU DEN AZOREN
Abschied von der amerikanischen Küste – Im Nebel vor Sable Island – Auf offener See – Der Mann im Mond nimmt an der Reise Anteil – Der erste Anfall von Einsamkeit – Die Spray trifft La Vaguisa – Eine Flasche Wein vom Spanier – Ein Wortwechsel mit dem Kapitän der Java – Der Dampfer Olympia – Ankunft auf den Azoren.
Ich verstaute jetzt alle meine Sachen seefest, denn der wilde Atlantik lag vor mir, und ich fierte auch die Stenge, weil ich wußte, daß die SPRAY mit dem Toppmast an Deck handiger sein würde. Dann setzte ich die Taljereeps durch, überprüfte den Bugsprietzurring und die Halterungen für das Beiboot; denn selbst im Sommer muß man bei der Überfahrt mit schlechtem Wetter rechnen.
Tatsächlich hatte schon wochenlang Schlechtwetter vorgeherrscht. Als am 1. Juli nach einem bösen Sturm der Wind jedoch aus Nordwest kam und den Himmel klarfegte, nahm ich das als ein günstiges Vorzeichen für die Reise. Am nächsten Tag ließ auch der Seegang etwas nach, und so verließ ich Yarmouth und damit meinen letzten Hafen in Amerika. Vom ersten Tag der SPRAY auf dem Atlantik enthält das Logbuch nur eine knappe Eintragung: 0930 Uhr von Yarmouth abgesegelt. 1630 Uhr Cape Sable passiert; Abstand 3 Kabellängen. Die Slup macht 8 Knoten. Frische Brise aus NW.“ Vor Sonnenuntergang nahm ich mein Abendessen ein: Erdbeeren und Tee; aufruhigem Wasser segelte die SPRAY gemächlich in Lee der Ostküste.
Am Mittag des 3. Juli lag Ironbound Island quer ab. Die SPRAY zeigte sich in bester Form. Ein großer Schoner kam an diesem Morgen mit Kurs Ost aus Liverpool, Neuschottland, heraus. Nach fünf Stunden hatte die SPRAY ihn achteraus gelassen. Um 1845 Uhr stand ich dicht unter dem Feuer von Chebucto Head in der Nähe von Halifax. Ich setzte meine Flagge und zog vorbei; noch vor Dunkelheit verabschiedete ich mich von George’s Island und nahm Kurs östlich an Sable Island vorbei. An dieser Küste gibt es viele Leuchtfeuer. So steht zum Beispiel auf Sambro, dem ”Felsen der Klagen“, ein starkes Feuer, das jedoch der Schnelldampfer ATLANTIC in der Nacht seines schrecklichen Schiffbruchs nicht sah. Feuer nach Feuer versank achteraus hinter der Kimm, als ich auf die grenzenlose See hinaussegelte, bis schließlich als letztes von allen auch Sambro verschwand. Dann war die SPRAY allein auf ihrem Kurs. 4. Juli, 0600 Uhr. Ich band zwei Reffs ein und schüttelte sie um 0830 Uhr wieder heraus. Um 2140 Uhr machte ich nur noch den Schein des Feuers auf der Westhuk von Sable Island aus, die man auch ”Insel der Tragödien“ nennen könnte. Der Nebel, der sich bis zu diesem Augenblick hoch in der Luft gehalten hatte, legte sich nun wie ein Leichentuch auf die See. Ich war in einer eigenen, nebelhaften Welt, ausgeschlossen vom übrigen Universum. Vom Leuchtfeuer sah ich nun gar nichts mehr. Nur weil ich oft das Lot auswarf, merkte ich, daß ich kurz nach Mitternacht die Osthuk passierte. Bald würde ich alle Gefahren, die vom Land und von den Untiefen ausgingen, hinter mir gelassen haben. Der Wind war weiter günstig, obwohl er aus der Nebelecke, aus Südsüdwest kam. Es heißt, daß Sable Island im Laufe von ein paar Jahren von 40 Meilen Länge auf 20 zusammengeschrumpft sei und daß von den drei seit 1880 gebauten Leuchttürmen zwei fortgewaschen wurden und der dritte auch bald von der See verschlungen würde.
Am Abend des 5. Juli setzte sich die SPRAY, nachdem ich sie einen ganzen Tag über unruhige See gesteuert hatte, in den Kopf, auf die Hilfe des Rudergängers zu verzichten. Ich hatte Südost zu Süd gesteuert, aber da der Wind jetzt etwas vorlicher einfiel, hielt sie ohne Schwierigkeiten Kurs Südost und machte dabei mit 8 Knoten ihre bestmögliche Fahrt. Ich setzte alle Segel, um den Dampfertrack möglichst schnell zu queren und in den freundlichen Golfstrom zu kommen. Vor Einbruch der Nacht verzog sich der Nebel, und so konnte ich eben noch die Sonne in die See eintauchen sehen. Ich schaute ihr zu, wie sie hinter der Kimm versank. Dann drehte ich mich nach Osten um, und dort stieg gerade vor der Nock des Bugspriets der lächelnde Mond aus der See. Wenn Neptun selbst über den Bug zu mir heraufgeklettert wäre, es hätte mich nicht mehr überraschen können. ”Guten Abend, mein Herr“, rief ich, ”nett, daß Sie da sind!“ Viele lange Gespräche habe ich seitdem mit dem Mann im Mond geführt; er war auf dieser Reise mein Vertrauter.
Um Mitternacht kam der Nebel wieder herunter, dichter als zuvor. Man konnte fast auf ihm stehen. So ging es ein paar Tage, während sich der Wind zum Sturm auswuchs. Die See ging hoch, aber ich hatte ein gutes Schiff. Und doch hatte ich in dem Nebel ein Gefühl, als ob ich in eine unendliche Einsamkeit abtrieb, ein Insekt auf einem Strohhalm inmitten der Elemente. Ich laschte das Ruder fest, und während mein Fahrzeug allein weiter Kurs hielt, versank ich in Schlaf.
In diesen Tagen beschlich mich ein Gefühl irgendwo zwischen Furcht und Ehrfurcht. Meine Erinnerung arbeitete mit bewundernswerter Genauigkeit. Das Geheimnisvolle und Unbedeutende, das Große und Kleine, das Wunderbare und Alltägliche – alles lief wie in einer magischen Prozession vor meinem inneren Auge ab. Seiten meiner Lebensgeschichte wurden wieder aufgeblättert, die so lange vergessen waren, daß sie einer früheren Existenz anzugehören schienen. Ich hörte all die Stimmen der Vergangenheit lachen, weinen und erzählen, was sie mir in den verschiedensten Winkeln der Erde schon einmal erzählt hatten.
Das Gefühl der Einsamkeit fiel von mir ab, als der Sturm losbrach und es viel zu tun gab. Doch sobald das schöne Wetter wiederkam, stellte sich auch das Gefühl der Verlassenheit wieder ein; ich konnte es nicht ganz abschütteln. Ich gebrauchte meine Stimme oft, zunächst nur, um mir selbst Kommandos für die Ausführung der Manöver zu geben; denn man hatte mir weisgemacht, daß ich vom langen Schweigen meine Stimme verlieren würde. Wenn mittags die Sonne kulminierte, rief ich laut: ”Acht Glasen“, wie es auf einem Schiff auf See üblich ist. Dann fragte ich aus der Kajüte heraus einen imaginären Rudergänger: ”Wie liegt sie im Wind?“ Und wieder: ”Liegt sie auf Kurs?“ Aber da ich keine Antwort bekam, wurde ich nur um so fühlbarer an meine Situation erinnert. Meine Stimme klang hohl in der leeren Luft, und so gab ich es auf. Bald jedoch fiel mir ein, daß ich ja als Junge immer gesungen hatte; warum sollte ich das nicht jetzt versuchen, wo es niemanden stören würde! Mein musikalisches Talent hatte noch nie Neid erweckt. Doch um das zu verstehen, müßten Sie mich schon draußen auf dem Atlantik singen gehört haben! Sie hätten die Tümmler springen sehen sollen, wenn ich meine Stimme gegen die Wogen und die See und alles, was in ihr ist, antönen ließ. Alte Schildkröten mit großen Augen reckten verwundert ihren Kopf aus der See, als ich ”Johnny Boker“ sang und ”We’ll Pay Darby Doyl for his Boots“. Aber mehr Zustimmung als von den Schildkröten kam insgesamt doch von den Tümmlern; sie sprangen etwas höher. Als ich eines Tages eines meiner Lieblingslieder sang, ich glaube, es war ”Babylon’s a-Fallin“, sprang ein Tümmler höher als das Bugspriet. Mit etwas mehr Fahrt hätte die SPRAY ihn einschaufeln können.
Am 10. Juli, nach acht Tagen auf See, stand die SPRAY 1200 Meilen östlich von Cape Sable. Ein durchschnittliches Etmal von 150 Meilen kann wohl für ein so kleines Fahrzeug als gute Segelleistung bezeichnet werden. Eine größere Strecke machte die SPRAY weder vorher noch nachher wieder in so kurzer Zeit. Am Abend des 14. Juli, ich war in besserer Stimmung als je, riefen alle Mann: ”Segel in Sicht!“ Das Segel war eine Schonerbark, drei Strich in Luv voraus, den Rumpf noch unter der Kimm. Dann kam die Nacht. Ich ließ mein Schiff sich nun selbst steuern. Der Wind kam aus Süd; wir hatten Kurs Ost. Die Segel waren getrimmt wie das des Nautilus. Gleichmäßig zogen sie die ganze Nacht hindurch. Ich ging häufig an Deck, fand jedoch immer alles in Ordnung. Eine leichte Brise stand von Süden her durch. Früh am Morgen des 15. war die SPRAY dicht bei dem fremden Schiff, das sich als die LA VAGUISA aus Vigo entpuppte, 23 Tage von Philadelphia her unterwegs mit Ziel Vigo. Ein Ausguck im Masttopp hatte die SPRAY am Abend vorher entdeckt. Als ich nahe genug heran war, warf mir der Kapitän ein Ende zu und sandte mir daran eine Flasche Wein herüber, einen sehr guten Tropfen. Er schickte auch seine Karte mit, die den Namen Juan Gantes trug. Wie die meisten Spanier war er ein freundlicher Mensch. Doch als ich ihn bat, mich als ”wohlauf“ zu melden (während die SPRAY gerade frisch an ihm vorbeirauschte), zog er die Schultern fast bis über den Kopf. Und als sein Maat, der offenbar von meiner Expedition gehört hatte, ihm erzählte, daß ich allein war, bekreuzigte er sich und verschwand in seiner Kajüte. Ich sah ihn nicht wieder. Bei Sonnenuntergang lag das Schiff so weit achteraus, wie es am Abend zuvor voraus gelegen hatte.
Es war nun immer weniger einsam. Am 16. Juli kam der Wind aus Nordwest, der Himmel war klar und die See ruhig; in Lee voraus tauchte an der Kimm eine große Bark auf. Um 1430 Uhr konnte ich sie ansprechen. Es war die JAVA aus Glasgow, von Peru nach Queenstown unterwegs. Ihr alter Kapitän war wie ein Bär; doch ich traf einmal in Alaska auf einen Bären, der freundlicher aussah. Zumindest schien er sich zu freuen, daß er mir begegnete. Nicht so dieser alte Grizzly! Nun, vielleicht störte mein Anruf seine Siesta, und daß meine kleine Slup sein großes Schiff überholte, wirkte auf ihn wie ein rotes Tuch auf einen Stier. Trotz aller Unterschiede hatte ich in den leichten Winden dieses und der beiden vorangegangenen Tage einen gewissen Vorteil gegenüber den schweren Schiffen. Auch jetzt war der Wind leicht; sein Schiff war schwer und unbeweglich, es machte kaum Fahrt voraus, während die SPRAY, deren mächtiges Großsegel sich sogar bei leichten Winden bauschte, so behende daherschipperte, wie ich es mir nur wünschen konnte. ”Wie lange ist es hier schon so windstill?“ brüllte der Kapitän der JAVA