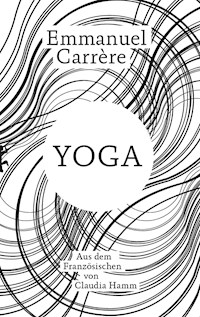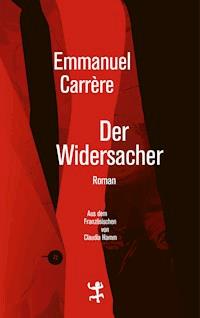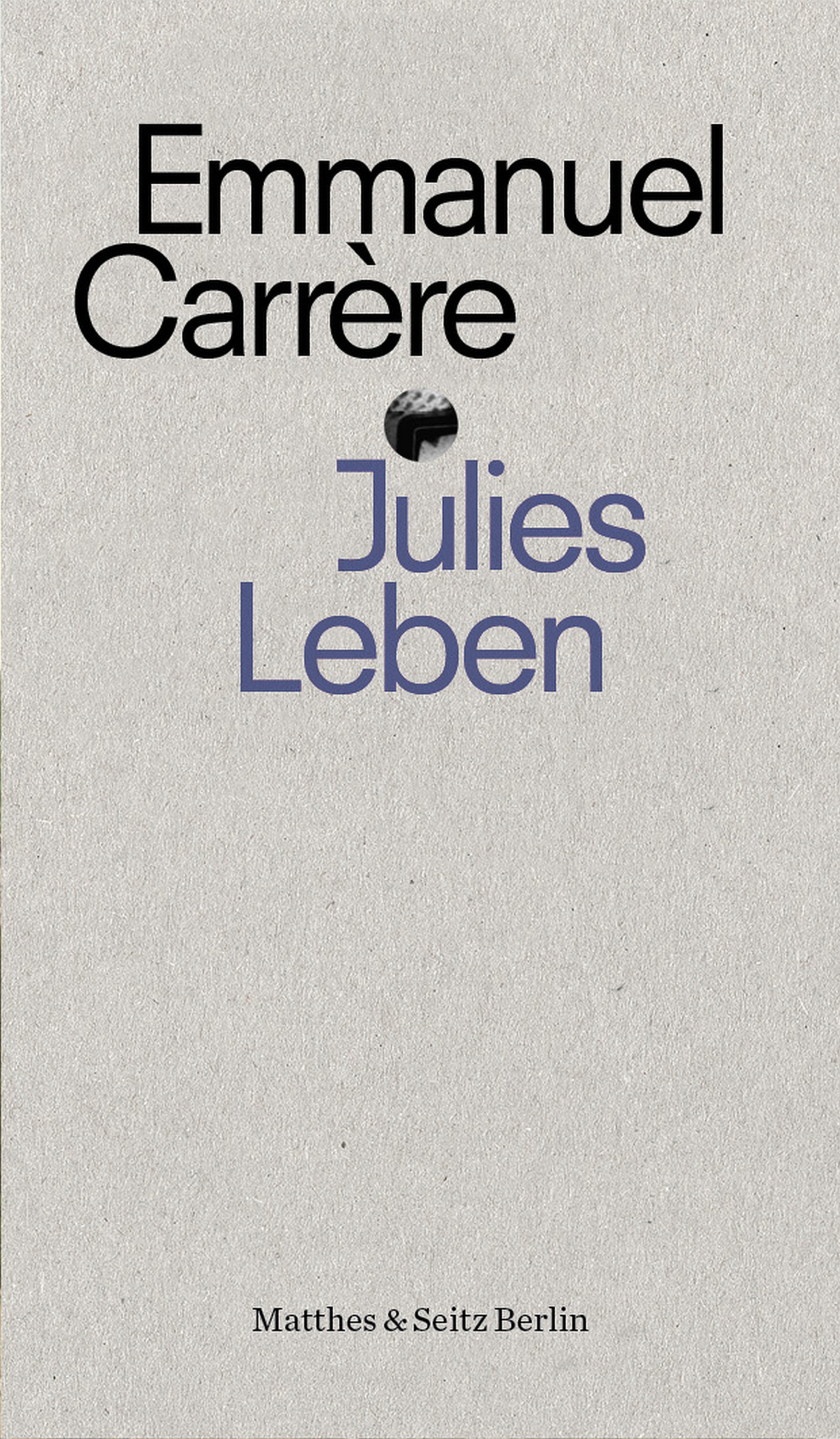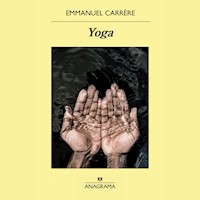Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der internationale Bestseller jetzt auf Deutsch: Der neue Roman des Autors von ›Limonow‹ Dieses Buch, in dem »alles wahr« ist, handelt von Leben und Tod, Krankheit, extremer Armut, Gerechtigkeit, vor allem aber von Liebe. Es erreicht das, wonach Literatur sucht: Es erschafft Realität neu. Alles ist wahr: 2004 wurde Emmanuel Carrère Zeuge der Tsunami-Katastrophe. In den Trümmern des Desasters lernte er ein junges Paar kennen, dessen Tochter von der Welle fortgerissen wurde. Carrère kümmert sich um die verwaisten Eltern - und beginnt ihre Geschichte zu schreiben. Zurück in Paris, umlagert das Unglück weiter Carrères Leben: Seine Schwägerin stirbt und lässt drei Kinder zurück. In der Trauer blitzen Erinnerungen auf, fl ießen Erzählungen von Freunden und Verwandten zusammen, die Hoffnung und Stärkung verheißen. Carrère gibt den großen und kleinen Katastrophen ein Gesicht und zeichnet das Schicksal anonymer Helden nach, dabei ist sein Schreiben immer präzise und ergreifend, ohne rührselig zu werden. Voller Menschlichkeit führt er verschiedene Ereignisse zusammen und gibt ihnen Bedeutung und Tiefe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emmanuel CarrèreAlles ist wahr
EMMANUEL CARRÈRE
ALLES IST WAHR
Aus dem Französischenvon Claudia Hamm
Inhalt
Alles ist wahr
Anhang
Impressum
Ich weiß noch, dass Hélène und ich in der Nacht vor der Welle davon gesprochen haben, uns zu trennen. Das Ganze war nicht kompliziert: Wir wohnten nicht unter einem Dach, hatten keine Kinder miteinander, wir konnten uns sogar vorstellen, Freunde zu bleiben. Trotzdem war es traurig. In unserer Erinnerung gab es eine andere Nacht, kurz nach unserer ersten Begegnung. Wir hatten sie bis zum Morgen damit verbracht, uns immer wieder daran zu begeistern, dass wir uns gefunden hatten, dass wir für den Rest unseres Lebens zusammenbleiben wollten, gemeinsam alt werden würden, vielleicht sogar eine Tochter miteinander haben könnten... Später haben wir tatsächlich ein Mädchen bekommen; in dem Moment, da ich das schreibe, hoffen wir noch immer, gemeinsam alt zu werden, und wir mögen die Vorstellung, das alles von Anfang an gewusst zu haben. Doch auf diesen Anfang war erst einmal ein schwieriges, chaotisches Jahr gefolgt, und was uns im Herbst 2003 im Rausch unserer heftigen Verliebtheit gewiss schien und was uns jetzt, fünf Jahre später, wieder gewiss scheint oder zumindest wünschenswert, kam uns in der Weihnachtsnacht 2004 in unserem Bungalow des Hotels Eva Lanka ganz und gar nicht mehr sicher vor und auch nicht erstrebenswert. Wir waren vielmehr überzeugt, dass dieser Urlaub der letzte war, den wir miteinander verbringen würden, und dass er trotz unserer gutwilligen Bemühungen ein Fehler war. Rücken gegen Rücken gekehrt lagen wir da und wagten nicht, unsere erste Nacht und das Versprechen zu erwähnen, an das wir beide so inbrünstig geglaubt hatten und das sich offensichtlich nicht würde halten lassen. Es gab keine Feindseligkeit zwischen uns, wir schauten uns nur gegenseitig hilflos dabei zu, wie wir voneinander weg drifteten. Es war schade. Ich grübelte wieder über meine Liebesunfähigkeit, die sich umso deutlicher abzeichnete, als Hélène wirklich liebenswert war. Ich dachte daran, dass ich wohl allein alt werden würde. Hélène dachte an etwas anderes: an ihre Schwester Juliette, die kurz vor unserer Abfahrt wegen einer Lungenembolie ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Sie hatte Angst, dass Juliette schwer krank war und dass sie sterben könnte. Ich wandte ein, dass diese Angst irrational sei, doch sie hielt Hélènes Gedanken bald vollständig besetzt, und ich nahm ihr übel, sich dermaßen von etwas einnehmen zu lassen, das mir keinerlei Rolle zubilligte. Sie ging auf die Terrasse des Bungalows, um eine Zigarette zu rauchen. Ich wartete im Bett auf sie und sagte mir, wenn sie bald zurückkommen und wir miteinander sachlafen würden, würden wir uns vielleicht nicht trennen, würden wir vielleicht doch miteinander alt werden. Aber sie kam nicht wieder, sie blieb allein auf der Terrasse und sah zu, wie der morgendliche Himmel langsam dämmerte, hörte die ersten Vogelstimmen, und ich schlief ein, einsam und traurig, überzeugt davon, dass mein Leben immer weiter den Bach runterging.
Wir hatten uns alle vier, Hélène mit ihrem Sohn und ich mit meinem, für einen Tauchkurs in einem kleinen Club im Nachbardorf angemeldet. Aber seit dem letzten Mal hatte Jean-Baptiste Ohrenschmerzen und wollte nicht tauchen gehen, und wir waren müde von unserer durchwachten Nacht und beschlossen, die Stunde abzusagen. Rodrigue, der einzige, der wirklich Lust darauf hatte, war enttäuscht. Du kannst doch im Swimmingpool baden, schlug Hélène vor. Doch er hatte genug vom Swimmingpool. Er wollte wenigstens zum Strand unterhalb des Hotels begleitet werden, an den er nicht allein durfte, weil es dort gefährliche Strömungen gab. Doch keiner mochte mit ihm gehen, weder seine Mutter noch ich noch Jean-Baptiste, der lieber im Bungalow lesen wollte. Jean-Baptiste war damals dreizehn, ich hatte ihm diese Ferien mit einem viel kleineren Jungen und einer Frau, die er kaum kannte, mehr oder weniger aufgezwungen, seit dem Beginn der Reise langweilte er sich und ließ uns das spüren, indem er den Stubenhocker spielte. Als ich ihn entnervt fragte, ob er nicht froh sei, in Sri Lanka zu sein, antwortete er mürrisch, doch, er sei froh, aber es sei zu heiß und das Beste sei immer noch, im Bungalow zu lesen oder Gameboy zu spielen. Im Grunde war er ein typisch vorpubertäres Kind und ich ein typischer Vater eines vorpubertären Kindes, und ich ertappte mich dabei, ihm fast wortwörtlich dieselben Dinge zu sagen, die mich selbst in seinem Alter zur Weißglut gebracht hatten, wenn ich sie aus dem Mund meiner Eltern vernahm: Geh doch mal raus, sei ein bisschen neugieriger, wozu nehme ich dich überhaupt so weit mit ... Vergeblich. Er verzog sich in seine Höhle, und der alleingelassene Rodrigue begann, sich im Kreis zu drehen und Hélène zuzusetzen, die in einem Liegestuhl ein bisschen Schlaf nachzuholen versuchte, neben einem riesigen Meerwasser-Pool, in dem eine betagte, aber unglaublich athletische Deutsche, die Leni Riefenstahl ähnlich sah, jeden Morgen zwei Stunden lang ihre Runden drehte. Meine Liebesunfähigkeit beschäftigte weiter mein Selbstmitleid, und ich setzte mich ab, um mich bei den Ayurveden herumzutreiben – so nannten wir eine Gruppe von Deutschschweizern, die ein paar auf dem Hotelgelände etwas abgelegenere Bungalows bewohnten und einem Yoga-Seminar und traditioneller indischer Massage nachgingen. Wenn sie sich nicht gerade in einer Sitzung mit ihrem Meister befanden, übte ich manchmal ein paar Asanas mit ihnen. Dann kam ich an den Pool zurück; man hatte die letzten Frühstücksgedecke abgeräumt und begonnen, die Tische fürs Mittagessen herzurichten, bald würde sich die quälende Frage stellen, was wir mit dem Nachmittag anfangen sollten. Drei Tage nach unserer Ankunft hatten wir bereits den Tempel im Regenwald besichtigt, die Äffchen gefüttert, die liegenden Buddhas gesehen – wenn wir uns nicht in ehrgeizigere Kulturerkundungen stürzen wollten, was keinen von uns reizte – und die Möglichkeiten des Ortes ausgeschöpft. Oder wir hätten zu der Art von Leuten gehören müssen, die tagelang durch ein Fischerdorf schlendern und sich für alles begeistern können, was die Einheimischen so tun: den Markt, die Flicktechniken für Fischernetze und Gemeinschaftsrituale jeder Art ... Ich gehörte nicht dazu und warf mir vor, es nicht zu tun und meinen Söhnen nicht diese großzügige Neugier weitergeben zu können, diese Genauigkeit im Blick, die ich zum Beispiel an Nicolas Bouvier bewundere. Ich hatte Der Skorpionsfisch mitgenommen: In diesem Buch erzählt der Reiseschriftsteller Bouvier von einem Jahr, das er in Galle verbrachte, einer großen Festung an der Südküste der Insel, etwa dreißig Kilometer von dem Ort entfernt, an dem wir uns befanden. Anders als sein berühmtester Reisebericht Die Erfahrung der Welt ist Der Skorpionsfisch kein Buch der Verzückung und des Überschwangs, sondern eines des Zusammenbruchs, Verlusts und eines schon fortgeschrittenen Verfalls. Ceylon wird darin als Bann beschrieben, und zwar im perfiden Sinn des Wortes und nicht dem, wie ihn Reiseführer für coole Rucksackreisende und Jungverheiratete benutzen. Leider hatte Bouvier seinen scharfen Verstand nicht dagelassen, und unser eigener Aufenthalt, mochte man ihn als Hochzeitsreise oder Aufnahmeprüfung für eine mögliche Familienzusammenführung verstehen, war missglückt. Auf eine laue Weise missglückt, ohne Tragik und ohne Risiko. Es drängte mich langsam wieder nach Hause. Als ich den von Bougainvilleen überwucherten Empfangsbereich mit den Lichtgaden betrat, stieß ich auf einen Hotelgast, der sich darüber empörte, ein Fax nicht versenden zu können. Stromausfall. An der Rezeption hatte man ihm von irgendeinem Ereignis im Dorf berichtet, einem Unfall, welcher der Grund für den Stromausfall sei, aber er hatte die Erklärungen nicht richtig verstanden und hoffte nur, das Ganze würde nicht lange dauern, denn sein Fax war sehr dringend. Ich ging zu Hélène, die nicht mehr schlief, und sie sagte mir, etwas Seltsames sei im Gange.
Das nächste Bild zeigt eine kleine Gruppe von Hotelgästen und Hotelpersonal, sie drängt sich am Ende des Parks auf einer Terrasse über dem Ozean. Auf den ersten Blick ist merkwürdigerweise nichts zu bemerken. Alles scheint ganz normal. Dann zieht man Bilanz. Man stellt fest, dass das Meer sehr weit draußen beginnt. Normalerweise ist der Strand von der Wasserkante bis zum Fuß der Felsen etwa zwanzig Meter breit. Jetzt erstreckt er sich, soweit das Auge reicht, grau, flach und flimmernd unter der verhangenen Sonne, man könnte meinen, man sei bei Ebbe am Mont Saint-Michel. Man erkennt auch, dass er mit Dingen übersät ist, deren Größe im ersten Moment nicht abzuschätzen ist. Ist dieses krumme Stück Holz ein abgerissener Ast oder ein Baum? Vielleicht sogar ein sehr großer Baum? Ist dieses zersplitterte Boot etwas Größeres als ein Boot? Ein Schiff etwa, ein Trawler, der wie eine Nussschale angespült und zerschmettert wurde? Nicht ein Geräusch ist zu hören, kein Windhauch bewegt die Wedel der Kokospalmen. Ich erinnere mich nicht an die ersten Worte, die in der Gruppe, der auch wir uns zugesellt hatten, gesprochen wurden, aber irgendwann hat einer gemurmelt: Two hundred children died at school, in the village.
Auf einem Felsen über dem Ozean erbaut wirkt das Hotel wie eingehüllt in die üppige Pflanzenpracht seines Parks. Geht man durch das von einem Wächter behütete Gittertor, erreicht man über eine Betonrampe die Küstenstraße. Am Ende dieser Rampe stehen normalerweise Tuk-tuks: Motorräder mit Dachplane und Rückbank, auf der man zu zweit, eng zusammengerückt auch zu dritt Platz findet und mit denen man kleinere Strecken bis zehn Kilometer zurücklegen kann, für längere Wege bestellt man sich ein Taxi. Heute sind keine Tuk-tuks zu sehen. Hélène und ich laufen zur Straße hinunter in der Hoffnung zu begreifen, was vor sich geht. Es scheint etwas Schlimmes passiert zu sein, doch außer dem Mann, der von den zweihundert toten Kindern in der Dorfschule sprach und dem, der ihm entgegnete, es haben keine Kinder in der Schule sein können, denn heute sei Poya, der buddhistische Neujahrstag, scheint niemand im Hotel mehr zu wissen als wir. Keine Tuk-tuks, aber auch keine Passanten. Sonst trifft man immer Leute zu Fuß an: Frauen, die Bündel tragen und in Zweier- oder Dreiergrüppchen unterwegs sind, Schulkinder in perfekt gebügelten weißen Hemden, all diese lächelnden Leute, die einen gern in Gespräche verwickeln. Solange wir auf der landeinwärts gewandten Seite des Hügels laufen, der einen Schutzwall zwischen Straße und Ozean bildet, wirkt alles ganz normal. Doch als wir ihn hinter uns lassen und die Ebene erreichen, sehen wir: Auf der einen Seite ist alles unverändert – Bäume, Blumen, Mäuerchen, kleine Buden –, aber auf der anderen ist alles verwüstet und mit einem klebrigen, schwarzen Schlick überzogen wie von einem Lavastrom. Nach einigen Minuten Fußweg Richtung Dorf kommt uns ein großer, blonder, verstörter Typ voll Schlamm und Blut, in zerrissenen Shorts und zerfetztem Hemd entgegen. Er sei Holländer, das ist kurioserweise das Erste, was er sagt, das Zweite: Seine Frau sei verletzt. Bauern hätten sie bei sich aufgenommen, er suche Hilfe, er habe gedacht, vielleicht in unserem Hotel welche zu finden. Er spricht von einer riesigen Welle, die alles überrollt habe und dann zurückgeflossen sei und dabei Häuser und Menschen mitgerissen habe. Er wirkt schockiert und eher überrascht als erleichtert, am Leben zu sein. Hélène schlägt vor, ihn bis zum Hotel zu begleiten, vielleicht funktionieren die Telefonleitungen wieder und man darf hoffen, unter den Gästen einen Arzt zu finden. Ich will noch ein Stück gehen und versichere Hélène, bald zu ihnen stoßen. Drei Kilometer weiter, am Dorfeingang, herrscht eine angsterfüllte, verwirrte Atmosphäre. Gruppen bilden sich und lösen sich wieder auf, mit Planen bedeckte Pick-ups kurven herum, überall Geschrei und Gewimmer. Ich biege in die Straße ein, die zum Strand hinunterführt, doch ein Polizist versperrt mir den Weg. Ich frage, was genau passiert sei, er antwortet: the sea, the water, big water. Gibt es wirklich Tote? Yes, many people dead, very dangerous. You stay in hotel? Which hotel? Eva Lanka? Good, good, Eva Lanka, go back there, it is safe. Here, very dangerous. Die Gefahr scheint vorüber, dennoch gehorche ich.
Hélène ist wütend auf mich, weil ich losgezogen bin und sie mit den Kindern allein gelassen habe, dabei hätte sie doch als erste den Meldungen nachgehen müssen, schließlich sei das ihr Job. Während meiner Abwesenheit hat sie einen Anruf von LCI erhalten, dem Sender, für den sie Nachrichten schreibt und moderiert. Es ist Nacht in Europa, was auch der Grund ist, warum die anderen Hotelgäste noch nicht von ihren panischen Familien und Freunden kontaktiert worden sind, aber die Journalisten im Nachtdienst wissen bereits, dass es in Südostasien eine gewaltige Katastrophe gegeben hat, etwas von völlig anderem Ausmaß als eine lokale Überschwemmung, wie ich in diesem Moment noch glaube. Da Hélènes Kollegen sie dort in den Ferien wussten, hatten sie sich einen brandheißen Augenzeugenbericht erwartet, doch Hélène konnte ihnen praktisch nichts dazu sagen. Was ich dazu sagen könne? Was ich in Tangalle gesehen hätte? Nichts wahnsinnig Aufregendes, muss ich zugeben. Hélène zuckt mit den Schultern. Ich verschwinde in unseren Bungalow. Bei meiner Rückkehr aus dem Dorf war ich eher aufgedreht gewesen, weil sich mitten in diesen sich dahinschleppenden Ferien plötzlich etwas Ungewöhnliches ereignete, jetzt ärgere ich mich über unseren Zwist und meinen Mangel an Geistesgegenwart. Mit mir selbst unzufrieden stecke ich die Nase noch einmal in Der Skorpionsfisch. Zwischen zwei Insektenbeschreibungen lässt ein Satz mich innehalten: »An diesem Morgen hätte ich mir gewünscht, dass eine fremde Hand mir die Augenlider schließe. Doch ich war allein, ich schloss sie mir also selbst.«
Jean-Baptiste kommt aufgelöst in den Bungalow, weil er mich sucht. Das französische Paar, dessen Bekanntschaft wir vor zwei Tagen gemacht haben, ist gerade im Hotel eingetroffen. Ihre Tochter ist tot. Er braucht mich, um sich dieser Nachricht zu stellen. Während ich mit ihm den Weg zum Hauptgebäude entlanggehe, denke ich an unsere erste Begegnung in einem der strohbedeckten Restaurants am Strand, an eben der Stelle, zu der mir heute der Polizist den Zutritt verweigerte. Sie saßen am Nachbartisch. Beide um die Dreißig, er etwas älter, sie etwas jünger. Beide hübsch, lustig, vertraut und ganz offensichtlich sehr verliebt ineinander und in ihre kleine vierjährige Tochter. Die Kleine kam zu uns herüber, um mit Rodrigue zu spielen, und so kamen wir ins Gespräch. Im Gegensatz zu uns kannten sie das Land sehr gut. Sie wohnten nicht in einem Hotel, sondern in einem Häuschen direkt am Strand, das der Vater der jungen Frau das ganze Jahr über mietete, etwa zweihundert Meter vom Restaurant entfernt. Sie waren genau die Art Leute, die man gern im Ausland kennenlernt, und wir verabschiedeten uns in der Gewissheit, uns wiederzusehen. Es war nicht nötig, sich zu verabreden, wir würden uns zwangsläufig im Dorf oder am Strand über den Weg laufen.
Hélène sitzt mit ihnen und einem älteren Mann an der Bar, sein graugelocktes Haar und sein Vogelgesicht verleihen ihm Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Pierre Richard. Wir hatten uns am Abend unserer ersten Begegnung nicht vorgestellt, Hélène holt das jetzt nach: Jérôme. Delphine. Philippe. Philippe ist Delphines Vater, derjenige, der das Strandhaus mietet. Und das kleine Mädchen, das gestorben ist, hieß Juliette. Hélène sagt es mit neutraler Stimme, Jérôme nickt. Sein Gesicht und das von Delphine bleiben ausdruckslos. Ich frage sie: Seid ihr sicher? Jérôme sagt, ja, sie kämen gerade aus dem Krankenhaus im Dorf, sie seien dort gewesen, um die Leiche zu identifizieren. Delphine starrt vor sich hin, ich bin mir nicht sicher, ob sie uns sieht. Wir sitzen alle sieben, sie zu dritt, wir zu viert, auf Teaksesseln und -bänken mit farbenfrohen Kissen, auf dem flachen Tisch vor uns stehen Fruchtsäfte und Tee, ein Kellner kommt vorbei und fragt, was Jean-Baptiste und ich wünschen, und wir geben mechanisch unsere Bestellung auf, dann herrscht wieder Stille. Sie währt lange, so lange, bis Philippe plötzlich zu sprechen beginnt. Er richtet sich an niemanden Bestimmten. Seine Stimme ist schrill und abgehackt wie ein kaputtes Getriebe. In den folgenden Stunden wird er diesen Bericht mehrere Male in fast identischer Weise wiederholen.
Heute morgen, gleich nach dem Frühstück, sind Jérôme und Delphine auf den Markt gegangen, und er ist zu Hause geblieben, um auf Juliette und Osandi aufzupassen, die Tochter des Vermieters ihres guesthouse. Er saß in seinem Korbsessel auf der Terrasse des Bungalows und las in der Lokalzeitung, von Zeit zu Zeit blickte er auf, um die beiden kleinen Mädchen im Auge zu behalten, die am Wasser spielten. Sie hüpften lachend durch die flachen Wellen. Juliette sprach Französisch, Osandi Singhalesisch, aber sie verstanden sich trotzdem bestens. Ein paar Krähen stritten sich zeternd um die Krümel, die vom Frühstück übriggeblieben waren. Alles war friedlich, es würde ein schöner Tag werden, Philippe überlegte, ob er nachmittags mit Jérôme angeln gehen sollte. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass die Krähen verschwunden und keine Vogelstimmen mehr zu hören waren. In diesem Moment kam die Welle. Einen Augenblick zuvor war das Meer noch gleichmäßig flach, Sekunden später eine Mauer, hoch wie ein Wolkenkratzer, die auf ihn herabstürzte. Blitzartig schoss ihm durch den Kopf, dass er jetzt stirbt und keine Zeit haben wird zu leiden. Eine Weile, die ihm unendlich schien, wurde er in dem gewaltigen Bauch der Welle hin- und hergerissen, fortgespült und umhergeschleudert und schließlich auf den Rücken geworfen. Wie ein Surfer fegte er über Häuser, Bäume und Straße hinweg. Dann floss die Welle in umgekehrter Richtung zurück und sog ihn ins offene Meer hinaus. Er erkannte, dass er auf abgerissene Mauern zuraste, an denen er zerschellen würde, und klammerte sich reflexartig an eine Kokospalme, wurde weggerissen, klammerte sich an die nächste und wäre auch von dort heruntergespült worden, hätte ihn nicht etwas Hartes, vielleicht ein Stück Bretterzaun, eingeklemmt und gegen den Stamm gepresst. Möbel, Tiere, Menschen, Balken und Betonblöcke fluteten an ihm vorbei. Er schloss die Augen und wartete darauf, von einem dieser gigantischen Brocken zertrümmert zu werden, und er hielt sie geschlossen, bis das ungeheuerliche Tosen der Strömung stiller wurde und er anderes hörte, Schreie von verletzten Männern und Frauen, und er begriff, dass die Welt nicht untergegangen war, dass er überlebt hatte und der wahre Albtraum jetzt erst begann. Er öffnete die Augen und ließ sich am Stamm bis zur Wasseroberfläche hinuntergleiten, sie war tiefschwarz und vollkommen undurchsichtig. Die Strömung erzeugte immer noch einen Sog, aber man konnte ihm widerstehen. Vor ihm schwamm die Leiche einer Frau vorbei, den Kopf im Wasser, die Arme weit ausgebreitet. In den Trümmern begannen die Überlebenden nach einander zu rufen, Verletzte schrieen. Philippe zögerte: Sollte er zum Strand oder ins Dorf gehen? Juliette und Osandi waren tot, dessen war er sich sicher. Jetzt musste er Jérôme und Delphine finden und es ihnen sagen. Das war nun seine Bestimmung. Philippe stand bis zur Brust im Wasser, in Badehosen und blutverschmiert, aber er wusste nicht genau, wo er verletzt war. Er wäre lieber reglos dort stehengeblieben und hätte auf Hilfe gewartet, doch er zwang sich zum Gehen. Der Grund unter seinen nackten Füßen war schlammig, kippelig und überzogen mit einem Magma von scharfen Dingen, die er nicht sehen konnte und an denen sich zu verletzen er fürchterliche Angst hatte. Mit jedem Schritt tastete er den Boden ab, nur langsam kam er vorwärts. Hundert Meter von seinem Haus entfernt erkannte er nichts wieder: Nicht eine Mauer, nicht ein Baum standen mehr. Hier und da sah er vertraute Gesichter, Nachbarn, die wie er herumwateten, schwarz vom Schlamm und rot vom Blut, mit vor Entsetzen aufgerissenen Augen, und wie er suchten sie ihre Angehörigen. Das Saugen des zurückströmenden Wassers war kaum noch zu hören, dafür wurden die Schreie umso lauter, das Heulen, das Röcheln. Philippe erreichte die Straße, dann, etwas weiter oben, die Kante, an der die Welle umgekehrt war. Diese scharf markierte Grenze war seltsam: unterhalb davon das Chaos, oberhalb die normale, völlig intakte Welt, die Häuschen aus rosa oder blassgrünen Backsteinen, die Wege aus rotem Laterit, Verkaufsbuden, Mofas, bekleidete, geschäftige, lebendige Menschen, die gerade erst zu begreifen begannen, dass etwas Gewaltiges, Grauenhaftes geschehen war; aber sie wussten noch nicht genau, was. Die Zombies, die wie Philippe wieder einen Fuß in die Welt der Lebenden setzten, konnten nichts anderes stammeln als das Wort »Welle«, und dieses Wort verbreitete sich im Dorf wie ein Lauffeuer, ähnlich, wie das Wort »Flugzeug« am 11. September 2001 in Manhattan die Runde gemacht haben musste. Panikwellen trieben die Menschen in zwei Richtungen: hin zum Meer, um zu sehen, was geschehen war, und um die zu retten, die noch zu retten waren, oder weg vom Meer, so weit weg wie möglich, für den Fall, dass das Ganze noch einmal von vorn begann. Durch das Gedränge und die Schreie hindurch lief Philippe die Hauptstraße hinauf bis zum Markt. Es war die Zeit des größten Andrangs, er machte sich darauf gefasst, Delphine und Jérôme lange suchen zu müssen, doch er sah sie sofort, sie standen unter der Turmuhr. Das Gerücht einer Katastrophe, das sie gerade erreichte, war so konfus, dass Jérôme im ersten Moment glaubte, ein Amokläufer habe irgendwo in Tangalle ein Feuer eröffnet. Philippe steuerte auf sie zu; er wusste, dies waren ihre letzten glücklichen Sekunden. Sie sahen ihn auf sich zukommen, dann stand er vor ihnen, mit Schlamm und Blut besudelt, das Gesicht verzerrt, und an diesem Punkt endet Philipps Bericht. Er schafft es nicht weiterzuerzählen. Sein Mund bleibt offen stehen, und es gelingt ihm nicht, noch einmal die drei Worte zu formulieren, die er in diesem Augenblick hatte aussprechen müssen.
Delphine schrie los, Jerôme nicht. Er nahm Delphine in die Arme und presste sie an sich, so fest er konnte, während sie weiter schrie und schrie und schrie, und in diesem Moment fasste er den Entschluss: Ich kann für meine Tochter nichts mehr tun, also rette ich meine Frau. – Ich habe diese Szene nicht miterlebt, ich erzähle sie nach Philippes Bericht. Aber ich war in der Folge dabei und habe Jérôme diesem Beschluss folgen sehen. Er verlor keine Zeit damit, weiter zu hoffen. Philippe war nicht nur sein Schwiegervater, sondern auch sein Freund. Er vertraute ihm vollkommen, und er hatte sofort verstanden: Wie geschockt und verwirrt Philippe auch immer sein mochte, wenn er diese drei Worte ausgesprochen hatte, waren sie wahr. Delphine dagegen wollte glauben, dass er sich irrte. Er selbst war doch auch davongekommen, also vielleicht auch Juliette ... Philippe schüttelte den Kopf: Unmöglich, Juliette und Osandi standen direkt am Wasser, es gibt keine Hoffnung, nicht die geringste. Sie fanden sie schließlich im Krankenhaus wieder, zwischen den Dutzenden oder schon Hunderten von Leichen, die der Ozean wieder ausgespuckt hatte und die man aus Platzmangel bereits in die Flure legte. Osandi und ihr Vater waren auch darunter.
Im Verlauf des Nachmittags verwandelt sich das Hotel in ein Floß der Medusa. Touristen, die Opfer der Katastrophe geworden sind, kommen halbnackt, oft verletzt und unter Schock an, man hat ihnen gesagt, hier seien sie sicher. Ein Gerücht macht die Runde, dass eine zweite Welle folgen könnte. Die Einheimischen flüchten auf die andere Seite der Küstenstraße, so weit vom Wasser entfernt wie möglich, und die Ausländer nach oben, das heißt zu uns. Die Telefonverbindungen sind abgeschnitten, doch in den Abendstunden beginnen die Handys der Hotelgäste zu klingeln: Eltern und Freunde, die gerade die Nachrichten gehört haben und sich vor Sorge verzehren, rufen an. Man beruhigt sie so knapp wie möglich, um die Akkus zu schonen. Am Abend nimmt die Hoteldirektion für einige Stunden ein Stromaggregat in Betrieb; es ermöglicht, die Batterien wieder aufzuladen und die Meldungen im Fernsehen zu verfolgen. An der Rückwand der Bar hängt ein riesiger Bildschirm; normalerweise dient er zur Übertragung von Fußballspielen, denn die Besitzer und ein Großteil der Gäste sind Italiener. Alle, Hotelgäste, Personal, Gerettete, versammeln sich vor CNN und erfahren zur gleichen Zeit vom Ausmaß der Katastrophe. Die Bilder kommen aus Sumatra, Thailand, den Malediven; ganz Südostasien und der Indische Ozean sind betroffen. In Schleifen beginnen die kleinen Amateurfilme abzulaufen, in denen man die Welle von fern herannahen, sich in Schlammlawinen in die Häuser stürzen und alles mitreißen sieht. Von da an spricht man von einem »Tsunami«, als hätte jeder dieses Wort immer schon gekannt.
Wir essen mit Delphine, Jérôme und Philippe zu Abend, wir treffen sie am nächsten Tag zum Frühstück, dann zum Mittagessen und auch zum Abendessen wieder; bis zu unserer Rückkehr nach Paris trennen wir uns nicht mehr von ihnen. Sie verhalten sich nicht wie vernichtete Menschen, denen alles gleichgültig ist und die über ihrem Unglück erstarren. Sie wollen mit Juliettes Körper zurückkehren, und vom ersten Abend an erhält der schauerliche Schwindel ihrer Abwesenheit ein Gegengewicht durch die damit verbundenen praktischen Fragen. Jérôme stürzt sich blindlings in dieses Vorhaben, es ist seine Art, am Leben zu bleiben und Delphine am Leben zu erhalten, und Hélène steht ihnen bei, indem sie versucht, die Versicherungsgesellschaft zu erreichen und ihre Abreise und die Rückführung von Juliettes Leiche zu organisieren. Natürlich ist es kompliziert, unsere Handys funktionieren schlecht, da ist die Entfernung, die Zeitverschiebung, alle Zentralen sind überlastet; man hängt sie in die Warteschleife und zwingt sie, während der wertvollen Minuten, in denen sich der Akku entleert, Musikgeplätscher und Stimmen vom Band zu hören. Als Hélène endlich auf ein menschliches Wesen trifft, wird sie an eine andere Stelle weitergeleitet, die Musik beginnt von vorn oder die Verbindung wird unterbrochen. Die üblichen Hindernisse, die normalerweise einfach nur ärgerlich sind, werden jetzt, unter diesen außergewöhnlichen Umständen, ungeheuerlich und hilfreich zugleich, denn sie stecken die Aufgabe ab, die zu bewältigen ist, und geben der ablaufenden Zeit Struktur. Es gibt etwas zu tun, Jérôme packt es an und Hélène hilft ihm dabei, so einfach ist das. Gleichzeitig beobachtet er Delphine. Delphine schaut ins Leere. Sie weint nicht, sie schreit nicht. Sie isst sehr wenig, aber immerhin ein wenig. Ihre Hand zittert, aber sie ist fähig, eine Gabel voll Curryreis zum Mund hinaufzuführen. Sie hineinzuschieben. Zu kauen. Die Hand mit der Gabel wieder abzusenken. Dieselbe Geste noch einmal zu beginnen. Ich meinerseits beobachte Hélène, und ich fühle mich ungeschickt, machtlos und unnütz. Fast nehme ich ihr übel, sich so für andere einzusetzen und sich nicht mehr um mich zu kümmern: Es ist, als existiere ich nicht mehr.
Später liegen wir nebeneinander im Bett. Meine Fingerspitzen streifen die ihren, sie antworten nicht. Ich würde sie gern in die Arme schließen, aber ich weiß, es geht nicht. Ich weiß, woran sie denkt, es ist unmöglich, an etwas anderes zu denken. In einem anderen Bungalow, ein paar Meter von uns entfernt, liegen Jérôme und Delphine wahrscheinlich auch mit offenen Augen da. Hält er sie in den Armen, oder ist es auch ihnen unmöglich? Es ist die erste Nacht. Die Nacht, die auf den Tag folgt, an dem ihre Tochter starb. Heute morgen war sie noch lebendig, sie ist aufgewacht und in ihr Bett gekrochen, um zu spielen, sie hat Papa und Mama gerufen und gelacht, sie war warm, sie war das Schönste, Wärmste und Süßeste, was es auf dieser Welt gab, und jetzt ist sie tot. Sie wird für immer tot sein.
Seit Beginn unseres Aufenthalts hatte ich immer wieder genörgelt, ich würde das Hotel Eva Lanka nicht mögen, und hatte vorgeschlagen, in eines der kleinen guesthouses am Strand zu ziehen, die weniger komfortabel waren, aber mich an meine Rucksackreisen vor fünfundzwanzig, dreißig Jahren erinnerten. Es war mir nicht wirklich ernst: In meinen Beschreibungen dieser wunderbaren Orte schmückte ich mit heimlichem Vergnügen das Fehlen von Strom aus, die durchlöcherten Moskitonetze und die giftigen Spinnen, die einem auf den Kopf fallen; Hélène und die Kinder stießen spitze Schreie aus und mokierten sich über meine Althippie-Sehnsüchte, es war unser Running Gag. Die guesthouses am Strand sind von der Welle weggewischt worden und mit ihnen die meisten ihrer Bewohner. Ich denke: Wir hätten unter ihnen gewesen sein können. Jean-Baptiste und Rodrigue hätten an den Strand unterhalb des Hotels gegangen sein können. Wir hätten, wie vorgesehen, mit dem Taucherclub auf Tour gewesen sein können. Und Delphine und Jérôme müssen sich denken: Wir hätten Juliette mit auf den Markt nehmen sollen. Hätten wir es getan, würde sie morgen früh noch zu uns ins Bett kriechen. Die Welt um uns herum wäre voller Trauer, aber wir würden unsere kleine Tochter in die Arme schließen und uns sagen: Sie ist da, Gott sei Dank, das ist alles, was zählt.
Am Morgen des zweiten Tags sagt Jérôme: Ich gehe zu Juliette. Als wolle er sicherstellen, dass man sich gut um sie kümmert. Geh ruhig, sagt Delphine. Er bricht mit Philippe auf. Hélène leiht Delphine einen Badeanzug, und diese schwimmt lange, langsam, mit aufgerichtetem Kopf und leerem Blick ihre Bahnen. Rund um den Swimmingpool sitzen inzwischen drei oder vier Touristenfamilien, die auch zu Schaden gekommen sind, aber sie haben nur ihre Sachen verloren und wagen nicht recht, vor Delphine über die Zerreißproben zu klagen, die sie zu bestehen hatten. Die Deutschschweizer verfolgen ihr Ayurveda-Seminar so seelenruhig weiter, als würden sie nichts von dem bemerken, was rings um sie vor sich geht. Gegen Mittag kommen Philippe und Jérôme verstört zurück: Juliette ist nicht mehr im Krankenhaus von Tangalle, man hat sie woandershin gebracht, die einen sagen nach Matara, die anderen nach Colombo. Es gibt zu viele Leichen, manche werden verbrannt, andere fortgeschafft. Gerüchte von einer Seuchengefahr beginnen die Runde zu machen. Alles, was man für Jérôme tun konnte, war, ihm auf einen Zettel ein paar Worte zu kritzeln, die ihm ein Hotelangestellter nun peinlich berührt übersetzt. Es ist eine Art Quittung, die nur bescheinigt: »kleines weißes Mädchen, blond, mit rotem Kleid«.
Hélène und ich fahren selbst nach Tangalle. Der Tuk-tuk-Chauffeur ist redselig, many people dead, aber seine Frau und seine Kinder seien Gott sei Dank unverletzt. Als wir uns dem Krankenhaus nähern, überfällt uns ein ätzender Gestank. Selbst wenn man ihn noch nie gerochen hat, erkennt man ihn sofort. Dead bodies, many dead bodies, kommentiert der Chauffeur und hält sich ein Taschentuch vor die Nase und rät uns, es ihm gleichzutun. Im Hof schuften Männer, nur einige von ihnen haben Pflegerkittel an, die anderen, wahrscheinlich Freiwillige, tragen Zivilkleidung; auf Krankenbahren schaffen sie Leichen herbei und stapeln sie auf die Ladefläche eines mit einer Plane bespannten LKWs. Diese wird man fortschaffen, andere werden eintreffen. Wir betreten einen großen Raum im Erdgeschoss, der weniger der Empfangshalle eines Krankenhauses gleicht als einem Fischmarkt. Der Zementboden ist feucht und glitschig, man spritzt ihn regelmäßig ab, um einen Anschein von Frische zu bewahren. Die Leichen liegen aufgereiht da, ich zähle etwa vierzig. Sie sind seit gestern hier, viele von ihnen sind vom langen Verbleib im Wasser aufgedunsen. Es sind keine Weißen darunter, vielleicht wurden sie wie Juliette bevorzugt weggeschafft. Ihre Haut wirkt eher grau als dunkel. Ich habe noch nie einen Toten gesehen, es kommt mir plötzlich seltsam vor, bis zum Alter von siebenundvierzig Jahren davon verschont geblieben zu sein. Einen Stoffzipfel gegen die Nase gepresst besichtigen wir weitere Räume und steigen in den ersten Stock hinauf. Es gibt keinerlei Kontrolle, die Besucher sind kaum vom Krankenhauspersonal zu unterscheiden, keine Tür ist verschlossen, überall liegen graue, aufgeblähte Leichen. Ich denke an das Seuchengerücht und an den Holländer, der im Hotel mit großer Bestimmtheit sagte, wenn man all diese Toten nicht sofort verbrenne, sei eine Gesundheitskatastrophe unausweichlich, sie würden das Brunnenwasser vergiften und Ratten die Cholera in die Dörfer tragen. Ich habe Angst, durch den Mund zu atmen, aber auch durch die Nase, als könne dieser grauenhafte Gestank ansteckend sein. Ich frage mich, was wir überhaupt hier tun. Schauen. Nur schauen. Hélène ist die einzige Journalistin vor Ort, gestern Abend hat sie einen ersten Artikel diktiert, heute morgen einen zweiten, sie hat ihren Fotoapparat mitgenommen, aber sie bringt es nicht übers Herz, ihn herauszuziehen. Sie spricht einen sichtlich erschöpften Arzt an und stellt ihm ein paar Fragen auf Englisch. Er antwortet, aber wir verstehen nur die Hälfte. Als wir wieder draußen stehen, ist der LKW mit den Leichen abgefahren. Hinter dem Zaun, am Straßenrand, gibt es einen Grünstreifen mit trockenem, scharfem Gras, das von einem riesigen Banyanbaum überschattet wird; unter dem Banyan sitzen ein Dutzend Menschen. Weiße in zerfetzten Kleidern voller kleiner Wunden – sie haben sich nicht die Zeit genommen, sie zu versorgen. Wir gehen zu ihnen, und sie scharen sich um uns. Sie alle haben jemanden verloren, Frau, Mann, Kind, Freund, aber im Gegensatz zu Delphine und Jérôme haben sie diese nicht tot gesehen und wollen weiter hoffen. Die erste, die uns ihre Geschichte erzählt, heißt Ruth. Eine rothaarige, etwa fünfundzwanzigjährige Schottin. Sie bewohnte mit Tom einen Bungalow am Strand, sie waren frisch verheiratet und auf Hochzeitsreise. Sie standen zehn Meter voneinander entfernt, als die Welle kam. Ruth wurde fortgerissen, dann aber auf dieselbe Weise gerettet wie Philippe; seither sucht sie Tom. Sie hat ihn überall gesucht: am Strand, zwischen den Trümmern, im Dorf, auf der Polizeistation. Als sie verstanden hat, dass alle Leichen ins Krankenhaus gebracht werden, ist sie hierher gekommen und hat sich nicht mehr von der Stelle gerührt. Sie ist schon mehrmals drin gewesen und hat die Entladung der LKWs, die neue Leichen bringen, überwacht und auch die Beladung derer, die zu den Scheiterhaufen fahren, sie hat nicht geschlafen und nichts gegessen, die Leute vom Krankenhaus haben ihr gesagt, sie solle sich ausruhen, man hat ihr versprochen, sie zu benachrichtigen, falls es Nachrichten gäbe, aber sie will nicht weg, sie will mit den anderen hierbleiben, und die anderen bleiben aus dem gleichen Grund. Sie ahnen, dass die Nachrichten nur noch schlecht sein können. Aber sie wollen da sein, wenn der Körper ihres geliebten Menschen vom LKW gehoben wird. Da Ruth schon seit gestern Abend hier wacht, ist sie gut informiert: Sie bestätigt, dass die Leichen der Weißen, die im Krankenhaus ankommen, schnell nach Matara gebracht werden, wo es mehr Platz und offenbar auch einen Kühlraum gibt. Bei den Leichen der Dorfbewohner wartet man auf die Nachfragen der Familien, aber viele Familien, vor allem von Fischern, deren Häuser sehr nah am Wasser standen, wurden vollständig ausgelöscht, und es gibt niemanden mehr, der die Toten abholen könnte, also schickt man sie auf den Scheiterhaufen. Das alles geschieht auf chaotische, improvisierte Weise. Da Strom und Telefon unterbrochen und die Straße abgeschnitten sind, kann keine Hilfe von außen kommen, und was sollte dieses Außen auch sein, da doch die ganze Insel betroffen ist? Niemand ist verschont worden, jeder kümmert sich um seine eigenen Toten. Ruth formuliert es so, doch sie sieht wohl, dass Hélène und ich eine Ausnahme bilden. Wir sind unverletzt und beieinander, unsere Kleider sind sauber, und wir suchen niemanden Bestimmten. Nach diesem Besuch in der Hölle werden wir in unser Hotel zurückkehren, wo uns jemand das Mittagessen servieren wird. Wir werden im Swimmingpool baden, unsere Kinder in die Arme schließen und dabei denken: Das war knapp. Ein schlechtes Gewissen führt zu nichts, ich weiß, eher raubt es einem Zeit und Kraft, trotzdem quält es mich, und ich möchte es dringend loswerden. Hélène dagegen kümmert sich nicht um ihre Seelenzustände. Sie setzt ihre ganze Kraft ein, um zu tun, was in ihrer Macht steht. Auch wenn es vergeblich sein sollte, es muss getan werden. Sie ist aufmerksam und genau, stellt Fragen und denkt an alles, was von Nutzen sein könnte. Sie hat unser gesamtes Bargeld mitgenommen und verteilt es an Ruth und ihre Gefährten. Sie notiert die Namen eines jeden und dann die Namen und eine grobe Beschreibung der Vermissten. Sie will versuchen, morgen nach Matara zu fahren und dort nach ihnen suchen. Sie schreibt sich die Telefonnummern der Familien in Europa und in Amerika auf, um sie anzurufen und ihnen mitzuteilen: Ich habe Ruth gesehen, sie lebt, ich habe Peter gesehen, er lebt. Sie schlägt vor, diejenigen, die es wollen, mit ins Hotel zu nehmen, es würde reichen, wenn einer oder zwei als Wachposten hierblieben, inzwischen könnten die anderen etwas essen, sich waschen, sich verarzten lassen, ein bisschen schlafen und telefonieren, danach würden sie zur Ablösung wiederkommen. Doch keiner will mit.
Von diesen Weißen, die unter dem Banyan vor dem Krankenhaus Wache hielten, ist mir vor allem Ruth in Erinnerung geblieben, denn mit ihr sprachen wir am meisten und sie sahen wir auch später wieder, aber ich erinnere mich auch an eine korpulente, kurzhaarige Engländerin mittleren Alters, die ihre Freundin verloren hatte – my girlfriend, sagte sie – und ich stelle mir das Leben dieses alternden lesbischen Paars in ihrer englischen Kleinstadt vor, ihr Engagement in den ortsansässigen Vereinen, ihr liebevoll eingerichtetes Haus, ihre jährlichen Fernreisen, ihre Fotoalben – all das in Scherben. Die Rückkehr der Überlebenden, das leere Haus. Die Kaffeebecher mit dem Namen einer jeden, von denen einer nie wieder benutzt werden wird. Und die dicke Frau am Küchentisch, die ihren Kopf in die Hände legt und weint und sich sagt, von nun an bin ich allein und werde es bis zu meinem Tod bleiben ... In den Monaten nach unserer Rückkehr war Hélène wie besessen von der Idee, noch einmal Kontakt mit den Mitgliedern dieser Gruppe aufzunehmen, um zu erfahren, was aus ihnen geworden war und ob einige von ihnen ein Wunder hatten erleben dürfen. Aber so sehr sie in unserem Gepäck auch nach dem Zettel suchte, auf dem sie alles notiert hatte, sie konnte ihn nicht wiederfinden, und wir müssen es hinnehmen, nie mehr von diesen Menschen zu hören. Das Bild, das ich bis heute von der halben Stunde bewahre, die wir mit ihnen verbrachten, gleicht einem Bild aus einem Horrorfilm. Da sind wir, sauber, adrett und verschont, und um uns herum diese Schar von Aussätzigen, von Strahlenopfern, von verwilderten Schiffbrüchigen. Am Abend zuvor waren sie noch wie wir und wir wie sie, aber ihnen geschah etwas, das uns nicht geschah, und jetzt gehören wir zu zwei verschiedenen Sorten von Mensch.
Am Abend erzählt uns Philippe von seiner Liebe zu Ceylon; vor mehr als zwanzig Jahren kam er zum ersten Mal hierher. Er war Informatiker in einem Pariser Vorort gewesen und hatte von fernen Ländern geträumt, dann freundete er sich mit einem sri-lankischen Kollegen an, und dieser lud Philippe, seine damalige Frau und die damals noch kleine Delphine auf die Insel ein. Es war ihre erste große Familienreise, und sie liebten einfach alles: das Gewimmel der Städte, die Frische der Berge, den Dämmerschlaf der Dörfer am Ozean, die Reisterrassen, die Schreie der Geckos, die Dächer aus gewellten Ziegeln, die Tempel im Regenwald, die Morgendämmerung, das Lächeln der Leute und die Reiscurrygerichte, die man mit den Fingern isst. Philippe dachte: Das ist das wahre Leben, hier will ich irgendwann bleiben. Doch noch war es nicht so weit. Der sri-lankische Kollege ging nach Australien, man schrieb sich hin und wieder, verlor sich dann aber aus den Augen; die Verbindung zur Zauberinsel brach ab. Philippe hatte genug davon, ein höherer Angestellter aus der Vorstadt zu sein, er begeisterte sich für Wein, und zu dieser Zeit fand ein Informatiker leicht gutbezahlte Arbeit, wo immer er wollte, also zog er in die Nähe von Saint-Émilion. Dort baute er sich schnell einen eigenen Kundenstamm auf: große Winzer und Einkaufszentralen, deren Verwaltungssysteme er modernisierte und wartete. Seine Frau eröffnete eine Boutique, die sehr gut lief – entgegen jeder Erwartung, denn es handelte sich um eine Gegend mit dem Ruf, Zugezogenen nicht besonders offen zu begegnen. Sie lebten nun auf dem Land, in einem hübschen Haus zwischen Weinreben, und verdienten gut mit Dingen, die sie gern machten: eine gelungene Veränderung. Dann lernte Philippe Isabelle kennen und ließ sich ohne große Dramatik scheiden. Delphine wurde älter, umwerfend hübsch und klug. Mit nicht einmal fünfzehn Jahren traf sie zum ersten Mal Jérôme und beschloss, dass er ihr Mann fürs Leben sei. Er war einundzwanzig, sah gut aus, stand mit beiden Beinen fest auf dem Boden und war Erbe einer reichen Weinhändlerfamilie. In seinen Kreisen scherzt man nicht mit Standesunterschieden, aber als sich seine jugendliche Schwärmerei mit den Jahren zu einer ernsthaften, beidseitigen Verbindlichkeit entwickelte, wusste Jérôme dem Druck der Seinen zu widerstehen und zeigte Entschlossenheit und Charakterstärke: Er liebte Delphine und hatte sie erwählt, niemand würde sie ihm nehmen. Philippe vergötterte seine Tochter, man hatte allen Anlass zu befürchten, dass nie ein Anwärter vor ihm würde bestehen können, aber auch bei ihm und Jérôme war es Liebe auf den ersten Blick: eine freundschaftliche Liebe zwischen Schwiegersohn und Schwiegervater. Trotz der zwanzig Jahre Altersunterschied entdeckten beide aneinander die gleichen Vorlieben: für große Bordeaux-Weine und die Rolling Stones, Pierre Desproges und das Angeln und als Krönung all dessen ihre Liebe zu Delphine. Schon bald ähnelte ihre Beziehung einer zwischen alten Freunden. Die beiden Jungverheirateten fanden ein Haus etwa zehn Kilometer von dem Dorf entfernt, wo Philippe und Isabelle wohnten, und die beiden Paare wurden unzertrennlich. Sie tafelten zu viert mal bei den einen, mal bei den anderen, und Philippe und Jérôme zogen jeder eine Flasche hervor, die man mit verbundenen Augen verkostete, man verbrachte den Abend damit, sich über Farbton, Geschmacksnote und Weintränen auszulassen, zum Dessert zündete man sich einen Joint mit selbst angebautem Gras an und legte Angie oder Satisfaction auf, alle liebten sich und waren glücklich. Unterm Weinlaub begann Philippe wieder von Sri Lanka zu sprechen. Acht Jahre lag die erste Reise nun schon zurück, doch seine Sehnsucht nach diesem Land war geblieben. An einem Herbstabend kurz nach der Weinlese aßen sie draußen zu Abend, sie hatten einen Château-Magdelaine von 1967, Jérômes Geburtsjahr, getrunken und sprachen davon, in den Ferien zu viert nach Sri Lanka zu fahren, da warf Isabelle eine Idee in die Runde: Und wenn die beiden Männer vorher eine kleine Erkundungstour machten?
Diese kleine, fünfwöchige Erkundungstour durch Sri Lanka ist den beiden in zauberhafter Erinnerung. Mit dem Rucksack auf dem Rücken und dem Guide du routard in der Tasche stiegen sie aufs Geratewohl in Züge, Busse und Tuk-tuks, landeten auf Dorffesten und gerieten an die unterschiedlichsten Menschen. Philippe war stolz, seinem Schwiegersohn seine Insel zu zeigen, und zunächst etwas perplex, dann aber auch beeindruckt, dass dieser sich dort nach einigen Tagen sogar besser zurechtfand als er. Mit seinem Format, seinem Humor und seiner gutmütigen Ironie stelle ich mir Jérôme als einen idealen Reisegefährten vor: einer, der die Dinge auf sich zukommen lässt, der es nicht eilig hat und nie völlig überrascht ist, der Widrigkeiten als Herausforderungen betrachtet und Fremden als möglichen Freunden begegnet. Der kleinere, nervösere, redseligere Philippe wieselte wahrscheinlich um diesen Ruhepol herum wie sein Quasi-Doppelgänger Pierre Richard um Gérard Dépardieu in Zwei irre Spaßvögel oder Ein Tollpatsch kommt selten allein. Und sicher amüsierte es sie köstlich, ihre Gesprächspartner auf den Veranden der guesthouses mit der Auskunft zu überraschen, sie seien Schwiegersohn und Schwiegervater.
Dann fuhren sie in den Süden. Die Küstenstraße von Colombo nach Tangalle, für die wir mit dem Taxi einen halben Tag gebraucht haben, nahmen sie in langen Etappen, und je träger sie sich in Kurven dahinwandte und von der Hauptstadt entfernte, desto paradiesischer und zeitloser erschien das Leben zwischen Brandung und Kokospalmen. Die letzte richtige Stadt an dieser Küste ist Galle, die portugiesische Festung, wo Nicolas Bouvier vierzig Jahre zuvor einsam gestrandet war und in Gesellschaft von Termiten und Geistern eine geraume Zeit in der Hölle verbracht hatte. Philippe und Jérôme empfanden nicht die geringste Affinität zur Hölle und setzten ihren Weg fröhlich pfeifend fort. Nach Galle gibt es nur noch ein paar Fischerdörfer: Welligama, Matara, Tangalle und das vorgelagerte Medaketiya. Eine Handvoll gischtangefressene Häuser aus grünen oder rosa Backsteinen und einen Dschungel aus Kokospalmen, Bananenstauden und Mangobäumen, deren Früchte einem direkt auf den Teller fallen. Weißer Sandstrand, Einbäume, die mit bunten Balancierstangen gesteuert werden, Fischernetze, Hütten. Keine Hotels, dafür einige Häuschen, die als guesthouses dienen und deren Besitzer M. H. genannt wird. Das heißt, eigentlich trägt er einen dieser srilankischen Namen mit mindestens zwölf Silben, ohne die ein Mensch kein Gewicht hat auf Erden, aber um den Ausländern das Leben leichter zu machen, nennt er sich M. H. und spricht das englisch aus: ämäitsch. Medaketiya und das guesthouse von M. H., das ist der Traum aller Rucksackreisenden dieser Welt. Der Strand. Das Ende der Reise, der Ort, an dem man sich endlich niederlässt. Lächelnde, unkomplizierte Einwohner, die einen nicht über den Tisch ziehen. Kaum Touristen und die wenigen einem selbst ähnlich: ruhige Individualisten, die den Geheimtipp eifersüchtig für sich behalten. Philippe und Jérôme blieben drei Tage dort, sie schwammen im Ozean, aßen abends den Fisch, den sie morgens selbst fingen, tranken Bier, rauchten Joints und gratulierten sich gegenseitig zum Erfolg ihrer Erkundungen: Das Paradies auf Erden existierte tatsächlich, sie hatten es gefunden – fehlten nur noch ihre Frauen. Als sie M. H. bei der Abreise ankündigten, bald wiederzukommen, wünschte dieser ihnen höflich das sri-lankische Pendant zu Inschallah, doch tatsächlich kamen sie schon im nächsten Jahr zu viert zurück und auch im übernächsten und in allen folgenden Jahren. Ihr Leben richtete sich mehr und mehr zwischen Saint-Émilion und Medaketiya ein. Vor allem Philippes, denn die anderen hatten mehr Verpflichtungen und kamen nur während der Ferienzeit in Europa mit, er dagegen verbrachte jedes Jahr drei oder vier Monate dort. Immer bei M. H., der nach und nach ihr Freund wurde und sie sogar einmal in der Gironde besuchte – wobei die Reise nicht besonders glücklich verlief. So weit von seinen Wurzeln entfernt fühlte sich M. H. nicht recht wohl, und er konvertierte auch nicht zu den Grands Crus der Bordeaux-Weine. Nun gut. Schließlich zog Philippe vom guesthouse in einen anderen Bungalow um, den M. H. ihm fest vermietete. Isabelle und er richteten ihn nach ihrem eigenen Geschmack ein, und er wurde ein echtes Zuhause. Sie hatten ein Haus in Medaketiya, Freunde in Medaketiya. Jeder dort kannte und mochte sie. Als Juliette geboren wurde, nahmen sie sie schon als Baby mit. M. H. hatte zu seinen großen Söhnen spät noch eine kleine Tochter namens Osandi bekommen, und die drei Jahre ältere Osandi lernte schon bald, sich um Juliette zu kümmern wie um eine Schwester.