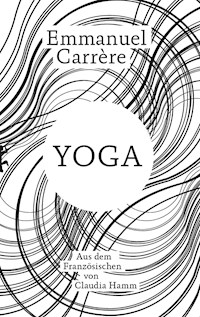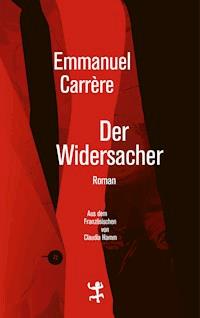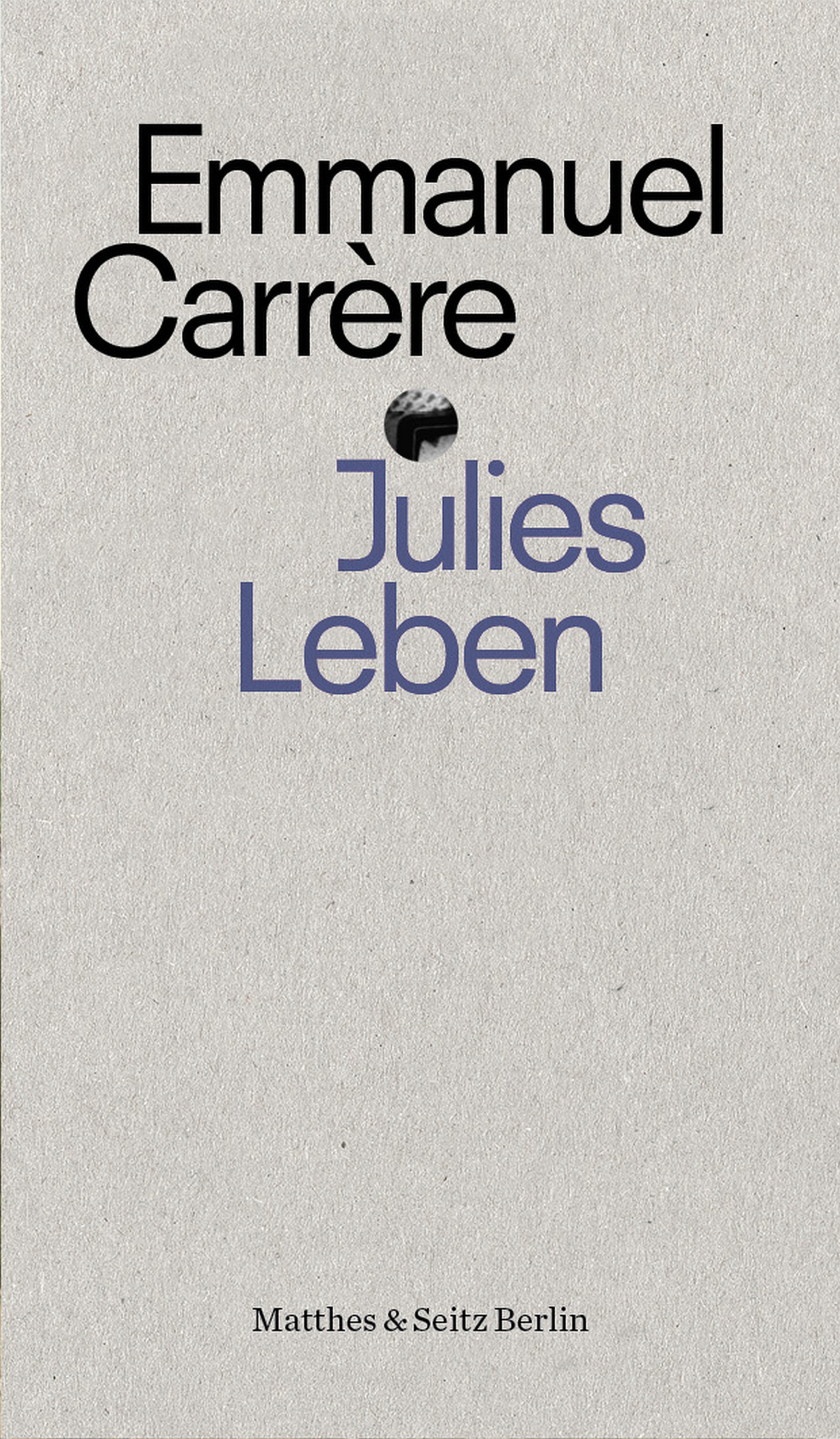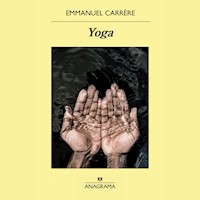Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mein Leben war verfolgt von Wahnsinn und Horror. Die Bücher, die ich geschrieben hatte, sprachen von nichts anderem. Nach Der Widersacher konnte ich nicht mehr. Ich wollte diesem Zwang entkommen. Und ich dachte, ihm durch die Liebe zu einer Frau und durch Nachforschungen über meine Familie entkommen zu können. Die Nachforschungen drehten sich um meinen Großvater mütterlicherseits, der nach einem tragischen Leben 1944 verschwand und sehr wahrscheinlich als Kollaborateur erschossen wurde. Seine Geschichte ist das Geheimnis meiner Mutter, das Gespenst, das in unserer Familie spukt. Um dieses Gespenst zu bannen, ging ich riskante Wege. Sie führten mich in ein verlorenes russisches Provinzstädtchen, und ich blieb lange dort, auf der Lauer, dass irgendetwas geschehe. Und es geschah etwas: ein grausames Verbrechen. Wahnsinn und Horror holten mich wieder ein. Sie holten mich auch in meinem Privatleben ein. Ich hatte für die Frau, die ich liebte, eine erotische Geschichte geschrieben, die in die Wirklichkeit eingreifen sollte, doch die Wirklichkeit entzog sich meinen Plänen. Sie stürzte uns vielmehr in einen Albtraum, der den grausamsten in meinen Büchern glich und der unser Leben und unsere Liebe zerstörte. Denn darum dreht sich dieses Buch: um die Drehbücher, die wir ausarbeiten, um die Wirklichkeit zu zähmen, und um die fürchterliche Weise, mit der sich die Wirklichkeit dieser bemächtigt, um darauf zu antworten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emmanuel Carrère Ein russischer Roman
Index
1
2
3
4
5
6
7
1
Der Zug rollt, es ist Nacht, auf der schmalen Liegestatt schlafe ich mit Sophie, und diesmal ist es wirklich sie. Normalerweise sind die Partnerinnen in meinen erotischen Träumen schwer zu identifizieren, sie sind mehrere Frauen in einer und haben dennoch das Gesicht von keiner von ihnen, aber diesmal ist es anders, ich erkenne eindeutig Sophies Stimme wieder, ihre Worte und ihre gespreizten Beine. Auf einmal ist da noch ein Paar in unserem Schlafwagenabteil, in dem wir uns bis jetzt allein befanden: Herr und Frau Fujimori. Frau Fujimori gesellt sich ganz nonchalant zu uns, und es herrscht sofort ein sehr heiteres Einvernehmen. Von Sophie in einer akrobatischen Stellung abgestützt, dringe ich in Frau Fujimori ein, und diese erbebt schon bald in einem heftigen Orgasmus. In diesem Moment weist uns Herr Fujimori darauf hin, dass der Zug nicht mehr fährt. Er ist, vielleicht schon vor geraumer Zeit, an einem Bahnhof zum Stehen gekommen. Vom mit gelbem Natriumdampf erleuchteten Bahnsteig aus beobachtet uns reglos ein Soldat. Wir ziehen eilig die Vorhänge zu und, überzeugt, dass der Soldat umgehend in unserem Waggon auftauchen wird, um uns für unser Benehmen zur Rechenschaft zu ziehen, räumen wir hastig alles auf und ziehen uns an, um für den Moment gewappnet zu sein, da er die Abteiltür aufschieben wird und wir ihm dreist versichern werden, er könne nichts gesehen, er müsse geträumt haben. Wir stellen uns sein mürrisches, misstrauisches Gesicht vor. All das geschieht in einer erregenden Mischung aus Kopflosigkeit und verrücktem Gelächter. Trotzdem erkläre ich, dass es nichts zu lachen gebe: Uns droht, verhaftet und auf die Wache gebracht zu werden, während der Zug weiterfährt, und dann kann weiß Gott alles passieren, unsere Spur wird verloren sein, wir werden krepieren und niemand wird uns in dem finsteren Verlies dieses schlammigen Nests im tiefen Russland schreien hören. Sophie und Frau Fujimori kringeln sich vor Lachen ob meiner Warnungen, und am Ende stimme ich in ihr Gelächter ein.
Der Zug steht, wie in meinem Traum, an einem menschenleeren, aber grell erleuchteten Bahnsteig. Es ist drei Uhr morgens, wir befinden uns irgendwo zwischen Moskau und Kotelnitsch. Meine Kehle ist trocken und ich habe Kopfschmerzen, vor dem Aufbruch zum Bahnhof habe ich im Restaurant zu viel getrunken. Leise, um den auf der Liege gegenüber schlafenden Jean-Marie nicht aufzuwecken, zwänge ich mich zwischen unsere Koffer mit der Filmausrüstung, die das Abteil verstopfen, und trete auf der Suche nach einer Flasche Wasser auf den Gang. Im Zugrestaurant, wo wir wenige Stunden zuvor unsere letzten Wodkas hinuntergekippt haben, wird nicht mehr bedient. Das Licht ist bis auf eine Notbeleuchtung pro Tisch heruntergedimmt. Vier Soldaten haben allerdings Vorsorge getroffen und zechen weiter. Als ich an ihnen vorbeigehe, bieten sie mir ein Glas an, doch ich lehne ab, und während ich meine Suche fortsetze, entdecke ich auf einer Bank zusammengesunken und kräftig schnarchend unseren Dolmetscher Sascha. Ich lasse mich ein Stück von ihm entfernt nieder, berechne die Zeitverschiebung – Mitternacht in Paris, das geht gerade noch – und versuche, Sophie anzurufen, um ihr von meinem Traum zu erzählen, der mir ausgesprochen vielversprechend erscheint, doch ich komme nicht durch, und so schlage ich mein Notizbuch auf und schreibe ihn nieder.
Wie komme ich auf Herrn und Frau Fujimori? Die Antwort ist schnell gefunden. Es ist der Name des japanischstämmigen peruanischen Präsidenten, über den die Libération gestern berichtete. Ich hatte den Artikel im Flugzeug nur kurz überflogen, die Korruptionsaffären, die ihn gerade um seinen Posten brachten, interessierten mich nicht sonderlich. Dagegen hatte mich ein anderer Bericht auf der gegenüberliegenden Seite in seinen Bann gezogen. In diesem ging es um vermisste Japaner, deren Familien der Überzeugung waren, sie seien nach Nordkorea entführt worden und würden dort gefangen gehalten, einige bereits seit dreißig Jahren. Es gab keine tagespolitische Neuigkeit, die den Artikel rechtfertigte, und man durfte sich fragen, warum er genau an diesem Tag und in diesem Jahr und nicht in irgendeinem anderen erschienen war. Weder hatte es von den Familien organisierte Demonstrationen gegeben noch einen Jahrestag oder irgendwelche neuen Erkenntnisse in dem Fall, den man wahrscheinlich längst ad acta gelegt oder vielleicht nie eröffnet hatte. Es schien, als sei der Journalist ganz zufällig in der U-Bahn oder einer Bar auf Leute gestoßen, deren Söhne oder Brüder in den siebziger Jahren spurlos verschwunden waren. Um der entsetzlichen Ungewissheit zu trotzen, hatten sie sich diese Geschichte zusammengereimt und später, lange Zeit danach, einem Unbekannten erzählt, der sie nun auf seine Weise wiedergab. War sie plausibel? Hatte es, wenn schon keine Beweise, wenigstens Verdachtsmomente gegeben, um sie zu untermauern? Wäre ich der Chefredakteur gewesen, hätte ich den Journalisten wohl aufgefordert, seine Nachforschungen weiterzutreiben. Doch nein, er berichtete nur, dass Einzelpersonen und Familien glaubten, ihre vermissten Verwandten befänden sich als Strafgefangene in nordkoreanischen Lagern. Tot oder lebendig, wer konnte das schon wissen? Wahrscheinlich eher tot: verhungert oder an den Schlägen ihrer Kerkermeister gestorben. Und falls sie noch lebten, durften sie wohl nichts mehr mit den jungen Leuten gemein haben, die man dreißig Jahre zuvor zum letzten Mal gesehen hatte. Was würde man zu ihnen sagen, wenn man sie wiederfände? Und sie, was würden sie sagen? Sollte man überhaupt hoffen, sie wiederzufinden?
Der Zug fährt weiter, durch endlose Wälder. Kein Schnee. Die vier Soldaten sind endlich schlafen gegangen. Im Zugrestaurant, in dem die Notlichter flackern, befinden sich nur noch Sascha und ich. Irgendwann in der Nacht rappelt sich Sascha schnaubend hoch. Sein breiter Strubbelkopf erscheint hinter der Rückenlehne seiner Sitzbank. Er sieht mich schreibend am Tisch sitzen und zieht fragend die Augenbrauen hoch. Ich mache eine kleine, beschwichtigende Handbewegung, wie um zu sagen: Schlaf weiter, wir haben noch Zeit, und er taucht, sicher im Glauben, geträumt zu haben, wieder ab.
Als ich vor fünfundzwanzig Jahren als Zivildienstleistender in Indonesien war, kursierten unter den Reisenden schreckliche und meist wahre Geschichten über die Gefängnisse, in die Leute gesteckt wurden, die mit Drogen erwischt worden waren. In den Bars von Bali fand sich immer irgendein bärtiger Typ mit Muskelshirt, der erzählte, er selbst sei in letzter Sekunde noch entkommen, aber einer seiner weniger glücklichen Freunde brumme hundertfünfzig Jahre in Bangkok oder Kuala Lumpur ab und sieche dort langsam dahin. Eines Abends, als wir schon seit Stunden mit ausgestellter Lässigkeit über derlei Dinge sprachen, es war noch zu Sowjetzeiten, erzählte ein mir unbekannter Typ eine andere, vielleicht erfundene, vielleicht wahre Geschichte. Wenn man die Transsibirische Eisenbahn nimmt, erklärte er, ist es strikt verboten, unterwegs auszusteigen und den Zug an einer Station beispielsweise für eine kurze Stadtbesichtigung zu verlassen und mit dem nächsten weiterzufahren. Nun gibt es aber offenbar bei manchen abgelegenen Städten entlang der Bahnstrecke außergewöhnlich gute halluzinogene Pilze – je nach Zuhörerschaft kann der Köder in der Geschichte auch in sehr seltene und sehr billige Teppiche, Schmuckstücke, Edelmetalle oder Ähnliches abgewandelt werden … Und so wagen ein paar Abenteurer manchmal, sich über das Verbot hinwegzusetzen. Der Zug hält für drei Minuten an einem kleinen Bahnhof in Sibirien. Eine Hundekälte, keine Stadt in Sicht, nur ein paar Baracken: eine trostlose, schlammige, scheinbar unbewohnte Gegend. Klammheimlich steigt der Draufgänger aus. Der Zug fährt weiter, er bleibt allein zurück. Seine Reisetasche über die Schulter geworfen verlässt er den Bahnhof, das heißt den Bahnsteig aus morschen Planken, watet durch Pfützen an Bretter-und Stacheldrahtzäunen entlang und fragt sich, ob das Ganze wirklich eine gute Idee war. Das erste menschliche Wesen, auf das er trifft, ist eine Art durchgedrehter Hooligan, der ihm einen entsetzlichen Mundgeruch ins Gesicht bläst und einen Vortrag hält, dessen Einzelheiten ihm unverständlich bleiben (der Reisende spricht nur ein paar Brocken Russisch), doch seine Hauptaussage ist klar: Er könne hier nicht einfach so herumspazieren, die Polizei werde ihn aufschnappen. Milizija! Milizija! Darauf stürzt ein Schwall an unverständlichen Worten auf den Reisenden ein, aber die Mimik des Halbstarken macht klar, dass dieser ihm vorschlägt, ihn bis zum Eintreffen des nächsten Zugs zu beherbergen. Kein sehr verlockendes Angebot, aber er hat wohl keine andere Wahl, und vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, das Gespräch auf Pilze und Schmuck zu lenken … Seinem Gastgeber folgend betritt er eine scheußliche, von einem qualmenden Ofen beheizte Bretterbude, in der noch andere, noch finsterere Gestalten zusammenhocken. Sie ziehen eine Flasche mit irgendeinem Fusel heraus, stoßen an und beginnen, den Blick auf ihn geheftet, zu diskutieren; immer wieder fällt das Wort milizija, es ist auch das einzige, das er heraushört, und zu Recht oder Unrecht bildet er sich ein, man spreche davon, was passieren würde, wenn er in die Hände der Polizei fiele. Mit einer saftigen Strafe käme er nicht davon, oh nein! – das Grüppchen krümmt sich vor Lachen. Nein, man würde ihn nie wiedersehen. Selbst wenn ihn jemand an der Endhaltestelle in Wladiwostok erwartete, würde dieser nur sein Fehlen bemerken und das war’s dann. Seine Familie, seine Freunde könnten noch so viel Krach schlagen, nie würde man in Erfahrung bringen und auch gar nicht zu erfahren versuchen, wo er verschwand. Der Reisende versucht sich zusammenzunehmen: Vielleicht reden sie ja von etwas ganz anderem, vielleicht fachsimpeln sie über die Marmeladen ihrer Großmütter. Nein, er weiß genau, so ist es nicht. Er weiß, sie schwadronieren darüber, was ihn erwartet, er hat sogar verstanden, dass er wohl besser auf einen dieser korrupten Polizisten gestoßen wäre, vor denen man ihn so munter warnt, dass sogar alles besser gewesen wäre als diese mies zusammengezimmerte Bude und diese zahnlosen Kerle in Feierlaune, deren Kreis sich jetzt immer enger um ihn schließt, die, immer noch scherzend, beginnen, ihm in die Wange zu kneifen und ein paar Schubser und Klapse zu verpassen, um zu zeigen, was die Polizisten mit ihm täten, und dann schlagen sie ihn zusammen und er wacht später im Dunkeln auf. Er liegt unbekleidet auf nacktem Erdboden und zittert vor Kälte und Angst. Er streckt den Arm aus und begreift, dass man ihn in eine Art Schuppen gesperrt hat und dass es aus ist. Die Tür wird sich von Zeit zu Zeit öffnen und die fidelen Kerle werden hereinkommen, um ihn zu schlagen, zu treten, in den Arsch zu ficken, kurz, sich ein bisschen zu amüsieren – schließlich hat man in Sibirien nicht so viel Gelegenheit dazu. Niemand weiß, wo er ausgestiegen ist, niemand wird ihm zu Hilfe eilen, er ist ihnen ausgeliefert. Wahrscheinlich lungern sie sogar absichtlich in der Nähe der Gleise herum, wenn ein Zug erwartet wird, und hoffen, dass irgendein Dummkopf das Verbot missachtet, denn sie wissen: Der gehört ihnen. Man benutzt ihn zu allem Möglichen, bis er krepiert, dann wartet man auf den nächsten. Natürlich sagt er sich das nicht so vernünftig, sondern im Zustand von jemandem, der in einem engen Kasten zu Bewusstsein kommt, in dem er nichts hört und sieht, sich nicht rühren kann und einige Zeit braucht, um zu begreifen, dass man ihn lebendig begraben hat, dass sein ganzer Lebenstraum auf das hinausgelaufen ist und das die Wirklichkeit ist, die letzte und wahre, aus der er nie wieder erwachen wird.
Da also ist er gelandet.
Auch ich bin irgendwie da gelandet. Mein ganzes Leben lang bin ich da gewesen. Schon immer habe ich zu solchen Geschichten gegriffen, um mir meine eigene Lage zu beschreiben. Als Kind erzählte ich sie mir selbst, später anderen. Ich las sie in Büchern, dann schrieb ich selbst welche. Und lange gefiel mir das. Ich genoss das Leid auf eine Weise, die nur mir eigen war und einen Schriftsteller aus mir machte. Jetzt habe ich genug davon. Ich ertrage es nicht mehr, Gefangener dieses düsteren, unabänderlichen Schemas zu sein und mit welchem Ausgangspunkt auch immer Geschichten von Wahnsinn, Eiseskälte und Abschottung auszuspinnen und den Plan zu der Falle zu entwerfen, die mich dann selbst gefangen hält. Vor einigen Monaten habe ich ein Buch herausgebracht, Der Widersacher, es hatte mich sieben Jahre lang besetzt und völlig ausgesaugt. Dann habe ich gedacht: Es reicht, ich muss das Thema wechseln. Ich will auf das Außen, die anderen, das Leben zugehen. Dafür wäre es das Beste, wieder Reportagen zu schreiben.
Ich erzählte verschiedenen Leuten von meinem Entschluss, und schon kurze Zeit später wurde mir eine angeboten. Und nicht irgendeine: die Geschichte eines unglücklichen Ungarn, der Ende des Zweiten Weltkriegs gefangen genommen worden und danach über fünfzig Jahre in der geschlossenen Anstalt einer Psychiatrie im tiefen Russland interniert war. Wir haben uns alle gleich gesagt, das ist ein Thema für dich, erklärte mir mein Journalistenfreund mehrmals begeistert, und das machte mich natürlich rasend. Dass man immer dann an mich denkt, wenn es um einen sein ganzes Leben in einer Irrenanstalt verwahrten Typen geht, genau das will ich nicht mehr! Ich will nicht mehr derjenige sein, den eine solche Geschichte interessiert! Obwohl sie mich natürlich wirklich interessiert. Und dass sie sich in Russland ereignet hat – nicht dem Land meiner Mutter, denn sie ist nicht dort geboren, aber doch dem Land, wo man die Sprache meiner Mutter spricht, die Sprache, die ich als Kind ein wenig gesprochen, dann aber völlig vergessen habe.
Ich sagte zu. Und ein paar Tage später lernte ich Sophie kennen, was mir auf andere Weise den Eindruck verschaffte, neu anzufangen. Während eines langen Abendessens in einem thailändischen Restaurant in der Nähe der Metro Maubert erzählte ich ihr die Geschichte dieses Ungarn, und heute Nacht in diesem Zug, der mich nach Kotelnitsch bringt, denke ich an meinen Traum zurück und sage mir, in ihm ist alles enthalten, was mich lähmt: der Blick des Soldaten, der mir beim Sex zuschaut, die Drohung oder vielmehr Gewissheit, in Gefangenschaft zu geraten und in die Falle zu tappen, und doch ist alles darin leicht, energiegeladen und fröhlich, wie die Nummer mit den Beinen in der Luft, die ich mit Sophie und der mysteriösen Frau Fujimori spiele. Ich sage mir, gut, ich werde eine letzte Geschichte von Gefangenschaft erzählen, aber sie soll die Geschichte meiner Befreiung werden.
Was ich über meinen Ungarn weiß, stammt aus einigen wenigen Agenturmeldungen der AFP vom August und September 2000. Als kleiner, neunzehnjähriger Bauer war er von der Wehrmacht während ihres Rückzugs in ihre Machenschaften verwickelt und 1944 von der Roten Armee verhaftet worden. Nachdem er zunächst in einem Gefangenenlager interniert war, wurde er 1947 in die Psychiatrie von Kotelnitsch überführt, einer kleinen Stadt 800 km nordöstlich von Moskau. Dort verbrachte er dreiundfünfzig Jahre von aller Welt vergessen und fast ohne ein Wort zu sprechen, denn niemand um ihn herum verstand Ungarisch, und er selbst, so seltsam das anmuten mag, lernte kein Russisch. In diesem Sommer hatte man ihn ganz zufällig wiedergefunden, und die ungarische Regierung hatte seine Heimkehr organisiert.
In einer etwa dreißig Sekunden langen Sequenz im Fernsehen hatte ich ein paar Bilder von seiner Ankunft gesehen: Die Glastüren des Budapester Flughafens öffneten sich vor einem Rollstuhl, in dem zusammengekauert ein armer, verängstigter Greis hockte. Die Leute um ihn herum trugen kurzärmelige Hemden, er dagegen, unter einer Decke schlotternd, eine dicke Wollmütze. Ein Hosenbein war leer, es war hochgeschlagen und mit einer Sicherheitsnadel festgesteckt worden. Die Blitze der Fotografen prasselten los und blendeten ihn. Rund um das Auto, in das man ihn einsteigen ließ, drängten sich wild gestikulierend alte Frauen und riefen verschiedene Vornamen: Sándor! Ferenc! András! Mehr als 80 000 ungarische Soldaten waren nach dem Krieg vermisst gemeldet worden, schon lange hatte man aufgehört, auf sie zu warten – und plötzlich kommt sechsundfünfzig Jahre später einer von ihnen zurück. Er leidet an mehr oder weniger vollständigem Gedächtnisschwund, selbst sein Name gibt Rätsel auf. Die Register der russischen Psychiatrie, sein einziger Identitätsnachweis, führen ihn abwechselnd als András Tamas oder auch András Tomas oder Tomas András, aber er schüttelt den Kopf, wenn man diese Namen in seinem Beisein ausspricht. Er will oder kann den seinen nicht nennen. Aus diesem Grund vermeinen Dutzende von Familien bei seiner Rückkehr – die von der ungarischen Presse als Ereignis von nationaler Bedeutung gefeiert wird –, in ihm ihren verschwundenen Onkel oder Bruder wiederzuerkennen. In den Wochen, die auf seine Rückkehr folgen, bringt die Presse praktisch täglich Neuigkeiten über ihn und den Stand der Nachforschungen. Einerseits führt man Gespräche mit den Familien, die ihn als einen der Ihren reklamieren, andererseits befragt man ihn selbst und versucht, seine Erinnerungen wachzurufen. Man nennt ihm Namen von Dörfern und Personen. Eine Meldung berichtet, dass sich in der Psychiatrie von Budapest, wo man ihn beobachtet, von seinen Ärzten einbestellte Antiquare und Sammler die Klinke in die Hand geben, um ihm Barette, Tressen, alte Münzen und andere Gegenstände vorzuführen in der Hoffnung, sie könnten ihm das Ungarn seiner Zeit ins Gedächtnis rufen. Er reagiert kaum, und statt zu sprechen grummelt er vor sich hin. Was ihm als Sprache dient, ist nicht mehr wirklich Ungarisch, sondern eine Art Privatdialekt: der des inneren Monologs, den er während seines halben Jahrhunderts Einsamkeit vor sich selbst abspulte. Satzfetzen treiben an die Oberfläche, in denen von der Überquerung des Dnjepr die Rede ist, von Socken, die ihm gestohlen wurden oder von denen er befürchtet, sie könnten ihm gestohlen werden, und vor allem von dem Bein, das man ihm da drüben, in Russland, abgeschnitten hat. Er will es wiederhaben oder zumindest einen Ersatz. Titel der Meldung: »Der letzte Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs verlangt ein Holzbein.«
Einmal liest man ihm Rotkäppchen vor und er weint.
Nach einem Monat wird die Untersuchung abgeschlossen, ein DNA-Test bestätigt sie. Der Heimkehrer heißt András Toma – aber in Ungarn sagt man Toma András, so wie Bartók Béla, den Nachnamen vor dem Vornamen, wie in Japan. Er hat einen Bruder und eine Schwester, beide sind jünger als er, sie bewohnen ein Dorf im östlichsten Winkel des Landes, dasselbe, das er vor sechsundfünfzig Jahren verlassen hatte, um in den Krieg zu ziehen. Sie sind bereit, ihn bei sich aufzunehmen.
Auf der Suche nach weiteren Auskünften erfahre ich zum Einen, dass sein Transfer von Budapest in sein Heimatdorf erst in einigen Wochen stattfinden wird, und zum Anderen, dass die Psychiatrie von Kotelnitsch am 27. Oktober ihr neunzigjähriges Bestehen feiert. Dort müssen wir anfangen.
Der Zug hält in Kotelnitsch nur etwa zwei Minuten, das ist wenig, um all unsere Koffer mit der Ausrüstung hinauszuhieven. Normalerweise fertige ich meine Reportagen für Printmedien an, das heißt, ich arbeite allein, allenfalls mit einem Fotografen, ein ganzes Fernsehteam ist da natürlich schwerfälliger. Obwohl wir die Einzigen sind, die aussteigen, und niemand einsteigt, ist der Bahnsteig ziemlich bevölkert, hauptsächlich von alten Frauen in Filzstiefeln und Kopftüchern, die uns ganze Eimer mit Preiselbeeren verkaufen wollen und uns ankeifen, wenn wir auf unser Gepäck deuten, damit sie begreifen mögen, dass wir schon beladen genug sind. Ringsherum sieht es ganz so aus wie am Bahnhof der Transsib in meiner Geschichte: festgetrampelte Erde, Schlammpfützen, abgeblätterte Bretterzäune, hinter denen uns kahlgeschorene Typen mit nicht gerade liebenswürdiger Neugier anstarren. Ich sage mir: Wahrscheinlich ist es ganz gut, dass wir zu viert hier sind … Jean-Marie schnappt sich seine Kamera, und Alain fixiert sein Mikrofon auf der Angel, was die schlechte Laune der alten Frauen noch steigert. Sascha zieht auf der Suche nach einem Auto Richtung Bahnhofsgebäude los und kehrt bald in Begleitung eines gewissen Witali zurück, der uns in seinem altersschwachen Lada zum einzigen Hotel der Stadt fährt, dem Wjatka. Wjatka ist der frühere und jetzt wiederverwendete Name von Kirow, der Gebietshauptstadt und nächsten Station auf der Bahnlinie. Während eines Mittagessens bei meinen Eltern einige Tage vor meiner Abreise, bei dem ich mit ihnen die Orte meiner Reportage durchging, erfuhr ich von meiner Mutter, dass Kirow diesen Namen zu Sowjetzeiten in Erinnerung an den gleichnamigen Bolschewisten erhalten hatte, dessen Ermordung Beginn und Vorwand der politischen Säuberungen von 1936 gewesen war, und von meinem Vater – der sich für die Familie meiner Mutter leidenschaftlich interessiert –, dass 1905, als die Stadt noch Wjatka hieß, mein Urgroßonkel, der Graf Wiktor Komarowski, dort Vizegouverneur war. Das Wjatka jedenfalls ist eines dieser Russlandreisenden wohlbekannten Hotels, in denen nicht nur nichts funktioniert – weder die Heizung noch das Telefon oder der Fahrstuhl –, sondern in denen wahrscheinlich noch nie irgendetwas funktioniert hat, nicht einmal am Tag der Einweihung. Zwei von drei Glühbirnen sind durchgebrannt. Knäuel von schlecht isolierten elektrischen Leitungen ziehen sich über grindige Wände in alle Richtungen. Die kalten Heizkörper sind nicht wie sonst üblich an einer Wand angebracht, sondern stehen quer in den Raum hinein und bilden das Ende von langen, stets seltsam verkrümmten Rohren. Verschlissene, gräuliche Laken, so klein, dass man sie kaum von Handtüchern unterscheiden kann, bedecken zur Hälfte die durchgelegenen Einzelbetten, eine fettige Staubschicht klebt auf dem, was als Ersatz für Möbel dient. Warmes Wasser gibt es nicht. Als ich mich am Vorabend bei Sascha naiv erkundigte, ob man im Hotel wohl mit einer Kreditkarte bezahlen könne, schaute er mich spöttisch an und schüttelte den Kopf: Mit einer Kreditkarte? Pfff … Und da ich ein wenig Russisch spreche, tschutschut, ein ganz klein wenig, fügte er hinzu: Tut, my wo dnje, das hier ist der Arsch der Welt.
Unsere Pilgerreise zu den Orten, an denen András Toma gelebt hat, beginnt im Büro des Doktor Petuchow, Chefarzt der psychiatrischen Anstalt, und es wäre gut, gibt dieser uns zu verstehen, wenn sie dort auch gleich wieder endete. Nicht dass Juri Leonidowitsch, wie er uns anbietet, ihn zu nennen, mit Journalisten fremdeln würde, ganz im Gegenteil, er blättert uns stolz einen Stapel Visitenkarten hin, die ihm Vertreter verschiedenster russischer und ausländischer Medien dagelassen haben: Iswestija, CNN, Reuter … Aber er beschränkt sich darauf, in gewohnter Manier seinen Kurzvortrag über diese Geschichte abzuspulen, und kann sich nicht vorstellen, was wir darüber hinaus noch wissen wollen könnten. Am 11. Januar 1947 wurde der Patient vom Strafgefangenenlager Bystrjagi, das in etwa vierzig Kilometern Entfernung lag und in den fünfziger Jahren aufgelöst wurde, in die psychiatrische Anstalt von Kotelnitsch überstellt. Hier, in diesem kleinen, gut geheizten, gebohnerten Holzhaus, wurde er von einer Frau Doktor Koslowa aufgenommen, und diese legte eine Akte für ihn an. Mit leicht theatraler Geste schlägt Juri Leonidowitsch die Akte auf und heißt Jean-Marie, die ersten Einträge der Frau Doktor Koslowa heranzuzoomen, wie es wahrscheinlich die Kameramänner vor ihm schon getan haben. Gelbliches Papier, ausgeblichene Tinte, eine kleine, regelmäßige Schrift. Der Patient ist unter dem Namen Tomas, Andreas, geboren 1925, ungarische Staatsangehörigkeit verzeichnet. Dieses zusätzliche »s« und das zusätzliche »e« hätten bei seiner Rückkehr nach Ungarn für einige Verwirrung gesorgt, aber dafür könne man wohl schwerlich Frau Doktor Koslowa verantwortlich machen, denn der Patient habe damals auf keine ihrer Fragen geantwortet und, so schien es, sie nicht einmal hören können, es sei also anzunehmen, dass die Antworten von den Soldaten stammten, die ihn begleiteten. Seine Kleider seien dreckig, zerrissen, zu klein und vor allem für die Jahreszeit zu dünn gewesen. Er habe hartnäckig geschwiegen und nur hin und wieder grundlos aufgelacht. Zuvor hätte er im dem Lager angegliederten Lazarett die Nahrung verweigert, nicht geschlafen, geweint und sich manchmal gewalttätig aufgeführt. Dieses Verhalten habe die Diagnose »Psychoneurose« begründet, die seine Einweisung in ein ziviles Krankenhaus rechtfertigte. Ohne selbst daran zu glauben, frage ich, ob Frau Doktor Koslowa noch lebt. Juri Leonidowitsch schüttelt den Kopf: Nein, es gibt keine Zeugen mehr, weder von der Ankunft András Tomas noch von der ersten Zeit seines Aufenthalts. Als er selbst vor etwa zehn Jahren die Stelle angetreten habe, fährt er fort, habe der Patient keinerlei Interesse an psychiatrischer Hilfe gezeigt. Ruhig, schweigsam und in sich gekehrt sei er gewesen. 1997 habe man ihm ein Bein amputieren müssen. Und dann, am 26. Oktober 1999, genau vor einem Jahr, sei ein hoher Beamter vom Gesundheitswesen zu Besuch in die Anstalt gekommen. Juri Leonidowitsch habe seinen Gast herumgeführt, und sie seien bei einem einbeinigen Alten stehen geblieben, den er als Dienstältesten unter den Patienten vorgestellt habe. Er lächelt gerührt in Erinnerung dieser Szene. Ich male mir aus, wie er ihm das Ohr zwirbelte, so wie Napoleon seinen Grenadieren: Jaja, ein braver Alter, ganz lieb und ruhig, seit dem Krieg ist er hier und spricht nur Ungarisch! Zufällig berichtete eine ortsansässige Journalistin über die Besichtigung, und da diese für einen spannenden Artikel wohl nicht ausreichte, hing sie ihren Bericht an dieser Geschichte auf: Der letzte Gefangene des Zweiten Weltkriegs lebt unter uns! Nachdem der Slogan einmal in der Welt war, nahm ihn erst eine Nachrichtenagentur auf, dann die nächste, und bald machte er in den Redaktionsstuben die Runde. So erfuhr auch der ungarische Botschafter davon und reiste aus Moskau an, dann einige Psychiater aus Budapest, und schließlich nahmen sie Toma im Sommer mit. Juri Leonidowitsch hat seither nur wunderbare Nachrichten über ihn erhalten und freut sich über die Fortschritte, von denen ihm seine ungarischen Kollegen regelmäßig berichten. Die Gelassenheit, mit der er über diese Fortschritte spricht, erstaunt mich ein wenig. Die Tatsache, dass ein Mann innerhalb von zwei Monaten ins Leben und zur Sprache zurückkehren kann, nachdem er bei ihm dreiundfünfzig Jahre auf den Zustand eines Holzscheits beschränkt verbracht hat, scheint ihn keineswegs zu irritieren, und es kommt ihm auch nicht in den Sinn, dass die Journalisten, die er empfängt, daraus wenig vorteilhafte Rückschlüsse auf die Psychiatrie seines Landes allgemein oder seine Anstalt im Besonderen ziehen könnten. In seiner Zusammenfassung des Falls scheint nicht einmal der Versuch einer Rechtfertigung durch, und wenn er uns direkte Akteneinsicht verweigert, so nicht aus Misstrauen, wie mir scheint, sondern um das Monopol auf den einzigen Gegenstand von Medieninteresse zu verteidigen, den es je in Kotelnitsch gegeben hat.
Der Chefarzt und Anstaltsverwalter Juri Leonidowitsch, Abgeordneter im Stadtrat, wie wir später erfahren, verlässt sein gemütliches Haus nicht oft und sieht seine Patienten nur selten. Wladimir Alexandrowitsch Malkow dagegen, dem er uns anvertraut, als wir hartnäckig darauf drängen, doch etwas mehr von der Einrichtung zu Gesicht zu bekommen, ist der behandelnde Arzt und verantwortlich für den Gebäudetrakt, in dem Toma die letzten Jahrzehnte verbracht hat. Er ist sehr groß, sehr blond, sehr blass, trägt einen weißen Kittel und eine leicht getönte Brille und hat die kühle Erscheinung dessen, von dem es in einem russischen Roman des 19. Jahrhunderts geheißen hätte, er sehe aus wie ein Deutscher. Auf den ersten Blick wirkt er weniger jovial und kooperativ als sein Chef, und er scheint die verschiedenen Journalistenteams, deren Visitenkarten dieser sammelt, in zwiespältiger Erinnerung zu haben. Wie können Sie bloß ohne warmes Wasser leben?, habe ihn ein Kameramann gefragt. Woraufhin er mit den Schultern zuckte und antwortete: Sie leben. Wir hier, wir überleben.
Zimmer 2. Neun Betten. Das von Toma war das erste links von der Tür, an der Wand, in der Ecke. Es gab keine Verlegungen in letzter Zeit, seit seiner Abreise wurde auch niemand einquartiert, es handelt sich also um seine früheren Zimmergenossen. Sie tragen Straßenkleidung und Hausschuhe und haben die leeren Gesichter von Menschen, denen alles genommen wurde. Manche schlurfen mit den Armen rudernd den Gang zwischen Betten, Fenster und Tür entlang. Einige sitzen seit Stunden am Bettrand, andere liegen: einer, dessen Gesicht wir nicht zu sehen bekommen, unter der Decke, ein anderer steif wie eine Grabfigur obenauf, die Arme vor der Brust verschränkt, das Gesicht zu einem schiefen Grinsen, seinem einzigen Ausdruck, erstarrt. Sie sind hier gestrandet, weil das Leben draußen zu hart, der Alkohol zu stark und die Stimmen in ihrem Kopf zu bedrohlich geworden waren, aber sie sind nicht aggressiv und nicht einmal unruhig. »Stabilisiert«, erklärt uns Wladimir Alexandrowitsch. In den letzten zehn Jahren sei das Budget der Klinik immer mehr geschrumpft, also habe man die Belegschaft verkleinern und von den Patienten entlassen müssen, wen immer man konnte: all jene, denen es etwas besser ging und die Angehörige besaßen, die sie bei sich aufnehmen konnten; doch die hier hätten nichts und niemanden, tja, was soll man da machen?, also behalte man sie hier.
Sie würden nicht wirklich behandelt, man spreche auch nicht wirklich mit ihnen, aber man behalte sie da. Das sei wenig. Aber es sei nicht nichts.
Auch András Toma behielt man da. Obwohl er eine Familie hatte und ein Land, in das man ihn hätte schicken können. Es wäre theoretisch nicht unmöglich gewesen, die ungarische Botschaft in Moskau über seine Existenz zu unterrichten, aber es kam einfach niemandem in den Sinn, Moskau ist so weit weg, und Ungarn erst … Er war hier gestrandet, und so blieb er da, wie ein Irrläufer auf dem Postamt, den niemand an den Absender zurücksendet.
Toma allerdings war keine Grabfigur, er verbrachte seine Tage nicht im Bett, sondern in der Schreinerei, der Schlosserei oder der Autowerkstatt, und zu den Zeiten, als die Klinik außerhalb noch einen Bauernhof besaß, trieb er sich auch dort herum. Als einer, der handwerklich geschickt und immer sehr umtriebig war, durfte er nach eigenem Ermessen kommen und gehen – weshalb Wladimir Alexandrowitsch die Schlagzeile vom letzten Kriegsgefangenen als etwas übertrieben betrachtet. Er sei ganz und gar kein Gefangener gewesen und eigentlich nicht einmal krank, er habe eben hier gelebt, er sei hier zu Hause gewesen, ganz einfach. Wirklich nicht einmal krank?, hakt Sascha nach. Nicht mehr. Bei seiner Ankunft sei er zwar als schizophren diagnostiziert worden, aber er habe damals ganz einfach unter Schock gestanden, immerhin hatte er die Schrecken des Kriegs erlebt und drei Jahre in einem Gefangenenlager verbracht. Die psychotische Phase, die er durchlebte, sei eine Reaktion auf diese Traumata gewesen, habe sich aber später nie wiederholt. Wahrscheinlich habe er sich mehr oder weniger bewusst gesagt: Um einen Rückfall zu vermeiden, sollte ich besser spuren und unauffällig bleiben, nicht sprechen, nichts verstehen und mit der Umgebung verschmelzen.
Schon im Büro von Juri Leonidowitsch war ich jedes Mal, sobald ich drei Worte Russisch verstanden hatte, in Saschas Übersetzung geplatzt und hatte eifrig beigepflichtet: da, da, ja ponimaju, ich verstehe, und als wir draußen standen, beschwerte dieser sich aufgebracht: Hör zu, entweder du verstehst Russisch und brauchst mich nicht, oder du lässt mich meine Arbeit machen, okay? In Ordnung, versicherte ich, aber bei Wladimir Alexandrowitsch kann ich mich wieder nicht zurückhalten, und jetzt erkläre ich nach bestem Bemühen, meine Mutter habe russische Wurzeln und als Kind hätte ich Russisch gesprochen und Tschechows Novelle Krankenzimmer Nr. 6, die in einer Provinzpsychiatrie spielt, auf Russisch gelesen. Sascha ist beleidigt, mein immer fließenderes Sprechen ärgert ihn, Alain und Jean-Marie dagegen sind beeindruckt, und Wladimir Alexandrowitsch taut jetzt vollständig auf. Ich spreche Russisch! Ich habe Krankenzimmer Nr. 6 gelesen! Jetzt sind wir Freunde, und in meiner Begeisterung schwinge ich mich auf, ihn zu fragen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gebe, die Akte des Ungarn einzusehen oder idealerweise sogar eine Kopie davon anzufertigen. Doch, ja, sicher, man müsse nur Juri Leonidowitsch fragen. Aber das Problem ist, dass Juri Leonidowitsch nicht will. Darauf hebt Wladimir Alexandrowitsch die Augenbrauen: Tja, wenn Juri Leonidowitsch nicht will, ist das tatsächlich ein Problem.
Meine wenigen Worte Russisch haben mich in einen Rausch versetzt, und als wir abends zu viert im einzigen geöffneten Restaurant der Stadt sitzen, will ich unbedingt mehr davon. Dieses Restaurant, das Troika, ist eine Art verlotterte Kellerbar, der Treffpunkt einer stark alkoholisierten Jugend, die wir verdächtigen – zumindest ihren männlichen Anteil –, potenziell gewalttätig zu sein. Zu essen gibt es nur Pelmenis, russische Teigtaschen, und ich bestehe darauf, Wodka dazu zu trinken. Trotz unseres Besäufnisses am Vorabend habe ich weder Schwierigkeiten, Alain zu überreden, der einen gehörigen Stiefel verträgt, noch Sascha, der mir gegenüber gleich viel nachsichtiger wird. Nur Jean-Marie lehnt wie am Vorabend lächelnd ab, er trinkt nie. Ich selbst war schon vor dem ersten Glas trunken vor Aufregung, jetzt versuche ich, meine Sprachkenntnisse an zwei eher unattraktiven Frauen am Nachbartisch zu erproben, die nach Gesellschaft geradezu dürsten. In meinem Kindergartenrussisch erkundige ich mich nach unserem Helden, der zur Berühmtheit der Stadt geworden ist. Ich garantiere nicht, alles verstanden zu haben, aber der einen zufolge, wie ich in meinem Heft notiere, wollte er gar nicht weg und musste gewaltsam nach Ungarn gebracht werden, laut der anderen war er gar nicht krank gewesen, sondern hatte sich nur verrückt gestellt, um nicht nach Sibirien geschickt zu werden. Ich erinnere mich vage, Sascha später kichern gehört zu haben, als ich ihn fragte, ob man wohl vom Hotel aus nach Frankreich telefonieren könne – und mit deiner Kreditkarte bezahlen, was? –, und dann mit ihm durch die menschenleeren Straßen zu einem Lokal getorkelt zu sein, das bis wirklich spät in die Nacht geöffnet ist und auch noch Säufer bedient, die selbst eine so wenig kleinliche Bar wie das Troika nicht mehr haben will. Dort findet man ein wenig menschliche Wärme, Gelegenheiten zum Prügeln, woran Sascha ziemlich interessiert zu sein scheint, und außerdem ein Telefon. Während wir ein Gespräch fortsetzen, das schon vom ersten Satz an zu eskalieren droht, hilft mir Sascha reichlich widerwillig, die Vermittlung für meinen Anruf zu bestellen, und ich gehe, um darauf zu warten, in eine Holzkabine, in die erst kürzlich jemand hineingepisst hat, sodass ich die Wahl habe zwischen dem Brechreiz, wenn ich die Tür schließe, und dem das ferne Klingeln übertönenden Lärm aus dem Lokal, wenn ich sie öffne. Als Sophie schließlich abnimmt, bleibt mir keine Wahl: Um ihre Stimme zu hören, muss ich die Tür zumachen, und ich beginne sofort, ihr das Telefonpissoir, die Post, die Stadt und die Psychiatrie zu beschreiben. Das Ganze erinnert sie wahrscheinlich an die Transsib-Geschichte, die ich ihr bei unserem Abendessen im Thairestaurant bei Maubert am ersten Abend erzählte. Dennoch bin ich ganz euphorisch, ich erkläre ihr, ich hätte heute begonnen, Russisch zu sprechen, und wolle damit weitermachen, ich wolle es noch einmal ernsthaft lernen, denn es bedeute mir ebenso viel wie sie kennengelernt zu haben, und die Tatsache, beide Entdeckungen so rasch aufeinander gemacht zu haben, sei kein Zufall. Ich erzähle von meinem Traum im Zug, reite etwas umständlich auf dem Versprechen einer Befreiung herum, das er enthalte, und übergehe dafür geflissentlich Frau Fujimori, denn auch wenn ich Sophie erst kaum zwei Wochen kenne, ist mir schon aufgefallen, wie eifersüchtig sie ist. Als ich sie anrief, glaubte ich erst, bei ihr sei es schon spät und sie liege vielleicht nackt im Bett und habe Lust, sich auf meine Bitte hin zu streicheln, aber ich habe mich in der Zeitverschiebung geirrt, tatsächlich ist es in Paris erst sieben Uhr abends und sie noch in ihrem Büro. Zu Beginn des Gesprächs fragte sie sich, ob ich vielleicht in Gefahr sei, doch jetzt begreift sie, dass ich ganz einfach betrunken und erregt bin, man könnte sogar sagen glücklich, und der Grund dafür ist, dass ich sie liebe. Also beginnt sie, von meinem Schwanz zu sprechen, sie möge Schwänze wirklich und habe schon einige kennengelernt, aber meinen möge sie am liebsten und wünsche sich, ihn in sich zu spüren, und ersatzweise solle ich mich selbst befriedigen. Sie selbst habe die Bürotür geschlossen, die Hand unter ihren Rock geschoben und auf die Strumpfhose und das Höschen gelegt. Mit den Fingerspitzen streife sie über den Stoff. Ich denke an die bezaubernden blonden Haare, die in ihrem Slip zusammengepresst werden, aber ich muss ihr auch mitteilen, dass ich auf keinen Fall sofort masturbieren könne, die Beschreibung meiner Umgebung sei absolut realistisch gewesen, durch die Glasscheibe sähe ich Sascha und einen anderen Typen, die geduldig versuchten, einen Streit vom Zaun zu brechen, und auch sie könnten mich sehen, ich müsse also bis zu meiner Rückkehr ins Hotel warten. Es sei nicht geheizt und die Laken so dreckig, dass ich zögern werde, mich hineinzulegen, und wohl angezogen schlafen und alles über mich breiten müsse, was ich als Bettdecke finden könne – aber ich verspreche, mir trotzdem einen runterzuholen, und genau das tue ich bei meiner Rückkehr.
Kotelnitsch ist ein Kaff, aber ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, und es vergehen keine zehn Minuten, ohne dass das Rattern eines oft sehr langen Güterzugs die Fensterscheiben in unseren Zimmern klirren lässt. Ich schlafe dennoch tief und fest. Alain nicht, und am nächsten Morgen im Speiseraum des Hotels, wo zwei Typen schweigend ihr Bier, mit Sicherheit nicht ihr erstes, hinunterkippen und wir mit Müh und Not eine Tasse Tee ergattern, ist er noch geräderter als sonst, aber dennoch bester Laune. Um während der schlaflosen Stunden nicht untätig herumzuliegen, hat er die ganze Nacht lang diese vorüberfahrenden Züge aufgenommen und spielt mir jetzt ein paar Kostproben vor. Zuerst kann ich keine großen Kontraste erkennen, dann versucht er, mein Gehör zu schulen und ihm den Unterschied zwischen dem Tschuktschuk des Güterzugs und dem Tschiktschik des Eilzugs beizubringen, ich nicke und sage ja, ja, und er lacht: Du wirst schon sehen, beim Schnitt wirst du dich darüber noch freuen!
Sascha, der als Letzter herunterkommt, stößt mehr oder weniger im Krebsgang zu uns, ständig schaut er anderswohin und dreht sich weg, und als er sich endlich durchringt, uns ins Gesicht zu blicken, stellen wir fest, dass er gehörig eins aufs Maul bekommen hat: Ein blaues Auge, ein geschwollener Wangenknochen und eine aufgeplatzte Lippe zeugen davon. Beschämt stürzt er sich in eine wirre Erklärung, er sei, nachdem er mich ins Hotel zurückgebracht hatte, noch einmal losgezogen, um in einer Bar, wie er sich ausdrückt, »noch eine kleine Gabel einzustechen«, doch die Bar stellte sich als eine Verbrecherspelunke heraus, und er wurde von mehreren Typen fertiggemacht – sein Bericht lässt offen, ob es sich um Kriminelle oder Polizisten handelte –, jedenfalls – aber das habe nichts damit zu tun, und es ist ihm wichtig, uns davon zu überzeugen – kehre er heute morgen nicht mit uns in die Psychiatrie zurück, denn er habe einen Termin mit jemandem vom FSB wegen unserer Pässe. Der FSB, das heißt der frühere KGB, und ein französisches Filmteam, das sich für mehrere Tage in einer kleinen Stadt wie Kotelnitsch einnistet – das schreit aus Sicht des FSB nach einer Sonderbehandlung: Es sei also gut, ein bisschen Bakschisch bereitzuhalten, um die Regelwidrigkeiten vergessen zu machen, die man zwangsläufig in unseren Papieren finden werde. Ich strecke Sascha hundert Dollar hin, er meint, das dürfe für den Anfang genügen.
Den ganzen Tag lang filmen wir in der Psychiatrie. Die Mahlzeiten und den Alltag. Die Brache, die als Hof dient und wo ein Militärwaggon aus dem letzten Krieg vor sich hin rostet. Den Drahtzaun vor der verregneten Landstraße, die Busse, die ab und zu vorbeifahren, und die beschlagenen Fensterscheiben. Die Patienten, die im Garten arbeiten, pausieren, Zigaretten drehen und rauchen und stundenlang auf Bänken hocken. Die Bank, die András Toma besonders mochte, weil man von ihr aus auf eine Koppel blickt, die ihn an Transsylvanien erinnerte. Das jedenfalls sagt Wladimir Alexandrowitsch oder wenigstens ist es das, was ich verstehe, denn durch Saschas Abwesenheit, der ja in der Stadt seine Verhandlungen mit dem FSB führt, bin ich auf meine eigenen Sprachkenntnisse angewiesen. Die Trunkenheit verlieh ihnen Flügel, der Brummschädel dagegen legt sie lahm. Demselben Kerl, den ich gestern noch hätte küssen können und dessen Wertschätzung gewonnen zu haben ich so stolz war, weiß ich heute nichts mehr zu sagen und noch weniger, wie es zu sagen wäre, die Worte fehlen mir, und ich höre ihm zu, wie er in der Schreinerei, in der Toma so gern gearbeitet habe, mit monotoner Stimme herunterleiert, was mir eine unverständliche Litanei zu sein scheint. Ich kommentiere sie mit stumpfen da, das und hin und wieder einem konetschno, was natürlich bedeutet und zu nichts verpflichtet. Ihn wiederum scheint meine Apathie zu enttäuschen, er würde gern noch einmal über Tschechow, Russland und Frankreich sprechen. Er träume davon, irgendwann einmal nach Frankreich zu reisen, das Problem sei nur, dass er kein Wort Französisch spreche, allerdings könne er ein bisschen Latein: de gustibus non est disputandum, deklamiert er. Damit wirst du dich schon durchschlagen, ermutigt ihn Sascha, der gerade zu uns gestoßen ist, sichtlich aufgemuntert durch seine Gespräche mit dem FSB. Der Oberstleutnant, der den Geheimdienst in Kotelnitsch vertritt, heißt ebenfalls Sascha, erzählt er uns – ein Zufall, der nicht weiter überrascht in einem Land, in dem für jedes Geschlecht vielleicht fünfzehn Vornamen im Umlauf sind, die allerdings mit einer ganzen Batterie von Kosenamen variiert werden –, aber es stellte sich wohl auch heraus, dass beide im Tschetschenienkrieg waren, der Oberstleutnant in der russischen Armee, unser Sascha als Dolmetscher für ein französisches Fernsehteam. So etwas verbindet, und offenbar haben ein paar Gläser Wodka diese Verbindung noch gefestigt, und nun ist Sascha in Form, um mir bei meinen Gesprächen mit Patienten, die von Wladimir Alexandrowitsch als präsentabel eingestuft wurden, behilflich zu sein. Über ihren früheren Zimmergenossen erzählen alle dasselbe: Ein ruhiger, hilfsbereiter Kerl sei er gewesen, der nie ein Wort gesprochen habe. Ob er Russisch verstand, hat keiner je erfahren, und ehrlich gesagt scheint sich auch niemand je dafür interessiert zu haben.
Als wir in der Abenddämmerung die Anstalt verlassen, verabschiedet uns Wladimir Alexandrowitsch mit einem do sawtra, bis morgen, nicht do swidanija, auf Wiedersehen, und mit derselben routinierten Gleichgültigkeit streckt er mir, als ich gerade die Tür des Ladas zuschlagen will und er schon auf dem Absatz kehrtmacht, ein dickes, in Packpapier eingeschlagenes Kuvert hin. Im Auto öffne ich es: Es enthält eine Kopie von Tomas Krankenakte. Der hat dich aber lieb, frotzelt Sascha.
An diesem Abend gehen wir früh ins Bett, wir trinken nicht, denn morgen müssen wir fit sein, es ist der Tag des Anstaltjubiläums. Sascha hat sich erkundigt: Es wird ein Festessen geben, und es wird im Speiseraum unseres Hotels stattfinden. Ich erwarte mir viel von diesem Festessen, ich male mir aus, mit dem ganzen Team in die farbenfrohe Welt russischer Gastlichkeit einzutauchen: Zwischen salbungsvollen Trinksprüchen und atemberaubenden Tänzen wird der Höhepunkt in der Begegnung mit einer urwüchsigen Babuschka bestehen, die sich als alte, pensionierte Krankenschwester entpuppen, uns von der Ankunft des Ungarn 1947 erzählen und mit schelmischem Augenzwinkern zu verstehen geben wird, dass er allen Grund gehabt habe, nicht zu sprechen, schließlich sei er mit allen Wassern gewaschen gewesen, der alte Halunke. Einstweilen – und weil die einzige gastronomische Alternative die Verbrecherbar zu sein scheint, in der sich Sascha hat vertrimmen lassen – gehen wir noch einmal ins Troika, um Pelmenis zu essen und unsere Beute zu begutachten.
Die Krankenakte von András Toma umfasst vierundvierzig in verschiedenen Handschriften verfasste Seiten, die die gesamten dreiundfünfzig Jahre seines Aufenthalts in Kotelnitsch umfassen. Die ersten Einträge sind jene der Frau Doktor Koslowa, die uns Juri Leonidowitsch schon vorgelesen und kommentiert hat. In den ersten Wochen sind es noch recht viele und sie sind voller detaillierter Beschreibungen, dann werden sie bald schon spärlicher und man begreift, dass allein die Anstaltsordnung den Ärzten vorschrieb, einmal alle zwei Wochen eine Notiz zum Zustand des Patienten zu machen. Anhand dieser Einträge, die mir Sascha zu übersetzen beginnt, lässt sich der Bogen eines ganzen Lebens verfolgen, und der von András Toma – wie der von vielen anderen sicher auch – ist grausam: ein unerbittlicher, in neutralen, platten, monotonen Phrasen heruntergeratterter Prozess der Zerstörung. Zum Beispiel:
15. Februar 1947: Der Patient liegt im Bett, er versucht etwas zu sagen, aber niemand versteht ihn. Auf die Frage: Wie geht es Ihnen?, antwortet er: Tomas, Tomas. Er verweigert jede Untersuchung.
31. März 1947: Er bleibt weiter im Bett, die Decke über den Kopf gezogen. Er schimpft wütend in seiner Sprache und zeigt seine Füße. Er versteckt Nahrungsmittel in seinen Taschen. Er ist körperlich gesund.
15. Mai 1947: Der Patient geht auf den Hof, spricht aber mit niemandem. Er spricht kein Russisch.
30. Oktober 1947: Der Patient will nicht arbeiten. Wenn man ihn zwingt hinauszugehen, schreit er und läuft kreuz und quer durch den Raum. Er versteckt seine Handschuhe und sein Brot unter dem Kopfkissen. Er hüllt sich in Lumpen. Er spricht nur Ungarisch.
15. Oktober 1948: Der Patient zeigt sexuelle Gelüste. Er kichert auf seinem Bett vor sich hin. Er befolgt die Anstaltsordnung nicht. Er versucht, mit der Krankenschwester Gilitschina anzubändeln. Der Patient Boltus ist eifersüchtig. Er hat Toma geschlagen.
30. März 1950: Der Patient kapselt sich völlig ab. Er bleibt im Bett. Er schaut aus dem Fenster.
15. August 1951: Der Patient hat Bleistifte von den Krankenschwestern entwendet. Er beschreibt damit auf Ungarisch Wände, Türen und Fenster.
15. Februar 1953: Der Patient ist ungepflegt und jähzornig. Er sammelt Müll. Er schläft an unpassenden Orten: auf dem Flur, auf Bänken, unterm Bett. Er belästigt seine Nachbarn. Er spricht nur Ungarisch.
30. September 1954: Der Patient ist debil und ablehnend. Er spricht nur Ungarisch.
15. Dezember 1954: Zustand des Patienten unverändert.
Wir sind auf Seite 6 der Akte, man spürt, dass die Ärzte der Sache überdrüssig werden, und Sascha und ich werden es auch. Die nächsten Seiten überfliegen wir nur noch. Sascha murmelt und summt vor sich hin, dann verfällt er in einen Sprechgesang: Zustand-des-Patienten-unverändert-er-spricht-nur-Ungarisch, Zustand-des-Patienten-unverändert-er-spricht-nur-Ungarisch … Ach doch, acht Seiten später, im Jahr 1965, passiert noch etwas. Der Patient empfindet Zuneigung zur Zahnärztin der Klinik, und um sich eine Gelegenheit zu verschaffen, sie wiederzusehen, zeigt er ständig sein Gebiss – »mit einem schwachsinnigen Lächeln«, erklärt die Krankenakte. Die Ärztin untersucht ihn noch einmal, alles in Ordnung. Doch er zeigt weiter seine Zähne, trägt man alle zwei Wochen ein. In Zeichensprache versucht er ihr verständlich zu machen, dass er sie gezogen haben möchte. Es ist der beste Weg, den er gefunden hat, um eine Beziehung zu ihr anzuknüpfen. Doch sie weigert sich, gesunde Zähne auszureißen. Also zertrümmert er sich mit einem Hammer den Kiefer. Doch keine Chance, er wird verarztet, aber nicht von der geliebten Zahnärztin. Armer Alter, seufzt Sascha. Armer Alter … Es ist gut möglich, dass er während all dieser Jahre nicht einmal Sex gehabt hat, und vorher, in Ungarn, möglicherweise auch nicht. Vielleicht hat er in seinem ganzen Leben nie Sex gehabt …
Noch zwanzig Seiten, noch dreißig Jahre.
11. Juni 1996: Der Patient klagt über Schmerzen im rechten Fuß. Diagnose: Periphere arterielle Verschlusskrankheit. Die Angehörigen des Patienten müssen wegen einer möglichen Amputation konsultiert werden. Der Patient hat keine Angehörigen.
28. Juni 1996: Zwei Drittel des rechten Schenkels des Patienten werden amputiert. Keine Komplikationen.
30. Juli 1996: Der Patient klagt nicht. Er raucht viel. Er beginnt, mit Krücken zu gehen. Sein Kopfkissen ist morgens feucht von Tränen.
Als wir am nächsten Morgen in der Klinik eintreffen, empfängt uns eine Krankenschwester in strengem Ton: Der Herr Doktor Petuchow wünsche uns zu sprechen. Er lässt uns eine Ewigkeit warten. Zum Zeitvertreib macht Jean-Marie ein paar Panoramaaufnahmen von der Ödnis hinter den Fensterscheiben und der polynesischen Lagune, die als Bildschirmhintergrund auf dem Computer prangt. Die Sekretärin bittet ihn, aufzuhören und seine Kamera einzupacken, und als sie einige Minuten später telefoniert, verstehe ich zwar nicht genau, was sie sagt, denn Sascha ist hinausgegangen, um zu rauchen, aber sie wiederholt mit gedämpfter Stimme immer wieder das Wort franzusy, und man spürt: Langsam reicht es ihr mit diesen franzusy. Schließlich tritt Juri Leonidowitsch aus seinem Büro, er geleitet einen offiziell wirkenden Besucher. Er scheint sowohl überrascht als auch genervt zu sein, uns im Weg stehen zu sehen, und zwischen Tür und Angel bedeutet er uns, jetzt aber bitte schön endlich zu verschwinden. Keine andere Brigade – so nennt man hier ein Filmteam – sei länger als ein paar Stunden da gewesen, wir dagegen schon zwei Tage, was wir denn noch wollten? Sascha versucht, ihm den Unterschied zwischen einem zweiminütigen Beitrag für die Fernsehnachrichten und einer Reportage von zweiundfünfzig Minuten zu erklären, doch es hilft nichts, Juri Leonidowitsch – oder ein anderer für ihn – hat seine Entscheidung getroffen. Es sei genug, unsere Anwesenheit störe den Heilungsprozess der Patienten, und auch bei den Jubiläumsfeierlichkeiten seien wir nicht willkommen. Das seien Privatangelegenheiten, eine Betriebsfeier, die mit dem Ungarn nichts zu tun habe.
Aber Juri Leonidowitsch, unser Film versucht, die Atmosphäre des Krankenhauses einzufangen …
So ist es, und morgen bitten Sie darum, mich in meinem Badezimmer filmen zu dürfen, weil das die Atmosphäre des Krankenhauses einfängt? Nein, tut mir leid.
Uns sind die Hände gebunden; bitter enttäuscht streunen wir durch die Stadt. Am Ortseingang steht auf einer Straßenseite eine etwa zwei Meter hohe Betonskulptur, die Hammer und Sichel darstellt, und auf der anderen ein riesiger Kessel – sehr viel länger schon das Wahrzeichen von Kotelnitsch. Kotel heißt auf Russisch Kessel oder Kochtopf, erklärt Sascha. Ein Aufenthalt darin entspricht der Mittelklasse an depressiver Leere und Einsamkeit, und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass dieses Gefühl von Stillstand am Boden eines Kessels voller kalter, gestockter Suppe, aus der schon vor langer Zeit alle gehaltvolleren Zutaten herausgefischt wurden, falls es sie je darin gegeben hat, in diesen Zwanzigtausend- Einwohner- Städten im tiefen Russland die Normalität darstellt. In diese Städte reist man nicht. Man spricht auch nicht von ihnen. Doch eines schönen Tages erfährt die Welt, dass es einmal ein verlorenes Nest namens Tschernobyl gegeben hat, und dasselbe geschah auch mit Kotelnitsch – nur aus weniger schrecklichem Anlass –, als man hier den letzten Gefangenen des Zweiten Weltkriegs fand.
Da das Festessen in unserem Hotel stattfindet, zu dem man uns ja schlecht den Zugang verwehren kann, beschließt Alain, ein Ehrengefecht zu liefern. Als wir zu dritt den Speiseraum betreten, sitzen etwa fünfzig Personen um die u-förmig angeordneten Tische, nicht ein Platz ist mehr frei, und der uns gegenüberstehende Petuchow bringt gerade einen Toast aus. Er bemerkt uns, tut aber so, als sehe er uns nicht. Eigentlich sollten wir den Rückzug antreten, doch Alain schreitet weiter in die Mitte des Saals und Jean-Marie und ich, die nicht kneifen wollen, folgen ihm nach. Ich erkenne ein paar Gesichter wieder: die Krankenschwestern aus dem Haustrakt des Ungarn, unseren Freund Wladimir Alexandrowitsch und den Funktionär, den Petuchow heute morgen eskortierte. Sie alle schauen uns verständnislos an, doch keiner sagt ein Wort. Petuchow unterbricht seinen Toast. Daraufhin spielt sich eine slapstickhafte Szene ab: Wir durchqueren höflich lächelnd den Saal und machen beschwichtigende Handzeichen, wie um zu sagen: Wir müssen nur kurz hier durch, tun Sie so, als seien wir gar nicht da, lassen Sie sich nicht stören! Die versammelte Gesellschaft schaut uns fassungslos zu, und in diesem Moment wirkt unser Gebaren so absurd, dass es unsere Gegner völlig entwaffnet. In einem Film würden sich die Helden in dem Moment, da die Hypnose nachlässt und sich der Mob blutrünstig auf sie stürzt, blitzschnell aus dem Staub machen. Zwischen den Seitentischen und dem mittleren Tisch, an dem der sprachlose Petuchow mit immer noch erhobenem Glas und offen stehendem Mund den Vorsitz führt, gibt es glücklicherweise einen Durchgang. Alain passiert ihn, wir folgen ihm nach. Wiederum glücklicherweise gibt es am gegenüberliegenden Saalende eine Tür, die uns erlaubt, den Raum zu verlassen und ihn nicht in umgekehrter Richtung noch einmal durchqueren zu müssen. Wir landen in einem dunklen, stinkenden Gewölbe – dann stehen wir auf der Straße, wo wir auf Sascha treffen, der verständnislos den Kopf schüttelt: Seid ihr jetzt völlig übergeschnappt? Es ist dunkel und kalt. Hinter angelaufenen Scheiben wird der Toast fortgesetzt, das Anstaltspersonal beginnt, sich volllaufen zu lassen, und uns bleibt nichts anderes übrig, als Kurs auf das Troika zu nehmen.