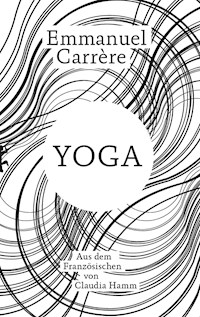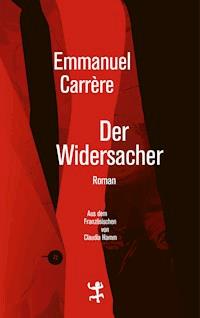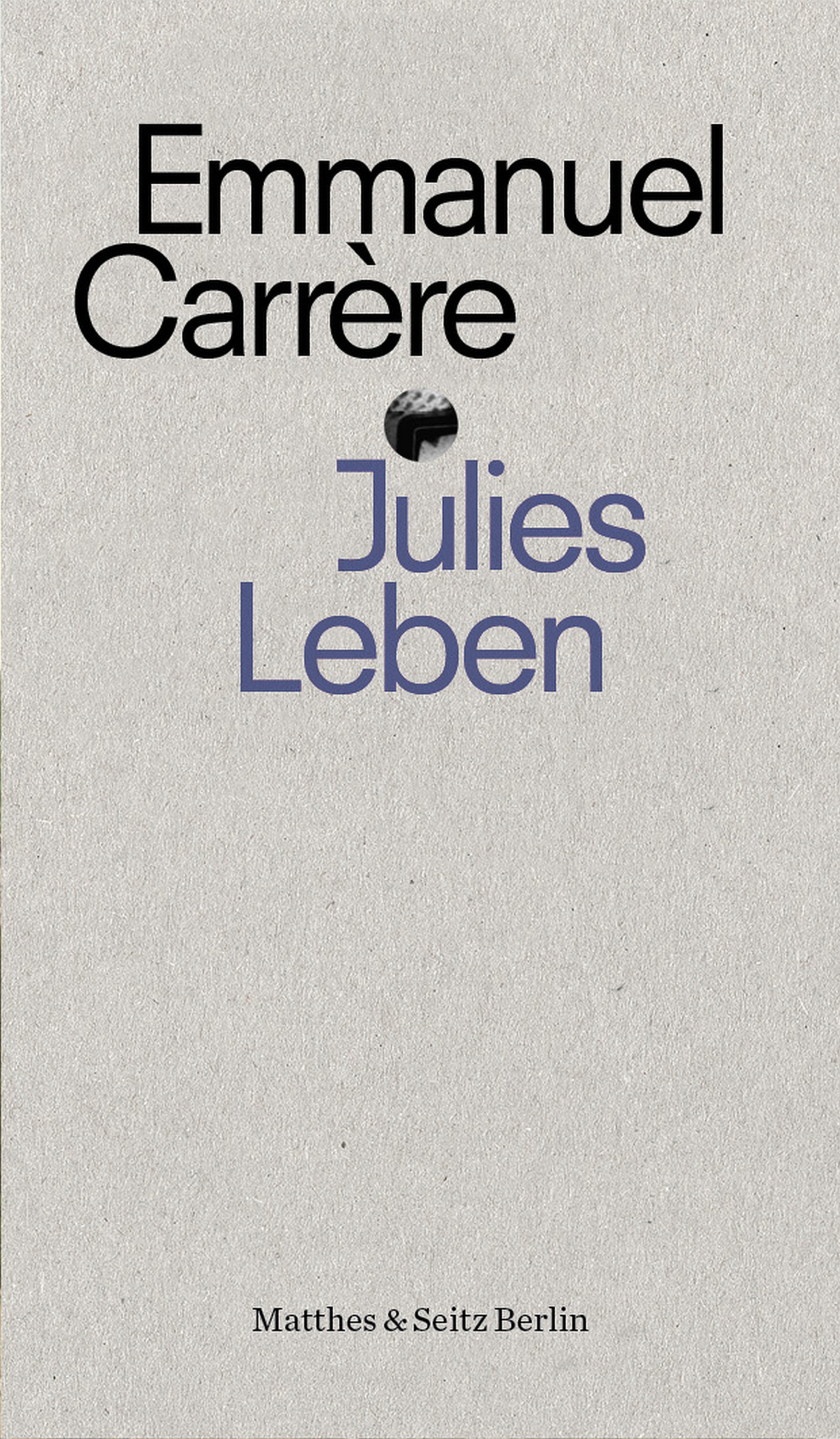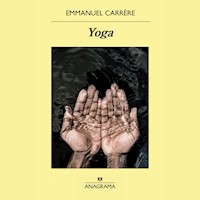Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
September 2021: In Paris beginnt ein Jahrhundertprozess. Am Freitag, den 13. November 2015 (vendredi 13), hatten sich in der Konzerthalle Bataclan, auf den Terrassen mehrerer Cafés und vor dem Stade de France sieben IS-Kämpfer in die Luft gesprengt, dabei 131 Menschen in den Tod gerissen und fast 700 verletzt. Nach diesen Attentaten wurde in Frankreich der Ausnahmezustand ausgerufen – er blieb zwei Jahre lang verhängt –, und das Bild des Landes und der Gesellschaft veränderte sich von Polizeimethoden bis Parteienspektrum nachhaltig: ein nationales Trauma. Im von den Insidern »V13« genannten exemplarischen Prozess sollte dieses Trauma bearbeitet, sollten Hunderte von Perspektiven abgewogen und schließlich ein Urteil gefällt werden. Emmanuel Carrère besuchte den Prozess über neun Monate lang Tag für Tag, schrieb wöchentlich eine Kolumne aus dem Gerichtssaal, berichtete über Akteure, das Grauen, unverhoffte Menschlichkeit und die Maschine der Rechtsprechung. V13 ist das vielstimmige Porträt eines Prozesses, mit dem eine in ihren Grundfesten erschütterte Gesellschaft nach Heilung sucht. Die Bühne des eigens gebauten Gerichtssaals ließ alle Beteiligten zu Wort kommen, und so erzählt Carrère, was er gehört und erfragt hat: Wer waren die Opfer und die Täter? Wie entsteht Terrorismus? Warum ist passiert, was passiert ist? Mit V13 gelingt Carrère ein weiteres großes Buch, das durch tiefstes Dunkel geht, um genau dort Liebe, Hoffnung und Licht zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emmanuel Carrère
V13
Die Terroranschlägein ParisGerichtsreportage
Aus dem Französischenvon Claudia Hamm
Inhalt
Die Geschädigten
Der erste Tag
In der Box
Nebenkläger
Der Schakal
Großflächige Gesichtsfrakturen
Maia aus dem Carillon
»Kümmert euch um die Lebenden«
Nadia
Im Parkett
Verkeilt
Blickkontakt
Zwei Väter
Die Vergessenen
Die Beschuldigten
Drei Brüder
Die Eröffnung
Hollandes Tag
»Individuen, die aus dem Nichts kommen«
Trockenzeit
Drei Klappsitze vor der Box
Was ist schlimmer?
Im Café Les Béguines
Unter Rojavas Sonne
Taqīya
Die Schweigeepidemie
Eine Garderobe aus gammeligem Rigips
Der Todeskonvoi
Das Grundsätzliche
Terrorlogistik
Der Countdown läuft
Mohamed Abrini nimmt die Maske ab
Die orangen Turnschuhe des Abdelhamid Abaaoud
Die letzte Version des Salah Abdeslam
Die Schleuser
Das Gericht
Reden wir über Geld
You can’t kill Rock ’n’ Roll
Todesangst
Die Ritter des Strafrechts
Der zerrissene Vorhang
Die Woche der kleinen Fische
Letzte Ehrengefechte
Das Ende
Allahu akbar
Danksagung
Ein Journalist. Nachwort von Grégoire Leménager
DIE GESCHÄDIGTEN
Der erste Tag
Start in den Herbst
8. September 2021, Mittag. Die Île de la Cité unter massivem Polizeischutz. Wir sind mehrere Hundert Personen und passieren zum ersten Mal die Sicherheitsschleusen, die wir nun ein Jahr lang jeden Tag passieren werden. Den Polizeibeamten, denen wir Guten Tag sagen, werden wir wohl oft Guten Tag sagen. Die Gesichter der Anwälte mit ihrem Ausweis an einem schwarzen, die der Journalisten mit einem orangen und die der Geschädigten mit einem grünen oder roten Band werden allmählich vertraut werden. Mit manchen von ihnen wird man sich anfreunden – etwa dem Grüppchen derer, mit denen man diese Reise gemeinsam unternehmen, Notizen und Eindrücke austauschen und sich gegenseitig vertreten wird, wenn der Tag kein Ende nimmt, und spät in der Brasserie Les Deux Palais etwas trinken gehen wird, wenn er zu hart war. Die Frage, die wir uns alle stellen, lautet: Hast du vor, die ganze Zeit herzukommen? Oder oft? Wie organisierst du dich mit dem Rest deines Lebens? Deiner Familie? Den Kindern? Manche, das weiß man schon, werden nur an den absehbar interessantesten Tagen vorbeischauen. Andere planen, jeden Tag dabei zu sein und die zähen Phasen genauso mitzumachen wie die intensiven. Ich gehöre zu Letzteren. Ob ich durchhalten werde?
Der Ablauf
Ende Juli wurde bekannt, dass der Prozess nicht sechs, sondern neun Monate dauern wird. Ein Schuljahr, eine Schwangerschaft. Der Ablauf bleibt gleich, was sich ändert, ist die Zeit, die man den Geschädigten widmen will. Etwa 1800 Personen. Wie viele davon aussagen werden, weiß man noch nicht. Bis zur letzten Minute können sie sich dafür entscheiden oder dagegen. Jedem wird durchschnittlich eine halbe Stunde eingeräumt – doch wer wird schon jemanden unterbrechen, der nach Worten ringt, um von der Hölle im Bataclan zu erzählen, und ihm sagen: »Ihre Redezeit ist abgelaufen«? Vielleicht wird die halbe Stunde zu einer ganzen werden, die sechs Monate sind jetzt schon dabei, sich in ein Jahr zu verwandeln, und ich bin wohl nicht der einzige, der sich heute fragt, warum ich mich anschicke, ein Jahr meines Lebens fünf Tage pro Woche mit einer Maske vorm Gesicht in einem riesigen Gerichtssaal zu verbringen und in aller Frühe aufzustehen, um meine Notizen vom Vorabend zu sortieren, bevor sie unentzifferbar werden – was schlicht bedeutet, ein Jahr lang an nichts anderes zu denken und kein Leben mehr zu haben. Warum? Warum tue ich mir das an? Warum habe ich dem Nouvel Observateur vorgeschlagen, den gesamten Prozess zu begleiten? Wenn ich Anwalt wäre oder irgendein Akteur in diesem riesigen Justizapparat, klar, dann wäre das mein Job. Genauso, wenn ich Journalist wäre. Aber als Schriftsteller, den niemand darum gebeten hat und der, wie Psychoanalytiker von sich sagen, sich nur qua seines Begehrens dazu ermächtigt? Ein sonderbares Begehren. Denn ich bin von den Anschlägen nicht persönlich betroffen gewesen und auch niemand in meinem Umfeld. Allerdings interessiere ich mich für Rechtsprechung. In einem Buch habe ich schon einmal das Dekorum eines Schwurgerichts beschrieben, in einem anderen die oft verkannte Arbeit eines Amtsgerichts. Was heute hier eröffnet wird, ist kein Nürnberger Prozess über den Terrorismus schlechthin, wie immer wieder behauptet wurde – in Nürnberg hat man hohe Nazifunktionäre verurteilt, hier wird man nur Mitläufern den Prozess machen, denn alle Mörder sind tot –, dennoch wird es ein Riesending werden, etwas nie Dagewesenes, und ich will dabei sein: Das ist der erste Grund. Ein zweiter ist, dass ich mich, ohne ein Experte des Islam und schon gar nicht der arabischen Welt zu sein, auch für Religionen und ihre krankhaften Mutationen interessiere – und für die Frage: Wo beginnt das Krankhafte? Wo beginnt der Wahnsinn, wenn es um Gott geht? Was geht im Kopf dieser Typen vor? Doch der eigentliche Grund ist noch ein anderer. Der wichtigste Grund ist, dass Hunderte von Menschen vor uns stehen und sprechen werden, die eines gemeinsam haben: die Nacht vom 13. November 2015 erlebt und überlebt zu haben oder diejenigen überlebt zu haben, die sie geliebt haben. Jeden Tag werden wir von extremen Todes- und Lebenserfahrungen hören, und ich glaube, zwischen dem Moment, da wir diesen Gerichtssaal betreten, und dem, da wir ihn verlassen werden, wird sich irgendetwas in uns allen verändern. Wir wissen nicht, was wir erwarten, wir wissen nicht, was uns erwartet. Also gehen wir hin.
Die Kiste
Immer wieder wurde gesagt, dieser Prozess sei ein Jahrhundertprozess, einer für die Geschichtsbücher, einer mit Vorbildcharakter. Dabei stellte sich die Frage, welcher Rahmen dieser gigantischen Werbekampagne für das Rechtsprinzip wohl angemessen wäre. Das vor drei Jahren eröffnete neue Gerichtsgebäude an der Porte de Clichy ganz im Norden von Paris? Zu modern, zu abgelegen. Eine Sporthalle? Nicht weihevoll genug. Ein Theaterraum? Nach dem Bataclan geschmacklos. Schließlich entschied man sich für den altehrwürdigen Justizpalast auf der Île de la Cité zwischen der von Ludwig dem Heiligen erbauten Sainte-Chapelle und dem Quai des Orfèvres, an dem der Schatten von Kommissar Maigret umgeht, doch da keiner seiner Säle groß genug war, baute man in die Vorhalle eine 45 Meter lange und 15 Meter breite, fensterlose weiße Sperrholzkiste, die 600 Personen fasst und den Staat 7 Millionen Euro gekostet hat. Dennoch ist sie nicht groß genug, um am ersten Tag alle Anwesenden zu fassen, also entscheidet das Los darüber, wer von den Journalisten Zutritt erhält. Allein für den Nouvel Observateur sind wir zu dritt da. Violette Lazard und Mathieu Delahousse – die über den Prozess für die Onlineausgabe der Zeitung im fieberhaften Tagesrhythmus berichten werden – und ich, der im bequemen Takt des Magazins schreiben wird: 7800 Zeichen pro Woche, Abgabe am Montag, Veröffentlichung am Dienstag, die gute alte Art. Wir hoffen, einander zu ergänzen. Violette und Mathieu sind Koryphäen unter den Gerichtsreportern – die sie »la presse ju’« nennen –, einer eingeschworenen, herzlichen Zunft voller starker Persönlichkeiten, mit der ich schon einigen Umgang hatte und auf die ich gerne wiedertreffe. Mit ihnen zusammen hier zu sein beruhigt mich, und sie nehmen den Neuling, den man ihnen in die Hand gegeben hat, wie gute Kameraden in ihrer Mitte auf. Das Los ergibt einen Platz für den L’Obs, als Willkommensgeschenk überlassen sie ihn mir. Ich finde mich eingezwängt zwischen dem Sonderberichterstatter der New York Times und dem von Radio Classique wieder. Dass Radio Classique jemanden schickt, ist verrückt, aber Violette und Mathieu haben mir schon prophezeit: Die Aufregung wird sich bald legen. Die Fernsehteams, die am Saaleingang auf der Stelle treten, weil es verboten ist, drinnen zu filmen, werden ihre Ausrüstung wieder einpacken, der Sonderberichterstatter von Radio Classique wird zu seinen Symphonien zurückkehren, und übrigbleiben werden nur die echten, die wirklichen Spezialisten für Verbrechen und Terrorismus – den sie »le terro« nennen. Unsere Sitzbänke sind sehr unbequem, kantig und ungepolstert. Es gibt auch keinerlei Schreibunterlage. Ob man direkt auf dem Computer schreibt oder, so wie ich, in ein Heft, in jedem Fall sagt man sich: Sich monatelang Notizen auf den Knien zu machen und ständig die Haltung zu wechseln, um möglichst wenig zu verkrampfen, das wird kein Spaziergang. Außerdem ist man weit weg. Weg von dieser Theaterbühne, die ein Gerichtssaal ist, so weit weg, dass man vor allem auf die Übertragungsbildschirme starren wird. Tatsächlich ist es ein bisschen so, als würde man den Prozess im Fernsehen verfolgen. Um 12.25 Uhr allgemeines Erzittern. Mit massiver Polizeieskorte werden die Angeklagten in die Sicherheitskabine geführt. Man sieht eher die Spiegelungen auf der Glasscheibe als sie selbst dahinter. Man steht auf, verrenkt den Hals und fragt: Ist er da? Ja, er ist da. Salah Abdeslam ist da. Der Typ im schwarzen Polohemd, der am weitesten weg steht, er ist es: das einzige überlebende Mitglied des Terrorkommandos. Dass er in der hintersten Ecke der Glasbox steht, liegt nicht daran, dass man ihn nicht sehen soll, sondern an der alphabetischen Reihenfolge. Er ist der erste in einer langen Reihe von As: Abdeslam, Abrini, Amri, Attou, Ayari. Schrilles Klingeln. Eine Stimme verkündet: »das Gericht«. Alle erheben sich, wie bei einer Messe. Der Vorsitzende Richter und seine vier Beisitzer treten ein und nehmen Platz. Mit leichtem Marseillaiser Akzent verkündet der Vorsitzende: »Bitte nehmen Sie Platz, die Sitzung ist eröffnet.« Es hat angefangen.
In der Box
Der Aufruf
Bei einem Schwurgericht wird das Urteil von Schöffen gefällt, also zufällig ausgewählten Bürgern. Bei Terrorismusfällen ist das Gericht aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen mit Berufsrichtern besetzt, für die ein solches Risiko zum Metier gehört. Rund um den Vorsitzenden sitzen also vier Beisitzer oder vielmehr Beisitzerinnen. Wir werden uns an diesen Anblick gewöhnen, trotzdem ist er eigenartig. Er hat damit zu tun, dass die Juristerei sowohl eine machohafte als auch mehrheitlich weiblich besetzte Profession ist – was Hand in Hand damit geht, dass sie immer schlechter bezahlt wird. Der Vorsitzende Richter, Jean-Louis Périès, ist ein standhafter, findiger Richter kurz vor der Pensionierung, dessen Großvater Gerichtsschreiber in Foix im Département Ariège war und der Vater Untersuchungsrichter im berühmten Fall Dominici, jener Tragödie auf dem Land, die in den Fünfzigerjahren alle Zeitungen des Landes beschäftigt hat. Tatsächlich sieht auch Périès aus wie ein Bauer. Oder wie ein Gymnasiallehrer alter Schule: auf den ersten Blick streng, aber im Grunde gutmütig. Seine erste Amtshandlung ist der Aufruf der Sache. Von den zwanzig Angeklagten in diesem Prozess sind vierzehn anwesend und sitzen elf in der Box. Das klingt kompliziert, doch ich habe den Sommer damit verbracht, ein Dokument namens Anklageschrift, kurz Anklage, durchzuackern, das auf 378 Seiten eine Ermittlungsakte auswertet, deren 542 Bände aufgestapelt angeblich 53 Meter Höhe ergeben, ich bin also halbwegs im Bilde. Die neun Mitglieder des Kommandos, diejenigen, die am Stade de France, im Bataclan und auf den Caféterrassen im Osten von Paris 130 Menschen getötet haben, sind alle tot, die Klage gegen sie ist also eingestellt. Sechs andere sind der Vorladung des Gerichts nicht gefolgt, und das, wie der Vorsitzende moniert, »ohne triftigen Grund« – tatsächlich haben sie einen, nämlich den, dass auch sie tot sind, aber da man sich dessen nicht zu 100 Prozent sicher ist, bleiben sie angeklagt. Von den vierzehn Übrigen sind drei auf freiem Fuß, weil die Anklagepunkte gegen sie nicht so schwer wiegen, doch sie sind verpflichtet, jeden Tag im Gerichtssaal zu erscheinen und vor der Box zu sitzen. Die elf Verbliebenen sind zu unterschiedlichen Graden Komplizen des Attentats: manche bis obenhin verstrickt, andere weniger eindeutig beteiligt. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, hier ist sie:
Die Angeklagten
SALAH ABDESLAM, Hauptangeklagter. Aufgewachsen in Molenbeek, einem Viertel in Brüssel, das als Brutstätte für radikalisierte Muslime gilt. Als jüngerer Bruder von Brahim Abdeslam, der sich im Café Le Comptoir Voltaire in die Luft gesprengt hat, hätte Salah Abdeslam es ihm gleichtun sollen, und man weiß nicht, ob sein Sprengstoffgürtel nicht gezündet hat oder er in letzter Minute einen Sinneswandel hatte. Nur er kann das sagen. Wird er es tun?
MOHAMED ABRINI, ein Jugendfreund von Salah Abdeslam, Molenbeeker wie er, ist bei den logistischen Vorbereitungen ständig an seiner Seite gewesen. Gehört zu dem, was er selbst den »Todeskonvoi« genannt hat: die drei Fahrzeuge (ein Seat, ein Polo, ein Clio), mit denen die zehn Kommandomitglieder am 12. November von Charleroi nach Paris gefahren sind.
OSAMA KRAYEM, schwedischer Staatsbürger, ist im Spätsommer 2015 aus Syrien angereist, um sich an den Attentaten in Paris und Brüssel zu beteiligen. Als erprobter Kämpfer gilt er als wichtigster IS-Kader in der Box.
SOFIEN AYARI, gleiches Profil wie Osama Krayem. Ist mit ihm aus Syrien gekommen, wurde am 18. März 2016 zusammen mit Salah Abdeslam verhaftet. Da beide in Belgien auf Polizisten geschossen haben, wurde er dort bereits zu 20 Jahren Haft verurteilt und wird im Prozess um die Anschläge vom 22. März 2016 in der U-Bahn und am Flughafen von Brüssel mit 32 Toten und 340 Verletzten noch einmal vor Gericht stehen. Überhaupt überschneidet sich der Prozess um die Anschläge von Paris mit dem um die von Brüssel, der im Herbst 2022 beginnt. Mehrere, die in Paris angeklagt sind, sind auch in Brüssel angeklagt, sie werden also einen Prozess nach dem anderen erleben.
MOHAMED BAKKALI, Logistiker, war vor allem für die Anmietung von Unterschlupfen in Brüssel zuständig. Im Sommer 2015 war er an einem (missglückten) Anschlag an Bord eines Thalys-Zugs beteiligt, wofür er in Belgien bereits zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde.
ADEL HADDADI und MOHAMED USMAN waren im Sommer 2015 zusammen mit den beiden Irakern, die sich am Stade de France in die Luft gesprengt haben, in Syrien. Als IS-Kämpfer hätten auch sie an den Anschlägen beteiligt sein sollen, doch sie wurden unterwegs festgenommen und in Wien inhaftiert.
Die folgenden Personen können in unterschiedlichem Maß als kleine Handlanger betrachtet werden. Die Anklage wird versuchen zu beweisen, sie hätten wissentlich den Anschlägen zugearbeitet; ihre Verteidiger dagegen werden behaupten, sie hätten nicht gewusst, was sie taten, und verdienten deshalb ein geringeres Strafmaß oder sogar einen Freispruch.
YASSINE ATAR tauchte in einer Reihe von Nachrichten auf, die man auf dem Computer fand, mit dem die verschiedenen Projekte des Kommandos koordiniert wurden. Er ist der Bruder von Oussama Atar, der als in Syrien verstorben, vor allem aber als Drahtzieher dieser Anschläge gilt. Immer wieder beteuert Yassine, Oussama sei Oussama und Yassine Yassine, und er, Yassine, habe mit all dem nichts zu tun.
ALI EL HADDAD ASUFI soll bei der Beschaffung der Waffen geholfen haben. Genaue Beteiligung ziemlich ungeklärt.
FARID KHARKHACH hat falsche Papiere besorgt. Gibt zu, ein Fälscher zu sein, aber kein Terrorist, und schwört, er habe nicht gewusst, woran er beteiligt war.
MOHAMED AMRI, HAMZA ATTOU und ALI OULKADI sind die drei Molenbeeker Kumpel, die Salah Abdeslam in der Nacht vom 13. auf den 14. November aus Paris nach Brüssel geschleust haben. Mohamed Amri wird außerdem vorgeworfen, vor den Anschlägen zusammen mit Abdeslam Fahrzeuge angemietet zu haben. Deshalb sitzt er mit in der Box, während die beiden anderen auf freiem Fuß vor Gericht erscheinen.
ABDELLAH CHOUAA schließlich wird vorgeworfen, verdächtige Kontakte zu Mohamed Abrini während dessen Reise nach Syrien im Sommer 2015 unterhalten zu haben. Auch er erscheint auf freiem Fuß.
Eine Frage des Namens
In den in der Anklage enthaltenen Biografien hat mich ein Detail überrascht. Im Allgemeinen legen sich Dschihad-Soldaten als Kampfnamen klassische arabische Personennamen mit einem Kunya genannten Beinamen zu. Ein solcher Name beginnt mit Abou, das heißt Vater, und endet auf al-irgendwas, je nach Herkunft des Namensträgers. So hieß zum Beispiel der IS-Chef Abou Bakr al-Baghdadi deshalb so, weil er aus Bagdad kam – und außerdem, weil Abou Bakr zu den ersten Gefährten des Propheten zählte. Nach diesem ruhmreichen Vorbild war es möglich, dass sich ein junger Dschihadist aus der Normandie mit einem Vornamen und Namen, die französischer nicht sein könnten, Abou Siyad al-Normandi nennen konnte. Vier der neun Mitglieder des Kommandos vom 13. November waren Belgier: Sie nannten sich also al-Belgiki. Drei waren Franzosen: al-Faransi. Zwei Iraker: al-Iraki. Schaut man sich allerdings die vierzehn Angeklagten an, so findet man nicht einen dieser Kampfnamen, sondern nur armselige Alltagsnamen. Manche haben zwar Spitznamen, doch die tun nichts zur Sache. (Konkret sind das Ahmed Damani, der »Gégé« oder »Prothese« genannt wird, und Mohamed Abrini, der »Brink’s« oder »Brioche« heißt.) Wann haben sich die einen diese Dschihad-Ritternamen verliehen oder verleihen lassen, die für sie von hohem Prestige gewesen sein mussten, und wann haben die anderen vorsichtigerweise darauf verzichtet? War es klar, ausdrücklich klar, dass man das Recht, einen solchen Namen zu tragen, mit dem Leben zu bezahlen hatte? Und was ist von dem einen, einzigen zu halten, der sich zwischen beiden Gruppen nicht entscheiden konnte? Im Unterschied zu den Statisten neben ihm in der Glasbox hätte Salah Abdeslam töten und getötet werden sollen. Beides hat er nicht getan. Und wie um diesen unentschlossenen Status zu kennzeichnen, hat auch er einen Alias-Namen, allerdings einen verkürzten: Abou Abderrahman, mehr nicht. Kein mörderisches Adelsprädikat, keinen Adelstitel: Abou Abderrahman al-nichts.
Zeitarbeiter
Während der gesamten sechsjährigen Laufzeit der Ermittlungen hat er die Aussage verweigert, und die große Spannung an diesem ersten Tag konzentriert sich deshalb auf die Frage: Wird er sein Schweigen brechen? Täte er es nicht, würde der ganze Prozess uninteressant. Wir schließen Wetten ab; die meisten meiner Kollegen sind skeptisch. Er wird zuerst aufgerufen, wieder wegen der alphabetischen Reihenfolge. Der Vorsitzende bittet ihn aufzustehen und seinen Familienstand anzugeben. Wird er aufstehen? Wird er antworten? Er steht auf. Eine jugendliche Gestalt, das Gesicht von der Maske verdeckt, darunter ein Salafistenbart. Vor jeder Antwort rezitiert er laut die Schahada, das schlichte, grandiose Glaubensbekenntnis des Islam: »Ich bezeuge, dass Allah der einzige Gott ist und Mohamed sein Gesandter.« Pause. »Gut«, sagte der Vorsitzende, »das klären wir später. Name des Vaters und der Mutter?« »Die Namen meines Vaters und meiner Mutter spielen hier keine Rolle.« »Beruf?« »Kämpfer des Islamischen Staats.« Der Vorsitzende schaut auf seine Notizen und antwortet gelassen: »Bei mir steht: Zeitarbeiter.«
Nebenkläger
Mittelbare Opfer und leidende Zeugen
»Verletzt, trauernd oder betroffen« – das gilt für die Nebenkläger, deren Anhörung Ende September beginnt. Einige Dutzend sind bereits da, sie sitzen auf den ihnen zugewiesenen Bänken, die mehr als die Hälfte des Saals einnehmen. Diejenigen, die ihren Besucherausweis an einem roten Band tragen, sind nicht gewillt, mit der Presse zu sprechen, die, die ihn an einem grünen tragen, schon. Manche Unentschlossene haben Bänder in beiden Farben um. Doch bislang bekommt man vor allem ihre Anwälte zu sehen. Geschäftige Schwärme von schwarzen Roben. Auch sie werden einer nach dem anderen aufgerufen, und jeder gibt seine Mandanten bekannt. Für die, die bereits registriert sind, ist das reine Formsache. Trotzdem dauert es zwei Tage; danach geht es an den Anschluss neuer Zivilparteien an die öffentliche Klage, was bis zur letzten Minute erlaubt ist. Bei diesen muss erst noch geklärt werden, welche dieser späten Antragsteller überhaupt Anspruch auf den Status eines Geschädigten haben und welche nicht. In manchen Fällen besteht kein Zweifel. Verletzt oder trauernd – der Schaden, den sie erlitten haben, ist nicht von der Hand zu weisen. Er ist bezifferbar, nach einem Schema, das monströs erscheinen mag, aber das existiert und auf das man sich berufen kann: Die Trauer um eine Schwester wiegt schwerer als die um eine Cousine, der Verlust eines Beins mehr als der eines Fußes. In anderen Fällen ist die Sache weniger eindeutig. Inwiefern darf man sich als »betroffen« bezeichnen, wenn man weder verletzt ist noch jemanden verloren hat? Ein gutgekleideter Herr tritt in den Zeugenstand. Er fordert, als Geschädigter anerkannt zu werden, weil er im Stade de France war, wo die Anschläge begannen. »Im oder vor dem Stade de France?«, fragt Périès. »Drinnen«, ist der Mann gezwungen zuzugeben. »Das Problem ist«, bemerkt Périès freundlich, »drinnen ist nichts passiert«. Die Terroristen hätten zwar eindringen und sich in die Luft sprengen sollen, aber sie haben es nicht getan, und deshalb ist es nicht angemessen, die 80 000 Zuschauer des Fußballspiels Frankreich – Deutschland, das an diesem Abend stattfand, genauso als Anschlagsopfer anzuerkennen wie die anderen. Und ebenso wenig diejenigen, die in den Nachbarstraßen des Bataclan wohnten und auf den Bürgersteigen Leute sterben oder mit dem Tod ringen sahen und noch heute an Albträumen leiden. Dabei geht es nicht darum, die Realität dieser Albträume, Krankschreibungen und Traumata zu leugnen, doch die Rechtsprechung unterscheidet zwischen einem »unmittelbaren« Opfer und einem »mittelbaren« beziehungsweise dem »leidenden Zeugen«, dessen Schädigung man leider nicht berücksichtigen kann, sonst nähme das Ganze kein Ende. Ein Gerücht, das auf den Bänken der »presse ju’« die Runde macht, handelt von einer Dame, die Schmerzensgeld fordere, weil die Anschläge ihre Geburtstagsparty vermasselt hätten, die sie seit Langem geplant und für die sie eine dicke Stange Geld bezahlt habe. Die Geschichte scheint wahr zu sein, doch die Frau ist nicht erschienen.
Die Mythomanin vom Bataclan
Ebenso erzählt man sich Geschichten von falschen Opfern. Solche gibt es, und gar nicht wenige. Der Journalist Alexandre Kauffmann hat über eins von ihnen ein Buch geschrieben, in dem er sehr plastisch die Gemeinschaft beschreibt, die sich in den Tagen nach den Anschlägen gebildet hat.* In den Cafés und Bars rund um die Bastille erzählte man sich in Dauerschleife von der Höllennacht; wo man im Moment des Anschlags war und mit wem. War die Frau, die unter dem Tisch im Belle Équipe neben mir lag, tot, oder lebt sie noch? Wer war der Mann, der mir am Ausgang des Bataclan in der Passage Amelot eine Rettungsdecke hinstreckte? Weiß das jemand? Oder kennt jemand jemanden, der es wissen könnte? Legenden entstanden. Im Bataclan habe es Messerstechereien gegeben, verstümmelte Leichen, eine aufgeschlitzte Schwangere, einen entmannten Mann, einen vierten Mörder – und an der Spitze des Staates habe man beschlossen, all das nicht öffentlich zu machen. Diese Geschichten aus 1001 Nacht des Grauens kursierten im echten Leben, auf den Straßen und in den Cafés, aber auch und vor allem im Internet. Im Dezember 2015 startete eine Kindergärtnerin, die mit ihrem Mann im Bataclan gewesen war, auf ihrer Facebook-Seite das, was später die Organisation Life for Paris werden sollte. Sehr schnell zog sie Hunderte von Überlebenden und Trauernden an. Unter vielen anderen eine gewisse Flo, die zwar kein direktes Opfer war, sich aber zu hundert Prozent dem Beistand ihres besten Freundes Greg verschrieben hatte, der schwerverletzt im Georges-Pompidou-Krankenhaus lag. Das Verrückteste sei, erzählte sie immer wieder, dass Greg sonst nie ins Bataclan gegangen sei und sie ständig. Auch an diesem Abend hätte eigentlich sie dort sein sollen, doch dann habe sie sich nicht gut gefühlt und in letzter Minute umentschieden, es sei ganz knapp gewesen. – Es gibt Leute wie sie, die sich auf ähnliche Weise ihr ganzes Leben lang damit brüsten, ein Flugzeug um zwei Minuten verpasst zu haben, das dann abstürzte. – Emsig bemüht und immer einsatzbereit wird Flo zur Webmasterin des Forums. Sie begrüßt und informiert, unterstützt, tröstet und verlinkt die verschiedenen Initiativen der Gemeinschaft wie Ausflüge, Geburtstage oder Gedenkfeiern auf dem Boulevard Voltaire, zu denen zahlreiche Menschen strömen und sich vor Kerzen, Blumen, Fotos und Zeichnungen versammeln. Wenn jemand über ihr Einfühlungsvermögen staunt, erklärt sie, die Bewährungsprobe habe sie reifer und offener für andere gemacht. Sie habe sie sogar die grausame Krankheit vergessen lassen, an der sie leide: das Cushing-Syndrom, das sie so fettleibig und behaart macht. Flo ist bei Life for Paris so nützlich, dass man ihr vorschlägt, in den Vorstand einzutreten. In dieser Funktion wird sie im Rahmen eines Gesetzesentwurfs für Opferhilfe im Parlament angehört und posiert danach mit den medienwirksamsten Figuren der Organisation für Paris Match. Bildunterschrift: »Das Trauma des Massakers. Sie schaffen es, wieder zu lächeln und sogar in Bars zu gehen.« Auf einem anderen Foto ist sie, deutlich rockiger, in Lederjacke in den Armen von Jesse Hughes zu sehen, dem Sänger der Eagles of Death Metal – seine Band, die am 13. November im Bataclan gespielt hatte, kehrte 2016 für ein Gedenkkonzert im Olympia noch einmal nach Paris zurück. Neben ihren repräsentativen und psychologischen Aufgaben besteht ihr neuer Job, wie sie sagt, darin, zwischen echten Überlebenden und den schrägen Individuen zu unterscheiden, die so zahlreich um das Unglück anderer kreisen. Was diese angeht, ist ihr Gespür unfehlbar. Als in einer Sendung von France’s Got Talent ein Gymnasiast ein Lied für Alexandre singt, seinen besten Freund, der im Bataclan starb, stellt sich heraus, dass im Bataclan gar kein Alexandre unter den Toten war. Der Gymnasiast verstrickt sich in seine Lüge, was ihm von den sozialen Netzwerken zunehmend übelgenommen wird – und ebenso von Flo, die behauptet, ihn sofort und vor allen anderen durchschaut zu haben, und die ihre Abscheu in einem Forum folgendermaßen formuliert: »Bullshit, alles nur, um die Einschaltquoten hochzutreiben, es ist ekelhaft, tragische Ereignisse so zu missbrauchen!« Allerdings wird sie bald selbst entlarvt, denn während sie weiter über Gregs Zustand berichtet, macht sie den Fehler, sich plötzlich selbst zum Opfer zu erklären. Das Protokoll ihrer Anzeige ist eine der vollständigsten, genauesten und überzeugendsten Schilderungen der Horrornacht im Bataclan. Doch ein Verdacht keimt auf, und er verstärkt sich, als ein Mitglied der Organisation sie im Wartezimmer eines Therapeuten trifft, der auf die Probleme von Überlebenden spezialisiert ist. Nachforschungen folgen, Informationen werden abgeglichen. Man findet heraus, dass es weder unter den Patienten des Pompidou-Krankenhauses noch auf der Liste der Opfer einen Greg gibt, Flo aber Schmerzensgeld in Höhe von 25 000 Euro kassiert hat – und das nur als erste Rate. Arthur Dénouveaux, der Vorsitzende von Life for Paris, reicht Klage gegen sie ein, allerdings mit einem Anflug von Bedauern, weil er Flo mochte und, wie er sagt, weil diese in ihrer Einsamkeit verlorene Frau in dieser Gruppe von Überlebenden die ersten wahren Freunde ihres Lebens gefunden hatte. Wegen Betrugs und Vertrauensmissbrauchs vor Gericht gestellt, wird Flo zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Dem Buch ist als Motto ein Satz von Christine Villemin vorangestellt, der Mutter des kleinen Grégory und Protagonistin eines anderen Falls, der landesweit Aufsehen erregte: »Man könnte meinen, die Menschen sind neidisch auf das Unglück, das wir durchmachen.«
*Alexandre Kauffmann: La mythomane du Bataclan, Éditions Goutte d’Or 2021.
Der Schakal
Verteidigung durch Gegenanklage?
Am zweiten Tag, an dem der Aufruf der Nebenkläger fortgesetzt wurde, war die Rede davon, dass die Opfer bald zu Wort kommen sollten. Plötzlich sprang Salah Abdeslam auf und fuchtelte in der Sicherheitskabine herum, auf dass man sein Mikro öffne, dann fragte er, ob man denn auch jene zu Wort kommen lassen wolle, auf die im Irak und in Syrien Bomben geworfen würden. Der Vorsitzende antwortete, darüber werde man zu gegebener Zeit diskutieren, und drehte das Mikro wieder ab. Abdeslams Ausfall wurde allgemein als Provokation gewertet, trotzdem gab mir das Argument zu denken. Es ist das einer Verteidigung durch Gegenanklage, die man »défense de rupture« nennt und die der berühmtberüchtigte Anwalt Jacques Vergès 1987 im Prozess gegen den Nazioffizier Klaus Barbie benutzte und theoretisch untermauerte. Gut, sagte Vergès, Barbie hat in Lyon gefoltert, aber die französische Armee hat in Algerien dasselbe getan, und insofern antwortet die Verteidigung jedes Mal, wenn von Folter in Lyon die Rede ist, mit Folter in Algerien. Es würde mich wundern, wenn Olivia Ronen, die blutjunge Anwältin von Abdeslam, sich dazu aufschwingen würde, es Jacques Vergès gleichzutun, allerdings stimmt es ja: Auch wenn die französische Armee dadurch nicht zum Äquivalent der SS wird, hat sie in Algerien gefoltert. Und es stimmt auch, dass die internationale Allianz, der Frankreich angehört hat, von 2014 an Bomben auf den Irak und auf Syrien abgeworfen hat, die Dutzenden oder sogar Hunderten von zivilen Opfern das Leben gekostet haben – denn »chirurgische Schläge« sind ein Mythos. Noch verwunderter allerdings war ich, als ich beim Lesen der Anklage, über deren Genauigkeit und Rechtschaffenheit sich doch alle so einig sind, eine Anspielung auf »angebliche Massaker an Zivilisten« fand, »die der Westen im Zuge seiner Bombardierungen begangen habe«. Ich bin kein Experte in der Sache, und ich lasse auch die Frage beiseite, ob der durch die amerikanischen Sanktionen direkt verursachte Tod einer halben Million irakischer Kinder »den Preis wert war«, wie sich seinerzeit Staatssekretärin Madeleine Albright in einem denkwürdigen Interview ausdrückte (»the price is worth it«), doch es dient weder der Wahrheit noch der Gerechtigkeit und auch nicht der Justiz, unbestreitbare Massaker an Zivilisten »angebliche Massaker an Zivilisten« zu nennen. Und es dient ebensowenig der Gerechtigkeit und der Wahrheit, wenn man leugnet, dass Salah Abdeslams Haftbedingungen besonders hart sind. Sechs Jahre Isolationshaft, das ist wirklich brutal. Das hat Olivia Ronen von der ersten Sitzung an sehr deutlich gemacht. Sie hat klargemacht, dass der junge Mann, der gerade in die Box geführt wurde wie ein Stier in die Arena, seit sechs Jahren praktisch mit niemandem gesprochen hat – und das klarzumachen gehört auch zu ihren Aufgaben. Ich habe ihr zugehört und zugestimmt, und doch habe ich gleichzeitig an eine E-Mail gedacht, die Frank Berton, der vorige Anwalt von Abdeslam, erhalten hatte, als er die Tag und Nacht laufende Videoüberwachung anprangerte, unter der sein Mandant stand:
»Sehr geehrter Herr Anwalt,
seit ihrem Abend im Bataclan steht auch meine Tochter Tag und Nacht unter Videoüberwachung: im Krankenhaus.
Es stört sie nicht, denn sie liegt in tiefem Koma.
Es stört auch meinen Sohn nicht, denn er ruht auf dem Friedhof.
Ich respektiere Ihre Arbeit und Ihre Überzeugungen, doch angesichts der Leute, die leiden, gibt es Grenzen.«
Ein Gespenst
Zur selben Zeit, da der Dampfer des V13 langsam in Sicht kommt – wie wir alle, die wir involviert sind, Richter, Anwälte, Journalisten, diesen monumentalen Prozess zum Freitag, den 13. November, inzwischen nennen –, geht die Arbeit am Gericht weiter. Ein anderes, ziemlich spezielles Schwurgericht hat in einem kleinen Saal im Untergeschoss über einen anderen Terroristen zu befinden. Dieser Prozess weckt wenig öffentliches Interesse. Eine befreundete Anwältin hat mich darauf aufmerksam gemacht, und so bin ich hinuntergestiegen, um mich vom langen Zug der Nebenkläger ein wenig abzulenken. Der Angeklagte ist ein alter Herr in himmelblauem Anzug und dazu passendem Schal und Einstecktuch, mit sorgfältig geglätteten weißen Haaren, schmalem Oberlippenbärtchen und starkem spanischen Akzent. Von seiner Glaskabine aus begrüßt er freundlich ein scheinbar treues Publikum. Das sind, in der Reihenfolge ihres Erscheinens: ein alter Fan, der Benoît Poelvoorde ähnelt und dem er mit der Bemerkung »revolutionäre Grüße« ein Autogramm gibt; zwei Typen in Schlips und Kragen, die wie Banker aussehen und sich, entgegen allem Anschein, als Gelbwesten vorstellen; zwei nette alte Damen, wohlbekannte Streiterinnen für die Sache der Palästinenser, von denen die eine ein unmissverständlich antisemitisches Pamphlet aus der Tasche zieht und der anderen in die Hand drückt; ein junger Kerl in Jogginghosen, der das neueste Buch von Éric Zemmour an die Brust gepresst hält; und, um den Reigen zu schließen, Bischof Gaillot, der linke Geistliche, der Ende des letzten Jahrhunderts, einige werden sich erinnern, von sich reden gemacht hat. Sie alle kennen sich, und der Angeklagte hat für jeden ein freundliches Wort übrig. Als er eine der netten alten Antisemitinnen Benoît Poelvoorde Begrüßungsküsschen geben sieht, wirft er ihr scherzhaft zu: »Na? Gehst du jetzt fremd?« Seine Strafverteidigerin, eine hochgewachsene, hagere Frau mit rabenschwarzen Augen und Haaren, die zufällig seine Gattin ist, kommt mit drei schwankenden Kaffeebechern herein, einem für ihren Mann, einem für sich und einem für den Staatsanwalt, dem sie den Becher, ebenfalls scherzend, mit den Worten reicht: »Bestechungsversuch!« Der Staatsanwalt lächelt, man ist unter sich. Er hat schon dreimal Anklage gegen den Beschuldigten erhoben, sie hat ihn schon siebenmal verteidigt. Gegenstand dieses Prozesses ist allein das Strafmaß, das dieser für den Anschlag auf das Kaufhaus Publicisdrugstore erhalten hat (1974, 2 Tote, 34 Verletzte), und dieser Gegenstand ist lächerlich und eine rein verfahrensrechtliche Angelegenheit, denn der Angeklagte wurde schon vor langer Zeit und für viele weitere Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Seit 27 Jahren sitzt er im Gefängnis und wird dort bis ans Ende seiner Tage sitzen, nur ist dieser Prozess sein letzter, danach sind keine Berufungen und Revisionen mehr möglich. Es ist also die Abschiedsvorstellung des Ilich Ramírez Sánchez, genannt der Schakal, genannt Carlos. Kein Witz: Nur ein paar Stufen vom V13 entfernt und ohne dass das irgendjemanden jenseits seines Fanclubs interessiert, wird Carlos der Prozess gemacht. Carlos, dem legendären Terroristen der 1970er Jahre, Carlos, dem berühmtesten Mandanten von Jacques Vergès. Der Staatsanwalt konnte sich nicht verkneifen, eine Verbindung zu dem zu ziehen, was im Stockwerk über ihnen stattfand. Er erinnerte daran, dass es Carlos war, der die ersten Attentate auf wahllose Opfer auf französischem Boden verübt hat, darunter »verhältnismäßig« blutige Attentate – das Wort »verhältnismäßig« ist ein Ausdruck jener Leute in den Strafbehörden geworden, die, seit sie mit dem »Salaf’« zu tun haben, wie sie den Salafismus nennen, finden, die Sache damals mit den Korsen und Basken sei die gute alte Zeit gewesen. Als Rechtsanwältin Coutant-Peyre – so heißt seine Frau – ihr Plädoyer hielt, lief die Sache jedoch endgültig aus dem Ruder, sie erzählte Anekdoten und persönliche Erinnerungen, er korrigierte sie, sie konterte: »Wenn du besser weißt als ich, was hier zu sagen ist, dann verteidige dich doch selbst«, und er setzte sich maulend wieder hin. Diese unglaublich seltsame Szene war wie aus einer Komödie. Meine Anwaltsfreundin und ich genierten uns nicht, verstohlen zu lachen. Wir hätten wohl weniger gelacht, wenn im Saal vor diesem Vintage-Terrorismusgespenst in Schlaghosen und neben diesen pittoresken Kasperlefiguren jene Frau im Rollstuhl gesessen hätte, die 1974 ein kleines Mädchen war, das von seinen Eltern im Publicisdrugstore zum Eisessen ausgeführt wurde und deren Leben an diesem Tag für immer zerstört wurde.
Großflächige Gesichtsfrakturen
2 Stunden 38 Minuten und 47 Sekunden
Diejenigen, die beim Charlie-Hebdo-Prozess vor acht Monaten dabei waren, werden die traumatischen Fotos vom Tatort nie vergessen: die Redaktionsstube, die Leichen. Und dann das Überwachungsvideo: der Empfangsraum, die hereinbrechenden Attentäter, wie der eine der beiden Kouachi-Brüder Schmiere steht, während der andere mordet … 1 Minute und 49 Sekunden, die viele lieber nicht gesehen hätten. In Absprache mit dem Vorsitzenden Richter trafen die Polizeibeamten, die während der gesamten zweiten Woche des V13 eine Art Schadensfeststellung machten, die gegenteilige Entscheidung: die Nebenkläger verschonen, nur das Nötigste zeigen. Fotos, aber nur von fern. Stadtpläne. Der verwüstete, aber leere Raum der Bar Le Carillon. Eine Litanei von Namen, auf den Bürgersteig gezeichnete Markierungen, gelbe oder blaue Kegel, aber keine blutüberströmten Leichen. Wenig Bilder, kaum Tonaufnahmen. Obwohl es welche gibt. Im Bataclan hatte ein Zuschauer das Konzert mit einem Diktafon mitgeschnitten, das man später fand. Es lief während des gesamten Massakers weiter, sodass es eine Aufnahme gibt, die vom Eindringen des Kommandos bis zur Erstürmung durch die Polizei 2 Stunden, 38 Minuten und 47 Sekunden dauert. Die Frage war, ob man es anhören sollte oder nicht. Doch auch in diesem Fall entschied sich das Gericht für Zurückhaltung und ließ nur die ersten 22 Sekunden abspielen: Man hört die Eagles of Death Metal, dann mischen sich die ersten Schüsse ins Schlagzeug. Bei der Wiedergabe bohrte sich jedoch ein Rückkoppelungseffekt in die Ohren, also wurde das Ganze sofort abgeschaltet. Als später die Sitzung unterbrochen wurde, sagte eine junge Frau, die im Bataclan gewesen war, etwas zu mir, das nur sie sagen darf und ich nicht: »Das reicht nicht. Wenn wir dadurch eine Vorstellung davon kriegen sollen, was das war, dann reicht das nicht. Das ist fast nichts.« Ich weiß es nicht. In einer Woche werden andere, die wie die junge Frau dort waren, diese Stunden in Worte zu fassen beginnen. Bis dahin lauschen wir denen des Ermittlers, der die erste Befundaufnahme am Tatort machte – ein Polizist, der im Laufe seiner zwanzig Jahre bei der Mordkommission viel gesehen habe, doch im Bataclan habe er gezittert. »Was Sie gerade nicht gehört haben«, sagte er, »die übrigen 2 Stunden 38 Minuten und 25 Sekunden, hat ein Beamter Wort für Wort, Geräusch für Geräusch und Schuss für Schuss transkribiert. 258 Schüsse während der ersten 32 Minuten, erst Salven, dann einzelne Schüsse.« Wie lange der Beamte dafür gebraucht hat, ist nicht bekannt. Wie seine Nächte aussahen, stellt man sich lieber nicht vor. Und da die Mörder zu Beginn des Massakers redeten und wir ihre Worte hören sollten, ohne dass man das Band abspielen wollte, nahm sich derselbe Polizist, Patrick Bourbotte, der Sache an. Er erklärte: »Ich werde den Terroristen meine Stimme leihen müssen. Das ist nicht das Einfachste, was ich in meiner Karriere als Kriminalbeamter bislang zu tun hatte.« Seine Stimme versagte, dann holte er tief Luft und begann tapfer und mit dem Eifer eines Schauspielstudenten mit jeweils veränderter Stimme die Worte des »Mörders Nummer eins«, Foued Mohamed Aggad, des »Mörders Nummer zwei«, Ismaël Omar Mostefai, und des »Mörders Nummer drei«, Samy Amimour, vorzulesen:
»… Ihr könnt euch bei eurem Präsidenten François Hollande bedanken … Er spielt im Irak und in Syrien Cowboy und Western und bombardiert unsere Brüder, jetzt machen wir dasselbe mit euch …
Wir sind Soldaten des Kalifats, wir sind überall auf der Welt.
Wir werden überall zuschlagen …
Halt still, Mann!
Schuss.
Ich hab doch gesagt, du sollst stillhalten.«
17 Leichenteile
Am Morgen des 14. November 2015 wurden im Leichenschauhaus zwei Opfer verwechselt. Die Eltern der einen hielten ihre Tochter für tot, obwohl sie noch lebte, und die der anderen wiegten sich in der verrückten Hoffnung, sie sei am Leben, während sie doch tot war. Bei der Vorladung des Leiters des Leichenschauhauses vor Gericht verteidigt sich dieser: Man habe mit so etwas noch nie zu tun gehabt, »123 Leichen und 17 Leichenteile« in wenigen Stunden! »17 Leichenteile«. Solche Wörter hören derzeit die Leute aller Altersgruppen, die auf den für sie reservierten Bänken sitzen und sich teils kennen, teils allein kommen, Tag für Tag: die Nebenkläger des V13. Für manche sind diese Leichenteile die ihres Kindes oder des Mannes oder der Frau, die sie einmal geliebt haben. Andere Wörter, die sie lernen müssen, sind: Lazeration, Verstümmelung, Mehrfacheinschüsse durch Streumunition. Oder Streuzone: Das heißt, dass man bis zu 50 Meter vom Epizentrum einer Explosion entfernt noch menschliche Überreste findet. Folgendes sagt ein Ermittler dazu, einer der ersten, die das Bataclan betraten: »Wir waten durch Leichen, die ineinander verkeilt oder verschlungen oder gestapelt sind, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Wir schlittern durch Blutlachen, wir zertreten Zahn- und Knochenteile, und überall vibrieren Telefone, weil die Familien anrufen. Als wir anfingen, die Leichen abzutransportieren, waren sie so vollgesogen mit Blut und so schwer, dass wir sie zu viert tragen mussten. Mein Albtraum war, dass wir ein Opfer übersehen würden, das sich irgendwo in einem Mauseloch versteckt hat und dort stirbt, weil wir es nicht finden. Noch zwei Wochen später haben wir ein Bein von einem der Terroristen gefunden.« Der Anwalt eines Nebenklägers fragte einen Ermittler, der das Gleiche im Restaurant La Belle Équipe erlebt hatte, seltsamerweise, was er angesichts dieses Gemetzels »empfunden« habe. »Empfunden? Keine Ahnung. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ein Opfer 30 Löcher hatte, ein anderes 22 und ein drittes 14.« Und: »Sie müssen begreifen, dass Schüsse mit einem Kaliber von 7,62 mm nicht dasselbe anrichten wie solche mit 9 mm. Bei 9 mm hat man Löcher mit einem Ein- und Ausgang, 7,62 mm zerstören sehr viel mehr, da hat man explodierte Schädel und großflächige Gesichtsfrakturen.«
Noch etwas also, das die Angehörigen der Opfer gelernt haben: In der Sprache von Gerichtsmedizinern hat ein zerfetztes, entstelltes Gesicht »großflächige Gesichtsfrakturen«.
Propaganda
Das Bekennervideo des Islamischen Staats nach den Anschlägen wurde dennoch gezeigt. Zensiert zwar, aber selbst zensiert macht seine Grausamkeit fassungslos. Wie ein Hollywood-Blockbuster oder Videospiel gefilmt, geschnitten und vertont, zeigt es die »neun Löwen des Kalifats«, das heißt die zukünftigen Selbstmordattentäter von Paris, im Sommer 2015 beim Training in einer wahrscheinlich syrischen Kies- und Schotterlandschaft. Sie wissen, dass sie in ein paar Monaten morden und sterben werden. Bis dahin enthaupten sie Gefangene, und zwar jeder seine eigenen, und sie enthaupten sie nicht nur, sondern manche krümmen sich dabei vor Lachen. Das Ganze dauert 17 Minuten und ist Propagandamaterial. Vielleicht irre ich mich, aber mir scheint, eine solche Art von Propaganda hat es noch nie gegeben. Was auch immer sie verschweigt und wie schrecklich es auch ist, normalerweise führt Propaganda das Gesicht der Tugend vor: Paraden oder junge Menschen mit klarem Blick, die in eine strahlende Zukunft blicken. Die Propaganda der Nazis zeigte nicht Auschwitz, die von Stalin zeigte nicht den Gulag, die der Roten Khmer zeigte nicht das Folterzentrum S.21. Normalerweise versucht Propaganda, das Grauen zu kaschieren. Hier stellt sie es aus. Der Islamische Staat behauptet nicht: Es herrscht Krieg, und wir haben die traurige Pflicht, schreckliche Taten zu begehen, damit das Gute siegen kann. Nein, er bekennt sich zum Sadismus. Um Leute zu bekehren, setzt er auf Sadismus. Auf die Zurschaustellung von Sadismus. Auf die Erlaubnis, sadistisch sein zu dürfen.
»Kein Witz«
Bevor der Seat des Trios, das die Terrassen der Bar Le Carillon und des Restaurants Petit Cambodge mit Maschinengewehrsalven überziehen sollte, in die Rue Buchat einbog, hielt er an der Ampel auf der Höhe von zwei Passanten, die nun in den Zeugenstand treten. Einer der Terroristen ließ die Scheibe herunter und rief: »Der IS ist da, um euch den Hals abzuschneiden!« Und als er wieder anfuhr, brüllte er noch hinterher: »Kein Witz.«
Maia aus dem Carillon
»Amine habe ich während unseres Architekturstudiums kennengelernt«, sagt Maia. »Er wurde erst ein Freund, dann mein Freund, dann mein Mann, dann mein Geschäftspartner. Wir haben zusammen eine Agentur gegründet. Er war meine erste Liebe, meine große Liebe. Wir hatten viele Pläne miteinander. Wir haben oft über unser Leben gesprochen, über die Kinder, die wir irgendwann haben wollten. Wir haben zweimal geheiratet. Einmal 2014 in Paris und das zweite Mal 2015 in Rabat in Marokko, wo er aufgewachsen ist und wo seine Familie wohnt. Zusammen haben wir dann Émilie kennengelernt, die eine enge Freundin wurde, und dann ihre Zwillingsschwester Charlotte. Die beiden waren schön, und wir verstanden uns sehr gut, wir haben viel miteinander gelacht. Außerdem war da noch Mehdi, Amines Jugendfreund. Wir alle fünf waren Architekten. Freitagabends haben wir uns immer im Carillon getroffen, in der Nähe der Agentur. Wir mussten uns nicht verabreden, es war einfach unser Stammtreff. An diesem Abend war es so mild, dass wir uns alle raus auf die Terrasse gesetzt haben. Es war wie ein allererster Frühlingsabend, die Leute sahen fröhlich aus, weil sie draußen herumspazieren konnten. Ich weiß noch, dass ich dachte, das Leben ist wirklich schön, und wir haben Glück. Im Moment, als es passierte, sprachen wir gerade über unsere Geburtstage. Ich war siebenundzwanzig, die anderen neunundzwanzig, und wir fragten uns, wie wir die Dreißiger von den Vieren feiern sollten. Und dann ist es passiert.
(Sehr lange Pause.)
Also, was da passiert ist … Die Bilder und Geräusche, die da in mir hochkommen, das ist ein totales Wirrwarr. Der Lärm, die