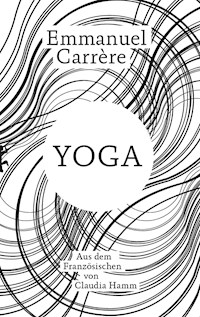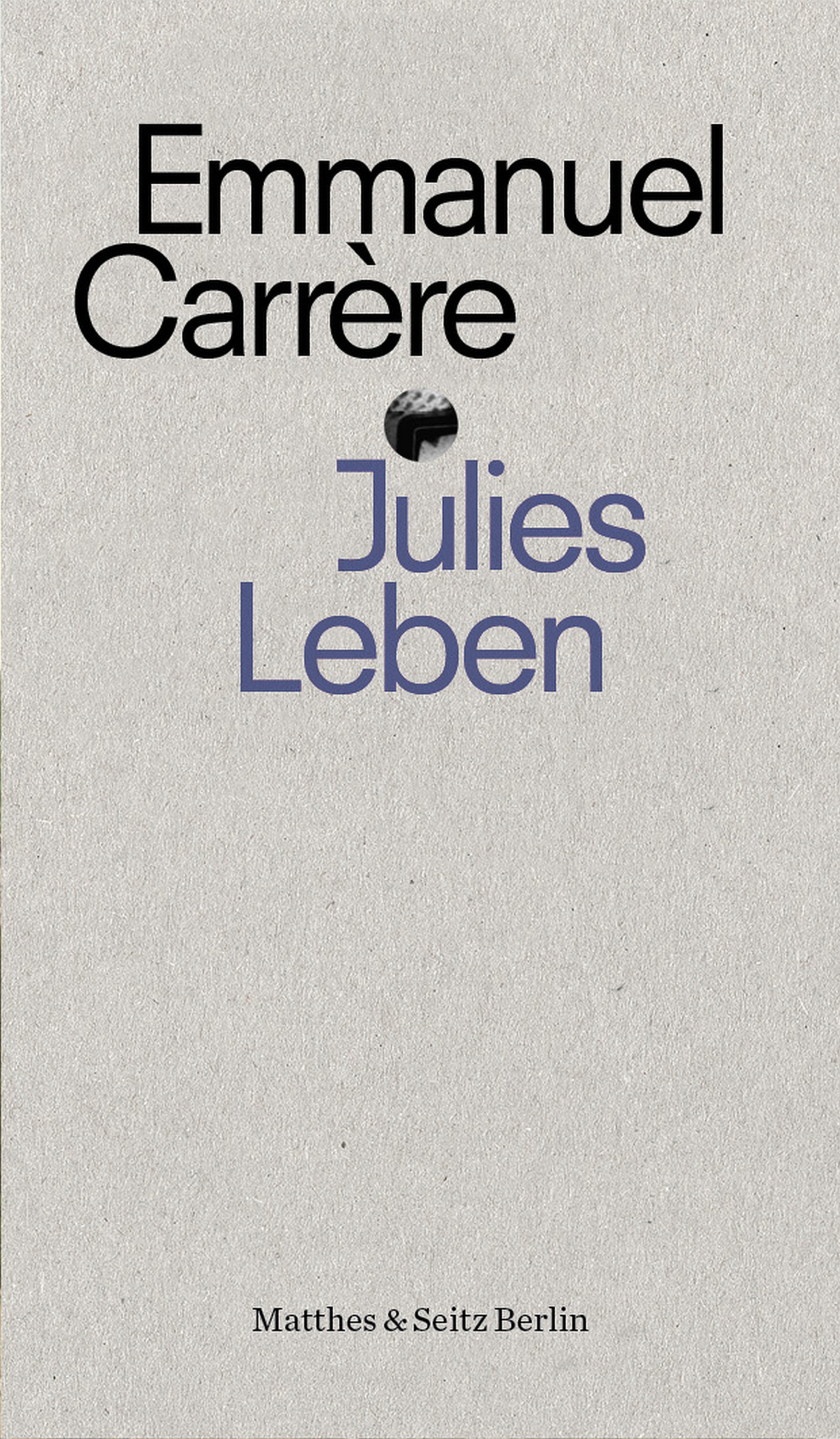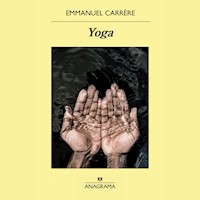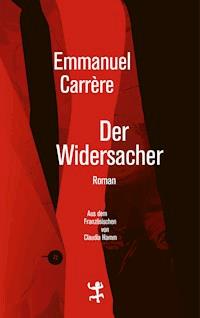
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit einem Gespräch zwischen Emmanuel Carrère und Claudia Hamm Jean-Claude Romand scheint sein Leben im Griff zu haben. Nachbarn und Bekannte schätzen den erfolgreichen Arzt, seine Bescheidenheit und Intelligenz. Doch plötzlich ermordet er seine Frau und seine beiden kleinen Kinder, seine Eltern und deren Hund. Der Versuch, seine Geliebte und sich selbst zu töten, misslingt, möglicherweise gewollt. Die Ermittlungen der Polizei lassen innerhalb von wenigen Stunden die äußere Fassade einstürzen, dahinter gähnt Leere: Romands Leben ist seit 17 Jahren auf Lügen und Betrug gebaut. »Seine Forscherstelle bei der WHO, Geschäftsreisen, Konferenzen mit hochrangigen Kollegen – all das hatte es nie gegeben.« Und niemand hatte je Verdacht geschöpft. Die Nachricht geht durch die Presse und veranlasst Carrère zu seinem ersten Tatsachenroman. Doch nicht die Fakten ziehen ihn in den Bann, sondern die dunklen Triebkräfte dahinter, »der Widersacher«. Er schreibt Romand, trifft ihn, wohnt seinem Prozess bei, befragt ehemalige Freunde, versucht zu verstehen. Mit einem schonungslosen Blick für die Abgründe unserer Psyche und die Rolle des Sprechens und Schweigens zeigt Emmanuel Carrère die Zerbrechlichkeit unserer sozialen Maske – in einer direkten, rohen Sprache, die seine eigene Fassungslosigkeit spürbar macht und von Claudia Hamm für die Neuausgabe kongenial ins Deutsche übertragen wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EMMANUEL CARRÈRE
DER WIDERSACHER
Aus dem Französischenvon Claudia Hamm
Mit einem Gespräch zwischenEmmanuel Carrère und Claudia Hamm
Während Jean-Claude Romand am Samstagmorgen, den 9. Januar 1993, seine Frau und seine Kinder tötete, saß ich mit meinen in einer Versammlung der Schule unseres älteren Sohnes. Gabriel war fünf Jahre alt, genauso alt wie Antoine Romand. Danach gingen wir zu meinen Eltern mittagessen und Romand ging zu seinen und brachte sie nach dem Essen um. Den Samstagnachmittag und Sonntag, die sonst unserem Familienleben vorbehalten sind, verbrachte ich allein in meiner Arbeitswohnung, denn ich beendete gerade ein Buch, an dem ich seit einem Jahr saß: eine Biografie über den Science-Fiction-Autor Philip K. Dick. Das letzte Kapitel schilderte die Tage vor seinem Tod, die er im Koma verbracht hatte. Am Dienstagabend setzte ich den Schlusspunkt und am Mittwochmorgen las ich in der Libération den ersten Artikel über den Fall Romand.
Inhalt
Der Widersacher
Anhang
Luc Ladmiral wurde am Montagmorgen kurz nach vier durch einen Anruf von Cottin, dem Apotheker von Prévessin, geweckt. Bei den Romands brannte es, die Freunde sollten versuchen zu retten, was noch zu retten war. Als er eintraf, trugen die Feuerwehrmänner gerade die Leichen aus dem Haus. Nie wird er den Anblick der grauen, versiegelten Plastiksäcke vergessen, in die man die Kinder gesteckt hatte, es war entsetzlich. Florence war nur mit einem Mantel zugedeckt. Ihr rußgeschwärztes Gesicht war unverletzt. Als Luc ihr mit einer trostlosen Abschiedsgeste übers Haar strich, stießen seine Finger auf etwas Merkwürdiges. Er tastete den Kopf der jungen Frau ab, wendete ihn vorsichtig um und rief dann einen Feuerwehrmann, um ihm eine klaffende Wunde am Hinterkopf zu zeigen. Wahrscheinlich hat sie einen Balken abbekommen, erklärte der Feuerwehrmann, schließlich ist der halbe Dachstuhl eingestürzt. Dann stieg Luc in den roten Transporter, in den man Jean-Claude, den einzigen Überlebenden der Familie, gelegt hatte. Sein Puls war schwach. Er trug einen Schlafanzug, war bewusstlos und verbrannt, doch bereits kalt wie ein Toter.
Der Krankenwagen traf ein und brachte Jean-Claude ins Genfer Krankenhaus. Draußen war es dunkel und frostig, und alle waren vom Wasser der in die Flammen gerichteten Strahlrohre durchnässt. Da rund ums Haus nichts mehr auszurichten war, fuhr Luc zu den Cottins, um sich aufzuwärmen. Im gelblichen Licht der Küchenlampe hörten sie dem Schluchzen der Kaffeemaschine zu und wagten nicht, einander anzusehen. Als sie die Tassen hoben und die unerträglich lärmenden Löffel kreisen ließen, zitterten ihre Hände. Dann fuhr Luc nach Hause und überbrachte Cécile und den Kindern die Nachricht. Sophie, die Älteste, war Jean-Claudes Patenkind. Nur wenige Tage zuvor hatte sie noch, wie so oft, bei den Romands übernachtet, sie hätte ebenso gut diese Nacht dort übernachtet haben und jetzt auch in einem grauen Sack stecken können.
Seit ihrem Medizinstudium in Lyon waren Luc und Jean-Claude unzertrennlich gewesen. Sie hatten fast zur gleichen Zeit geheiratet, ihre Kinder waren zusammen aufgewachsen. Jeder kannte das Leben des anderen in- und auswendig, sowohl die äußere Fassade als auch die Geheimnisse – Geheimnisse rechtschaffener, bodenständiger Männer, die für Versuchungen umso anfälliger sind. Als Jean-Claude ihm eine Affäre gestanden und davon gesprochen hatte, alles dafür aufzugeben, war Luc es gewesen, der ihn zur Vernunft gebracht hatte: »Unter der Bedingung, dass du dasselbe für mich tust, wenn ich mich mal wie ein Idiot aufführe.« Eine solche Freundschaft gehört zu den Dingen im Leben, die fast so wertvoll sind wie eine glückliche Ehe, und Luc war sich immer sicher gewesen, dass sie irgendwann einmal sechzig oder siebzig werden und vom Gipfel all dieser Jahre wie von einem Berg auf den gemeinsamen Weg zurückblicken würden: auf die Orte, an denen sie gestolpert und fast in die Irre gegangen waren, auf die Hilfe, die sie sich entgegengebracht, und die Art, wie sie sich schließlich wieder herauslaviert hatten. Ein Freund, ein echter Freund, ist auch ein Zeuge, einer, dessen Blick das eigene Leben besser zu beurteilen erlaubt, und seit zwanzig Jahren hatte jeder für den anderen zuverlässig und ohne großes Aufheben diese Rolle eingenommen. Ihre Leben ähnelten einander, wenn sie auch nicht gleichermaßen erfolgreich verlaufen waren. Jean-Claude hatte es zum weithin anerkannten Forscher gebracht, der mit Ministern verkehrte und an internationalen Konferenzen teilnahm, während Luc praktischer Arzt in Ferney-Voltaire geworden war. Doch er war nicht eifersüchtig. Das Einzige, was sie in den letzten Monaten ein wenig entzweit hatte, war eine absurde Meinungsverschiedenheit über die Schule gewesen, die ihre Kinder besuchten. Jean-Claude war aus unerfindlichen Gründen plötzlich aus der Haut gefahren, sodass er, Luc, den ersten Schritt hatte tun und an ihn appellieren müssen, man werde sich doch wegen einer solchen Lappalie nicht entzweien. Die Geschichte hatte ihm zugesetzt; er und Cécile hatten mehrere Abende hintereinander darüber gesprochen. Wie lächerlich das jetzt alles war! Wie zerbrechlich das Leben doch ist! Gestern noch eine glücklich zusammenlebende Familie, Menschen, die sich liebten, und heute ein Gasunfall und verkohlte Körper, die man in die Leichenhalle trug … Florence und seine Kinder waren für Jean-Claude alles gewesen. Wie würde sein Leben aussehen, wenn er nicht starb?
Luc rief die Notaufnahme in Genf an: Man hatte den Verletzten in eine Dekompressionskammer gelegt. Seine Überlebenschancen waren mäßig.
Luc betete mit Cécile und den Kindern, er möge nicht wieder zu Bewusstsein kommen.
Als Luc am Morgen seine Praxis öffnen wollte, erwarteten ihn zwei Polizisten. Ihre Fragen erschienen ihm abstrus. Sie wollten wissen, ob die Romands Feinde hätten oder verdächtigen Aktivitäten nachgingen. Da er völlig entgeistert reagierte, enthüllten sie ihm die Wahrheit: Eine erste Untersuchung der Leichname hatte ergeben, dass sie bereits vor dem Brand gestorben waren, Florence durch Verletzungen am Kopf durch einen stumpfen Gegenstand, Antoine und Caroline durch Schüsse.
Das war noch nicht alles. In Clairvaux-les-Lacs im Jura war der Onkel von Jean-Claude damit beauftragt gewesen, dessen Eltern, alten, gebrechlichen Leuten, die Nachricht von der Katastrophe zu überbringen. In Begleitung ihres Hausarztes war er zu ihnen gegangen. Das Haus war verschlossen gewesen, der Hund hatte nicht angeschlagen. Besorgt hatte er die Tür aufgebrochen und seinen Bruder, seine Schwägerin und ihren Hund in einem Blutbad vorgefunden. Auch sie waren erschossen worden.
Ermordet. Die Romands waren ermordet worden. Das Wort hallte in Lucs verstörtem Kopf wider. »Ist etwas gestohlen worden?«, fragte er, als könnte dieses Wort den Horror des anderen auf etwas Rationales zurechtstutzen. Die Polizisten waren sich noch nicht sicher, doch zwei Verbrechen in einer Entfernung von 80 Kilometern, deren Opfer Mitglieder ein und derselben Familie waren, das ließ eher an einen Rache- oder Vergeltungsakt denken. Sie warfen noch einmal die Frage nach möglichen Feinden auf, doch Luc schüttelte ratlos den Kopf: Feinde? Die Romands? Jeder hatte sie gemocht. Wenn sie ermordet worden waren, dann ganz bestimmt durch Leute, die sie nicht gekannt hatten.
Die Polizeibeamten fragten sich, welchen Beruf genau Jean-Claude ausübe. Arzt, hätten die Nachbarn geantwortet, doch er besitze ja keine Praxis. Luc erklärte ihnen, Jean-Claude sei Forscher bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Einer der Polizisten rief dort an und verlangte jemanden zu sprechen, der mit Doktor Romand zusammenarbeitete, seine Sekretärin oder einen seiner Mitarbeiter. Die Telefonistin kannte keinen Doktor Romand. Da ihr Gesprächspartner nicht locker ließ, stellte sie ihn zum Personalchef durch, der seine Kartei durchforstete und bestätigte: Bei der WHO gab es keinen Doktor Romand.
Da wurde Luc alles klar und er fühlte sich ungeheuer erleichtert. Alles, was seit vier Uhr morgens passiert war, der Anruf von Cottin, die Feuersbrunst, Florences Verletzungen, die grauen Säcke, Jean-Claude in der Kammer für Brandopfer und schließlich die Geschichte mit den Morden, all das hatte sich mit unglaublicher Wahrscheinlichkeit abgespielt und so real gewirkt, dass es nicht den geringsten Anlass zum Zweifeln gegeben hatte, doch jetzt, Gott sei Dank, entgleiste das ganze Drehbuch und gab sich als das zu erkennen, was es war: ein Albtraum. Bald würde er in seinem Bett aufwachen. Er fragte sich, ob er sich an alles würde erinnern können und es wagen, Jean-Claude davon zu erzählen. »Ich habe geträumt, dass dein Haus brennt, dass deine Frau, deine Kinder und deine Eltern ermordet wurden, dass du im Koma liegst und bei der WHO dich niemand kennt.« Kann man einem Freund, selbst seinem besten Freund, so etwas erzählen? Die Vorstellung schoss ihm in den Kopf – sie sollte ihn auch weiter umtreiben –, Jean-Claude sei in diesem Traum nur sein Double und es offenbarten sich darin die Ängste, die er eigentlich selbst hegte: seine Familie zu verlieren, aber auch, sich selbst zu verlieren und festzustellen, dass er hinter seiner sozialen Fassade niemand war.
Im Laufe des Tages wurde die Wirklichkeit noch albtraumhafter. Nachdem man ihn am Nachmittag ins Polizeirevier bestellt hatte, erfuhr Luc innerhalb von fünf Minuten, man habe in Jean-Claudes Auto eine handgeschriebene Mitteilung gefunden, in der dieser sich der Verbrechen für schuldig erkläre und bekenne, alles, was man über seine Karriere und seine beruflichen Aktivitäten zu wissen geglaubt habe, sei eine Täuschung gewesen. Ein paar Anrufe und allgemeine Überprüfungen hätten genügt, um die Maske abzureißen. Man habe die WHO angerufen: Niemand dort kenne ihn. Im Ärzteverzeichnis sei er nicht eingetragen. In den Pariser Krankenhäusern, wo er angeblich Assistenzarzt war, sei sein Name in keiner Liste zu finden und ebenso wenig in denen der medizinischen Fakultät von Lyon, obwohl Luc selbst und mehrere andere doch schworen, dort mit ihm studiert zu haben. Tatsächlich habe er dort zu studieren begonnen, doch vom Ende des zweiten Studienjahres an habe er keine Prüfungen mehr absolviert, und von da an sei alles gelogen gewesen.
Zuerst weigerte Luc sich schlicht und einfach, das zu glauben. Wenn einer daherkommt und einem sagt, der beste Freund, Patenonkel der eigenen Tochter und der aufrichtigste Mensch, den man kennt, habe seine Frau, seine Kinder und seine Eltern umgebracht und einen darüber hinaus seit Jahren in Bezug auf alles und jeden belogen, ist es doch normal, ihm trotz schlagender Beweise weiter zu vertrauen, oder? Was wäre eine Freundschaft, die sich so leicht des Irrtums überführen ließe? Jean-Claude konnte kein Mörder sein. Sicher fehlte ein Teil in diesem Puzzle. Man würde es finden, und alles ergäbe einen anderen Sinn.
Für die Ladmirals vergingen diese Tage wie eine übernatürliche Prüfung. Jesus’ Jünger hatten mitangesehen, dass man diesen wie einen gemeinen Verbrecher festgenommen, verurteilt und zu Tode gefoltert hatte, und doch, auch wenn Petrus eingeknickt war, hatten sie weiter an ihn geglaubt. Am dritten Tag wussten sie dann, dass es richtig gewesen war. Auch Cécile und Luc kämpften nach Kräften. Doch am dritten Tag, und sogar schon vorher, mussten sie zugeben, dass ihre Hoffnung vergeblich gewesen war und sie fortan nicht nur mit dem Verlust derer würden leben müssen, die gestorben waren, sondern auch mit der Trauer um ihr verlorenes Vertrauen und ein vollständig von der Lüge vergiftetes Leben.
Hätten sie wenigstens ihre Kinder davor bewahren können! Ihnen nur sagen – das war schließlich schrecklich genug –, Antoine und Caroline seien mit ihren Eltern bei einem Brand umgekommen. Doch alles Flüstern half nichts. Binnen weniger Stunden war das Dorf von Journalisten, Fotografen und Fernsehleuten überschwemmt, die jeden, selbst die Schüler, mit Fragen bestürmten. Spätestens am Dienstag wussten alle, dass Antoine, Caroline und ihre Mama von ihrem Papa ermordet worden waren und dieser dann ihr Haus angezündet hatte. Viele begannen nachts zu träumen, auch ihr Haus brenne und ihr Papa tue dasselbe wie der von Antoine und Caroline. Luc und Cécile hockten sich an den Rand der Matratzen, die sie nebeneinandergelegt hatten, denn keiner traute sich mehr, allein zu schlafen, und so zwängte man sich zu viert ins Elternschlafzimmer. Sie wussten zwar noch nicht, was sie den Kindern hätten erklären können, doch sie wiegen und liebkosen oder wenigstens zu beruhigen versuchen konnten sie. Dennoch spürten sie, dass ihre Worte nicht mehr dieselbe magische Kraft hatten wie zuvor. Ein Zweifel hatte sich eingenistet, den nichts auszutreiben vermochte, höchstens die Zeit. Und das bedeutete, dass ihnen die Kindheit geraubt worden war, den Kindern wie den Eltern. Nie wieder würden sich die Kleinen in ihren Armen mit diesem wunderbaren, in ihrem Alter in normalen Familien normalen Vertrauen fallen lassen, und bei dem Gedanken, was unwiederbringlich zerstört war, kamen Luc und Cécile endlich die Tränen.
Gleich am ersten Abend hatte sich ihr Freundeskreis bei ihnen eingefunden, und so ging es eine Woche lang jeden Abend weiter. Bis drei, vier Uhr morgens blieb man zusammen und versuchte gemeinsam, dem Schlag standzuhalten. Man vergaß zu essen, trank zu viel, und mehrere fingen wieder an zu rauchen. Diese Nachtwachen waren keine Totenwachen, es waren sogar die lebendigsten Abende, die man je in diesem Haus erlebt hatte, denn der Schock saß so tief und entlud sich in einem solchen Mahlstrom von Fragen und Zweifeln, dass er die Trauer unterlief. Jeder begab sich mindestens einmal täglich aufs Polizeirevier, entweder weil er vorgeladen war, oder um sich nach dem neuesten Stand der Ermittlungen zu erkundigen, und die ganze Nacht lang diskutierte man darüber, verglich die Auskünfte und stellte Vermutungen an.
Das Pays de Gex ist eine weite, etwa dreißig Kilometer lange Ebene, die vom Fuß der Berge des Jura bis zum Ufer des Genfer Sees reicht. Auch wenn es auf französischem Staatsgebiet liegt, ist es eigentlich Teil des Speckgürtels um Genf: eine Zusammenballung von wohlhabenden Dörfer, in denen sich eine Kolonie von internationalen Beamten angesiedelt hat, die in der Schweiz arbeiten, in Schweizer Franken bezahlt werden und zumeist nicht der Steuer unterliegen. Sie alle pflegen einen ähnlichen Lebensstil: Sie wohnen in alten Bauernhäusern, die in komfortable Villen umgebaut wurden, der Mann fährt morgens mit einem Mercedes ins Büro, seine Frau geht mit einem Volvo ihren Besorgungen und diversen Vereinstätigkeiten nach, und die Kinder besuchen die kostspielige Privatschule École Saint-Vincent im Schatten des Voltaire-Schlosses. Jean-Claude und Florence waren bekannte und geschätzte Mitglieder dieser Community und hatten ihre feste Rolle darin, sodass sich alle, die sie kannten, nun fragten: Woher hatten sie das Geld? Wenn Jean-Claude nicht der war, für den er sich ausgegeben hatte, wer war er dann?
Kaum dass der stellvertretende Staatsanwalt mit dem Fall betraut worden war, erklärte er den Journalisten, er sei »auf alles gefasst«, und nach einer ersten Prüfung der Bankauszüge, das Motiv für die Verbrechen sei »die Befürchtung des falschen Arztes« gewesen, »er könnte entlarvt und damit ein bislang undurchsichtiger Handel abrupt beendet werden, in dem er eine treibende Kraft war und aus dem er seit Jahren hohe Geldsummen bezog.« Diese Erklärung beflügelte die Fantasie. Man erging sich in Spekulationen über Waffen-, Devisen-, Organ- und Drogenhandel. Über eine mächtige kriminelle Organisation mit Umtrieben im zerbröckelnden ex-sozialistischen Ostblock. Über Verbindungen zur russischen Mafia – schließlich war Jean-Claude oft auf Reisen gewesen. Im letzten Jahr war er nach Leningrad geflogen und hatte seinem Patenkind Sophie eine Matrjoschka mitgebracht. In einem Anfall von Verfolgungswahn fragten sich Luc und Cécile, ob diese Puppe vielleicht kompromittierende Dokumente, Mikrofilme oder Mikroprozessoren enthielt und die Mörder von Prévessin und Clairvaux möglicherweise danach gesucht hatten. Denn Luc, auch wenn er damit zunehmend allein stand, wollte immer noch an eine Intrige glauben: Vielleicht war Jean-Claude ein Wissenschafts- oder Wirtschaftsspion, der geheime Informationen schmuggelte, doch seine Familie konnte er nicht ermordet haben. Man hatte sie ermordet, man hatte Beweise gefälscht, um die Verbrechen auf ihn abzuwälzen, man war sogar so weit gegangen, die Spuren seiner Vergangenheit auszuradieren.
»Ein banaler Unfall, eine Ungerechtigkeit kann einen in den Wahnsinn treiben. Vergib mir, Corinne, vergebt mir, meine Freunde, verzeiht, ihr rechtschaffenen Leute des Verwaltungsrats, die ihr mir eine aufs Maul hauen wolltet.«
So lautete der Abschiedsbrief, den man im Auto gefunden hatte. Was für ein banaler Unfall? Welche Ungerechtigkeit?, fragten sich »die Freunde«, die sich abends bei den Ladmirals trafen. Einige von ihnen gehörten auch zu den »rechtschaffenen Leuten«, den Mitgliedern des aus Eltern bestehenden Verwaltungsrats der Schule – und von diesen ließen die Polizisten nun nicht mehr ab. Jeder von ihnen musste ausführlich zu dem Streit aussagen, der zu Beginn des letzten Schuljahrs um die Auswechslung des Direktors entbrannt war. Und die Beamten hörten argwöhnisch zu. War das etwa die Ungerechtigkeit gewesen, die das Drama ins Rollen gebracht hatte? Die Vereinsmitglieder waren fassungslos: Gut, man hatte gestritten, vielleicht hatte sogar jemand gedroht, Jean-Claude eine aufs Maul zu hauen, aber eine Verbindung zwischen diesem Streit und dem Massaker an einer ganzen Familie zu ziehen, das war doch verrückt! Ja, gaben die Polizisten zu, das war verrückt, trotzdem bestand da wohl ein Zusammenhang.
Corinne wiederum, die in den Zeitungen nicht namentlich genannt werden durfte und deshalb als »geheimnisvolle Geliebte« bezeichnet wurde, machte eine erschütternde Aussage. Am letzten Samstag hatte Jean-Claude sie in Paris getroffen, um sie zu einem Abendessen bei seinem Freund Bernard Kouchner in Fontainebleau mitzunehmen. Der Autopsie nach hatte er nur wenige Stunden zuvor seine Frau, seine Kinder und seine Eltern ermordet. Doch davon hatte sie natürlich nichts geahnt. In einem abgelegenen Waldstück hatte er versucht, auch sie umzubringen. Sie hatte sich gewehrt, woraufhin er von ihr abgelassen, sie nach Hause gefahren und ihr erklärt hatte, er sei schwer krank und das sei der Grund für seinen Tobsuchtsanfall gewesen. Als sie am Montag von dem Massenmord erfuhr und begriff, dass sie beinahe dessen sechstes Opfer geworden wäre, rief sie selbst die Polizei an, die ihrerseits Kouchner vernahm. Dieser hatte nie von einem Doktor Romand gehört und besaß auch kein Haus in Fontainebleau.
Jeder in Ferney kannte Corinne, denn bevor sie sich hatte scheiden lassen und nach Paris gezogen war, hatte sie dort gewohnt. Keiner jedoch wusste, dass sie ein Verhältnis mit Jean-Claude hatte – außer Luc und seine Frau, die deshalb nicht viel von ihr hielten. Sie betrachteten sie als Unruhestifterin, die lauter Unsinn in die Welt zu setzen vermochte, nur um sich interessant zu machen. Doch da die Hypothese eines Racheakts immer unwahrscheinlicher wurde, trat nun die eines Verbrechens aus Leidenschaft an ihre Stelle. Luc erinnerte sich an Jean-Claudes Geständnis und an die tiefe Depression, in die ihn die Trennung von Corinne gestürzt hatte. Er konnte sich gut vorstellen, dass diese Beziehung, falls sie wieder aufgeflammt war, seinen Freund in den Wahnsinn getrieben hatte: das Hin und Her zwischen Ehefrau und Geliebter, die Spirale von Lügen und darüber hinaus die durch die Krankheit ausgelöste Angst … Denn auch ihm hatte Jean-Claude offenbart, er sei an Krebs erkrankt und deswegen bei einem Professor Schwartzenberg in Paris in Behandlung. Luc hatte den Polizisten davon erzählt und diese die Aussage überprüft: Professor Schwartzenberg kannte Jean-Claude ebenso wenig wie Kouchner, und die Ermittlungen, die auf die Krebsstationen sämtlicher französischer Krankenhäuser ausgeweitet wurden, förderten nirgends eine Krankenakte auf den Namen Jean-Claude Romand zutage.
Corinne ließ durch ihren Anwalt erwirken, dass man sie in der Presse nicht mehr als die Geliebte des Ungeheuers bezeichnen durfte, sondern nur noch als eine Freundin. Dann erfuhr man, dass sie ihm Ersparnisse im Wert von 900 000 Francs anvertraut hatte, um diese in der Schweiz für sie anzulegen, und dass er sie stattdessen veruntreut hatte. Der geheimnisvolle Devisenhandel schrumpfte auf eine simple Unterschlagung zusammen. Nun war nicht mehr von Spionage und großem Bandengeschäft die Rede. Stattdessen gingen die Ermittlungsbeamten davon aus, dass Romand das Vertrauen mehrerer Leute aus seiner Umgebung missbraucht hatte – und die Journalisten deuteten an, diese hätten nicht gewagt, sich zu beklagen, weil die Anlagen, mit denen er sie gelockt hatte, illegal gewesen seien, was wohl auch erkläre, warum sich der Kreis der Ferneyer Notabeln so bedeckt halte … Solche Unterstellungen brachten Luc zur Weißglut. Als »bester Freund« des Mörders hatte er ständig mit Typen in Lederjacken zu tun, die mit Presseausweisen wedelten, ihm Mikrofone unter die Nase hielten und kleine Vermögen boten, damit er sein Fotoalbum für sie öffne. Um das Andenken an die Toten nicht zu beschmutzen, hatte er sie systematisch davongejagt – und das Ergebnis war, dass man ihn der Steuerhinterziehung verdächtigte.
Andere Enthüllungen kamen von den Crolets, Florences Angehörigen, die in Annecy lebten und mit den Ladmirals gut bekannt waren. Auch sie hatten Jean-Claude Geld anvertraut: die Rentenzulage des Vaters und nach dessen Tod eine Million Francs aus dem Verkauf seines Hauses. Nicht nur war ihnen bewusst geworden, dass dieses Geld, die Frucht eines ganzen Arbeitslebens, endgültig verloren war, sondern auch ein quälender Zweifel mischte sich in ihre Trauer und höhlte sie aus: Herr Crolet war durch einen Sturz von der Treppe gestorben, nachdem er mit Jean-Claude allein gewesen war. Hatte dieser etwa auch seinen Schwiegervater umgebracht?
Jeder fragte sich: Wie hatten wir so lange in der Nähe dieses Mannes leben können, ohne irgendetwas zu merken? Jeder wühlte in seinen Erinnerungen nach einem Moment, in dem Zweifel wach geworden waren – oder hätten wachwerden müssen. Der Vorsitzende des Elternvereins erzählte jedem, wie er im Telefonverzeichnis der Internationalen Organisationen vergeblich nach Jean-Claudes Namen gesucht hatte. Luc erinnerte sich, einige Monate zuvor dieselbe Idee gehabt zu haben, nachdem er von Florence erfahren hatte, dass sein Freund bei der Assistenzarztprüfung in Paris seinerzeit Fünfter geworden war. Nicht sein Erfolg hatte ihn stutzig gemacht, sondern die Tatsache, damals nichts davon erfahren zu haben. Warum hatte er ihm nichts erzählt? Als er Jean-Claude danach gefragt und einen Geheimniskrämer geschimpft hatte, hatte dieser bloß mit den Schultern gezuckt, geantwortet, er habe eben keine Staatsaffäre daraus machen wollen, und das Thema gewechselt. Diese seine Fähigkeit, das Gespräch umzulenken, sobald es auf ihn fiel, war ganz außerordentlich. Er tat das so geschickt, dass man sich dessen nicht einmal bewusst wurde, und falls man darüber nachdachte, bewunderte man sogar seine Zurückhaltung, Bescheidenheit und Bemühtheit, eher den anderen Wertschätzung entgegenzubringen als sich selbst welche zu verschaffen. Luc hatte dennoch das vage Gefühl gehabt, irgendetwas an dem, was er über seine Karriere behauptete, stimme nicht. Er hatte überlegt, ob er bei der WHO anrufen solle, um herauszufinden, was genau er dort tat. Doch dann war es ihm absurd erschienen. Und jetzt sagte er sich immer wieder, hätte er es getan, wären die Dinge vielleicht anders gelaufen.
»Vielleicht«, erwiderte Cécile, als er sie wegen dieser Gewissensbisse ins Vertrauen zog, »aber vielleicht hätte er dann auch dich umgebracht.«
Wenn sie tief in der Nacht über ihn sprachen, gelang es ihnen nicht mehr, ihn Jean-Claude zu nennen. Sie nannten ihn auch nicht Romand. Er befand sich irgendwo jenseits von Leben und Tod, er hatte keinen Namen mehr.
Nach drei Tagen erfuhren sie, dass er überleben würde.
Die Nachricht wurde am Donnerstag bekannt und sie lastete schwer auf der Trauerfeier für Romands Eltern, die am nächsten Tag in Clairvaux-les-Lacs stattfand. Die für Florence und die Kinder war bis zum Abschluss der Obduktion aufgeschoben worden. Beide Umstände machten die Feierlichkeit noch unerträglicher. Wie sollte man den Worten von Frieden und Ruhe Glauben schenken, die der Pfarrer sich auszusprechen zwang, während man bei Regen die Särge in die Erde hinabließ? Niemandem gelang es, sich zu fangen und irgendwo in sich einen Winkel der Ruhe und der hinnehmbaren Trauer zu finden, in den die Seele hätte flüchten können. Auch Luc und Cécile waren gekommen, aber da sie Jean-Claudes Familie kaum kannten, hielten sie sich im Abseits. Die roten, rauen Gesichter dieser Bauern aus dem Jura waren von Schlaflosigkeit, Todesgedanken, Ablehnung und einer Scham gezeichnet, gegen die man nichts auszurichten vermag. Jean-Claude war der Stolz des Dorfes gewesen. Man hatte ihn bewundert, es so weit gebracht zu haben und doch so bodenständig und seinen alten Eltern so verbunden geblieben zu sein. Jeden Tag hatte er sie angerufen. Man hatte einander erzählt, wie er einen angesehenen Posten in Amerika ausgeschlagen habe, um weiter in ihrer Nähe zu leben. Die Zeitung Le Progrès veröffentlichte auf den beiden Seiten, die sie täglich diesem Fall widmete, ein Foto, das in der sechsten Klasse im Gymnasium von Clairvaux aufgenommen worden war und ihn sanft lächelnd in der ersten Reihe zeigte. Die Bildunterschrift lautete: »Wer hätte geglaubt, dass aus dem Musterschüler ein Monster würde?«
Dem Vater war in den Rücken, der Mutter in die Brust geschossen worden. Ihr also mit Sicherheit, vielleicht aber auch beiden war demnach bewusst gewesen, dass sie durch die Hand ihres Sohnes starben, sodass sie im selben Augenblick sowohl ihrem Tod ins Auge sahen – jenem, dem wir alle entgegenblicken und der sie in einem Alter ereilte, in dem er keinen Skandal darstellt – als auch der Auslöschung all dessen, was ihrem Leben Sinn, Freude und Würde verliehen hatte. Der Priester versicherte, nun würden sie Gott schauen. Für Gläubige ist der Tod der Augenblick, da man Gott sieht, und zwar nicht mehr »durch den Spiegel eines dunklen Worts«, sondern von Angesicht zu Angesicht. Selbst jene, die nicht glauben, glauben an irgendetwas dieser Art: dass Sterbende in dem Augenblick, da sie von der einen Seite auf die andere wechseln, blitzartig den ganzen, endlich verständlichen Film ihres Lebens vorbeiziehen sehen. Und diese Schau, die für die alten Romands die Fülle alles Gelungenen hätte beinhalten müssen, war stattdessen zum Triumph der Lüge und des Bösen geworden. Sie hätten Gott schauen sollen und stattdessen hatten sie, mit den Gesichtszügen ihres geliebten Sohnes, denjenigen gesehen, den die Bibel Satan nennt. Den Widersacher.
Man konnte an nichts anderes mehr denken als an den bestürzten Ausdruck verratener Kinder in den Augen der beiden Alten, an die kleinen, halbverkohlten Körper von Antoine und Caroline, die im Leichenschauhaus aufgebahrt neben ihrer Mutter lagen, und schließlich an den anderen, schweren, schlaffen Körper, den des Mörders, der allen doch so nah und vertraut gewesen und nun so ungeheuer fremd geworden war und der langsam begann, sich in seinem Krankenhausbett ein paar Kilometer entfernt wieder zu regen. Er leide noch an den Verbrennungen, sagten die Ärzte, und an den Vergiftungserscheinungen durch die Barbiturate und den eingeatmeten Rauch, doch im Laufe des Wochenendes sollte er wieder voll zu Bewusstsein kommen und ab Montag vernehmungsfähig sein. Kurz nach dem Inferno, als man es noch für einen Unfall gehalten hatte, hatten Luc und Cécile gebetet, er möge sterben, damals war das zu seinem Besten gedacht. Jetzt beteten sie ebenfalls, er möge sterben, doch jetzt war es ihretwegen, wegen ihrer Kinder und all jener, die noch lebten. Dass er, der menschgewordene Tod, weiter in der Welt der Lebenden bleiben sollte, war eine entsetzliche, lauernde Bedrohung, war die Gewissheit, dass nie wieder Frieden einkehren werde und der Schrecken ohne Ende sei.
Am Sonntag erklärte einer von Lucs sechs Brüdern, Sophie brauche einen neuen Patenonkel. Er bot sich selbst an und fragte sie weihevoll, ob sie einverstanden sei. Mit dieser Familienfeier begann ihre Trauer.
Im letzten Herbst stand Déa kurz davor, an ihrer Aids-Erkrankung zu sterben. Déa war keine nahe Freundin, aber eine der besten Freundinnen von Elisabeth, die eine unserer besten Freundinnen war. Déa war schön, auf eine leicht irritierende Weise, was die Krankheit zusätzlich unterstrich, und hatte eine rehbraune Mähne, die sie mit Stolz erfüllte. Da sie zum Ende hin sehr fromm geworden war, hatte sie eine Art Altar bei sich aufgebaut, auf dem Kerzen Ikonen erleuchteten. Eines Nachts setzte eine Kerze Déas Haare in Brand und sie loderte wie eine Fackel. Man brachte sie ins Krankenhaus Saint-Louis, auf die Station für Schwerbrandverletzte. Verbrennungen dritten Grades auf der Hälfte ihres Körpers: Sie würde also nicht an Aids sterben, und vielleicht hatte sie das ja gewollt. Doch sie starb nicht sofort, ihr Ende zog sich fast eine Woche hin, und in dieser Woche ging Elisabeth sie jeden Tag besuchen, das heißt, sie besuchte das, was von ihr übrig geblieben war. Und danach kam sie zu uns, um zu trinken und darüber zu sprechen. Sie erzählte, eine Station für Schwerstverbrannte sei auf ihre Weise schön. Überall weiße Vorhänge, Gaze und Stille, man wähne sich in einem Dornröschenschloss. Von Déa sehe man nur eine weißumwickelte Gestalt, und wäre sie tot, wäre das fast beruhigend. Das Grauenhafte sei, dass sie noch lebe. Die Ärzte beteuerten, sie habe kein Bewusstsein dafür, und Elisabeth, die absolut nicht gläubig ist, betete nachts, das möge wahr sein. Ich war damals mit meiner Biografie über Dick bei dem Zeitpunkt angelangt, da dieser den furchteinflößenden Roman Ubik schreibt und sich vorstellt, was im Gehirn von Leuten vor sich geht, die durch Kältetechnik konserviert werden: irrlichternde Gedankensplitter aus verwüsteten Erinnerungsbeständen, das beharrliche Nagen der Entropie, Kurzschlüsse, die Funken von panischer Hellsicht verursachen, all das, was die friedliche, regelmäßige Linie eines fast kurvenlosen Elektroenzephalogramms verbirgt. Ich trank und rauchte zu viel und fühlte mich die ganze Zeit, als schreckte ich plötzlich aus dem Schlaf hoch. Eines Nachts wurde es unerträglich. Ich stand auf, legte mich wieder zu der schlafenden Anne zurück, wälzte mich mit verkrampften Muskeln und verdrillten Nerven hin und her. Ich glaubte, nie zuvor in meinem Leben eine solche körperliche und seelische Not empfunden zu haben, wobei Not ein zu schwaches Wort war: Ich spürte das unsagbare Grauen eines lebendig Begrabenen in mir aufsteigen, mich überfluten und fast ersticken. Nach mehreren Stunden löste sich plötzlich alles auf. Alles strömte wieder frei, und mir wurde bewusst, dass ich weinte, dicke, warme Tränen, vor Freude. Niemals zuvor hatte ich eine solche Not empfunden und niemals ein solches Gefühl von Befreiung. Einen Moment lang badete ich verständnislos in diesem Fruchtblasenglück, dann begriff ich. Ich schaute auf die Uhr. Am nächsten Morgen rief ich Elisabeth an. Ja, Déa war gestorben. Ja, am Morgen, kurz vor vier.
Nur er, der noch im Koma lag, wusste nicht, dass er lebte und dass die, die er liebte, tot waren, von seiner Hand gestorben. Doch diese Bewusstlosigkeit würde nicht lange währen. Er würde aus der Vorhölle zurückkehren. Was würde er sehen, wenn er die Augen öffnete? Ein weiß gestrichenes Zimmer und seinen Körper in weißen Bandagen. Woran würde er sich erinnern? Welche Bilder würden in ihm aufsteigen, wenn er wieder an die Oberfläche tauchte? Auf wen würde sein Blick zuerst treffen? Sicher eine Krankenschwester. Würde sie ihn anlächeln, wie sie alle es in solchen Momenten tun sollen, weil eine Krankenschwester eine Mutter ist, die ihr Kind am Ausgang eines langen Tunnels empfängt, und alle Krankenschwestern instinktiv wissen – sonst hätten sie einen anderen Beruf –, entscheidend ist, beim Verlassen dieses Tunnels Licht, Wärme und ein Lächeln zu spüren? Ja, aber für ihn? Die Krankenschwester musste wissen, wer er war; sie musste am Eingang der Station lauernde Journalisten abgewiesen und dennoch ihre Artikel gelesen haben. Sie musste die Fotos gesehen haben, es waren in allen Zeitungen dieselben: das ausgebrannte Haus und die sechs kleinen Passbilder. Die sanfte, ängstliche alte Dame. Ihr Mann, steif wie die Justiz, mit aufgerissenen Augen hinter seiner dicken Hornbrille. Die schöne, lächelnde Florence. Er mit seinem sanftmütigen Gesicht eines ruhigen, etwas untersetzten Vaters mit leicht schütterem Haar. Und dann die beiden Kleinen, vor allem sie: Caroline und Antoine, sieben und fünf Jahre alt. Ich betrachte sie, während ich das schreibe; ich finde, Antoine hat ein wenig Ähnlichkeit mit Jean-Baptiste, dem jüngeren meiner beiden Söhne; ich stelle mir sein Lachen vor, sein leichtes Lispeln, seine Wutanfälle, seinen kindlichen Ernst, all das, was für ihn ganz furchtbar wichtig war, all die Kuscheltierempfindsamkeit, die der Liebe zugrunde liegt, die wir unseren Kindern entgegenbringen, und auch ich möchte am liebsten weinen.
Nachdem ich beschlossen hatte, über den Fall Romand zu schreiben, was sehr schnell geschah, überlegte ich, ob ich nach Ferney-Voltaire fahren solle. Mich in einem Hotel dort einquartieren und den schnüffelnden Reporter spielen, der sich selbst einlädt. Doch ich konnte mir nur schwer vorstellen, meinen Fuß in Türen zu klemmen, die mir trauernde Familien am liebsten vor der Nase zugeschlagen hätten, und Stunden damit zuzubringen, mit Polizisten aus der Franche-Comté Glühwein zu trinken und Strategien auszuspinnen, um die Protokollführerin des Untersuchungsrichters kennenzulernen. Vor allem wurde mir bewusst, dass es gar nicht das war, was mich interessierte. Die Nachforschungen, die ich selbst hätte anstellen können, und die Ermittlung, an deren Ergebnisse zu kommen ich hätte versuchen können, hätten nichts anderes ans Licht gebracht als Fakten. Die Details zu Romands veruntreuten Geldern, die Art und Weise, wie er sich im Laufe der Jahre sein Doppelleben eingerichtet hatte, die Rolle, die dieser oder jener darin gespielt hatte, all das, was ich in überschaubarer Zeit hätte in Erfahrung bringen können, hätte mir nicht erklärt, was ich wirklich wissen wollte, nämlich: Was hatte sich während der Tage in seinem Kopf abgespielt, die er weder, wie behauptet, im Büro verbracht hatte noch mit Waffenschmuggel oder Industriespionage, wie man anfangs geglaubt hatte, sondern, wie man inzwischen annahm, damit, im Wald umherzustreunen? (Ich erinnere mich an einen Satz, den letzten eines Artikels in der Libération, der mich endgültig in den Bann dieser Geschichte gezogen hatte: »Und er zog los, um in den Wäldern des Jura herumzuirren, allein.«)