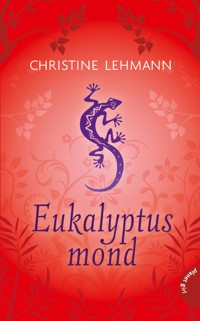11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bitte Ruhe! Aufnahme! Schichtarbeit, Newsroom-Stress, Hickhack im Team, und alles in einer fremden Stadt – was hat sich Lisa Nerz da aufgehalst? Undercover soll sie in der Nachrichtenredaktion eines öffentlich-rechtlichen Senders einem Datenleck nachgehen. Prompt stößt ihr auf, wie viel Sendeplatz eine lokale Populistin erhält, um Unwahres zu verbreiten. Und dann ist da auch noch eine unidentifizierte Leiche, Todesursache unklar, aber Gewalteinwirkung sicher … In Alles nicht echt geht es um öffentlich-rechtliche Nachrichten, um Narrative, Positionen und Populismus, kurz: um die Suche nach Wahrheit. Ein heiter-kritisch-aufschlussreicher Kriminalroman mit Lisa Nerz, die per Fahrrad in einer ungenannten Stadt ermittelt – natürlich auf eigene Gefahr. Über Christine Lehmanns Lisa-Nerz-Krimis: »Lehmann schreibt mit Herz und, eine Rarität im D-Krimi, (Wort-)Witz.« Die Zeit »Die Ich-Sicht der Lisa Nerz hat einen Reiz, der an Die Tote im See erinnert. Vermutlich liegt es an den coolen Sprüchen und Methoden der Krimifigur, die sich hinter Philip Marlowe nicht verstecken muss.« Kommune »Nerz ist misstrauisch und provokant, reizbar und schredderzüngig, sie stellt sich risikobewusst auf die Seite der Schwächeren. Ihre Streitlust drückt sich in der Dynamik, Frechheit, Wendigkeit der Sprache bestens aus.« Stuttgarter Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Bitte Ruhe! Aufnahme!
Schichtarbeit, Newsroom-Stress, Hickhack im Team, und alles in einer fremden Stadt – was hat sich Lisa Nerz da aufgehalst? Undercover soll sie in der Nachrichtenredaktion eines öffentlich-rechtlichen Senders einem Datenleck nachgehen. Prompt stößt ihr auf, wie viel Sendeplatz eine lokale Populistin erhält, um Unwahres zu verbreiten. Und dann ist da auch noch eine unidentifizierte Leiche, Todesursache unklar, aber Gewalteinwirkung sicher …
In Alles nicht echt geht es um öffentlich-rechtliche Nachrichten, um Narrative, Positionen und Populismus, kurz: um die Suche nach Wahrheit. Ein heiter-kritisch-aufschlussreicher Kriminalroman mit Lisa Nerz, die per Fahrrad in einer ungenannten Stadt ermittelt – natürlich auf eigene Gefahr.…
Über die Autorin
Christine Lehmann, jahrzehntelang als Nachrichten- und Aktuellredakteurin beim SWR, widmet sich der Politik heute als Stuttgarter Stadträtin. Mit Alles nicht echt werfen nun 13 Lisa-Nerz-Krimis unterschiedlichste Schlaglichter auf unsere Gesellschaft von den 1990ern bis heute. Christine Lehmann schreibt Romane, Glossen und Hörspiele und betreibt ein Fahrradblog.
Christine Lehmann
Alles nicht echt
Kriminalroman
Vorbemerkung von Else Laudan
Hallo, Radio! Was wollen wir hören?
Den Öffentlich-Rechtlichen pauschal vorzuwerfen, sie seien einseitig, beliebig oder befangen, ist leicht und billig in Zeiten des allgegenwärtigen Kreisch- und Pöbelsounds, der eifrig auf Sündenböcke und »Feinde« eindrischt, wobei jeder alles am besten weiß und gern von verschworenen Fronten fantasiert. Als brächte das irgendwie weiter. Nein, wesentlich interessanter finde ich die konkreten Einblicke in Strukturen und Alltag von Nachrichtenproduktion, die Alles nicht echt höchst unterhaltsam gewährt. Was ist eine Meldung, wer ist wie verantwortlich für das, was uns stündlich als tagesrelevant verabreicht wird, welchen Regeln folgt Berichterstattung und was hat sich daran im Laufe der Jahre verändert? Wer öfters Rundfunknachrichten hört, wird nach der Lektüre dieses Krimis anders lauschen, so viel kann ich versprechen. Wir erfahren eine Menge übers Radiomachen von Anbeginn bis heute. Denn ein erheblicher Teil der Handlung spielt sich im Funkhaus ab.
Mich entzückt der mühelose Spagat aus angespitzten Pointen und erzählerischer Leichtigkeit, den Christine Lehmann hier vollführt, wobei sie das Düstere und Üble nie ausblendet oder bemäntelt. Ganz ohne den im Krimigenre leider so häufigen klebrigen Pfuhl des Voyeurismus, ohne selbstgerechte Schießwut oder Moralinsäure lässt sie unsere Alltagsspionin Lisa Nerz mit ergebnisoffener Wissbegier durch den Sender strolchen. Dreht hier einen Stein des Anstoßes um, wendet dort ein Klischee, hinterfragt die Vorgaben des Altbewährten und interessiert sich für die Menschen. Genau diese Neugier aufs Lebendige, auf junge, alte, starke, schwache, garstige, gierige, engagierte, bunte Personen, die gehört für mich zum Stärksten, was Gegenwartsliteratur bieten kann – so wichtig in Zeiten wie diesen.
Ein HATÜ ist ein halber Türke. Für eine Radiosendung wird das Interview vorher aufgezeichnet, vom Moderator aber live anmoderiert und nach der ersten Frage abgefahren. Ein TOTÜ ist die Abkürzung für totaler Türke. Da wird die An- und Abmoderation ebenfalls vorher aufgezeichnet. Nix ist mehr live, obwohl es so klingt.
Herauszufinden, woher der Begriff »türken« stammt, ist kein Akt. Man schaut schnell in Wikipedia und liest etwas über einen Schachtürken. Das war ein Kasten mit einem Automaten, in dem eine Puppe an einem Schachbrett saß und zu spielen vorgab. Sie wurde jedoch von einem Menschen gesteuert. Und über Türkengefechte. Das waren gestellte Gefechte, die wie echte Manöver aussahen. Und wenn sich der Fernsehkorrespondent nach einer Reportagereise auf einem deutschen Kriegsschiff für einen nachträglichen Aufsager schnell mal mit dem Kameramann unter die Heizungsrohre im Keller des Funkhauses stellt, was ändert das schon am Inhalt seiner Worte?
Vom einst gebrauchten »türken« sind heute nur noch HATÜ und TOTÜ übrig. Wer will schon von faken reden oder von fälschen, von einem totalen Fake, TOFA, oder einer halben Fälschung, HAFÄ? Handelt sich doch nur um eine klitzekleine Täuschung, bezogen auf den Zeitpunkt des Gesprächs: Es klingt wie live, ist es aber nicht. Eigentlich egal. Grob gesagt. Fein betrachtet, kann sich die Hörerin zusammen mit dem Interviewpartner reingelegt vorkommen, weil das Interview auf die nötigen 2 Minuten 30 beschnitten wurde und von einer längeren Schwadronade deshalb nur der Satz übrigblieb: »Der deutsche Journalismus krankt an einer durchgegenderten multikulturalisierten Gehirnwäsche durch das Establishment der internationalen woken Netzwerke, das uns vorschreibt, welche Wörter wir verwenden dürfen und welche nicht.«
»Du bist doch Journalistin«, stellte Richard fest.
»Ich bin Lisa Nerz.«
Richard deutete ein genervtes Lächeln an. »Das ist Zufall. Deinen Namen hast du dir nicht ausgesucht.«
Ganz im Gegensatz zu ihm. Er hatte seinen Mädchennamen eines Tages abgelegt und sich einen neuen gegeben. Wieso eigentlich gerade Richard? Richard von althochdeutsch »rihhi«: reich, mächtig, die Macht, die Herrschaft, der Herrscher, und »harti«: hart, stark, fest, entschlossen. Richard, der zur Macht entschlossene Oberstaatsanwalt. Passt.
»Bei uns auf dem Dorf hießen die Kühe Lisa. Was bedeutet Lisa eigentlich? Weißt du das?« Ich hatte schon mein Handy gezückt, um zu googeln, aber Richard war schneller.
»Lisa ist die Kurzform von Elisabeth, auf Hebräisch: Elischeva. Eli ist ein sehr alter orientalischer Name für Gott. Scheva bedeutet sieben auf Hebräisch. Die Sieben steht für den Himmel mit seinen damals mit bloßem Auge erkennbaren sieben Wandelsternen einschließlich Mond und Sonne, also für Vollkommenheit. Dein Name könnte so etwas bedeuten wie ›Mein Gott ist Vollkommenheit‹.«
»Das ist dem bigotten Geist meiner Mutter entsprungen.«
»Vermutlich viel einfacher: In der Bibel ist Elisabeth die Mutter von Johannes dem Täufer.«
»Siehst du, Richard, darum musste ich Journalistin werden: Leuten Namen geben, neue Heilsbringerinnen in die Öffentlichkeit pushen und so Kram. Der Nerz gibt dem Ganzen noch eine kleine schwarze Bissigkeit.«
Richard lachte.
»Aber von mir als Journalistin hast du nie viel gehalten. Warum soll ich jetzt auf einmal eine von diesen Heldinnen des Skandals sein?«
»Für eine Newsredaktion dürfte es reichen.«
»Wieso?«
Er setzte sein Zaudergesicht auf, mit dem er gewöhnlich den Bruch der staatsanwaltlichen Verschwiegenheit einleitete. »Aber das ist unter drei«, sagte er.
»Schon klar. Ich veröffentliche es nicht. Was ist los?«
Am liebsten hätte er mich mit verbundenen Augen auf Umwegen in die Stadt bringen und mir erst im Gebäude den Sack vom Kopf ziehen lassen. Aber ich hätte das Gebäude zum Schlafen ja sowieso verlassen müssen, und Städte verraten sich durch Autokennzeichen und Wegweiser.
Ich kam in den Genuss dienstbarer Sekretärinnen, die mir eine Bahnfahrkarte besorgten und eine Wohnung anmieteten, deren Schlüssel mir zugeschickt wurde. Sie lag im zweiten Stock eines Gründerzeitwohnblocks an einer vierspurigen Ausfallstraße, die ich mal Granitstraße nenne, mit Baustelle, Fußgängerampel, Bushaltestelle und Radwegen, wie sie in jeder Stadt irgendwo vorkommen. Die Briefkästen hingen im Hausflur, die dunklen Holztreppen knarrten, in den holzverblendeten Wohnungseingängen klapperten die Glasscheiben bei jedem Tritt, die Tür würde einem kräftigen Stoß nicht standhalten. Unter dem Türritz zog kalte Luft in einen Flur, von dem ein Zimmer mit Fenstern zur Straße und eine Küche mit Blick in einen Hinterhausgarten abgingen, wo im strömenden Regen Fahrräder verrotteten und ein Tisch und Stühle rosteten. Zum Klo ging es durch einen schweren Vorhang in einen langen Gang zwischen Treppenhaus- und Küchenwand. Das Badezimmer nahm der Küche eine Ecke weg. Die Küche bestand aus einer Zeile mit Spüle, Mülleimer und Boiler, einem Gasherd und offenen Regalen mit rotem und blauem Steingutgeschirr und Konservendosen, Reis und Spaghetti, Teebeuteln und einer Sammlung von unnützen Küchengeräten, die das Leben einem so zuschanzte: Entsafter, Kartoffelpresse, Eierkocher und Joghurtautomat. Am Fenster stand ein Tisch mit zwei Stühlen. Dort lag ein Zettel, auf dem die mir unbekannte Bewohnerin mit tintenblauer linksgeneigter Schrift notiert hatte, wie man den Boiler anstellte und dass das WLAN-Passwort hinten auf dem Router stand. »Du kannst auch gern mein Fahrrad nehmen. Es ist das violette Veloretti. Die Zahlenkombi fürs Schloss lautet 5889. Fühl dich wie zu Hause, Gruß, Sandra.« Sie befand sich als Schwangerschaftsvertretung in einem Korrespondentenbüro im Ausland, das ich nicht nenne, weil die Zuständigkeit für bestimmte Korrespondentenstellen die Anstalt verrät. Es muss ja nicht jede der neun ARD-Sendeanstalten einen eigenen Korrespondenten in jede bedeutende Hauptstadt schicken.
Oder korrekt: eine:n eigene:n Korrespondenten/in. Gab es eigentlich eine andere Möglichkeit, die Personen, die außerhalb des Funkhauses tätig waren, im Ausland oder im Berliner Studio, geschlechtsneutral zu benennen: die Korrespondierenden? Man sagte ja auch »die Aufsichtsratsvorsitzenden«, ohne sich zu krümmen. Medien genderten nicht gern. In meinen Berichten für die Sonntagsbeilage des Stuttgarter Anzeigers hatten sie mir Gendersternchen, Doppelpunkte und Schrägstriche verboten. »Das polarisiert nur und lenkt vom Inhalt ab.« Von welchem Inhalt? In den Nachrichten hörte ich anstelle von »Kindergärtnerinnen« immer öfter »Erzieher«, weil ja immer mehr Männer unter den Kindergärtnerinnen waren. Männliche Vorbilder für Jungs, ganz wichtig.
Nachts erleuchteten die Straßenlaternen direkt das Wohn- und Schlafzimmer. Die Vorhänge glühten orange. Der Bus hielt quasi in meinem Bett, entließ Passagiere und lud neue ein. Autos bremsten an der Ampel und starteten durch, je später, desto vereinzelter, aber hochtouriger. Die Reifen zischten durch Pfützen. Der Regen gurgelte ein Fallrohr hinab. Ich war aus meiner Neckarstraße Licht und Krach gewöhnt, allerdings hatte ich dort Lärmschutzfenster.
Am Morgen suchte ich vergeblich nach einer Kaffeemaschine, die ich hätte füllen und anstellen können. Egal, Kaffee gab es auch keinen. Sandra war offensichtlich Teetrinkerin. Ich trank keinen Tee mehr, seit ich eine leidenschaftliche Teetrinkerin zu Unrecht ins Gefängnis gebracht hatte. Er erinnerte mich an meine Dummheiten zum Nachteil anderer Menschen. Und so begann man keinen Tag, an dem man einen neuen Job antrat.
Draußen goss es aus grauen Wolken, und das Mitte August. Aber das Duschwasser tröpfelte nur. Ich rauchte eine Zigarette in der Nichtraucherinnenküche – selber schuld, Sandra! –, fand in Sandras Schrank einen langen braunen Gladstone Coat mit Schultercape und kariertem Futter, unter dem auch meine Crossover Moon Bag Platz hatte, zog mir die Chelsea Boots an und ging dergestalt modisch verortet und für die Fremde gewappnet übers Treppenhaus zur Hintertür das Veloretti suchen. »Bitte Türe immer schließen!«
Auf Zetteln kam praktisch nur »Türe« vor. So als ob »Tür« zu einsilbig wäre für eine Bitte, der zuwiderzuhandeln nicht erlaubt war. Der Aschenbecher auf einem Steinsims draußen neben der Tür erklärte den Zettel hinreichend. Die Kippen schwammen.
Sandras violettes Fahrrad stand, zugelehnt von Kinderrädern und einem Dreigangrad, in dem verbogenen Fahrradständer der Marke Felgenkiller. Ich kippte die Räder beiseite, was einen Dominoeffekt auslöste, und arbeitete mich zum Schloss vor, mit dem sie den Vorderreifen angeschlossen hatte. Und jetzt noch mal zurück in die Küche und auf den Zettel nach der Zahlenkombination schauen? Nein, mein sonst so löchriges Gehirn hatte sie behalten und gab sie frei: 5889. Es war ein gepflegtes Stangenrad, das ich hervorzog, mit Nabenschaltung, einem gebogenen Aerowing-Lenker und Gepäckträger am Vorderrohr. Ich gab ihm den Namen Veronika. Nur die Kette rasselte arg. Der Regen hatte das Öl rausgewaschen.
Das Grässliche am Reisen: Man muss erst alle Konsum-Essentials suchen. Das Gute an deutschen Städten: Sie sind alle gleich. Den Aldi gab es schräg gegenüber und auf dem Weg zum Funkhaus kam ich an einem Coffee-to-go mit Pfandbechern vorbei. Ich trank den Kaffee im Laden.
In Zeiten von Facebook und Google-Bildersuche lassen sich Identitäten nicht verschleiern, wenn man sie einmal ins Netz gestellt hat. Aber dass man mich hier kannte, war nicht anzunehmen. Meine Prominenz war dann doch sehr lokal. Deshalb hatten wir auf einen Alias verzichtet.
»Lisa Nerz, ich habe um zehn einen Termin mit Herrn Ochs«, meldete ich mich an der Pforte.
»Herrn Ochs?«, wiederholte die junge Frau hinter Glas gedehnt.
»Das ist der Chef der Newsabteilung.«
»Ich weiß. Sind Sie angemeldet?«
»Ich denke schon, ich habe ja einen Termin.«
»Hat er Sie bei uns an der Pforte angemeldet?«
»Das weiß ich nicht.«
Die junge Frau blickte tadelnd drein und suchte etwas in dem Bereich unterhalb der verglasten Empfangstheke, den ich nicht einsehen konnte.
»Haben Sie eigentlich einen Alarmknopf?«, fragte ich.
»Wie bitte?«
»Na, falls jemand in terroristischer Absicht das Funkhaus stürmen will. Man weiß doch heutzutage nie. Da wäre es doch gut, Sie hätten einen Alarmknopf für die Polizei.«
»Nein. So was haben wir hier nicht.«
An ihrer Stelle hätte ich nicht verraten, über welche Sicherheitstechnik ich verfügte. Bildschirme für Überwachungskameras gab es jedenfalls reichlich. Sie zeigten mir alle die Rückseite.
»Also ich finde hier nichts«, sagte sie. »Dann stelle ich Ihnen einen Besucherausweis aus. Sie wissen, wo Sie hinmüssen?«
»Zimmer 4.07.«
»W oder O?«
Ich schaute auf den Notizzettel in meinem Telefon. »W.«
»Also West, dort entlang. Vierter Stock, wenn Sie aus dem Aufzug kommen, links.«
Mal was anderes, mit einem legal erworbenen, wenn auch provisorischen Ausweis durch eine Drehschranke schreiten zu können. Ich schlenderte. Im Foyer warben Bildersäulen für die drei Programme des Senders, an den Wänden hingen Flachbildschirme, auf denen stumm ein Fernsehprogramm kasperte. In einer Vitrine standen altertümliche Mikrofone, eine Bandmaschine und Merchandising-Produkte. Am schwarzen Brett des Betriebsrats hingen eine Todesanzeige und Fortbildungsprogramme. Es roch nach feuchtem Teppich und einem süßlichen Rasierwasser, das offenbar auch Fahrstuhl gefahren war.
Im vierten Stock herrschte Bitte Ruhe, Sendung. Über einigen Türen leuchteten rote Lampen. Im Vorbeigehen konnte ich in eine Senderegie blicken. Gerade dudelte Werbung. Es war kurz vor zehn. Eine Frau saß am riesigen Pult mit Reglern und Knöpfen im Dutzend und drei oder vier Bildschirmen mit Blick auf die zwei großen Scheiben der Studios. In einem stand einer an einem Tisch hinter dem Mikro. Wie leicht es wäre, einzutreten und irgendwas anzustellen: Kaffee ins Schaltpult gießen, alle Regler aufmachen, Knöpfe drücken, ins Studio platzen und irgendwas in die Welt hinausschreien wie »Lügenpresse« oder »Die Aliens sind gelandet«.
Der Boden schluckte meine Schritte mit leichtem Beben. In einer hellblau gestrichenen Sitzecke saß niemand. Eine überschlanke Frau schritt in der bräunlich roten Dämmerung des langen Gangs in kurzem Rock und Stiefeln vor mir her und bog ab. An die Tür neben dem Schild 4.07 war ein Blatt Papier mit der Aufschrift »Eingang Zi. 4.06« geklebt. Ich trat in ein Sekretariat, in dem an zwei Schreibtischen mit Bildschirmen mit dem Rücken zueinander zwei Frauen saßen.
»Guten Morgen, Lisa Nerz, ich habe einen Termin mit Herrn Ochs.«
Eine der beiden riss sich vom Monitor los und sagte mit knatschiger Stimme: »Ach so, ja.« Sie stand auf, zog sich den Pullover auf die Hüften, öffnete eine Tür, steckte den Kopf hinein und sagte: »Frau Nerz wäre jetzt da.« Dann zog sie den Kopf wieder heraus und knatschte: »Sie können reingehen.«
Wohin mit dem feuchten Mantel?
»Den können Sie da hinhängen. Aber vergessen Sie ihn nicht!«
Roland Ochs ließ sich drei Sekunden Zeit, bevor er seinen Blick vom Bildschirm löste. Sein schmächtiger Oberkörper steckte in einem roten Hemd, darauf saß ein kleiner Kopf mit milchiger Haut und gelblich weißem Haar.
»Ah, Frau Nerz!« Er stand auf, gab mir die Hand und wies mich zur Sitzecke. Er selbst ließ sich in die Couch fallen, spreizte die dünnen Beine und faltete seine Hände im Schritt unter seinem Geschlecht. Lust zu lächeln hatte er nicht.
»Sie kommen vom Zeitungsjournalismus her. Rundfunkerfahrung haben Sie keine«, sagte er mit leicht nasaler Radiostimme. »Ich frage Sie nicht, was Sie hierher verschlagen hat. Das ist kein normales Bewerbungsgespräch. Ich bin aus Gründen, über die ich nur Vermutungen anstellen kann, gehalten, Sie zu übernehmen.« Er schaute mich herausfordernd an. »Sie werden die Probezeit hier nicht überstehen.«
Was hätte ich darauf alles antworten können! Als Rächerin aller Volontärinnen, Praktikantinnen und Bewerberinnen, die wie ich vor ihm auf dem Sessel gesessen und ihm beim Wiegen des Gemächts in den gefalteten Händen zwischen den gespreizten Beinen zugeschaut hatten, eingeschüchtert, verstört, verwirrt, zum Schweigen verdammt, weil sie den Job oder später eine gute Beurteilung wollten. »Sie sind ja ein richtiges kleines Arschloch«, hätte ich ihm ins Gesicht lachen können. »Wetten, dass Sie das kommende halbe Jahr nicht überstehen?« Aber ich ließ meinen Lisa-Nerz-Verbalprügel stecken und fragte artig dumm: »Wieso?«
Ochs breitete die Arme auf der Sofalehne aus und dehnte den Brustkorb unter dem roten Hemd, legte dabei aber schützend den rechten Unterschenkel aufs linke Knie. Oha, Spürsinn für Gefahren besaß er auch, er hatte mir vermutlich am vernarbten Gesicht angesehen, dass ich respektlos war.
»Sie passen nicht hierher«, sagte er, »und das wissen Sie ganz genau.«
Vielleicht hätte ich einen Rock oder ein graues Business-Kostüm anziehen sollen, nicht Jeans und eine schwarze Jeansjacke mit Moon Bag quer drüber. Unangenehme Weiberkleider signalisierten Unterwerfung: kneifende Stoffhosen, unter denen sich der Slip abzeichnete, Röcke, die man sich im tiefen Sessel zu den Knien zupfte, Nylons, die im Schritt spannten und die man sich beim Aufstehen unwillkürlich hochzog, oder wenigstens ein Tuch, das ständig von der Schulter rutschte. Zeigen, dass man Spielregel-Opfer war.
Er wartete. Er schwieg. Er setzte darauf, dass ich würde wissen wollen, warum ich nicht passte, dass ich mich gegen die Unterstellung wehren würde und mich ihm erklärte. Und dass meine Stimme ihm verriet, wie ich mich fühlte: verunsichert, ertappt, schuldbewusst oder aufsässig. Wie viele meiner Vorgängerinnen versuchte ich in rasender Eile abzuschätzen, welche Seite von mir ich rauskehren sollte. Fight or Flight? Dem künftigen Vorgesetzten ins Unkraut treten oder selber die Beine übereinanderschlagen? Im Gegensatz zu anderen Frauen, die hier gesessen hatten, hatte ich die Wahl, gar nicht mitzuspielen.
Schweigen war die beste Antwort. Kein Dementi war eine Bestätigung seiner Mutmaßung, dass ich aus bestimmten Gründen, über die er »nur Vermutungen anstellen konnte«, gegen seinen Willen und gegen seine Überzeugung über Beziehungen nach ganz oben ohne Bewerbungsverfahren an die Stelle einer freien Redakteurin gekommen war, obgleich meine Qualifikation dafür nicht ausreichte. Die meisten Menschen glaubten, dass wer nichts sagte, zustimmte, auch wenn sie von sich selbst wussten, dass sie den Mund nur dann hielten, wenn sie einen Streit vermeiden wollten.
Ochs war mit meinem Schweigen offenbar zufrieden. Er ließ etwas Luft aus seinem Lungenballon und stand auf. Als wir durch die Tür ins Sekretariat gingen, legte er die Hand auf meine Schulter.
Ich hatte mich gewehrt. »Ich bin arbeitsscheu, das weißt du doch, Richard. Ich hasse Acht-Stunden-Schichten, und das auch noch fünf Tage die Woche.«
Nachdem ich vor vielen Jahren beim Stuttgarter Anzeiger rausgeflogen war, hatte ich mich ans Willkürliche gewöhnt. Von meinem vor noch längerer Zeit verstorbenen ersten Mann hatte ich ein Vermögen geerbt. Mein zweiter verdiente als Oberstaatsanwalt genug für uns beide, auch wenn ich das vor mir selbst leugnete. Hin und wieder schrieb ich einen Artikel für die Sonntagsbeilage, damit meine Selbsterklärung stimmte.
»Du musst natürlich nicht, wenn du nicht willst«, hatte Richard geantwortet.
»He, komm mir nicht so!«
Er grinste.
»Ich kenne mich nicht aus mit Datenklau, Richard. In die IT-Abteilung könnt ihr mich nicht stecken. Da braucht ihr Spezialkräfte.«
»Mit der IT hat das nichts zu tun.«
»Und wieso können es nicht Hacker von außen gewesen sein, die Russen oder Chinesen?«
»Einen solchen Angriff gab es nicht. Die Daten wurden mithilfe eines Schattenadminkontos im Funkhaus abgegriffen, und zwar auf einem der Rechner in der Newsredaktion.«
»Und was ist ein Schattenadminkonto?«
»Das Konto eines Nutzers, dem ein Admin vor längerer Zeit sehr weitreichende Zugriffsberechtigungen gegeben hat, ohne sie zurückzunehmen.«
»Aber dann ist der Nutzer doch bekannt.«
»Das Konto gehörte einem Mitarbeiter in der Personalabteilung, der seit geraumer Zeit verstorben ist. Mit diesem Konto hat der Unbekannte eine mutmaßlich im Darknet gekaufte Spyware aufgespielt. Die IT konnte deren Signaturen entdecken und den infizierten PC identifizieren und entfernen.«
»Aber wenn sich jemand in der Newsredaktion eingeloggt hat, muss man doch nur die Daten und Uhrzeiten mit den Dienstplänen abgleichen, um die Person zu finden.«
»Die Aktionen sind zu einem Zeitpunkt geschehen, wo überhaupt niemand Dienst hatte, zwischen ein und drei Uhr morgens.«
»Haben die keine Dienstausweise oder Stechuhren?«, fragte ich.
»Würdest du dich in einer Stechuhr einloggen, wenn du vorhast, Daten zu klauen?«
»Und die an der Pforte wissen nicht, wer nachts im Haus ist?«
»Im Prinzip schon. Sie sehen, wer kommt und geht, führen aber nicht Buch. Die Besatzung an der Pforte kriegt auch nicht immer mit, wenn jemand geht. Es gibt neben der Hauptpforte zwei weitere Ausgänge. Da kommt man nur mit dem Chip im Hausausweis rein, aber hinaus kommt jeder.«
»Und hinein, falls die Tür noch nicht wieder zugefallen ist.«
Richard nickte.
»Haben die dort keine Überwachungskameras?«
»Doch. Aber die Videos dürfen nur 48 Stunden gespeichert werden. Dann werden sie überschrieben.«
»Und wenn es einer der Menschen vom Betriebsschutz war? Die sind ja die ganze Nacht da.«
Die Frage hatte man sich im Bundeskriminalamt auch gestellt und die Sicherheitsfirma durchleuchtet. »Alles friedlich«, erklärte Richard. »Keine auffälligen Kündigungen, geringe Fluktuation, wenig Krankheitstage. Ganz anders sieht das in der Newsabteilung aus. Da rumort es. Es hat mehrere Programmreformen und Umstrukturierungen gegeben. Der Krankenstand ist hoch. Ein Drittel der rund dreißig Leute bewirbt sich auf jede ausgeschriebene Stelle in anderen Abteilungen oder Funkhäusern, einige haben bereits nach wenigen Jahren die Redaktion wieder verlassen, zwei davon in Richtung Privatsender, die schlechter bezahlen. Ein Viertel der Leute hat ihre Arbeitszeit auf achtzig bis sechzig Prozent reduziert, zwei Personen sind mit chronischen Erkrankungen als arbeitsunfähig ausgeschieden, eine Person ist Ende Juli ohne Kündigung verschwunden. Zwei Stellen sind derzeit ausgeschrieben. Und zwar nicht nur ARD-intern, sondern auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt.«
»Hui! Das klingt nach einem Schlachtfeld von Intrigen, schlechter Führung, innerer Kündigung und Mobbing.«
»Dachte ich mir doch, dass dich das interessiert.«
»Aber die habt ihr doch sicher alle längst durchleuchtet.«
»Nein, Lisa. Privatpersonen ganzer Abteilungen kann man nicht einfach verdachtsunabhängig durchleuchten. Dass sich das Bundeskriminalamt die Personalakten hat geben lassen, halte ich schon für grenzwertig. Die Mitglieder der Redaktion wurden natürlich befragt, aber ein Anfangsverdacht ergab sich daraus nicht.«
Kurz und gut, für die Softskills brauchte man mich, die sich die Unwuchten des Organigramms von innen anschaute, Vertrauen gewann, Informationen sammelte und Leute verriet.
»Deine Notizen sollten genau und nachvollziehbar sein, Lisa.«
»Es ist aber verboten«, wandte ich ein, »Dossiers von Kolleginnen und Kollegen anzulegen, außerhalb der Personalabteilung.«
»Ja, wenn es rauskommt, hat es deine fristlose Kündigung zur Folge«, antwortete Richard.
»Okay. Aber eines frage ich mich doch.«
»Und was?«
»Was fängt man eigentlich groß an mit internen Unterlagen eines öffentlich-rechtlichen Senders und mit Adressen von ARD-Mitarbeitenden?«
»Man bietet sie im Darknet zum Verkauf an. So ist das BKA darauf gekommen.«
»Und wer kauft sie?«
Richard zuckte mit den Schultern. »Nach Angaben des BND kursieren Auszüge von Personalakten und private Adressen von ARD-Journalistinnen und -Journalisten in der Türkei und in Russland, ebenso wie in rechten Chatdiensten.«
»Und was wollen die damit?«
»Persönliche Informationen über Leute an Schlüsselstellen können dazu dienen, sie erpressbar zu machen.«
»Sitzt die Journaille denn in Schlüsselpositionen?«
»Wie man es nimmt. Sie sitzt zumindest an der Schnittstelle zwischen den Informationen, die hereinkommen, und denen, die an die Öffentlichkeit hinausgehen.«
»Ach herrje! So viel Macht haben doch die armen Öffentlich-Rechtlichen gar nicht mehr. Facebook, YouTube, Instagram, Tiktok, Telegram oder X erreichen viel mehr Leute.«
»Aber die Öffentlich-Rechtlichen haben mehr Renommee. Sie gelten als Garant für unabhängigen Journalismus.«
»Aha, deshalb nennt man sie neuerdings staatsnah und unkontrollierbar. In den rosigen Achtzigern hießen sie noch Linksfunk. Die wissen auch nicht, was sie wollen.«
»Doch, Lisa, die – wer auch immer die sind – wollen reine Propagandasender. Trump hat 2016 die Wahl gewonnen, weil die Leute auf dem Land die Horrorberichte vom Untergang der US-Wirtschaft in den Medien für Realität hielten. Und die meisten Leute in Russland glauben, dass Putin ihr neuer Peter der Große ist. Wirst sehen: Im Herbst wird er zum Kaiser gekrönt. Die Fernsehübertragung wird die der Krönung von Queen Elizabeth um ein Vielfaches an Prunk und Reichweite übertreffen, eine halbe Million Komparsen als Jubelrussen, dreißigtausend Pferde, fünf Kilo Gold und Edelsteine, Atomsprengköpfe, Panzer …«
»Quatsch jetzt, oder?«
In Richards asymmetrischem Gesicht verhakte sich ein Lächeln. »Siehste! Nenne Zahlen, und die Leute horchen erst mal hin.«
»Wahrscheinlich ist der Ukraine-Krieg nur ein Videospiel.«
»Cui bono?«, fragte er.
»Auf jeden Fall nützt es erst mal der Rüstungsindustrie. Da trudeln jetzt Bestellungen aus ganz Europa ein. Und wir Deutschen lassen uns widerspruchslos einstimmen auf eine Kriegsertüchtigung der Bundeswehr und eine Erhöhung des Verteidigungsetats. Jetzt verstehe ich das Ganze. Wow!«
»Putin ist übrigens auch schon lange tot«, sagte Richard.
»Was? Blödsinn!«
Er lächelte nicht. »Woher weißt du, dass die Fernsehbilder nicht reines Face Swapping sind? Technisch kein Problem. Abba hat mit Avataren eine ganze Show auf die Beine gestellt. Und kurz nach Kriegsbeginn erschien nachweislich auf einer ukrainischen Nachrichten-Webseite ein Deepfake-Video, in dem Selenskyj die ukrainischen Soldaten dazu aufrief, sich zu ergeben. Und haben wir uns nicht alle kurz nach Kriegsbeginn gewundert, wie verquollen Putins Gesicht aussah? Und dieses Sprechen, ohne die Lippen richtig zu bewegen!«
»Jetzt, wo du es sagst. Er hinkte auch. Sein Gang hatte ja immer Schlagseite, die rechte Hand an der Hosennaht, wo beim KGBler der Colt sitzt, der linke Arm selbstgefällig schwingend, aber am Anfang des Kriegs war es schon extrem.«
»Der Schauspieler, auf den sie ihn projizieren, kann es inzwischen besser.«
»Aber irgendwelche Leute sehen ihn doch, sie stehen in einem Saal herum, er läuft durch.«
»Hologramm-Technik. Die glauben nur, ihn zu sehen. Er schüttelt ja niemandem die Hand.«
»Aber wem nützt das, Richard?«
»Das Land muss stabil bleiben, bis der Machtkampf im Hintergrund um seine Nachfolge entschieden ist. Zuerst muss Prigoschin weg.«
»Also nur einem einzigen Mann.«
»Nein, uns allen, Lisa. Das Land bricht auseinander, wenn der starke Mann fehlt. In Russland leben über hundert Ethnien. Das gibt Dutzende von Unabhängigkeitskriegen, die globale Wirtschaft leidet, infolgedessen gewinnen die Rechten die Wahlen. Was auch für China gilt, wenn die Diktatur an Kraft verliert. Und daran können unsere westlichen Demokratien kein Interesse haben.«
»Seit wann hängst du Verschwörungserzählungen an, Richard?«
Er schwieg.
»Muss man das so pessimistisch sehen? Gibt es nicht andere Erzählungen?«
»Weißt du eine, Lisa?«
Richard glaubte nicht an das Gute im Menschen. Als Pietist rang er täglich um Rechtschaffenheit. Fehler verzieh er nur anderen, nicht sich selbst. Er wollte nicht verstehen, warum andere nicht ebenso streng nach Anstand strebten, aber er wusste, dass sie es nicht taten. Ich verstand ihn zunehmend besser, obgleich ich vorhatte, ewig jung zu bleiben. Misanthropie ist eine Alterserscheinung. Immer öfter fiel auch mir auf, dass die Menschheit überhaupt nicht klüger wurde. Eher dümmer. Was daran liegen mochte, dass ich selber klüger wurde. Doch wenn das so war, hätten Millionen andere mit zunehmendem Alter ebenfalls klüger werden müssen. So kam es mir aber gar nicht vor.
»Und um was geht es dir jetzt genau?«, fragte ich.
Der Radio-Talk ist ein Interview mit einem Gast oder eine Diskussionssendung mit mehreren Gästen. Eine Moderatorin oder ein Moderator leitet das Gespräch.
Jingle: Gesellschaft und Medien
Sprecher: Thema heute: Ist der Rundfunk noch zeitgemäß?
Moderatorin: Willkommen zu einer neuen Folge von Gesellschaft und Medien. Mein Name ist Anastasia Goldmund. Schön, dass Sie da sind. In der heutigen Folge werfen wir zunächst einen Blick zurück in die Geschichte des Rundfunks. Danach wollen wir mit unseren Studiogästen diskutieren. Während des Nationalsozialismus diente der Hörfunk der Propaganda. Nach dem Krieg unterstanden die Sender in Deutschland den Besatzungsmächten. Nach und nach wurden sie dann in Anstalten des öffentlichen Rechts überführt. Sie sollten für immer unabhängig vom Staat sein. Bei mir im Studio sitzt der Medienwissenschaftler Bruno Kunz.
Kunz: Guten Tag.
Moderatorin: Herr Kunz. Mit dieser Entscheidung hat der Rundfunk einen Auftrag bekommen.
Kunz: Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den verfassungsrechtlich vorgegebenen Auftrag, einen Beitrag zur individuellen und öffentlichen Meinungsbildung zu leisten. Damit soll er zu einem demokratischen Gemeinwesen beitragen. Entstanden ist er, wie Sie schon gesagt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg als Gegenentwurf zum zentralistisch organisierten Staatsfunk der NS-Diktatur. Er gehört der Allgemeinheit. Die beaufsichtigt ihn durch Aufsichtsgremien, in denen Vertreterinnen und Vertreter aller gesellschaftlichen Gruppen sitzen. Dieser Rundfunkrat soll für Staatsferne und Pluralismus sorgen. Vorbild war die BBC. Der britische Sender galt über Jahrzehnte als unbestechlich, aufklärerisch und unparteiisch. Er stand für eine objektive Berichterstattung.
Moderatorin: Sie sprechen in der Vergangenheit. Ist die BBC heute kein so gutes Vorbild mehr?
Kunz: Die BBC hat ihre Unschuld verloren. 1995 hat sich ein Journalist ein Interview mit Prinzessin Diana erschlichen. Er hat Dianas Bruder falsche Kontoauszüge vorgelegt und behauptet, Mitarbeiter bei Hof würden dafür bezahlt, Diana auszuspionieren. So kam ein Interview zustande.
Moderatorin: Und Lady Di hat damals angedeutet, dass Prinz Charles immer eine Geliebte hatte. Was die britische Monarchie in eine Krise gestürzt hat.
Kunz: Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich der gebührenfinanzierte Rundfunk seit der Zulassung privater Sender in einem Dilemma befindet. Die Privaten haben keinen gesetzlich definierten Programmauftrag. Sie arbeiten nach rein wirtschaftlichen Kriterien. Ihre Werbekunden wollen große Reichweiten. Sie müssen deshalb ein Unterhaltungsprogramm für Massen machen. Und nun muss auch das Gebühren-Radio beweisen, dass es kein abgehobenes Minderheitenprogramm macht. Es braucht ebenfalls Quote. Schließlich muss ja jeder die Rundfunkgebühr zahlen. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen die Gratwanderung zwischen Informationsauftrag und Unterhaltung hinbekommen.
Moderatorin: Vielen Dank für diese ersten Informationen. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch zeitgemäß? Das ist die Frage, die wir heute mit unseren Studiogästen diskutieren wollen.
Der bunte Roland Ochs redete mit nasaler Stimme jede Menge Rundfunkgeschichte an mich heran, während wir die Gänge abschritten. Hier und da öffnete er eine Bürotür, wo Leute an Bildschirmen saßen und mich stumm anguckten. Bevor irgendjemand mehr als Hallo zu mir sagen konnte, verkündete er: »Wir wollen nicht weiter stören«, und führte mich wieder auf den Gang.
Dünne LED-Röhren an der Decke bildeten eine Flucht bis dorthin, wo sich parallele Geraden schneiden. Ihr Licht wurde geschluckt von braunen Wänden, dunkelvioletten Türen und einem schwarzen Teppich. Ein paar Sitzecken bildeten hellblaue Inselchen. Vermutlich wollte Ochs sich mit seinem roten Hemd in diesem Zwielicht sichtbar machen.
Das Radiofeature, auch Radiodokumentation genannt, ist ein nicht-fiktionales Hörfunkgenre, das sich nach 1945 in den Kulturprogrammen des europäischen Hörfunks etabliert hat. Ein Radiofeature verbindet Elemente von Hörspiel, Dokumentation und Reportage. Der Autor oder die Autorin recherchiert, nimmt O-Töne auf, führt Interviews und schreibt das Manuskript. Ein Regisseur oder eine Regisseurin produziert die Sendung mit Schauspielerinnen und Schauspielern im Studio.
Vom Spartenprogramm zur Welle
Feature
Geräusch: Rauschen und Zwitschern einer Sendersuche auf UKW
Sprecher: In den Neunzigerjahren liefen den öffentlichen Rundfunkanstalten die Hörerinnen und Hörer davon zu den Privaten. Das war das Ende des Spartenrundfunks und der festen Sendeplätze.
Geräusch: Zeitzeichen mit Nachrichten-Gong
Sprecherin: Meine Eltern haben sich noch aufrecht hingesetzt und mit ernsten Mienen den Nachrichten zugehört: Und die waren lang. Mindestens fünf Minuten Weltgeschehen, Bundespolitik, Kultur, Gesellschaft und Wetter.
Sprecher: Zwischen den Nachrichten lief das Programm. Musikwunschsendungen hatten ihren festen Sendeplatz …
Sprecherin (nostalgisch begeistert): Ja, ich erinnere mich. »Sie wünschen, wir spielen«. Die Hörerinnen und Hörer riefen an. Und immer richteten sie dem Schallarchiv, wo die Platten geholt werden mussten, einen schönen Gruß aus.
Sprecher (fährt fort): Genauso wie Kultur, Kirche und Gesellschaft, Wissenschaft, Neues aus der Rechtsredaktion oder Schulfunk, das Symphonie-Orchester oder das Hörspiel.
Sprecherin: Oh ja, ich erinnere mich, Samstagabend Sport. Und sonntags Kirchenglocken.
Geräusch: Kirchenglocken, überblenden mit Titelmusik von Studio 13
Sprecherin: Und Montagabend Studio 13, das Kriminalhörspiel. Wenn man das Radio einschaltete, wusste man, welcher Wochentag war. Den Mittwochabend habe ich gehasst: Jazz mit ellenlangen Erläuterungen.
Sprecher: Deshalb untersuchte man Ende der Neunzigerjahre, was die Menschen hauptsächlich hören wollen, und erfand die Welle. Wer morgens einschaltet, soll bis zum Abend auf derselben Welle surfen können: vertraute Musik, vertraute Moderatorinnen und Moderatoren, kurze Nachrichten alle halbe Stunde mit Eilmeldungen als Breaking News zwischen den Nachrichten und mit kurzen Beiträgen über gesprächswertige Themen wie Promis, Ernährung oder Lifestyle. Hörerbindung ist das Stichwort.
Sprecherin: Aber die Kinotipps und Buchbesprechungen vermisse ich schon manchmal. Und es ist mir zu viel Sport.
Geräusch: Eine Fußballreportage wird angespielt.
Sprecher: Sport polarisiert. Aber Fußball interessiert eben auch viele.
Sprecherin: Was ist eigentlich mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag? Bücher, Oper, Wissenschaft?
Sprecher: Dafür haben die Sender die zweiten oder dritten Programme. Da kann man Theaterbesprechungen, Hörspiele und Features, Reportagen und Wissenssendungen hören. Man leistet sie sich, obgleich sie großen personellen Aufwand und hohe Kosten bedeuten, verglichen mit den sehr geringen Hörerzahlen.
Musik: Klassische Musik
Sprecher: Für die journalistische und redaktionelle Arbeit hatte die Reform Folgen. Aus den Einzelkämpferredaktionen wurden große Einheiten gebildet, vor allem Newsredaktionen, die Fernsehen, Hörfunk und soziale Medien zusammenführten. Trimedialität ist das Stichwort der Zeit. Ein Reporter, eine Reporterin muss Fernsehen, Hörfunk und Online gleichermaßen bedienen, fährt zu einem Ereignis, filmt mit dem Handy, sammelt O-Töne und schreibt die Texte.
Sprecherin: Früher ist man mit einem Kameramann, einem Tontechniker und einem Reporter vor Ort gewesen. Und vom Hörfunk kam auch noch jemand.
Sprecher: Das macht jetzt ein Mensch alleine.
Sprecherin: Sozusagen eine eierlegende Wollmilchsau.
Fünf vor zwölf stellte Ochs fest, dass er Termine habe, ließ mir von seinen Sekretärinnen den »Leitfaden für moderne Nachrichten« übergeben, auf dem sein Name stand, und brachte mich in die Newsredaktion, wo ich »vorerst mitlaufen« sollte. Den Dienstplan würde ich im Lauf des Tages erhalten, den Dienstausweis morgen.
Da stand ich, mit Sandras Gladstone überm Arm und dem Leitfaden in der Hand. Vier Leute, drei Frauen und ein Mann, saßen an vier Tischen, die paarweise einander gegenüberstanden und mit je zwei Bildschirmen ausgestattet waren, an denen ihre Blicke klebten. Eine war blond und schmal, die andere sportlich und gelockt. Dann waren da noch ein junger tätowierter Bursche mit schwarzen Haaren im Fade Cut und eine langhaarige Frau mittleren Alters.
Die schmale Blonde winkte über die Schulter. »Hallo, ich bin die Judith.« Sie deutete über den Verhau der Computer auf die andere Seite der Tische. »Das ist Kerstin, und das unser Milan. Er präsentiert heute.«
Die langhaarige Kollegin stellte sich mir selber als Sekretärin Andrea vor.
»Du kannst dich erst mal da hinsetzen, an den Voloplatz«, sagte Judith, ohne auch nur eine Sekunde den Blick vom Word-Dokument zu lösen, in dem sie herumtippte. »Wir machen gerade die Sendung fertig.«
Ich setzte mich an den Platz mit zwei dunklen Bildschirmen.
»Ochs wird es nie lernen«, bemerkte Kerstin. »Er weiß doch, dass wir fünf vor keine Zeit haben.«
Judith lachte böse. Routineworte und Halbsätze flogen über die Tischnaht hin und her.
Hörspiele sind akustische Dramatisierungen von Geschichten. Sie werden von einem Regisseur, einer Regisseurin in einem Hörspielstudio produziert. Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen die Rollen, Geräusche und akustische Akzente werden im Studio hergestellt oder eingespielt. Hörspiele sind die erste eigenständige Kunstform, die das Radio in den 1920er Jahren hervorgebracht hat.
In der Nachrichtenredaktion
Hörspiel von Judith Hollwein
Regie: Hildegart Kumpf
5. Szene
Judith: Eins null zwei?
Kerstin: Wir werden zu lang. Und der Arbeitsmarkt fehlt noch.
Judith: Hab’s gleich.
Milan: Das passt schon, ich lese schnell.
Kerstin: Ich könnte das Hochwasser noch kürzen.
Milan: Nicht nötig.
Judith: A … es ist, E … werden soll … So, kannst den Take reinladen.
Kerstin: Ist drin, Andrea, du kannst es ausdrucken.
Andrea (mahnend): Drei fünfundvierzig?
Kerstin (genervt): Ich kürze das Hochwasser.
Milan: Druck es aus, ich kürze per Hand.
Geräusch: Drucker, der Blätter ausspuckt
Judith: Ich sehe gerade: In den Schlagzeilen muss es Fußballverbandschef Rubiales heißen, da fehlt das Fußball.
Geräusch: Blätterrascheln, ein Stift auf Papier
Milan: Fußball (liest murmelnd die Meldungen durch) Nach dem Kuss-Eklat hat die FIFA den umstrittenen Verbandschef Rubiales suspendiert. Das teilte der Wel … da fehlt ein t, Weltverband …
Kerstin: Die Takes stehen drin?
Andrea: Reihenfolge Kuss, Arbeitsmarkt und Hochwasser.
Kerstin (hektisch): Falsche Reihenfolge, das Hochwasser ist zwei, der Arbeitsmarkt drei.
Milan: Dann stimmt die Reihenfolge bei mir auch nicht. Also wie jetzt?
Kerstin: Lass es so.
Andrea: Jetzt habe ich die Takes aber gerade getauscht.
Milan: (Papierrascheln) Also Kirchhoff, Mayer und dann Rehm?
Andrea: Genau.
Judith (hektisch): In der Meldung Überschwemmung, da muss es heißen, nahe des …«
Milan: Was hab ich denn?
Judith: Dem.
Kerstin (energisch): Stimmt so: nahe dem.
Judith (gereizt): Es geht beides.
Kerstin: Nein, Genitiv ist falsch.
Milan: Dann hab ich es doch richtig?
Geräusch: Milan steht auf und geht durch eine Tür hinaus und über den Gang ins News-Studio, man hört ein Zeitzeichen.
»Dem«, sagte ich. »Nahe mit Dativ.«
Die schmale Judith drehte sich um, blaue Augen ballerten mich an. Die sportliche Kerstin unterdrückte ein Grinsen. Ich hätte natürlich besser meinen Mund gehalten. Und die Trumpfkarte der einstigen Fremdsprachensekretöse zog ich lieber auch nicht. Außerdem hätte ich jetzt gerne eine Zigarette geraucht. Vom Nebenzimmer, in das die langhaarige Sekretärin gegangen war, wehte Milans Nachrichtenstimme herüber, jung und ein wenig affektiert.
Währenddessen stand Kerstin auf, streckte die Beine und ging zum Whiteboard, das an der Wand hing. An ihm klebten Dutzende von Magnetstreifen, auf die mit blauem, grünem und rotem Filzstift Stichwörter, Abkürzungen und Namen geschrieben waren. »Dann wollen wir mal.«
Ochs hatte mir erklärt, dass in einer bereits angegrauten Vorzeit ein einzelner CvD allein und »nach eigenem Gusto« die Auswahl der Themen und die Reihenfolge bestimmt hatte. Die anderen Redakteurinnen und Redakteure hätten ihm zugearbeitet. Nun herrschte das Vieraugenprinzip. »Die Redakteure MÜSSEN sich einigen.« Ochs hatte zufrieden gelächelt, als er das sagte.
Die blecherne Themenwand diente der gemeinsamen Planung.
Leitfaden für moderne Nachrichten von Roland Ochs
Die Ware Nachricht
Nachrichten- und Presseagenturen bieten weltweite News allen Massenmedien als vorgefertigte Meldungen zum Kauf an. Im globalen Nachrichtenfluss spielen sie eine zentrale Rolle. Sie sind das unsichtbare Nervensystem der Medienlandschaft.
Nachrichtenagenturen operieren als privatwirtschaftliche oder staatliche Unternehmen und sind untereinander durch Austauschverträge verbunden. Von den 140 Nachrichtenagenturen sind nur 20 frei von staatlichem Einfluss. Zehn davon befinden sich in Europa und bilden die Gruppe 39. Sie wurde vor dem Zweiten Weltkrieg als Hell Commune gegründet und sollte dafür sorgen, dass Meldungen auf eigenen Kanälen versendet und empfangen werden konnten. Namensgeber war der Hell-Schreiber, ein Fernschreibgerät, mit dem man Schrift störungsfrei telegrafieren konnte. Bei uns stammt der Großteil der Nachrichten heute von drei global agierenden Agenturen, der US-amerikanischen Associated Press (AP), der britischen Agentur Reuters und der französischen Agence France-Presse (AFP). In Deutschland ist die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit ihren zwölf Regionaldiensten oder Landesdiensten Marktführerin.
Die sportliche Kerstin wischte mit einem Tuch die 2 von 12 Uhr weg und malte eine 3 für 13 Uhr hin. Dann knickte sie ins Hohlkreuz wie ein störrischer Backfisch und fragte mit ihrer brüchigen Stimme: »Derselbe Aufmacher?«
»Hast du einen besseren?«, antwortete Judith schmallippig.
»Zum Bundestag kommt ein neuer KB.«
»A-näh! Das interessiert doch keinen.«
Kerstin verdrehte die Augen.
Judith drehte sich zu mir um. »Du hast schon mal Nachrichten gemacht?«
»Ja«, log ich, um die Pädagogik abzukürzen.
»Dann mach du doch mal einen Vorschlag für einen Aufmacher.«
»Äh!« Die Schlagworte auf den Magnetkärtchen an der Wand hoppelten in alle Richtungen. Sie waren gespickt mit Abkürzungen wie KB, LaPo oder HSS. »Hochwasser, was verbirgt sich dahinter?«
»Du hast wohl noch keine Nachrichten gehört. Das ist das Hochwasser in Portugal«, antwortete Judith.
»Das ist durch«, sagte Kerstin. »Vielleicht für die Tageszusammenfassung um 18 Uhr.« Sie zog den Magnetstreifen ab und klebte ihn ganz nach rechts.
Hinter BuTa verbarg sich der Bundestag, der über irgendwas debattierte, was Judith nicht interessant fand, wozu es aber für 13 Uhr einen Ton geben würde, womit ein Korrespondentenbericht gemeint war, kurz KB genannt oder auch mal Take, der in OpenMedia, also in der digitalen Datenbank, als MoE bezeichnet wurde, als Minute ohne Einspielung, die beispielsweise aus dem HSS, dem Hauptstadtstudio, also aus Berlin kam, oder von der LaPo, also aus der Redaktion Landespolitik, genauso wie die MmE, die Minute mit Einspielung, also mit O-Ton oder auch Originalton einer Politikerin oder eines Wirtschaftsbosses. Nicht für die News, sondern für die Magazine war der BmE, der Beitrag mit Einspielungen, der war 2:30 Minuten lang. Eine Geheimsprache ist die Basis aller Geheimbünde.
»Da gewöhnst du dich dran«, behauptete Kerstin.
»Wo hast du denn Nachrichten gemacht?«, erkundigte sich Judith misstrauisch.
»Bei Telecinco in Madrid.«
Judiths Brauen zuckten. »Ein Privatsender. Also, was wäre dein Vorschlag?«
»Ähm.«
Hinter dem Stichwort Griechenland verbargen sich verheerende Waldbrände, und Leiche bezog sich auf den Fund einer Frauenleiche im Kanal, zu dem die Staatsanwaltschaft am Morgen eine PK oder auch Pressekonferenz abgehalten hatte. Die Meldung war bereits um elf gelaufen.
»Könnten wir eigentlich mal wegwischen«, sagte Kerstin, ohne es zu tun.
»Heute ist einfach nichts los«, seufzte Judith, wandte sich dem Bildschirm zu und wechselte zu den Agenturmeldungen.
»Beschrei’s nicht«, sagte Kerstin, zog den Streifen mit dem Stichwort BuTa an die erste Stelle unter die 13 und setzte sich wieder hin.
»Hier: zwei Tote bei Waldbränden in Indien«, sage Judith.
Kerstin verzog das Gesicht. »Indien hat über eine Milliarde Einwohner.«
»Aber der Klimawandel!«
Beide scrollten stumm erbittert durch die Agenturmeldungen und verwarfen die Vorschläge der jeweils anderen. Milan kam vom Studio zurück, warf die Sendung in den Papierkorb und fragte mit Blick auf die Wand: »Wollt ihr wirklich mit dem Bundestag aufmachen?«
»Ich nicht«, sagte Judith.
Eine Weile herrschte Stille. Die Blicke klebten an den Bildschirmen. »Habt ihr gesehen«, sagte Milan, »es gibt ein Update zu den Überschwemmungen in Portugal.«
»Ist durch«, erklärte Kerstin.
»Aber das ist ein Urlaubsgebiet.«
Judith stand auf, ging an die Tafel, löste den Magnetstreifen mit dem Stichwort Flut von ganz rechts und setzte ihn anstelle des Bundestags, den sie beiseite klebte.
»Es gab mal eine Zeit«, sagte Kerstin, »da hätten wir selbstverständlich mit der Bundestagsdebatte aufgemacht. Wir haben schließlich einen öffentlich-rechtlichen Auftrag.«
Judith und Milan stöhnten. Judith klebte eine Sendung zurecht, die genauso aussah wie die vorige, nur dass auf den hinteren Plätzen die Reihenfolge verändert und die Meldung Griechenland durch die Meldung Leiche ersetzt worden war. Dann setzte sie sich wieder und wandte sich mir zu. »Möchtest du dich mal an der Leiche versuchen?«
Möchten? Nein. »Gern«, sagte ich.
Sekretärin Andrea half mir, meine Bildschirme zum Leuchten zu bringen und die Fenster zu öffnen, eines für Agenturen, eins für Word-Texte und eins für den Audio-Player, der zugleich die bereits geschriebenen Meldungen in einem Fach sammelte. Ich machte die Meldung »Leiche« von elf Uhr auf und las: »Nach dem mutmaßlichen Mord an einer unbekannten Frau hat die Staatsanwaltschaft noch keine Erkenntnisse zum mutmaßlichen Täter und möglichen Tatmotiv …«
Hä? Ich suchte nach den Agenturmeldungen dazu.
Leitfaden für moderne Nachrichten von Roland Ochs
Die Agenturmeldung
Die Nachrichtenagenturen formatieren ihre Meldungen immer gleich. Am Anfang steht die Spitzmarke. Das ist der Ort des Geschehens. Ihr folgt die Agenturkennung. Der erste Satz (Leadsatz) liefert die Kerninformationen: Wer hat was gesagt oder getan, was ist passiert? Der zweite Satz nennt die Quelle der Information: eine Bundestagsrede, eine Pressemeldung, ein Post auf einer Online-Plattform, eine Pressekonferenz, ein Interview. Im nächsten Absatz wird das Geschehen näher erläutert, gegebenenfalls werden Gründe aufgeführt und Rückgriffe auf vorausgegangenes Geschehen gemacht. Unsere Nachrichtenmeldungen folgen im Wesentlichen diesem Aufbau, sind aber deutlich kürzer.
Es gab eine Meldung von dpa und eine von der hiesigen Landesagentur. Dpa verwendete denselben ersten Satz. Der Landesagentur zufolge »tappt die Polizei noch im Dunkeln«. Die Geschichte war die, dass man vor anderthalb Wochen in einem der Kanäle der Stadt eine kopflose Frauenleiche mit Messerstichen im Rücken gefunden hatte. Das Neue war, dass eine Genanalyse ergeben hatte, dass sie vermutlich aus dem osteuropäischen Raum stammte, aber identifiziert war sie noch nicht.
Ich machte ein neues Word-Dokument auf und textete: »Die Staatsanwaltschaft kann auch eineinhalb Wochen nach dem Fund einer Frauenleiche ohne Kopf im Kanal keine Aussagen zum Täter und zum Motiv machen.« Nach 72 Stunden sind die Spuren kalt. Es würde schwer werden für die Ermittler. Ohnehin Quatsch. Das Neue war ja nicht der Fund, sondern die Herkunft der Toten. Also noch mal: »Die Staatsanwaltschaft hat fast eineinhalb Wochen nach dem Fund einer Frauenleiche ohne Kopf einen ersten Hinweis auf die Identität des Mordopfers. Täter und Tatmotiv sind noch unbekannt.«
Ich bosselte schon am nächsten Satz herum, als sich die schmale Judith mit dem Stuhl umdrehte und zu mir rollte. »Das kannst du so nicht schreiben. Das muss ›mutmaßliches Mordopfer‹ heißen. Bei uns gilt die Unschuldsvermutung, und bevor ein Mörder nicht rechtskräftig verurteilt wurde …«
»Es gibt noch keinen Beschuldigten. Und bei Messerstichen im Rücken kann man von einem Tötungsdelikt ausgehen«, belehrte ich sie in meinem Lisa-Nerz-Duktus. »Das Opfer wird sich die Stiche in den Rücken kaum selbst beigebracht haben. Totschlag käme zwar auch in Betracht, aber bei einem Angriff von hinten kann von Heimtücke ausgegangen werden. Das ist ein Kennzeichen von Mord. Ich kann natürlich auch Tötungsdelikt schreiben.«
»Bist du Juristin oder was?«
»Nein.«
»Also! Bei uns entscheiden Gerichte, wie schon gesagt. Und hier muss ›mögliches Motiv‹ hin. Oder steht inzwischen fest, dass es eine ausländerfeindliche Tat war?«
»Nein. Aber irgendein Motiv gibt es ja immer. Wenn ich ›mögliches Motiv‹ schreibe, dann heißt das doch: Es ist möglich, dass es ein Motiv gibt, aber es könnte auch sein, dass es keines gibt.«
Judith schnaubte. »Wir haben hier bestimmte Regeln.«
»Aber …«
»Für diese Meldung brauchen wir wohl unsere Krimiautorin«, bemerkte Kerstin.
»Und wer ist das?«, fragte ich.
»Adolfine Fürbeck.«
Kannte ich nicht. »Ich lese keine Krimis.«
»Sind gar nicht so schlecht«, behauptete die sportliche Kerstin. »Ziemlich düster. Wir versuchen sie ja immer zu überreden, dass sie mal einen Krimi über unseren Sender schreibt. ›Der Tod kam live‹ oder so.«
»Am besten, du schaust dir mal die Meldung an, die ich vorhin geschrieben habe«, unterbrach uns Judith mit leicht angeschrillter Stimme.
»Ich habe unseren Aufmacher«, rief Milan in den Raum.
»Ja?«, rief Judith und drehte sich freudig zu ihm um.
»Nämlich?«, fragte Kerstin misstrauisch.
»Unterwasser legt nach und fordert eine Sittenpolizei.«
»Wer ist Unterwasser?«, fragte ich.
Sie glubschten mich entsetzt an. »Anneliese Unterwasser, Deutschlands Rettung.«
»Wie?«
»So heißt die Partei, die sie gegründet hat.«
Judith hatte die Meldung ebenfalls aufgerufen und las daraus vor: »Aufreizende Kleidung macht Frauen zu Sexualobjekten und Freiwild auf der Straße. Davor müssen wir auch und vor allem unsere minderjährigen Mädchen schützen. Wo sie recht hat, hat sie recht.«
»Quatsch«, entfuhr es mir, ehe ich begriff, dass sie das ironisch gemeint hatte. »Männer sehen Frauen als Freiwild, egal, was sie anhaben.«
»Oha!«, machte Milan. »Das weise ich energisch von mir.«
»Du natürlich ausgenommen«, sagte Judith etwas zu laut.
Damit hatten wir seine sexuelle Orientierung auch geklärt. Ich gab »Unterwasser« ins Suchfeld der Agenturen ein.
»Es gibt ein Sammelangebot dazu. Kurz, lang, 12:45 Uhr«, meldete Milan.
»Dann machen wir das.« Judith sprang auf und ging zum Whiteboard, nahm den blauen Stift und schrieb »Sittenpolizei« auf einen Magnetstreifen, den sie unter 13 Uhr klebte.
»Meint ihr das ernst?«, fragte Kerstin. »Der müssen wir doch nicht ständig eine Plattform geben.«
»Wir können uns nicht aussuchen«, antwortete Judith streng, »was uns politisch genehm ist und was nicht.«
In den Agenturmeldungen sah ich, dass Unterwasser vor zwei Tagen drastische Strafen für die Vermüllung von Plätzen, Parks und Partymeilen gefordert hatte. Die Verursacher, »meist Jugendliche aus der Generation Spaßkultur und Verantwortungslosigkeit«, sollten zu Putzdiensten verurteilt werden, »damit sie Anstand lernen«. Dafür hatte sie ordentlich Zustimmung erhalten. Im vergangenen Herbst hatte sie bei einem Erntedank-Markt zum ersten Mal die Aufmerksamkeit eines Agentur-Reporters erregt, als sie sich über »Tonnen von Pflaumen und Mirabellen« aufregte, »die man wegschmeißen muss, weil Maden und Wespen das Obst angefressen haben. Dank der Grünen, denn die verbieten zwar Chemie in der Landwirtschaft, nicht aber die Pille, und die ist auch Chemie.« Im Zuge dessen hatte sie ein Verhütungsverbot für Frauen zwischen 18 und 40 gefordert. »Was für ein Unsinn, dass wir unsere Frauen im fruchtbarsten Alter unfruchtbar machen, nur damit sie Karriere oder Party machen können.« Im Gegenzug sollte es ein Verhütungsgebot für ausländische Frauen ab 25 geben, »die in Ermangelung von Bildung und Perspektiven Kinder werfen wie die Karnickel«. In knapp einem Jahr hatte sich Anneliese Unterwasser im Land zur führenden Produzentin von alternativen Fakten gemausert und die Partei Deutschlands Rettung gegründet, die nun bei Umfragewerten von knapp 20 Prozent stand.
Kerstin versuchte ruhig zu bleiben. »Wo hat sie das denn gesagt?«
»Das spielt doch keine Rolle«, rief Judith. »Sie hat es gesagt.«
»Warte …« Milan schaute in die Meldung. »Das hat sie gesagt bei … bei einem Treffen mit Vertretern von Sozialverbänden und Gewerkschaften zum Thema …«, er lachte halb entrüstet, halb anerkennend, »Chancengleichheit für Mädchen und Frauen.«
Judith lachte ebenfalls.
»Und in welcher Funktion hat sie das gesagt?«, fragte Kerstin genervt. »Doch nur als Privatmensch.«
»Als Parteivorsitzende. Die PDR tritt bei den nächsten Wahlen an«, keifte Judith. »Und wir haben eine Informationspflicht, schon vergessen?«
»Aber doch nicht zur Volksverdummung!«
»Es steht uns nicht zu, zu werten«, mahnte Milan. »Das wäre so was wie Zensur.«
»Aber es ist doch ein Unterschied, ob jemand im Landtag einen Vorschlag zur Lösung der Energiewende macht oder ob sich eine selbsternannte Volkstribunin zur Mode äußert.«
»Um Mode geht es nicht«, sagte Judith erregt. »Die will unsere Freiheit beschneiden. Darum geht es. Das müssen die Leute wissen, die so eine wählen wollen.«
»Das wissen die Leute längst«, seufzte Kerstin. »Und ich sag dir: Es gefällt ihnen.«
»Gesprächswert hat es auf jeden Fall«, bemerkte Milan. »Bei Insta geht das voll viral.«
Kerstin bäumte sich noch einmal auf. »Wir machen uns zum Handlanger dieser Leute.«
»Grundsatzdebatten bringen uns nicht weiter«, stellte Judith fest. »Also ich bin dafür, dass wir damit aufmachen. Was meinst du, Milan?«
»Ich denke, das kann man machen.«
»Zwei zu eins. Du bist überstimmt, Kerstin.« Es klang schrill.
»Fragen wir doch mal unsere Neue«, sagte Kerstin. Alle Augen richteten sich auf mich.
»Mir scheint, diese Tante hat euch gut im Griff. Die weiß, wie das geht.«
»Sie ist ja schließlich auch eine von uns, äh, gewesen«, sagte Kerstin mit ihrer bröseligen Stimme.
»Wie?«
»Eine Kollegin, Ex-Kollegin. Wir haben zusammen Volontariat gemacht. Die hatte damals schon einen Drang zu Höherem.«
Judith konnte da nicht mitreden, sie war zu jung.
»Sie hat dann eine Karriere hingelegt«, erzählte Kerstin auf ihre resignationsbissige Art, »da haben uns die Ohren geschlackert. Nachrichtenchefin, Programmchefin, Ausbildungschefin, Verwaltungsdirektorin. Dann kam raus, dass sie ihrer Frau Millionenaufträge zugeschanzt hat. Die hat eine Filmgesellschaft. Dann war sie nur noch Chefin der Verkehrsredaktion, und vor fünf Jahren war sie dann weg.«
»Habe ich gar nicht gewusst«, sagte Judith.
»Und jetzt ist sie wieder da«, antwortete Kerstin und deutete Richtung Fenster nach draußen. »Auf der anderen Seite unserer Wand.«
»Und ihr müsst tun, was sie sagt«, stellte ich fest. »Ich meine, ihr müsst es melden, wenn sie was sagt.«
Kerstin verdrückte ein verständnisinniges Lächeln. Die beiden jungen Leute, Judith und Milan, schwiegen, um die schnelle Antwort verlegen.
Milan fand den Ausweg: »Bisher gibt es erst eine Agentur.«
Aus den Anfängen meiner Arbeit für den Stuttgarter Anzeiger kannte ich noch den Satz »Eine