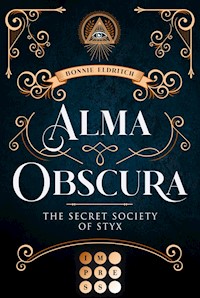
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
»Willkommen, Alma, in den Armen des Styx.« Alma kann nicht glauben, dass ausgerechnet sie die Alleinerbin ihrer sonderbaren Großtante sein soll. Als die Studentin im Nachlass ein magisches Buch findet, wird sie kurz darauf von einem Schattendämon angegriffen. Im letzten Moment kann sie von einem fremden jungen Mann gerettet werden, der sie mit zur sagenumwobenen Geheimgesellschaft Styx nimmt. Dort erfährt Alma, was sie wirklich ist: eine Hexe! Charon, der zwar verboten attraktiv, aber auch unnahbar und arrogant ist, soll fortan stets an ihrer Seite bleiben und Alma helfen, mehr über ihre Kräfte zu erfahren. Doch je tiefer sie in die mystische Welt eintaucht, desto mehr erfährt sie über ihr wahres Erbe – und über die Schatten, die sie selbst in sich trägt. Tauche ein in die übernatürliche Welt einer magischen Studentenverbindung und lass dich von düsteren Fae und dunklen Dämonen in ihren Bann ziehen! Textauszug: »Ich spüre seine filigranen Finger sanft über meine Haare fahren, so viel sanfter, als ich es ihm je zugetraut hätte; hauchzart, als hätte er Angst, sich zu verbrennen, wenn er mich berührt. Und doch hält es ihn nicht zurück, weder seine Fingerspitzen noch seinen Blick, der ebenso streichend über mein Gesicht gleitet und schließlich den meinen findet und ungewohnt weich erwidert. Die Welt steht still um uns herum und ich habe alles vergessen. Wo ich bin, wer er ist. Ich will ihn von mir stoßen und an mich ziehen, will, dass er mich liebt und hasst, will mich verlieren und finden. Alles und doch nichts.« //»Alma Obscura. The Secret Society of Styx« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Bonnie Eldritch
Alma Obscura. The Secret Society of Styx
»Willkommen, Alma, in den Armen des Styx.«
Alma kann nicht glauben, dass ausgerechnet sie die Alleinerbin ihrer sonderbaren Großtante sein soll. Als die Studentin im Nachlass ein magisches Buch findet, wird sie kurz darauf von einem Schattendämon angegriffen. Im letzten Moment kann sie von einem fremden jungen Mann gerettet werden, der sie mit zur sagenumwobenen Geheimgesellschaft Styx nimmt. Dort erfährt Alma, was sie wirklich ist: eine Hexe! Charon, der zwar verboten attraktiv, aber auch unnahbar und arrogant ist, soll fortan stets an ihrer Seite bleiben und Alma helfen, mehr über ihre Kräfte zu erfahren. Doch je tiefer sie in die mystische Welt eintaucht, desto mehr erfährt sie über ihr wahres Erbe – und über die Schatten, die sie selbst in sich trägt.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© Janine Ulbrich
Born and raised im Bremer ¼ war Bonnie Eldritch schon immer fasziniert vom Düsteren, wenngleich sie ihre Liebe zu schwarzem Kaffee und schwarzer Kleidung erst noch entwickeln musste. Mit dem Schreiben begann sie erst mit 15, inspiriert von einer nebligen Nacht in den slowenischen Bergen. Fantasygeschichten, besonders der finsteren Sorte, waren jedoch stets ein Teil ihres Lebens und ihr literarisches Idol ist seit Jahren H.P. Lovecraft. Als selbsternannte Hexe lebt sie heute allein in einer kleinen Wohnung – leider ohne Pflanzen, da diese stets den Freitod bei ihr wählen.
Inhaltswarnung
Liebe Lesende,
wenn ihr kein Fan von Triggerwarnungen seid, dann könnt ihr diese Seite getrost überblättern. Sie ist nicht an euch gerichtet. Doch Alma Obscura ist eine düstere Urban Fantasy und beinhaltet einige Themen, die nicht für alle Lesenden leicht zu verdauen sind. Solltet ihr also mit euren ganz eigenen Dämonen zu kämpfen haben, dann bereitet euch gegebenenfalls darauf vor, in diesem Buch mit triggernden Inhalten konfrontiert zu werden. Darunter befinden sich die Themen Mobbing in der Vergangenheit und dessen Auswirkungen, toxische Männlichkeit, dämonische Besessenheit, Einsamkeit, Suizid, explizite Gewaltdarstellungen, Blut sowie Verlust und Trauer. Zudem werden ableistische Ausdrücke benutzt und von einem Protagonisten unbewusst antisemitische Aussagen reproduziert.
Bei Fragen könnt ihr mich gerne auf Instagram oder Facebook kontaktieren.
Eure Bonnie Eldritch
Für jedes (ehemalige) Opfer von Mobbing.Gib nicht auf – auch du wirst deinen Weg finden.
Golden
Nebel trifft auf Bucht und Stadt,
lässt schemenhaft verschleiert
liegen, was verloren wirken mag;
In fragile Helligkeit gehüllt warst du
es doch nicht; Dunkelheit floss träge
aus den Löchern deines Herzens, deiner Seele;
ließ dein bittres Antlitz in den Schatten
dennoch sanft auf jeden wirken, zart
als würden deine Adern
Blumen bluten.
von H. Storm
1
Das falsche Lächeln auf meinen Lippen beginnt langsam schmerzhaft zu werden. Meine Wangen sind verkrampft und flehen mich an, endlich die Mundwinkel zu senken – ich bin es nicht mehr gewöhnt, gute Laune vorzutäuschen. Einer der vielen Vorteile, die das Campusleben mir bietet. Aber manches ändert sich wohl nie und die konstante Nörgelei meiner Mutter gehört definitiv dazu.
Ich lege eine Hand auf das für diese Wohngegend so typische gusseiserne Tor mit Art-Deco-Muster und nicke, als meine Mutter mir zum fünften Mal einbläut, meine Oma anzurufen. Die Verabschiedung dauert nun schon gut zwanzig Minuten, doch das ist normal für meine Familie. Teil unseres Kulturerbes, sagt mein Vater immer. Fast bin ich froh, dass er heute länger arbeitet und Mutter deswegen allein zu Hause ist. Ansonsten würde ich hier wohl bis Einbruch der Dunkelheit versauern.
»Ich muss jetzt wirklich los, Mom«, versuche ich erneut, ihren Redeschwall zu unterbrechen, und bin beinahe erstaunt, als es klappt.
»Schon gut, schon gut.« Sie seufzt schwer, um ihre Enttäuschung zu verdeutlichen, dann schließt sie mich ein letztes Mal fest in die Arme. Ihr Duft nach Opium von Yves Saint Laurent steigt mir in die Nase, schwer und exotisch. Als sie sich von mir löst, ruhen ihre Hände weiterhin auf meinen Schultern und ihre Augen mustern mich streng unter den nachgezogenen Brauen. »Schreib mir, wenn du im Wohnheim angekommen bist, ja?«
»Natürlich, Mom.« Wieder fake ich ein Lächeln und weiß gleichzeitig, dass sie den Unterschied zu einem echten nie bemerken wird. Ich lasse mich von ihr auf die Wange küssen und daran erinnern, die Suppe zu essen, die sie mir in einer Tupperdose mitgegeben hat.
»Gei gesund, mein Schatz.« Ein letztes Mal streicht sie mir die blonden Haarsträhnen hinters Ohr und schenkt mir ein warmes, herzliches Lächeln, das mir einen Stich im Herzen verpasst.
»Bis bald«, gebe ich zurück und mache mich dann eiligst auf den Weg. Zwar ist das Manzanita-Square-Studentenwohnheim nur einen kurzen Fußweg vom Haus meiner Eltern entfernt und ich habe eigentlich nicht vor, den Abend wirklich mit Lernen zu verbringen, wie ich es meiner Mutter aufgetischt habe, doch ich habe keine Lust, dass sie den Stuss durchschaut.
Erst als drei Blocks zwischen mir und dem Eckhaus meiner Eltern liegen, verlangsame ich meine Schritte und erlaube mir ein lautes Ächzen, lege den Kopf in den Nacken und atme tief durch. Die laue Septemberluft ist ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit, was immerhin den Vorteil hat, dass Karl sich mal wieder blicken lässt. Während ich die Nachbarschaft meiner Eltern, Merced Heights, entspannt verlasse, öffne ich Instagram und gucke, ob auf dem Account Karl, the San Francisco Fog etwas gepostet wurde. Nichts Neues, auch wenn die vielen Fotos vom berühmt-berüchtigten Nebel mich glücklich stimmen. Ich lasse das Smartphone wieder in die Tasche meines Oversized-Mantels gleiten. Mir wird sowieso niemand schreiben.
Jedenfalls denke ich das, bis ich im Apartment die Tupperdose mit Matzeknödelsuppe in den Kühlschrank räume und dabei einen zerknitterten Brief in dem Beutel finde. Ich werfe einen Blick zu meiner Mitbewohnerin Grace, die am Esstisch zwischen Küche und Wohnbereich sitzt und sich auf ihre nächste Biologievorlesung vorbereitet. Von meinen anderen beiden Mitbewohnerinnen – Hailey, einer Anwaltstochter und Literaturstudentin, sowie Melaina, die Philologie studiert und laut Hailey und Grace sicher Teil einer semigeheimen Studentenverbindung names Styx ist, da sie uns eher meidet – fehlt jede Spur. Kurz überlege ich, trotzdem in mein Zimmer zu gehen, doch dann siegt die Neugier.
Alma Rosenhain steht auf dem Kuvert, gefolgt von der Adresse meiner Eltern. Ich runzle die Stirn. In den zwei Semestern, die ich bereits auf dem Campus wohne, habe ich noch nie einen Brief erhalten. Als mein Blick zum Absender wandert, stocke ich jedoch. Notariat Jonathan Bennett. Ich habe noch nie von der Kanzlei gehört, geschweige denn jemals Kontakt mit einem Notar gehabt. Plötzlich fühlt sich meine Kehle furchtbar trocken an und in meinem Inneren frisst sich Unsicherheit durch mein Bewusstsein. Habe ich etwas falsch gemacht? Ein Gesetz gebrochen? Meine Finger zittern und mit ihnen der Umschlag, den ich noch immer unverwandt anstarre.
Mir ist klar, dass die aufbrandende Panik vor einem Brief dämlich ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss, doch gleichzeitig kann ich nicht verhindern, dass mir eintausend Horror-Szenarien in den Kopf schießen, was ich verbockt haben könnte.
»Alles okay bei dir, Alma?«, höre ich Grace wie durch Watte fragen.
Immerhin holen ihre Worte mich wieder zurück in die Realität und helfen mir, die Zwangsgedanken wegzuschieben. »Alles gut, ich bin nur überrascht. Anscheinend hat mir ein Notar geschrieben.«
Als ich jedoch den Briefbogen entfalte, treffen mich die Worte völlig unvorbereitet. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Großtante Gisela Bromberg …
Großtante Gisela. Wie lange habe ich nichts von ihr gehört?
»O je, du bist ganz schön bleich, steht was Mieses drin?«, fragt Grace.
Ich bin doch immer blass, will ich sagen, doch traue mich nicht. Stattdessen schlucke ich den Kloß in meinem Hals herunter und blicke von dem Brief auf. »Meine Großtante ist tot.«
Augenblicklich scheint jegliche Wärme aus unserem Apartment gewichen. Selbst die sonst so warmbraunen Haare von Grace wirken auf mich aschig.
»Uff«, flüstert sie und verfällt dann wieder in ein bedrücktes Schweigen, bevor sie hinzufügt: »Das tut mir so leid, Alma.«
»Ist schon okay, ich kannte sie kaum.« Das ist nicht gelogen. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht einmal an Großtante Giselas Gesicht. Als wir uns das letzte Mal auf einer Familienfeier gesehen haben, muss ich noch im Kindergarten gewesen sein.
»Aber der Notar hat trotzdem dir geschrieben?«
Mir ist das Zweifeln in ihrer Stimme schmerzlich bewusst, auch wenn ich es gut verstehen kann. Gott sei Dank ist Hailey mit ihrer schnippischen Art nicht hier, ansonsten würde ich wohl noch mehr mit der Situation kämpfen. Auch wenn ich vor wenigen Wochen bereits mein drittes Semester angefangen habe, fällt mir der Umgang mit meinen Mitbewohnerinnen nach wie vor schwer. Bewerten sie mein Verhalten, mein Aussehen? Reden sie über mich, wenn ich nicht dabei bin? Wird Grace alles, was ich ihr jetzt sage, später Hailey erzählen, um sich darüber zu amüsieren?
»Blöde Frage, sonst hättest du den Brief ja nicht in der Hand, ups«, reißt mich Grace wieder aus den Gedanken und ich blinzle sie verdutzt an. Sie lächelt, ehe sie mit den Schultern zuckt und neugierig auf den Brief deutet. »Steht noch was drin?«
»Ich soll morgen in die Kanzlei kommen«, murmle ich und blicke wieder auf die wenigen Zeilen, die der Notar an mich gerichtet hat. Dennoch fokussiere ich mich auf Graces Worte und darauf, die aufdringlichen Gedanken zu widerlegen, die sie in mir ausgelöst haben. Kurz spüre ich Scham in mir aufbranden, doch ich schiebe sie grob beiseite. Ich muss mich nicht vor meinen Mitbewohnerinnen fürchten. Es ist okay, dass ich trotzdem in alte Muster verfalle, solange ich sie bemerke und dagegen arbeite. Alles ist gut.
»Und? Wirst du hinfahren?«, fragt Grace weiter. Ihr Buch über Mikrobiologie hat sie längst zugeklappt.
Ich muss lächeln über ihren Enthusiasmus und nicke ihr schließlich zu. »Hoffentlich ist das kein schlechter Scherz.«
2
Als ich am nächsten Mittag in der kleinen Kanzlei im zwölften Stock eines Hochhauses in Downtown sitze, bin ich immer noch nicht an einem Punkt angelangt, an dem ich Giselas Tod begreifen kann. Selbst nach dem Telefonat mit Jonathan Bennett, dem Notar, fühlt sich alles surreal an.
Nervös spielen meine Finger an dem linken Ärmel des Blazers, den ich mir in einem verzweifelten Versuch, irgendwie seriös zu wirken, übergeworfen habe. Das hätte vielleicht auch geklappt, wenn ich nicht darunter ein Leopardenmuster-Shirt angezogen hätte, das mich aussehen lässt wie eine junge Version von Sylvia Fine aus Die Nanny. Oy.
Ich zucke erschrocken zusammen, als sich die Bürotür von Mister Bennett öffnet und er mich freundlich zu sich hereinbittet.
»Nur keine falsche Scheu, Miss Rosenhain!« Er scheint die Tür hinter mir besonders vorsichtig zu schließen, als hätte er Angst, dass ich beim nächsten lauten Geräusch mit Anlauf aus dem Fenster springe. Zugegeben, das würde ich auch am liebsten tun, doch die Fenster sind wahrscheinlich aus Sicherheitsglas. »Es freut mich, dass Sie es so schnell einrichten konnten.« Mister Bennett lässt sich auf seinem dicken Ledersessel hinter dem Schreibtisch nieder und öffnet eine Schublade des Aktenschranks daneben. Ich erhasche einen Blick auf Unmengen an Akten, bevor er zielstrebig einen Manila-Umschlag hervorzieht, auf dem die Adresse der Kanzlei steht. Fragend schaue ich ihn an und setze mich ebenfalls.
»Ich muss gestehen, dass wohl niemand von uns mit Giselas Tod gerechnet hat und ich erst eine Weile suchen musste, bis ich ihr Testament wiedergefunden habe. Deswegen war es auch nicht Ihrem Brief beigefügt«, fängt er zu erklären an, während er ein einzelnes Blatt aus dem Umschlag zieht und es mir reicht. »Mit einem tödlichen Herzinfarkt hat wohl niemand gerechnet. De facto waren Gisela und ich sogar nächste Woche zum Bridge verabredet, und ich bin mir sicher, dass Sie wahrscheinlich nicht minder überrascht waren, als Sie von ihrem Ableben hörten?«
»Um ehrlich zu sein«, setze ich vorsichtig an, doch halte inne, da mir die Worte wegbleiben. Ja, was denn genau? War ich überrascht? War ich geschockt? Ich schaue auf das Testament und schlucke schwer.
»Ah, ich bitte darum!« Bennett scheint meine dramatische Pause als Wunsch nach Interesse gewertet zu haben, was mir augenblicklich das Blut in den Kopf schießen lässt.
»… ich habe seit fast zwanzig Jahren nichts mehr von Großtante Gisela gehört.«
»Oh«, macht Bennett. Die Information scheint ihn zu überraschen, denn seine gesamte Haltung ist mit einem Mal angespannt. »Seltsam. Gisela erzählte manchmal von Ihnen und es klang stets, als würden Sie einander … nahestehen.«
Ich sacke auf meinem Stuhl zusammen und zucke hilflos mit den Schultern.
»Verzeihen Sie die Frage, aber haben Sie jemals den Spruch Panta Rhei gehört, Miss Rosenhain?«
Fragend blicke ich auf und schüttle den Kopf.
»Verstehe, verstehe.« Es dauert eine Sekunde, bis der Notar in Mister Bennett die Kontrolle übernimmt und er zu seinem professionellen Auftreten zurückkehrt. »Egal, vergessen wir das. Wenn Sie stattdessen einen Blick auf das Testament werfen möchten, werden Sie feststellen, dass Miss Gisela Bromberg Sie als Alleinerbin eingesetzt hat.«
Mir klappt der Mund auf, was Mister Bennett jedoch nicht davon abhält, weiterzusprechen. Als würde er instinktiv meine Fragen spüren, rattert er einen einstudiert wirkenden Vortrag darüber herunter, dass es keine weiteren Anspruchsteller gibt und das Testament nicht anfechtbar ist, gepaart mit den zugehörigen Rechtsprechungen und Erläuterungen.
Es dauert nicht lange, bis ich von all den Informationen vollkommen überfordert bin und den Faden verliere.
»Stopp, bitte«, stoße ich hervor. »Das ist alles zu viel, Mister Bennett, ich … ich verstehe das nicht.«
»Machen Sie sich keine Gedanken, Miss Rosenhain. Gisela hat zu Lebzeiten alles mit mir abgeklärt. Ich übernehme sämtliche Arbeit für Sie, sowohl die Verwaltung als auch die juristischen Papiere und …«
»Aber was wird das kosten?« Verzweifelt rücke ich näher an Bennetts Schreibtisch und lege das Testament weg. »Ohne meine Eltern könnte ich nicht einmal studieren, wie soll ich da einen Anwalt zahlen?«
»Zunächst einmal …«, setzt Bennett an und lächelt auf eine seltsam gutmütige Art und Weise. Meine Finger zerknittern das arme Testament und ich nehme sie schnell vom Tisch. »Ich bin Notar, kein Anwalt. Das ändert zwar nichts an der Tatsache, dass mich jemand bezahlen muss, doch darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen. Ihre Großtante hat zu Lebzeiten alles für Sie geregelt, angefangen bei meiner Bezahlung und aufhörend bei der Verwaltung ihres Eigentums. Ich bin ihr Beistand, Verwalter und Berater. Alles was Sie, Miss Rosenhain, noch tun müssen, ist das Erbe zu akzeptieren.«
Als ich drei Stunden später in den Fahrstuhl neben der Kanzlei trete und mit zitternder Hand die Taste fürs Erdgeschoss drücke, ist mir noch immer nicht vollends bewusst, was seit gestern Nachmittag geschehen ist. Die Kabine setzt sich lautlos in Bewegung, was meinen Magen einen schmerzhaften Satz machen lässt. Mein Frühstück liegt einen halben Tag zurück und als ich den Blick vom Boden hebe, blickt mir mein erschreckend blasses Spiegelbild entgegen. Tiefe Schatten lassen meine Augen größer und noch tonloser wirken; ein Mischmasch aus Blau und Grün und Grau, der im kalten Neonlicht der Fahrstuhlbeleuchtung fast farbtot aussieht.
Schnell wende ich meine Aufmerksamkeit auf die digitale Anzeige der Stockwerke. Der Blick in den Spiegel fiel mir noch nie leicht und auch wenn ich mittlerweile halbwegs okay mit meinem Aussehen bin, insbesondere seitdem ich immerhin ein kleines bisschen Farbe angenommen und endlich Gewicht zugelegt habe, so schmerzhaft ist für mich der Anblick, wenn es mir nicht gut geht. Ich brauche dringend etwas zu essen, das meinen Blutzucker in die Höhe treibt und mich nicht mehr tot aussehen lässt. Allein der Gedanke daran, was Passanten wohl über mich und meine Gesundheit mutmaßen, wenn sie mich so sehen, lässt mich zittern.
Obwohl das Gespräch mit Mister Bennett für mich durchweg positiv, ja beinahe traumhaft verlaufen ist, fühle ich mich schrecklich. Mehr noch, ich fühle mich undankbar und maßlos, bin überfordert von meinen eigenen Gefühlen und der erdrückenden Realität des Testaments.
Großtante Gisela ist tot.
Auch als ich aus dem Gebäude in die lauwarme Spätsommerluft trete, erscheint mir das nicht real. Mein Hirn kann diese Information nicht wirklich fassen, nicht wirklich begreifen. Ich versuche, mir ein Bild ins Gedächtnis zu rufen, mich an ihr Gesicht zu erinnern oder wenigstens an irgendetwas von ihr, doch ich scheitere.
Dafür erinnere ich mich bildhaft an das Abendessen bei meiner Oma, bei dem sie unserer Familie von dem großen Streit berichtet hat, den sie mit Gisela hatte. Damals hatte ich keine Ahnung, dass ich sie nie wieder sehen, ja nicht einmal an sie denken würde, bis ihr Testament mich erreicht. Sie war weg und ich hatte es stillschweigend hingenommen.
Und nun bin ich ihre Alleinerbin.
Mister Bennett hat sich alle Mühe gegeben, mir die juristischen Details zu ersparen und stattdessen zu erklären, was genau ich geerbt habe. Neben einer hübschen Summe bei der Bank of San Francisco und einigen Aktien, von denen ich sowieso nichts verstehe, besteht mein Erbe hauptsächlich aus einer Sache, die mich noch immer fassungslos den Schlüsselbund in meiner Manteltasche umfassen lässt.
Großtante Gisela war Besitzerin einer Wohnung hier in Downtown.
Nicht Mieterin, nein. Besitzerin. Und wenn man die Immobilienpreise in der Bay Area und insbesondere San Francisco bedenkt, ist das vergleichbar mit einem Sechser im Lotto – wobei der einem wahrscheinlich keine Wohnung in Downtown bezahlen kann!
Okay, vielleicht übertreibe ich, aber dennoch. Selbst ein winziges Apartment kostet in dieser Gegend mehrere hunderttausend Dollar und ich erinnere mich noch gut an einen Zeitungsartikel, in dem eine Nobel-Wohnung mit Blick über den Fisherman’s Wharf für zwölf Millionen angeboten wurde. Zwölf! Egal wie heruntergekommen Großtante Giselas Zuhause auch sein mag, die Lage ist unschlagbar.
Wieder fahre ich mit der Fingerspitze die Konturen der Schlüssel in meiner Tasche nach, meine Aufmerksamkeit wird jedoch von etwas anderem angezogen. Zuerst ist es der süße Duft von Gebäck, der mir in die Nase steigt und der meinen Magen knurren lässt, dann erspähe ich den Donut-Shop. Im Normalfall bin ich, wenn überhaupt, nachmittags in Downtown und Bob’s Donuts wird von Einheimischen wie Touristen belagert, doch im Augenblick, kurz nach der Mittagspause, steht nur eine Handvoll Leute vor der Ladentheke. Ich stehe schneller selbst an, als ich darüber nachdenken kann. Übe meine Bestellung ein Dutzend Mal in meinem Kopf und verhasple mich dennoch, als ich an der Reihe bin.
Ich weiß, dass ich kirschrot im Gesicht bin, als die junge Angestellte mir meinen Milchkaffee und eine kleine, rosa Pappschachtel mit zwei Donuts reicht. Dennoch bedanke ich mich höflich und erwidere das »Schönen Tag noch«, ehe ich schnell weitergehe. Das Gebäck werde ich später essen, wenn ich in der Wohnung bin. Nicht, dass es mir unangenehm wäre, in der Öffentlichkeit zu essen oder so. Ich esse sogar gerne vor anderen, um Nachfragen über mein Essverhalten vorzubeugen. Doch jetzt gerade bin ich viel zu aufgeregt, um mich irgendwo hinzustellen und Donuts zu mampfen.
Stattdessen nehme ich einen vorsichtigen Schluck von dem Milchkaffee und schreibe meinem Bruder eine Nachricht, dass er sich so schnell wie möglich bei mir melden soll. Zwar ist mir bewusst, dass er entweder lernt, in einer Vorlesung sitzt oder trainiert, doch ich hoffe, dass er es für mich unterbricht. Ich muss mit jemanden reden und Bram ist der einzige Mensch, mit dem ich immer und offen über alles sprechen kann.
Als die Nachricht abgeschickt ist, öffne ich die Navi-App auf meinem Telefon. Bis zu Großtante Giselas ehemaliger Adresse sind es noch einige Blocks, doch mein Magen hängt mir bereits jetzt in den Kniekehlen. Ich lege einen Schritt zu und konzentriere mich darauf, nicht auf die Rillen des Bordsteins zu treten, wie ich es als Kind immer getan habe. Mir ist jede Ablenkung recht, solange ich nicht darüber nachdenken muss, dass diese ganze Erbgeschichte real ist. Auf keinen Fall will ich mir eingestehen, dass ich – von allen Mitgliedern der Familie, ausgerechnet ich – wirklich Giselas Alleinerbin bin. Wie kann das Realität sein und nicht nur ein ausführlicher Traum?
Keine zehn Minuten später erreiche ich den Broadway, der die Hälfte meines Wegs markiert und zu einer der längsten Straßen der Stadt gehört. Anders als der Broadway in New York hat dieser hier allerdings keine Musicaltheater. Stattdessen beheimatet er eine Menge Nachtleben-Etablissements, die ich noch nie betreten habe. Auf dieser der Innenstadt zugewandten Hälfte, nahe des Broadway Tunnels, finden sich jedoch zu meiner Überraschung kaum Clubs oder Restaurants, sondern fast nur Wohnhäuser. Im Stadtviertel gegenüber ragen Hochhäuser auf und erst jetzt fällt mir auf, dass ich zwar mein gesamtes Leben in San Francisco wohne, doch in diesem Teil der Stadt noch nie wirklich war.
Ein Anflug von Aufregung lässt mich die Zähne fest aufeinanderbeißen. Ich überquere den Broadway und setze meinen Weg in Richtung des Hafens fort. Mein Herz fängt an, mir bis zum Hals zu schlagen, ein widerliches Pochen in meiner Aorta, das meinen gesamten Körper erbeben lässt. Ich will es ignorieren, doch mit jedem Schritt pocht es erneut auf.
Nachdem ich einen weiteren Block hinter mir gelassen habe, werfe ich wieder einen Blick auf mein Handy.
So gut wie da.
Meine Finger verkrampfen sich um den Schlüssel in meiner Manteltasche, der durch die Hitze meines Körpers geradezu zu glühen scheint. Am liebsten würde ich laut schimpfen, doch dazu bin ich zu nervös.
Noch fünfzig Schritte.
Wie automatisch wird mein Blick von dem großen Hochhaus-Kasten angezogen, der an der gegenüberliegenden Straßenecke aufragt. Das muss es sein. Giselas Zuhause. Ist es plötzlich wärmer geworden?
Zwanzig Schritte.
Schweiß rinnt meinen Nacken runter und das erste Mal an diesem Tag wünsche ich mir, dass die kühle Seeluft eine Brise durch die Stadt schicken möge. Eigentlich liebe ich das sonnige Wetter Kaliforniens, auch wenn San Francisco nicht ganz Los Angeles oder San Diego ist, doch gerade würde ich für Kälte alles tun.
Zehn Schritte.
Der viereckige Kasten ist fast genauso hoch wie er breit ist und plötzlich werde ich mir der Tatsache bewusst, dass ich nicht nur eine Wohnung in einer riesigen Gemeinde geerbt habe, sondern auch die Nachbarn dazu. Ob sie mit Großtante Gisela befreundet waren?
Mein Herzschlag scheint mit der Erkenntnis einzufrieren. Beinahe erscheint es mir, als wäre der unterschwellige Lockruf der Wohnung plötzlich verstummt. Die Hitze ist verflogen und von der Panik ist nichts übergeblieben.
Unschlüssig bleibe ich am Bordstein der letzten Querstraße vor meinem Ziel stehen und blicke die Fassade empor. Die ersten drei Stockwerke sind weiß verputzt, doch die vier darüber sind aus braunem Backstein. Lediglich die für San Francisco so typischen Erker sind bis zum Flachdach hoch in Weiß gehalten. Eher untypisch sind hingegen die Feuertreppen, die zwischen den Erkern angebracht sind und als Notausgang dienen.
Das Haus ist perfekt. Urban und schick, ohne übermäßig edel zu wirken.
Verzweifelt versuche ich, die Frage aus meinem Kopf zu verbannen, wie viel eine Wohnung hier wohl kostet. Selbst für eine Ein-Zimmer-Wohnung zahlt man mindestens eine halbe Million. Woher hatte Großtante Gisela so viel Geld? Mister Bennetts Worte kommen mir in den Kopf.
Machen Sie sich keine Gedanken, Miss Rosenhain. Alles ist geregelt.
Doch wie? Die monatlichen Kosten einer Eigentumswohnung sind nicht zu verachten, das weiß ich von Bram. Die Steuern – Himmel, denk nicht drüber nach! Ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, was ich fühle, doch mein Körper ist seltsam taub.
Kann mir mal jemand sagen, wieso ich so übertrieben reagiere? Was ist hier los?
Die Einsicht, dass ich mich seltsam verhalte, hilft mir dabei mich zu beruhigen und ich atme tief durch. Dann überquere ich die letzte Straße und suche nach dem Eingang des Hauses. Auf der Straße neben mir fährt eine historische Schienenbahn vorbei, doch ich schenke ihr kaum Beachtung. Stattdessen trete ich auf das Portal zu, das sich in einem kleinen Alkoven versteckt, der mit reichlich Stuck und Fries verziert ist. Durch mein Studium der Museologie erkenne ich den halbrunden Tympanonbogen, ein typisches Schmuckelement, das seit der Antike immer wieder gerne genutzt wird. Hier sind jedoch keine Musen oder Götter zu sehen, sondern leere Wappenschilde. Zu meiner Überraschung ist die Eingangstür nicht verschlossen und ich kann problemlos eintreten. Dann wiederum habe ich auch nur einen Schlüssel von Mister Bennett bekommen und ich vermute ganz stark, dass dieser für die Wohnungstür sein wird. Er schmiegt sich in meine Handfläche, als wäre er für mich geschaffen worden, warm und schwer.
Ein großes, marmornes Foyer empfängt mich mit klimatisierter Luft. Der Blick auf das Klingelschild erschlägt mich ein wenig, denn es wohnen in der Tat eine Menge Menschen in diesem Klotz – nicht, dass ich etwas anderes erwartet habe, doch die schiere Menge an Nachbarn überfordert mich. Was, wenn mich jemand anspricht? Und was, wenn dieser jemand Gisela kannte? Allein die Vorstellung, dass ich mit Fragen zu meiner verstorbenen Großtante bombardiert werde, die ich niemals beantworten könnte, lässt meinen Magen hüpfen. Ich trinke einen großen Schluck des Milchkaffees in der Hoffnung, dass die Flüssigkeit ihn beruhigt. Kein Glück.
Nach einigen Minuten durchschaue ich endlich das System, nach dem die Wohnungen eingeteilt sind und verstehe, dass ich ins oberste Stockwerk muss. Als ich auf den Knopf des Aufzugs drücke, springen die Türen rechts von mir lautlos auf. Auch hier drinnen ist die Luft klimatisiert und leiser Jazz ertönt aus einem versteckten Lautsprecher. Ich meide den Blick in den Spiegel und betrachte stattdessen den Teppichboden. Bin ich hier in einem Hotel gelandet? Nein, es gab keine Lobby und auch das Klingelschild lässt mir den Gedanken kaum eine Sekunde später absolut albern erscheinen.
Als die Türen sich mit einem kaum hörbaren Pling öffnen, stolpere ich beinahe auf den Flur. Mein ganzer Körper scheint schlagartig wieder taub zu sein, denn ich spüre gar nichts mehr, während ich mich zweifelnd umschaue. Sowohl links als auch rechts geht der Flur an der Seite des Gebäudes entlang und verschwindet um eine Ecke. Wo muss ich hin? Meine Intuition lässt mich schließlich den linken Weg einschlagen und belohnt mich, indem ich am Ende des Flurs vor einer Wohnungstür lande, auf deren Klingelschild Bromberg steht. Entweder ist diese Eckwohnung die richtige oder Großtante Gisela hatte Nachbarn mit demselben Nachnamen.
Ich hebe den Schlüssel zum Schloss, doch halte in letzter Sekunde inne. Denke ein letztes Mal darüber nach, dass das alles nicht real, dass Großtante Gisela nicht plötzlich verstorben sein kann. Dass ich nicht ihre Alleinerbin sein sollte. Nicht ich. Jeder andere erscheint mir logischer. Wir kannten uns doch kaum. Was hat sie dazu verleitet, ausgerechnet mich einzusetzen? Und wieso hat sie nie Kontakt mit mir aufgenommen, als sie noch lebte, wenn sie sogar ihrem Notar von mir erzählt hat?
Als ich auf meine Hand schaue, bemerke ich, dass sie zittert.
»Oy veh, jetzt reiß dich doch zusammen«, fauche ich mich selbst an und erschrecke wie der letzte Volltrottel vor dem Geräusch meiner Stimme, als hätte ich nicht geahnt, dass sie ein Geräusch macht. Als ich am Ende des Flurs zusätzlich eine Tür knacken höre, ramme ich den Schlüssel ins Schloss. Zum Glück gleitet er hinein wie frisch geölt und ich schließe schnell auf. Die Tür ist schwer und das Holz massiv, und doch lässt sie sich mühelos aufstoßen. Ich schlüpfe ins Innere der Wohnung, doch meine Knie sind so weich, dass ich innen gegen die Tür sinke. Mit einem gedämpften Geräusch fällt sie ins Schloss und ich schnappe nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen.
Meine Sicht ist von tausend bunten Punkten getrübt und so ziehe ich die Knie an den Körper und bette den Kopf darauf, um zu verschnaufen. Geschafft. Ich bin in der Wohnung. Meine Hände sinken neben meinem Körper auf den Boden, der angenehm kühl unter meinen viel zu warmen Fingern ist. Echtholzparkett. Mama hat darauf plädiert, dass wir in unserem Haus welches haben, deswegen glaube ich es zu erkennen.
Für eine Weile sitze ich bloß da, konzentriere mich auf meine Atmung und beruhige mich nur. Mein Puls geht nur langsam runter, doch das tiefe Ein- und Ausatmen, das ich in einem Selbsthilfeforum gelernt habe, lässt wenigstens meinen Geist ruhiger werden. Stille umfängt mich. Wenn meine direkten Nachbarn gerade irgendetwas in ihren Wohnungen machen, dann sind die Wände dick genug, um alles abzudämmen. Das Fehlen der Geräusche hilft mir dabei, die Situation zu hinterfragen, die sonderbare Reaktion meines Körpers, die Anziehungskraft der Wohnung und die Nervosität, je näher ich ihr komme. Ich war schon immer ein sensibler Mensch, der viel zu viel empfindet, aber das hier ist selbst für mich … ungewöhnlich.
Es dauert eine Weile, bis ich meine Ruhe wiedergefunden habe, vorsichtig den Blick hebe und mich in dem Raum umsehe, in dem ich Zuflucht gefunden habe. Es ist ein Flur und nicht direkt das Wohnzimmer des Apartments, was mich ein wenig überrascht. Habe ich jemals in einer Wohnung oder einem Haus mit Flur gestanden? Abgesehen von öffentlichen Gebäuden natürlich, doch selbst im Studentenwohnheim öffnet unsere Eingangstür direkt in die Wohnküche.
Mit großen Augen rapple ich mich auf und lasse den Blick durch den Flur schweifen. Er ist hell gestrichen, mit weißen Türen und Schränken, die den sowieso schon großen Raum noch größer wirken lassen. Ich stopfe den Wohnungsschlüssel zurück in meine Manteltasche und ziehe gleichzeitig mein Smartphone aus der Tasche auf der anderen Seite hervor. Bram hat noch nicht geantwortet. Zwar sitzt er wahrscheinlich mitten in einem Finanzwesenkurs, doch ich kann trotzdem nicht anders, als mich zu ärgern. Zu gerne würde ich mit ihm über den Termin mit Mister Bennett reden, mir versichern lassen, dass ich richtig handle und dass unsere Mutter mich nicht direkt verstoßen wird, wenn sie von dieser Sache erfährt. Ich möchte seine Unterstützung einholen und mich selbst beruhigen.
Oder besser gesagt, mich weiter davon abhalten, Großtante Giselas Wohnung zu erkunden. Verdammt.
Wahrscheinlich wäre Bram ziemlich enttäuscht, wenn er mich anruft und ich ihm nicht einmal sagen kann, wie viele Zimmer mir vererbt wurden, also atme ich ein letztes Mal tief ein und aus. Dann stecke ich das Handy wieder weg und schalte das Flurlicht an. Die Glühbirnen erzeugen ein ungewöhnlich kühles Licht, in dem meine sowieso schon kühle Hautfarbe geradezu rosastichig aussieht. Ich wende mich der Tür rechts von mir zu und versuche, mein klopfendes Herz zu ignorieren, während ich sie aufstoße.
Dahinter verbirgt sich ein großzügiges Schlafzimmer, das von zwei bodentiefen Fenstern ausgeleuchtet wird. Das Parkett zieht sich auch durch diesen Raum und im Tageslicht fällt mir die hübsche Maserung auf, die sich spielerisch gegen die reinweißen Möbel absetzt. Ich lehne mich an den Türrahmen und betrachte das gemachte Queensize-Bett, den großen Kleiderschrank und die Reflexionen, die das Sonnenlicht auf den Boden zaubert.
Immerhin kein Ein-Zimmer-Küche-Bad-Loft.
Als ich den Kopf in den Raum stecke, entdecke ich zudem eine weitere Tür, die mich nach dem Öffnen in ein kleines Dusch-Bad führt. Leben wie in besseren Kreisen, was? Ich schließe die Tür wieder, lasse die vom Schlafzimmer jedoch weit offen, damit das Tageslicht den Flur erhellt und ich das Licht ausknipsen kann. Beinahe kann ich meinen Vater zufrieden murmeln hören, dass man am helllichten Tage keinen Strom verschwenden soll, und ich kann nicht anders als seufzend die Augen zu verdrehen. Ich bin wirklich das Kind meiner Eltern.
Als Nächstes trete ich zu dem offenen Durchgang, der ins Wohnzimmer führt und neben dem sich die Tür in die moderne, große Küche befindet. Durch die Ecklage der Wohnung hat anscheinend jedes Zimmer Fenster und ich staune über den Ausblick, der mir geboten wird. San Franciscos Downtown erstreckt sich, so weit das Auge reicht, auch wenn das durch die umliegenden Hochhäuser kein Panoramablick ist, wie beispielsweise in Mister Bennetts Büro. Das Meer ist ebenfalls nirgends zu entdecken.
Zu Wohnzimmer und Küche gesellen sich ein Esszimmer sowie ein Durchgangsbereich, von dem aus man eine Waschküche erreicht, die Zugang zu einer der weiß lackierten Feuertreppen hat. Überwältigt schüttle ich den Kopf. Selbst eine Waschmaschine und einen Trockner gibt es. Diese Wohnung war sicher nicht billig und allein der Gedanke daran dreht mir den Magen um.
Was werden meine Eltern dazu sagen? Und was soll ich antworten, wenn jemand mir die Frage stellt, die ich mir selbst die ganze Zeit vorhalte: Wieso ich?
Als ich gerade wieder den Flur erreiche, fängt meine Manteltasche an zu vibrieren. Mit einem flauen Gefühl im Bauch fische ich das Handy heraus, kontrolliere kurz, ob es Bram ist, und gehe dann ran.
»Hey, Bruderherz«, begrüße ich ihn.
»Was gibt’s, Schwesterchen?« Seine Stimme klingt warm und sanft, wie immer, wenn wir miteinander sprechen, doch ich höre direkt heraus, dass er gestresst ist.
»Störe ich?«
»Vielleicht ein kleines bisschen«, gibt er zu. »Aber mach dir keine Sorgen darüber, du hast Priorität. Also?«
Ich spüre ein angenehmes Prickeln in meiner Brust und lächle treudoof in die Leere des Flurs, doch als ich versuche, die richtigen Worte zu finden, muss ich seufzen.
»Was ist los?«
»Ich … Gott Bram, entschuldige«, setze ich an und fahre mir mit einer Hand durch die Haare, um die Strähnen aus meiner schweißnassen Stirn zu entfernen. »Ich hätte mich schon gestern melden müssen, aber ich konnte einfach nicht, solange ich keine Gewissheit hatte.«
Kurz schweigt mein Bruder und ich bekomme Angst, dass er mir böse ist, doch als der Hintergrundlärm plötzlich verstummt, wird mir klar, dass er lediglich in einen abgelegenen Raum gegangen sein muss.
»Das klingt nicht gut, was ist los? Bist du in Ordnung?«
»Bram …« Ich spüre, wie mir die Tränen kommen. Mein Bruder hatte schon immer dieses Talent dafür, mich mit den simpelsten Dingen zum Weinen zu bringen. Ob mit dem Wegkicken meiner Puppe, als wir Kinder waren, oder seinen kurzen Umarmungen, als ich in der Highschool gemobbt wurde. Bram und ich waren typische Geschwister, nicht immer einer Meinung und oft am Zanken, doch häufig genug ein Herz und eine Seele.
Kurz überlege ich, mich mit Bram am Ohr an die letzte Tür der Wohnung zu wagen, doch dann entscheide ich mich dagegen und kehre ins Wohnzimmer zurück, wo ich mich auf dem breiten Sofa niederlasse. Die Polster sind überraschend hart und doch bequem.
»Brauchst du mich? Soll ich mich auf den Weg machen?« Jetzt klingt seine Stimme alarmiert und ich kann nicht anders, als ein schluchzendes Lachen hervorzupressen.
»Nein, keine Sorge, ich bin nur überfordert, aber … alles ist gut. Irgendwie.«
»Du klingst nicht, als wäre alles gut. Was ist los?« Sein Tonfall ist prüfend und ich kann mir bildlich vorstellen, wie auf seiner linken Stirnhälfte die kleine Falte entsteht, die er immer hat, wenn er angestrengt nachdenkt. Ich atme tief durch.
»Großtante Gisela ist tot und sie hat mich als Alleinerbin eingesetzt.«
Jetzt ist es raus.
»Du machst Witze.«
»Nein, sie ist wirklich tot, Bram. Ich habe das Testament in den Händen gehalten. Sie ist tot und ich bin ihre Erbin.«
»Das ist absurd!«, entfährt es meinem Bruder. »Wie lange haben wir sie jetzt nicht gesehen, zwanzig Jahre?«
»Siebzehn«, murmle ich, was ihm ein Seufzen entlockt.
»Das war eine rhetorische Frage, Alma. Egal. Hast du das Erbe schon akzeptiert? Bitte sag mir, dass du es nicht angenommen hast, ohne mich oder Papa drüber schauen zu lassen!«
»Ähm …«
»Bist du meschugge?! Wenn sie irgendwelche Schulden hatte, dann …«
»Hatte sie nicht, Bram. Sie hat einen Notar damit beauftragt, mir mit allem zu helfen. Bei dem war ich heute früh. Ich weiß nicht wieso, aber sie hat mir wirklich alles hinterlassen.«
Kurz herrscht Stille zwischen uns, sodass ich beinahe anfange, mich zu fragen, ob die Verbindung gestorben ist, doch dann erhebt Bram wieder seine Stimme.
»Mazel Tov, Schwesterchen«, sagt er zögerlich. »Auch wenn ich das wohl nicht sagen sollte, so im Andenken an Großtante Gisela. Was genau hat sie dir vererbt?«
»Ein paar tausend Dollar, eine Handvoll Aktien-Anteile und eine Eigentumswohnung«, antworte ich nicht minder zurückhaltend und höre ihn aufkeuchen.
»Mazel Tov!«, wiederholt er, dieses Mal bestimmt. »Wissen unsere Eltern schon Bescheid?«
»Nein. Und ich würde es gerne erst mal so belassen, Bram.« Ich seufze leise und betrachte meine Fingernägel, die unbedingt mal ein bisschen Pflege benötigen würden. Mein Bruder schweigt und ich weiß, dass er mir am liebsten widersprechen würde. Doch er tut es nicht und dafür bin ich ihm unendlich dankbar.
»Ich muss zuerst selbst damit klarkommen, bevor ich es Mom und Dad erzähle. Gerade bin ich einfach nur … erdrückt von allem.«
»Kann ich dir etwas Gutes tun, Schwesterherz?«
»Nein, aber danke. Ich … ich musste es nur jemandem erzählen. Und du bist nun mal der Einzige, dem ich wirklich vertraue.«
»O Alma«, murmelt er. »Dafür ist Mischpoche doch da.«
Ich seufze lediglich als Antwort. Irgendwann werde ich meinen Eltern von all dem erzählen, das weiß Bram genauso gut wie ich. Und auch, wenn meine Familie, meine Mischpoche, jetzt für mich da ist, sitzt der Schmerz der Vergangenheit doch zu tief.
»Ich muss wieder zurück in die Studiengruppe, kommst du klar?« Sein Tonfall ist forschend und ich kann nicht anders, als zu lächeln. Egal, was kommt, ich weiß, dass Bram für mich da ist.
»Mach dir keine Sorgen, ich komm klar. Ich schau mich jetzt weiter in der Wohnung um und fahr danach zurück ins Manzanita Square.«
»Oh, du bist in der Wohnung?«
Ich bejahe und erkläre kurz, dass Mister Bennett mir den Schlüssel übergeben hat.
»Okay, ich muss echt zurück, Aaron und Ethan sind schon richtig ungeduldig«, unterbricht er mich, doch dann fügt er noch schnell hinzu: »Ich ruf dich heut Abend an und dann erzählst du mir alles, ja?«
»Gerne«, erwidere ich. »Viel Erfolg beim Lernen.«
»Hab dich lieb, Schwesterherz.« Bram legt schneller auf, als ich ein »Ich dich auch« erwidern kann, und ich schaue pikiert auf mein Smartphone, dessen Bildschirm von meiner Wange ganz schmalzig ist. Kopfschüttelnd stehe ich vom Sofa auf und reibe das Glas an meinem Leoshirt sauber, dann lasse ich es zurück in meinen Mantel gleiten. Obwohl die Wohnung nicht geheizt ist, wird mir langsam aber sicher ziemlich warm.
Als ich jedoch die letzte Tür öffne und in das Zimmer spähe, vergesse ich das. Vor mir liegt ein … Arbeitszimmer? Nein, einen Schreibtisch sehe ich nicht, nur Unmengen an Bücherregalen, Beistelltischchen und zwei große Lesesessel.
Verblüfft trete ich in die Bibliothek und blicke mich um. Was auch immer ich vom letzten Zimmer erwartet habe, es war nicht das hier. Anders als der Rest der Wohnung, die in hellen, sanften Farben gehalten ist, dominieren hier dunkles Holz und graue Wandfarbe. Die einzige Wand ohne Bücherregal ist die Außenwand, die das Zimmer durch die großen Erkerfenster dennoch hell und freundlich wirken lässt.
Mein Blick wandert an den Bücherregalen entlang und streift über die hellgrauen Lesesessel, bis er an einem Regal hängen bleibt. Es ist als einziges nicht mit Büchern gefüllt, sondern geradezu dekorativ; taillenhoch, mit Schnitzereien verziert und voller Edelsteine, verschiedenster Fläschchen, seltsam anmutender Figuren und weiterem Tand.
Doch es ist eine andere Sache, die meine Neugier erweckt und mich schließlich nähertreten lässt: das schwarze, titellose Buch, dessen Oberfläche im Tageslicht zu glänzen scheint.
3
Meine Schritte fühlen sich seltsam federnd an, als ich an das Regal herantrete. Wie automatisch wandern meine Finger über die Kanten, streichen über die Schnitzereien und fahren ihre Muster nach, deren Herkunft sich mir seltsamerweise entzieht. Wenn sie aus der Historik stammen, habe ich sie jedenfalls noch nicht im Studium behandelt.
Ehrfürchtig lasse ich den Blick über die großen lila Kristalle wandern, die das Buch einrahmen, ehe ich es vorsichtig in die Hand nehme. Es fühlt sich angenehm kühl an, weich und glatt und doch sanft texturiert, sodass es meine Fingerkuppe kitzelt, als ich darüberstreiche. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es in eine Art Leder gebunden. Dafür spricht auch das nicht zu verachtende Gewicht. Sollte jemand einbrechen, könnte das Buch locker als Waffe herhalten.
Bevor mir wirklich bewusst ist, was ich tue, liegt meine rechte Hand auf dem Buchdeckel und streicht darüber, als würde ich es liebkosen wollen. Irgendetwas in mir scheint auf das Buch zu reagieren, fühlt sich von ihm angezogen wie eine Maus vom Käse in der Mausefalle.
Ich stocke. Woher kam dieser Vergleich? Wie komme ich darauf, dass es eine Falle für mich sein könnte? Mit gerunzelter Stirn streiche ich weiter über das Leder, genieße die Empfindung, die es in mir hervorruft, und denke nicht daran, es wieder aus der Hand zu legen. Aufregung kribbelt in meiner Magengegend, ein Gefühl wie Fernsehrauschen, tausend winzige Impulse, die mich ganz benommen machen.
Ich atme zitternd ein und aus, realisiere die abnormale Reaktion meines Körpers und schaffe es doch kaum, sie zu hinterfragen. Das Buch zieht alle meine Gedanken auf sich, seine schlanke Gestalt, die sich in meine Hand schmiegt als gehöre es dorthin, und die verlockende Neugier, was wohl in ihm steht.
Erst als meine Finger bereits den Buchdeckel anheben, schaffe ich es, mich aus dem seltsamen Bann zu befreien. Sekunden vergehen, in denen meine Gefühle so stark abflauen, dass ich mich zu fragen anfange, ob sie überhaupt existiert haben. Ist das wirklich passiert? Wo ist die Faszination hin, die ich eben noch gespürt habe?
Zögernd blicke ich auf das Buch herab, das noch immer schwer in meiner Hand liegt. Dann klappe ich es auf – und halte verblüfft inne.
Ein Aquarell eines Sternenhimmels prangt auf der ersten Seite, verziert mit zarten, rosa Blüten und einem weißen Banner. Grimoire steht in einer an Kalligrafie anmutenden, feinen Handschrift darauf geschrieben. Ich ziehe die Augenbrauen zusammen und streiche mit dem Zeigefinger über die Sterne des Bilds, die mit weißer Perlmuttfarbe aufgemalt worden sind. Ich kenne das Wort irgendwoher, doch erst als ich die nächste Seite aufschlage, fällt mir ein, was Grimoire bedeutet.
Zauberbuch.
Auf der Rückseite des Aquarells befindet sich eine Art Symbol mit einem Auge in der Mitte, unter dem griechische Buchstaben zwei Worte formen. Durch das Wasser des Aquarells ist das Papier wellig geworden und die einst geraden Striche des Symbols haben leichte Kurven bekommen. Dank meines Studiums habe ich eine entfernte Ahnung, um was es sich hier handelt: eine Sigille. Bereits in der Antike wurden solche Zeichen genutzt, um höhere Mächte anzurufen, und ich frage mich leise, was zur Hölle mit Großtante Gisela verkehrt war.
Seitdem ich das Buch geöffnet habe, fühlt sich die Luft um mich herum bizarr an, eine Mischung aus warmem Knistern und kühler Spannung, die mich nervös werden lässt. Es ist mir ganz und gar nicht geheuer, dass mein Erbe augenscheinlich ein Buch mit Zaubern beinhaltet und dass meine Großtante sich dementsprechend wohl für eine Magierin hielt.
Und dennoch kann ich nicht anders, als die Seiten ohne Zurückhaltung durchzublättern und jedes Bisschen von Giselas feinsäuberlicher Handschrift in mich aufzusaugen. Die meisten Worte sind in einer mir fremden Sprache geschrieben, bilden skurrile Sätze und unaussprechliche Formeln, die sich mir nicht erschließen. Je mehr ich lese, desto weniger habe ich das Gefühl, irgendetwas zu verstehen, bis mein Blick unerwartet über ein Wort huscht, vier Buchstaben, die meine Augen groß und meinen Mund trocken werden lassen.
Alma.
Minutenlang starre ich einfach nur auf die Seite mitten im Buch; versuche zu begreifen, was mein Name in diesem Hexenbuch ausdrücken soll, wieso meine Großtante ihn geschrieben haben könnte, was all das zu bedeuten hat, doch versage kläglich.
Mister Bennetts Worte blitzen in meinen Gedanken auf. Seltsam. Es klang stets, als würden Sie einander nahestehen. Aber das taten wir nicht. Kann man jemandem nahestehen, ohne dass der andere davon weiß? Hat Großtante Gisela womöglich mein Leben verfolgt und sich mir nahe gefühlt?
Oy veh, das klingt, als wäre sie ein besessener Stalker gewesen. Ich vertreibe den Gedanken schnell wieder, doch immerhin hilft mir die Aversion, mich aus meiner Beklommenheit zu befreien. Ich fahre mit der Fingerspitze über die Buchstaben meines Namens und fühle, wie Giselas Schrift sich sanft in die Seiten gedrückt hat. Die Worte fühlen sich fremdartig an und doch wispere ich sie leise in die Stille der Wohnung hinein, ohne es wirklich zu merken.
»Ti’ahu suzazusr a’AlmaObscura bsaas hrusahrrUmcaosoem angr’aafuhNmao l’untha sha ang’athafts.«
Erst als das letzte Wort meine Lippen verlassen hat und mein Herzschlag für eine Sekunde aussetzt, wird mir bewusst, dass ich den Spruch nicht bloß gelesen, sondern ausgesprochen habe. Ich lasse das Buch fallen. Ist das gerade wirklich passiert?!
Mein Atem stockt. Wildes Herzklopfen klingt laut in meinem Kopf wieder, während alles andere in Position verharrt. Ich warte, lausche, auch wenn ich nicht weiß, auf was. Versuche, eine Veränderung in der Luft zu spüren. Ein Knistern, einen Aufwind. Der Klang von Gewitter in der Ferne. Irgendeine Reaktion auf den Zauberspruch, den ich gerade wie verhext vorgelesen habe – doch es passiert nichts.
Natürlich nicht, du Schmock!Die letzten vierundzwanzig Stunden scheinen endlich ihren Tribut zu fordern, wenn ich wirklich schon so weit bin, an Zaubersprüche zu glauben, nur weil meine Großtante sich ein Hexenbuch angelegt hat. Langsam entspannen sich meine Muskeln wieder und auch meine Atmung normalisiert sich. Obwohl ich den Mantel nicht ausgezogen habe, wird mir plötzlich ziemlich kalt. Unschlüssig blicke ich auf das Grimoire, das noch immer auf der Seite mit meinem Namen aufgeschlagen daliegt.
Alma Obscura. Die Worte klingen in meinem Kopf wider, geflüstert von meiner eigenen Stimme, die befremdlich finster klingt. Obscura. Ist es das, was Gisela von mir dachte? Dass ich obskur bin? Sprach sie deswegen mit Mister Bennett über mich und fühlte sich mir nah? Glaubte sie, in mir eine verbundene Seele gefunden zu haben, weil ich in ihren Augen genauso obskur war, wie sie sich fühlte?
Oder interpretiere ich gerade viel zu viel?
Mit zusammengezogenen Augenbrauen strecke ich die Hand aus und klappe den Buchdeckel zu, ehe ich auf dem Absatz kehrtmache und das Lesezimmer verlasse. Ich will ehrlich gesagt nicht darüber nachdenken, was gerade passiert ist. Einfach nur die seltsamen Worte aus meinem Kopf verbannen, die mir so leicht über die Lippen gekommen sind, als hätte ich sie einstudiert. Mein Blick fällt auf die rosa Schachtel mit den Donuts, die bei der Wohnungstür liegt, doch mein Appetit hat sich vollends verabschiedet, sodass ich sie nur schnell auflese und in den Händen drehe. Vielleicht esse ich sie später, vielleicht schenke ich sie auch einfach Grace. Erst einmal möchte ich lediglich aus dieser Wohnung raus.
Ich lasse die Tür laut hinter mir ins Schloss fallen, als würde ich damit alles zurücklassen können. Die seltsamen Gefühle, das Erbe, das Buch, den Spruch. Meine Hand zittert nicht mehr, als ich die Tür abschließe. Auch den Weg zum Fahrstuhl bringe ich mit festen Schritten hinter mich. Keine weichen Knie, kein Zögern. Im Fahrstuhl fällt mein Augenmerk wieder auf den Spiegel. Ich bin bleich, noch mehr als zuvor, sodass sich meine breiten, vollen Lippen viel zu rosig von meiner leichenblassen Haut absetzen. Das komische Licht der Fahrstuhlbeleuchtung macht es nicht besser. Doch anders als zuvor tut mir der Blick in den Spiegel dieses Mal nicht weh. Stattdessen prallt er an der Oberfläche ab und lässt mich kalt.
Ich fröstle auch noch, als ich das Gebäude verlassen habe und auf der gegenüberliegenden Straßenseite in der Sonne stehen bleibe. Eine Straßenbahn fährt an mir vorbei und ich erkenne sofort, dass gut die Hälfte der Insassen Touristen sind. Irgendwann kriegt man ein Auge dafür, wer nur zu Besuch in San Francisco ist und wer in der City by the Bay lebt. Und in meiner momentanen Situation bin ich dankbar über das leise Murmeln derer, die unserer schönen Stadt alle Aufmerksamkeit schenken.
Zu meinem Glück muss ich nicht lange auf die Bahn in meine Richtung warten und ich kriege einen außenliegenden Platz neben einer Gruppe Touristen, die sich leise in einer kehlig klingenden Sprache unterhalten. Ich habe keine Ahnung, was sie sagen, doch mich auf die Wörter zu konzentrieren und ihren Blicken zu folgen hilft mir ungemein dabei, mich zu beruhigen. Sie haben gute Laune und freuen sich darüber, hier zu sein, und das färbt auf mich ab.
Als ich eine knappe Stunde später auf dem Campus ankomme, ist mir noch immer kalt. Auf dem Weg zum Manzanita Square versuche ich durch einen strammen Schritt, an Körperwärme zu gewinnen, doch es hat lediglich zur Folge, dass ich mich ausgelaugt und verkrampft fühle, als ich im Apartment ankomme.
»Hallo Alma«, begrüßt mich Melaina, als sie kurz den Blick von ihrem Laptop hebt. Sie sitzt am Esstisch, was ein ziemlich seltener Anblick ist. Ihre dunkelbraunen Haare fallen in voluminösen Wellen über ihre Schultern und umspielen dabei ihr herzförmiges Gesicht, aus dem ihre hellgrauen Augen förmlich hervorblitzen. Irgendwie hat sie immer etwas Geheimnisvolles an sich, und ich bin mir fast sicher, dass es von ihrer Augenfarbe kommt.
Laut der Griechin liegt diese in ihrer Familie, was Grace zufolge eine Mutation sein müsste. Leider hat diese Aussage dazu geführt, dass Melaina uns bloß noch mehr meidet als zuvor schon.
»Hey«, erwidere ich schwach und schließe die Tür hinter mir. Melaina scheint mich für einen Moment zu mustern, doch dann senkt sie den Blick wieder auf ihren Laptop. Erst nachdem ich die Donutbox abgestellt habe, mir einen Becher mit Wasser gefüllt und ihn in die Mikrowelle gestellt habe, erhebt sie wieder die Stimme.
»Du siehst ziemlich fertig aus, ist alles okay?«
Ich werfe ihr einen fragenden Blick zu. Melaina hat in den letzten sechs Wochen nicht mehr als eine Handvoll Hallo und Tschüss mit mir gewechselt. Wieso spricht sie plötzlich mit mir und erkundigt sich sogar nach meinem Wohlergehen? Sehe ich so mies aus?
»Alles okay, nur ein anstrengender Tag«, erwidere ich und öffne die Mikrowelle, bevor sie piepst. Das Wasser ist heiß genug, dass ich einen Teebeutel darin abkochen kann, aber mir in ein paar Minuten beim Versuch zu trinken nicht die Lippen verbrenne. Wirklich okay fühle ich mich allerdings nicht. Meine Hände zittern wie Espenlaub, als ich versuche, den Kamillenteebeutel aus seiner Plastikfolie zu befreien. Mit Mühe gelingt es mir und ich schmeiße ihn in das Wasser, wo er sanfte gelbe Wolken produziert, die meinen Blick an sich fesseln.
Obwohl ich den Becher mit beiden Händen umklammere und die Hitze des Tees gegen meine Handflächen drängt, habe ich nicht das Gefühl, dass sie in mein Inneres vordringt. Meine Augen lösen sich nur schwer von der Tasse, doch als ich bemerke, dass Melaina mich weiterhin mustert, werde ich nervös.
»Ist was?«, frage ich mit bebender Stimme und beiße mir auf die Lippe. Wieso ist mir denn so verdammt kalt?
Melaina beobachtet mich, ohne mir eine Antwort zu geben. Sie scheint mich nicht wirklich anzusehen, eher durch mich hindurch. Erst nach einer Weile des unangenehmen Schweigens findet ihr Blick den meinen und sie zieht die breiten dunklen Augenbrauen empor.
»Irgendwas ist anders an dir, hast du eine neue Frisur?«, fragt sie aus heiterem Himmel.
»Was?« Vor Verblüffung ziehe ich eine Grimasse. »Nein?«
Meine Haare sehen aus wie immer, dünn, hellblond und brustlang. Vielleicht sind sie strähnig vom Tag, aber sie sehen ganz sicher nicht nach einer neuen Frisur aus.
»Seltsam«, murmelt Melaina und lächelt mich dann traurig an. »Entschuldige, ich bin nicht sehr aufmerksam bei … den meisten Menschen.«
»Okay«, gebe ich zurück, weil ich nicht weiß, was sie mir damit sagen will. Ich blicke in meinen Tee, der mittlerweile eine kräftige Farbe angenommen hat, und fische dann den Beutel heraus. »Ich geh in mein Zimmer.«
Auf dem Weg schmeiße ich ihn in den Mülleimer und vermeide es, Melaina anzusehen. Ich spüre ihre hellgrauen Augen auch so, wie sie sich mit ihrer Intensität in mich bohren und nach etwas forschen, das ich nicht verstehe und auch nicht geben kann. Ich wünschte, diese Erkenntnis würde wenigstens Hitze in mir hervorrufen, doch noch immer fühle ich mich wie in der Antarktis.
In meinem Zimmer ist die Luft abgestanden, sodass ich erst mal das Fenster aufreiße. Doch auch die warme Luft von draußen hilft mir nicht, besser zu atmen oder weniger zu frieren. Meine Zähne beginnen zu klappern und ich umklammere den Tee noch fester, als würde das etwas ändern. Als ich einen Schluck davon nehme, habe ich das Gefühl, Lava würde meinen Mund und meine Speiseröhre hinunterrauschen. Ich würge und gebe ein Winseln von mir.
Was soll der Mist? Werde ich krank?
Mit zitternden Händen stelle ich den Tee auf meinem Nachttisch ab und schließe das Fenster wieder, ehe ich die Heizung aufdrehe. Doch bevor ich in mein Bett schlüpfen kann, klopft es an meiner Tür. Ich zucke zusammen, das Geräusch tut in meinen Ohren weh.
Als ich die Tür öffne und Melaina davorsteht, runzle ich die Stirn. »Was?«
Sie hebt etwas empor, was ich erst nach einigen Sekunden des Daraufstarrens als eine Wärmflasche erkenne und überrascht entgegennehme. Die Hitze fühlt sich gut an und ich presse sie gegen meinen Körper.
»Du hast so geschlottert, da dachte ich, vielleicht tu ich dir damit was Gutes«, erklärt Melaina mit einem schiefen Lächeln.
»Danke …«
»Nichts zu danken. Gute Besserung, Alma.« Sie wartet nicht darauf, dass ich etwas sage oder die Tür schließe, sondern dreht sich um und geht schnurstracks zurück ins Wohnzimmer. Ich kneife die Augen zusammen, als ein pochender Schmerz in meinem Kopf einsetzt und mich beinahe in die Knie zwingt.





























