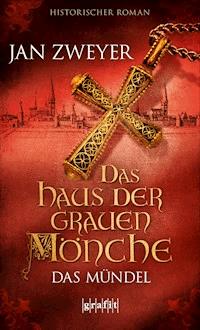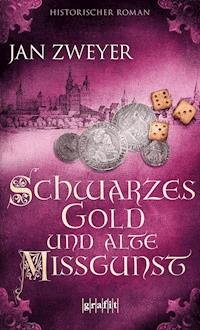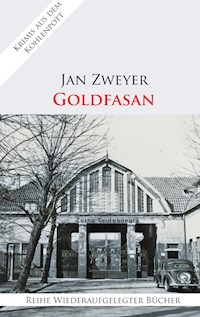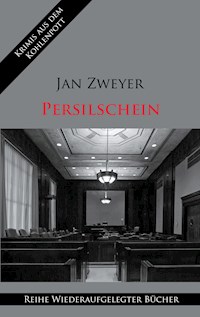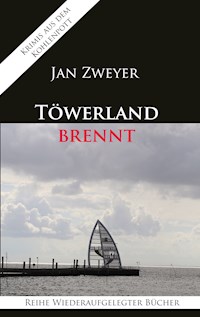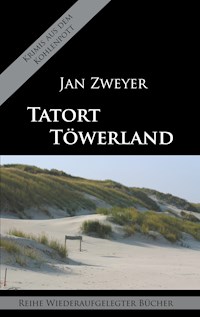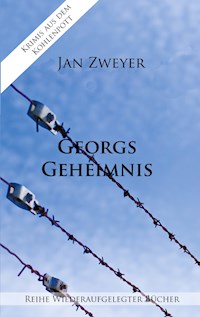5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mediterranes Flair, vorchristliche Mythen und ein modernes Verbrechen: Versicherungsdetektiv Jean-Paul Büsing soll die Himmelsscheibe von Nebra wiederbeschaffen. Aber als auch die attraktive Wissenschaftlerin Gianna Rossi auf mysteriöse Art verschwindet, beschäftigt Büsing nur noch die Frage: Wo ist Gianna?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Autor
Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne. Nach zahlreichen zeitgenössischen Kriminalromanen hat er sich mit der Goldstein-Trilogie (Franzosenliebchen, Goldfasan, Persilschein) das erste Mal historischen Themen zugewandt. Es folgte die fünfbändige Linden-Saga, eine historische Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet, ein Thriller zur Flüchtlingsproblematik (Starkstrom) und 2020 ein Ökothriller (Der vierte Spatz).
In der Reihe Wiederaufgelegter Bücher werden verlagsseitig vergriffen Texte von Jan Zweyer als Buch und eBook neu veröffentlicht. Der Originaltext unterliegt jetzt den neue Rechtschreibregeln. Inhaltliche Veränderungen wurden nur in Ausnahmefällen vorgenommen.
Wenn das Gestirn der Plejaden, der Atlastöchter,
heraufsteigt,
Fanget die Ernte an; die Saat dann, wenn sie
hinabgehn.
Sie sind vierzig Nächt’ und vierzig Tage zusammen.
Nimmer gesehen; dann wieder im rollenden Laufe des
Jahres.
Treten sie vor zum Lichte, sobald man schärfet das
Eisen.
Hesiod, Werke und Tage (etwa 700 v. Chr.)
Der Unternehmensberater ist ein Mann, der siebenunddreißig
Liebesstellungen, aber keine Frau kennt.
Volksmund
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Erster Teil: Toskana
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Zweiter Teil: Regensburg
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Nachbemerkung
Prolog
Bei Nebra, etwa 1600 Jahre vor unserer Zeitrechnung:
Der weise Mann blieb schwer atmend im stürmischen Wind stehen. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Aber er durfte sich nicht lange ausruhen. Es war nicht mehr weit bis zu seinem Ziel. An den drei stämmigen Eichen vorbei, die eben in seinem Blickfeld aufgetaucht waren, dann um den magischen Stein herum. Von dort waren es nur noch wenige Schritte bis zum höchsten Punkt des Hügels. Trotzdem, er wusste, ihm blieb nicht mehr viel Zeit.
Der Alte sah vom Hügel durch das Unterholz hinab in die Talsenke. Die vier lang gestreckten Häuser, die seiner Gemeinschaft bisher Heimat gewesen waren und Sicherheit geboten hatten, brannten lichterloh. Obwohl sein Augenlicht nicht mehr das beste war, erkannte er neben den Häusern einige Mitglieder seiner Sippe: Sie lagen regungslos auf dem schlammigen Lehmboden. Von hier oben sahen sie aus wie braune, schmutzige Bündel. Er wusste mit Bestimmtheit, dass die Bündel dort liegen bleiben würden, bis sie von Wildtieren gefressen wurden. Die Knochen, die nicht zur Nahrung taugten, würden in der Sonne bleichen, schließlich zu Staub zerfallen und ein Opfer des Windes werden. Mit Bedauern machte sich der Weise klar, dass niemand den alten Ritus ausführen und die Gefährten den Geistern übergeben konnte, so wie es die Überlieferungen der Ahnen verlangten.
Er hetzte weiter durch das Unterholz. Zweige schlugen in sein Gesicht. Verstümmelte Rufe und Stimmfetzen drangen zu ihm. Seine Verfolger waren vielleicht noch zwei-, vielleicht dreihundert Schritte von ihm entfernt. Er lief, so schnell er konnte, und klemmte den Beutel, den er trug, fester unter den rechten Arm. Die Gaben der Götter mussten im geweihten Versteck sein, bevor die Häscher ihn erreichten. Er war der Bewahrer. Und die Männer, die nicht zu seiner Sippe gehörten, durften die Göttergeschenke nicht finden. Vielleicht hatte ja doch jemand das Gemetzel überlebt und konnte mit dem Wissen, das der Weise an langen Winterabenden versucht hatte, an seine Gefährten weiterzugeben, eine neue Gemeinschaft gründen. Vielleicht. Sie hatten ihr Blut für diese Gabe gegeben. Immer wieder. Sie musste geschützt werden. Auch mit seinem Leben. Das war sein Auftrag. Er war der Bewahrer.
Der Alte blieb wieder stehen. Angestrengt lauschte er. Für einen Moment schöpfte er Hoffnung. Hinter ihm blieb alles ruhig. Hatten sie seine Spur verloren? Aber als der Wind plötzlich drehte, waren auch die Rufe wieder zu hören. Er musste sich beeilen.
Früh am Morgen war die Horde aus Richtung der aufgehenden Sonne gekommen und hatte sie überrascht. Seine Gefährten und er wussten nicht, warum sie angegriffen wurden. Aber der Grund war auch unwichtig. Die fremden Krieger waren über sie gekommen und hatten den Tod gebracht. Seine Sippe hatte versucht, sich zu verteidigen, aber ihre Beile und Äxte aus Stein und Horn taugten zur Arbeit auf den Äckern und zum Bau von Häusern, waren aber, um als Waffen zu dienen, zu schwer und unhandlich. Mit den Speeren, die sie zur Jagd benutzten, wehrten sie sich, so gut sie konnten, unterlagen aber schnell der Übermacht. Ihre Gegner schwangen Schlagwaffen aus dem gleichen Material, aus dem die Göttergaben gemacht waren. Der weise Mann hatte schon von solchen Waffen gehört. Besucher, die von weit her gekommen waren, hatten davon berichtet. Scharf sollten diese Waffen und Werkzeuge sein, unzerbrechlich. Aber nur wenige verfügten über das Wissen, um sie herzustellen. Und dieses Wissen kam direkt von den Göttern. Woher sonst? Die Angreifer hatten diese Waffen. Und setzten sie todbringend ein. Die Götter zürnten seiner Sippe.
Seine Gefährten hatten bis zuletzt versucht, ihn zu beschützen. So war ihm die Flucht gelungen. Ihm und damit dem, was er bei sich trug. Aber jetzt kamen die Rufe der Verfolger wieder näher. Schnell, schnell! Sonst war es zu spät.
Kurz darauf hatte der weise Mann sein Ziel erreicht. Hastig murmelte er die notwendige Beschwörungsformel. Dann fegte er mit der Hand das Laub beiseite, welches die geflochtene Weidenplatte verdeckte. Er hob die Platte, die als Deckel diente, und schob den Beutel in die mit Steinen ausgekleidete Grube. Anschließend verschloss er die Öffnung wieder und verteilte das Laub über dem Deckel. Ein letzter prüfender Blick. Er war zufrieden. Einem flüchtigen Beobachter würde das Erdloch nicht auffallen.
Ächzend erhob sich der Alte, um sich so weit als möglich vom Versteck zu entfernen, so wie es die Enten taten, wenn ihre Brut durch Räuber gefährdet war.
Er wandte sich nach links und lief den Abhang hinunter. Dabei achtete er nicht mehr darauf, ob ihn das Brechen von Zweigen verriet. Eine Entenmutter, die ihr Nest beschützte, tat genau das Gleiche. Sie täuschte eine Verletzung vor, spielte die leichte Beute und lockte so den Räuber immer weiter von ihren Jungen fort. War der Feind weit genug davon entfernt, flog sie davon. Das allerdings blieb ihm verwehrt. Er wusste, was ihn erwartete, wenn die Fremden ihn erreichten.
Die Rufe und das Geschrei hinter ihm wurden lauter. Er stürzte über eine hochstehende Wurzel, fiel, rollte einige Meter den Abhang hinunter und blieb schließlich an einem Wacholderstrauch hängen. Ehe er sich wieder aufrappeln konnte, waren sie über ihm. Der Alte drehte sich langsam auf den Rücken. Er sah in das bärtige Gesicht eines der Männer, die ihn gestellt hatten. Dessen Gesichtsausdruck war seltsam gleichgültig. Keine Wut, kein Triumph war in seinen Zügen auszumachen. Der Gefallene unter ihm war ein Opfer, eine Jagdbeute, sonst nichts. Der Bärtige hob beide Arme.
Für einen Moment brach ein Sonnenstrahl durch die Wolken. Etwas in den Händen des Kriegers über ihm blitzte. Der Alte erkannte, was ihn töten würde. Eine Waffe aus dem Stoff, den die Götter erschaffen hatten. Etwas, das die gleiche Beschaffenheit hatte wie das, was nun sicher in seinem Versteck verborgen lag. Der Bewahrer schloss die Augen und lächelte. Nun war es so weit. Dann sollte es wohl so sein. Der Weise würde durch die Hand der Götter sterben. Aber die Gabe war sicher. Er hatte seinen Auftrag erfüllt.
Erster Teil
Toskana
1
Die Hügel der Toskana sind an einem nebeligen Novembertag bei leichtem Nieselregen auch nicht sehr viel attraktiver als, sagen wir, die Berge bei Olpe. Nur der Rotwein ist hier besser. Im Chianti, nicht im Sauerland natürlich. Und wer schon einmal in der Trattoria Montagliari zwischen Greve und Panzano ein Bistecca Fiorentina mit einem Glas Rotwein genossen hat, weiß, warum die halbe Welt in diesen Landstrich, nicht aber nach Sundern fährt.
Das war mein fünfter Besuch in der Toskana. Bei den vorherigen war allerdings das Wetter besser gewesen. Aber ich war dieses Mal nicht hier, um Ferien zu machen. Ganz im Gegenteil: Die hatte ich gerade unterbrochen.
Dermöllers Anruf hatte mich vor zwei Tagen auf der Insel Juist erreicht. Ich liebe die Nordsee im Winter. Kaum Touristen. Man hat die ursprüngliche Natur zu dieser Jahreszeit quasi für sich allein.
Heinz Dermöller, der höchste Chef aller Schadensregulierer der Versicherung AG, hatte mich in dem Gespräch für den nächsten Morgen nach Italien beordert, wo er sich auf einer Dienstreise befand. Da seine Gesellschaft mir die meisten meiner Aufträge übertrug, hatte ich schweren Herzens der Urlaubsunterbrechung zugestimmt. Wie heißt es doch so schön: Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.
An den meisten Wintertagen gibt es nur eine Fährverbindung von Juist zum Festland. Und zum Zeitpunkt von Dermöllers Anruf war die Fähre schon auf dem Rückweg nach Norddeich. Der Novembernebel verhinderte, dass Flugzeuge auf dem kleinen Flugplatz der Insel landen konnten. Kurz: Ich konnte den Termin nicht einhalten, sondern saß bis zum nächsten Tag auf Juist fest. Nicht dass mir das etwas ausgemacht hätte. Aber Dermöller war über diese Verspätung mehr als ungehalten und verlangte, dass ich mich so bald wie möglich in seinem Hotel in Montecatini Terme einfand.
Ich nahm also am Morgen die Fähre, fuhr mit meinem Wagen, den ich in Norddeich abgestellt hatte, zurück zu meiner Wohnung nach Herne, ersetzte die schmutzige Wäsche durch saubere und saß bereits am frühen Nachmittag im Flieger nach München, wo ich in die Maschine nach Florenz umsteigen musste. Wegen eines technischen Defektes verzögerte sich der Abflug in der bayerischen Landeshauptstadt jedoch um zwei Stunden. So kam ich erst sehr spät in dem Hotel an, in dem Dermöller wohnte und in dem sein Büro auch für mich ein Zimmer reserviert hatte.
An der Rezeption wurde mir eine Nachricht übergeben. Warten Sie ab zehn auf mich in der Hotelbar. Dermöller. So war sein Stil. Knapp, unmissverständlich und keinen Widerspruch ertragend. Ich fügte mich. Allerdings würde sich dieser Befehlston für die Versicherung AG ungünstig auf meine nächste Rechnung auswirken, das stand fest.
Der Jugendstilbau an einem Hang oberhalb des Stadtkerns erinnerte an einen der Paläste, wie ihn schwerreiche italienische Adelige oder Industrielle im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert bewohnt hatten.
Die Lobby des Hotels glänzte in schwarzem Marmor, von den etwa fünf Meter hohen Decken spendeten pompöse Kristallleuchter warmes Licht. Weiche, großzügig angeordnete Polstergruppen bildeten kleine Inseln der Ruhe am Rande der Geschäftigkeit des Eingangsbereichs.
Mein Hotelzimmer war von fast quadratischem Grundriss. Da die Höhe der Wände die der Seitenlängen überstieg, hatte ich den Eindruck, einen Turm zu betreten. Auch die Zimmertüren waren mindestens einen halben Meter höher als gewöhnlich, sodass die gesamte Anordnung überdimensioniert wirkte und ich mich angesichts des Gigantismus meiner Umgebung ein wenig klein und unbedeutend fühlte. Architektur als subtiles Herrschaftsinstrument.
Der Blick vom Balkon auf die Stadt entschädigte für das so einschüchternde Ambiente und die eher rustikale Ausstattung des Raumes.
Um kurz vor zehn suchte ich die Hotelbar auf, um bei einem Espresso und einem Brandy auf Dermöller zu warten. Als mein Auftraggeber um halb elf noch nicht erschienen war, orderte ich eine Flasche Vernaccio di San Giminiano, fest entschlossen, damit das Spesenkonto der Versicherung AG zu belasten.
Um kurz nach elf Uhr fuhr Dermöller in einem Taxi vor. Ich beobachtete ihn durch die großen Fenster der Lobby. Er betrat die Hotelhalle, sah sich einen Moment suchend um, nickte mir zu, als er mich erkannte, und ging zur Rezeption, an der er seinen Zimmerschlüssel in Empfang nahm. Dann kam er an meinen Tisch und ließ sich grußlos in einen der Sessel fallen.
»Ich habe mich verspätet. Wie Sie auch«, setzte er hinzu. Das klang nicht gerade nach einer Entschuldigung. »Wie war Ihr Flug?«
»Leidlich. Ich besteige Maschinen, bei denen kurz vor dem Abflug noch wichtige Aggregate ausgetauscht werden müssen, immer mit einem unguten Gefühl. Und fliege erst recht nicht besonders gern propellergetrieben über die Alpen. Eigentlich benutze ich Flugzeuge nur in Notfällen.«
»Aha. Da Sie hier sind, kann ich wohl davon ausgehen, dass Sie mich als einen solchen Notfall betrachten?«
»Zweifelsohne. Oder haben Sie mich etwa nicht aus einem wichtigen Grund von Juist in die Toskana beordert?«
Dermöller schwieg. Dann zeigte er auf die halb volle Weißweinflasche. »Laden Sie mich ein?«
»Selbstverständlich.« Ich winkte einem Kellner und bestellte ein zweites Glas.
»Von Weinen verstehen Sie etwas«, bemerkte mein Gesprächspartner, nachdem er den Vernaccio probiert hatte. »Ohne Zweifel.«
»Danke.«
Der Direktor nahm noch einen Schluck. »Haben Sie eigentlich abgenommen?«
Normalerweise fühle ich mich geschmeichelt, wenn jemand bemerkt, dass ich etwas abgespeckt habe. Dermöllers Bemerkung hörte sich aber eher wie Kritik und nicht wie ein Lob an. Wie auch immer. Ein befreundeter Arzt hatte mir vor knapp einem Jahr lachend die simple Rechnung aufgemacht: Ein Mensch wird nur dicker, wenn er mehr Kilokalorien zuführt, als er verbraucht. Also gebe es zwei Möglichkeiten, um abzunehmen. Weniger essen oder mehr bewegen. Ich hatte mich für die zweite Variante entschieden. Nun jogge ich morgens und abends je dreißig Minuten. Und das mit Erfolg.
»Ja. Etwa zehn Kilo im letzten Jahr.«
»Sie hatten es auch nötig.«
Die Rechnung an die Versicherung AG würde noch etwas höher werden.
»Sagt Ihnen die Himmelsscheibe von Nebra etwas?«, beendete er unvermittelt unseren Smalltalk.
»Nein«, antwortete ich wahrheitsgemäß.
»Sollte Ihnen aber. Wegen der sind Sie nämlich hier.«
»Tatsächlich?« Ich war wenig beeindruckt.
Er ignorierte meinen leichten Spott. »Ja. Die Himmelsscheibe wurde vom Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an das Florentiner Museo Archeologico für eine Ausstellung über frühgermanische Astrologie ausgeliehen und vor einigen Tagen aus dem Museum gestohlen.«
»Ich vermute, diese Scheibe ist wertvoll? Sonst hätten Sie mich ja wohl nicht aus dem Urlaub geholt.«
»Davon können Sie ausgehen.«
»Und wie wertvoll?«
»Keine Ahnung. Wie wollen Sie den Wert eines Unikates bestimmen, für das es keinen Käufer gibt?«
»Aber Ihr Unternehmen hat diese Scheibe versichert?«, vergewisserte ich mich.
»So ist es.«
»Und für wie viel?«
»Zwanzig Millionen.«
Ich pfiff durch die Zähne.
»Eben.« Dermöller griff zum Weinglas.
»Sie sagten eben, es gebe keinen Käufer für das Stück?«, fragte ich weiter.
»Das glauben wir.«
»Wieso?«
»Erfahrung, Intuition, was immer Sie wollen.«
»Also Artnapping.«
Dermöller nickte.
Diese Variante des Kunstdiebstahls kam in letzter Zeit immer häufiger vor. Durchgeknallte Sammler, die zum Beispiel den Diebstahl eines Renoirs in Auftrag geben, um sich dann bei Kunstlicht allein in einem versteckten Safe an dem Anblick des Gemäldes zu berauschen, sterben langsam aus. Stattdessen treten mehr und mehr organisierte Banden auf den Plan. Sie entwenden ein wertvolles Kunstwerk und bieten es den bestohlenen Museen oder auch den Versicherungsunternehmen zum Rückkauf an. Im Vergleich zum ›echten‹ Kidnapping birgt der Raub von Kunstgegenständen weniger Risiken. Bilder wehren sich nicht, lassen sich leichter verstecken und können nicht als Zeugen aussagen. Vor allem aber ist das Strafmaß für Kunstdiebstahl deutlich geringer als das für erpresserische Entführung. Um nicht ermutigend zu wirken, bestreiten betroffene Versicherungen allerdings vehement, Zahlungen für gestohlene Kunstgegenstände zu leisten.
»Sie haben Prokura bis zwei Millionen. Jeder Betrag, der darunterliegt, erhöht Ihre Provision um zehn Prozent des eingesparten Betrages.«
»In Ordnung. Zuzüglich fünf Prozent der zwei Millionen. Fixum dreihundert am Tag. Plus Spesen.«
»Sie sind nicht billig«, stöhnte Dermöller.
»Nein«, grinste ich. »Aber gut.«
Der Direktor griff in seine Jackentasche und schob mir eine Visitenkarte zu. »Diese junge Dame hier wird Ihnen alles über die Himmelsscheibe und die geplante Ausstellung erzählen. Sie hat in Archäologie promoviert und spricht ausgezeichnet Deutsch. Ich habe für Sie morgen einen Termin organisiert. Um zehn im Museum.« Dermöller schob mir einen Zettel zu. »Und hier ist die Anschrift unserer Repräsentanz in Florenz und der Name Ihres Ansprechpartners. Er weiß Bescheid und wird Ihnen bei Bedarf behilflich sein.« Er stand auf. »Sie entschuldigen mich bitte. Ich habe morgen einen schweren Tag.«
»Herr Dermöller …«
»Ihren Vertrag, meinen Sie? Kommt. Schickt Ihnen mein Sekretariat zu. War es das?«
Er wartete meine Antwort nicht mehr ab, sondern verschwand in Richtung Fahrstuhl.
Ich goss den restlichen Wein in mein Glas und griff nach der Visitenkarte. Dr. Gianna Rossi, las ich da. Und dann den Namen und die Adresse des Museums.
2
Es war sieben Uhr, als mich mein Wecker aus dem Schlaf riss. Für meine Verhältnisse zu früh, vor neun Uhr bin ich einfach ungenießbar. Aber was sein muss, muss sein.
Ich hatte mich noch gestern Abend an der Rezeption erkundigt, wie weit es von Montecatini Terme nach Florenz sei. Die Hotelangestellte hatte daraufhin mit einem entschuldigenden Lächeln doziert, dass sich fast alle Auto fahrenden Italiener als Anarchisten fühlten und deshalb Ver- und Gebote im Straßenverkehr allenfalls als unverbindliche Hinweise auffassen würden. Das führe üblicherweise zu leicht chaotischen Straßenverhältnissen. Deshalb sollte ich sicherheitshalber ein wenig mehr Zeit für die fünfzig Kilometer einplanen, als ich es aus Deutschland gewohnt sei. Etwa neunzig Minuten im morgendlichen Berufsverkehr dürften vermutlich reichen, meinte sie. Am einfachsten sei es, ein Taxi zu nehmen. Das würde mir nicht nur die Anpassung an die italienische Fahrweise, sondern auch die lästige und ziemlich aufwändige Suche nach einem Parkplatz in der Florentiner Innenstadt ersparen. Ich hatte beschlossen, ihrem Rat zu folgen.
Da ich um halb acht noch nicht in der Lage bin, mir den Magen voll zu schlagen, beschränkte sich mein Frühstück auf einen starken Kaffee und einen Toast. Anschließend griff ich zum Handy, um Marlene anzurufen. Meine übliche Joggingtour musste heute ausfallen.
Mit Marlene Schneider, Oberstaatsanwältin in Dortmund, teile ich manchmal Tisch und Bett. Marlene und ich hatten uns sehr nahe gestanden, bis wir uns vor etwas mehr als vier Wochen einen ziemlich heftigen Streit lieferten. Seitdem war zwischen uns eine gewisse Funkstille eingetreten.
Eigentlich war unsere Auseinandersetzung vorhersehbar gewesen. Wir hatten den Versuch unternommen, gemeinsam in einer Wohnung, genauer: in Marlenes Wohnung, zu leben. Es sollte eine Art Generalprobe für eine zukünftige ständige Zweisamkeit sein. Und wie so häufig ging diese Probe aufs Exempel gründlich schief. Es waren die alltäglichen Kleinigkeiten, die nicht miteinander vereinbar waren: Ich hielt es für schlampig, wenn wir nicht sofort nach dem Essen die Küche aufräumten, sie für gemütlich. Sie störte, dass ich ständig das Radio im Hintergrund als Geräuschkulisse vor sich hin dudeln ließ, mich beruhigte das. Nach einer Woche hatte es fast zwangsläufig krachen müssen.
Menschen, die jahrelang allein gewohnt haben, sind eben nicht so ohne Weiteres kompatibel. Was im Urlaub funktioniert, muss nicht automatisch auch im Alltag klappen. Das zumindest war uns klar geworden.
Natürlich redeten wir noch miteinander. Wir sind schließlich erwachsene Menschen. Unsere Gespräche hatten im Moment jedoch nur noch den Charakter eines unverbindlichen Geplauders und nicht den einer wirklichen Auseinandersetzung mit den Ansichten des anderen.
Marlene nahm nicht ab. Achselzuckend verstaute ich das Handy in meiner Jackentasche, schnappte mir meine Lederjacke und verließ das Zimmer.
Italienisch radebrechend und mit Händen und Füßen versuchte ich, dem Taxifahrer zu erklären, wo ich hinwollte. Er quittierte meine Versuche mit einem mitleidigen Gesichtsausdruck und gab mir in grammatikalisch zwar nicht ganz korrektem, aber gut verständlichem Deutsch zur Antwort, dass er einige Jahre bei Ford in Köln am Band gearbeitet habe und deshalb durchaus meine Muttersprache verstünde. Dann gab er Gas.
Kurz vor Florenz, auf einer zweispurigen Schnellstraße, erkundigte ich mich bei ihm, wie eine promovierte Wissenschaftlerin im Italienischen richtig angesprochen wurde. Ich hatte schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass die fehlerfreie Aussprache von Titel und Namen einen guten Eindruck machte und einem manche Tür öffnen konnte.
Der Fahrer erklärte es mir.
»Und der Name?«, fragte ich. »Wie wird der ausgesprochen?«
»Haben Sie Visitenkarte?«
Ich reichte sie ihm nach vorn.
Er warf nur einen flüchtigen Blick darauf, setzte den Blinker und überholte vor einer Kurve hupend einen langsameren Wagen, etwa so, als ob er sich als Testfahrer bei Ferrari bewerben wollte. Ich rutschte tiefer in meinen Sitz und beobachtete mit Sorge die Geschwindigkeitsanzeige, deren Zeiger sich zügig auf die einhundertundvierzig zubewegte. Auch die unübersichtliche Kurve kam schnell näher. Anscheinend waren die Warnungen der Hotelangestellten vor der Fahrweise ihrer Landsleute berechtigt gewesen. Der Taxifahrer blieb auf der linken Spur und beschleunigte weiter, um den nächsten Lkw zu überholen. Mit links hielt er das Lenkrad, mit rechts die Visitenkarte, drehte sich schließlich halb zu mir um, sah mir ins Gesicht und erläuterte mit einem verträumten Lächeln: »Name ist wie Musik. Dottoressa Gianna Rossi.«
Er wedelte mit der Karte durch die Luft. Wir waren noch immer auf der linken Spur.
Aus der Kurve schoss ein anderes Fahrzeug und kam uns, wie ich meinte, mit sehr hoher Geschwindigkeit entgegen. Ich atmete tief ein und hielt die Luft an.
Mein Kutscher schaute glücklicherweise wieder nach vorn auf die Straße und gab noch mehr Gas. Die Tachonadel zitterte. Mit quietschenden Reifen lenkte er das Taxi unmittelbar vor den Lkw und vermied so in letzter Sekunde einen Frontalzusammenstoß. Rasselnd entwich die Luft aus meinen Lungen. Mein Chauffeur trat kräftig auf die Bremse, um mit geringerer Geschwindigkeit endlich selbst die Kurve zu nehmen. Der Sicherheitsgurt schnitt schmerzhaft in meinen Oberkörper.
Sowohl der Kontrahent auf der Gegenspur als auch der hinter uns fahrende Brummi zeigten wenig Verständnis für dieses gewagte Fahrmanöver und der Lkw-Fahrer schickte uns wütende Hupsignale und Lichtblitze hinterher.
Der Taxifahrer hingegen hatte für diese berechtigte Empörung nur eine verächtliche Handbewegung übrig.
»Stupido«, war sein Kommentar.
Dann hatte er die Kurve passiert und trat wieder aufs Gaspedal. Ich ergab mich in mein Schicksal.
Auch die verbleibende Strecke legten wir in Rekordzeit zurück. Als ich bezahlt hatte und aussteigen wollte, drückte mir der Fahrer eine Visitenkarte in die Hand. »Wenn Sie brauchen Taxi«, meinte er grinsend.
Das Archäologische Museum befand sich in der Innenstadt, ganz in der Nähe der Universität und nur zwei Querstraßen vom Dom entfernt. Die Leitung des Museums war jedoch nicht im ehemaligen Palazzo della Crocetta an der Via della Colonna untergebracht, sondern in einem Nebengebäude in der Via Laura.
Der dortige Pförtner sprach Englisch. Ich trug ihm mein Anliegen vor, er griff zum Telefonhörer und kurze Zeit später begrüßte mich die Frau mit dem Namen wie Musik im Eingangsbereich.
Ich weiß nicht genau warum, aber ich war davon ausgegangen, dass Archäologinnen und Archäologen eine gewisse Ähnlichkeit mit den Gegenständen ihrer Forschungen aufweisen würden. Ich hatte mir die Wissenschaftlerin als jenseits der fünfzig vorgestellt, in Ehren ergraut und leicht verstaubt.
Dottoressa Gianna Rossi war das genaue Gegenteil: höchstens fünfunddreißig, hoch gewachsen, schlank. Lange dunkle Haare umrahmten ihr Gesicht, welches die typischen Züge einer stolzen Italienerin trug, die sich ihrer Wirkung auf die vorzugsweise männliche Umgebung sehr wohl bewusst ist. Sie schenkte mir ein bezauberndes Lächeln. Keine Frage, Dottoressa Gianna Rossi war atemberaubend schön.
»Guten Morgen. Herr Büsing, nehme ich an?« Sie sprach Deutsch mit einem leichten Akzent, der ein wenig an einen bayerischen Dialekt erinnerte.
Ich war so überrascht, dass ich mich prompt verhaspelte. »Dorotessa … Äh … Entschuldigen Sie, ich …«
Sie streckte mir strahlend ihre Hand entgegen. »Vergessen Sie doch bitte den Titel. Belassen wir es bei den Vornamen, wenn Sie einverstanden sind. Ich bin Gianna. Und Sie heißen …«
»Jean-Paul«, beeilte ich mich zu erwidern.
»Schön, Sie kennen zu lernen, Jean-Paul. Wollen wir in mein Büro gehen?«
Ich nickte folgsam.
Ihr Büro lag im vierten Stock des Gebäudes, direkt unter dem Dach. Es gab keinen Fahrstuhl. Auf dem Weg nach oben erhielt ich Gelegenheit, unbemerkt ihre perfekte Figur zu bewundern. Sie trug enge Jeans und einen dunkelblauen Pullover, der ihre Reize betonte.
»Wo haben Sie meine Sprache so gut sprechen gelernt?«, erkundigte ich mich etwas außer Atem, als wir die oberste Etage erreicht hatten. Einmal mehr musste ich feststellen, dass ich mit Ende vierzig nicht mehr der Jüngste war.
»In Deutschland natürlich. Meine Eltern und ich sind Ende der Siebzigerjahre dorthin gezogen. Da war ich acht. Mein Vater hat von einem Cousin eine Pizzeria in Passau übernommen. Später habe ich in Regensburg studiert. In Italien lebe ich erst wieder seit etwa sieben Jahren.«
Das erklärte alles. Wir blieben vor einer kleinen Tür stehen.
Sie öffnete und ließ mich eintreten. »Hier, bitte.«
In ihrem Büro herrschte das blanke Chaos. Auf dem Schreibtisch waren Papierhaufen zu eindrucksvollen Gebirgen aufgetürmt, die so aussahen, als ob sie jeden Augenblick in sich zusammenfallen würden. Auf dem Boden stapelten sich Bücher und Zeitschriften, die Regale an den Wänden bogen sich unter der Last dutzender Aktenordner. Nur der Inhalt einer Glasvitrine hinter dem Arbeitsplatz sah so aus, als ob er von Zeit zu Zeit einer Inventur unterzogen wurde.
Gianna Rossi registrierte meinen überraschten Blick und räumte mit einem herzlichen Lächeln mehrere Bücher zur Seite, die auf dem einzigen Besucherstuhl lagen, den ich auf die Schnelle in dem Raum ausmachen konnte.
»Vielleicht sollte ich bei Gelegenheit mal etwas Ordnung schaffen«, meinte sie immer noch lachend und zauberte aus den Tiefen des Raumes ein Tablett mit Kanne, Tassen, Milch und Zucker hervor, das sie mir in die Hände drückte.
»Halten Sie es bitte einen Moment?«
Sie schob zwei der Papierberge auf dem Schreibtisch zur Seite und schaffte so Platz für das Tablett. »Dorthin bitte.« Geschickt steuerte sie ihren Schreibtischstuhl auf seinen Rollen um die Buchbarrieren herum und bugsierte ihn neben die andere Sitzgelegenheit.
»Nehmen Sie doch Platz. Kaffee?«
Wir setzten uns. Ohne meine Antwort abzuwarten, griff sie zur Kanne, schenkte ein und reichte mir die Tasse. Ich nickte dankend und nahm einen Schluck. Der Kaffee war ausgezeichnet. Wie fast überall in Italien.
»Sie sehen gar nicht aus wie ein Detektiv«, stellte Gianna Rossi fest. »Sie wirken so, wie soll ich sagen, seriös.«
»Danke, falls es ein Kompliment sein sollte. Aber wie sieht denn Ihrer Meinung nach ein Detektiv aus?«
»Wie Roger Moore«, platzte es aus ihr heraus.
Ich grinste schief. Mit James Bond konnte ich mich tatsächlich nicht messen. »Kein Wunder, dass ich bei diesem Vergleich schlecht abschneide. Ich mag nämlich keine Martinis. Egal ob gerührt oder geschüttelt. Außerdem arbeite ich für Versicherungsgesellschaften. Da geht es üblicherweise um Betrug. Die Rettung der Welt ist nicht mein Metier.«
Sie machte ein erschrockenes Gesicht. »Habe ich Sie mit meiner dummen Bemerkung etwa verletzt?«
Ich hob abwehrend die Hände. »Ach was.«
»Wirklich nicht?«
»Nein, bestimmt nicht.«
Sie wirkte beruhigt. »Gut. Erzählen Sie mir, was Sie genau tun?«
Ich berichtete ihr, dass ich dann engagiert werde, wenn es zum einen um hohe Versicherungssummen geht und zum anderen die Polizei nicht eingeschaltet werden soll oder aber ihre Ermittlungen bereits eingestellt hat.
»Deshalb besitze ich auch keine Schusswaffe«, schloss ich meine kurzen Erläuterungen. »Wirtschaftskriminelle, und um die Klientel handelt es sich fast immer in meinen Fällen, arbeiten in der Regel mit Handy und Computer und nicht mit einer Pistole.«
»Das hört sich interessant an.« Sie nippte am Kaffee und schwieg für einige Sekunden. Dann fuhr sie fort: »Soweit ich weiß, ermittelt die hiesige Polizei noch. Der Grund dafür, dass die Versicherungsgesellschaft einen eigenen Detektiv beauftragt, ist vermutlich die hohe Versicherungssumme?«
Ich nickte.
»Das heißt, Ihre Auftraggeber glauben, dass Sie mehr über das Verschwinden der Scheibe herausbekommen können als die offiziellen Stellen, oder?«
»Lassen Sie es mich so formulieren: Ich kann die Bestimmungen des Gesetzbuches vermutlich etwas weniger restriktiv als ein Polizeibeamter auslegen.«
Sie lachte schallend. »Da kennen Sie aber meine Landsleute schlecht. Im kreativen Umgang mit Vorschriften aller Art sind wir kaum zu schlagen. Das gilt auch für Beamte. Oder gerade für diese«, schmunzelte sie. »Hohe Repräsentanten des Staates eingeschlossen. Aber lassen wir das. Wie kann ich Ihnen helfen?« Gianna Rossi sah mich aufmerksam an.
»Fangen wir mit dem Objekt an. Was habe ich mir unter der Himmelsscheibe von Nebra genau vorzustellen?«
»Haben Sie sie schon einmal gesehen?«, fragte sie zurück.
»Nicht dass ich wüsste.«
Die Archäologin stand auf, trat hinter ihren Schreibtisch und kramte in einem der Papierstapel. »Wir haben uns aus Halle Abbildungen der Scheibe schicken lassen, um den Ausstellungskatalog vorbereiten zu können. Warten Sie, ich finde die Bilder sofort. Ja, hier sind sie.« Sie zog ein Foto aus einer Klarsichthülle und kehrte zu mir zurück. »Bitte. Das ist sie.«
Ich nahm die Fotografie. Abgebildet war eine runde, fleckig grüne Scheibe. Gut zwei Dutzend goldgelber Punkte bildeten unregelmäßige, helle Sprenkel, in der Mitte der Scheibe befand sich ein Kreis. Er war ebenfalls golden, allerdings schien ein Teil der Beschichtung abgeplatzt. Drei goldene Sicheln am Rand der Scheibe vervollständigten die Darstellung. Ich konnte mich erinnern, in einer Illustrierten schon einmal ein solches Bild gesehen zu haben.
»Ist diese Abbildung maßstabgetreu?«, erkundigte ich mich.
»Nein. Die Scheibe misst zweiunddreißig Zentimeter im Durchmesser und wiegt etwa zwei Kilogramm.«
»Aha.« Also war es für denjenigen, der sich des Artefaktes bemächtigt hatte, kein Problem gewesen, das Teil unauffällig zu transportieren. »Aus welchem Material besteht das Ding?«
Sie rutschte etwas näher zu mir heran. Ich nahm ihr Parfüm wahr. Dezent und frisch.
»Die Scheibe selbst ist aus Kupfer. Oxydiert. Die Patina ist …« Sie suchte nach dem richtigen Wort.
»Grünspan«, beeilte ich mich, ihr zu helfen.
»Ja, genau. Das Metall stammt vermutlich aus den Ostalpen. Die Sterne, die Horizontbögen und die Mond- oder Sonnenscheibe sind aus Gold, welches möglicherweise seinen Ursprung in Siebenbürgen hat. Darauf deuten jedenfalls Goldfunde gleichen Alters hin, die in dieser Gegend gemacht wurden.«
»Und wie alt ist die Scheibe?«
»Sie wurde um 1600 vor Christus in mehreren Phasen gefertigt. In der frühen Bronzezeit.«
»Und in Deutschland gefunden?«
»Ja. In einem Waldgebiet auf dem Mittelberg in der Nähe von Nebra. Das liegt in Sachsen-Anhalt im Grenzgebiet der Landkreise Merseburg-Querfurt und dem Burgenlandkreis. Dort befindet sich eine ringförmige Wallanlage. Ausgegraben wurde die Scheibe übrigens von Amateuren, nicht von Archäologen. Von Raubgräbern, um genau zu sein.«
»Raubgräbern?«
»Ja. Im Juli 1999 haben zwei Amateurschatzsucher den Mittelberg mit einer Metallsonde abgesucht und sind auf die Scheibe gestoßen. Die Raubgräber haben sie später für etwa fünfzehntausend Euro an einen Hehler verkauft. Über die Schweiz kehrte die Scheibe dann nach Deutschland zurück, wo sie unter anderem auch der Ruhr-Universität in Bochum zum Kauf angeboten worden ist. Bei ihrer illegalen Ausgrabung haben die Täter noch andere Gegenstände gefunden. Schwerter, Beile, Meißel und Armringe. Bedauerlicherweise sind die beiden nicht professionell vorgegangen und haben aus Unkenntnis vieles von dem zerstört, was uns Archäologen einen Hinweis darauf hätte geben können, ob die Himmelsscheibe und die anderen Fundstücke dort nur zufällig gelegen haben oder aber einem bestimmten Zweck dienten.«
»Welchem Zweck?«
»Möglicherweise handelt es sich bei der Scheibe um einen astronomischen Kalender. Sehen Sie«, Gianna Rossi deutete auf eine Ansammlung von sieben Punkten im oberen Teil der Scheibe. »Das könnte eine Abbildung des Siebengestirns sein, der Plejaden. Die am Rand aufgetragenen Horizontalbögen stellen möglicherweise Auf- und Untergangspunkte der Sonne sowie den realen Horizont dar.« Die Begeisterung in ihrer Stimme war nicht zu überhören. »An den Tagen der Tag-und-Nacht-Gleiche, das sind der 21. März und der 21. September, gehen die Plejaden unter beziehungsweise auf und sie sind für etwa drei Monate die ganze Nacht hindurch sichtbar. In diesem Fall stehen sie der Sonne gegenüber. Dagegen sind sie im Winter und Sommer nachts nur vor oder nach Mitternacht zu beobachten. Sie können also als Jahreszeitenanzeiger für Frühling und Herbst verwendet werden. Das waren für die damaligen Kulturen wichtige Daten, denn sie markierten den Beginn der Saat und der Ernte. Besonders interessant ist, dass die Sternengruppe die Vorhersage einer Mondfinsternis ermöglicht. Wenn der zunehmende Halbmond etwa alle achtzehn Jahre die Plejaden verdeckt, kommt es beim nächsten Vollmond zu einer Mondfinsternis. Auch das lässt sich vermutlich aus der Anordnung der Sterne auf der Himmelsscheibe herauslesen. Und schließlich …«
Ihr Monolog wurde durch ein Klopfen unterbrochen. Unmittelbar darauf streckte ein Mann seinen Kopf durch den Türspalt, nickte mir kurz zu und redete mit der Dottoressa auf Italienisch. Dann wurde die Tür wieder geschlossen.
»Das war mein Kollege Paolo Meozzi. Er hat sich mit mir zum Essen verabredet. Ich habe ihm gesagt, dass Sie uns begleiten. Das ist Ihnen doch recht, oder?«
»Natürlich.«
Das Telefon klingelte. Die Archäologin stand auf, beugte sich vor und nahm ab. »Pronto?«
Danach sagte sie nur noch »Si« und »No«. Nach höchstens einer Minute legte Gianna Rossi wieder auf. Als sie sich setzte, war ihr Gesicht aschfahl. Die Mimik waren starr und die Augen blickten ins Leere. Dann ging ein Ruck durch ihren Körper und die Wissenschaftlerin hatte sich augenscheinlich wieder im Griff.
»Schön. Wo waren wir stehen geblieben?«, sagte sie.
Ich glaubte nicht, dass mir die archäologisch korrekte Einordnung der Himmelsscheibe bei der Suche nach dem oder den Tätern weiterhelfen würde. Andererseits wollte ich die junge Archäologin auch nicht kränken. Deshalb antwortete ich so diplomatisch wie möglich. »Sie sollten mir später mehr von der Bedeutung dieses Fundes erzählen. Im Moment interessieren mich vor allem einige praktische Fragen, wenn Sie erlauben.«
Dottoressa Gianna Rossi antwortete nicht. Sie schien mit ihren Gedanken weit weg zu sein.
»Dottoressa?«
»Ja?«, schreckte sie hoch. »Natürlich. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie gelangweilt habe.«
»Nein, im Gegenteil«, beeilte ich mich zu versichern. »Das ist alles sehr interessant. Wirklich.« Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie mir glaubte. »Können Sie mir etwas über diese Ausstellung erzählen, für die die Scheibe ausgeliehen wurde?«
»Selbstverständlich. Wir planen seit etwa zwei Jahren eine Präsentation von astronomischen Gegenständen der Kulturen, die in der Bronzezeit und danach in Mitteleuropa ansässig waren. Bis hin zu den Germanen. Als wir von dem sensationellen Fund in Sachsen-Anhalt hörten, waren wir natürlich sofort daran interessiert, die Scheibe auch unserem Publikum vorzustellen. Die Verhandlungen zogen sich über Monate hin. Sie waren nicht einfach, wie Sie sich denken können. Strittig blieb bis zum Schluss die Höhe der Versicherungssumme.«
»Zwanzig Millionen, ich weiß.«
»Ein symbolischer Betrag. Der Wert der Himmelsscheibe von Nebra ist unschätzbar.«
Das wusste ich ja schon von Dermöller. »Wie wird eine solche Ausleihe abgewickelt?«
»Meinen Sie die praktische Durchführung oder die rechtliche Dimension?«
»Beides.«
»Die rechtliche Seite ist schnell erklärt: Der Verleiher bestimmt die Ausleihbedingungen, der Entleiher stimmt zu, zahlt und haftet für mögliche Schäden an dem ausgeliehenen Objekt.«
»Was zahlt der Entleiher?«
»Alles. Versicherung, Transport, eventuelle Restaurierung, manchmal eine Leihgebühr …«
»Ist die hoch?«
»Das hängt vom Wert des ausgeliehenen Stückes ab.«
»Musste Ihr Museum Leihgebühr bezahlen?«
»Nein. Glücklicherweise nicht. Vermutlich hätten wir uns sonst eine Ausstellung der Scheibe nicht leisten können.«
»Und wie läuft das Verfahren praktisch ab? Wer wusste davon, dass Sie sich die Scheibe ausleihen wollten?«
»Da das Objekt noch wissenschaftlich untersucht wurde, konnte die Öffentlichkeit nichts von der Leihgabe wissen. Informiert waren in unserem Haus selbstverständlich die Museumsleitung, die Mitarbeiter, die die Ausstellung konzipiert haben …«
»Wer ist das?«, unterbrach ich sie.
»Paolo Meozzi und ich.«
Fragend sah ich zu einem Block, der auf dem Schreibtisch lag. Wie so häufig, hatte ich meine Schreibutensilien vergessen.
»Bedienen Sie sich.«
Ich notierte, was mir Frau Rossi über das Ausleihverfahren gesagt hatte, und schrieb auch den Namen auf. »Sonst wusste keiner davon?«
»Nein … Halt, natürlich auch die Mitarbeiterin, die für uns die Schreibarbeiten erledigt. Aber sie ist über jeden Verdacht erhaben.«
»Verraten Sie mir trotzdem, wie sie heißt?«
Gianna Rossi zog die Augenbrauen hoch. »Luisa Meozzi. Sie ist die Schwester von Paolo.«
»Noch jemand?«
»Unser Lagerverwalter. Renaldo Schreiber.«
Die Archäologin sprach den Nachnamen deutsch aus. Als sie meinen fragenden Blick bemerkte, erklärte sie: »Sein Vater ist ein Landsmann von Ihnen.«
»Und sonst?«
»Keiner aus unserem Haus, soweit ich weiß. Wer von den Kollegen in Halle allerdings informiert war …?« Sie hob die Schultern.
»Wie wurde der Transport organisiert?«
»Genau so, wie es von den deutschen Behörden, dem Museum in Halle und der Versicherung AG verlangt wird. Eine Sicherheitsfirma brachte die Scheibe unter Polizeischutz im gepanzerten Fahrzeug zum Flughafen in Leipzig. Von da ging es per Flugzeug via München nach Florenz. Dort hat ein Wagen der hiesigen Niederlassung dieser Sicherheitsfirma die Himmelsscheibe entgegengenommen und bewacht zu uns ins Museum gebracht. Der Code für das Zahlenschloss, mit dem das Behältnis verplombt war, war uns zwei Tage vorher per Bote überbracht worden. Das ist alles.«
»Wussten die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, was sie transportierten?«
»Ich glaube nicht. Natürlich war in den Papieren vermerkt, dass es sich um wertvolle Fracht handelte, aber das lag für die Fahrer der Wagen ja wohl eh auf der Hand. Warum sonst hätten wir die Dienste ihres Unternehmens in Anspruch nehmen sollen?«
»Und die Scheibe ist bei Ihnen wie vorgesehen abgeliefert worden?«
»Ja. Ich selbst habe sie in Empfang genommen und den Eingang quittiert. Paolo, Herr Schreiber und ich haben dann die Einlagerung in unserem Lager überwacht. Die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma standen vor der Tür, als ich den Zahlencode eingegeben, die Stahlkiste geöffnet und die Scheibe geprüft habe. Sie war unversehrt.«
»Woher wussten Sie, dass es keine Fälschung war?«, kam mir plötzlich in den Sinn. »Sie hatten die Himmelsscheibe doch nie zuvor gesehen. Oder doch?«
Gianna Rossi sah mich verblüfft an. »Wie kommen Sie darauf, dass uns jemand eine Kopie untergeschoben haben könnte?«
»War nur so eine Idee.«
»Es war das Original. Da war kein Zweifel möglich. Alle Dokumente waren vollständig, jedes Detail stimmte.« Sie wirkte ungehalten.
»Ich wollte Ihre Kompetenz nicht infrage stellen«, entschuldigte ich mich rasch.