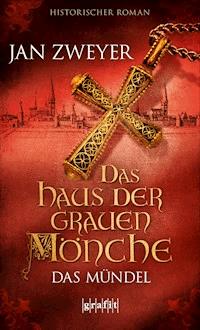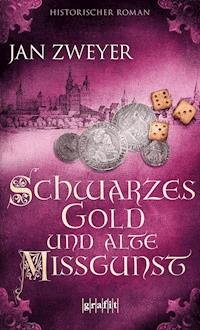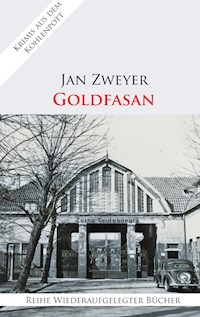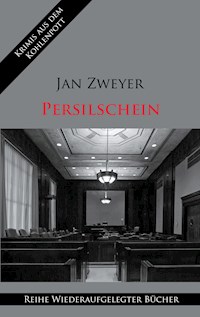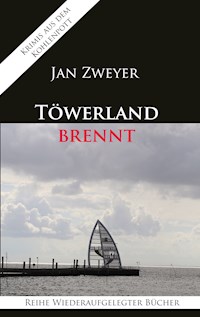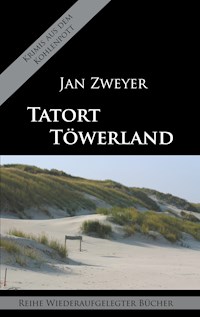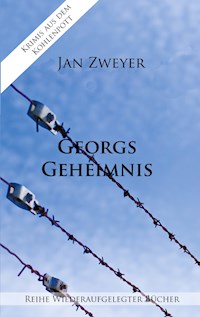Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Haus der grauen Mönche
- Sprache: Deutsch
Anno 1531: Die von Lindens gehören zu den angesehensten Handelsfamilien Hattingens. Doch bereiten dem Patriarchen Jorge seine Söhne Kopfzerbrechen: Linhardt bekommt die Probleme der Niederlassung in Lübeck nicht in den Griff. Hinrick ist zwar blitzgescheit, hat aber keinerlei kaufmännische Ambitionen. Genauso wenig wie Lukas, der sogar mit seinem Vater bricht, um Instrumentenbauer in Münster zu werden. Dort reißen gerade die Wiedertäufer die Herrschaft an sich. Ungewollt steht Lukas bald im Zentrum der Auseinandersetzungen … Jan Zweyer erzählt die große Historiensaga Das Haus der grauen Mönche in der zweiten Generation weiter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Jan Zweyer
Ein Königreichvon kurzer Dauer
Historischer Roman
Die Von-Linden-SagaDas Haus der grauen Mönche– Das Mündel Das Haus der grauen Mönche– Freund und FeindDas Haus der grauen Mönche – Im Dienst der HanseEin Königreich von kurzer Dauer
© 2017 by GRAFIT Verlag GmbH Chemnitzer Str. 31, 44139 Dortmund Internet: http://www.grafit.de E-Mail: [email protected] Alle Rechte vorbehalten. Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/CreativeHQ E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck eISBN 978-3-89425-730-9
Über das Buch
Anno 1531: Die von Lindens gehören zu den angesehensten Handelsfamilien Hattingens. Doch bereiten dem Patriarchen Jorge seine Söhne Kopfzerbrechen: Linhardt bekommt die Probleme der Niederlassung in Lübeck nicht in den Griff. Hinrick ist zwar blitzgescheit, hat aber keinerlei kaufmännische Ambitionen. Genauso wenig wie Lukas, der sogar mit seinem Vater bricht, um Instrumentenbauer in Münster zu werden. Dort reißen gerade die Wiedertäufer die Herrschaft an sich. Ungewollt steht Lukas bald im Zentrum der Auseinandersetzungen …
Der Autor
Jan Zweyerwurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für dieWestdeutsche Allgemeine Zeitung.Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne.
Mit seiner TrilogieDas Haus der grauen Möncheentführte er die Leser in das deutsche Mittelalter. InEin Königreich von kurzer Dauererzählt er nun die Geschichte der von Lindens in nächster Generation weiter.
Dramatis Personae
(Die mit einem * gekennzeichneten Figuren sind historisch belegt.)
Familie von Linden
Jorge von Linden, Kaufmann
Marlein von Linden, seine Frau
Linhardt von Linden, sein ältester Sohn
Hinrick von Linden, sein mittlerer Sohn
Lukas von Linden, sein jüngster Sohn
Hattinger Bürger
Hermann Offerhues, Kaufmann
Werner Koitgen, Bürgermeister
Konrad Kielmann, Kaufmann *
Johannes Hörstken, Gerichtsschreiber
Seyfrid, sein Sohn, Lukas’ Freund aus Kindertagen
Hug, Gehilfe Kielmanns
Fritz van Emsche, Gildemeister der Krämer
Caspar Terboven, Ratsmitglied
Werner Mey, Richter *
Lübecker Bürger
Clas Wibbeking, Kaufmann
Juliana Wibbeking, seine Frau
Martin Wibbeking, sein Sohn
Jürgen Richolff, Drucker und Buchbinder *
Madlen, seine Tochter
Jürgen Wullenwever, Bürgermeister *
Peter,Gehilfe Linhardts
Claus Upberge, Medikus
Marx Meyer, Söldner *
Jacob, Tagelöhner
Johann Oldendorp, Jurist *
Münsteraner Bürger
Heinrich Xantus, Schmied und Ratsmitglied *
Jobst, sein Sohn und Lehrling
Cuntz Muntzer, Lautenmacher *
Anna, seine Tochter
Hans Westenbrinck, Schöffe der Tischler
Melchior, Tischlerlehrling
Hinrich Gresbeck, Schreinermeister *
Jan van Leiden, Täufer, selbst ernannter König des neuen Jerusalems
Bernd Knipperdolling, führendes Mitglied der Täufer *
Jan Matthys, führendes Mitglied der Täufer *
Bernd Rothmann, führendes Mitglied der Täufer *
Bernd Krechting, führendes Mitglied der Täufer *
Heinrich Krechting, Kanzler und Stellvertreter Jan van Leidens *
Johann Dusentschuer, Goldschmied und Prophet *
Wilbolt aus Neustadt, Wiedertäufer
Hänsel Eck (eigentlich Hans von Langenstrate), Überläufer im Kampf um Münster *
Adelige und ihre Gefolgsleute, Politiker und Geistliche
Johann III. von Jülich-Kleve-Berg, auch Johann der Friedfertige genannt, war ab 1521 der erste Herrscher der vereinigten Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg *
Wilhelm, genannt Wilhelm der Reiche, sein Sohn *
Konrad Heresbach, Prinzenerzieher, ab 1534 Geheimer Rat und einer der wichtigsten Politiker am Hof von Jülich-Berg *
Johann Ghogreff, von 1528 bis 1554 Kanzler am Hof von Jülich-Berg *
Johann von Vlatten,ab 1554 Kanzler am Hof von Jülich-Berg, Probst in Aachen *
Walther von Luitzenrode, Schultheiß auf Haus Cliff
Franz von Waldeck, Bischof *
Wilken Steding, Landadeliger aus Südoldenburg, Oberbefehlshaber der bischöflichen Truppen *
Lorenz Horst, Hauptmann der klevischen Truppen *
Karten
Hattingen
Lübeck
Münster
Teil 1: DER ENGLISCHE SCHWEISS
April bis Mai 1531
1
– Hattingen, 4. April 1531
Das Haus der von Lindens am Markt gehörte zu den schönsten Gebäuden der Stadt: tiefschwarzes Fachwerk, der Lehm auf dem Weiden- und Strohgeflecht dazwischen strahlend weiß gestrichen, Butzenglasscheiben in allen Fenstern. Es wirkte nicht protzig, aber der Wohlstand der Bewohner schlug sich in der Gestaltung der Hausfassade nieder: Farbige Muster rahmten die Fensteröffnungen ein, die breite Eingangstür wies kunstvoll geschnitzte Ornamente auf.
An dieser Stelle im Herzen Hattingens hatte noch vor zehn Jahren das Stammhaus der van Enghusens gestanden, einer alteingesessenen Kaufmannsfamilie, deren Tochter Marlein seit zwei Jahrzehnten mit Jorge von Linden verheiratet war. In einem Frühjahr waren das Dachgeschoss und die obere Etage des Hauses abgebrannt. Glücklicherweise war niemand bei dem Feuer zu Schaden gekommen und auch ein Übergreifen auf die Nachbargebäude konnte verhindert werden. Die Familie von Linden hatte damals entschieden, das beschädigte Gebäude bis auf die Grundmauern abzureißen und neu zu errichten – größer und schöner als zuvor.
Von der Diele im Erdgeschoss betrat man die geräumige Stube, inwelchergegessen und Gäste empfangen wurden. Davon ab ging das Kontor, welches nicht nur ein Fenster zur Straßehin hatte, sondern nach Lübecker Sitte auch eines zur Diele. So konnte der Hausherr, der lange in der Hansestadt an der Ostsee gelebt hatte, jederzeit kontrollieren, wer sich in seinem Haus aufhielt.
Über eine Treppe gelangte man in die oberen Etagen. Im ersten Stock fanden sich die Schlafkammern der Familie und eine weitere, deutlich kleinere Kammer. Hier bewahrten die Eheleute das auf, was ihnen wichtig, nicht aber für jedermanns Augen bestimmt war: Erinnerungsstücke wie den Tanach, eine jüdische Bibel, die Jorge von einem Freund erhalten hatte, der schon lange tot war.
Unter dem Dach hatten ursprünglich die Bediensteten gewohnt. Nachdem jedoch ein Anbau im Garten errichtet worden war, hatte man die frei gewordene Fläche in einen Vorratsraum umgewandelt, in den ausgewichen werden konnte, falls das eigentliche Lager zu voll zu werden drohte. Dortkonnte jedoch nur das untergebracht werden, was ein Mann auf seinen Schultern über die Treppe hochzuschleppen vermochte, denn eine Seilwinde fehlte.
Die gesamte untere Etage des Anbaus war den Waren vorbehalten, mit denen Jorge von Linden Handel trieb. Die Kammern des Knechtes und die der zwei Mägde lagen darüber.
Zum Anwesen gehörte außerdem eine Scheune. Neben den zwei Pferden, die die Familie ihr Eigen nannte, fanden dort auch noch die beiden Karren Platz.
Brunnen und Abort lagen im Garten, so weit auseinander wie möglich. Und da der Brunnen sehr tief gegraben worden war, schmeckte sein Wasser weniger brackig als in vielen anderen Haushalten.
In der Stube brannte wie immer das Feuer im Kamin. Dieser konnte auch von der angrenzenden Küche beschickt werden, wo die Speisen zubereitet und die Kochgeräte gelagert wurden. Im Boden war eine schwere Holzklappe eingelassen, die über eine Stiege in den Keller führte, in dem verderbliche Nahrungsmittel kühl gelagert wurden. Eine schmale Tür öffnete sich von der Küche in den Nutzgarten, in dem Kräuter und allerlei Gemüse wuchsen.
Die Stube selbst war so gestaltet, wie der Hausherr es aus Lübeck kannte. Ledertapeten aus Flandern schmückten die Wände, die Deckenbemalung ließ den Raum niedriger erscheinen, als er war. Blau-weiße Fliesen ersetzten hier die sonst üblichen Holzdielen. Möbliert war der Raum mit einem mächtigen Tisch aus massiver Eiche, der zwölf Personen ausreichend Platz bot. Darum standen Bänke und zwei Holzstühle mit hohen Lehnen, die vor dem Kamin platziert waren und den Eheleuten oder hohem Besuch vorbehalten blieben. An einer Wand befand sich ein mannshoher Schrank, in dem die wertvollen Zinnteller und – schüsseln sowie die kostbaren Trinkbecher aus Glas aufbewahrt wurden.
Jorge von Linden hatte auf der langen Bank neben dem Fenster Platz genommen, sein Sohn Lukas saß ihm gegenüber.
»Ich werde kein Kaufmann.« Der Siebzehnjährige warf seinen Kopf in den Nacken und schob das Kinn angriffslustig vor. »Das macht keinen Spaß.«
Diese Pose seines jüngsten Sohnes erinnerte Jorge von Linden an dessen Mutter Marlein. Als diese in Lukas’ Alter gewesen war, hatte sie in Auseinandersetzungen ähnlich reagiert. Jorge hatte ihr Durchsetzungsvermögen immer bewundert. Sein jüngster Sohn schien es geerbt zu haben. Aber er durfte nicht nachgeben, auch wenn ihm Lukas’ konsequente Haltung im Grunde imponierte.
»Du solltest anspäterdenken. Bald willst du eine Familie gründen, musst für sie sorgen. Wie willst du das als Spielmann tun?«
Vor sechs Monaten hatte Lukas seine Eltern zum ersten Mal mit der Idee konfrontiert, nicht in das Handelsgeschäft seines Vaters einzutreten, sondern sein Glück als Musikant zu versuchen.
Anfangs hatten sie das Ansinnen als einfältig abgetan. Aber der Junge ließ sich nicht beirren. Er sei für den Kaufmannsberuf ungeeignet, hatte Lukas selbstbewusst verkündet. Seine Zukunft gehöre der Musik.
Jorge wusste nicht, woher dieses Interesse rührte. Gewiss, Marlein hatte ihrem Jüngsten, wie auch seinen Geschwistern, Lieder vorgesungen, als er noch klein war. Aber niemand in der Familie beherrschte ein Instrument. Und wenn sie tatsächlich einmal einen Gesang anstimmten, war er zwar laut, klang aber recht unmelodisch. Auch Marlein konnte sich nicht erinnern, dass sich in ihrer Verwandtschaft jemals jemand zur Musik hingezogen gefühlt hatte. Woher also kam nur diese seltsame Neigung seines Jüngsten?
»Ich will kein Spielmann werden, sondern Musikinstrumente bauen. Die Fidel zum Beispiel, die Laute. OdereineRebec. Natürlich muss ich sie dafür spielen können, um zu wissen, wie sie klingen sollen.«
Jorge seufzte. Er ahnte, dass dieses Streitgespräch ebenso enden würde wie die anderen zuvor. »Aber ich brauche dich.«
»Weshalb? Du hast doch Linhardt.«
»Du weißt, dass dein ältester Bruder unsere Interessen in Lübeck vertritt.«
»Dann hole ihn zurück. Du selbst hast mir mehr als einmal erzählt, dass unser Geschäft in Lübeck jahrelang von deinem Freund Clas Wibbeking geführt wurde.«
Das stimmte.Als Linhardt noch klein war und Jorges gesamte Kraft dem Aufbau und Erhalt der geschäftlichen Aktivitäten in Hattingen galt, hatte Clas Marleins Erbe in Lübeck verwaltet. Allen Beteiligten war klar gewesen, dass dieser Freundschaftsdienst nicht ewig währen konnte.Und als Clas’ älterer Bruder Konrad gestorben war, fehlte dem Freund schlicht die Zeit, sich neben seinem auch noch um den Besitz der von Lindens zu kümmern. Für lange Jahre hatte ein Verwalter die Geschicke der Lübecker Niederlassung gelenkt und die Firma trotz Jorges häufiger Kontrollbesuche in der Hansestadt fast zugrunde gewirtschaftet. Als Linhardt endlich alt genug war, um selbstständig zu arbeiten, hatteer die Vertretungübernommen und wieder nach vorn gebracht.
»Das geht nicht.Claskann sich nicht zweier Handelshäuser annehmen.« Und ich will nicht, dass er es tut, setzte Jorge im Stillen hinzu.
Sein Sohn schob die Unterlippe trotzig vor. Ebenfalls eine Geste, die er von seiner Mutter geerbt hatte.
»Dann ebenHinrick.« Lukas war aufgestanden und hatte sich vor seinem Vater aufgebaut. »Bitte!«
Hinrick, der Grübler. Jorge musste lächeln, wenn er an seinen mittleren Sohn dachte. Natürlich würde Hinrick ihm diesen Wunsch nicht verwehren, sollte er je an ihn herangetragen werden. Er verweigerte sich niemals einer Bitte seiner Eltern. Nur würde Jorge ihn nicht fragen.
Der Achtzehnjährige war einfach kein Händler. Er war klug, sicher. Schon früh hatte er lesen gelernt. Er verschlang jedes Buch, das er finden konnte. Nur eins hatte er nach wenigen Stunden beiseitegelegt: Jorges abgegriffenes Lehrbuch derMathematik,verfasst von Fibonacci.
Hinrick grauste vor Zahlen. Er tat sich selbst mit den einfachsten Rechenoperationen schwer. Eine schlechte Voraussetzung für ein Leben als Kaufmann. Ihr Geschäft wäre in wenigen Jahren ruiniert, müsste Hinrick die Rechnungen ausstellen.
Dafür sprach er recht ordentlich Latein, konnte eine Unterhaltung auf Italienisch und Französisch führen und verstand sogar einige Brocken der englischen Sprache. All das hatte er sich durch die Lektüre einschlägiger Bücher selbst beigebracht. Wie sein Vater vor Jahrzehnten auch. Jorge hatte Hinrick mehrmals mit auf Reisen genommen, damit er ihm als Übersetzer zur Seite stand. Sprachen und die Schriften von Philosophen, deren Namen Jorge, kaum gehört, schon wieder vergaß, waren Hinricks Welt.
Natürlich arbeitete auch der mittlere Sohn im Hattinger Kontor. Er war ein geschickter Verhandler, verstand es, Menschen für sich einzunehmen und zu überzeugen. Mehr als einmal war durch seine Vermittlung ein Auftrag gerettet worden, den Jorge schon verloren glaubte. Aber Hinrick brauchte jemanden an seiner Seite, der etwas von Finanzen verstand. Er bemühte sich nach Kräften, würde aber niemals einen guten Kaufmann abgeben.
Wann immer es seine Zeit erlaubte, ritt Hinrick nach Werden, um im dortigen Benediktinerkloster alte Schriften zu studieren. Wie sein Sohn die Mönche überredet hatte, ihm Zugang in die ansonsten verschlossene Welt eines Klosters zu gewähren, war Jorge ein Rätsel. Gläubig war Hinrick allerdings nicht, im Gegenteil. Wenn er sich überhaupt mit religiösen Dingen beschäftigte, dann nur mit der Diskussion über diesen Reformator Luther, von dem alle Welt sprach. An eine Mönchsgemeinschaft würde die Familie Hinrick jedenfalls nie verlieren, dessen war Jorge sich sicher. Aber ebenso wenig konnte sein mittlerer Sohn ein Geschäft allein führen. Nein, es blieb nur Lukas.
»Du wirst meinem Wunsch folgen.« Jorges Stimme klang strenger als beabsichtigt. »Ab morgen wirst du dich jeden Tag im Kontor einfinden und lernen, wie ein Kaufmann zu handeln. Du wirst sehen, es kommt der Tag, da wird dir diese Arbeit Spaß machen.« Er sah Unwillen in den Augen seines Sohnes aufblitzen. »Hastdumichverstanden?«
Lukas wagte keinen offenen Widerspruch und senkte gehorsam den Kopf. »Ja, Vater.«
Was wäre wohl gewesen, dachte Jorge, wenn die anderen drei Kinder, die Marlein ihm geschenkt hatte, nicht so früh verstorben wären? Hätte er den Wunsch seines Jüngsten dann erfüllt? Oder hätte er sich noch immer verweigert? Er wusste es nicht. »Gut. Du kannst gehen.«
Lukas trottete zur Tür und wäre dort beinahe mit seiner Mutter zusammengestoßen, die die Stube betrat und ihm im Vorbeigehen zärtlich über das Haar strich. Mit einer schnellen Kopfbewegung wehrte Lukas diese Geste ab. Jorge erkannte daran, wie sehr es in ihm brodelte.
Marlein schloss die Tür hinter ihrem Jüngsten. »Ich sehe, du hast mit ihm gesprochen?«
Jorge lächelte. »Hast du nicht hinter der Tür gestanden und jedes Wort der Unterhaltung verfolgt?«
Seine Frau senkte ertappt den Kopf.
»Also hast du«, stellte Jorge belustigt fest.
Er konnte Marlein nicht böse sein. Schon als Kinder spielten sie miteinander, später vermittelte er ihr das Wissen, das ihm Dominikanermönche beigebracht hatten. Dann verloren sie sich aus den Augen, vergaßen einander aber nicht. Und als sie sich in Lübeck wiedertrafen, war es, als ob sie nie getrennt gewesen wären. Aus ihrer kindlichen Zuneigung wuchs Liebe und sie heirateten. Selbstverständlich gab es in ihrem Leben auch Streit. Jedoch überdauerten ihre Auseinandersetzungen keinen Tag und hatten nie wirklich verletzt. So war es bis heute geblieben.
»Natürlich. Schließlich liegt mir das Wohlergehen unserer Kinder am Herzen.«
»Höre ich da Missfallen in deiner Stimme?«
Sie sah ihn an.Es war dieser Blick, der Jorge als unreifen Knaben vor fast drei Jahrzehnten in den Bann gezogen hatte und der ihn auch als Mann immer wieder schwach werden ließ. Marlein war trotz ihrer fast vierzig Jahre eine schöne Frau. Ihr feuerrotes Haar fiel wallend auf ihre Schulter, ihre sommersprossige Haut schien fast durchsichtig. Jorge hätte sie auch heute vom Standweg geheiratet.
»Nein, kein Missfallen. Ich weiß, dass du an die Zukunft denken musst. Und es bleibt auch keine andere Wahl. Aber Lukas tut mir leid. Er wünscht sich nichtssehnlicher, als Musikinstrumente zu bauen.«
»Vieles von dem, was ich mir in meinem Leben gewünscht habe, ist auch nicht eingetreten«, erwiderte Jorge. »Er muss lernen, mit Niederlagen umzugehen.«
»Sicher. Aber hast du auch so gedacht, als du vor Jahren aus Hattingenfortmusstest?«
Jorge wusste, dass sie recht hatte. Nachdem die Dominikaner, bei denen er erzogen worden war, ihr Haus unweit der Kirche Sankt Georg nicht ganz freiwillig aufgegebenhatten, musste auch Jorge als knappVierzehnjährigerHattingen verlassen und war, völlig auf sich allein gestellt, auf eine lange Wanderung gegangen. Er spürte seine damalige Verzweiflung auch heute noch so, als ob seine Vertreibung gestern gewesen wäre.
»Lukas geht es genauso. Also sei nicht zu streng mit ihm. Er wird sich in sein neues Leben schon einfinden.«
»Hoffentlich.«
2
– Kleve, 5. April 1531
Heftiger Regen prasselte gegen die Butzenglasscheiben des Rittersaals im herzoglichen Schloss Schwanenburg bei Kleve. Der kräftige Wind, der draußen um das Backsteingebäude wehte, ließ das Feuer im Kamin in einem Moment hell auflodern, kurz darauf fast erlöschen.Trotz der schweren Teppiche, mit denen die kalten Mauern behängt waren, lag klamme Feuchtigkeit in der Luft, die auch die Flammen, welche von Bediensteten immer wieder angefacht wurden, nicht vertreiben konnten.
Herzog Johann III. von Jülich-Kleve-Berg hieltnur noch selten Hof in dem Schloss, das auf einer Anhöhe über dem Ort thronte, meistens residierte er in Jülich oder Düsseldorf. Heute jedoch hatte er sich mit seinen wichtigsten Beratern in Kleve getroffen und diesen Entschluss angesichts der Kälte, die den Raum durchzog, schon längst bereut.
Der Herzog schaute in die prasselnden Flammen und rieb sich die Hände, um sie zu erwärmen. Hinter seinem Rücken stand ein schwerer Eichentisch, an dem drei Männer, keiner von ihnen älter als vierzig, saßen und schweigend warteten.
Endlich drehte sich der Regent um, ging die wenigen Schritte zu seinen Ratgebern und stützte sich mit beiden Händen auf die Tischplatte. »Und sie lehnen die Kindstaufe ab?«, fragte er mit sorgenvoller Miene.
Ein Mann mit spitzem Bart und halblangem Haar beugte sich vor und ergriff das Wort. »Ja, Durchlaucht. Sie berufen sich dabei auf Jesus, der ihre Form der Taufe am Jordan praktiziert habe. Aber nicht nur das. Sie behaupten, dass jeder, der des Lesens mächtig ist, deshalbdie Bibelverstehenund nach seinem Gutdünken auslegen kann. Deshalb fühlen sie sich auch zu Predigern berufen, ziehen durchs Land und setzen dem einfachen Volk Flausen in den Kopf.«JohannvonVlattenlehnte sich zurück und strich mit der rechten Hand durch seinen Bart. Dann griff er zum Weinkrug, warf den anderen beiden Männern am Tisch einen fragenden Blick zu und schenkte sich, nachdem diese dankend abgelehnt hatten, ein.
Der Herzog wandte sich dem Mann zu, der zu seiner Linken saß. »Was meint Ihr, Kanzler?«
Johann Ghogreff zögerte ein wenig mit der Antwort. Dann erwiderte er bedächtig: »Nun, wenn die Wiedertäufer nur dieses Ziel hätten, könnte man sie als ungefährliche Wirrköpfe betrachten. Aber immer lauter werden ihre Forderungen nach Abschaffung des Eigentums. Zins und Zehnter seien ebenso wie kirchlicher Besitz gegen Gottes Gebot. Kein Mönch und keine Nonne sollten Handel treiben, Vieh züchten, Korn anbauen.«
»Wovon sollen die Klöster dann leben?«, wunderte sich der Herzog.
»Von Spenden. Solche Einnahmen sollen allerdings nach deren Vorstellungen durch Bürgerausschüsse verwaltet werden, die den Mönchen und Nonnen nur das zubilligen, was diese benötigen, um nicht zu verhungern.«
»Und die Kirchenherren?«
»Dürften wohl leer ausgehen.«
Herzog Johann schüttelte entgeistert den Kopf.
»Es gibt unter diesen selbst ernannten Prädikanten sogar einige, die die Bibel als nicht von Gott kommend anerkennen. Sie erklären sie zum Menschenwerk, dem man nicht folgen müsse, sondern nur seinem eigenen Gewissen.«
Der Herzog schlug mit der Faust so heftig auf den Tisch, dass die Becher erzitterten. »Das ist Häresie! Und diese Leute treiben an unseren Landesgrenzen ihr Unwesen?«
Kanzler Ghogreff nickte. »Nur wenige Meilen westlich von Jülich gewährt ihnen der Droste vonWassenbergSchutz und Unterkunft. Von dort ziehen sie ins Westfälische, um ihre Lehren zu verbreiten, aber auch in Euer Herzogtum.«
»Wie reagiert das Volk?«
»Viele Bürger lassen sich in dieIrre führen.«
Herzog Johann zog seinen Stuhl an den Tisch heran und setzte sich. Mit einer schnellen Handbewegung gab er zu verstehen, dass er zu trinken wünsche. Ein Diener sprang herbei und kredenzte seinem Herrn den roten Wein. Als der Herzog den Becher abgesetzt und sich mit dem Handrücken den Mund trocken gewischt hatte, fragte er: »Wir haben doch in unserem Edikt den Klerus zur Mäßigung aufgefordert, Reformen angemahnt und die Gläubigen zur Einheit aufgerufen. Reicht das den Leuten nicht?«
»Ich fürchte nein, Durchlaucht.« Konrad Heresbach, der dem Gespräch bisher schweigend gefolgt war, erhob seine Stimme. Er war schlank, trug ebenfalls einen Bart und war wie die anderen beiden Berater ganz in Schwarz gekleidet. »Vielleicht wäre es klüger, Euch eindeutig für eine der Seiten zu entscheiden. Das Volk erwartet von seinem Herrscher Führung.«
Johann griff erneut zum Becher. »Ich weiß schon, was Ihr meint, Heresbach. Ich soll mich Eurem Luther zuwenden und einen Konflikt mit dem Kaiser riskieren. Wir haben das schon Dutzende Male besprochen. Ich kann mich nicht gegen ihn und die anderen Landesfürsten stellen.«
»Ihr habt mich falsch verstanden, Durchlaucht. Ich bin keineswegs ein Lutheraner. Auch wenn ich nicht verhehlen möchte, dass mir manches an seinen Schriften gefällt.«
»Mir etwa nicht?«, unterbrach ihn der Herzog. »Aber es geht hier nicht um Gefallen, sondern um das Herzogtum. Wir sind nicht nur von Freunden umgeben. Gerade Ihr solltet das wissen.«
Demütig senkte Heresbach den Kopf. Aber als er weitersprach, klang seine Stimme keinesfalls unterwürfig. »Das ist mir wohl bewusst. Gerade deshalb ist der innere Friede in Eurem Reich so wichtig. Das Volk muss in solch gefährlichen Zeiten hinter seinem Herrscher stehen.«
»Und wie erreiche ich das?«, wollte der Herzog wissen. »Ich werde mich nicht bedingungslos auf die Seite der Lutheraner schlagen.«
»Das kann ich verstehen«, erwiderte Heresbach. »Ich rate Euch deshalb: Präzisiert Eure Vorstellungen vom Vollzug der religiösen Praxis und kritisiert erneut den Missbrauch, der im Namen des Herrn getrieben wird. Dann wird das Volk Euch folgen.«
»Euer Wort in Gottes Ohr«, knurrte Johann und nahm einen großen Schluck Wein. »Und wie soll ich das machen?«
»In einem Erlass, der neue Regeln für die Religionsausübung festschreibt. Eine Reformordnung.«
»Die Ihr zu verfassen gedenkt, nehme ich an?«
»Wenn Ihr es wünscht, Durchlaucht.«
Mit einem Ruck stellte der Herzog den Becher auf dem Tisch ab. »Gut. Verfasst mir ein solches Dokument, meine Herren. Gemeinsam.« Er warf Heresbach einen schnellen Blick zu. »Aber ich will keine strittigen Fragen in meiner Ordnung finden.Klammertdiese Punkteaus. Ich möchte mir weder die Lutheraner noch den Papst zum Feind machen. Verweist meinetwegen auf ein Konzil, das berufener ist als ich, solche Fragen zu entscheiden. Aber nehmt eindeutig Stellung gegen diese Wiedertäufer. Ich dulde in meinen Grenzen niemanden, der das Volk aufwiegelt. Das wäre alles.«
Die Herren erhoben sich, um den Rittersaal zu verlassen.
»Ihr nicht, Heresbach«, befahl der Herzog. »Ich habe noch etwas mit Euch zu besprechen.«
Als Ghogreff und vonVlattengegangen waren, meinte Johann: »Setzt Euch wieder, Heresbach. Was macht mein Sohn für Fortschritte in der französischen Sprache?«
»Es würde nicht schaden, Durchlaucht, wenn er mehr Zeit für das Lernen seiner Vokabeln aufbrächte als für die Ausritte mit den Offizieren Eurer Garde.«
»Höre ich etwa Kritik in Euren Worten?«
»Ich weiß, dass Ihr diese Ausflüge unterstützt, aber …«
»Mein Sohn wird einmal Herzog sein«, unterbrach ihn Johann. »Soll er etwa vom Pferde fallen, wenn er sich seinen Untergebenen zeigt?«
»Natürlich nicht. Aber er hält sich im Sattel schon besser als die meisten seiner Begleiter. Er springt mit dem Pferd über Mauern und Gräben, wie ich es nicht wagen würde. Ich glaube nicht, dass ernsthaft die Gefahr besteht, er könne vom Pferderücken stürzen.«
»Ihr widersprecht Eurem Herzog?«
»Habt Ihr mich an Euren Hof geholt, um die Riege derBücklinge um einen Kopf zu erweitern? Dann bin ich fehl am Platze und Ihr solltet mich schleunigst aus Eurem Dienst entlassen.«
Der Herzog seufzte. »Immer diese Drohungen. Warum nur müsst Ihr mich ständig zum Rückzug zwingen, Heresbach?«
»Das ist nicht meine Absicht, Durchlaucht.«
»Mag sein. Aber immer wieder enden unsere Dispute damit, dass Ihr mich entweder um Entlassung bittet oder mit Eurer Abreise droht. Und immer tue ich weder das eine, noch akzeptiere ich das andere. Ihr seid der Erzieher des Prinzen. Ich kann auf Euch nicht verzichten.« Er machte eine Pause. »Und das gilt auch für Eure Funktion als Berater. Also gut. Wie oft finden diese Ausritte statt?«
»Jeden Nachmittag.«
»Und was haltet Ihr stattdessen für sinnvoll?«
»Jeden zweiten Nachmittag.«
Wieder ließ der Herzog einen tiefen Seufzer hören. »Und in der frei gewordenen Zeit soll Wilhelm Französisch lernen?«
»Und Latein.«
»Ich befürchte, das wird ihm nicht besonders gefallen.«
»Da bin ich Eurer Meinung. Aber wie soll er die Allianz mit Frankreich, die Ihr anstrebt, nach Eurem Tod festigen, wenn er die Sprache seines Verbündeten nur unvollständig spricht?«
»Einverstanden«, stimmte Johann zu. »Aber der Verkünder der schlechten Nachrichten seid Ihr.«
Konrad Heresbach nickte.
Der Herzog stand auf und brummte beim Verlassen des Saales halblaut: »Manchmal sind Arschkriecher die angenehmeren Zeitgenossen. Vor ihnen kann man wenigstens das Gesicht wahren.«
Konrad Heresbach lachte laut auf. »Das habe ich gehört, Durchlaucht.«
»Das solltet Ihr auch, elender Erpresser.«
3
– Lübeck, 6. April 1531
Obwohl gerade erst neunzehn geworden, führte Linhardt von Linden das Geschäft in Lübeck nun schon seit fast einem Jahr. Die Familie handelte mit allem, was sich transportieren ließ und Gewinn versprach: gesalzener Hering und Honig aus dem Norden, Holz und Pelze aus dem Osten, Wein und Bier aus dem Süden.Und Tuchwaren natürlich, die Linhardts Vater aus der Tuchstadt Hattingen schickte und die sich in Lübeck und auf anderen Märkten der Region gut verkaufen ließen.
Linhardt hockte in seiner Dornse im elterlichen Haus in der Fischergrube und studierte die Frachtlisten derIrmla.Die Kogge war einige Jahrzehnte alt und in die Jahre gekommen – immer häufiger fielen Reparaturen an. Der Kapitän lag Linhardt seit Monaten mit der Forderung in den Ohren, endlich ein neues Schiff zu kaufen. Aber dafür fehlte das Geld. Zu große Löcher hatte die Misswirtschaft der vergangenen Jahre in das Budget des Unternehmens gerissen. Löcher, dieLinhardtnur langsam stopfen konnte.
Die Schläge des Türklopfers schallten durch das Haus. Da beide Mägde zum Markt gegangen waren, musste er sich selbst bemühen. Mit einem Seufzer legte er Papier und Feder beiseite und stand auf. Er hasste es, bei der Arbeit gestört zu werden.
Sein Freund Martin Wibbeking wartete im strömenden Regen vor der Tür und schüttelte das Barett und seinen Mantel aus, nachdem er sich anLinhardtvorbei in die Diele des Hauses gedrängt hatte.
Einige der Wassertropfen trafenLinhardtauf der Stirn. Unwillig wischte er sie ab. »Wir waren doch erst für morgen verabredet oder irre ich mich?«, fragte er Martin.
Derlachte. »Wenn du dein Gesicht sehen könntest. Was hat dir den Tag verhagelt? Um deine Frage zu beantworten: Ja, wir wollten uns morgen treffen. Und um einer weiteren zuvorzukommen: Nein, mein Vater ist noch nicht wieder zurück.«
Martin war nur zwei Monate jünger alsLinhardt. Ihre Väter und Mütter waren in ihrer Jugend eng miteinander befreundet gewesen. Auch heute trafen sie sich noch dann und wann, allerdings kam es immer seltener vor, dass Linhardts Eltern die beschwerliche Reise nach Lübeck auf sich nahmen. Die beiden Söhne hingegen setzten die Familienfreundschaft fort und waren mittlerweile unzertrennlich geworden. Nur jetzt konnte Linhardt diesen überraschenden Besuch nicht gebrauchen und sagte das auch.
»Hastdumir eben nichtzugehört? Vater ist noch nicht von seiner Reise nach Riga zurückgekehrt. Dukannst dir also Zeit lassenmit der Kostenaufstellung.«
Natürlich hatte Linhardt die erforderlichen Daten, die er für das geplante Gespräch mit Martins Vater Clas benötigte, schon längst erstellt. Er wollte den anderen Kaufmann davon überzeugen, dass es sinnvoll sei, gemeinsam ein neues Schiff zu kaufen und auszurüsten. Das wäre für beide Seiten günstiger.
Die außenpolitische Situation der größten der Hansestädte hatte sich in den vergangenen Jahren weiter zugespitzt. Lübeck befand sich seit Längerem in einem unerklärten Krieg mit dem Dänenkönig Johann, der der Hanse den Handel mit Schweden untersagte und die Niederländer bei seinen Geschäften bevorzugte. Hinzu kamen innenpolitische Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern des alten und des neuen Glaubens, die das Leben in der Stadt lähmten. All das erschwerte den Handel, was die Lübecker Kaufleute in ihren Geldkatzen spürten.
Linhardt interessierte weder Politik noch Religion. Er ging sonntags zur Kirche, gewiss. Und auch die Beichte legte er regelmäßig ab. Doch er besuchte die katholische Messe mehr aus Gewohnheit denn aus Überzeugung. Die heftigen Auseinandersetzungen in der Stadt um den wahren Glauben ließen ihn kalt, die Heftigkeit, mit der der Glaubenskrieg ausgefochten wurde, stieß ihn ab.
Die Stadt war in Fragen der Religion gespalten. Keine der Seiten konnte die Oberhand gewinnen.Zwar hatte der Rat durch die Annahme der neuen Kirchenordnung bereits Anfang des Jahres die Einführung der Reformation auch in Lübeck beschlossen, aber Beschlüsse zu fällen war die eine Seite, die Herzen und Köpfe der Bürger für den neuen Glauben zu gewinnen, eine andere.
Den jungen Händler beschäftigten nur die Erlöse, die ihm der Verkauf seiner Waren einbrachte. Und alles, was die Gewinne schmälerte, war ihm zuwider. Er hatte seinem Vater versprochen, die Lübecker Niederlassung zu alter Stärke zurückzuführen. Und genau das gedachte er mit Wibbekings Hilfe zu tun. Ein Schiff und zwei Eigner bedeuteten zwar nur denhalbenGewinn, aber eben auch nur diehalbenKosten und das hälftige Risiko. Den Preis für eine neue Kogge konnte Linhardt allein nicht aufbringen, ebenso wenig wie den für eine grundlegende Überholung derIrmla.Und ohne ein seetüchtiges Schiff mit großen Laderäumen musste seine Familie über kurz oder lang die Niederlassung in Lübeck schließen.
»Was ist so wichtig, dass du mich beim Arbeiten störst? DieIrmlaläuft in zwei Tagen nach Riga aus und ich muss noch die Frachtlisten überprüfen.«
»Ein Glas Wein mit einem Freund?«
Linhardtschluckte seinen Ärger über die Störung hinunter. Martin hatte ja recht. Die Arbeit lief ihm nicht weg. Außerdem hatte er seine Kontrollen fast beendet. Den Rest konnte er auch später erledigen. Also bat er seinen Freund in die Stube.
Der Raum hatte sich seit den Tagen, als Linhardts Mutter hier gelebt hatte, kaum verändert. Die Ledertapeten aus Flandern zierten noch immer die Wände, auch wenn sie in den vergangenen dreißig Jahren rissig geworden waren. DerübermannshoheSchrank stand wie eh an seinem Platz neben der Tür. Nur die Bank vor dem ausladenden Tisch war durch einige Stühle ersetzt worden.
Die Holzdielen knarrten, alsLinhardtmit dem Weinkrug und zwei Zinnbechern in der Hand aus der Küche zurückkehrte und einschenkte. Dann tranken die beiden jungen Männer.
»Du bist nicht nur wegen des Weines gekommen, habe ich recht?«, fragteLinhardt. »Du siehst aus, als würdest du jeden Moment platzen. Also, was gibt es Neues?«
»Eine Schönheit in unserer Stadt.«
»Dagibt es einige«, meinteLinhardtgrinsend.
»Aber keine wie Madlen.«
»Madlen? Sollte ich sie kennen?«
Martin ignorierte die Frage. »Siebzehn Jahre alt. Schlank, fast so groß wie ich, braune Augen … Also, ich sage dir, diese Augen … Dunkle Haare und eine Stimme wie der Gesang einer Nachtigall. Und dann erst ihre Figur.« Er fuchtelte mit den Händen in der Luft herum und verdrehte dabei die Augen.
Linhardt musste lachen. »Du führst dich auf wie ein Gockel. Wer ist diese Madlen?«
»Die Tochter von Jürgen Richolff.«
»Und wer zum Teufel ist das?«
Martin machte ein überraschtes Gesicht. »Du kennst den Drucker Richolff nicht?«
Linhardtschüttelte den Kopf.
»Die ganze Stadt spricht von ihm. Sein Haus steht in Fünfhausen, unweit Sankt Mariens. Dort wohnte schon sein Vater. Richolff ist erst vor knapp einem Jahr nach Lübeck zurückgekehrt. Davor lebte er in Schweden und Hamburg. Er druckt Bücher, die den neuen Glauben propagieren, sehr zum Unwillen einiger Ratsmitglieder.«
»Gehört dein Vater dazu? Er ist doch katholisch, oder?«
»Das schon. Aber er sympathisiert mit Bürgermeister Wullenwever und hat auf einer Versammlung auch Richolff kennengelernt. Er und mein Vater sind sich wohl sympathisch, denn die Richolffs haben uns zu sich nach Hause eingeladen. Da habe ich Madlen kennengelernt.« Er machte eine Pause. »Das heißt, ich habe sie nur kurz gesehen, aber mich sofort in sie verliebt.«
»Und sie sich in dich, nehme ich an?«
Martin zuckte nur mit den Schultern. »Ich konnte sie natürlich noch nicht fragen.«
»Ich verstehe.«
Es schien, als ob seinem Freund das Thema unangenehm war, denn er erkundigte sich: »Hast du dich schon entschieden?«
»Wofür?«
»Das fragst du? Welcher Religion du dich anschließen wirst. Die ganze Stadt spricht seit Monaten über nichts anderes und du tust so, als ob dich das nichts anginge.«
»Du weißt doch, dass mich Religion nicht interessiert.«
»Natürlich.« Martin griff zum Glas. »Dich beschäftigen nur Einnahmen, Ausgaben, Gewinne.Linhardt, das Leben besteht doch noch aus etwas anderem als Zahlen«, meinte er lachend.
»Für dich vielleicht«, knurrte sein Freund. »Aber ich habe einen Auftrag meiner Familie zu erfüllen.«
»Ich etwa nicht? Mein Vater erwartet ebenfalls, dass ich die Geschäfte weiterführe. Was ich auch tun werde. Aber deshalb muss ich doch nicht die Augen vor den schönen Dingen des Lebens verschließen. Wie hübschen Mädchen zum Beispiel.« Er zwinkerteLinhardtzu. »Du solltest Madlen kennenlernen. Sie wird dir gefallen.«
»Na gut. Wann stellst du sie mir vor?«
Etwas verlegen rutschte Martin auf seinem Stuhl herum. »So habe ich das nicht gemeint.«
»Nein? Wie dann?«
Sein Freund wand sich wie ein Aal. »Ich hatte noch keine Gelegenheit, mit ihr zu sprechen.«
Jetzt war es anLinhardt, laut aufzulachen. »›Eine Stimme wie eine Nachtigall‹, das waren doch deine Worte?«
»Ich habe sie beobachtet, als sie mit Freundinnen sprach«, druckste Martin herum. »Ich kann doch nicht einfach so auf sie zugehen. Was soll sie von mir denken!«
»Dass du ein ungehobelter Kerl bist, was sonst?«
»Linhardt!«, rief Martin. »Das nimmst du zurück.«
»Warum? Es ist die Wahrheit.«
Martin sprang in gespielter Empörung auf. »Ich werde dich …«
Das Eintreten der Magd beendete ihre Kabbelei. Martin stellte den Becher ab und lächelte seinem Freund zu. »Kein Wort zu Dritten. Versprich es mir.«
»Du kannst dich auf mich verlassen«, erwiderte Linhardt und begleitete seinen Gast in die Diele.
4
– Münster, 7. April 1531
In Münster brodelte es. Schon lange schwelte der Streit zwischen den alteingesessenen Patrizierfamilien und den aufstrebenden Handwerkern. Die Patrizier hielten an ihrer Herrschaft fest, heirateten nur untereinander und sicherten so in Verbindung mit dem Klerus ihre Pfründe. Die Handwerker hingegen forderten ihren Anteil an der Macht. Als die Patrizier dieses Ansinnen zurückwiesen, kam es zu einem Aufstand, der mit Gewalt niedergeschlagen wurde. Aber auf Dauer ließ sich der Unmut nicht unterdrücken.
Ein Ventil lieferte ein Mönch im fernen Wittenberg. Vierzehn Jahre war es her, dass Martin Luther seine Thesen an das Hauptportal der Schlosskirche geschlagen hatte. Fünfundneunzig Thesen, die das Fundament der katholischen Kirche ins Schwanken brachten.
Die benachteiligten Handwerker griffen nach der neuen Lehre wie Ertrinkende nach einem Strohhalm. Einige Jahre war es den Münsteraner Herrscherfamilien gelungen, die Bewegung unter Kontrolle zu halten. Als aber der Konflikt zwischen Klerus und Patriziern auf der einen Seite und den Handwerkergilden auf der anderen Seite offen ausbrach,fandenLetztere Unterstützungbei den Vertretern des neuen Glaubens.
In der Nacht vor Karfreitag versammelten sich auf dem Münsteraner Domplatz wenige Dutzend Menschen. Sie folgten einem Aufruf des Kaplans von Sankt Mauritz, Bernd Rothmann, der sich als charismatischer Prediger im Sinne der Ideen Luthers einen Namen in der Stadt und ihrer Umgebung gemacht hatte.
Rothmannging weiter als Luther. Er prangerte die Zahl der Feiertage an, die zu groß sei, verkündete, der Gottesdienst sei vom Teufel, ebenso wie der Reichtum der Kirchen. Und als er auch noch erklärte, Kirchengut sei herrenlos und leicht zu gewinnen, liefen ihm die armen Leute in Scharen zu, in der Hoffnung, sich so ihrer Schulden zu entledigen. Aber auch bei einigen der wohlhabenderen Bürgern Münsters fielen seine Predigten auf fruchtbaren Boden. Zu faszinierend erschien das, was ein Mönch in Wittenberg losgetreten und Rothmann weitergedacht hatte.
Schon bald lief ein Gerücht durch die Menge: Bernd Rothmann habe gefordert, die Mauritzkirche, in der er selbst predigte, aufzusuchen und von den teuflischen Götzenbildern und dem eitlen Tand zu befreien. Rothmann warte dort bereits auf die Gläubigen. Deshalb sei er auch nicht auf dem Domplatz erschienen.
Mittlerweile war die Menschenansammlung weiter angewachsen. Zahlreiche Fackeln brannten. Lieder wurden gesungen.
Einige Hundert Gläubige machten sich schließlich, laut betend, auf den Marsch nach Osten, um der vermeintlichen Aufforderung ihres Kaplans zu folgen. Unter ihnen befanden sich viele jüngere Menschen wie der knapp zwanzigjährige Jobst, Sohn des HeinrichXantus.
Jobst war wie sein Vater Schmied. Dementsprechend kräftig waren seine Muskeln. Fast immer ging er als Sieger aus den zahlreichen Streitereien mit anderen Männern hervor, in die er aufgrund seines aufbrausenden Wesens verwickelt wurde. Alles Zureden seines Vaters half nicht: Jobst liebte kaltes Bier, schweren Wein, das Würfelspiel und die Rauferei.
Schon mehrmals hatte sein Vater ihn davor bewahrt, wegen seiner Schlägereien vor Gericht gezerrt zu werden. Einige Groschen, die er den Opfern zahlte, ließen diese die Angriffe Jobsts schnell vergessen. Auch die Spielschulden seines Sohnes hatte der Schmied schon häufiger beglichen, damit sein Sprössling nicht im Schuldturm landete.
Jobst waren die theologischen Dispute, die die Münsteraner Gläubigen umtrieben, ziemlich egal. Er war mit seinen Freunden nur deshalb dem Aufruf Rothmanns gefolgt, weil ihn jedwede Auseinandersetzung magisch anzog. Und dass es zu einer solchen kommen würde, stand für ihn fest. Wenn er sich dann noch etwas aneignen konnte, was sich zu Geld machen ließ – umso besser. Darum hatte er sich auch an die Spitze des Zuges gestellt.
»Macht auf«, rief er der Stadtwache zu, als die Menge in den frühen Morgenstunden vor dem verschlossenen Mauritztor stand. »Wir wollen hinaus.«
Einer der Soldaten verließ das Wachhaus und hob die Laterne, um besser sehen zu können. »Wer will die Stadt verlassen?«, fragte er.
»Wir natürlich«, plusterte sich Jobst auf. »Oder siehst du hier noch andere?«
Seine Freunde quittierten diese Antwort mit Gelächter.
Jobst grinste ihnen zu. »Wird’s bald?«, blaffte er dann den Soldaten an, der angesichts der Menge, die ihm gegenüberstand, weiche Knie bekam.
»Wir dürfen das Tor nicht zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang öffnen. So hat’s der Rat beschlossen«, versuchte der Wächter, die Situation zu retten.
»Was schert uns der Rat?«, rief Jobst fröhlich. Solche Auseinandersetzungen waren nach seinem Geschmack. »Öffne endlich das Tor.« Er machte einen Schritt auf den Soldaten zu. »Wir können auch anders«, drohte er mit leiser Stimme.
Eingeschüchtert trat der Wachhabende zur Seite, rief seinen Kameraden zu Hilfe und die beiden Männer schoben den schweren Riegel beiseite, der das Tor sicherte. Dann drückten sie die Flügel auf und die Menge flutete aus der Stadt.
Es war nicht weit bis Sankt Mauritz. Wäre es nicht so dunkel gewesen, hätten die Menschen den mächtigen Westturm ausmachen können, derdas Stiftbeschützte.
Jobst schritt zügig aus, bis sie vor der Kirche standen. Von hinten drängten die anderen nach. Rufe nach Rothmann wurden laut, den alle hier erwartet hatten. Aber ihr Prediger glänzte durch Abwesenheit. Die Enttäuschung der Menge war spürbar.
Wieder war es Jobst, der das Heft des Handelns in die Hand nahm. »Kaplan Rothmann hat uns aufgefordert, dem wahren Glauben in seiner Kirche zum Durchbruch zu verhelfen. Stimmt das?«, rief er.
»Ja«, brüllte es aus zahlreichen Kehlen.
»Sieht Gott auf das, was wir vorhaben, mit Wohlgefallen?«
»Das tut er«, antwortete die Menge.
»Dann sollten wir seinem Befehl folgen.« Jobst marschierte zu einem der Eingänge am Seitenschiff der Kirche. Er rüttelte an der Tür. Sie war natürlich verschlossen. »Weiß einer von euch, wo der Dechant wohnt?«
Er bekam keine Antwort.
»Auch gut. Dann müssen wir uns eben ohne Schlüssel Zutritt verschaffen.« Er zog zwei seiner Freunde zu sich heran. »Nehmt noch ein paar andere Leute und sucht Steine, die wir als Hammer benutzen können. Wir sind doch eben an einer Mauer vorbeigekommen. Dort werdet ihr sicher fündig.«
Es dauerte nicht lange, da störte der Knall heftiger Schläge die Nachtruhe. Und noch ehe der mittlerweile herbeigeeilte Dechant beruhigend auf die Menschen einwirken konnte, hatten Jobst und seine Kumpane die Tür zur Kirche aufgesprengt.
»Für Gott und Rothmann«, brüllte der Schmied, schnappte sich eine Fackel und stürmte ins Kircheninnere.Den Dechanten, der sich in den Weg stellen wollte, stieß er barsch beiseite.
Jobst lief zum Altar, um sich die Silberleuchter zu schnappen, die dort üblicherweise standen. Aber da waren keine Leuchter. Auch die silbernen Teller, auf denen die Hostien gereicht wurden, waren verschwunden. Keine edelsteinverzierten Kreuze, einfach nichts, was einen gewissen Wert besaß.
»Wo sind die Leuchter und das ganze Zeug?«, fuhr er den verschreckten Dechanten an, der ihm ins Kircheninnere gefolgt war.
Der schwieg.
Jobst griff den Geistlichen bei den Schultern, schüttelte ihn und hob drohend die Faust: »Antworte, sonst …«
»Jobst, lass.« Einer seiner Freunde war hinzugetreten und zog den jungen Schmied mit sich. »Er wird es dir ohnehin nicht sagen.«
Wütend riss sich Jobst los. Für einen Moment sah es so aus, als ob er sich erneut auf den Dechanten stürzen wollte. Dann besann er sich eines anderen. »Schlagt alles kurz und klein«, brüllte er. »Die Altäre, die Bilder, einfach alles. Es ist vom Teufel.«
Johlend folgte ihm die Menge, zog die alten Bilder von den Wänden, schlitzte die Leinwände auf, riss die Bänke aus ihren Verankerungen. Auch vor dem Altar machte der Mob nicht halt. Nur das hölzerne Kreuz mit dem leidenden Christus ließen sie an seinem Platz.
Mit Tränen in den Augen musste der Dechant zusehen, wie seine Kirche verwüstet wurde.
5
– Hattingen, 9. April 1531
Die Messe zog sich hin, schließlich war Ostersonntag. Nur unter Anstrengungen gelang es Jorge, wach zu bleiben. Immer wieder fielen seine Augen zu und nurMarleinsdiskrete Knüffe verhinderten, dass er vollends einschlief.
Der gestrige Abend hatte länger gedauert. Konrad Kielmann war zu Besuch gekommen. Kaum älter alsLinhardt, war er trotz seiner jungen Jahre einer der reichsten Kaufleute der Stadt.
Jorge erinnerte sich gut an Johann Kielmann, den Vater Konrads. Dieser war in seinem Alter gewesen und sie hattenhäufiger erfolgreich Geschäftemiteinander gemacht. Kielmann war schon vor Jahren verstorben, seine Frau folgte ihm nur kurze Zeit später ins Grab.
Der einzige Sohn der Eheleute schien das Talent seines Vaters geerbt zu haben, denn was er auch anpackte, gelang ihm. So war es nicht verwunderlich, dass sein Elternhaus, in dem er südlich des Marktes allein wohnte, noch beeindruckender war als das der von Lindens.
Kielmann hatte Jorge eine Partnerschaft vorgeschlagen. Er wolle mit ihm in den Getreidehandel einsteigen, hatte er in dem Gespräch eröffnet. Dort seien zukünftig hohe Gewinne zu erwarten. Jorge hatte selbst schon mit dem Gedanken gespielt, sich auf diesem Markt zu engagieren, und deshalb interessiert zugehört.
Allerdings war Kielmann solventer als er und als unbarmherziger Geschäftsmann bekannt. Erst kürzlich hatte er einen Bochumer Händler, mit dem er zusammengearbeitet hatte, aus dem gemeinsamen Geschäft gedrängt. Der Bochumer hatte den Fehler begangen, den einschmeichelnden Worten des Kaufmanns zu glauben, und einen für ihn unvorteilhaften Vertrag unterzeichnet. Das war ihm schließlich zum Verhängnis geworden.
Insgeheim bewunderte Jorge die Geschäftstüchtigkeitdes jungen Kielmanns. Aber dessen Juniorpartner wollte er nicht sein. Das Risiko, wie der Bochumer ausgebootet zu werden, erschien ihm zu hoch. Deshalb hatte er nach kurzem Überlegen abgelehnt.
Nach einigen gezwungen freundlichen Worten hatte sich Kielmann daraufhin schnell verabschiedet. Als Jorge ihm nachsah, ahnte er, dass er den Kaufmann mit seiner Ablehnung gegen sich aufgebracht hatte. Noch schwerer würde bald aber vermutlich wiegen, dass Jorge den Getreidehandel selbst übernehmen wollte und Kielmann darüber im Unklaren gelassen hatte.
Den Rest des Abends hatte er kalkuliert, Pläne geschmiedet und verworfen, nachgedacht. Aber wie immer er auch rechnete, schnell war klar, dass Kielmann in einem Punkt recht hatte: Allein konnte ein Händler die finanziellen Belastungen nur schwer stemmen, die ein Engagement in dem neuen Geschäftszweig mit sich bringen würde. Obwohl Jorges Haus eines der größten der Stadt war, verfügte es nicht über ausreichende Lagermöglichkeit, um die Mengen an Getreide und Mehl unterzubringen, die kurz nach der Ernte anfielen. Es musste also ein Speicherhaus gebaut werden, wasein kleines Vermögenkosten dürfte. Jorge hatte eine Liste möglicher Partner erstellt, jede Person eingeschätzt und am Ende war nur ein Name infrage gekommen: HermannOfferhues.
Wieder knuffte ihn Marlein. Jorge schreckte hoch. Er war so in Gedanken versunken gewesen, dass er nicht bemerkt hatte, dass die Messe beendet war. Er erhob sich und folgte seiner Frau ins Freie.
Vor Sankt Georg standen die Gläubigen wie immer in kleinen Gruppen zusammen. Man sprach über das Wetter, tauschte den neuesten Tratsch aus, kommentierte Entscheidungen der Obrigkeit.
Jorge schaute sich um.Offerhuesund Bürgermeister Werner Koitgen waren im Gespräch vertieft. Er gab Marlein mit einer Geste zu verstehen, dass er sie einen Moment allein lassen würde, und näherte sich den beiden Männern. Die Honoratioren unterbrachen ihre Unterhaltung, als er sich zu ihnen gesellte.
»Ich hoffe, ich störe nicht«, begann Jorge. »Aber ich möchte gerne etwas Geschäftliches mit Euch besprechen, HerrOfferhues.«
»Jetzt?«, erwiderteder Angesprocheneerstaunt.
»Nein. Wie wäre es, wenn wir uns am Nachmittag im Weinhaus treffen?«
Offerhuesnickte. »Warum nicht? Es wäre allerdings hilfreich, wenn Ihr mir Euer Anliegen verraten könntet.«
Jorge warf einen schnellen Blick zum Bürgermeister. Dertathöflicherweise so, als ob ihn diese Unterhaltung nicht interessierte, aber natürlich war er gespannte Aufmerksamkeit und ließ sich kein Wort entgehen.
Deshalb antwortete Jorge: »Ach, nichts Besonderes. Dies und das.«
Offerhues, dem der Blick ebenfalls nicht verborgen geblieben war, verstand. Auch Koitgen war Kaufmann und damit Konkurrent. »Gut. Gegen drei Uhr?«
Marleins Vater hatte das Weinhaus vor Jahrzehnten von Reinhard von Krekenbeck, dem damaligen Erbhofschultheiß des Hofs Hattingen, gepachtet. Später dann hatten Marlein und Jorge den Pachtvertrag auf einen VetterMarleinsübertragen lassen. Heutiger Pächter war dessen Sohn, mit dem das Ehepaar von Linden gute verwandtschaftliche Beziehungen pflegte.
Entsprechend herzlich wurde Jorge begrüßt, als er kurz vor dem vereinbarten Termin die Schenke betrat. Er bat um einen Tisch hinten im Raum, etwas abseits des Kamins und der anderen Gäste.
Offerhues war pünktlich. Jorge spendierte einen Becher Rotwein und begann das Gespräch. »Bevor ich Euch erkläre, was ich mir vorstelle, muss ich Euch darüber in Kenntnis setzen, dass ich eine ähnliche Unterhaltung bereits mit Konrad Kielmann geführt habe.«
»Wann war das?«, wolltesein Gegenüberwissen.
»Gestern.«
Der Kaufmann lachte auf. »Lasst mich raten: Es ging um den Getreidehandel.«
»Richtig. Aber wie …«
»Kielmann hat auch mit mir geredet«, unterbrachOfferhuesihn. »Am Gründonnerstag, um genau zu sein.« Er schaute Jorge prüfend an. »Ich nehme an, Ihr habt eine Zusammenarbeit abgelehnt?«
»Wie kommt Ihr darauf?«
»Würdet Ihr Euch sonst mit mir treffen?«
Jorge grinste. »Richtig vermutet. Und Ihr?«
»Ich habe ebenfalls kein Interesse gezeigt. Der junge Kielmann ist mir zu forsch in seinen Methoden. Mag sein, dass ich für seine Art, Geschäfte zu machen, zu alt bin. Aber ich bevorzuge es, Verträge noch mit Handschlag und einem Viertel Wein zu besiegeln. Und mich dann daran zu halten.«
»Da stimme ich Euch zu. Ich würde Euch gerne meine Ideen mitteilen, wenn Ihr erlaubt.«
»Nur zu. Deshalb bin ich ja gekommen.«
Jorge schätzte die offene Art seines Gesprächspartners.Offerhueswar wie er Mitglied der Kaufmannsgilde, hatte ihr sogar einige Jahre vorgestanden. Er handelte überwiegend mit Eisen,das er aus dem Bergischen bezog und gegen Auf-schlag an die ortsansässigen Schmiedeverkaufte. Dann nahm er den Handwerkern die Messer und Scheren, die diese fertigten, wieder ab und vertrieb sie auf den Märkten der umliegenden Städte.
Der Handel ernährte ihn und seine Familie, warf aber nicht so viel ab, dass er Reichtümer anhäufen konnte. Dafür waren die Eisenmengen, die er aus dem Bergischen bezog, zu gering. Trotzdem galt die Familie als gut situiert. Jorge hatte sich vor Jahren ebenfalls in diesem Geschäft engagiert, es dann aber wegen der geringen Gewinnmargen wieder aufgegeben.
»Ihr wisst, dass Roggen, Gerste und Hafer sowohl aus den Grundherrschaften der Häuser Bruch und Cliff als auch aus Altendorf und von den Hügellandbauern aus dem Bergischen stammen. Auch aus der Soester Börde über den Hellweg wird Getreide nach Hattingen geliefert. Ein geringerer Teil kommt von Feldern, die Hattinger Bürger auf Land bewirtschaften, das Herzog Johann gehört. Dieses Getreide muss ausnahmslos in der Bannmühle an der Ruhrbrücke gemahlen werden.«
»Genau. Und das Mehl geht an die Bäcker in der Stadt.«
»Das Mehl der Landpächter allerdings wird häufig gegen Bezahlung von unseren Bäckern verarbeitet, die das fertige Brot zurück an die Pächter geben. Ein weiterer Teil wird ins Sauerland verbracht, um dort gebacken zu werden.«
»Das ist mir alles bekannt.«
»Natürlich. Ich schlage nunFolgendesvor: Wir beide tun uns zusammen und bieten den Getreidebauern an, ihre gesamten Erträge zu einem Festpreis zu übernehmen, den wir am Jahresende für das folgende Jahr vereinbaren.«
»Das ist ein Risiko. Was, wenn die Ernten außergewöhnlich hoch sind? Üblicherweise sinkt dann der Preis. Verkalkulieren wir uns, sind wir an den vereinbarten höheren Preis gebunden.«
»Richtig. Das gilt aber auch dann, wenn die Ernten schlecht ausfallen. Dann kaufen wir günstiger ein.«
Offerhuesmachte ein skeptisches Gesicht.
»Außerdem können wir in den Jahren guter Ernten das Getreide für schlechte Zeiten lagern und so dieNachfrage und damit den Preis bestimmen.«
»Und wo sollen wir lagern? Euer Haus und noch weniger meins verfügen über genügend Platz.«
»Wir müssen ein Speicherhaus bauen.«
»Das kostet viel Geld.«
Jorge nickte. »Ihr solltet aber eines bedenken: Von Jahr zu Jahr nimmt die Bevölkerung in Hattingen und damit der Bedarf an Brot zu. Als ich vor dreißig Jahren in die Stadt kam, lebten wesentlich weniger Menschen in unseren Mauern als heute. Das verspricht zukünftig gute Geschäfte. Und je mehr Bauern wir dazu bewegen können, uns ihr Getreide zu liefern, umso flexibler können wir die Preise gestalten. Wenn wir die Hauptmenge an Getreide zum Mahlen anbieten, könnte ich mir vorstellen, dass der Schultheiß uns auch bei der Multer entgegenkommt.«
»Warum sollte er das tun? Wir können das Getreide nicht woanders mahlen lassen.«
»Weshalb eigentlich nicht? Bochum und Werden verfügen über eigene Mühlen.«
»Das wird der Schultheiß nicht akzeptieren.«
»Was will er machen? Soldaten schicken?«
»Er könnte das Mehl besteuern.«
»Gut. Backen wir eben in Bochum oder Werden.«
»Dann wird er das Brot besteuern.«
»Das kann er nur, wenn wir es auch auf dem Markt in Hattingen verkaufen. Beruhigt Euch, ich will ja nicht wirklich auf die anderen Mühlen ausweichen. Das gäbe nur Ärger mitdem Schultheißund dem Herzog. In den Verhandlungen über die Multer könnten wir aber etwas in dieser Art vortragen. Als einen Denkanstoß für die Herren.«
»Verstehe.«
»Was ist? Seid Ihr dabei?«
»Der Gewinn wird geteilt?«
»So wie die Kosten. Und wer von uns höhere Kosten trägt, erhält auch anteilig mehr Gewinn.«
Offerhuesstreckte ihm die Hand hin. »Einverstanden.«
Jorge lächelte. »Das freut mich. Lasst uns die Übereinkunft begießen. Und dann gehen wir in mein Haus und ich zeige Euch anhand meiner Berechnungen, welche Kosten auf uns zukommen können.«
Die beiden Männer hoben ihre Gläser.
6
– Werden, 15. April 1531
Bei Sonnenaufgang war Hinrick von Linden losmarschiert. Er hatte die Stadt durch das Bruchtor verlassen und die Straße nachBonsfeldgenommen. An der Ruhrschleife war er zwischen demIsenbergund dem Fluss entlanggegangen, bis er den Weg erreichte, der amDeilbachvorbei nach Werden führte. Heute war Samstag, sein freier Tag. Er wollte zum Benediktinerkloster, um in der dortigen Bibliothek zu lesen.
Auf der Hälfte der Strecke legte er imDeilbachtaleine Rast ein. Die Sonnenstrahlen wärmten schon kräftig.Hinricksuchte sich einen Platz am Bach. Dort setzte er sich auf einen Stein, zog seine Schuhe aus, hielt die Füße ins kalte Wasser, lehnte sich zurück und schloss die Augen. Was für eine Wohltat!
»Heh, du!«
Hinrickschreckte hoch und sah in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Einen Steinwurf entfernt füllte ein Mann seinen Trinkschlauch.
»Findest du es richtig, deine stinkenden Haxen ins Wasser zu halten, während ich mit demselben Wasser meinen Durst stillen will?«
Erschrocken zog der junge Hattinger seine Füße aus dem Bach und stand auf. »Entschuldigung«, antwortete er. »Ich habe Euch nicht gesehen.«
Der Fremde brummte etwas Unverständliches und beugte sich wieder zum Bach hinunter, um seine Arbeit fortzusetzen.Als er mit dem Befüllen fertig war, knotete er sorgfältig ein Lederband um die Öffnung des Schlauches, prüfte, ob dieser tatsächlich dicht war, nickte befriedigt, erhob sich dann und kam langsam näher.
Der Unbekannte schien deutlichälter als Hinrick zu sein. Er hatte langes, strähniges Haar, einen wilden Bart und trug Kleidung, die ihm am Körper schlackerte. Neben dem Trinkschlauch hatte er sich sein Bündel über die Schulter geworfen. Beim Gehen stützte er sich auf einen langen Stecken.
»Ich bin Wilbolt aus Neustadt.«
»Hinrickvon Linden.«
»Du hast nicht zufällig ein Stück Brot bei dir, welches du mit einem hungrigen Wanderer teilen möchtest?« Wilbolt warf einen begehrlichen Blick auf Hinricks ausgebeulte Tasche.
Der drückte seinen Besitz enger an den Körper.
»Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin ein ehrbarer Mann und kein Räuber. Ich habe nur seit zwei Tagen nichts mehr gegessen. Hast du Brot in deinem Beutel?«
Hinricknickte. Wie immer, wenn er zu seinen Besuchen ins Kloster aufbrach, hatte ihm seine Mutter auch heute Morgen reichlich Verpflegung eingepackt. Schon häufigerhatte Hinricksie wegen der Mengen, die sie ihm zusteckte, geneckt. Er sei in wenigen Stunden in Werden, hatte er gescherzt. Das, was sie ihm als Essen aufdrängte, würde für eine Reise bis Frankfurt reichen. Und selbst dann müsse er dort noch die Hälfte davon wegwerfen. Wolle sie ihn mästen? Aber seine Mutter hatte nur gelächelt und noch ein Stück gesottenes Fleisch dazugelegt.
»Ich denke,« erwiderte er deshalb, »es reicht für uns beide.«
Eine halbe Stunde später wischte sich Wilbolt den Mund ab, rülpste kräftig und strich sich zufrieden über den Bauch. »Danke. Du hast mir das Leben gerettet.«
Hinrickschauteamüsiert auf das Wenige, was der Wanderer verschmäht hatte. Heute dürfte er den Tag in der Bibliothek zum ersten Mal mit knurrendem Magen verbringen.
»Du kommst also aus Hattingen?«
»Ja.«
»Die Wachen wollten mich gestern nach Sonnenuntergang nicht mehr in die Stadt lassen. Also habe ich im Freien übernachtet. Glücklicherweise hat es nicht geregnet. Wohin willst du?«
»Nach Werden.«
»Da will ich auch hin. Und dann weiter nach Düsseldorf. Was machst du in Werden?«
»Das Benediktinerkloster besuchen.«
WilboltsGesicht verfinsterte sich. »Du bist doch nicht etwa ein Pfaffe?«
»Nein.«
»Ein Bediensteter der Mönche etwa?«
»Nein.«
»Ein Händler bist du auch nicht. Was willst du dann im Kloster?«
»Ich möchte in die Bibliothek. Lesen und studieren.«
Wilbolt spuckte aus. »Pah! Was kann ein junger Mann wie du schon von Mönchen lernen? Sie sind fett und faul. Papisten eben.« Er musterte sein Gegenüber. »Bist du einer von ihnen?«
»Ihr meint, ob ich an Gott glaube?«
»Nein. Ich meine, ob du an den Papst glaubst.«
Hinrickmachte ein nachdenkliches Gesicht. »Wenn ich ehrlich bin, weiß ich das nicht genau.«
Die Miene des anderen hellte sich auf. »Das ist doch ein Anfang. Hast du schon etwas von Martin Luther gehört?«
»Ja.«
»Und was hältst du von ihm?«
»Es ist interessant, was er scheibt.«
Wilbolt sprang auf. »›Interessant‹? Er hat zwar unsereins verdammt, sich aber als Erster gegen den Papst gestellt. Das rechne ich ihm trotz allem hoch an.« Als Wilbolt Hinricks fragendes Gesicht bemerkte, erklärte er: »Luther hat sich gegen den Ablass gewandt. Aber nicht nur das. Er hat den verfluchten Papst als das bezeichnet, was er ist: ein Diener des Teufels.« Der Wanderer nahm einen großen Schluck aus seinem Schlauch. »Allerdings hat er uns später hintergangen. Hat sich gegen die aufständischen Bauern gewandt, sie als räudige Hunde bezeichnet und gefordert, sie zu erschlagen. Pfui Teufel!« Wieder spuckte er verächtlich aus. »Sei’s drum. Dem Papst jedenfalls hat er die Stirn geboten.«
Hinrickstand auf. »Tut mir leid, aber ich muss weiter. Die Bibliothek, Ihr versteht …«
»Nun lass das vornehme Getue.« Der Fremde streckteihmdie Hand hin. »Ich bin Wilbolt.«
Hinricknickte.
»Ich begleite dich bis zu deinen Pfaffen. Auf dem Weg dorthin erzähle ich dir etwas über mich und denBaltringerHaufen. Da lernst du mehr über das Leben als aus den Büchern dieser verdammten Klosterbibliothek.«
Neustadt, so begann Wilbolt, liege im Thüringischen an der Orla. Dort habe er noch vor sechs Jahren gelebt. Er sei Schneider gewesen und habe kurz davor gestanden, Meister zu werden und der Gilde beizutreten. Aber dann sei alles ganz anders gekommen. »Die Herren von Beulwitz residierten damals wie heute auf SchlossEichicht. Sie plünderten das Volk aus, wo sie nur konnten. Irgendwann hatten wir die Nase voll. Es war Ende April vor sechs Jahren. Ein ebenso milder Tag wie der heutige. Eine Abordnung der Neustädter zog zum Schloss, um den Herren eine Lehre zu erteilen. Ich war einer von ihnen.«
Er erzählte, wie sie begonnen hatten, denSchlossteichleer zu fischen. Als der empörte Besitzer sie zur Rede stellte, nahmen sie ihm sein Pferd und zwangen ihn, zu Fuß zurück zu seinem Schloss zu laufen – für einen Adeligen eine große Schmach.
Die erbeuteten Fische banden sie auf Stangen und trugen sie in einem Triumphzug zurück in die Stadt, begleitet von der Musik der städtischen Pfeifer und Trommler. Dort brieten sie ihre Beute auf dem Marktplatz und verspeisten sie im Haus eines Ratsherrn.
Dummerweise verspürte einer der Fischer noch Hunger und kehrte allein zum Teich zurück. Dort wurde er verhaftet und ineiner nahe gelegenen Festunginhaftiert.
Am nächsten Tag hatte sich die Festnahme herumgesprochen. Der Stadttrommler rief die Bevölkerung an der Kapelle zusammen. Auch der Magistrat erhob keine Einwände gegen die Versammlung, im Gegenteil: Er überließ den wütenden Bürgern Waffen und Pferde.
»Dann hieß es, der Häftling sei getötet worden«, berichteteWilbolt. »Da gab es für uns kein Halten mehr. Wir haben SchlossEichichtgestürmt, den Bewohnern aber kein Haar gekrümmt. Das schwöre ich!« Er hielt demonstrativ drei Finger in die Höhe. »Die Schlossherrin hat uns sogar ihre Küche geöffnet. Mann, was haben wir geschmaust. So besoffen wie an diesem Tag war ich schon lange nicht mehr. Mittlerweile hatten sich uns auch die Bauern der Umgebung angeschlossen. Die waren arm und hatten noch mehr Hunger als wir. Tja, und dann sind wir doch in die Wohnräume der hohen Herren und haben dort das eine oder andere mitgenommen.«
Zurück in Neustadt, soWilbolt