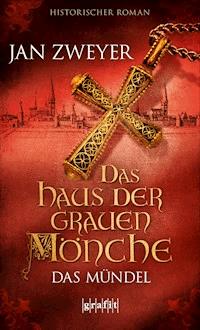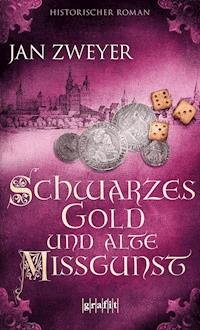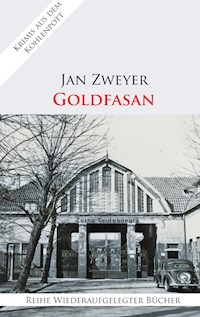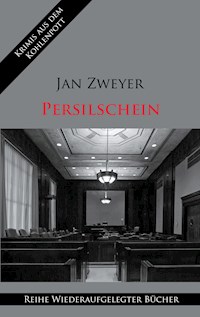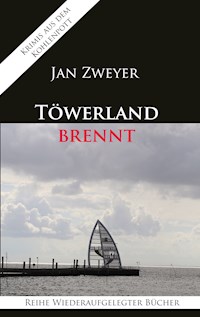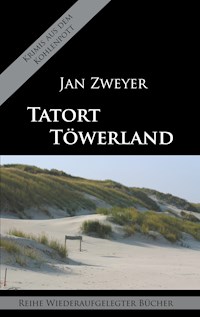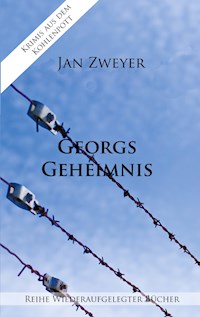Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Von Linden.-Saga
- Sprache: Deutsch
Hattingen um 1773. Das Land an der Ruhr befindet sich im Umbruch. Räuberbanden treiben ihr Unwesen. Mit allen Wassern gewaschene Geschäftsleute versuchen, von der geplanten Schiffbarmachung der Ruhr zu profitieren. Demjenigen, der zuerst Schiffe und Besatzungen bereitstellen kann, winkt das große Geld. Auch Paul von Linden, erfolgreicher Transport-kaufmann und Zechenbesitzer, beteiligt sich an diesem Wettlauf. Der Kaufmann lebt allein in seinem Haus in Hattingen. Überraschend kehrt sein Zwillings-bruder aus Russland zurück und wird einige Tage nach seiner Rückkehr ermordet. Haben ihn tatsächlich Räuber auf dem Gewissen, wie die Obrigkeit annimmt? Oder steckt doch mehr hinter seiner Ermordung? Paul von Linden forscht nach.. Der sechste Band der von Linden-Saga
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Eva T.
Danke.
Die von Linden-Saga:
Bd. 1 Das Haus der grauen Mönche - Das Mündel
Bd. 2 Das Haus der grauen Mönche - Freund und Feind
Bd. 3 Das Haus der grauen Mönche - Im Dienst der Hanse
Bd. 4 Ein Königreich von kurzer Dauer
Bd. 5 Schwarzes Gold und Alte Missgunst
Der Autor
Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne.
Nach zahlreichen zeitgenössischen Kriminalromanen hat er sich mit der Goldstein-Trilogie Franzosenliebchen, Goldfasan und Persilschein das erste Mal historischen Themen zugewandt. Es folgte die von Linden-Saga, eine Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet (bisher fünf Bände, zuletzt: Schwarzes Gold und Alte Missgunst, Ein Königreich von kurzer Dauer, beide Grafit-Verlag).
2020 veröffentliche Zweyer den Öko-Thriller Der vierte Spatz, 2021 den Polit-Thriller Fake News.
Das Verrätermal ist der sechste Band der von Linden-Reihe.
Dramatis Personae
(Die mit einem * gekennzeichneten Figuren sind historisch belegt)
Familie von Linden
Paul von Linden, Transportunternehmer und Zechenbesitzer
Franz von Linden, sein Zwillingsbruder
Anton von Linden, ihr Onkel
Elise, Magd
Hattinger Bürger
Emanuel Burmester, Tuchhändler
Marie, seine Frau
Sofie, ihre Tochter
Jürgen am Wege *, Kaufmann und Zechenbesitzer
Julia Rauter
Moritz Bernds, Kaufmann * (Vorname ist erfunden)
Jörgen Dellmann *, Tuchmacher
Conrad Funcken, Tuchmacher
Bürger anderer Städte
Johann Henrich Oberste Frielinghaus *, Gutsherr und Zechenbesitzer
Jeremias Huchten, Chirurg und Zechenbesitzer
Ebert Osterhoff, Zechenbesitzer
Hermann Grosser, Zechenbesitzer
Ludwig Engels * Tuchfabrikant in Werden (Vorname ist erfunden)
Hans Girou, Aakebaas aus Linden
Luise Schäffer, Düsseldorf
Martin, ihr Bruder
Albert Michaelis *, Kaufmann aus Mülheim (Vornameist erfunden)
Fuchsfezzer, Goldschmied und Hehler in Essen
Hellmes Glaserbeck, Schneider und Hehler in
Wattenscheid
Adelige und Beamte
Ernst Cramer, Gerichtsbüttel des Landgerichts
Hattingen
Johann Heinrich Märcker *, Justizbürgermeister und Richter in Hattingen
Franziska Christine von Pfalz-Sulzbach *,
Fürstäbtissin des freiweltlichen Frauenstifts Essen
Anselm Sonius *, Abt des Klosters Werden
(Benediktiner)
August Conradi, Rentmeister auf Schloss Broich
Karl Tenhagen, Schichtmeister Zeche Treue
Georg Losseling, Schichtmeister Zeche Treue
Julius Philipp Tiefbach, Bergmeister beim
märkischen Bergamt in Bochum Friedrich Wilhelm von Derschau *, Präsident der
Kriegs- und Domänenkammer Kleve
Gottlob Ehrenreich, Landrat, zuständig u.a. für Hattingen
Peter Bennighoff, Schichtmeister Zeche Hermann
Otto Breitling, Stadtschreiber in Blankenstein
Auguste, seine Frau
Hermann Castringius *, Leiter des märkischen
Kriminalgerichts auf Burg Altena
Eduard Wahring, kurfürstlicher Beamter in Düsseldorf
Dorothea, seine Frau
Luise von Schäffer, Gräfin, Düsseldorf
Martin, Graf, ihr Bruder
Caspar von Versal, Kaiserswerth, Onkel von Luise und Martin
Mitglieder von Räuberbanden
Reinhard Stiehl *
Herz Hammerich *
Langleiser *
Hüskenhannes *
Ein Glossar der wichtigsten Begriffe findet sich ab
Seite 390.
Inhaltsverzeichnis
Raub und Mord
1. Merklinde und Bommern, 30. März 1773
2. Hattingen, 1. April 1773
3. Bei Blankenstein, 7. April 1773
4. Hattingen, 7. April 1773
5. Schloss Borbeck, 8. April 1773
6. Hattingen, 8. April 1773
7. Gut Holthaus bei Werne, 14. April 1773
8. Bommern, 16. April 1773
9. Hattingen, 18. April 1773
10. Mülheim, 20. April 1773
11. Bochum, 24. April 1773
12. Kleve, 3. Mai 1773
13. Hattingen, 5. Mai 1773
14. Mülheim, 9. Mai 1773
15. Kloster Werden, 10. Mai 1773
16. Sprockhövel, 12. Mai 1773
17. Hattingen, 15. Mai 1773
18. Mülheim, 16. Mai 1773
19. Bochum, 19. Mai 1773
20. Hattingen, 15. Juni 1773
Verrat und Verleumdung
1. Hattingen, 6. Juni 1774
2. Kettwig, 6. Juni 1774
3. Hattingen, 7. Juni 1774
4. Dilldorfer Höhe, 10. Juni 1774
5. Düsseldorf, 12. Juni 1774
6. Hattingen, 18. Juni 1774
7. Hattingen, 21.6.1774
8. Düsseldorf, 22. und 23. Juni 1774
9. Hattingen, 24. Juni 1774
10. Weitmarer Holz, 25. Juni 1774
11. Hattingen, 25. Juni 1774
12. Düsseldorf, 26. Juni 1774
13. Bei Sprockhövel, 27. Juni 1774
14. Hattingen, 27. und 28. Juni 1774
15. Bochum, 28. Juni 1774
16. Hattingen, 2. Juli 1774
17. Hattingen, 3. Juli 1774
18. Blankenstein, 4. Juli 1774
19. Hattingen, 9. Juli 1774
20. Weitmarer Holz, 10. Juli 1774
21. Kleve, 12. Juli 1774
22. Hattingen, 25. Juli 1774
23. Hattingen und Blankenstein, 30. Juli 1774
24. Weitmarer Holz, 1. August 1774
Schuld und Sühne
1. Hattingen, 9. Oktober 1774
2. Bei Garenfeld, 11. Oktober 1774
3. Kaiserswerth, 11. und 12. Oktober 1774
4. Hattingen, 12. Oktober 1774
5. Burg Altena, 12. Oktober 1774
6. Hattingen, 20. Oktober 1774
7. Bei Sprockhövel, 21. Oktober 1774
8. Hattingen, 21. Oktober 1774
9. Hattingen, 22. Oktober 1774
10. Burg Altena, 23. Oktober 1774
11. Blankenstein, 23. Oktober 1774
12. Burg Altena, 24. Oktober 1774
13. Düsseldorf und Hattingen, 1. Dezember 1774
14. Burg Altena, 3. und 4. Dezember 1774
15. Hattingen, 6. Dezember 1774
16. Bei Menden an der Ruhr, 7. Dezember 1774
17. Bochum, 7. Dezember 1774
18. Hattingen, 8. Dezember 1774
19. Bei Menden, 8. Dezember 1774
20. Wattenscheid, 8. Dezember Burg Altena, 9. Dezember 1774
21. Hattingen, 9. Dezember 1774
22. Kettwig, 10. Dezember 1774
23. Hattingen, 11. Dezember 1774
24. Hattingen, 16. Dezember 1774
25. Blankenstein, 17. Dezember 1774
26. Hattingen, 18. Dezember 1774
27. Burg Altena und Bochum, 20. und 21. Dezember 1774
Epilog
Glossar
Nachbemerkung
RAUB UND MORD
März bis Juni 1773
1
Merklinde und Bommern, 30. März 1773
Stiehl war der unangefochtene Anführer der Bande. Er saß am Kopfende des schweren Eichentisches und hielt ein Weinglas in der Hand. Die grüne Lederweste mit den silbernen Knöpfen trug er offen, darunter ein weit geschnittenes Hemd ohne Kragen, welches ursprünglich weiß gewesen war, jetzt aber gräulich aussah. Entgegen der Mode reichten ihm seine Hosen bis zu den Knöcheln. Ein Strick diente als Gürtel und verhinderte, dass die eigentlich zu großen Beinkleider rutschten. Sein grauer Filzhut lag neben ihm auf dem Tisch.
Er strich mit der rechten Hand über sein struppig braunes Haar und meinte: »Herz Hammerich, erzähl uns, was du ausbaldowert hast.« Stiehls kölscher Dialekt war unüberhörbar. Mit blitzenden Augen schaute er in die Runde. Sieben Bandenmitglieder waren seinem Ruf gefolgt und hockten nun eng nebeneinander.
Natürlich wusste der Gauner, was kam. Hammerich hatte ihm vor einer Woche alles berichtet und Stiehl plante, den Überfall heute durchzuführen. Er zweifelte keine Sekunde daran, dass die Männer dem Vorschlag folgten. Er war der unbestrittene Hauptmann und hatte der Bande bei ihren letzten Unternehmungen ein stolzes Sümmchen beschert. Warum sollte es diesmal anders sein?
Hammerich stotterte leicht. »Wir sollten uns das Gut Frielinghaus vornehmen. Bei Frie … Frie …«
»Frielinghaus«, rief jemand dazwischen.
Hammerich warf dem Zwischenrufer einen finsteren Blick zu. Er wusste, was er sagen wollte und hasste es wie die Pest, von Gesprächspartnern wie ein kleines Kind korrigiert zu werden. »Da ist jede Menge Kies zu holen. Der Bauer ist stinkreich. Ihm gehören nicht nur das Anwesen, sondern auch Beteiligungen an Zechen unten im Muttental und in Annen.«
»Was ist mit der Bewachung? Wenn dieser Frielinghaus so viel Zaster in seinem Haus versteckt, hat er doch wohl Bewaffnete zum Schutz?«
»Nein«, ergänzte Herz Hammerich. »Ein, zwei Knechte, nicht mehr. Einige Frauen halten sich ebenfalls im Gebäude auf.«
»Und wenn der Nachbar zu Hilfe kommt? Wie weit ist der entfernt?«
»Tausend Schritt mindestens.«
»Wie viele Leute brauchen wir?«, fragte ein Anderer.
»Wir acht reichen«, schaltete sich Stiehl in die Planungen ein. »Sechs gehen ins Haus, zwei stehen Schmiere.«
»Flinten?«
»Nur für die, die draußen bleiben. Die anderen nehmen Pistolen.«
»Und sonst?«
»Ein Rammholz. Das habe ich vor Tagen im nahen Wald versteckt. Ich werde es holen. Zusätzlich Brecheisen, Stricke und Messer.«
»Wie hauen wir ab?«
Stiehl breitete eine Skizze aus. »Das Gut liegt auf einer Anhöhe und ist hier.« Er zeigte auf ein Kreuz. »Darunter fließt die Ruhr. Das ist diese gekringelte Linie. Wir schlagen uns zum Fluss durch, folgen ihm erst in östliche Richtung, überqueren ihn über die Brücke bei Bommern und halten uns anschließend nördlich, bis wir Tuckermanns Gasthof erreichen. Ihr kennt den Weg. Nach dem Teilen der Beute ist jeder auf sich selbst gestellt. Er kann einfach in der Gaststube sitzen bleiben, sich in der Grube verstecken oder nach Hause durchschlagen.«
»Was ist mit den Pferden?«
»Die bleiben im Stall. Wer reitet schon nachts als Einzelner durch die Gegend? Das würde sofort auffallen. Sind viele böse Menschen unterwegs in diesen Zeiten.«
Sie lachten.
Reinhard Stiehl hatte die Bande in Tuckermanns Gasthaus südlich von Merklinde unweit der Straße nach Castrop versammelt. Die versteckt liegende Kaschemme suchten Durchreisende selten auf und diente seit Jahren Stiehl und seinen Kumpanen als sicherer Rückzugsort. Hier planten sie in aller Ruhe ihre Raubzüge, feierten Erfolge und bejammerten Niederlagen. Tuckermann verdiente gut an den verwegenen Gestalten. Er war gelernter Fischer, der einen Gasthof eröffnet hatte, als die Erträge seines Berufs nicht mehr zum Leben reichten.
Der Stall hinter dem Wirtshaus war durch eine Hintertür in der Küche zu erreichen. Dort standen ständig vier gesattelte Pferde, die von Tuckermann und seiner Frau versorgt wurden. Falls tatsächlich Soldaten oder Gerichtsbüttel die Schenke kontrollierten, war mit den Gäulen eine schnelle Flucht möglich.
Außerdem hatte Stiehl in einem neben dem Haus wuchernden Unterholz eine Grube buddeln lassen, die mit Holzbalken, Brettern und darauf liegenden Grassoden abgedeckt war. Dort fanden sich Kerzen, Decken, Dörrfleisch und Wasserschläuche, die ständig frisch gefüllt waren. Ein, zwei Tage bot diese Höhle ein recht sicheres Versteck, falls ein Entkommen mit den Pferden scheiterte. Allerdings durfte niemand, der darin hockte, eine empfindliche Nase haben, denn die Notdurft musste in einer Ecke der Grube verrichtet werden.
Selbst aus geringer Entfernung war die Abdeckung nicht auszumachen, so gut passte sich das darauf liegende Gras an die Umgebung an. Nur wer zufällig auf die Stelle trat, erkannte vielleicht am Klang seiner Schritte, dass sich unter ihm ein Hohlraum verbarg.
»Seid ihr einverstanden?«
Die Männer nickten.
»Alles klar«, meinte Stiehl zufrieden. »Vor Mitternacht geht's los. Lasst uns die Aufgaben verteilen und die Details besprechen.«
Sie rollten die Flinten in alte Pferdedecken, die Pistolen steckten sie sich hinter ihrem Rücken in den Hosenbund und die restlichen Utensilien verstauten sie in Jutesäcken, in denen sie auch ihre Beute abzutransportieren gedachten. Stiehl glaubte zwar nicht, dass ihnen um diese nachtschlafende Zeit jemand begegnete, aber um nicht aufzufallen, verließen sie den Gasthof jeweils zu zweit im Abstand von einigen Minuten. Zwei Männer erregten weniger Aufsehen als acht. Als Treffpunkt wählten sie den Waldrand oberhalb des Gutes.
Dass es leicht regnete, war ihnen nur recht. Das fahle Mondlicht durchbrach die Wolkendecke kaum. Teilweise war es stockdunkel und sie stolperten blindlings durch die Nacht. So benötigten sie für den Weg länger als tagsüber. Erst vier Stunden nach ihrem Aufbruch erreichten die letzten zwei Räuber den vereinbarten Sammelplatz.
»Jeder weiß, was er zu tun hat?«, flüsterte Stiehl. Die Bandenmitglieder bejahten seine Frage. Er klopfte ihnen aufmunternd auf die Schulter. »Haltet euch an den Plan. Keine Eigenmächtigkeiten und wir schwimmen im Zaster. Benutzt eure Waffen nur im Notfall. Ich will keine Toten.«
Sie schlichen den Hang hinunter zum Haupthaus. Das aus Ruhrsandstein erbaute Gebäude ähnelte im Dunkeln einer Burg, denn an einer Seite überragte ein dreigeschossiger Turm den Herrensitz.
Bemüht, kein unnötiges Geräusch zu verursachen, näherte sich die Bande dem Wohnhaus, blieb an einer Ecke stehen und lauschte in die Dunkelheit. Erst als sie sicher waren, nicht entdeckt worden zu sein, huschten sie weiter Richtung Eingang. Der war zu gut gesichert. Deutlich ertastete Stiehl die schweren Nieten, die von innen die Auflager hielten, auf denen das Kantholz zum Verriegeln der Tür lag. Da gab es kein Durchkommen.
»Zum Fenster«, flüsterte Stiehl. »Zwei bleiben hier und beobachten die Umgebung. Solltet ihr Lichter auf dem Weg sehen, der von der Ruhr hochführt, warnt uns sofort. Verstanden?«
Kurz darauf drückten sich die Ganoven an die schmale Gebäudeseite. Die eisenbeschlagenen Fensterläden des Hauses waren fest verschlossen. Doch sie fanden einen Ansatzpunkt für das Brecheisen.
Stiehl schob das Eisen in den Spalt zwischen den Läden, fixierte es und wandte sich an seine Kumpanen. »Das verursacht gleich ein wenig Lärm, aber wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Sobald wir im Haus sind, steckt die Kerzen an. Alles klar?«
Er drückte kräftig gegen das Brecheisen. Es knirschte, dann gab der Laden quietschend nach. Die Glasscheibe dahinter stellte kein Hindernis mehr dar und Sekunden später stand das Fenster offen. Im Inneren des Gebäudes blieb es still. Sie hatten die Bewohner nicht aufgeweckt.
»Los, rein.«
Einer nach dem anderen kroch durch die Öffnung und verschwand im Haus. Stiehl kletterte als letzter hinein und zog die Läden hinter sich zu, ohne sie zu verschließen. »Jetzt die Kerzen«, befahl er.
Die Tür zum Hausflur war nicht verschlossen, drei andere schon. Sie führten zur Stube und zu zwei weiteren Kammern. Aus ihnen war lautes Schnarchen zu hören.
Stiehl gab seinen Männern ein Zeichen. Je drei versammelten sich vor einem der Räume und auf sein Kommando rammten sie die eine Tür mit dem mitgebrachten Rennbaum auf, gegen die andere warfen sich zwei von ihnen.
Krachend schlugen die Türblätter auf und Stiehl und seine Männer stürmten die Zimmer.
Johann Henrich Oberste Frielinghaus überwältigten die Eindringlinge im Bett. Der Sechzigjährige erhielt einen heftigen Schlag mit dem Pistolenknauf. Das brach seinen Widerstand.
In der Kammer daneben schliefen der Knecht, seine Frau, ihr Sohn und die Tochter. Der Knecht erfasste die Situation als Erster. Es gelang ihm, aus dem Bett zu springen und sich auf einen der Räuber zu stürzen. Aber gegen drei Bewaffnete hatte er keine Chance. Von mehreren Kopfhieben und einem Messerstich in den Oberarm schwer getroffen, fiel er benommen zu Boden.
In dem Getümmel gelang es seinem Sohn, unbemerkt unter das Bett zu kriechen, wo er vor Angst schlotternd zusah, wie seine Eltern und Schwester gefesselt und in die Stube zum Gutsherrn geschleppt wurden.
Die Räuber stürmten das letzte Zimmer. Die vom Lärm aufgeschreckten Mägde hockten verängstigt aufrecht im Bett. Einer von ihnen gelang es, sich durch das Fenster ins Freie zu retten.
»Ein Weib ist getürmt«, brüllte Stiehl in die Nacht, um seine Schmiere stehenden Kameraden zu warnen. »Schnappt sie euch und bringt sie her.« Dann lief er zurück in die Stube.
»Wo hast du dein Geld versteckt?«, fuhr er den Gutsbesitzer an.
Johann Oberste Frielinghaus antwortete nicht.
»Wie du meinst.« Er schlug dem Großbauern die Faust ins Gesicht. Blut schoss aus dessen Nase.
»Durchsucht alles«, ordnete der Anführer an. »Schafft die Wertsachen in den Flur. Aber macht schnell.« Dann wandte er sich wieder Oberste Frielinghaus zu. »Rede.«
Dieser verweigerte jedoch die Antwort. Stiehl zog seine Pistole, spannte den Hahn und hielt ihm die Waffe an die Stirn. »Ich zähle bis drei«, meinte er und schnitt eine entschlossene Grimasse. »Eins, zwei …«
»In der Stube«, stieß der so unter Druck Gesetzte hastig hervor. »Hinter der Schrankrückwand.«
»Na bitte«, erwiderte Stiehl grinsend und gab einem seiner Männer ein Zeichen. »Geht doch.«
Das Geräusch zersplitternden Holzes erklang aus dem Nebenraum, dann lautes Gepolter, schließlich ein freudiger Schrei. Wenig später schleppten zwei seiner Leute eine Truhe an, an der das zerschmetterte Vorhängeschloss hing.
»Alles voller Silber- und Goldtaler«, versicherte der, den sie Langleiser nannten. »Das sind Tausende!«
»Lass sehen«, befahl Stiehl.
Seine Kumpanen stellten ihre Beute ab, Stiehl öffnete die Truhe und ließ die Münzen durch die Finger gleiten. Er lachte vor Freude auf. »Das hat sich gelohnt.«
Eilige Schritte kamen vom Flur her. Eine der Wachen, die Schmiere standen, stürmte in die Stube. »Das verfluchte Weib ist uns entwischt und hat anscheinend die Nachbarn alarmiert. Unten vom Weg her sind Fackeln zu erkennen, die näher kommen.«
»Wie viele?«
»Sicher ein Dutzend.«
Wie zur Bestätigung knallte es. »Warnschüsse«, erklärte Stiehl. »Feuert zurück auf die Lichter. Das wird sie auf Abstand halten.«
In der Ferne läuteten Glocken.
Er betrat den Flur, wo sich silbernes Geschirr, Krüge, Becher und Leuchter auf dem Boden stapelten.
»Wir müssen weg. Schnell! Sonst verfolgt uns bald der ganze Ort. Sie schlagen bereits Alarm.«
»Was ist mit der Beute?«
»Der Silberkram ist zu schwer. Begnügen wir uns mit der Geldtruhe. Daran haben wir genug zu schleppen. Lasst uns abhauen, bevor die Nachbarn hier auftauchen. Ballert noch ein wenig herum, das verschafft uns Zeit. Jetzt nichts wie weg.«
Die Räuber verließen das Gutshaus auf dem Weg, den sie gekommen waren. Kaum war es wieder still im Haus, kroch der Sohn des Knechts aus seinem Versteck, rannte zur Küche und holte ein Messer, mit dem er die Fesseln der anderen Gefangenen durchschnitt.
Oberste Frielinghaus wirkte noch benommen, ein Bediensteter hingegen öffnete das Fenster und brüllte in die Nacht: »Die Ganoven sind getürmt! Wir sind in Sicherheit.« Er zog eine Flinte aus dem Schrank, lud sie hastig, entriegelte den Hauseingang und stürmte ins Freie, um den Fliehenden einen Schuss hinterherzujagen.
Doch die Dunkelheit hatte die Räuber verschluckt.
2
Hattingen, 1. April 1773
Wütend klappte der Zechenbesitzer Paul von Linden das Rechnungsbuch zu und überflog seine Notizen. Es gab jetzt keinen Zweifel mehr. Er wurde betrogen!
Der Verdacht war ihm vor einigen Monaten gekommen. Die Abrechnungen, die der Schichtmeister Karl Tenhagen präsentierte, stimmten nicht.
Paul hatte dem Kerl von Anfang an nicht über den Weg getraut. Er wusste nicht, woher sein Misstrauen stammte, aber ihm war Tenhagen unsympathisch, seitdem er vor zwölf Monaten in seinem Amt vereidigt worden war.
Vor einigen Jahren hatte Paul die Kuxe der Zeche Treue, die zwischen Linden und Stiepel lag, gekauft und seither erfolgreich mit Kohle gehandelt, obwohl ihm das Bergamt diesen Nichtsnutz vor die Nase gesetzt hatte.
Verschiedene Zechenbesitzer klagten über Schwierigkeiten mit den eingesetzten Bergbeamten, deren einzige Funktion es in ihren Augen war, die Eigentümer zu gängeln und zu belehren. Gut, Paul verstand im Gegensatz zu anderen Bergbaubetreibern nicht das Geringste von der Kunst, Schächte und Stollen in die Erde zu graben und daraus Kohle zu fördern. Dafür bezahlte er zwei Hauer, die den notwendigen Sachverstand mitbrachten. Aber zu rechnen vermochte er selbst. Weshalb brauchte er also einen Schichtmeister? Noch dazu einen, der sich vor Angst in die Hosen schiss, wenn er den Pütt befahren sollte?
Zeche Treue förderte im Monat rund einhundertfünfzig Fass Kohle, die überwiegend mit Flachbooten, densogenannten Ruhraaken, über den Fluss nach Westen transportiert wurden. Bei der Prüfung der Erlöse und der Rechnungen für den Transport, die ihm der Schiffseigner ausstellte, hatte Paul festgestellt, dass die Anzahl der verkauften nicht mit der Zahl der verschifften Fässer übereinstimmte. Es fehlten bis zu zehn Behälter im Monat. Um auszuschließen, dass ihn die Schiffer betrogen, war Paul dem Weg des schwarzen Goldes auf der Ruhr gefolgt. Die erste Umladung der Kohle erfolgte an den Hattinger Wehren. Dort hatte er die Behälter gezählt. Mehrmalige Stichproben ergaben, dass die Rechnungen des Transporteurs korrekt waren. Also hatte Tenhagen mehr Tonnen verkauft als abgerechnet und den Erlös in die eigene Tasche gesteckt.
Zehn veruntreute Fässer im Monat schmälerten Pauls Gewinn um etwa fünfzehn Taler im Jahr. Das war der Monatslohn dieses Mistkerls. Er musste diesen Hundsfott auch noch bezahlen! Was tat eigentlich das Bergamt? Nichts! Der Bergmeister hatte Tenhagen vereidigt. Das war schon alles.
Paul schlug voller Zorn mit der flachen Hand auf den Tisch. Diese Unterschlagung ließ er sich nicht länger bieten!
Er stand auf, schnappte sich seine Notizen, verließ das Kontor seines Hauses in Hattingen und ging durch die Diele zum Hinterausgang, um seinen Hengst aus dem Stall zu holen.
Er ließ das Pferd vom Knecht satteln und führte es am Zügel Richtung Weiltor. Nachdem er die Stadtmauer hinter sich gelassen hatte, saß er auf und ritt über den alten Hilinciweg zum märkischen Bergamt in Bochum.
Eine Stunde später stand er vor dem Gebäude unweit des Marktes. Er band die Zügel an den dafür vorgesehenen Eisenring und stieg die vier Stufen hoch zum Vordereingang.
Eine breite Treppe führte ins Obergeschoss, in welchem der Bergmeister residierte. Um zu ihm zu gelangen, musste sich Paul jedoch bei einem seiner Mitarbeiter anmelden. Also betrat er das Büro rechts neben dem Eingang und wartete, bis ihm der Schreiber, ein in Ehren ergrauter Beamter von sicher sechzig Jahren, seine Aufmerksamkeit schenkte.
Paul stellte sich vor und bat, Bergmeister Tiefbach zu sprechen.
»Er ist nicht anwesend.«
»Wann kommt er zurück?«
Der Beamte zuckte mit den Schultern.
»Es lohnt sich nicht, auf ihn zu warten?«
»Nein.«
»Können Sie mir eine Audienz bei ihm besorgen?«
»Ich werde es dem Herrn Bergmeister ausrichten. Er wird Sie durch einen Boten informieren, sobald er Zeit für Sie hat.«
»Wann wird das sein?«
Erneutes Schulterzucken.
Paul sah ein, dass er hier nicht weiterkam. Enttäuscht verließ er das Gebäude.
Er ließ sich Zeit für den Rückweg, um in Ruhe nachzudenken. Vielleicht war es gut, dass er Tiefbach nicht hatte sprechen können. Denn falls der Beamte Pauls Vorwürfe ernst nahm, hätte er Tenhagen sofort seines Postens entheben müssen. So lauteten die Regeln. Und dann? Der Schichtmeister wäre mittellos. Wer würde Paul seinen Schaden erstatten? War es nicht sinnvoller, Tenhagen unter Druck zu setzen und das Geld bei ihm einzutreiben? Den Bergmeister konnte er immer noch informieren, unabhängig davon, wie das Gespräch mit dem Schichtmeister verliefe. So gelang es ihm vielleicht, seine Verluste zu begrenzen. Das Mundloch von Zeche Treue lag oberhalb der Ruhr in einem Waldstück. Ein schlichtes Holzhaus diente als Werkzeuglager und gleichzeitig dem Schichtmeister als Kontor. Auf der unzureichend mit Steinen befestigten Fläche daneben warteten die Pferdeburschen, um die Fässer mit der geförderten Kohle zur Niederlage am Fluss zu schaffen, wo sie in die Aake verladen wurde.
Paul grüßte die Männer und fragte: »Ist Herr Tenhagen da oder ist er angefahren?«
Die Burschen grinsten breit. Paul lächelte ebenfalls. Seine Frage war völlig überflüssig. Soweit ihm bekannt war, hatte der Kerl den Pütt tatsächlich erst ein Mal besucht und das auch nur für kurze Zeit.
»Im Kontor«, lispelte einer, ohne seine Pfeife aus dem Mund zu nehmen.
»Danke.«
Paul betrat das Holzhaus. Tenhagen saß zurückgelehnt mit geschlossenen Augen auf seinem Stuhl vor dem Tisch, der ihm als Arbeitsplatz diente und hatte die Füße auf der Tischplatte deponiert. Wenn man das, was der Schichtmeister im Moment tat, überhaupt als Arbeit bezeichnen konnte.
Der Bergbeamte Tenhagen trug einen verwaschenen Überrock, der über seinem Bauch spannte, ein spitzenverziertes Hemd, darüber eine graue Weste und eine zu große Bundhose, die unterhalb des Knies endete. Obwohl nicht älter als vierzig, glänzte seine polierte Glatze in den Sonnenstrahlen, die trotz der blinden Scheiben in den Raum fielen.
»Ich habe euch schon hundertmal gesagt, dass ihr anklopfen sollt und nicht unangemeldet hereinplatzt«, blaffte er los, ohne die Augen zu öffnen. »Falls ihr euch nicht an meine Anordnungen haltet, kürze ich euren Lohn.«
»Einen Teufel werden Sie tun.«
Tenhagen fiel fast vom Stuhl, als er die Stimme des Grubenbesitzers hörte.
»Herr von Linden«, stammelte er. »Ich habe Sie nicht erwartet.«
»Das sehe ich.«
»Was kann ich für Sie tun?«
Paul zog seine Notizen hervor und breitete sie vor dem Schichtmeister auf dem Tisch aus. Dieser legte die Stirn in Falten.
»Sehen Sie es sich genau an. Wissen Sie, um was es sich handelt?«
»Das könnten Abschriften von Erlösen und Transportkosten sein, die ich vorgelegt habe, und Berechnungen. Sind die von Ihnen?«
»So ist es. Haben Sie mir etwas dazu zu sagen?«
Tenhagen erbleichte. »Nein. Warum?«
»Weil die Kalkulationen eindeutig belegen, dass Sie mich betrügen.«
»Aber das ist doch … Diese Unterstellung weise ich auf das Schärfste zurück.« Das Dementi klang blass.
»Tun Sie das ruhig. Wenn Sie sich die Zahlen jedoch genauer ansehen, werden Sie schnell auf die Ungereimtheiten stoßen.«
Der Schichtmeister tat so, als überprüfe er die Berechnungen von Lindens. »Tatsächlich«, meinte er nach einer Weile. »Sie haben recht. Der Transporteur hat uns betrogen. Ungeheuerlich. Ich werde der Sache sofort auf den Grund gehen und den Mann zur Rede stellen.«
»Das habe ich bereits erledigt. Die Anzahl der Fässer, die er abgerechnet hat, ist korrekt. Was nicht stimmt, sind die Beträge, die Sie als Erlös verbucht haben.«
Tenhagen schnappte nach Luft. »Wollen Sie damit sagen, dass ich ein Betrüger bin?«
»Genau das. Sie haben mindestens einhundert Fass verkauft und den Ertrag von rund fünfzehn Talern in die eigene Tasche gesteckt. Diese Summe zahlen Sie zurück!«
Tenhagen schluckte. »Das kann nur ein Versehen meinerseits gewesen sein. Selbstverständlich entschuldige ich mich in aller Form …«
»Das reicht mir nicht. Ich will mein Geld.«
»Ich verfüge nicht über so viel.«
Von Linden faltete seine Notizen zusammen. »Ihr Problem. Ich gebe Ihnen eine Woche. Wenn ich bis dahin den unterschlagenen Betrag in der Hand halte, verzichte ich auf eine Anzeige beim Bergmeister, vorausgesetzt allerdings, Sie quittieren von sich aus den Dienst. Zahlen Sie nicht, zeige ich Sie an. Ihre Entscheidung.« Paul drehte sich um und verließ grußlos den Raum.
Der Schichtmeister verzog das Gesicht. »Du verdammter Dreckskerl«, zischte er, nachdem Paul die Tür hinter sich geschlossen hatte.
3
Bei Blankenstein, 7. April 1773
Es war spät geworden. Die Sonne stand tief über den Feldern, die sich westlich von ihm bis Hattingen erstreckten, und schob die dunklen Wolken, die im Osten hingen, beiseite. Der schmale Weg, auf dem er ritt, führte ihn durch einen dichten Buchenwald und eignete sich nur für Reisende, die zu Pferde oder zu Fuß unterwegs waren. Von Tieren gezogene breite Karren fanden nicht genug Platz.
Da der Weg die direkte Verbindung von Sprockhövel nach Blankenstein darstellte, nutzten ihn all diejenigen, die keine Lasten zu befördern hatten. Die anderen nahmen entweder die Route durch das Hammertal zur Ruhr hinunter und später die steile Straße hinauf gen Blankenstein oder bogen bei Pattberg Richtung Westen ab, um ihr Ziel zu erreichen.
Franz von Linden hatte seinen Wohnort am Morgen verlassen, um mit einem Messerschmied in der Nähe von Sprockhövel zu verhandeln. Er gedachte, mit ihm einen Vertrag über den Transport seiner Erzeugnisse zu Kunden in Bochum und Umgebung abschließen. Den trug er jetzt in seiner Tasche.
Er aß in einem Gasthaus zu Mittag und ritt später weiter nach Haßlinghausen, wo er mit einem anderen potenziellen Auftraggeber leider erfolglos verhandelte. Von dort hatte er sich auf den Rückweg begeben.
Der 30-Jährige lebte seit knapp einer Woche in einem kleinen Haus der Familie in Blankenstein. Sein Zwillingsbruder Paul hatte es vor einigen Jahren gekauft, um Geld anzulegen. Gewohnt darin hatte niemand. Erst Franz hatte das alte Gemäuer wieder zum Leben erweckt. Er war froh, sich für den Ort entschieden zu haben. Der Stammsitz in Hattingen war mit dem Pferd oder der Kutsche schnell erreichbar. Es war eindeutig geräumiger als die winzige Kammer, die ihm sein Bruder dort angeboten hatte.
Abenteuerlust hatte Franz vor mehr als fünf Jahren aus seiner Heimatstadt vertrieben. Er war bis nach Russland gewandert, hatte sich von Werbern der russischen Armee in Dienst nehmen lassen und unter dem deutschen General von Tottleben im türkischrussischen Krieg als Grenadier gekämpft. Nach dem Ablaufen des Kontrakts war er desillusioniert zu seinem zehn Minuten älteren Bruder zurückgekehrt und versuchte seitdem, die schrecklichen Kriegserlebnisse zu vergessen.
Nur wenige wussten von seiner Rückkehr. Paul plante, dieses Ereignis mit einem großen Fest zu feiern, während Franz das als Zurschaustellung seiner Person empfand und sich dagegen ausgesprochen hatte. Eine Einigung über die Gästeliste oder den Termin war deshalb bis zum heutigen Tag ausgeblieben. Ihm war das nur recht. Wenn er seinen Bruder weiter hinhielt, ließ dieser vielleicht von seinem Vorhaben ab.
Ihn schmerzte sein Hinterteil. Langes Reiten bereitete ihm Schwierigkeiten. Dafür war er gut zu Fuß. Das endlose Marschieren während des Armeedienstes hatte seine Ausdauer gestärkt. Fünf Meilen am Tag bewältigte er problemlos. Franz freute sich auf ein kühles Bier und einen Abend am wärmenden Kaminfeuer.
Links vom Weg fiel das Gelände ein gutes Dutzend Schritte ab. Über weite Felder sah er im Licht der untergehenden Sonne die fast senkrecht in den Himmel steigenden Rauchfahnen der Hattinger Häuser. Deren Bewohner bereiteten das Abendessen zu.
Rechts von ihm säumten Büsche den Weg, einer Barriere gleich. Dahinter erhob sich der Buchenwald, soweit das Auge reichte.
Franz' Gedanken schweiften ab. Sein Bruder hatte das Familienunternehmen in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. Neidlos gestand er sich ein, nicht die Tatkraft Pauls zu besitzen. So war es schon immer gewesen. Sein Zwilling plante, organisierte, wägte ab. Risiken akzeptierte er nur, wenn er die Folgen umfassend kalkulieren konnte. Er selbst hingegen war ein Draufgänger, der erst handelte, dann überlegte. Keine guten Voraussetzungen, ein Geschäft wie das seiner Familie zu führen.
Allerdings hatte ihm diese Spontanität in den Schlachten, in denen er gekämpft hatte, mehrmals das Leben gerettet. Während Kameraden auf die Kommandos ihrer Offiziere gewartet oder überlegt hatten, was sie tun sollten, war er bereits losgerannt – entweder zum Angriff oder in Deckung. Das hatte in einem Fall zu einem Schulterdurchschuss und einer Auszeichnung geführt. Sonst aber in Sicherheit, weil er schon hinter Bäumen lag, während die anderen Soldaten dem konzentrierten feindlichen Feuer zum Opfer fielen.
Obwohl er froh war, die Gemetzel in den Schlachten lebend überstanden zu haben und unversehrt zurück nach Deutschland gekommen zu sein, vermisste er manchmal dieses riesige Land. Er hatte sich fast nur im Westen und Süden Russlands aufgehalten, wusste aber aus Erzählungen, dass das Zarenreich eigentlich erst dahinter begann. Da lag ein unendliches, weitgehend unentdecktes Gebiet und wartete auf seine Inbesitznahme.
Vielleicht würde er irgendwann dorthin zurückkehren. In den Weiten Sibiriens konnten Draufgänger wie er ihr Glück machen und waren nicht eingebunden in das enge Korsett gesellschaftlicher Verpflichtungen. In der Tundra zählten Taten. Nicht Herkunft oder Stand.
Ein Knacken vor ihm riss ihn aus seinen Gedanken. Er hielt seinen Schimmel an. Bewegte sich da nicht etwas in den Büschen? In Georgien hätte sein Instinkt ihm befohlen, die Büchse in Anschlag zu bringen und Deckung zu suchen. Aber er trug keine Waffe. Schutz gab es auch nicht. Also ritt er langsam weiter.
Unvermittelt sprangen zwei verwegen aussehende Gestalten auf den Weg und richteten ihre Flinten auf ihn. Ihre verfilzten Bärte fielen fast auf ihren Brustkorb, ihr Haar hing strähnig über ihre Schultern. Beide trugen abgewetzte, speckige Lederwesten, unter dem Knie geschnürte Hosen und Stulpenstiefel. Der eine Kerl hatte Franz‘ Größe, der andere war deutlich kleiner. Sie waren auch weniger kräftig als er. Ohne ihre Waffen hätte er sie sicher überwältigt.
Einen Moment lang überlegte Franz, dem Schimmel die Sporen zu geben und die beiden Männer einfach niederzureiten. Aber würden sie aus so kurzer Entfernung vorbeischießen? Vermutlich nicht. Er hob langsam die Hände. »Ich habe ein paar Taler bei mir. Die könnt ihr haben.« Er griff in seine Jacke. Vielleicht gaben die Räuber sich ja damit zufrieden. Denn in der linken Satteltasche lag die Anzahlung, die der Sprockhöveler Schmied im Vorgriff auf den späteren Transport seiner Waren geleistet hatte. Das war deutlich mehr, als er in der Geldbörse trug.
»Lass das«, fuhr ihn einer der Gauner an. »Steig vom Pferd. Aber mach keine falsche Bewegung. Sonst knallt's.« Seine Stimme zitterte.
Franz gehorchte.
»Binde den Gaul da am Busch fest.« Der Größere der beiden zeigte auf ein Gebüsch am Wegrand.
Auch diesen Befehl führte Franz aus.
»Umdrehen.«
Schlagartig wurde ihm klar, dass er einen schrecklichen Fehler begangen hatte. Die Kerle hatten Angst vor ihm. Er hätte nicht absteigen dürfen, sondern versuchen müssen, durchzubrechen. Er war kräftiger als sie und das wussten die Wegelagerer. Niemals würden sie ihm die Chance geben, sich auf sie zu stürzen. Um ihn zu durchsuchen, musste er zumindest kampfunfähig, wenn nicht sogar tot sein. Das bedeutete …
Er rannte los, um über den Hang auf die Felder zu entkommen. Nach wenigen Schritten blieb er abrupt stehen. Von hinten hatte sich ein dritter Räuber angeschlichen, der ihm mit einer Pistole mit gespanntem Hahn den Fluchtweg abschnitt. Der Gauner schüttelte lächelnd den Kopf und drückte ab.
Der Schlag schleuderte Franz zu Boden. Die Kugel zerschmetterte einige Rippen und zerriss seine Lunge. In seiner Brust brannte ein heftiger Schmerz. Japsend sog er Luft ein, wollte sprechen, aber hörte nicht mehr als sein ersticktes Gurgeln. Blut sickerte aus seinem Mund. Sterbend bäumte sich Franz noch einmal auf.
Hämisch grinsend verfolgte der Pistolenschütze die Anstrengungen Franz‘, sich aufzurichten. Der Todgeweihte fiel zurück auf den Rücken. Sein Mörder lud in aller Ruhe die Waffe neu und richtete die Mündung auf den Kopf seines Opfers. Lakonisch meinte er: »Du hast es hinter dir« und drückte erneut ab.
Dann beugte er sich über die Leiche, durchsuchte ihre Taschen, fand die Geldbörse, warf einen Blick hinein, nickte zufrieden und streifte Franz den auffälligen Ring vom Finger, den dieser als Erinnerungsstück an einen gefallenen Kameraden geerbt hatte. Aus dem Stiefelschaft des Toten zog er dessen Messer und steckte es, unbemerkt von seinen Kumpanen, in den Hosenbund. Schließlich entdeckte er in den Satteltaschen das übrige Geld.
»Wir verschwinden«, befahl er seinen Spießgesellen. »Wir teilen später.«
»Was ist mit dem Pferd?«, fragte der Kleinere der Räuber.
»Was soll damit sein?«
»Wir könnten es verkaufen.«
»Einen Schimmel? Die gibt es in dieser Gegend wie Sand am Meer.« Der Pistolenträger sah in die erstaunten Gesichter seiner Kumpanen und klärte sie auf: »Das war ein Scherz. Schimmel sind selten. Willst du jeden Gerichtsbüttel im Umkreis von fünfzig Meilen auf uns aufmerksam machen? Du bist wohl nicht recht bei Trost. Lass den Gaul, wo er ist. Nun nichts wie weg. Die Schüsse konnte man sicher eine halbe Meile weit hören.«
4
Hattingen, 7. April 1773
Seit mehr als zweieinhalb Jahrhunderten stand das Haus der von Lindens an der Gelinde direkt am Markt. Pauls Vorfahren hatten das Gebäude mehrmals umbauen und erweitern lassen, bis es sein gegenwärtiges Aussehen erhielt. Wie früher lagen im Erdgeschoss das Büro, die Stube sowie die Küche. Die beiden oberen Geschosse boten Unterbringungsmöglichkeiten für wertvolle Waren, dienten als Gästezimmer und hier schlief in den Kammern die Familie. Allerdings: Paul von Linden bewohnte das stattliche Anwesen allein, von einer Magd, die ihm den Haushalt führte und den Knechten abgesehen. Letztere wohnten unter dem Dach des großen Lagerhauses hinter dem Wohnhaus.
Der Dreißigjährige galt als gute Partie. Schon häufiger hatten die Oberhäupter anderer Familien mit Töchtern im heiratsfähigen Alter das Gespräch mit ihm gesucht. Sie versuchten ihm die Vorzüge einer Ehe schmackhaft zu machen. Paul hatte diese teils offen, teils verklausuliert vorgebrachten Offerten freundlich zurückgewiesen oder bewusst überhört. Denn er hatte ein Auge auf Sofie geworfen, der siebzehnjährigen Tochter des wohlhabenden Tuchfabrikanten Emanuel Burmester. Diese jedoch ignorierte sein vorsichtiges Werben seit mehr als einem Jahr.
Ihr Vater billigte diese Entscheidung nicht, tolerierte sie aber. Ihm war klar, dass selbst sanfter Zwang Sofie nicht dazu bewegen konnte, eine Ehe einzugehen, für die sie sich nicht bereit fühlte.
Das lag nicht an Paul von Linden, im Gegenteil. Sofie schätzte den Kaufmann durchaus und er war ihr von allen Freiern der Angenehmste. Kinder gedachte sie allerdings erst später in die Welt zu setzen – sehr zum Missfallen ihrer konsternierten Mutter, die ihre einzige Tochter schon als alte Jungfer enden sah.
Paul legte die Kladde aus der Hand, in die er, wie seine Vorfahren, das eintrug, was die Familie bewegte. Geburten und Sterbefälle wurden darin festgehalten, Hochzeiten, Taufen und natürlich wichtige Ereignisse, geschäftliche zumeist. Mittlerweile hatten sich fast einhundert dieser ausnahmslos in schwarzes Leder gebundenen Tagebücher angesammelt. Bei einigen war der Einband speckig und abgegriffen, andere sahen aus, als ob sie erst gestern vom Buchbinder abgeholt worden wären.
Paul blätterte häufig in den alten Bänden. Manche Passagen lasen sich wie ein Roman, die meisten jedoch waren in der nüchternen Sprache von Kaufleuten verfasst – Chroniken ohne jede Empathie. Einer seiner Ahnen hatte es vorgezogen, lediglich Stichwörter zu vermerken, mit denen vielleicht er selbst, aber keiner seiner Nachkommen etwas anfangen konnte. Augenscheinlich bedeuteten dem Verfasser die Eintragungen wenig, schienen eher eine lästige Pflicht zu sein. Doch selbst dieser von Linden wagte es nicht, auf das Führen des Familientagebuchs zu verzichten. Zu schwer wogen die Verpflichtung, die der erste Chronist, ein gewisser Jorge von Linden, seinen Nachfahren auferlegt hatte, und die Ehrfurcht vor der Familiengeschichte.
Es existierten weitere zwei Familienzweige: Die italienische Linie lebte in und um die Hafenstadt Genua und verdiente ihr Geld mit einem Bankhaus und mehreren Herbergen und Tavernen, die sie betrieb. Paul hatte die entfernten Vettern und Basen bisher nur einmal gesehen. Der Kontakt zu ihnen gestaltete sich als schwierig, sprach er doch kein Italienisch und seine Verwandten kaum Deutsch.
Den Klever Zweig, zwei Großonkel und Großtanten nebst ihren Kindern, sah Paul häufiger. Beide Onkel und wie ihre Söhne arbeiteten in der preußischen Administration, die Kriegs- und Domänenkammer, die von der linksrheinischen Stadt die Geschickte des Herzogtums Kleve und der Grafschaft Mark lenkte.
Hattingen gehörte zum steuerrätlichen Kreis südwärts der Ruhr, dem ein Landrat vorstand. Diesem Beamten diente Pauls Onkel Anton, der seinem Neffen des Öfteren mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatte. Quasi über Nacht musste Paul damals nach dem frühen Unfalltod seines Vaters die Führung des Familienunternehmens übernehmen. Die Übernahme fiel in eine Zeit, als die Entscheidung anstand, den Transportweg von der Zeche Treue hinunter zur Niederlage an der Ruhr instandzusetzen. Der Weg war in einem erbärmlichen Zustand. Schlagloch reihte sich an Schlagloch. Bei Regen blieben die Lastpferde im Matsch stecken. Ein Einsatz von Pferdekarren war unmöglich. Entsprechend mühselig war es, die Kohle zum Fluss zu schaffen.
Pauls Vater hatte die Idee, diese Aufgabe selbst in die Hand zu nehmen. Seit Jahrzehnten war die Familie im Transportgeschäft tätig. Sie verfügte über Pferde, Weiden, Ställe und natürlich Karren und Wagen. Um Pferdefuhrwerke einzusetzen, galt es, den Weg zu befestigen. Das Vorhaben würde viel Geld verschlingen und hatte Paul schlaflose Nächte bereitet, da er, um die Kosten aufzubringen, einen hohen Kredit aufnehmen musste. Der Onkel hatte ihm jedoch zu der Verschuldung geraten. Diese Maßnahme erwies sich im Nachhinein als richtig. Das Kohlelager wurde besser ausgelastet als zuvor und diente seitdem als Puffer für mögliche Förder- und Abnahmeschwankungen. Das Darlehen von damals war inzwischen längst getilgt.
Nun stand eine neue Entscheidung an. Paul trug sich mit dem Gedanken, eine Aake zu pachten, um unabhängig von den Ruhrschiffern zu werden. Ein solches Schiff ermöglichte es ihm, nicht nur die Kohlen von Zeche Treue, sondern auch die der Pütts seiner Konkurrenten über den Fluss Richtung Rhein zu transportieren. So würde er sich ein neues Geschäftsfeld erschließen können. Erste erfolgversprechende Gespräche hatte er bereits geführt. Zwar wollte der Werdener Schiffseigner, mit dem er verhandelt hatte, seine Aake eigentlich verkaufen, aber den geforderten Preis konnte Paul nicht aufbringen. Deshalb hatte er eine jährliche Pacht vorgeschlagen, über deren Höhe sie noch keine Einigung erzielt hatten.
Dann war da noch die Sache mit Tenhagen. Bisher hatte sich der Schichtmeister nicht bei ihm gemeldet und war auch seit Pauls Besuch nicht mehr zum Dienst erschienen. Hatte der Kerl sich abgesetzt? Paul machte sich langsam mit dem Gedanken vertraut, sein Geld abschreiben zu müssen.
Der gusseiserne Türklopfer schickte ein dumpfes Dröhnen durch das Haus. Paul hörte die Magd in den Flur trippeln, um zu öffnen.
Kurz darauf klopfte es an der Kontortür und die vierzigjährige Elise, die schon seinen Eltern gedient hatte, steckte ihren Kopf in das Kontor. »Herr, der Gerichtsbüttel Cramer möchte Sie sprechen.« Sie schaute Paul fragend an.
Er erhob sich. Dann strich er mit den Fingern durch das lockige Haar, um es in Form zu bringen, verzichtete auf die Perücke, zupfte das Hemd mit den Rüschen gerade, tupfte sich ein wenig Rosenwasser hinter die Ohren und auf den Hals – womit wie üblich die Morgentoilette beendet war. Schließlich streifte er den frackähnlichen Hausmantel über. In diesem Aufzug plante er, den Besucher zu empfangen. Dann nickte er Elise zu.
Die Magd schob die Tür auf und trat beiseite, um dem Gast Platz zu machen.
Ernst Cramer, Gerichtsbüttel des Landgerichts Hattingen, betrat das Kontor und deutete eine Verbeugung an. »Herr von Linden, Sie glauben ja nicht, wie froh ich bin, Sie bei bester Gesundheit anzutreffen. Herr Märcker hatte das Schlimmste befürchtet.«
Johann Märcker diente als Richter und Justizbürgermeister in Hattingen. Paul kannte den Juristen schon seit Langem.
»Was ließ Ihren Vorgesetzten annehmen, mir ginge es nicht gut?«
»Ein tragisches Ereignis. Auf der Straße von Blankenstein nach Sprockhövel wurde gestern ein Reisender überfallen und ermordet. In seiner Tasche fand sich ein auf Ihren Namen ausgestellter Vertrag mit einem Schmied. Deshalb befürchtete Herr Märcker, dass Sie der Tote sein könnten.«
Er reichte Paul das Schriftstück, der es hastig überflog und erbleichte. »Beschreiben Sie bitte das Opfer.«
»Das ist schwer möglich. Eine Kugel hat sein Gesicht zerfetzt.« Er schaute sein Gegenüber prüfend an. »Seine Haare ähneln dem Ihren. Er hat ungefähr Ihre Größe und Ihren Körperbau.«
»Welche Kleidung trug er?« Pauls Stimme klang nun heiser.
»Das Übliche. Einen dunklen Überrock und schwarze Schnürhosen. Ein grauer Zylinder lag auf der Straße. Ach ja, an einem Busch war ein Schimmel angebunden. Wir vermuten, dass er dem Ermordeten gehörte.«
Paul schwindelte es. Er hielt sich mit beiden Händen an der Stuhllehne fest.
»Ist Ihnen nicht wohl?«, erkundigte sich der Büttel besorgt.
»Der Tote«, keuchte von Linden »Wo ist er jetzt?«
»Wir haben die Leiche in den Keller des alten Gerichtsgebäudes in Blankenstein gebracht. Warum interessiert Sie das?«
Der Kaufmann wahrte mühsam die Fassung. »Ich glaube«, stöhnte er, »der Ermordete ist mein Bruder.«
Eine Stunde später stand er mit Richter Märcker vor einem langen Holztisch, auf dem verborgen unter einem gräulichen Leinentuch ein Körper lag. Paul holte tief Luft, als der Jurist einen Zipfel des Lakens ergriff und es beiseitezog, sodass der Oberkörper der Leiche frei lag. Das Gesicht glich einer blutverkrusteten Maske. Trotzdem erkannte Paul die vertrauten Züge seines Zwillingsbruders. Erschüttert wandte er sich ab. »Das ist Franz«, flüsterte er. »Ohne jeden Zweifel.«
Der Richter verdeckte den Toten erneut und legte eine Hand auf Pauls Schulter. »Mein Beileid.«
Paul nickte. Der Kloß in seinem Hals verhinderte ein Sprechen. Es dauerte lange Sekunden, bis er sich wieder in der Gewalt hatte. Dann fragte er: »Wer hat ihn gefunden?«
»Ein Hausierer, der uns informiert hat«, antwortete der Richter. »Als Gerichtsbüttel Cramer am frühen Abend am Tatort eintraf, war die Leichenstarre nochnicht eingetreten. Die Tat konnte also noch nicht lange zurückliegen.«
Paul nickte. »Er war in meinem Auftrag unterwegs, um in Sprockhövel und Haßlinghausen mit Kunden zu verhandeln.«
»In dem Vertrag, den Ihr Bruder in der Tasche trug, stand etwas von einer Anzahlung. Wir haben aber kein Geld bei ihm gefunden. Das spricht dafür, dass es sich um einen Raubmord handelt. Wusste jemand außer Ihnen, was Ihr Bruder gestern vorhatte?«
Paul schüttelte den Kopf.
»Auch nicht der Schmied, mit dem Sie verhandelt haben?«
»Nein. Das heißt, natürlich habe ich mit ihm bei meinem letzten Besuch darüber gesprochen, dass ich unsere mündlich getroffene Vereinbarung zu Papier bringen und ihm den Kontrakt in den nächsten Tagen vorbeibringen würde. Einen bestimmten Termin nannte ich nicht.« Ihm kam ein Gedanke und er trat an den Tisch, auf dem die Leiche aufgebahrt war, hob das Tuch leicht an und legte es dann vorsichtig zurück auf den Toten. »Franz trug einen auffälligen goldenen Ring am Mittelfinger seiner rechten Hand. Er fehlt.«
»Wie sieht dieses Schmuckstück aus?«
»Es stellt einen Elchkopf mit einem Geweih dar und ist etwas größer als ein Daumennagel.«
»Dann haben die Mörder den Ring ebenfalls gestohlen.«
»Was ist mit dem Hausierer?«
Richter Märcker schüttelte den Kopf. »Wir haben den Mann selbstverständlich durchsucht. Er besaß nur einige Stüber und keinen goldenen Schmuck.«
»Verstehe.« Paul ging zum Ende des Tisches, zögerte einen Moment und zog das Laken von den Füßen seines Bruders. Er griff in die Schäfte beider Stiefel.
»Vermissen Sie etwas?«, fragte Märcker.
»Ja. Sein Messer.«
»Wir haben keins bei ihm gefunden.«
»Es ist rund eine halbe Elle lang und hat einen Hirschhorngriff, in den mehrere Kreuze eingeritzt sind.«
Märcker machte sich eine Notiz. Dann meinte er: »Vor sechs Tagen überfiel eine Räuberbande einen Gutsbesitzer in Bommern. Wir vermuten, dass es sich um die Bande handelt, die auch Ihren Bruder auf dem Gewissen hat. Sie treibt schon seit Längerem ihr Unwesen in der Mark und den angrenzenden Gebieten. Unmittelbar nach dem Überfall haben wir mit mehreren hundert Bürgern die Verfolgung der Spießgesellen aufgenommen, leider erfolglos. Sie waren wie vom Erdboden verschluckt.«
»So viele Freiwillige haben sich an der Suche beteiligt?«
»Beeindruckend, nicht wahr?«
»Warum sind die Ganoven dann nicht geschnappt worden?«
»Die Kerle waren bestens organisiert. Sie wollten anscheinend an der Ruhr entlang nach Osten, vermutlich um sich hinter Bommern Richtung Süden zum Bergischen durchzuschlagen. Dieser Weg war allerdings durch die alarmierten Bürger versperrt. Am Ufer des Flusses unweit der Zeche Nachtigall entdeckten sie einige Boote. Zwei benutzten sie zum Übersetzen, die anderen banden sie los und ließen sie die Ruhr hinabtreiben. Deshalb konnte ihnen niemand folgen und die Bürgerwehr verlor die Spur der Gauner. Ärgerlich, oder?«
Paul beantwortete Märkers rhetorische Frage nicht und erkundigte sich stattdessen: »Was gedenken Sie nun wegen des Mords an meinem Bruder zu unternehmen?«
»Wir bringen Aushänge an den Häusern in den umliegenden Städten an, um mögliche Zeugen zu finden. Außerdem befragen wir die Bewohner an dem Weg, den Ihr Bruder zurückgelegt haben muss. Wir zeigen ihnen die Diebeslisten, in denen die uns bekannten Gauner beschrieben werden. Vielleicht ist ja jemanden einer der Spitzbuben aus unserer Kartei aufgefallen. Mehr können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht tun.«
Paul nickte. »Ich danke für die Mühen.«
»Eine Frage noch. Hatte Ihr Bruder Feinde?«
»Bestimmt nicht. Er hielt sich die letzten fünf Jahre in Russland auf und kehrte erst vor einer Woche hierher zurück. Es wusste kaum jemand, dass er wieder da ist. Seit seiner Rückkehr hat er unser Haus in Blankenstein nur selten verlassen, soweit mir bekannt ist. Einmal sind wir gemeinsam nach Bochum geritten, haben aber mit niemanden länger gesprochen. Wie sollte er sich da Feinde machen? Sagten Sie nicht gerade, Räuber hätten Franz ermordet?«
Richter Märcker hielt Pauls Aussage schriftlich in einer Notiz fest. »Wir vermuten, dass es sich bei den Tätern um diese Bande handelt. Aber mit Gewissheit wissen wir das natürlich erst, wenn wir die Ganoven festgesetzt und sie gestanden haben.«
»Verstehe. Wann kann ich meinen Bruder beerdigen?«
»Sind sie mit einer Kutsche nach Blankenstein gekommen?«
»Ja.«
»Dann nehmen Sie den Leichnam sofort mit, wenn Sie möchten.«
Mit belegter Stimme bedankte sich Paul.
5
Schloss Borbeck, 8. April 1773
August Conradi war früh aufgebrochen, um sich unter keinen Umständen zu verspäten. Fürstäbtissin Christine von Pfalz-Sulzbach ließ man nicht warten. Erst recht nicht, wenn man selbst nur als untergeordneter Rentmeister auf Schloss Broich diente und nur deshalb zu dieser Besprechung geladen war, weil die eigentliche Herrin, die Prinzessin von Darmstadt, wie so oft verhindert war. Sie kümmerte sich zwar intensiver um Schloss Broich als ihre Vorfahren, zog es aber dennoch vor, ihr Leben in Hessen zu verbringen.
Ein Waldgebiet erstreckte sich bis zum Wassergraben, der das Schloss Borbeck umgab. Conradi passierte das Tor im Norden und erreichte den Vorhof, den im Osten und Westen lang gestreckte Wirtschaftsgebäude, die in Schutzmauern übergingen, begrenzten. Südlich lag eine steinerne Brücke, die zum eigentlichen Schloss führte. Schnee fiel in dicken, feuchten Flocken und legte sich auf seinen Mantel.
Er stieg vom Pferd. Ein Pferdebursche eilte aus dem Stall herbei und griff die Zügel des Wallachs. Conradi warf ihm einen Pfennig zu. »Reibe den Gaul ab und gib ihm zu saufen. Aber fressen soll er nicht. Hast du verstanden?«
Der Bursche nickte diensteifrig. Aus dem Gebäude näherte sich ein Diener, der sich vor dem Gast verbeugte. »Sie sind zu früh, Herr«, bemerkte der Livrierte unnötigerweise.
»Ich weiß«, erwiderte Conradi eine Spur zu barsch. »Abt Sonius ist noch nicht anwesend?« Der Geistliche sollte ebenfalls an der Besprechung teilnehmen.
»Nein.«
Wie bestellt rollte eine kleine Kutsche in den Vorhof, die von einem Mönch im Habit eines Benediktiners gesteuert wurde. Neben ihm saß Anselm Sonius, Abt des Klosters Werden. Der Sechzigjährige kletterte umständlich vom Bock herunter. Conradi wusste, was der Abt erwartete. Also ging er schnellen Schrittes zu ihm.
»Hochwürdigster Vater Abt«, begrüßte er ihn unterwürfig. »Ich freue mich, Sie zu sehen.«
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite«, erwiderte der Geistliche mit einem Gesichtsausdruck, der seine Worte Lügen strafte. »Mir tut der Allerwerteste weh. Die Federung dieser Kutsche ist zu hart und die Straßen so schlecht, dass man gehörig durchgeschüttelt wird. Dann das Wetter. Einfach grausam. Die feuchte Kälte kriecht mir in die Knochen. Aber was bleibt mir übrig? Da die Fürstäbtissin nicht nach Werden kommt, müssen wir zu ihr. Sie ist selbst für so kurze Fahrten wie die in mein Kloster zu schwach und gebrechlich. Andererseits: Ich würde mir wünschen, mit Vierundsiebzig auch noch so klar im Kopf zu sein wie sie. Ihre Glieder mögen nicht mehr mitspielen, ihr Verstand jedoch ist so scharfsinnig wie eh und je.« Er sah zum Schloss hinüber. »Ah, da kommt einer ihrer jesuitschen Wachhunde, um uns zu begrüßen.«
»Woran erkennen Sie das?«, wunderte sich Conradi, denn der schlanke Mann, der über die Steinbrücke auf sie zukam, trug keinen Habit, sondern einen bis zum Hals zugeknöpften schwarzen, wadenlangen Mantel.
»Sie haben nichts von den Beratern der Äbtissin gehört?«, fragte der Abt.
»Nicht genug, fürchte ich.«
»Sie umgibt sich ausschließlich mit Jesuiten. Einer ist ihr Beichtvater, andere dienen als Räte in der Verwaltung des Stifts. Sie halten alle Schaltstellen besetzt und flüstern ihrer Herrin das ein, was ihnen ihr Orden befiehlt. Das führt zu ständigem Streit mit dem Rat der Stadt Essen und ihren Bewohnern.«
»Ebenso wie mit dem Kloster in Werden?«, vermutete Conradi.
Der Abt grinste. »Auch das. Aber nun still. Der Jesuit muss meine despektierlichen Äußerungen nicht unbedingt hören. Wappnen wir uns für das Gespräch mit der Fürstäbtissin.«
Die Schlossherrin empfing sie in ihrem Arbeitszimmer im ersten Stock des Westturms. Der Raum war spärlich möbliert. Lediglich die schweren Brokatvorhänge an den drei Fenstern zeugten von Wohlstand.
Die Äbtissin saß an der Längsseite einer langen Tafel, flankiert von zwei Jesuiten und stand nicht auf, um ihre Gäste zu begrüßen, stattdessen zeigte sie wortlos auf die Stühle an der gegenüberliegenden Tischseite.
Christine von Pfalz- Sulzbach trug keine Perücke, sondern versteckte ihr züchtig nach hinten gebundenes, weißes Haar unter einer Seidenhaube. Die Kopfbedeckung war von tiefschwarzer Farbe, wie auch ihre restliche Kleidung. Das Kleid war bis zum Hals zugeknöpft und ließ ihr Dekolleté nur erahnen, ein langer Schal reichte bis zur Brust. Trotz ihrer fahlen, faltigen Haut erkannte Conradi, dass sie in jungen Jahren eine Schönheit gewesen sein musste.
Nachdem Abt Sonius und Conradi Platz genommen hatten, hörte der Rentmeister zum ersten Mal ihre knarzige Stimme: »Haben Sie genug gesehen, Herr …?« Sie zögerte, bis ihr ein Berater seinen Namen ins Ohr flüsterte. »Conradi.«
Dieser senkte beschämt den Kopf.
»Dann fangen wir an. Die Herren neben mir sind meine Ratgeber. Ich hoffe, wir erzielen zügig eine Einigung, denn die Gicht macht mir zu schaffen. Ich möchte so schnell wie möglich zurück in meine Privatgemächer.« Sie sprach den Rentmeister an. »Ich vermute, Sie wissen, worum es geht?«
»Nicht im Detail, verehrte Frau Fürstäbtissin.«
»Lassen Sie die Höflichkeitsfloskel. Fürstäbtissin reicht.«
Conradi schluckte. »Ihr untertänigster Diener.«
»Papperlapapp.« Sie streckte die Hand aus und einer ihrer Berater gab ihr ein Schriftstück, mit dem sie durch die Luft wedelte. »Der König von Preußen hat uns einen Brief geschrieben. Darin geht es wieder einmal um die Schiffbarmachung der Ruhr. So wie es sich hinter den wohlgesetzten Worten anhört, verliert er die Geduld mit uns. Ich befürchte, er wird sich nicht mehr lange hinhalten lassen.«
Die Federn der Jesuiten kratzten über das Papier. Sie protokollierten das Gesprochene mit.
»Was will er machen?«, warf der Abt ein. »Seine Truppen schicken?«
»Wohl nicht. Aber er ist der oberste Landesherr der Grafschaft Mark und des Herzogtums Kleve und der Stift Essen ist umgeben von seinem Territorium. Außerdem ist er unser Vogt. Er kann uns das Leben recht schwer machen.« Sie wandte sich erneut an den Rentmeister. »Zu Ihrer Information: Friedrich fordert schon seit Jahren den Bau von sechzehn Schleusen im mittleren und unteren Bereich der Ruhr, ab Wetter flussabwärts. Er möchte so sein Salz aus Unna und die Kohlen, die auf seinem Land gefördert werden, kostengünstig zum Rhein transportieren, um sie dort weiter zu verschiffen. Sein Herrschaftsgebiet endet allerdings bei Hinsel. Da beginnen die Territorien des Klosters Werden südlich des Flusses und das meinige nördlich davon. Broich und Mülheim, also Teile der Grafschaft Hessen und des Herzogtums Berg, schließen sich an.«
Conradi nickte.