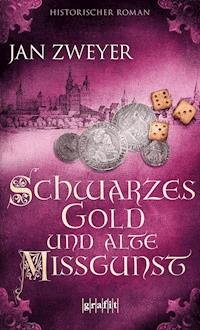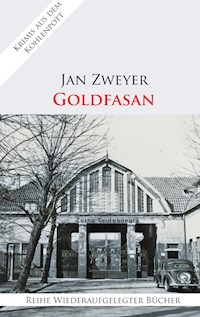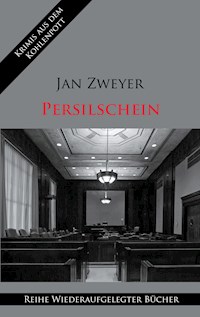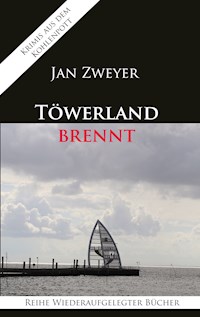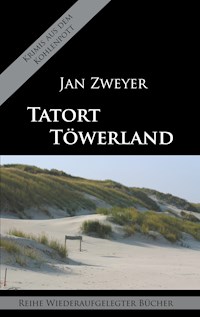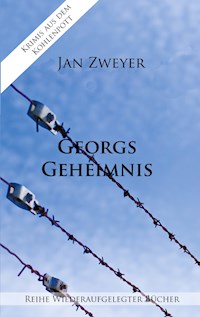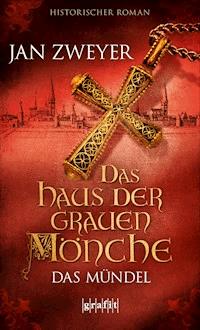
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GRAFIT
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Das Haus der grauen Mönche
- Sprache: Deutsch
Der erste Teil der großen Mittelaltersaga Das Haus der grauen Mönche. Das Ruhrgebiet im Mittelalter: Wegen einer Wiese müssen Linhardt von Linden und seine Frau ihr Leben lassen. Der neugeborene Sohn Jorge bleibt nur vom Tod verschont, weil sich Bruder Bernardo seiner annimmt. Doch die Erziehung des Waisen im ›Haus der grauen Mönche‹ ruft Missgunst auf den Plan - sogar unter den Mönchen selbst. Auch von anderer Seite droht Ungemach: Der Hattinger Bürger Hinerick van Enghusen strebt das Amt des Bürgermeisters an - und ihm sind die Bettelmönche schon lange ein Dorn im Auge. Selbst der Erzbischof in Köln hat guten Grund, die Mönche weit weg zu sehen, und trägt diesen Wunsch an den ehrgeizigen Benediktiner Bartholomäus heran. Dem ist jedes Mittel recht, um in der Kirchenhierarchie aufzusteigen. Gemeinsam mit einem Gefolgsmann des Herzogs, Philip von der Schadeburg, spinnt er eine gefährliche Intrige. Und macht sich damit den Richtigen zum Kumpanen. Denn von der Schadeburg ist lasterhaft, aufbrausend und skrupellos - und mitschuldig am Tod der Eltern Jorges. Der Waisenjunge gerät zwischen die Fronten von weltlichen und kirchlichen Machthabern. ›Das Mündel‹ ist der Beginn einer großartigen Familiensaga, die vor allem den bürgerlichen Alltag im Mittelalter facettenreich und mitreißend lebendig werden lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Jan Zweyer
Das Haus der grauen Mönche
Das Mündel
Historischer Roman
Das Mündel ist der erste Teil der dreiteiligen Mittelaltersaga Das Haus der grauen Mönche:
Das Haus der grauen Mönche – Das Mündel (Juni 2015)
Das Haus der grauen Mönche – Freund und Feind (Oktober 2015)
Das Haus der grauen Mönche – Im Dienst der Hanse (Februar 2016)
© 2015 by GRAFIT Verlag GmbH
Chemnitzer Str.31, 44139 Dortmund
Internet: http://www.grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
eBook-Produktion: CPI books GmbH, Leck
eISBN 978-3-89425-184-0
Der Autor
Jan Zweyer wurde 1953 in Frankfurt am Main geboren. Mitte der Siebzigerjahre zog er ins Ruhrgebiet, studierte erst Architektur, dann Sozialwissenschaften und schrieb als ständiger freier Mitarbeiter für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Er war viele Jahre für verschiedene Industrieunternehmen tätig. Heute arbeitet Zweyer als freier Schriftsteller in Herne.
Nach zahlreichen zeitgenössischen Kriminalromanen hat er sich mit der Goldstein-Trilogie Franzosenliebchen, Goldfasan und Persilschein das erste Mal historischen Themen zugewandt. Es folgte zuletzt Die brillante Masche.
Für Barbara
Dramatis Personae
(Die mit einem * gekennzeichneten Figuren sind historisch belegt. In einigen Fällen wurde bei ihnen der Vorname Johann geändert, um eine Verwechslungsgefahr mit anderen Figuren zu vermeiden.)
Dominikaner im Haus der grauen Mönche, Hattingen
Jacob – Ältester
Albertus
Bernardo
Christoph
Matthias
Thomas
Ulrich
Dominikaner im Kloster Soest
Vinzenz, Prior
Gregor, Subprior
Benediktiner im Kloster Deutz
Maximilian, bis zu seinem Tod im Jahr 1500 Abt
Paschalis, bis 1500 Prior, danach Abt
Gallus, Sekretär des Abts
Bartholomäus, genannt ›der Römer‹
Familie von Linden
Linhardt, freier Bauer
Ursell, seine Frau
Jorge, ihr Sohn
Bauern in Alte Schee
Caspar, Pflegevater Jorges
Martha, seine Frau
Brid, ihre Tochter
Familie van Enghusen, Hattingen
Hinrick, Patrizier, Kaufmann (Viehhändler), ab 1501 Bürgermeister *
Ella, seine Frau
Lucas, sein Sohn
Marlein, seine Tochter
Familie von Krekenbeck, Hattingen
Reinhard, Erbhofschultheiß des Hofs Hattingen und Herr von Haus Cliff
Agnes, seine Tochter aus erster Ehe
Wendel, sein Sohn aus erster Ehe
Burg Blankenstein, Hattingen
JohannII., von 1481 bis 1521 Herzog von Kleve und Graf von der Mark *
Hanle Stecke, Graf zu Dortmund und Amtmann zu Blankenstein
Philip von der Schadeburg, Freiherr, Hauptmann der Garde des Herzogs
Kracht von Mylendonk, nach Hanle Stecke 1494 bis 1503 Droste und Amtmann Burg Blankenstein *
Hattinger Bürger
Lucius, Pfarrer in St.Georg, Hattingen
Zacharias, Jude
Aron ben Zacharias, sein Sohn
Ditz Huyser, Bürgermeister *
Erhardt Bungener, Richter am Gericht in Hattingen zwischen 1486 und 1503 *
Sonstige
Hermann von Hessen, Erzbischof von Köln, genannt ›der Friedsame‹ *
Alhayt,
DAS URTEIL
Mai bis Oktober 1488
1
Burg Blankenstein, 12.Mai 1488
Das Feuer in dem großen Kamin, der die Westmauer des Saals beherrschte, drohte zu erlöschen. Ein Bediensteter verließ seine Stellung neben der Eingangstür an der Stirnseite des Raumes und eilte auf einen Wink seiner Herrschaft herbei, um frisches Holz nachzulegen. Er schichtete die Scheite auf dem Feuerbock übereinander und blies danach mit einem Balg Luft in die Glut. Schnell loderten die Flammen empor. Da das Holz jedoch nicht ausreichend getrocknet war, entstanden beißende Qualmwolken, die durch die Halle der Burg Blankenstein oberhalb der Ruhr bei Hattingen zogen.
Herzog Johann der Zweite von Kleve und Mark, der die Anstrengungen des Dieners mit zunehmender Missbilligung verfolgt hatte, wandte sich um und schritt zu einem der Butzenfenster, um es zu öffnen. Die hereinströmende Luft war kühl und drohte die Bemühungen des Mannes am Kamin, den Saal zu erwärmen, zunichtezumachen.
Nach mehreren tiefen Atemzügen schloss der Herzog das Fenster, blickte aber immer wieder ungeduldig hinaus auf das gegenüberliegende Burgtor. Nach einigen Minuten erfolglosen Wartens kehrte er zurück zum Tisch in der Raummitte. »Wann wollte der Abt hier sein?«, fragte er den dritten Mann im Raum, den Drosten der Burg, Hanle Stecke, Graf zu Dortmund und Amtmann zu Blankenstein.
Der Graf lächelte nachsichtig. Sein Landesherr hatte ihm diese Frage in der letzten Stunde schon mehrfach gestellt. Er konnte dessen Unruhe nur zu gut nachvollziehen, deshalb antwortete er gelassen: »Um die Mittagszeit. Die Gäste Euer Durchlaucht müssten in Kürze eintreffen.«
Wie zur Bestätigung drang wenig später das Geklapper von Pferdehufen vom Burghof herauf.
»Sieh nach, wer das ist«, herrschte der Herzog den Diener an, der immer noch mit dem Balg in der Hand das Feuer zu entfachen suchte, um die Rauchentwicklung zu bekämpfen. Der Mann ließ sein Arbeitsgerät fallen und eilte zum Fenster. »Drei Mönche auf Pferden, Euer Hoheit.«
»Benediktiner?«
»Ja, Euer Hoheit.«
Herzog Johann vollführte eine Handbewegung, als ob er eine Fliege verscheuchen wollte. Der Diener gehorchte sofort und nahm seinen Platz neben der Tür wieder ein.
»Endlich.« Der Herzog griff sein rotes, edelsteinverbrämtes Barett und setzte es auf.
»Soll ich den Abt im Hof empfangen?«, erkundigte sich der Droste.
Der Herzog nickte. »Tun Sie das, Graf. Aber führen Sie ihn auf dem schnellsten Wege zu mir.«
Stecke deutete eine Verbeugung an. »Selbstverständlich.« Dann machte er sich auf, diesen Wunsch zu erfüllen.
Einige Minuten später waren gedämpfte Stimmen aus der Vorhalle zu vernehmen. Der Herzog stand auf und stellte sich in die Mitte des Saals. Nachdem sich sein Herr in Position gebracht hatte, zog der Diener die grobe Holztür auf und verbeugte sich ehrfurchtsvoll, als Abt Maximilian vom Benediktinerkloster Deutz mit seinem Gefolge den Raum betrat. Die Mönche waren in schwarze, weite Kapuzenmäntel gehüllt. Unter der Kukulle trug jeder eine ebenfalls schwarze, bodenlange Kutte. Zwei der Geistlichen hatten ihre Hände tief in den Taschen der Mäntel versenkt. Nur der Abt nicht. Seine herausragende Stellung an der Spitze der kleinen Delegation war an zwei Insignien zu erkennen: ein schweres, mit Edelsteinen besetztes Goldkreuz, welches um seinen Hals hing, und ein goldener Ring an seiner rechten Hand. Wie seine Glaubensbrüder war er bartlos und auch sein Haupthaar zur Tonsur geschoren.
Der Herzog näherte sich den Geistlichen und blieb kurz vor dem Abt stehen. »Ehrwürdiger Vater«, begrüßte er seinen Gast, wobei er leicht den Kopf neigte.
Der Abt lächelte huldvoll. »Durchlaucht«, erwiderte er und streckte dem Adeligen seinen Handrücken entgegen.
Es war eindeutig. Der Abt verlangte eine Unterwerfungsgeste. Johann zögerte. Lehnte er sie demonstrativ ab, wäre die Gesprächsatmosphäre bereits im Vorfeld vergiftet. Es würde schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, sein Ziel zu erreichen, sagte ihm sein Verstand. Also überwand er seinen Stolz und fügte sich. Er machte einen weiteren Schritt nach vorne, ergriff die dargebotene Rechte, beugte sich darüber und deutete einen Kuss auf den Ring an.
»Hattet Ihr eine angenehme Reise?«, erkundigte er sich dann mit säuerlicher Miene, nachdem die Begrüßungszeremonie vollzogen war.
»Es ist ja nicht weit von Hattingen hierherauf. Der Ritt nahm weniger als eine Stunde in Anspruch.«
»Ich meinte eher den Weg, den Ihr von Eurem Kloster in Deutz zurücklegen musstet. Ihr seid gestern angekommen, wie ich hörte.« Der Herzog wies auf den Tisch in der Mitte des Raums. »Wenn Ihr Euch setzen wollt …«
Der Abt kannte den Saal von früheren Besuchen. Nur wenig hatte sich verändert: Ein geknüpfter Wandbehang, der religiöse Motive zeigte, war zu denen mit Jagdszenen hinzugekommen und schmückte die obere Hälfte der südlich gelegenen Wand. Darunter stand die lange, mit dicken Kissen ausgelegte Bank. Auch am Tisch dienten zwei Bänke als Sitzgelegenheit, die aber frei im Raum standen. »Ihr seid wie immer gut informiert.«
Die beiden Männer schritten zur Tafel. Die Mönche und der Droste folgten schweigend.
»Ja, unsere Reise verlief ohne Komplikationen. Ein Trupp Bewaffneter des Erzbischofs sicherte unseren Weg.«
Sein Gastgeber verzog das Gesicht. Mit Hermann von Hessen saß der Vierte dieses Namens seit nunmehr zehn Jahren auf dem Bischofsstuhl. Hermann war ein Onkel seiner Frau Mathilde und er hatte die Jahrzehnte währende Fehde des Kölner Bistums mit den Herzögen von der Mark und Kleve beendet.
Aber Johann traute dem Bischof nicht über den Weg. Denn der Streit, der sich am Status der Stadt Soest entzündet hatte, schwelte weiter. Der Erzbischof hatte noch immer ein Auge auf die Stadt geworfen, um seine Macht im Westfälischen weiter auszubauen. Die Soester jedoch hatten sich dem Herzogtum unterworfen und die Herzöge von Kleve dachten gar nicht daran, dem Erzbischof die Stadt zu überlassen und ihren Einfluss auf die Region aufzugeben. Johann war davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es zu einem neuen Waffengang um die Vorherrschaft in der Börde kam.
Und so, wie er den Frieden beargwöhnte, misstraute er auch dem Gesprächspartner, der ihm jetzt gegenübersaß. Er gab dem Diener ein Zeichen. Der sprang herbei und servierte gewürzten Wein in Trinkbechern aus Zinn, deren Rand vergoldet war.
»Sicher seid Ihr hungrig.« Der Herzog hob den Becher zum Gruß.
»Nein, danke. Wir haben bereits gespeist.«
»Wie Ihr wünscht.« Eine kaum wahrnehmbare Kopfbewegung seines Herrn verwies den Diener in seine Warteposition, bereit, jeden Wunsch seiner Herrschaft zu erfüllen. Erst nachdem der Abt und der Herzog am Kelch genippt hatten, tranken ihre Begleiter.
»Gestattet, dass ich Euch meine Gefolgschaft vorstelle.« Abt Maximilian deutete auf den Mönch an seiner rechten Seite. »Prior Paschalis kennt Ihr ja schon von früheren Zusammentreffen. Zu meiner Linken sitzt Bruder Bartholomäus. Er hat ein Schweigegelübde abgelegt und wird sich daher nicht an unserer Unterhaltung beteiligen.«
Johann glaubte kein Wort von dem, was der Abt sagte. Dieser Mönch hatte die alleinige Aufgabe, genau zuzuhören und zu beobachten. Reden war da nur hinderlich. Um den Grund für seine Anwesenheit zu verschleiern, benutzte der Abt diese Notlüge. Johann musterte den Mönch ungeniert. Bartholomäus war im Gegensatz zu seinen Mitbrüdern, die zur Fülle neigten, hager, aber nicht sehr groß. Sein spitzes Gesicht und der stechende Blick seiner Augen weckten im Herzog Erinnerungen an eine Ratte.
»Und Euch ist der Graf zu Dortmund, Hanle Stecke, bekannt«, erwiderte er, »mein Amtmann hier auf Blankenstein.«
Die Männer nickten sich freudlos zu. Dann tranken sie und setzten den Austausch von belanglosen Höflichkeiten fort.
Schließlich verstummte ihr Geplauder und es trat jene Stille ein, die schon nach kurzer Zeit unangenehm berührt. Dann brach der Herzog das Schweigen. »Ich hörte, die Ernte war gut im letzten Jahr?«
»Nicht besser als in den Jahren zuvor«, entgegnete der Abt.
»Aber Eure Ländereien sind ertragreich?«
Mit einem Ruck stellte der Abt den Trinkbecher ab. Er fixierte den Herzog kalt. Jede Emotion war aus seinem Gesicht gewichen. »Durchlaucht, Ihr müsst nicht um den heißen Brei herumreden. Ihr braucht Geld, nehme ich an?«
Empört sprang Johann auf. »Wie könnt Ihr es wagen …«
Der Abt hob beschwichtigend die Hände. »Durchlaucht, ich wollte Euch keineswegs beleidigen. Aber Eure finanzielle Situation ist kein Geheimnis. Haben sich nicht einige Städte in Eurem Herzogtum sogar zu einem Bündnis gegen Euch zusammengeschlossen? Und weigert sich nicht auch der Landadel, seine Steuerpflicht zu erfüllen? Wir Benediktiner dagegen sind unseren Pflichten als Grundherren gegenüber Euch als Landesherrn immer nachgekommen. Also setzt Euch wieder und sagt, weshalb Ihr um dieses Gespräch gebeten habt.« Der Abt machte eine einladende Geste.
Herzog Johann wusste, dass der Mönch recht hatte. Also nahm er seinen Platz wieder ein. »Ihr vermutet richtig. Ich wollte mit Euch über ein Darlehn verhandeln.«
»Das dachte ich mir. Wie viel?«
»Eintausend Goldgulden würden für den Anfang reichen.«
»Für den Anfang?« Ein spöttisches Lächeln umspielte die Züge des Abts. »Durchlaucht, wir sind ein Kloster, keine Geldverleiher.«
»Na gut. Sagen wir als ein einmaliges Darlehn.«
Der Abt dachte nach. Dann wandte er sich an den Prior. »Bruder Paschalis, was sagst du dazu? Sind unsere Truhen voll genug, um dem Wunsch des Herzogs nachzukommen?«
»Wenn wir sparsam leben, könnten wir den Betrag aufbringen. Welche Sicherheiten haben Euer Durchlaucht anzubieten?«
Der Herzog bewahrte nur mühsam die Fassung. Was erlaubte sich dieser Mönch seinem Landesherrn gegenüber? »Ihr wollt Sicherheiten? Reichen Euch etwa mein Name und Rang nicht aus?«, erwiderte er wütend.
Paschalis wollte antworten, aber der Abt legte ihm besänftigend die Hand auf die Schulter und richtete sein Wort an den Herzog: »Eine Geste des guten Willens, Durchlaucht. Keine Sicherheiten.«
»Was verlangt Ihr also?«
»Etwas Boden aus Eurem Besitz, mehr nicht.«
Johann kalkulierte überschlägig die Preise. Ein durchschnittliches Stadthaus kostete rund zweihundert Gulden, also war diese Sicherheit durchaus annehmbar. »Dachtet Ihr an ein bestimmtes Grundstück?«
»Wenn Ihr dem Hilinciweg über die Brücke der Ruhr nach Norden in Richtung Linden folgt, erreicht Ihr kurz nach dem Beginn der Anhöhe ein Flachstück. Das öffnet sich nach Osten, ist kaum bewaldet und etwa zehn Morgen groß.«
Amtmann Stecke beugte sich zur Seite und flüsterte dem Herzog ins Ohr: »Ich kenne das Gelände. Es ist nicht Euer, sondern wurde einem Bauern aus Linden überlassen.«
Unwirsch schüttelte der Herzog den Kopf und ignorierte den Einwand des Drosten. »Was wollt Ihr mit einem so großen Grundstück?«, fragte er den Abt.
»Wie Ihr wisst, führt die Ruhr im Frühjahr und Herbst häufig Hochwasser. Unsere Weiden werden überflutet. Wenn wir unser Vieh weiter oben grasen ließen, bliebe uns Ungemach erspart.«
Johann wusste, dass auf den Uferwiesen tatsächlich häufig Wasser stand. Aber bisher hatte dies nie ein Problem dargestellt. Woher also sonst rührte das Interesse der Mönche an dieser Brache? Erschließung neuer Ackerflächen? Wohl kaum. Dem Deutzer Kloster gehörten in dieser Gegend mehr Ländereien als ihm, vermutete er. Plötzlich drängte sich dem Herzog ein Verdacht auf: Vielleicht war es der Kölner Erzbischof, der die Benediktiner leitete. Zehn Morgen Land reichten aus, um darauf eine befestigte Anlage, wenn nicht sogar eine Burg zu bauen. Nachdem die Isenburg zerstört und die Ruhrfurt, die von dort kontrolliert wurde, durch die weiter östlich liegende Brücke ersetzt worden war, blieben nur Burg Blankenstein und das Haus Cliff, um den wichtigen Handelsweg über den Fluss zu beherrschen. Denn wer trockenen Fußes über die Ruhr wollte, musste den Weg über die Brücke nehmen und Brückengeld und Steuern bezahlen. Wollte ihm der Erzbischof diese Einnahmequelle streitig machen? Die Mönche hatten anscheinend bereits vor der Unterredung gewusst, dass er sie um ein Darlehn bitten wollte. Gab es einen Zuträger in seinem Umfeld? Er ging in Gedanken die Namen seiner Getreuen durch, die von seinem Vorhaben wussten. War einer von ihnen der Spitzel? Er konnte es sich nicht vorstellen. Trotzdem musste er zukünftig noch wachsamer sein. Hermann von Hessen, der Kölner Erzbischof, den sie den Friedsamen nannten, war möglicherweise doch eher ein Wolf im Schafspelz. Wollte der Bischof auf dem Gelände eine Festung errichten und ihm das Ruhrtal militärisch streitig machen?
Der Abt riss den Herzog aus seinen finsteren Gedanken. »Was sagt Ihr zu unserem Vorschlag?«
Johann atmete tief ein. Was blieb ihm übrig? Er brauchte das Geld. Sollte er seine Zahlungsfähigkeit nicht wiederherstellen können, drohte seinem Geschlecht der Sturz in die Bedeutungslosigkeit. Dagegen wog ein möglicher Burgenbau auf der anderen Seite der Ruhr, der Jahre in Anspruch nehmen dürfte und möglicherweise nie fertig wurde, wenig. »Einverstanden«, sagte er deshalb.
»Aber Durchlaucht«, wagte der Graf einen Einwand. »Das Grundstück …«
Johann hob drohend die Hand. »Schweigt!«, gebot er.
Der Abt griff zum Kelch und trank ihn in einem Zug aus. »Der Wein ist wirklich exzellent«, sagte er und erhob sich. »Sobald wir die von Euch unterschriebene und besiegelte Urkunde in den Händen halten, geht Euch das Geld zu.«
Als die Mönche den Saal verließen, glaubte der Herzog, die Mimik des Grafen drücke Missfallen aus. »Ihr haltet meine Entscheidung für falsch?«, fragte er deshalb.
Hanle Stecke war knapp dreißig Jahre alt und seit mehr als zwei Jahren Droste auf Blankenstein. Sein Vater hatte das Amt als Pfand für ein Darlehn erhalten, das er Herzog Johann dem Ersten vor fast drei Jahrzehnten eingeräumt hatte. Weder der Vater noch dessen Sohn hatten diese Schuld bis heute beglichen. Und so hatte Hanle Stecke nicht nur den Grafentitel, sondern auch das Drostenamt geerbt.
»Durchlaucht, es steht mir nicht an, Eure Wahl zu kritisieren. Nur …«
»Nun redet schon.«
»Das Verfügungsrecht über dieses Grundstück liegt nicht bei Euch.«
»Das sagtet Ihr bereits. Wer ist der Nutzer?«
Die Saaltür wurde durch den Diener aufgedrückt. Ein etwa zwanzigjähriger Edelmann betrat den Raum. Er verbeugte sich und sprach unaufgefordert: »Die Mönche haben Blankenstein soeben verlassen. Ich habe ihnen zwei Mann als Geleit mitgegeben. An den Toren Hattingens lassen sie die Geistlichen allein. Und kehren zur Burg zurück, so wie Ihr befohlen habt.« Philip von der Schadeburg machte Anstalten, sich zurückzuziehen.
»Bleibt!«, ordnete der Herzog an. »Und lasst Euch den Wein schmecken.« Er zeigte zum Tisch, auf dem die immer noch vollen Krüge standen. »Und nun zu Euch, Graf. Also, wem obliegt das Nutzungsrecht an dem Gelände, das die Mönche so interessiert?«
»Einem Bauern aus Linden.«
»Nehmen wir es ihm weg.«
»Er ist ein freier Bauer. Ihr könnt nicht über seinen Besitz verfügen.«
Der Herzog machte eine abwehrende Handbewegung. »Ach was. Frei oder unfrei. Er ist ein Bauer.«
»Durchlaucht, bestimmt erinnert Ihr Euch. Als Euer Vater gegen die Kölner zog, kam es vor Soest bei der Belagerung der Stadt durch die Truppen des Erzbischofs zu einem Scharmützel. Das Pferd des Herzogs strauchelte, er stürzte und fiel so unglücklich, dass er unter dem Pferdeleib eingeklemmt war. Wäre ihm nicht ein Bauer, der auf Eurer Seite gekämpft hatte, zu Hilfe geeilt, hätten ihn die heranstürmenden Kölner gestellt. Als Dank für die Rettung aus höchster Not hat Ihr Vater dem Bauern ein Geschenk angeboten. Dieser wählte die Wiese, um dort einige Weinstöcke anzubauen. Ihr Vater hat ihm das Privileg gewährt. Und nun ist dessen Sohn der Nutzer des Grundstücks.«
»Wein? An der Ruhr?« Der Herzog lachte auf. »Hatte er mit dem Anbau Erfolg? Dann können wir von ihm lernen.«
»Das weiß ich nicht.«
»Gut. Machen wir die Schenkung rückgängig. Das dürfte doch kein Problem darstellen.«
»Durchlaucht, die Schenkung wurde hier in diesem Saal feierlich begangen, die Urkunde vom Abt des Klosters in Werden beurkundet. Euer Vater hat vor Zeugen erklärt, dass der Grund für ewig dem Bauern und seinen Erben überlassen werde. Solltet Ihr die Schenkung für ungültig erklären, würdet Ihr gegen den Willen Eures Vaters verstoßen und Euer Ansehen schmälern.«
»Zahlt er Pacht?«
»Natürlich nicht. So hat es Euer Vater verfügt.«
Johann dachte nach.
»Dürfte ich einen Vorschlag machen?«, schaltete sich der junge Freiherr von der Schadeburg in das Gespräch ein. Es konnte für ihn nur von Vorteil sein, wenn er seinem Landesherrn zu Gefallen war.
»Nur zu.« Der Herzog nickte gnädig. »Wenn Ihr einen klugen Gedanken habt, lasst ihn hören.«
»Warum kauft Ihr diesem Bauern das Recht an der Wiese nicht einfach ab? Zahlt einen guten Preis, beurkundet den Kauf hier in diesem Saal wie damals die Schenkung, und Euer Ruf bleibt so makellos wie bisher.«
Die Miene des Herzogs hellte sich auf. »Ein guter Vorschlag, Freiherr. Graf, kümmert Euch darum. Ach, wer ist dieser Bauer?«
»Der Vater trug den Namen Jorge. Sein Sohn heißt Linhardt, genannt von Linden.«
»Linhardt von Linden also. Er wird seinem Landesherrn doch wohl keine Schwierigkeiten bereiten wollen, oder?«
2
Linden, 13.Mai 1488
Der Hof Linhardts und seiner Frau Ursell lag einige Hundert Schritte von der Kapelle entfernt, die dem heiligen Antonius geweiht war. Dass Linhardts Vater Jorge vor mehreren Jahrzehnten die Entscheidung für diesen Siedlungsplatz getroffen hatte, war bei den übrigen Bewohnern des Dorfes Linden auf Unverständnis gestoßen, hatten sie doch alle ihre Häuser in unmittelbarer Nähe des Gotteshauses errichtet. Jorge jedoch sah mehr Nutzen darin, wenn sein neuer Hof näher bei den Feldern lag, die er bewirtschaftete. So seien die Wege, die er zurücklegen müsse, nicht so weit und die Ernte schneller ein- und in Sicherheit gebracht, erklärte er seinen Nachbarn, die ihm beim Bau zur Hand gingen. Trotzdem wurde er einige Jahre lang misstrauisch beäugt, denn bisher hatte niemand so mit der Tradition gebrochen wie er. Irgendwann folgten weitere Bauern seinem Beispiel, sodass Linden zwar immer noch einen Ortskern besaß, aber an den Rändern ausfranste.
Linhardts Haus duckte sich in eine Senke und war so vor dem Wind geschützt. Das Einfahrtstor, groß genug, um das Ochsengespann aufzunehmen, öffnete sich gen Norden. So schien die Sonne, wenn sie am höchsten am Himmel stand, direkt in die Stube und wärmte diese im Winter. Das war dringend nötig, denn die einzige Feuerstelle befand sich im Flett am Ende der Diele neben dem Seitentor. Auch die Ställe lagen zu weit von der Stube entfernt, als dass die Abwärme der Tiere bis dorthin gelangen konnte. Die Außenwände aus Flechtwerk, mit Lehm verschmiert, boten nur unzulänglichen Schutz vor der Kälte. So drängten sich an kalten Tagen Bauern und Gesinde vor dem Feuer im Flett, um ihre Mahlzeiten einzunehmen, und betraten die Stube eigentlich nur, um darin zu schlafen. Da es für Mai noch recht kühl war, brannte auch in diesen Tagen das Feuer ununterbrochen. Ursell sorgte dafür, dass es nicht erlosch. Trotz des feuchtkalten Wetters schwitzten Linhardt und sein einziger Knecht Mathes beim Ausbessern einer schadhaften Stelle im Dach, die der Sturm der vergangenen Nacht verursacht hatte.
»Hast du schon gehört?«, fragte Mathes seinen Herrn, als sie eine kurze Pause einlegten und sich auf den Strohbündeln, die für die Dacheindeckung vorgesehen waren, ausruhten. »Im Ort erzählt man sich, der Herzog halte Hof auf Burg Blankenstein.«
»Hm«, brummte Linhardt und griff zur Holzkelle, um Trinkwasser aus dem bereitstehenden Eimer zu schöpfen. »Hat er sich also aus seinem Klever Schloss zu uns begeben.«
»Ja. Der ehrwürdige Abt soll ihn auf der Burg aufgesucht haben.«
»Der Deutzer?« Linhardts Interesse war geweckt. Zwei so hochgestellte Herren gemeinsam auf Blankenstein? Das war in der Tat ungewöhnlich. »Was sagen die Leute über den Zweck der Zusammenkunft?«
Der alte Mathes zuckte mit den Schultern. »Nichts. Es weiß doch keiner etwas. Einige erzählen, der Abt habe den Lebenswandel des Herzogs gerügt und ihn zu mehr Sittsamkeit angehalten. Er solle sich auf seine christliche Erziehung besinnen.«
Linhardt wusste, worauf Mathes anspielte, hielt diese Vermutung aber für Unsinn.
»Der Herzog soll ja hinter den Weibern her sein wie ein geiler Bock. Man sagt, er habe schon mehr Kinder gezeugt, als er Lebensjahre auf dem Buckel hat. Also pass nur gut auf deine Ursell auf. Gefallen täte sie ihm bestimmt. Nachher will er die Kraft, die in seinen Lenden steckt, auch noch an ihr ausprobieren.«
Der Bauer machte eine abweisende Handbewegung. »Du solltest nicht so viel auf das Geschwätz der Leute geben. Der Herzog ist von adeligem Blut und …«
»Aber er bleibt ein Mann, oder? Außerdem wird er doch nicht umsonst ›Kindermacher‹ genannt«, unterbrach ihn Mathes. »Und was da bei ihm zwischen den Beinen baumelt, sieht sicher nicht anders aus als bei uns.« Er griff sich mit der linken Hand in den Schritt und schob seinen Unterleib ruckartig vor und zurück. »Oder glaubst du etwa, das herzogliche Gemächt …« Mathes biss sich auf die Lippen, denn Ursell war um die Hausecke getreten und näherte sich den beiden Männern.
»Mir blieb nicht verborgen, was du sagtest, Mathes. Nur mach dir um mich keine Sorgen. Herzog hin oder her, in einem hast du recht: Er ist ein Mann. Und mit Männern kenne ich mich aus. So schnell zerrt mich keiner ins Bett, nicht wahr, Linhardt?« Der Schalk blitzte aus ihren Augen.
Ihr Mann verzog das Gesicht. Es gefiel ihm nicht, dass seine Frau ihn vor ihrem Knecht bloßstellte. Auch wenn es sich nur um einen Scherz handelte. »Schweig, Weib!«, befahl er deshalb barscher als beabsichtigt.
»Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?«, fragte Mathes.
»Das geht dich nichts an«, fauchte der Bauer.
»Schon gut, schon gut.« Mathes hob beschwichtigend die Hände. »Aber du solltest deine schlechte Laune nicht an ihr auslassen. Seit einigen Tagen bist du unausstehlich und aufbrausend. Wenn du mit mir nicht zufrieden bist, sag es und …«
»Es liegt nicht an dir.« Linhardt ließ die Kelle wieder in den Eimer fallen. Dann griff er Ursell am Arm. »Komm. Ich wollte ohnehin mit dir sprechen.« Und zum Knecht gewandt meinte er knapp: »Arbeite weiter. Ich bin gleich zurück.«
Das Paar ging ins Haus und durchquerte die Diele. Linhardt ließ sich auf der Bank nieder, die bei der Feuerstelle stand. Er stützte den Kopf in beide Hände und schwieg. Ursell blieb vor ihm stehen und sah ihn verwirrt an.
Eigentlich hatten sie keine Geheimnisse vor Mathes. Der Knecht lebte seit seiner Geburt auf dem Hof. Er hatte schon Linhardts Vater Jorge treu gedient und Linhardt kannte ihn von Kind auf. Mathes war, obwohl ein Höriger in dritter Generation, Familienmitglied. Er teilte Freud und Leid mit dem jungen Paar, hatte dem Bauern nach dem Tod Jorges zur Seite gestanden und war mit den Jahren in die Rolle eines Ersatzvaters hineingewachsen. Warum also diese Heimlichkeit?
»Es steht nicht gut um den Hof«, begann Linhardt schließlich. »Die Ernten werden immer schlechter. Und der Zins drückt.« Er stand auf und zog seine Frau an sich. »Es war ein Fehler, dass wir uns das Geld für das Ochsengespann geliehen haben.«
»Aber wir hätten doch sonst das Feld hinten am Hang nicht bestellen können«, warf Ursell ein. »Wolltest du dich mit Mathes ins Geschirr legen?«
Ihr Mann ignorierte die Bemerkung. »Und dann der Dienst für den Landesherrn. Drei Tage müssen Mathes und ich auf den Feldern des Herzogs arbeiten. Zur Aussaat und Ernte. Jedes Jahr immer wieder aufs Neue. Warum? Unsere eigene Saat bleibt liegen. Da wären wir als hörige Bauern fast besser dran.« Seine Stimme klang verzweifelt. »Und jetzt auch noch das Kind, das du unter dem Herzen trägst.«
Ursell schob ihren Mann ein wenig zurück. »Sag so etwas nicht. Auch dein Vater hatte schwierige Jahre, nachdem er das Haus gebaut hat. Er hat sich damals Geld geliehen und seine Schulden zurückbezahlt. Bist du ein schlechterer Bauer als dein Vater?«
»Vielleicht.«
»Rede keinen Unsinn. Wenn die Felder nicht mehr hergeben, müssen wir an anderer Stelle das Geld auftreiben.«
Linhardt lachte bitter. »Wenn es doch nur so einfach wäre.«
»Was ist mit dem Weinanbau auf der Wiese oberhalb der Ruhr?«
»Das hat schon mein Vater versucht. Die Stöcke wachsen nicht richtig und die Reben bleiben zu klein. Außerdem ist der Wein sauer und nicht zu verkaufen.«
»Woran liegt das?«
Linhardt zuckte unsicher mit den Schultern. »Im Rheinischen, hat mir mein Vater erzählt, wächst der Wein auf steilen Hängen, die der Sonne zugewandt sind.«
»Das ist die Wiese auch«, wagte Ursell einen Widerspruch.
»Schon. Aber möglicherweise ist sie nicht hoch genug.«
»Du meinst, je höher ein Hang ist, desto näher ist er am Himmel und damit an der Sonne?«
Linhardt nickte. »Daran mag es liegen.«
Sie schüttelte energisch den Kopf. »Das kann nicht sein. Ich habe gehört, dass auf den Bergen bis weit in das Frühjahr hinein Schnee liegt. Dann kann es dort nicht wärmer sein.«
»Was weiß ich. Frag die Pfaffen. Der Himmel ist ihr Geschäft.« Sein Tonfall war gereizt. Frauen hatten Männern nicht zu widersprechen.
»Willst du es nicht noch einmal versuchen?«
Er schüttelte heftig den Kopf. »Das geht nicht. Die Weinstöcke sind längst verfault. Für neue fehlt uns das Geld. Selbst wenn wir uns etwas leihen würden – was ist, wenn es wieder nichts wird mit dem Wein?«
Ursell dachte nach. Nach einer Weile meinte sie: »Die Wiese liegt doch am kleinen Hellweg. Dort kommen ständig Reisende vorbei, die nach Hattingen, Bochum oder gar Dortmund wollen. Warum verkaufen wir ihnen nicht ein wenig Wegzehrung? Wenn wir unsere Waren preiswerter anbieten als die Händler in den Städten, könnte es gehen.« Sie spann den Gedanken weiter. »Später können wir vielleicht sogar eine Schenke errichten und …«
Ihr Mann unterbrach sie. »Ach was. Das werden die Hattinger und die Mönche niemals billigen.«
»Was können sie denn dagegen tun? Es ist unser Grund. Wir halten ja keinen Markt ab, sondern bieten nur das an, was wir selbst erzeugt haben.«
»Und wer soll die Waren zum Kauf anbieten? Mathes und ich müssen auf den Feldern …«
»Ich. Wer sonst?«
»Und das Kind?«
Ursell straffte sich. »Andere Frauen unterstützen ihre Männer auf den Feldern bis zur Geburt und nehmen ihre Arbeit am nächsten Tag wieder auf. Manche kommen sogar in den Furchen nieder. Da werde ich mich ja wohl mit einem Kind auf dem Arm an einen Wegrand stellen können.«
»Aber wenn es regnet?«
»Das tut es auf dem Acker auch. Außerdem kannst du mir einen Unterstand bauen. Bäume gibt es am Rand der Wiese schließlich genug. Und wir werden mit der Enndlin sprechen.«
»Was willst du von der Alten?«
»Ihr fällt das Gehen immer schwerer. Sie hat mich gefragt, ob sie nicht an den Markttagen auf unserem Ochsenkarren mit nach Hattingen fahren darf. Ich denke, ich biete ihr an, nicht sie, sondern lediglich ihre gebrannten Tontöpfe und -schüsseln mitzunehmen und selbst auf dem Markt zu verkaufen. Sie gibt uns dafür einen Anteil am Erlös.« Und dann sprudelte es nur so aus ihr heraus: »Ihr Kotten fällt beim nächsten Sturm in sich zusammen. Wir könnten ihr anbieten, in der Kammer neben Mathes zu schlafen. Für Speis und Trank muss sie natürlich zahlen. Die Unterkunft ist für Enndlin umsonst, als Gegenleistung bringt sie mir das Töpfern bei. Enndlin ist alt. Noch zwei oder drei Jahre, dann ist es mit ihr vorbei. Ihr Mann ist seit Langem tot und auch ihre beiden Söhne haben im Dienst des Herzogs ihr Leben gelassen. Wenn sie nicht mehr ist, betreibe ich das Geschäft allein.«
»Du?«
»Ich meine natürlich wir«, korrigierte sie sich sofort.
»Du scheinst das ja alles genau geplant zu haben.«
Ein Lächeln erhellte ihr Gesicht. »Also, was meinst du?« Sie schaute Linhardt prüfend an.
Dessen Miene zeigte Zuversicht. »Na gut«, sagte er endlich. »Versuchen wir es.«
»Danke.«
Linhardt kramte in seiner Tasche. »Eigentlich wollte ich es dir erst geben, wenn das Kind da ist.« Er zog ein Holzkreuz hervor. »Aber vielleicht ist heute der richtige Zeitpunkt. Es soll das Kind beschützen. Aber du kannst jetzt schon göttlichen Beistand gebrauchen. Eigentlich wir beide«, setzte er hinzu und reichte seiner Frau ein kleines, fast schwarzes Kreuz, welches an einem Band aus weichem Leder befestigt war.
Liebevoll strich sie mit den Fingern über das Geschenk. »Das fühlt sich so glatt an. Es ist wunderschön.«
»Ich habe es aus Nussbaum geschnitzt und mit einer Raspel bearbeitet.« Der Stolz über Ursells Lob war ihm anzumerken. »Den Ast, aus dem es gemacht wurde, hat mir der Böttcher im letzten Winter überlassen.«
»Was hast du ihm dafür gegeben?«
»Keine Angst, kein Geld. Zwei Kohlköpfe.«
Sie küsste das Kreuz, murmelte ein kurzes Gebet und legte es sich um den Hals. »Es wird seinen Zweck erfüllen«, meinte sie. »Ich spüre es.«
Schritte näherten sich und Mathes betrat die Flett. »Es kommen Reiter. Zwei.«
Droste Hanle Stecke und Freiherr von der Schadeburg galoppierten auf den Hof und sprangen von ihren Pferden.
»He du!«, herrschte der Freiherr Mathes an. »Binde unsere Tiere an und gib ihnen zu saufen.« Er drückte ihm die Zügel in die Hand. »Aber ich will meinen Gaul im Auge behalten.«
»Herr«, antwortete Linhardt, der mit seiner Frau die Ankunft der Reiter verfolgt hatte, »unsere Tränke liegt auf der anderen Seite des Hauses.«
»Dann schafft das Wasser hierher.« Philip von der Schadeburg stolzierte auf Linhardt zu. »Und besorg für uns eine Sitzgelegenheit. Ich werde nicht vor einem Bauer stehen.« Mathes band die Pferde an einen Pfosten und verschwand, um Wasser aus dem Brunnen zu holen.
Linhardt nickte Ursell zu. Die lief ins Innere des Gebäudes und kehrte kurz darauf mit zwei dreibeinigen Schemeln zurück, die sie sonst zum Melken benutzten. Mit gesenktem Kopf stellte sie den Adeligen die Sitzgelegenheiten hin. Sichtbar unzufrieden nahm der Freiherr Platz, während der Droste keine Anstalten machte, es ihm gleichzutun.
»Sei gegrüßt, Linhardt«, sagte er stattdessen. »Und auch du, Ursell.«
»Seid ebenfalls gegrüßt, hohe Herren«, erwiderte Linhardt. »Möchtet Ihr etwas trinken? Die Sonne hat die Wolken aufgerissen und Euch muss vom Ritt warm geworden sein.«
»Wein«, orderte von der Schadeburg.
»Tut mir leid, Herr. Wir haben nur Wasser.«
»Ein Schluck Wasser wird uns erfrischen«, antwortete der Droste. »Hab Dank.«
Ursell füllte die Kelle im Eimer und reichte sie, ohne nachzudenken, zuerst dem Freiherrn, da dieser ihr am nächsten war. Der sah empört zu der Bäuerin auf und schlug ihr die Schöpfkelle aus der Hand. Klappernd fiel sie zu Boden. »Was soll das? Ich trinke doch nicht aus demselben Gefäß wie ihr!«
»Ihr könnt ja auch aus dem Eimer saufen wie Euer Gaul.« Kaum hatte Ursell diese Ungeheuerlichkeit ausgesprochen, schlug sie erschrocken die Hand auf den Mund und wich einen Schritt zurück.
Philip sprang auf und ballte die Faust zum Schlag. »Was erlaubst du dir?«, rief er, die Zornesröte im Gesicht.
»Herr, verzeiht. Mein Weib erwartet ein Kind. Da sind Frauen immer launisch und wissen nicht, was sie reden. Nicht wahr, Euer Durchlaucht?« Linhardt wandte sich Hilfe suchend an den Grafen.
»Da könntest du recht haben«, unterstützte ihn der Droste. »Ich würde auch gern einen Schluck trinken. Aber sei so gut und wasche vorher den Sand von der Kelle. Vielleicht habt ihr ja auch zwei Becher für uns.«
Ursell nickte dankbar und eilte davon, um das Gewünschte aus dem Haus zu holen.
Philip von der Schadeburg sah der jungen Frau nach. Ihre Bewegungen wirkten fließend und ihre langen, braunen Haare wehten im Wind.
Philip fragte sich, wie die Bäuerin unter ihrem grauen Kleid aus grobem Linnen aussehen mochte. Und er stellte sich vor, wie es wäre, Ursells augenscheinlich wohlgeformten Körper in seiner Schlafstatt mit den Händen zu berühren, ihn zu küssen und schließlich zu besitzen. Linhardts Stimme riss ihn aus diesen angenehmen Gedanken. »Nun, was führt Euch zu mir?«
»Es geht um die Wiese am Hang der Ruhr, die Herzog Johann der Erste deinem Vater überlassen hat.« Der Droste setzte sich nun ebenfalls.
»Was ist damit?«
»Der Herzog möchte das Nutzungsrecht von dir kaufen.«
Linhardt kratzte sich am Kopf. »Der Sohn fordert also das Geschenk seines Vaters zurück?«
»Er fordert nicht, er bittet und zahlt einen angemessenen Preis.«
»Und was ist in seinen Augen angemessen?«
»Er bietet einen Gulden. Keinesfalls mehr.«
Linhardt lachte auf. »Selbst für zehn würde ich das Land nicht verkaufen.«
Der Freiherr blickte den Bauern aus finsteren Augen an. »Du wirst das Angebot annehmen, Bursche. Sonst …«
»Was sonst?«, wollte Linhardt wissen.
»Der Herzog ist dein Landesherr!«
»Ich weiß. Ich schulde ihm drei Tage Arbeitsleistung im Frühjahr und Herbst. Weiter nichts. Meine sonstigen Abgaben bekommt der Grundherr. Und ich bin beiden noch nie etwas schuldig geblieben. Ich bin ein freier Bauer, der auf seinem seit alters her verbrieften Besitz lebt. Kein Herzog, Fürst oder Freiherr kann mich zwingen, mein Recht an der Wiese zu verkaufen, solange ich meine Verpflichtungen erfülle.« Bei diesen Worten hielt Linhardt dem Blick Philips stand. »Sagt seiner Durchlaucht, ich werde seiner Bitte nicht nachkommen.«
Philip sprang auf und für einen Moment sah es so aus, als ob er zur Waffe greifen würde. Dann hatte der Adelige sich wieder in der Gewalt. »Du tust es. Oder du wirst deine Entscheidung bitter bereuen.«
»Wollt Ihr mir drohen? Ihr steht auf meinem Boden. Eure Pferde saufen mein Wasser, mein Knecht reibt Eure Gäule trocken.« Er zeigte auf den Hauseingang, aus dem Ursell trat, mit zwei Bechern in der Hand. »Dort kommt mein Weib. Sie bringt Trinkgefäße, um Euch die Euch gebührende Gastfreundschaft zu erweisen. Ich habe eine, wie sagtet Ihr gerade, Bitte meines Landesherrn abgelehnt, ich habe ihm nicht die Treue oder Gefolgschaft verweigert. Darüber mag er ungehalten sein. Aber es ist mein Recht, so zu verfahren. Und dieses Recht werdet Ihr mir nicht streitig machen.«
Ursell war hinzugetreten und reichte dem Freiherrn demütig einen Krug. Sie wusste, dass sie vorhin zu weit gegangen war. Es stand einer Frau nicht an, Gäste ihres Mannes zu beleidigen. Vor allem dann nicht, wenn diese von Adel waren.
»Scheiß auf dein Wasser.« Die Adern auf Philips Stirn traten vor Wut hervor. »Du machst einen großen Fehler, Bauer.«
Mit diesen Worten ging er zu Mathes, riss diesem den Zügel aus der Hand, schwang sich auf sein Pferd und gab ihm die Sporen. Erschrocken machte der Warmblüter einen Satz nach vorne, stieß mit einem Hinterhuf den Wassereimer um und jagte mit seinem Reiter davon.
»Du hast dir soeben einen Feind gemacht, Linhardt«, meinte der Droste. »Ich weiß nicht, ob du klug gehandelt hast.« Er ließ sich von Ursell den Becher reichen und trank das kühle Wasser in einem Zug aus. »Danke.«
»Klug oder nicht, Herr, ich weiß das Recht auf meiner Seite.«
Hanle Stecke ging zu seinem Hengst. Bevor er aufstieg, wandte er sich Linhardt noch einmal zu. »Recht hat am Ende immer der, der die Macht hat. Und das bist nicht du. Wenn du es dir also noch überlegen solltest, lass es mich wissen. Eine Bedenkzeit von drei Tagen kann ich dir zubilligen. Und überlege wohl. Es ist nie gut, einen Herzog zum Feind zu haben.« Sprachs und folgte Philip.
3
Burg Blankenstein, 13.Mai 1488
Er hat was gesagt?« Herzog Johann war außer sich. Er marschierte im Burgsaal auf und ab und machte Anstalten, das filigrane Hohlglas, welches er in der Hand hielt, auf dem Boden zu zerschmettern.
»Er lehnt es ab zu verkaufen, Durchlaucht.« Graf Stecke saß auf der Bank am Fenster und trank einen großen Schluck Wein. »Er ließ sich nicht überzeugen. Er meinte, Ihr hättet kein Recht, ein solches Geschäft zu verlangen. Als freier Mann sei er seinen Pflichten Euch gegenüber nachgekommen. Mehr könntet Ihr nicht von ihm fordern.«
»Und was sagt Ihr dazu, Graf?«
»Dass Linhardt von Linden recht hat.«
Johann brüllte los: »Ihr seid der Droste von Blankenstein. Dieser Bauer untersteht Eurer Gerichtsbarkeit! Ich will nicht wissen, ob er im Recht ist oder nicht, sondern ich will das verfluchte Grundstück, weil mir sonst dieser Mistkerl von einem Abt das Geld verweigert. Und Ihr, Graf, seid dazu da, meine Interessen zu vertreten.«
Stecke blieb trotz der Vorwürfe ruhig. »Genau das tue ich, Durchlaucht. Ihr könnt den Bauern in der Tat nicht zwingen, Euch das Nutzungsrecht zu überlassen. Ihr müsst Euch an das Gesetz Eurer Vorfahren halten, das wisst Ihr so gut wie ich. Und der Bauer hat Euch keinen Anlass gegeben, aufgrund dessen Ihr anderweitig an seine Wiese kommen könnt. Er ist seinen Verpflichtungen …«
»Haltet endlich das Maul!«, tobte der Herzog. »Wenn ich das schon höre: Recht. Gesetze. Ich bin das Gesetz in diesem Land. Ich bin der Herzog von Kleve und Mark!« Er lief zum Fenster, zeigte hinaus und machte dann mit der Hand eine kreisende Bewegung. »Das gehört alles mir.« Er klopfte sich theatralisch auf die Brust und schrie noch lauter als zuvor: »Mir, versteht Ihr!«
Stecke zog es vor, den Wutausbruch seines Landesherrn schweigend zur Kenntnis zu nehmen.
»Und Ihr, Freiherr, was habt Ihr getan? Euch ebenfalls nur angehört, wie mir dieser unverschämte Bauer verweigert, was mir zusteht?«
Philip von der Schadeburg hatte es dem Drosten überlassen, die schlechte Nachricht zu überbringen und zu gestehen, dass sie erfolglos geblieben waren. Sollte Johann seinen Missmut doch an dem Grafen abreagieren. Nun aber geriet auch er in die Schusslinie. Das musste er unter allen Umständen vermeiden, schließlich hatte er nicht vor, ewig nur Hauptmann zu bleiben. »Ich habe ihm gedroht, Herr«, erwiderte er in der Hoffnung, auf diese Weise Eindruck zu schinden.
»Und ihn damit in seiner Weigerung nur noch bestärkt«, warf der Graf ein. »Außerdem wolltet Ihr seine Frau schlagen.«
»Sie hat mich beleidigt«, verteidigte sich Philip empört.
»Das stimmt. Trotzdem wäre es klüger gewesen, zu schweigen.«
Der Herzog ließ sich auf eine Bank fallen. »Mir scheint, Ihr habt Euch beide nicht besonders geschickt benommen. Der eine unterstützt anscheinend diesen Linhardt in seiner Halsstarrigkeit, der andere bedroht dessen Frau. Freiherr, habt Ihr jemals etwas von Diplomatie gehört? Oder löst Ihr Eure Konflikte immer nur mit Schwert und Fäusten?«
Als Philip sich verteidigen wollte, hob der Herzog die Hand. »Kein Wort mehr. Von keinem von Euch. Lasst mich allein. Ich muss nachdenken.«
Philip von der Schadeburg war nach dieser Unterredung nach Hattingen geritten, um in einer der Herbergen in der Nähe des Marktplatzes seinen Ärger mit Bier zu lindern.
Der Freiherr entschied sich für das Weinhaus, aus dem lautes Stimmengewirr drang. Er näherte sich dem Gebäude und versuchte, durch die geschlossenen hölzernen Fensterläden einen Blick ins Innere zu werfen. Vergeblich. Es war zu dunkel. Der Lärm, den er hörte, ließ jedoch auf zahlreiche Gäste schließen. Das kam ihm entgegen. Um sich abzulenken, war ein volles Haus der geeignete Ort.
Philip ging zur Tür, drückte sie auf und betrat die Gaststube. Es dauerte ein wenig, bis sich seine Augen an das schummerige Licht gewöhnt hatten. Die meisten Plätze in der Schenke waren besetzt. Heute war Markttag. Reisende Krämer, Kleinhändler, ortsansässige Handwerker und die Bauern der Umgebung begossen ihre guten Geschäftsabschlüsse oder ertränkten ihren Kummer über leere Geldbeutel mit Wein oder Bier. Letzteres wurde in Hattingen selbst gebraut und war daher preiswerter zu haben als der Wein, der von weit her angeliefert wurde. Der Weinanbau auf den Ländereien der Stadt war aufgrund der schlechten Witterung in den vergangenen Jahrzehnten vollständig zum Erliegen gekommen. Und nicht nur Jorge und Linhardt von Linden mussten die Erfahrung machen, dass sich nicht jede Gegend für die süßen Trauben eignete.
Der Freiherr setzte sich an den letzten leeren Tisch an der linken Seite des Raumes und sah sich um. Um ihn herum hockten, ihrer Kleidung nach zu urteilen, Hattinger Bürger und Kaufleute auf Schemeln oder Bänken eng beieinander. Die Tranlampen erhellten die Szenerie nur unzureichend und sonderten obendrein Qualm ab, der stinkend im Raum hing. Noch mehr dieser Lampen und das Atmen wäre unmöglich geworden. Deshalb diente als zusätzliche Beleuchtung ein metallisches Feuerbecken, das in der Mitte der Stube an Ketten von der Decke hing. Darunter saß niemand, zu hoch war die Gefahr, durch herunterfallende, glimmende Holzstücke verletzt zu werden.
Im hinteren Bereich des Gasthauses befand sich die Küche. Über dem offenen Herdfeuer hingen zwei Töpfe, in denen vermutlich Suppe kochte. Die Wirtin, eine Frau von vielleicht dreißig Jahren mit prallem Busen und ausladenden Hüften, deren wallendes Haar nur mühsam von einer Haube in Schach gehalten wurde, fragte nach seinen Wünschen. Philip bestellte Bier und Brot.
Die Wirtin zeigte auf Philips Schwert. »Das brauchst du hier nicht.«
Philip ärgerte sich über die unziemliche Ansprache, beschloss aber, sie zu ignorieren. Er wollte sich unterhalten, nicht aufregen.
»Das Tragen von Waffen aller Art ist in den Schenken der Stadt durch den Rat untersagt worden«, insistierte die Wirtin erneut.
Mürrisch gürtete Philip ab und lehnte das Schwert samt Scheide griffbereit neben sich an den Tisch. Als die Wirtin danach greifen wollte, um die Waffe anderenorts aufzubewahren, schlug der Freiherr ihr auf die Finger. »Behalte deine Hände bei dir, Weib«, drohte er. »Sonst könnte es sein, dass du bald keine mehr hast.«
Erschrocken suchte die Wirtin das Weite. Kurz darauf stand der erste Krug Bier vor Philip, den er in einem Zug austrank. Dann orderte er einen zweiten.
Philip von der Schadeburg war vor vier Jahren als Siebzehnjähriger in die Dienste des Herzogs getreten. Er war der Spross einer Familie niederen Adels. Diese stammte aus einem kleinen Dorf namens Börnig. Sie besaß kaum Ländereien, eigentlich nur den Adelstitel. Ihr Familiensitz, von ihnen großspurig als Burg bezeichnet, war nicht viel mehr als ein nur unzureichend befestigtes Herrenhaus. Und der wenige Grund und Boden, den sie ihr Eigen nannten, lag im Emscherbruch. Dieses Gebiet wurde regelmäßig von Hochwasser heimgesucht und ähnelte einem Sumpf. Fast ihr gesamtes Einkommen erzielten die von Schadeburg, von einigen Kleinpächtern abgesehen, durch die Wildpferde, die sie im morastigen Gelände fingen, abrichteten und auf dem Markt des nahen Crange verkauften. Zu allem Übel lagen ihre Ländereien genau zwischen zwei Burgen, den Schlössern Strünkede und Bladenhorst, die wechselseitig entweder von den Herren zur Mark oder dem Kölner Erzbischof belagert wurden und mehrmals den Besitzer gewechselt hatten. Anfangs hatte die Familie von der Schadeburg noch versucht, in diesem Konflikt der beiden Mächte neutral zu bleiben. Aber dann drohte es ihnen zu ergehen wie dem Getreidekorn zwischen zwei Mühlsteinen: Sie mussten befürchten, zermahlen zu werden. Also entschieden sie sich für die Seite des Herzogs von der Mark und Kleve. Zum Beweis ihrer Treue trat der jeweils zweitälteste Sohn der Familie für den Rest seines Lebens in dessen Dienste. Er war der Zweite seiner Familie, dem dieses Schicksal widerfahren war, und wusste, dass er nur durch die Gnade seines Herrn von diesem heiligen Eid befreit werden konnte. Ein Bruch dieses Versprechens hätte das Ende derer von der Schadeburg bedeutet.
Zwei bunt gekleidete Spielleute bauten sich mit Fiedel und Flöte auf der Fläche unter dem Feuerbecken auf. Nach einer Eröffnungsmelodie setzte der Flötist sein Instrument ab und sang, während der Fiedler ihn begleitete.
Das Lied handelte von einem Burgfräulein, welches am Fenster ihrer Kemenate auf ihren Ritter wartete, der in der Fremde Heldentaten beging, im Kampf verletzt wurde und schließlich starb. Das edle Fräulein aber harrte den Rest seines Lebens auf ihrem Platz aus, hoffte auf die Rückkehr ihres Liebsten, aß und trank nicht mehr, bis auch sie das Zeitliche segnete.
Philip hatte solche Weisen schon häufig gehört. Nur waren sie sonst besser interpretiert worden als von den beiden Musikanten hier. Aber er versagte ihnen nicht den zustehenden Lohn, als sie nach dem Ende des Auftritts mit einer Kappe durch die Reihen der Zecher gingen.
Am Nachbartisch spielten drei Männer mit Würfeln. Philip sah hinüber. Als sie das Interesse des Adeligen bemerkten, fragte einer von ihnen: »Möchtet Ihr Euch anschließen, Herr?«
Philip, den sein mittlerweile drittes Bier milde gestimmt hatte, ließ sich dazu herab, zu antworten. »Wie hoch ist der Einsatz? Und was spielt ihr?«
Der Mann, der ihn angesprochen hatte, erklärte: »Wir spielen mit einem Mindesteinsatz von einem Pfennig. Und das Spiel nennen wir Kalter Schlag.«
Ein Pfennig. Das war etwa ein Zehntel eines Albus. Der Gegenwert des Brückenzolls für einen Berittenen. »Nicht viel. Und wie sind die Regeln?«
»Einfach, Herr. Wir benutzen drei Würfel. Der Vorleger, so bezeichnen wir den, der das Spiel eröffnet, schüttelt den Würfelbecher und stellt das Gefäß mit dem Boden nach oben auf dem Tisch ab. Er lupft ihn vorsichtig an und rechnet zusammen, welche Augenzahl sich aus den drei Würfeln ergibt. Natürlich achtet er darauf, dass seine Mitspieler nicht erkennen können, was er geworfen hat. Dann setzt er auf den Wurf. Wie gesagt, mindestens einen Pfennig. Die anderen versuchen, anhand des Einsatzes die Höhe des Wurfs zu erraten und entscheiden, ob sie das Spiel annehmen oder passen. Wenn sie sich beteiligen, müssen sie den Einsatz des Vorlegers mitgehen und denselben Betrag auf den Tisch legen. Haben sich alle entschieden, wird der Würfelbecher angehoben. Jetzt kann jeder Mitspieler den Wurf sehen. Der Vorleger reicht den Becher an den links von ihm Sitzenden weiter, der diesen Wurf übertreffen muss. Gelingt es ihm, erhält er den Einsatz. Verliert er, bekommt der Vorleger das Geld. Nach jeweils fünf Würfen übernimmt der nächste Spieler die Rolle des Vorlegers. Eigentlich ganz einfach.«
»Und gibt es eine Obergrenze beim Einsatz?«
»Ja. Einen Albus.«
Philip griff zu seinem Bierkrug. »Gut. Ich steige ein.«
Nach fünf Runden hielten sich Gewinn und Verlust die Waage. Philip bestellte ein Bier nach dem anderen. Langsam konnte er sich kaum noch auf den Beinen halten. So schenkte er einem vierten Mann, der sich bisher an einem der anderen Tische aufgehalten hatte, keine Beachtung, als dieser neben ihm Platz nahm. Immer dann, wenn Philip unter seinen Becher lugte, beugte sich auch sein neuer Sitznachbar hinüber und versuchte, ebenfalls einen Blick auf die Würfel zu erhaschen. Gelang ihm dies, gab er seinen Kumpanen verdeckte Zeichen. So kam es, dass Philip, wenn er einen hohen Wurf vorfand, keine Gegenspieler hatte, da diese alle passten, egal, wie zurückhaltend er setzte. Fiel sein Wurf jedoch auffällig niedrig aus, würfelten auch die anderen und er musste in der Regel an alle seinen Obolus leisten. Nach weiteren zehn Runden hatte Philip schon mehr als zwanzig Albus verloren, etwa den Wochenlohn eines Pfarrers. Er versuchte, den Verlust dadurch wettzumachen, dass er mit immer höheren Einsätzen immer waghalsiger spielte. Doch je mehr er riskierte, desto mehr verlor er.
In einem hellen Moment fielen ihm plötzlich die Handbewegungen auf, mit denen der Mann neben ihm Signale an seine Kumpane gab. »Ihr betrügt«, rief Philip empört, sprang auf, stolperte aber und stürzte. Da er sich nicht mehr aus eigener Kraft aufrappeln konnte, kroch er langsam über den Lehmboden, um zu seiner Waffe zu gelangen. »Ich werde euch erschlagen«, stieß er mit schwerer Zunge hervor, als er den Knauf seines Schwertes in der Hand spürte. Bevor er sich aufrichten konnte, packten ihn jedoch zwei kräftige Hände und zogen ihn hoch. »Lasst es bleiben«, raunte eine tiefe Männerstimme in sein Ohr. »In Eurem Zustand seid Ihr leichte Beute für diese Kerle.«
Der Alkoholnebel verhinderte, dass Philip genau verstand, was ihm da geraten wurde. Er versuchte, sich loszureißen. Seine Hände tasteten erneut nach der Waffe. Aber sein Schwertarm wurde nach hinten gerissen und festgehalten. »Es ist zu Eurem Besten«, meldete sich wieder die Stimme. »Und jetzt kommt.«
Philip wurde durch die Tischreihen hindurch nach draußen gezerrt. Seine Gegenwehr erlahmte. Aus den Augenwinkeln nahm er wahr, dass die Wirtin ihnen folgte und ihm seine Waffe nachtrug.
Erst auf dem Marktplatz erkannte Philip, dass der Mann, der ihn aus dem Wirtshaus geschleppt hatte, ein Mönch war. Die schwarz-weiße Ordenstracht wies ihn als Dominikaner aus. Er war bartlos, sein Haupthaar geschoren. Er überragte Philip um Haupteslänge. Seine Hände waren rau wie die eines Bauern, der Griff eisern. Er schien über Bärenkräfte zu verfügen.
»Lasst mich los«, herrschte der Adelige den Geistlichen an. »Ich nehme es mit den Gaunern gerne auf.«
»Dann lasst ihn doch in sein Unglück rennen, Vater«, meinte die Wirtin. »Vorher zahlt Ihr jedoch die Zeche. Danach könnt Ihr Euch meinetwegen von den vier Halsabschneidern massakrieren lassen.«
»Kennst du diese Kerle?«, erkundigte sich der Mönch, ohne jedoch den Griff, der Philip umfasste, zu lockern.
»Nein. Sie sind zum ersten Mal hier.« Und zu dem Freiherrn gewandt forderte sie: »Fünf Albus.«
»Ich würde ja, kann aber nicht«, stöhnte Philip.
»Wenn Ihr mir versprecht, vernünftig zu sein, kommt Ihr frei. Nur das Schwert bleibt in der Obhut der Wirtin, bis Ihr Eure Schuld beglichen habt.« Der Mönch sah Philip fragend an.
Der nickte. Kurz darauf griff er zu seinem Geldbeutel und händigte der Wirtin den gewünschten Betrag aus. Die drückte dem Mönch Schwert und Scheide in die Hand und kehrte an ihren Arbeitsplatz zurück.
»Jetzt hört mir zu«, bat der Mönch, »bevor Ihr unüberlegt handelt. Die vier Männer in der Schenke sind mit Sicherheit bewaffnet. Solche Scharlatane tragen ihre Kurzschwerter oder Dolche normalerweise unter ihren Gewändern. Wenn Ihr sie angreift, stechen sie Euch ab, ohne das geringste Zögern. Einen von ihnen werdet Ihr vielleicht niedermachen können, obwohl ich angesichts Eures Zustands daran zweifele. Aber einer gegen vier – das ist schon unter normalen Bedingungen keine einfache Sache.«
»Ich bin Soldat«, stellte Philip klar. »Ich habe schon so manchen Strauß ausgefochten.«
»Das glaube ich Euch gerne. Aber nicht so trunken, wie Ihr jetzt seid. Ich kenne Euch. Ihr steht im Dienst des Herzogs?«
»Ja.«
»Was habt Ihr an einem solchen Ort verloren?«
»Was geht Euch das an? Außerdem könnte ich dasselbe fragen.«
»Da habt Ihr recht. Nun, ich bin dort, wo meine Schäflein sind. Und Ihr braucht nicht zu antworten. Es geht mich wirklich nichts an.« Er reichte Philip die Waffe. »Da, nehmt. Nur denkt daran: Manchmal ist es klüger, nicht zu kämpfen, sondern auszuweichen.«
So etwas Ähnliches hatte Philip heute schon einmal gehört. »Dann lauft und holt Hilfe. Ich bewache den Ausgang und stelle die Vier, sollten sie sich herauswagen.«
Der Mönch lachte leise auf. »Ihr seid in der Tat noch sehr jung. Glaubt Ihr wirklich, die Männer, die Euch ausgenommen haben, sitzen noch in der Schenke und warten darauf, dass Ihr mit der Stadtwache zurückkehrt? Die sind hinten heraus und vermutlich schon vor einem der Stadttore. Lernt aus dem Vorfall. Euer Geld ist weg – besser als Euer Leben. Versucht in Zukunft, Euren Hitzkopf zu kontrollieren.« Mit diesen Worten wandte er sich zum Gehen.
»Bleibt noch einen Moment.« Philip wurde der Mund trocken. Er war es nicht gewohnt, auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein. »Danke für Euren Beistand«, presste er widerwillig hervor. »Wie werdet Ihr gerufen?«
»Man nennt mich Bruder Bernardo.«
4
Hattingen, 20.Mai 1488
Eine Woche nach dem Besuch der beiden Adeligen waren Linhardt und Ursell unterwegs zum Wochenmarkt in Hattingen. Der nächtliche Regen hatte die Wege aufgeweicht und der Ochse zog schwer an dem hölzernen Karren. Obwohl es leicht bergab ging, mussten Linhardt und Ursell mehrmals absteigen, weil sich ein Rad im tiefen Schlamm festgefahren hatte. Linhardt schob dann den Karren von hinten, während sein Weib den Ochsen am Nasenring zog. An einer Stelle musste Linhardt mit der Axt, die er vorausschauend noch kurz vor ihrer Abfahrt auf den Bock gelegt hatte, einige Äste schlagen und damit den Boden befestigen, sodass die Räder besseren Halt fanden. Gemeinsam war es ihnen jedoch immer wieder gelungen, ihr Fuhrwerk in Bewegung zu setzen. Es war voll beladen. Tönerne Töpfe und Trinkbecher in verschiedenen Größen lagerten in mit Stroh ausgepolsterten Holzkisten. Hinzu kamen Lebensmittel wie Käse und Eier, die Ursell feilbieten wollte.
Die alte Enndlin hatte den Vorschlag des Ehepaares freudig angenommen, ihre wenigen Habseligkeiten zusammengepackt und war auf den Hof umgezogen. Der Knecht hatte später das schon fertige Steinzeug und natürlich die Töpferscheibe abgeholt. Der Brennofen blieb zunächst an Ort und Stelle. Linhardt hatte vor, ihn später auf seinem Hof neu zu errichten. Bis dahin musste Enndlin eben einen etwas längeren Weg zurücklegen, wollte sie ihre Erzeugnisse brennen.
Sie näherten sich der Ruhrbrücke. Die Silhouette des Herrenhauses Cliff tauchte hinter den Bäumen auf.
»Gut, dass wir so früh aufgebrochen sind«, meinte Linhardt. »Wir dürften zu den Ersten gehören, die die Brücke überqueren. In knapp einer Stunde sind wir auf dem Markt.«
Ursell nickte. Sie freute sich auf die Abwechslung und beabsichtigte, bei einem der Tuchhändler Stoff zu kaufen. Das Kind unter ihrem Herzen brauchte nach der Geburt wärmende und weiche Kleidung.
Ursell hatte das Bessere ihrer zwei Oberkleider angezogen. Es war von dunkelblauer Farbe, bodenlang und hatte weite Ärmel. Darüber trug sie noch eine graue Schürze. Die neue Haube lag neben ihr auf dem Bock, sie würde sie erst aufsetzen, wenn sie den Markt erreicht hatten. Zu groß war Ursells Angst, dass ihr das Kleidungsstück beim ständigen Auf- und Absteigen vom Kopf rutschte und in den Schmutz fiel.
Das Paar vernahm das Wiehern eines Pferdes. Kurz darauf preschten vier Reiter auf sie zu, an ihrer Spitze Philip von der Schadeburg. Der Freiherr gab seinen Leuten ein Zeichen. Einer von ihnen führte sein Reittier so, dass es den ohnehin nicht sehr breiten Weg versperrte. Die anderen beiden platzierten sich links und rechts einige Schritte vom Karren entfernt. Philip hingegen brachte seinen Hengst unmittelbar neben dem Bock zum Stehen. »Sieh einer an«, meinte er zur Begrüßung. »Der widerspenstige Bauer und sein schönes Weib. Was für eine Überraschung.«
Linhardt senkte schweigend das Haupt.
»Hat es dir die Sprache verschlagen?«, blaffte der Freiherr. »Antworte!«
»Ich vermag nicht zu erkennen, dass Ihr eine Frage an mich gerichtet habt. Und«, fügte er mit Trotz in der Stimme hinzu, »gegrüßt habt Ihr ebenfalls nicht.«
Philip von der Schadeburg hob drohend die Gerte. »Wer bist du, mir Vorhaltungen zu machen?«
»Nur ein einfacher Bauer, der auf dem Weg zum Markt in Hattingen ist. Verzeiht, wenn ich Euch gekränkt habe«, entschuldigte sich Linhardt. Doch das Feuer in seinen Augen strafte seine Worte lügen. Für den Moment schien der Adelige besänftigt. Er trieb sein Pferd an und ritt zur anderen Seite des Karrens. Dort beugte er sich im Sattel weit vor, sodass er mit seiner Linken das braune Haar der Bäuerin erreichen konnte. Langsam zog er Ursells Kopf zu sich herüber, bis ihr Gesicht nur noch wenige Zentimeter von seinem entfernt war. »Wirst du mir den Gruß gewähren, der mir gebührt?«, fragte er leise. Dann griff er mit der rechten Hand an ihre Brust.
Ursell riss ihren Kopf so heftig zurück, dass ein Büschel Haare in der Faust des Edelmanns verblieb. »Ja, das werde ich«, fauchte sie. »Fahrt zur Hölle, Philip von der Schadeburg!«
Dieses Mal zögerte der Freiherr nicht. Blitzschnell schoss seine Faust vor und traf Ursells Gesicht. Ihre Augenbraue platzte auf, Blut lief über ihre Wange. »Ich werde dich lehren, einen Edelmann zu beleidigen, Bäuerin«, brüllte Philip. »Du wirst gleich meine Peitsche spüren und zukünftig jedem meines Standes mit Ehrerbietung begegnen. Das verspreche ich dir, Weib.«
»Ihr werdet nichts dergleichen tun.« Linhardt hatte sich erhoben und seine Frau nach hinten auf den Karren geschoben. Nun stand er Philip Auge in Auge gegenüber. »Herr, Ihr habt sie unsittlich berührt. Keine Frau mit Anstand, egal ob von hoher Geburt oder nicht, würde eine solche Tat unwidersprochen lassen. Nicht sie, sondern Ihr habt unrecht gehandelt. Lassen wir es dabei bewenden. Ich bitte Euch untertänigst: Gebt uns den Weg frei. Wir sind nicht auf Streit aus. Schon gar nicht mit Euch. Ihr steht im Dienst des Herzogs, so wie mein Vater früher. Würde er noch leben, wäret ihr Waffenbrüder an des Herzogs Seite.«
Philip lachte boshaft auf. »Ein Bauer, der mein Waffenbruder sein will. Welche Anmaßung! Ja, ich werde dein Weib und dich ziehen lassen. Nachdem sie ihre Strafe erhalten hat.« Er zeigte auf Ursell. »Packt sie!«, befahl er seinen Männern. »Bindet sie an den Baum dort.« Er warf einen lüsternen Blick auf Ursell. »Ihren Rücken werde ich eigenhändig entblößen. Vielleicht macht mir aber auch etwas ganz anderes mit deinem Weib Freude. Vielleicht binden wir dich ebenfalls an, Bauer, und du kannst dabei zusehen, wie wir uns mit ihr vergnügen. Wäre das nicht in eurem Sinne?«, rief er lachend den drei Soldaten zu.
Mit einem heiseren Schrei griff Linhardt die Axt, die neben dem Bock stand, machte einen schnellen Schritt nach vorne, stieß sich ab und warf sich auf Philip von der Schadeburg.
Der Angriff erfolgte so überraschend, dass der Freiherr nicht mehr in der Lage war, seinerseits zur Waffe zu greifen. Die Männer stürzten zu Boden. Der Hengst, der Kontrolle seines Reiters beraubt, tänzelte nervös um die Kämpfenden herum.
Linhardt hatte, dank des Überraschungsmoments, einen Vorteil errungen. Er lag auf dem Adeligen, der verzweifelt versuchte, sich zu befreien. Linhardts Hand tastete nach der Axt, die ihm beim Sturz aus den Fingern geglitten war. Erst als sich seine Faust um den Stiel ballte, erwachten die anderen Soldaten aus ihrer Erstarrung. Einer griff zu seiner Armbrust, legte hastig einen Bolzen ein, zielte, drückte schließlich ab.
Für einen Moment sah es so aus, als ob der Schuss Linhardt verfehlt hatte. Dann aber schoss ein Blutschwall aus seinem Mund und ergoss sich über Philip von der Schadeburg. Langsam senkte sich der Oberkörper des Bauern. Sein Blick wurde glasig, die Axt rutschte aus seinen Fingern. Schließlich fiel er zur Seite und blieb regungslos liegen.
Philip rappelte sich auf. Er stolzierte zu Linhardt und trat mit dem Fuß in dessen Brust. »Tot.« Und zu dem Schützen gewandt sagte er: »Das Fässchen Wein heute Abend hast du dir redlich verdient.«
Ursell hatte die kurze Auseinandersetzung und das Sterben ihres Mannes starr und mit weit aufgerissenen Augen verfolgt. Aber unvermittelt löste sich diese Lähmung. »Nein!«, stöhnte sie und griff zu dem Messer, mit dem sie sonst den Käse auf dem Markt zerteilte. Mit einer schnellen Bewegung schleuderte sie es auf Philip, der gerade dabei war, wieder sein Pferd zu besteigen.
Die Waffe traf den Adeligen am Hals und riss eine breite, aber nicht tiefe Wunde. Philip schrie auf. Er presste die Hand auf den Schnitt und sah dann zu Ursell hinüber, die breitbeinig auf dem Bock stand.
»Ergreift sie!«, befahl er zum zweiten Mal den Soldaten seines Trupps. »Aber lasst sie ungeschoren. Sie hat einen Hauptmann des Herzogs angegriffen – darauf steht der Tod.«
Ursell erkannte, dass sie keine weitere Möglichkeit bekommen würde, ihren Mann zu rächen. Auch an Flucht war nicht zu denken. Deshalb ergab sie sich in ihr Schicksal. Als sie an eines der Pferde gebunden wurde, stieß sie hervor: »Ich verfluche dich, Philip von der Schadeburg. Dich und deine Nachkommen. Wie du sollen sie für ewig in der Hölle brennen!«
Der Freiherr wandte sich ab und ritt davon, Hattingen entgegen. Seine Männer folgten ihm langsam, Ursell hinter sich herziehend. Schnell war der Freiherr außer Sichtweite. Der Ruf der Bäuerin jedoch gellte noch lange in seinen Ohren. »Brennen sollst du, Philip. Brennen.«
5
Burg Blankenstein, 20.Mai 1488
Herzog Johann hatte seinen Aufenthalt auf Burg Blankenstein immer wieder verlängert. Daran war eine hübsche Freifrau aus dem benachbarten Bochum nicht ganz unschuldig, welcher der Herzog den Hof machte. Bislang erfolglos, anscheinend war der adeligen Dame der Ruf Johanns als Schwerenöter nicht gänzlich unbekannt, und obwohl sie sich geschmeichelt fühlte, wies sie die Avancen ihres Landesherrn immer wieder zurück.
So verschob der Herzog seine Abreise Tag um Tag und wurde, da sein Werben nicht erhört wurde, immer ungehaltener. Insgeheim hofften nicht wenige der Bediensteten auf Burg Blankenstein, dass der Herzog endlich ans Ziel seiner Wünsche käme, damit er seine Untertanen nicht weiter mit seiner Übellaunigkeit traktierte.