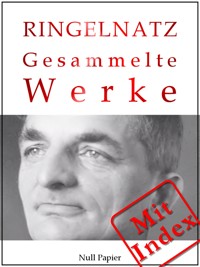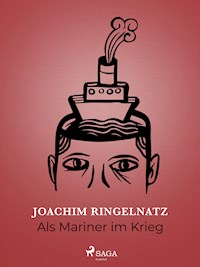
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Packend und mitreißend berichtet Joachim Ringelnatz über seine Zeit als Seemann der deutschen Marine im ersten Weltkrieg. Für den Kriegsdienst eingezogen, schildert er seine anfängliche Kriegsbegeisterung und Euphorie, aber auch das spätere Erwachen in den Schrecken des Kriegsgeschehens. Ein Lebensbericht der besonderen Art, der nichts verheimlicht und seinen LeserInnen einen authentischen Einblick in die Seemannswelt zwischen Kriegs- und Seefahrerromantik sowie bitterer Realität gewährt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joachim Ringelnatz
Als Mariner im Krieg
Saga
Als Mariner im Krieg
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1928, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728015827
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1 Einberufung und Kaserne
Ich weinte, während ich mein Testament schrieb. Es wurde ein ausführliches und in der Form korrektes Schreiben, darin ich Tante Michel, bei der ich wohnte, zur Universalerbin meiner sichtbaren wie auch unsichtbaren Hinterlassenschaft sowie meiner Schulden einsetzte. Falls Tante Selma nicht mehr lebte, sollten meine Eltern diese Erbschaft übernehmen.
Ich sprach dann in bewegten Worten über meine Stellung zum Tode und über mein bisheriges, vielfarbiges Leben, deutete an, wie oft ich Hunger gelitten und kein Obdach gehabt hatte, und was für schöne Pläne in mir gewesen wären. Ich erklärte, daß ich mir bewußt sei, auch viel Böses getan zu haben und bat alle Betroffenen und Gott, mir zu verzeihen.
Tante Selma ersuchte ich, nach einer beigefügten Liste gewisse Andenken an gewisse, mir teure Menschen zu verteilen. »Das Buch ›Aus der alten Fabrik‹ an Eichhörnchen ... einen Ring an Wanjka ... auch eine Kleinigkeit an Meta Seidler in Hamburg« usw.
Ferner fertigte ich eine zweite Liste an: Welchen Personen ich noch wieviel Geld schuldete (es waren insgesamt 318 Mark) und bat Tante Selma, wenn sie es vermöchte, auch das zu regeln.
Mein Testament schloß mit dem Wunsche, daß die Gottheit, an die ich glaubte, und die ich persönlich mit keiner kirchlichen Verbildlichung identifizieren könnte, meinen Angehörigen und meinen Freunden gnädig sein möchte.
Ich weinte noch, als ich das Manuskript kuvertierte, versiegelte und ins Geheimfach meiner altmodischen Truhe verschloß.
Denn nun war wirklich der Krieg erklärt. Ich dachte an Kriegsromantik und Heldentod, und meine Brust war bis an den Rand mit Begeisterung und Abenteuerlust gefüllt.
Nachts traf ich Freunde in der Torggelstube, denen ich mitteilte, daß ich mich nach der Instruktion zwar erst am zweiten Mobilmachungstage in Augsburg zu stellen hätte, daß ich aber es so lange nicht aushielte und deshalb schon morgen führe. Ich war der erste in der Tischgesellschaft dort, der in den Krieg zog. Alle staunten mich an, und der Anarchist Mühsam führte mich zu Frank Wedekind und sagte begeistert: »Du, Wedekind, der geht morgen in den Krieg!«
Danach wurde ich aber in eine Schlägerei mit einem Korpsstudenten vom Nebentisch verwickelt. Er hatte mißgünstig unser Gespräch belauscht, und indem er das Gehörte nun boshaft verdrehte, behauptete er laut: ich triebe englandfreundliche Politik. Der Wirt bat mich beiseite, zwei herbeigeholte Schutzleute verhafteten mich und führten mich in ein Auto. Unterwegs schenkten sie meiner ehrlichen und entrüsteten Erklärung jedoch Glauben und entließen mich unter der Bedingung, daß ich nicht in jene Weinstube zurückkehren würde.
Ich packte am nächsten Tage ein paar nötigste Reisesachen in ein Köfferchen und war ganz allein in Selmas Wohnung, denn die Tante weilte derzeit zur Kur im Ötztal. Und weil mich niemand zur Bahn brachte, mich aber in meiner sentimentalen Stimmung nach etwas Abschiedsherzlichkeit verlangte, betrat ich noch einmal den Laden meiner Zigarettenfrau. Auch fing ich noch den Briefboten ab, der mir Geld und ein Schreiben von meinem Vater brachte.
»Leipzig, den 1. August 1914. – Geliebter Gustav, Schicke Dir gleichzeitig mit diesem Briefe – zunächst 30 Mark per Postanweisung, bitte umgehend mich wissen zu lassen, ob Du mehr brauchst (was sehr möglich), dann erhältst Du sofort weiteres. (Bitte schreib es offen und ungeniert!!) Eine furchtbare Katastrophe bricht herein, ob durch die Dummheit oder die Falschheit des Zaren ist zur Zeit nicht klar. Begeisterung kann man bei solch einem schweren Fall die Stimmung, die allerorts (auch hier) in Deutschland herrscht, kaum nennen, aber das Gefühl der Treue für den Bundesgenossen und der männlichen Empörung für den niederträchtigen Friedensstörer ist auch etwas Schönes und Gewaltiges, alle Bedenken Wegfegendes.
Ich hoffe sehr, mein geliebter Junge, daß Du durch Deine Füße freikommst. Hermann und Hans Mitter sind beide, als Offiziere, bereits im Begriff einzupacken und sich zu stellen. Dem alten Mitter geht es sehr nahe, und auch Otti weint.
Die Lage bringt furchtbare Veränderungen hervor, und es ist noch gar nicht abzusehen, was alles daraus erfolgen wird.
Ich umarme und küsse Dich, mein lieber Gustav! Dein Pa.«
Der Zug nach Augsburg war überfüllt. Es machte einen seltsamen, großen Eindruck, so viel Menschen ernst und um einen allgemeinen Gedanken beschäftigt zu sehen, Leute, die einander ohne Worte innig zugrüßten, aus allen Provinzen zusammengeströmte Deutsche, die höflich zueinander waren, jeden Streit vermieden und sich alle als ein einig Volk fühlten. Nichts Gleichgültiges, nichts Läppisches wurde gesprochen. Allenthalben hörte man ruhige gütige Worte, klare Auskünfte, knappe Berichte von Neuigkeiten.
In Augsburg bezog ich ein kleines Hotel und besah mir aus Geld, Freiheit und Unbekanntsein heraus das öffentliche Treiben. Die ganze Bevölkerung verkehrte in den Straßen und Gaststätten wie familiär. Man scharte sich um Plakatsäulen, die dauernd mit Meldungen über neue Fortschritte beklebt wurden. Eine arme Frau sprach mit einem reichen Herrn über die bevorstehende Teuerung. Stündlich tauchten neue Gerüchte auf. Man hatte einen französischen Flieger bei Nürnberg gefangen. In München waren aufrührerische Leute erschossen worden. Die Russen waren bereits in deutsches Gebiet eingedrungen.
Etwas wie ein Gruseln ging durch alle, und auch die ruhigdenkendsten Leute waren tief ergriffen von dem Gedanken des Weltbrandes.
Abends saß ich im »Grünen Haus« bei Moselwein und redete mir als Ahnung ein, daß ich meine Freunde und Verwandten nimmer wiedersehen würde. Wie gut, daß ich alles noch geordnet, mein Testament gemacht und auf dem Leihhaus meine Pfänder eingelöst hatte.
Demonstrationen, Jubelhymnen auf den Krieg und den Dreibund, Laufereien um Paß und Ausweise, Zweifel, ob wir losschlagen würden oder nicht, schlaflose Nächte. – Es lag eine Zeit voll Spannung und Aufregung hinter mir. Ich war blaß, hatte starken Husten und bei der Schlägerei in der Torggelstube hatte ich mir Finger verstaucht. Zudem war ich etwas traurig darüber, daß ich Anno 1903 als Einjähriger auf die Reserveoffizierslaufbahn verzichten mußte, weil mir das nötige Geld fehlte; nun würde ich als Unteroffizier gewiß unter viel rohes Volk geraten.
Indessen der Wein im »Grünen Haus« war gut. Das erste Glas den Eltern und Geschwistern! Das zweite Tante Selma! Das dritte für Eichhörnchen; das liebe Mädchen hatte mir von dem knappen Salär, das sie als Hauslehrerin bezog, noch tags zuvor Reisegeld gesandt.
Am Nebentisch saß ein Offizier in Uniform. Ich erkannte in ihm einen Arzt, mit dem ich früher oft vergnügt gezecht hatte. Erfreut eilte ich auf ihn zu, wünschte ihm guten Waffengang und erzählte, daß auch ich morgen – allerdings nur als Unteroffizier – er erwiderte kühl und lud mich nicht an seinen Tisch.
Plötzlich draußen anhaltendes, brausendes Vivatrufen. Einige Abteilungen Infanterie und Kavallerie zogen aus, alle neu und blank ausgerüstet, mit herrlichen Pferden. Gott mit ihnen! Eine große Zeit! dachte ich und bestellte noch eine Flasche »Wachenheimer Luginsland«.
Das Lokal füllte sich mit Offizieren, die alle Gesellschaft, mindestens jeder eine Dame bei sich hatten. Meine Einsamkeit und der Wein stimmten mich etwas kritisch. Ich trat hinaus in die warme Sommernacht. Überall nationale Lieder. Aus einem Kaffeehaus wurde ein junger Mann geworfen, den die Menge draußen mit Füßen und Stöcken jämmerlich zurichtete, weil er bei einer Ovation sich nicht vom Stuhle erhoben hatte.
Nach unruhiger Nacht begab ich mich pünktlich zur Sängerhalle am Stadtgarten. Ich zeigte meine Papiere, und weil daraus hervorging, daß ich seinerzeit als Bootsmannsmaat entlassen war, wurde ich durch eine Armbinde als Zugführer gekennzeichnet. Etwa tausend ehemalige Mariner waren zusammengeströmt, Matrosendivision, Seebataillon, Maschinenpersonal usw. Sie sollten um zehn Uhr nach dem Norden abtransportiert werden. Nur wer »partout krank« wäre, sollte sich melden. Nur einer tats. Selterwasser in Flaschen und einpapierte Frühstücksbrote wurden verkauft.
Ich ward als Führer einem Kupee zugeteilt, das achtundvierzig Menschen enthielt, rote, verbrannte, größtenteils tätowierte Gestalten. Einige hatten ihre ehemaligen Uniformen an; wir anderen in Zivilkleidern sahen aus wie Leute aus dem Asyl für Obdachlose. Auf jeder Station wiederholte sich dasselbe: Unsere Leute ließen sich nicht halten, sondern stürmten über Geleise und Wagen, über Zäune und Mauern in die Stadt, und obwohl nirgends alkoholische Getränke verabfolgt wurden, kehrten doch alle mit Bier zurück. Mehrere tausend bayrische Bierkrüge reisten gen Norden. Einmal kam es zu einem Krach. Ein Offizier befahl einem Manne, der sechs Maß Bier anbrachte, diese in den Sand auszugießen. Anfangs weigerte der Mann sich. Einige Kameraden riefen ihm zu: »Tu es doch!« Da tat er es. Aber erst als der Offizier ihm den Verlust reichlich bezahlte, legte sich die Erregung über den Vorfall, der mehr Aufsehen machte als die Nachrichten, die in Würzburg verteilt und multipliziert wurden: daß die russische Ostseeflotte vernichtet und daß Peter von Serbien mit zwanzigtausend Mann gefangen sei.
Mit Kreide wurde Peter am Galgen auf die Außenwand des Waggons gezeichnet und darunter geschrieben: »Die serbischen Raben mögen nun Peterchen fressen samt seinen Läusen!« Um das Bild hingen wir Speckschwarten. Andere Wagen dekorierten wir mit Tannengrün.
Unsere Fahrt war ein strapaziöser Triumphzug. Auf jedem Bahnhof empfing uns eine Hurra rufende Menge, und wir gaben aus unserem Viehwagen Hurra zurück oder sangen mit total heiseren Stimmen die wenigen Zeilen, die wir von unserem Marinelied wußten »Stolz weht die Flagge ...« Dabei ward unaufhörlich nach Bier, Limonade und Zeitungen verlangt. Aus allen Dörfern, die wir passierten, von allen Landstraßen, aus den Feldern, überall winkten uns Mädchen und Feldarbeiter zu; alte Frauen weinten, daß mir selbst mitunter die Augen feucht wurden. Aber die meisten von uns begriffen das nur halb und lachten und witzelten. Nur wenn man sie nach ihren zurückgelassenen Frauen und Kindern ausfragte, wurden sie für Momente ernst.
An der Bahnstrecke entlang standen ergraute Landsturmleute mit Gewehr als Wachen, oft Vater und Sohn zusammen. Uns ward bekannt gegeben: Wer den Bahnkörper beschädigt, wird sofort erschossen.
Lange Züge entgegengesetzter Richtung mit Militär, Kanonen und Pferden donnerten an uns vorbei und das Hurra war ein kurzer, gigantischer Schrei. Im Fenster neben mir saß ein Mann, der durchaus die Beine an die Luft hängen wollte, so daß ich vor jedem Tunnel um ihn bangte. Als abends eine allgemeine Müdigkeit einsetzte, legte ein ungeschlachter Kerl seinen Kopf in meinen Schoß wie ein Kind.
Und weiter gings. Unsere Lampe war ausgebrannt. Ich saß lange draußen auf der Plattform, rauchte eine Zigarette nach der andern und sann, während der Qualm der Lokomotive mir Mund, Nase und Augen mit Ruß füllte. Mein Husten ward elefantisch, und meine Stimme ging auf Urlaub. So kriegte ich kein »Danke« heraus, als ein langer Bursche, der mit dem Kopf in meiner Achselhöhle lag und mit den Beinen irgendwo oben hing, mir plötzlich drei Bonbons in den Mund schob.
Allerorts brachte man uns neue Gerüchte zu. Leute waren erschossen, weil sie einen Bahntunnel sprengen wollten. »Hier war soeben vor unserer Ankunft eine sonderbar verschleierte Frau den Berg hinauf geflüchtet und wurde nun verfolgt.« Man hörte das heimlich schauernd und schlief wieder ein. Wenn der eine einschlief, ward ein anderer gerade einmal wach und warf irgendein Scherzwort in die Stille. »Bildet mal einen Satz mit Weißwürst,« rief ein Bayer in seinem Dialekt und gab gleich selbst die Lösung: »Wer weiß würst du mich wiedersehen?« Jemand wollte ein Lied anstimmen, aber alle Lieder waren schon abgesungen, wir waren schon elf Stunden unterwegs. Ein anderer fragte, wie wir in Wilhelmshaven verteilt würden, ob wir gleich auf Schiffe kämen usw. Aber keiner wußte mehr als der andere oder mehr als nichts. Und bis Wilhelmshaven waren mindestens noch elf Stunden, man schnarchte weiter. Ich rechnete mir aus, daß ich seit ungefähr einer Woche auch nicht einmal so geschlafen und gegessen hatte, wie es ein normaler Mensch benötigt. Trotzdem – vor Aufregung – spürte ich weder Hunger noch Müdigkeit.
Der Transport führende Offizier kam keinen Moment zur Ruhe. Er tat mir leid, ich bot ihm meine Hilfe an. Er bat mich nur, ihm etwas Trinkwasser zu besorgen. »Durst!« schrie es aus allen Mündern, aus allen Augen und aus den Tausenden von leeren Maßkrügen.
In vielen Gegenden waren – hieß es – als Frauen, zumal als Nonnen, verkleidete Spione verhaftet. In Bebra war ich ausgetreten und fand meinen Zug nicht wieder. Aber schon ziemlich abgestumpft und abgespannt setzte ich mich in den Warteraum, schrieb dort Tagebuch und hörte gleichzeitig mit wachsender Bissigkeit auf ein recht blasiertes Zivilistengespräch. Auf einmal vernahm ich drei Hurras. »Ist das Marine?« frug eine Stimme. »Ja!« Ich sprang, ohne meine Zeche zu bezahlen, aus dem Fenster, sah einen rollenden Zug und erreichte mit einem kühnen Sprung den letzten Wagen. Als ich beim nächsten Halt mein Abteil aufsuchte, brachte mir meine Mannschaft eine Ovation.
Sie hatten ihren Waggon inzwischen mit einem Sielrohr armiert, durch das sie leere Selterwasserflaschen schossen. Der ganze Zug war mit Tannenkränzen und Girlanden und die Lokomotive über und über mit Bierseideln behängt.
In Niederhofen ward einer unserer Leute wahnsinnig. In Wunsdorf bei Hannover verteilten Damen Erfrischungen. Ich schenkte einem hübschen, bezopften Mädchen ein seidenes Tuch, notierte mir ihre Adresse Elly Meyer, Wunsdorf bei Hannover, Südstraße 3 und verabredete, das seidene Tuch – wenn ich zurückkehren sollte – gegen zwei Küsse nicht wieder einzulösen. Eine alte Dame drückte herzzerbrechend weinend mir die Hand: »Schlagen Sie diese Russen!«
Wir fuhren durch entzückende Wälder und Täler. Die Vogelbeeren leuchteten und erinnerten mich wehmütig an Burg Lauenstein.
Als wir in Nienburg lagen, lief ein anderer Zug ein, der von Bremen kommend österreichische Soldaten nach der französischen Grenze beförderte. Plötzlich verbreitete sich das Gerücht, ein russischer Spion hielte sich in diesem Zuge versteckt. Im Nu hatten wir tausend Mariner uns mit Steinen und Brettern bewaffnet und stürmten den Zug unter Ausrufen wildester Wut. Alle Wagen wurden außen, innen, oben und unten durchsucht. »Hier ist er!« Alles raste nach hinten. »Hier ist er!« Alles raste nach vorn. Und dann fanden sie ihn unter der Lokomotive. Während er hervorgezogen wurde, bekam er schon blutige Schläge auf den Kopf, bis er sich als einer unserer eigenen Leute erwies. Er war von der einen Seite suchend unter die Lokomotive gekrochen, und von der andern Seite hatte man ihn als Spion hervorgeholt.
Der Bahnhof Oldenburg bereitete uns einen eindrucksvollen Empfang. Schöne, große Frauen überschütteten uns mit Aufmerksamkeiten. Unsere Bayern, besonders diejenigen, die noch kurze Wichs trugen, sangen ihnen zum Dank Schnadahüpfel oder melancholische Heimatlieder und tanzten Schuhplattler vor. Wieder sprach und tröstete ich, so gut ich vermochte, eine schluchzende alte Dame, die drei Söhne und den Mann an die Front gegeben hatte.
Wir fuhren nicht, wir schlichen. Man hatte Angst vor Sabotagen durch Spione. Endlich tauchte Wilhelmshaven auf. »Morgenrot ...« stimmten wir an, und ein Virtuose verstand es, dazu die Trompete zu imitieren. Doch der Gedanke: Jetzt kommen wir alle an Bord! frischte die abgespannten Gesichter auf.
Wie enttäuscht waren wir, als unser Zug in weitem Bogen um die Stadt nach der düsteren Kaserne geführt wurde, wo schon Tausende Leute wie wir in Zivilkleidern seit einem, seit zwei, sogar drei Tagen warteten, ohne erfahren zu können, was aus ihnen würde. Sie schimpften darüber, daß auch in bezug auf Verpflegung, Schlafdecken usw. kein Mensch sich um sie kümmerte. Mich deprimierte am meisten die Mitteilung eines Obermaats, daß die Seewehr – wozu ich gehörte – überhaupt nicht auf Schiffe käme. Ich hatte mir vorgenommen, gleich anfangs um einen besonders gefährlichen und hohe Anforderungen stellenden Posten zu bitten. Nun irrte ich bedrückt mit den anderen durch die stinkenden Schuppen, wo die Leute dicht an dicht im Stroh lagen und dann wieder in dem sumpfigen Hof herum, auf dem klägliche Waschkübel mit schmutzigem, fettigem Waschwasser standen. Darin wusch auch ich mich endlich und trocknete mich mit meinem Nachthemd ab.
Unter all den bunten Gerüchten, die dort kursierten, erregte die Nachricht von Englands Kriegserklärung unser höchstes Interesse, hatten wir doch einen höllischen Respekt vor der englischen Flotte.
In Wilhelmshaven und Umgebung waren Brot und die wichtigsten Lebensmittel ausgegangen. Ich schloß mich unbemerkt einigen Leuten an, die eine Kneipe wußten, wo es wenigstens Fisch gab. Zurückgekehrt, mußten wir wieder einmal antreten, abzählen, warten, wieder auseinandertreten und weiter warten, ohne daß sich irgend etwas für uns änderte. Derweilen trafen immer neue Mannschaftstransporte ein. Das Bild dieser Massen lud gewiß zu malerischen und anderen reizvollen Betrachtungen ein, aber wir hatten keinen Sinn dafür. Wir hatten seit drei Tagen nicht Kleider, Strümpfe und Schuhe gewechselt, noch ein Bett gesehen; wir waren ungeduldig, und murrten über das unsinnige Stehen und Warten. Infolge des langen Sitzens im ratternden Bahnwagen standen meine Beckenknochen wie Schmetterlingsflügel ab. Auch mein Fußleiden, ein Ekzem, das mir seit Jahren zu schaffen machte, hatte sich verschlimmert, und ich fürchtete, was mein Vater erhoffte, daß man mich wegen dieser Krankheit für dienstuntauglich erklären würde. Als wir aber schließlich durch ein Bad zur ärztlichen Untersuchung kamen, ward ich, und wurden, soweit ich das verfolgte, nach kurzem Abklopfen alle für tauglich befunden, darunter Leute, die soeben erst von der Ruhr und Pest genesen waren. Würde ich nun auf ein Schiff kommen?
Auch in den Büros der Kaserne herrschte ein grelles Durcheinander. Treppauf, treppab. Türen klappten, Befehle und Telefongespräche überstürzten sich, und die jungen, rosigen Schreibstubenmatrosen hatten es heiß damit, die verwickelten Paßangelegenheiten zu entwirren. Von und nach den Bekleidungsämtern und Proviantämtern wogten Berge von blauen Hosen, Kommißbroten, Schuhwerk und anderem. Es war kaum zu begreifen, daß das alles an Fäden lief.
Wir wurden instruiert, wie man sich feindlichen Luftschiffen und Flugzeugen gegenüber zu verhalten hätte. In den Straßen durfte kein Licht brennen. Auf den Dächern standen Posten, die des Nachts häufig auf angebliche Flieger schossen und offenbar sehr gern schossen.
Endlich standen im Hof ein paar tausend Mariner, ausgerüstet bereit, an Bord zu gehen. Ein kurzer Gottesdienst; die Musik spielte einen Choral. Dann flogen die Kleidersäcke auf Handwagen und ab marschierten die Beneideten.
Wir, die wir von Augsburg kamen, wurden nun getrennt und eingekleidet. Ich kriegte eine Hose, die Kilometer zu lang und zu weit war, und Stiefel, die mich an der Ferse drückten. Aber alles Jammern half nichts, die Schuster und Schneider waren schon unabsehbar überhäuft mit Reparaturaufträgen. So erfand ich eine List nach der andern, um zu einer neuen Hose, später auch noch zu einer neuen Jacke zu kommen. Viele andere Leute begingen ähnliche Schwindeleien, denn die Bekleidungsstellen hatten für Kontrolle keine Zeit. Meine jämmerlich zugerichteten Zivilkleider mußte ich verpacken und mit der Adresse meiner Eltern abgeben. Ich legte einen herzlichen Abschiedsbrief an Vater und Mutter bei, in welchem ich fragte, ob mein Bruder auch eingezogen sei, und ob ich etwas Geld bekommen könnte.
Mit einem Dutzend anderer Leute wurde ich der dritten Kompanie zugewiesen. Man gab uns eine Kasernenstube mit Betten. Da wir aber in diesen Betten noch schlafende Fremdlinge fanden, die sich partout nicht aufwecken ließen, und weil wir kurz zuvor pro Mann zwei Mark als Ersatz für unsere Reisespesen erhalten hatten, so eilten wir zur Kantine, wo ich mir Grog und Malzbonbons gegen meinen Mammut-Husten kaufte und mich mit Notizbüchern versah. Auch traf ich dort Kameraden, die mich aus München oder das eine oder andere Gesicht von mir aus Zeitschriften kannten.
Ich hatte mir mit der Begründung, meine Hose bei einem Zivilschneider abändern zu lassen, einen Passierschein verschafft, den ich zu einem Dauerpaß fälschte. Damit verließ ich abends die Kaserne, wo ich sowieso weder Bett noch Decke noch einen Tisch bekam.
Zwei Damen, die mit ihren Kindern belegte Brote als Liebesgaben zu unseren Soldaten brachten, erklärten sich auf meine Anfrage bereit, mir in der Stadt ein Zimmer zu vermieten. Sie führten mich zum Lehrer Mechau in Rüstringen, der mir in einem Klassenzimmer der Schule ein Lager bereitete, und mich vortrefflich bewirtete. Morgens schlich ich mich dann wieder in die Kaserne. Herr Mechau nahm keine Bezahlung von mir. Der Schneider, der meine Hose kürzte, nahm keine Bezahlung. Eine Dame, die sich erboten hatte, mir die Namenläppchen in mein Unterzeug einzunähen, lehnte ebenfalls jede Vergütung ab. Im Gegenteil, alle diese Leute bewirteten und beschenkten mich noch obendrein und führten mich zu neuen Gönnern. Ganz anders erging es uns Mannschaften in den Wirtshäusern. Dort war ein Matrose oder ein Maat eben nur einer von Tausenden, ein »Kuli«. Ob einer hinzukam oder wegblieb, war dem Wirt gleich, sein Geschäft florierte wie nie zuvor.
An meinem Geburtstage wollte ich eine stille, gute Flasche Wein trinken und dabei möglichst nicht unter Matrosen sein, deren Kriegsgeschwätz mir auf die Dauer doch langweilig wurde. Ich erkundigte mich bei einem Schutzmann, wo das vornehmste Weinhaus wäre. Er nannte mir Trokadero, fügte aber mit einer entsprechenden Handbewegung hinzu: »Das ist viel zu fein für euch Kulis!«
Als ich abends zur Kaserne zurückkehrte, ward ich vom Posten angehalten und zur Wache gebracht, weil ich die Parole nicht wußte, und man meine Paßfälschung erkannte. Indessen war weder Zeit noch Raum da, die vielen Paßschwindler einzusperren, und so entließ man mich, nachdem man meinen Passierschein zerrissen hatte. Ich schlich mich auf das Zimmer der dritten Kompanie. Da fand ich alle Betten und auch jeden Fleck am Boden mit Schlafenden belegt. Plötzlich rief einer derselben mir zu: »Bist du's?« »Ja«, flüsterte ich. Er lüftete einen Zipfel seiner Decke und sagte müde: »Komm her! Ich habe zwei Decken für uns ergattert.« Schnell warf ich Hose und Hemd ab und kroch zu ihm unter die Decke, mich des knappen Raumes wegen eng an ihn anschmiegend. »Ach«, rief er enttäuscht, »ich dachte, du wärst der Signalmaat von der Wettin.« Ich schnarchte. Leider lagen wir am Fenster, wo es scheußlich zog. Ich feuerte Salven grünen Hustens in die Nachbarschaft. Am nächsten Morgen ward Antreten zum Appell gepfiffen und gerufen. Jedermann fürchtete, zum Kohlenschaufeln oder zum Exerzieren abkommandiert zu werden. Jedermann versuchte, sich irgendwie beiseite zu drücken. Die, denen das gelang, trafen sich dann im Kasino beim Grog wieder. Aber häufig wurden sie dort alle wieder ausgehoben. Die Gewieftesten aber schnallten sich ihr Seitengewehr um und schlossen sich, als wären sie im Dienst, irgendeinem Trupp an, der gerade die Kaserne verließ. Draußen, hinterm Tor, versteckten sie ihr Seitengewehr im Hosenbein und gingen spazieren. Wer hätte sich die vielen Gesichter und Namen merken können.
Ich erhielt telegrafisch fünfundzwanzig Mark mit Gruß und Kuß von den Eltern. Auch erreichte mich, was bei dem Durcheinander durchaus nicht sicher war, mein Unterzeug. Jene Dame hatte die Namenläppchen so sauber eingenäht, daß mir der Feldwebel später ein Lob erteilte. Ich rauchte vergnügt meine Shagpfeife, die ich »Lulu« getauft hatte.
Was tat man nicht alles, um aus der Kaserne zu kommen. Man erbettelte Urlaub wegen Zahnschmerzen, wegen Haare schneiden, und wenn das nichts nützte, fand man andere Wege. Der Dienst kam besonders uns altgedienten Soldaten recht überflüssig vor. Wir wußten nicht mehr viel davon. Auch das Grüßen in der Stadt bereitete uns anfangs Schwierigkeiten. Es waren seit unserer Dienstzeit so viel neue Abzeichen eingeführt worden. Zum Glück nahmen es auch die Vorgesetzten derzeit mit der Grußpflicht nicht so genau.
Nachts schlief ich auf Stroh unter einer Treppe. Ich fühlte mich von Tag zu Tag energieloser werden und sehnte mich an Bord nach Strenge und Arbeit. Versuchte ich aber, mit solchen Wünschen mich einem der Offiziere zu nähern, so stieß ich jedesmal auf krasse, entmutigende Ablehnung. Es war nicht Zeit für individuelle Behandlung.
Immer wieder antreten, abzählen, stillstehen, während lange, nach Feldwebelschweiß riechende Listen verlesen wurden, exerzieren in der Hitze, Kohlen schaufeln oder »Wache schieben«. Dazu waren auch unsere Privatgelder ausgegangen. Im Unteroffizierskasino fand ich keine Partner mehr für Schach und Billard. Man las etwas Zeitung, las über Lüttich und vom Sinken eines englischen Dampfers. Aber die Begeisterung flammte nicht auf, wir waren in unserer Mühle abgestumpft und müde und priesen einen Mann glücklich, der entlassen wurde, weil er an der linken Hand nur vier Finger hatte. Obwohl der Stabsarzt meinte, das wäre genug zum Draufhauen. Das Essen blieb sich zum Überdruß gleich. Einige reinigten ihre Blechschüsseln im Sande des Hofes, andere sah man mit dem Tischmesser auch Stiefelsohlen und Fingernägel beschneiden.
Immer neue Schübe von Zivilisten kamen an. Die armen Kerle lagen mißmutig wartend im Hof und in den Rasenanlagen herum. Die Passierscheinkontrolle war streng geregelt worden, es gab nur noch in beschränktem Maße Stadturlaub.
Der Mißmut machte sich in Anschnauzern und Zänkereien Luft, wozu oft die geringfügigsten Anlässe herhalten mußten. Beim Infanteriedienst war ein scharfer Schuß gefallen, vermutlich hatte ein Posten bei Ablösung vergessen, das Gewehr zu entladen. Ich verprügelte den kleinen Moritz, weil er auf meinem Zeugsack geschlafen und dabei mein Nähzeug zerdrückt hatte. Besonders aber spitzte sich der Kampf um ein Bett zu. Wer noch immer keins hatte, der suchte sich eins zu stehlen oder eins mit Gewalt einzunehmen, und wer eins hatte, mußte, wenn er abends in die Stadt ging, befürchten, daß es ihm gestohlen oder zum Beispiel von Leuten eingenommen wurde, die ihr Vorrecht damit begründeten, daß sie von Wache kämen, also ernsthaft Dienst verrichtet hätten und nicht, wie wir, nur Heimarbeiter und Faulenzer wären. Eines Tages wurden aber alle Betten und Spinde in unserer Stube frei, weil die für den Kreuzer »York« bestimmte Mannschaft ausrückte. Wir waren selig, diese Kerle losgeworden zu sein, packten unsere Kleidersäcke aus und richteten uns endlich einmal ein, wie sich's gehört. Spiegel, Ansichtskarten und Fotografien von Bräuten wurden angenagelt, und als wir mit allem fertig waren, kam uns der Befehl zu, sofort nach einer Stube im obersten Stock zu übersiedeln, wo es wieder keine Spinde und nur Strohsäcke gab.
Auch dem Abendurlaub waren keine Reize mehr abzugewinnen. Die wenigen Frauen in Wilhelmshaven hatten bestenfalls nur für Offiziere etwas übrig, und was sonst herumlief, waren Mariner oder Seebatailloner, daß einem der Arm vom Grüßen lahm wurde, sonst nur noch Schlachter, Papierhändler, Uniformschneider und Wirte, Leute, die größtenteils die Kulis verachteten, obwohl sie von ihnen lebten.
Es erwischte auch mich eines Tages, zum »Kohlen« abkommandiert zu werden. Das galt schwere und vor allem schmutzige Arbeit zu verrichten, und mir grauste davor, obwohl es Löhnungszulagen dafür gab, und ich als Unteroffizier selbst weder schaufeln noch Körbe dabei zu schleppen brauchte. Brummig rückten wir nach dem Südhafen ab, wo mehrere Torpedoboote und auch große Schiffe lagen und unter den Klängen ihrer Bordkapellen Kohlen einnahmen. Wir sollten für die »Straßburg« arbeiten, wurden dort aber zu unserer Freude wieder weggeschickt, weil bereits andere Leute kohlten. Ganz langsam, Pfeife rauchend, Mädchen grüßend und Lieder pfeifend, marschierten wir zurück. In der Kaserne grollte ein böses Donnerwetter. Der neue Abteilungschef inspizierte und war sehr unzufrieden. Es sollten strengerer Dienst und straffere Disziplin eingeführt werden. Das war zweifellos nötig und wurde wohl beschleunigt, weil man einen neuen Divisionskommandeur erwartete, Herrn von Meerscheit-Hülsen. Dieser populäre Kapitän schritt am nächsten Vormittag bei Musik die peinlichst ausgerichtete Front ab und hielt hinterher eine etwas schwülstige, aber sehr anständige Rede, die mit drei Hurras auf den Kaiser endete, der ihn aus dem Zivilstand einberufen hätte. Der Kommandeur sagte unter anderem: Unsere Bekleidung, Verpflegung und Versorgung seien etwas mangelhaft, doch käme das daher, daß außer den erwarteten Mannschaften noch tausend Mann mehr sich freiwillig gestellt hätten. Hatten wir beim Antreten und Vorbereiten zum Teil gelacht und gemurrt, so stand jetzt, während dieser Ansprache, alles straff und mäuschenstill. Gewehre und Koppelzeug blitzten in der Sonne, und die windgepeitschten Mützenbänder kitzelten unsere Nacken. Dann folgte die Besichtigung der Räumlichkeiten. Herr von Meerscheit-Hülsen sagte mir, der ich als Ältester von uns Meldung zu erstatten hatte, daß unsere Stube sehr sauber und im Vergleich zu den anderen ein Paradies wäre. Seitdem hießen wir nur noch die Paradiesvögel.
Wir ließen uns noch selben Tages fotografieren, und ich schrieb im Ratskeller, wo ein Stammtisch mir Wein und Radieschen spendierte, wohlgelaunte Briefe.
Mein liebster Stubengenosse wurde Toni Pfeiffer, der von Beruf Rheinschiffer war und darüber witzig zu plaudern wußte, wenn wir uns in der Kantine unseren Schlafballast antranken. Es gab auch unangenehme, ja tückische Leute bei uns, und ich mußte mit Rücksicht auf ihr Alter so viel Dürftigkeiten und Dummheiten mitmachen, daß ich die erste Gelegenheit benutzte, mich freiwillig auf Torpedo-Werft-Wache zu melden.
Ich kam auf die sogenannte Alte Wache. Mit sechs Mann, die abwechselnd zwei Stunden lang mit aufgepflanztem Bajonett auf dem Pulverprahm standen, um aufzupassen, daß kein Boot dort landete. Wer nicht Parole wußte und sich verdächtig machte, auf den sollte geschossen werden. Parole war »Metz«.
Unser Wachtlokal enthielt zwei Pritschen, ein Pult und ein Wachtjournal, das bis zum Kriegsausbruch mit unorthographischer Gewissenhaftigkeit amüsante Protokolle über Verhaftete enthielt. Ich füllte nach Absitzen der vierundzwanzig Stunden alles aus, was ich auszufüllen hatte, und in die Rubrik »sonstige Vorfälle« schrieb ich:
Kein Feind, kein Schuß, kein Spion, kein Mord.
Man wacht und gähnt und wünscht sich an Bord.
Meine sechs Mann wurden dann in der Werftkantine ausgezeichnet verpflegt. Ich selbst erhielt Befehl, sofort neun andere Leute zu den Öltanks zu führen, weil die dortige Wache infolge Kompanie-Wirrwarrs nicht abgelöst worden war. Im Eilschritt irrten wir durch die dunklen Kais über Eisenbahnschienen, Tauwerk und Brücken, bis wir unser Wachtlokal fanden, einen unfreundlichen, weiten, mit schmutzigen Karren vollgepfropften Schuppen. Um meinen Matrosen etwas Gutes zu erweisen, begab ich mich an Bord der dort liegenden »Moltke«, meldete mich beim wachthabenden Offizier und log ihm frech vor, meine Leute hätten seit zwölf Stunden nichts zu essen bekommen.
Als ich mit Wurst, Butter und zwei Broten in den Schuppen zurückkehrte, riefen mir die Zurückgebliebenen lachend entgegen, es wären inzwischen Engel dagewesen. Dabei wiesen sie auf einen Krug heißen Kaffees und auf ein Riesenbündel, das uns über hundert prima-prima belegte Butterbrote bescherte. Mädchen einer höheren Töchterschule hatten das gebracht, aber es war natürlich viel zu viel für uns zehn. So aßen wir nur einen Teil des Belages ab und warfen das andere heimlich fort. Zu einer Zeit, da schon viele andere Menschen anderswo hungerten.
An Bord der »Moltke« hatte ich mich übrigens mit höchstem Interesse umgesehen, und der Unteroffizier vom Dienst des Mitteldecks zeigte mir stolz die schußfertigen Kanonen, die vielen neuen technischen Wunder und die erstaunlichen Massen aufgestapelter Vorräte. Wie er mich auf verschlungenen Gängen durch das gewaltige Panzerschiff führte, bekam ich wieder einen mächtigen Eindruck, zumal ich mir gleichzeitig vorstellte, wie diese wertvolle schwimmende Stadt von tausenddreihundert Einwohnern durch einen einzigen Treffer in die Luft zerfliegen oder restlos ins Nimmerwiedersehen versinken könnte.
Nun saß ich die ganze Nacht in dem öden Schuppen auf einem Faß voll grüner Seife, trank Kaffee und schrieb, Lulu rauchend, mein Tagebuch. Eine einzige, von Mücken und Kohlenstaub belagerte Glühbirne gab ihr spärliches Licht dazu, nur von Zeit zu Zeit warf ein ferner Scheinwerfer für Sekunden sein blendendes Weiß herein. Sirenen heulten auf. Dumpfe Nebelhörner tuteten. Friedlich, in dicke Mäntel gehüllt, auf Holzbetten schlief die abgelöste Mannschaft. Dann erschien leise eine Patrouille auf Rondegang. Der befehlende Steuermann beschwerte sich darüber, daß die Posten am Öltank ungenügend instruiert seien. Aber angesichts unserer Eßvorräte wurde er teilnehmend und erzählte, daß zwei Unterseeboote von uns vermißt würden.
Kaum war die Patrouille wieder fort, so haute auch ich mich aufs Ohr und erwachte erst von den Kommandos »Zur-r-r Flaggenparade«, die von den Schiffen herüberklangen. Es war schönes Wetter. Die bunten Winkflaggen unterhielten sich rege von Bord zu Bord. Mehrere Schiffe liefen aus, darunter das Minenschiff »Kaiser«, ein ehemaliger Handelsdampfer. Noch einmal wagte ich mich auf die »Moltke«, um meinen Leuten ein Extra-Mittagessen zu verschaffen.
Wir waren nun schon achtundzwanzig Stunden auf Wache, man, hatte auch uns offenbar vergessen. Erst als ich dringend telefonierte, schickte man Ablösung. Abends ließ mich Toni Pfeiffer ins Kasino rufen. Er habe unermeßlich viel Geld. Er fiel mir überglücklich um den Hals und rief einmal übers andere: »Gustav, meine Kleine ist da! Niemand kann mir mein Glück abkaufen!« Seine Liebste hatte ihm Geld mitgebracht, und er hielt nun die Paradiesvögel und was sich sonst einstellte, frei.
Wieder gab es Streitigkeiten zwischen aktiven und inaktiven Unteroffizieren, zwischen Küchenpersonal und Gästen der Kantine. Ich flüchtete auf unsere Stube und von da – weil es hieß, hundertvierzig Mann würden zum Wachtdienst gesucht – auf den Trockenboden, darauf unters Dach, wo mich aber ein findiger Diensttuender entdeckte. Ich wurde in einen Trupp gesteckt, der zur Badeanstalt marschierte. Der Zugführer, ein ganz junger Fähnrich, geriet unterwegs in Verlegenheit, weil wir in den Straßen die unanständigsten Lieder sangen, und er zu schüchtern war, uns Alten das zu verbieten.
Beim Appell wagte ich – meiner hervorstechenden Intelligenz wegen und aus Feigheit von den andern dazu aufgefordert –, mich beim Kompaniehauptmann im Namen aller Divisionsreservemaate wegen eines die Verpflegung betreffenden Erlasses zu beschweren. Man hätte mir das als Aufwiegelung auslegen können, jedoch der Hauptmann war vernünftig und regelte die Angelegenheit zu jedermanns Genugtuung.
Von daheim bekam ich ein Paket mit Taschentüchern, Strümpfen, Seife, Zigaretten und vielem Eßbaren. Auf so viel Paradiesvögel war das zwar nur ein Tropfen auf heißen Stein, aber dafür regnete es auch damals von allen Seiten solche Tropfen. Vater teilte mir mit, daß mein Bruder Wolf im Landsturm, also vorläufig noch nicht »dabei« sei. Wolf selber schrieb:
»Mückenberg N. L. 9. 8.14. – Alles Gute lieber Gustav! Haut sie, daß die Lappen fliegen! Lüttich unser! Belfort unser! Hurra! Haut die Bande von Engländern, daß sie das Wiederauftauchen vergessen. Unsere Gedanken weilen bei Dir. Komm gesund und siegreich wieder heim. Dore und Hansjörg grüßen Dich. Ich beneide Dich! Herzlich umarmt Dich Dein Wolf.«
Auch Tante Michel hatte aus Österreich geschrieben, eine Karte, die noch nach München gerichtet und mir nun nachgesandt war:
»Längenfeld in Tirol. – L. G.! Heute den 6.8.1914 erhielt ich früh Deine Karte besten Dank. Mein Brief mit Inhalt für Besorgungen für Marie wird hoffentlich jetzt auch bei Dir angelangt sein. Gestern sandte Dir Geburtstagskartenbrief mit 5 Mark ab. Sowie der Bahnverkehr eröffnet für Privatreisende, kehre ich heim. Wer hätte gedacht, daß es einen Weltkrieg gibt. Ich hoffe, Du kommst wegen Deiner Füße frei. Dein Sparkassenbuch liegt in meinem Vertikow, Schlafzimmer im zweiten Fach unter Wäsche rechts. Heute regnet es in Strömen. Bitte schließt nur ja die Korridortüre immer zu. Mir geht es so so. Nimm doch von der Wachholdersulz Speisekammer, ist für Husten gut. Nun lebe wohl! Die Bekannten grüßen. Herzlichste Grüße von Selma. Wie schade, daß Du keinen Datum auf die Karte geschrieben. Bitte bald Antwort geben.«
Ich zog nach dem Dienst mit Pfeiffer und seiner Braut durch Matrosenschenken. Sie küßte ihn fortwährend und schwur bei jedem Glas unter Tränen, daß sie sich erschießen würde, wenn sie je erführe, daß ihr Toni gefallen sei.
Am 18. August kam ich wunschgemäß auf Wache nach Mariensiel, einem Dörfchen, das eine Stunde entfernt am Ems-Jade-Kanal liegt. Wir, das hieß zwei Unteroffiziere und zwölf Mann, wurden bei der Bäuerin Harms einquartiert und lagen dort im Pferdestall auf Stroh. Die Landschaft war schön, malerische Scheunen zwischen alten knorrigen Bäumen, liebliche Wiesen mit grasenden Herden. Ohne die Sehnsucht, endlich einmal an die Kanonen zu kommen, hätten wir uns dort nach den trüben Kasernentagen restlos glücklich gefühlt. Unser Fähnrich meinte zwar, wir kämen noch früher und mehr ins Gefecht, als uns lieb sein würde.
Die Witwe Harms empfing uns freundlich, und ich sagte ihr gleich: Wenn wir ihr bei irgendwelchen Arbeiten helfen könnten, möchte sie über uns verfügen.
Jawohl: wir könnten Kartoffeln schälen. Auch gab es eine Menge Gartenarbeit und anderes, und wir hatten Fachleute unter uns. Ich freute mich, daß diese einen Nebenverdienst fanden und legte mich selbst, zum Nachdenken, hinter das Gehöft ins Gras in die Sonne.
Es war unsere Aufgabe, mit scharf geladenem Gewehr einen zwischen Wällen und Blättergrün versteckten Pulverturm zu bewachen. Wir Unteroffiziere führten die Posten auf dunklen Wegen über eine halsbrecherische Brücke dorthin und holten sie wieder ab. Die Wälle waren mit Birnbäumen bepflanzt, und die Posten holten sich gleich mit dem Bajonett die riesigen, aber leider ganz unreifen Früchte herunter. Eine dieser Birnen verwahrte ich mir, in der Hoffnung, sie würde nachreifen.
Wir lagen angekleidet und mit Schuhen im Stroh. Die Wolldecken waren dünn, und wir froren, weil Fenster und Türen des Pferdestalles offen standen. Über uns nisteten Schwalben. Morgens kleckste eine Henne dem Trockenbodengespenst mitten ins Gesicht, – so nannten wir einen Matrosen, weil er sich regelmäßig vorm Appell auf den Trockenboden geflüchtet hatte. Sein Fluchen, die Stimmen der Haustiere und die Sonne weckten mich. Ich verschaffte mir mit Mühe Seife, wusch mich wonnig ausführlich und rückte mir zwecks Kaffee mit Zigaretten einen Stuhl zwischen die Rosenbeete des Gartens.
Aber mittags mußten wir uns schon zum zweitenmal über das Essen beklagen, und bald merkten wir, woran wir dort waren. Witwe Harms war steinreich. Sie hatte große Äcker und viel Vieh. Aber sie war herzlos geizig und verpflegte uns in einer Art, die durchaus nicht der Entschädigung entsprach, die ihr die Behörde dafür zahlte. Auch dachte sie nicht daran, sich den Matrosen, die ihr bei der Arbeit halfen, irgendwie erkenntlich zu zeigen.
Ich hatte es mir und meinen Leuten zur eisernen Pflicht eingeprägt, im Quartier dankbar, höflich und bescheiden zu sein. In diesem Falle, da wir von Tag zu Tag schlechter behandelt und obendrein ausgenutzt wurden, gab ich die gegenteilige Parole aus.
Wir entdeckten einen Zwetschgenbaum, der besonders reich mit köstlichen Früchten gesegnet war. Am Stamm hing ein Plakat mit der Aufschrift »Pflaumen nicht essen! Vergiftet! Vorsicht!« Wir lachten einander schweigend zu, und im Nu war alles heruntergefressen. Frau Harms war eine abscheuliche, ziemlich alte Dame, aber jeder meiner Leute erklärte, daß er diese Frau ob ihres schönen und reichen Gutes und in der Hoffnung auf baldiges Absterben sofort mit Freuden heiraten würde. Sie hatte zwei Mägde, eine Geistesgestörte und ein hübsches, braunverbranntes, nur leider allzu sprödes Mädchen. Wir fanden mehr Gegenliebe bei einem prächtigen Bernhardiner.
In der Dorfschenke verlor ich am Billard gegen das Trockenbodengespenst, das sonst meisterhaft spielte, aber diesmal außer Fassung war, weil es zuvor, auf Pulverwache, in der Dusterheit nach einer Kuh geschossen hatte, die auf Befragen die Parole »Mühlhausen« nicht kannte. Ich tötete sieben Fliegen mit einem Schlag, das erste Blut, das ich vergoß, und verhaftete auf Posten einen Zivilisten, der sich verdächtig herumtrieb und keine Ausweise hatte. Es war ja so schön, wenn mal etwas verdächtig war.
Übrigens mußten auch wir Unteroffiziere Posten stehen.
Die Abende und Nächte in Mariensiel schienen mir besonders schön.
Die Kartoffelschäler sangen »Stürmisch die Nacht, und die See geht hoch ...« ein Lied, das ich auswendig lernte, weil es so instinktiv richtig den Rhythmus eines Schiffes im Sturm trug. Durch den Jadekanal zogen kleine, schwere Holländerboote, die vor jeder Brücke ihre Segel einzogen und die Masten umlegten. Sie wurden selbstverständlich kontrolliert und überwacht. Die Brücken, die Bahndämme, die Übergänge alles wurde überwacht. Seebataillon und Marine stellten die Posten. Wächter zu Fuß, zu Pferd, zu Rad, teils mit Hunden an der Kette streiften herum. Wenn ich nachts in der romantischen Allee, die zu Harms Gehöft führte, einsam, ach so gern Wache stand, und die Ronde nahte, versteckte ich mich hinter einem Baum; und dann sprang ich plötzlich hervor, riß das Schloß gefährlich knackend auf und rief die, die mich überraschen wollten und nun selbst erschrocken waren, scharf an: »Halt! Wer da? Parole oder ich schieße!«
Es trafen Leute in Mariensiel ein, die uns erzählten, daß sie an Bord der »Stralsund« ein Gefecht mit englischen Schiffen gehabt und dabei zwei feindliche Torpedobootszerstörer vernichtet, zwei andere untauglich gemacht hätten. Diese Leute lösten uns für einen Tag ab. Der Marsch von Mariensiel nach der Kaserne kam uns recht sauer an, für Infanteristen mit viel schwerem Gepäck wäre das ein Spaziergang gewesen, und die hätten dabei herzhaft Lieder gesungen. Bei uns kam nie ein Marschgesang zustande. Wenn wirklich ein paar Matrosen ansetzten, und eine Melodie mehr in sich hinein als aus sich heraus brummelten, dann machten die andern sich über ihn lustig, und außerdem kannten wir nur immer den Anfang der Texte.
Ich feierte mit Toni Pfeiffer ein feuchtes Wiedersehen. Er war im Rauschzustand sehr komisch. Dann warf sich der lange Schlacks knallend auf den Bauch und schob sich in Schwimmbewegungen über den Hof. Beim Mittagessen mußte ich ihn aber oft ernsthaft korrigieren. Er warf dann mit Brotstücken um sich und gab ungeniert laute Gestänke von sich.
Nachdem geraume Zeit das Gerücht verbreitet war, die Japaner hätten den Russen den Krieg erklärt, las man auf einmal, daß sie vielmehr uns ein Ultimatum gestellt hätten. Das hieße eventuell eine Großmacht mehr gegen uns. Aber wir meinten, in solchem Falle würde sich andererseits Amerika gegen Japan erheben.
Abermals trotteten wir gen Mariensiel. Diesmal wurden wir von einem alten Obermaat geführt, der im Gruß-Reglement sichtlich unsicher war. Er erwies unterwegs infolgedessen hartnäckig überhaupt keine Ehrenbezeugung, und wenn wir ihm sagten: »Du, das war doch ein Offizier!?«, dann knurrte er jedesmal: »Ik häv keen sehn.« Es regnete kalt, und wir dachten unbehaglich an Musterung mit verrosteten Gewehren. Einige Leute trugen noch immer Zivilschuhe. Auf den Kleiderkammern wollte das Tohuwabohu kein Ende nehmen. Natürlich ward sofort von Unterschlagungen und Verhaftungen gemunkelt.
Der braunen Magd in Mariensiel, die ich Teufel und die mich Bootsmaat Habicht nannte, streckte ich die Hand zum Gruße hin, aber das stolze Mädchen nahm sie nicht. Da brachte ich sie so zum Lachen, daß sie einen Schluck Kaffee über den Küchentisch spuckte, worauf nun ich mich stolz abwandte. Frau Harms brachte mir ein »Gedenkbuch an die Einquartierung bei Witwe Harms«, das sie auf irgendwessen Rat angelegt hatte, und bat mich, unsere Namen, Chargen, Adressen usw. einzutragen. Ich fügte, wie die vorige Wache getan hatte, ein Verschen zu:
Sei freundlich zu dem rauhen Gast,
Den dir der Krieg ins Haus geschickt.
Wenn ihn die Kugel trifft, so hast
Du ihn auf letztem Weg erquickt.
Und wenn er siegreich heimwärts kehrt,
Dich nimmer sieht, die ihn beschenkt,
So ist schon das der Liebe wert:
Daß er stets dankbar deiner denkt.
Wir Unteroffiziere schälten auch der Wirtin einen Eimer Rüben, weil unsere Leute sich weigerten, Privatarbeit für sie zu leisten. Doch wurden die Leute auch im Dienste fauler und nachlässiger. Sie vertrugen keine Nachsicht, und wenn unser Fähnrich Zigaretten verteilte, nahmen sie das hin, als müßte es sein. Nachdem ich den Posten Hoftor beim Angeln ertappt hatte, begann ich strengere Zucht einzuführen.
Ich hatte mir diesmal einen Bettbezug mitgebracht, in den ich wie in einen Sack kroch, und der mich ebenso gegen Kälte wie meine Uniform gegen Strohfusseln schützte. Auch hatte ein Vorgänger Läuse gesät. Wir badeten öfter im Kanal. Eines Nachts großer Alarm, – Werdarufe, – ein Schuß. Es sollte ein verdächtiger Mann in Hemdsärmeln gesehen worden sein. Das Resultat war Null, jedoch für einige von uns eine fidele Nacht im Lindenhof. Leider durfte die Wirtin keinen Alkohol ausschenken. Ich sprach auf dem Heimweg eine Dame an und erhielt, weil ich sie mit einem Kuß überrumpelte, eine weithin schallende Ohrfeige.
Kinder verteilten Zeitungen. U 12 war unversehrt heimgekehrt. Die Amerikaner sollten den Japsen den Krieg erklärt und in Kiautschou die amerikanische Flagge gehißt haben. Ferner war von einem großen Sieg zu Lande über die Franzosen die Rede. In den Straßen von Wilhelmshaven wurde der von Menschenmassen mit Liedern, Flaggen und Lampions abends gefeiert. Ich war traurig. Ich wollte fort. Die Leute, die mich umgaben, würden draußen im Kampfe sich größtenteils äußerst brav benehmen, aber wie sie sich jetzt hier betrugen, und was sie läppisch und dumm zusammenschwatzten, dünkte mich unerträglich.
Einmal gerieten Pfeiffer und ich in die Abschiedsfeier von sieben oldenburgischen Infanteristen, die nach Belgien mit unbestimmtem Ziel abgingen. Es wurde fürchterlich gezecht. Wir ließen die Infanterie, und diese ließ uns leben, wollte aber die Franzosen verhauen. Pfeiffer tanzte zuletzt mit einer Brotschneidemaschine und wiederholte unaufhörlich:
»Meine Frau, die ißt gern Sülze.
Wenn se keine kriegt, dann brüllt se.«
Der folgende Tag war ein nasser, war ein großer Reinigungstag bei dem wir Seeleute – als wären wir an Bord – nicht mit Wasser sparten. Korridore und Stuben waren hoch überschwemmt, und in den Räumen darunter entstanden nasse Flecke an der Decke; zu Mittag gab es, das gehörte dazu, süßen Milchreis mit Zimt und Knoblauchwurst. Ich saß einem Freiwilligen gegenüber, der seinen siebzigsten Geburtstag feierte. »Das hätte mir einfallen sollen, nicht mitzumachen!« sagte er. Ein Kamerad reichte mir bei dieser Gelegenheit an mich gerichtete Briefe, die er seit längerer Zeit in seiner Hosentasche trug. Maulwurf schrieb besorgt um mein Leben und sandte mir zehn Mark. Ich schämte mich.
Und wieder ging's nach Mariensiel. Aber häßliche, kleinliche Geschichten begegneten mir dort. Die Lindenwirtin wollte mich bei meiner Division verklagen, weil ich ihrer Tochter mit Erschießen gedroht hätte, wenn sie mir keinen Schnaps gäbe. Ein Scherz von mir, den die stolzbornierte, siebzehnjährige Gans in die falsche Kehle bekommen hatte. Der Teufel bei Harms war auch noch schnippischer als zuvor, und die im Gasthof Ewers untergebrachten Soldaten beschwerten sich ebenfalls über ihre Quartiergeber, die doch, wie das ganze Dorf, an uns beträchtliches Geld verdienten. Ich organisierte ein wenig unseren Widerstand. Außerdem war mein Nacken steif, und ich bekam Zahnschmerzen. Diese vielen winzigen, aber zeitlich zusammenfallenden Umstände verleideten mir den Ort mehr und mehr. Seife, Kämme, Handtücher, Schuhwichse, Bindfaden und Zündhölzer wurden kostspielige, begehrte Artikel, und die Geldsendungen aus der Heimat nahmen ab. Mir war bei einem Sprung über eine Barriere meine Uhr zerbrochen. Da ich sie auf Wache schwer entbehrte und die Reparatur viel kostete, gab ich die Sache nachträglich zu Protokoll. Ich beantragte Schadenersatz, indem ich in einer vier Seiten langen Abhandlung nach vorschriftsmäßigem Stil nachzuweisen suchte, daß der Sprung über die Barriere eine dienstliche und höchst notwendige Angelegenheit gewesen sei.
Ein herrlicher Sieg bei Metz wurde gemeldet. Drei Armeekorps geschlagen, über fünfzig Geschütze erbeutet. So erfreulich das war, mich machte es auch neidisch. Ich hatte mich inzwischen in einem förmlichen Gesuch auf ein Schiff nach der Ostsee beworben, mit der Erwähnung, daß ich im Baltikum gut Bescheid wüßte. Der Himmel mochte wissen, in welchem Papierkorbe jetzt dieses Gesuch lag.
Es gab sich so, daß ich eine Nachtpatrouille erhielt, die die Wirtshäuser auf spätes unerlaubtes Ausschenken revidierte. Dabei konnte ich an dem Wirte Ewers Rache nehmen, der ein Verbot überschritten hatte und nun, als ich ihn im Nebenzimmer anschnauzte, ganz jämmerlich die Kontenance verlor. Ich zeigte ihn indessen nicht an. Und als ich den Lindenhof kontrollierte, war dort zwar nichts auszusetzen, aber ich fand insofern Genugtuung, als die Wirtin und anscheinend auch die Tochter furchtbar erschraken, wie ich mit bewaffneten Leuten so überraschend eindrang, als wollte ich meine Drohung nun wahrmachen.
Es gab frohe und idyllische Stunden in dem Dorfe dort. Morgens trieben wir Sport auf dem Hofe, stemmten oder schleuderten schwere Steine, spielten Fußball (als Ball diente eine Konservendose) und führten mächtige Ringkämpfe auf. Abends genossen wir im Grase hingestreckt Ruhe und Harmonikawehmut. Mein Lieblingslied »La Paloma« wurde mir zuliebe gespielt. Dann erzählte ein Matrose von seinen Erlebnissen an Bord eines Auslandkreuzers. Da hatte auf einem Ausflug ein Kapitänleutnant ein Krokodil erlegt und ließ es häuten und die Haut auf dem Achterdeck zum Trocknen ausspannen. Die Matrosen aber brachen dem Tier heimlich alle Zähne aus, um ein Andenken zu haben. Und nach Ansicht unseres Erzählers hatte das Krokodil dann ausgeschaut wie ein altes verdattertes Fischweib, und der Kapitänleutnant mußte ihm später ein künstliches Gebiß einsetzen lassen.
Ein Vizefeuerwerker, der den Fähnrich ablöste, hielt uns offiziöse Vorträge über die Kriegslage: – »Durch unsere gute Küstenverteidigung haben wir erreicht, daß England uns nicht angreift. Wir können ihm, wenn es Hamburg angriffe, in den Rücken fallen. Wir haben an der englischen Ostküste Minen gelegt. (Der Feind steht an der Westküste.) Wir haben mittlere Artillerie auf unseren Dreadnoughts. England fängt jetzt erst an, sie einzurichten. Unsere Marine hat nicht soviel zu verlieren wie die ihrige. England braucht seine Flotte, weil es auf Einfuhr angewiesen ist und seine vielen Kolonien schützen muß. – » Wir hörten zu. Auch das wurde langweilig.
Das Verhältnis zwischen Militär und Bauern spitzte sich immer mehr zu. Diese Oldenburger waren an sich verschlossen. Sie hatten mit Marinern schon in Friedenszeiten zu tun, und diese hatten sich damals gewiß oft als Rowdies benommen. Das wirkte sich nun noch bei uns aus, die wir wirklich alle mit größter Rücksichtnahme aufgetreten waren. Nun wurden wir in unserem Unbeschäftigtsein und der daraus resultierenden Unzufriedenheit immer empfindlicher, verständnisloser und nörgelsüchtiger, und so schürte sich das wechselweise weiter zur Glut. Die böse alte Harms und ihr Gesinde verpflegten und behandelten uns immer abscheulicher, und wir schlichen heimlich in ihre Ställe, schütteten den ganzen Hafer unter die Hühner und gossen die frisch gemolkene Milch in die Schweinetröge.
Ich gab die Mariensieler Wache auf und zog vor, wieder in der Kaserne den Leuten Exerzieren, Schießen und Grüßen beizubringen.
Allerdings geriet ich dort gleich in eine hochnotpeinliche Untersuchung und in ein allgemeines Verhör. In der vierten Kompanie waren Spinde erbrochen und bestohlen worden.
Andererseits wurden gerade geeignete Leute für den Kreuzer »Pillau« gesucht, den die Deutschen für Rußland gebaut hatten und nun gegen Rußland verwenden wollten. Jedoch ich kam wieder nicht auf die Designierungsliste.
Viel Siegesnachrichten. Eines Morgens hörten wir Geschützdonner von See her. Nachmittags lief »Frauenlob« mit zerschossenem Schornstein und einem Seitentreffer dicht über der Wasserlinie ein. Sie sollte gemeinsam mit »Von der Tann« zwei englische Schiffe gefangen und eingeschleppt haben. Man sprach von sieben deutschen Toten und fünfzehn Verwundeten; wir mutmaßten mehr. »Frauenlob« war ein Schwesterschiff zur »Nymphe«, auf der ich seinerzeit als Einjähriger gedient hatte.
Ho! Eine scharfe Brise kam auf. Außer der »Pillau« sollten noch weitere Schiffe in Dienst gestellt werden. Gerade um diese Zeit verschlimmerte sich mein verwünschtes Fußleiden. Ich desinfizierte mit irgendwas, was mir zur Hand war, und worauf ich Vertrauen setzte, ich glaube, es war Petroleum.
Ich hatte ein Gedicht auf die deutschen Matrosen verfaßt. Als ich die fertige Arbeit betrachtete, nahm sie sich aus wie ein Kommißstiefel.
In der Stadt sah ich eine Menschenmenge, die auf den Transport der Opfer von »Frauenlob« wartete. Ein Obermatrose wollte die zerrissenen Leichen auf dem blutbesudelten Deck gesehen haben, ich traute ihm nicht recht. Es wurde so viel zusammengelogen. Es wurde von Verstümmelungen, Explosionen, Abschlachtungen erzählt, es wurde von glorreichen Siegen und deutschen Heldentaten geschrieben. Wir steckten alle günstigen wie ungünstigen, alle wahren und unwahren Nachrichten mit einer gleichmäßigen Sachlichkeit ein. Auch mir kam das Merkwürdige unserer Lage nur in einsamen Stunden, etwa des Nachts auf Wache, zum Bewußtsein. Dann schwoll in mir die romantische Abenteuerlust, die mich seit meiner frühesten Kindheit begleitet und vielleicht allzuoft geleitet hatte.
Weitaus die Mehrheit der Militärs und Zivilisten war davon überzeugt, daß wir unsere Gegner schlagen würden. Nur die Frauen sahen skeptischer und gefühlsmäßiger in die Zukunft.
Eines Nachts lagen Toni Pfeiffer, eine Postordonnanz und ich allein in unserer Stube. Die übrigen Betten standen leer; sie gehörten Leuten, die gerade auf Wache waren. Da öffnete sich die Tür. »Es gibt Einquartierung!« rief eine Stimme.
»Ausgeschlossen! Gibts nicht!« riefen wir drei, und die Postordonnanz pustete schnell die Lampe aus.
»Ach was, hier sind doch Betten frei.«
»Nein! Die Leute dazu stehen Posten in Mariensiel!«
»Nur für eine Nacht«, beharrte die Stimme, »es sind Leute von der ›Ariadne‹, die mit zwei Panzerkreuzern gekämpft haben. Sie sind zum Teil ganz naß, ihr Schiff ist untergegangen –«
»Oh, das ist was anderes!« Wir sprangen aus den Betten. Die Lampe ward angezündet.
Da kamen sie schon, die Kerle. In weißen Anzügen mit Dreck und Blut bespritzt, Heizer, Matrosen, Küchenpersonal, vom Pulver schwarz punktiert, mit entzündeten Augen und von Gasen aufgedunsen. Aber sie lachten und witzelten schief, um ihr Stolzsein zu verdecken. Wir drei gaben unsere Decken, Butter, Zigaretten her, alles was wir hatten, es war nicht viel, denn wir besaßen schon lange keinen Pfennig mehr. Und dann legten die Ankömmlinge los und erzählten trotz ihrer Erschöpfung stundenlang, wobei sie einander ergänzten oder berichtigten und ihre Aufregung immer höher steigerten: Blut wie Schlamm. Furchtbares Getöse durch die krepierenden Granaten. Leute in Fetzen gerissen und Panzerplatten wie Papier gebogen. Am schlimmsten die Pulvergase und der Brandrauch. Wer nicht, wie die Leute an den Geschützen, Mundbinden trug, der litt entsetzlich. Die »Ariadne« – (sie war auch meiner »Nymphe« verschwestert, also ein längst veralteter Kasten – sollte fünfzehn Treffer bekommen, dann sich auf die Seite und später ganz herum gedreht haben. Die Leute, die sich retteten, waren über Bord gesprungen – »Rette sich, wer kann!« – und von dem kleinen Kreuzer »Danzig« aufgenommen. Ihr Schiff sackte bald darauf ab, nachdem noch der Kommandant durch die Kuttergäste der »Danzig« gerettet war. Die beiden englischen Schiffe, welche die »Ariadne« in die Falle gelockt und vernichtet hatten, machten sich vor der »Danzig« aus dem Staube. Es waren Geschosse in das Pulverdepot und in den Torpedoraum gedrungen, ohne diese sofort zur Explosion zu bringen. Sie verursachten zunächst nur Brände und giftige Gase, vor denen sich einige Leute dadurch retteten, daß sie sich platt auf den Boden warfen. Besonders schlimm und folgenschwer hatte die Ölfarbe gebrannt, mit der die Aufbauten an Bord verschwenderisch oft gestrichen wurden. Das war eine tragische Lehre für unsere Marine.
Einer unserer Schlafgäste hatte einen Mann sitzen sehen, der den Kopf wie verzweifelt in beide Hände gestützt hatte. Dann zeigte sich, daß dieser Kopf vollständig verkohlt war. – Das Licht erlosch plötzlich. –
Ein Ingenieur, dessen Beine mit schrecklichen Brandwunden bedeckt waren, lief noch auf die Brücke und stimmte mit anderen das Flaggenlied an. Ein Steward sah einen Seestiefel liegen, woran noch ein Stück Bein war.
Die Geretteten traten beim nächsten Mittagsappell gesondert an. Der Kompanieführer hielt eine ehrende Ansprache an sie.
Es verlautete: Auch die »Stettin« sei dienstunfähig gemacht, sie habe fünf Volltreffer erhalten.
Jemand vom Büro teilte mir mit, ich sollte an Bord kommen. Hurra! Hurra!
Erna Krall schrieb über meine baltische Freundin: »Wanjka Plawneck ist nicht gefangen, hat aber in dem von Spionagefurcht verrückten München eine entsetzliche Straßenszene erlebt. Man hielt sie für einen verkleideten Mann. Die Polizei hat sie vor einer Prügelei errettet und sie umgehend in die Schweiz expediert.« – Auch ein Brief von Eichhörnchen. Darin die Stelle: »Es schmerzt mich tief, daß ich von Dir, dem Freunde, der so Vieles innig mit mir teilte, der auf Leben und Tod hinauszog, nicht ein einzig liebes, treues Wort erhalten habe! Ich weiß nicht, ob Du mir geschrieben hast; sollte es aber so sein, so danke ich Dir für Deine Zeilen, auch wenn ich sie nicht gelesen habe.« – In einem zweiten Briefe von Eichhörnchen, ebenso lang wie der erste, stand u.a.: »– Wenn die hellen Sternenaugen am Abend über die See strahlen, dann blick nach der Küste, wo zwei andere Augen Dich grüßen, und wisse, daß ich Dich sehr lieb habe und Dir treu bin. Vielleicht beglückt Dich dieses Bewußtsein, wenn Du in der Gefahr draußen stehst! – Und nun Adieu mein Gustav, geliebter Freund! Vergib mir, ich bitte Dich von Herzen, wenn immer ich Dich kränkte und Dir wehe tat, wo ich in unserer Freundschaft fehlte. – Ich habe viel gelitten über die Gegensätze, die zwischen uns traten, aber über allem steht leuchtend das Edle, Gute, das Schöne und Wertvolle, das Du mir gabst, das immer bleiben wird und das ich Dir von ganzer Seele danke. – Ich will nun hoffen und beten und tapfer ausharren. – Und indem sie Dir in die lieben Augen blickt, küßt Dich Dein Eichhörnchen mit festem, treuem Händedruck.«
2 Mit »Blexen« in der Werft
Ich war für das 2. Jade-Sperrschiff »Blexen« bestimmt. Zunächst mußte ich aber noch von Schreibstube zu Schreibstube laufen und überall lange warten, bevor ich nähere Instruktionen, Ausweise und meine rückständige Löhnung bekam. Dabei hatte ich ein zufälliges Wiedersehen mit meinem »Gesuch betreffend Schadenersatz für Reparatur einer im Dienste beschädigten Privatuhr«. Das Schreiben war vom Hauptmann unterschrieben, es wanderte nun zur Kompanie, von dort zur Division und wahrscheinlich weiter, immer weiter.
Mit anderen Schicksalsgenossen marschierte ich nach der Werft, an den beiden beschädigten Schiffen »Frauenlob« und »Stettin« vorbei zum Navigationsressort, wo wir uns meldeten und wo unsere Personalien zum unzähligsten Male aufgenommen wurden. Dann wieder durch die weitläufigen Dockanlagen, zwischen Stapeln von Fässern, Schiffsschrauben und über sauber aufgeschichtete Ankerketten hinweg, immer den schweren Zeugsack auf dem Buckel und überall nach der »Blexen« fragend. Wir fanden und beschnüffelten sie kritisch. Es war ein kleiner, wenig Vertrauen erweckender Privatschlepper, der knapp für fünf Personen Platz hatte, und wir sollten ihn mit elf Mann besetzen, nämlich dem Kommandanten, zwei Maaten (Jessen und ich), zwei Matrosen (Eichmüller und Apfelbaum), drei Maschinistenmaaten und drei Heizern. Im Logis konnten sich zwei Menschen nur mit Mühe aneinander vorbeiwinden. An Deck waren Arbeiter beschäftigt, alles war verdreckt, und außer Minenmaterial fanden wir kein Inventar an Bord. »Das gibt viel Arbeit mit Aufklaren, Waschen und Malen«, sagte Jessen. Mit ihm verabredete ich, daß wir fortan zu den Leuten etwas Distanz wahren und sie auch künftig mit »Sie« anreden wollten, weil einige gleich plump vertraulich auftraten, besonders der lange und, wie ich schon gespitzt hatte, unaufrichtige und feige Apfelbaum.
Wer etwas kochen könnte, fragte der Kommandant. Apfelbaum trat vor und wurde in die niedrige, enge Küche gesteckt, wo er sich unter unserem Gelächter einrichtete. Dann fuhr ein Teil von uns mit dem Kommandanten in einer Barkasse über den Bauhafen, um Bordrequisiten zu beschaffen. Staunend und darüber unwillkürlich leise, wie auf Zehen, gingen wir durch die weiten Säle des Depots. Da war einer ganz mit Flaggen, ein anderer mit Porzellan, ein dritter mit Besenstielen und Scheuerlappen bis an die Decke angefüllt. Und wie wir die Barkasse nun mit soundsoviel Signalflaggen, Ölzeugen, Kupferkesseln, nautischen Instrumenten, Bootshaken, Pinseln, Tassen, Tellern, Farbe, Proviant und anderen Dingen beluden, die alle nagelneu und blitzeblank waren, da sagte jemand: »Das ist wie Weihnachtsbescherung.« Mehrmals mußten wir mit solcher Ladung hinüber- und zurückfahren. Mir ward so seemännisch wohl zumut. Die Barkasse schaukelte in Wind und Sonne. Rings herum sah man die von Kanonen strotzenden Panzerschiffe, und aus dem geteerten Tauwerk roch ich alte Erinnerungen.
Inzwischen hatte der Koch uns Kaffee gebrüht und Speck und Butter hingestellt. Er gab mir, sicher nicht aus Sympathie, ein besonders großes Stück und machte mir auch vor, wie ich auf meiner Bootsmannspfeife blasen müßte. Aber ich vermochte nur klägliche und blamable Töne zu erzeugen, während alle meine Kameraden auf demselben Instrument die festgelegten, vielen Signale wie Lerchen trillerten.
Ich richtete meine unglaubhaft schmale und kurze Koje ein, eine Decke pfropfte ich zusammengerollt zu Kopfende unter die Matratze. Am Fußende war ein Tragbrettchen angebracht. Dorthin legte ich mein Wichtigstes: Uhr, Börse, Bordmesser und Spindschlüssel. Mein kleiner Spind war so vollgepfropft, daß ich ihn nur mit Hilfe von Fußtritten schließen konnte. Aber nicht alle Leute bekamen Koje und Spind, für einige wurden Matratzen auf den Boden gelegt, für andere Hängematten aufgehängt.
Bevor wir Urlaub bis zehn Uhr erhielten, gab mir der Kommandant noch den mich ehrenden Auftrag, am nächsten Morgen Punkt 8 Uhr die Flaggenparade vorzunehmen. Außerdem wurden wir wieder einmal ermahnt, nicht über maritime Verhältnisse oder Vorgänge zu sprechen. Diese Instruktion war diesmal besonders aktuell. Täglich kursierten neue schlimme Nachrichten über die Flotte. Ein Torpedoboot war gesunken, und der Kreuzer »Mainz« und die »Köln« wurden vermißt. In der Stadt herrschte große Besorgnis darüber. Vor der Wilhelmshavener Zeitung warteten Menschenmengen, ich sah Tränen und sprach Zivilisten, die Angehörige an Bord der vermißten Schiffe hatten.
Und nachts schlief ich nun wirklich seit Jahren wieder einmal an Bord, in der Stickluft eines überfüllten Logis. Auf dem Tisch klebte und flackerte eine Kerze. Ein höllisches, an Maschinengewehre erinnerndes Geknatter ließ das ganze Schiff erzittern. Oben an Deck wurden Nieten mit Preßluft eingeschlagen. Die Arbeiter mit ihren schlangenartigen Instrumenten, von aufgeregten Fackeln beleuchtet, boten ein seltsames Bild.
Morgens brachten wir die Flaggenparade rechtzeitig und nach vorgeschriebenem Zeremoniell zustande, obwohl nicht ohne Schwierigkeit, denn der Flaggenstock achtern paßte nicht in seine Ringe und der Kommandantenwimpel hatte sich in die Gaffel verwickelt, es brauchte viel Zeit, Mühe und Meinungsverschiedenheit, um ihn zu klarieren. Dann wuschen wir Deck und schälten Kartoffeln.
»Können Sie morsen? Können Sie winken?« fragte mich der Kommandant, als er an Bord kam.
»Ich habe es gelernt, aber das meiste vergessen«, erwiderte ich.
Wir waren alle Reservisten. Niemand verstand sein Metier noch perfekt. Ein Matrose fragte den andern verlegen, wie Buchstabe Quatsch (also Q) in der Flaggensprache oder wie Uli in der Winkflaggensprache hieße, oder wie der Anruf beim Morsen wäre. Die Maschinistenmaate suchten nach Ventilen oder betasteten verwirrt ihre Maschine. Auch der Kommandant war unsicher. Dabei sollten wir um zwölf Uhr in See gehen. Es war noch kein Geschütz, es waren weder Ferngläser noch Kompaß noch Karten an Bord. Die Nietenarbeiter hämmerten ebenfalls weiter. Das zog sich denn auch noch mehrere Tage so hin.