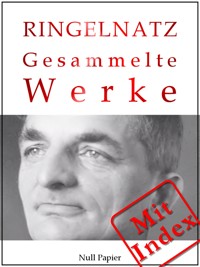
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Mit alphabetischem Index und 30 Illustrationen aus der Hand des Autors 580 Werke auf 2717 Seiten Seine skurrilen, spielerisch verschwurbelten Verse, die nicht selten vor Zynismus triefen, und doch eine sensible Seele offenbaren, machten Ringelnatz zu einem der schöpferischsten Multitalente Deutschlands zwischen den Weltkriegen. Zeitlebens meist pleite, konnte er sich nur schlecht mit einer Bürgerlichkeit arrangieren. Ringelnatz blieb nur wenig Zeit, seinen aufkeimenden Ruhm zu genießen, die Nazis erteilten Veröffentlichungs- und Auftrittsverbot. Armut, Alkoholismus und die Tuberkulose trieben ihn ins Grab. Heute bleibt uns ein großes Werk aus Gedichten, Abzählreimen, Geschichten, Tagebüchern, Dramen und skurrilen Figuren, wie der Seemann Kuttel Daddeldu. Wenn man Ringelnatz ständige Existenznöte betrachtet, überrascht dieser Fleiß umso mehr. Sein Verdienst war das Spiel mit dem Wortwitz. Seine Gedichte zählen heute zu den populärsten Texten deutscher Literatur. Seine wichtigsten Werke sind hier veröffentlicht: Die Schnupftabaksdose, Turngedichte, Kuttel Daddeldu oder das schlüpfrige Leid, …liner Roma…, Kinder-Verwirr-Buch und mehr als 500 weitere Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2072
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joachim Ringelnatz
Joachim Ringelnatz
Gesammelte Werke
Joachim Ringelnatz
Joachim Ringelnatz
Gesammelte Werke
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: Jürgen Schulze 2. Auflage, ISBN 978-3-954186-49-5
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Joachim Ringelnatz
Lyrik
Turngedichte
Allerdings
Miliz
Lustig quasselt
Liedchen
Von einem, dem alles danebenging
Morgenwonne
Schöne Fraun mit schönen Katzen
Nichts geschieht
So gut wie schlecht
Ab Kopenhagen
Insel Hiddensee
Großer Vogel
Die Überholten
Jene kleinsten ehrlichen Artisten
Heimatlose
Im Park
Nie bist du ohne Nebendir
Es ist besser so
Erzählungen
Die Walfische und die Fremde
Vom Tabarz
Der arme Pilmartine
Die Ode an Elisa
Drama im Zoo
Der ehrliche Seemann
Kuttel Daddeldu erzählt seinen Kindern das Märchen vom Rotkäppchen und zeichnet ihnen sogar was dazu
Rätselhaftes Ostermärchen
Vom andern aus lerne die Welt begreifen
Die wilde Miß vom Ohio
Durch das Schlüsselloch eines Lebens
Der tätowierte Apion
Jemand erzählt von Illineb
Das schlagende Wetter
Nervosipopel
Diplingens Abwesenheit
Vom Baumzapf
Abseits der Geographie
Eheren und Holzeren
Vom Zwiebelzahl
Die Blockadebrecher
Die zur See
Nordseemorgen 1915
Totentanz
Auf der Schaukel des Krieges
Der Freiwillige
Aus dem Dunkel
Flaggenparade
Nach zwei Jahren
Lichter im Schnee
Fahrensleute
Die Zeit
Das halbe Märchen Ärgerlich
Kuttel Daddeldu
Avant-propos
Vom Seemann Kuttel Daddeldu
Daddeldus Lied an die feste Braut
Seemannstreue
Abendgebet einer erkälteten Negerin
Die Weihnachtsfeier des Seemanns Kuttel Daddeldu
Kuttel Daddeldu und Fürst Wittgenstein
Kuttel Daddeldu besucht einen Enkel
Seemannsgedanken übers Ersaufen
Kuttel Daddeldu im Binnenland
Kuttel Daddeldu und die Kinder
Matrosensang
Logik
Rezept
Das Terrbarium
Die Ameisen
Novaja Brotnein
Gladderadatsch
Es setzten sich sechs Schwalben
Überfahrt
Das Gesellenstück
Ansprache eines Fremden an eine Geschminkte vor dem Wilberforcemonument
Die Blindschleiche
Mutter Frühbeißens Tratsch
Feierabendklänge eines einhändigen Metalldrehers an seine Frau mit preisgekrönten Beinen
Es waren zwei Moleküle
Billardopfer
Mein harmlos Lied
Balladette
Noctambulatio
Was der Liftboy äußert
Die Nagelfeile
Die Badewanne
Lampe und Spiegel
Der Globus
Flie und Ele
Der Briefmark
Zwei Schweinekarbonaden
Der Bandwurm
Fliege und Wanze
Die Schnupftabaksdose
Schaudervoll, es zog die reine
Schicksal der Schlaube
Die Geburtenzahl
Stoffwechsel
Miß Longwieles Stoßgähnen
Vier Treppen hoch bei Dämmerung
Mein Riechtwieich
Frühlingsanfang auf der Bank vorm Anhalter Bahnhof
Lied aus einem Berliner Droschkenfenster
Jene brasilianischen Schmetterlinge
Vorm Brunnen in Wimpfen
...liner Roma...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Als Mariner im Krieg
1 –– Einberufung und Kaserne
2 –– Mit »Blexen« in der Werft
3 –– In See auf »Blexen« und »Vulkan«
4 –– Minenabteilung
5 –– Festung Friedrichsort und Fischdampfer »Bergedorf«
6 –– Fahrt nach dem Osten
7 –– Warnemünde
8 –– Korrügen
9 –– Rußland
10 –– Von Osten nach Westen
11 –– Matrosenartillerist und R.-O.-A
12 –– Vizefeuerwerker und die H.M.S.D
13 –– Kommandant und Leutnant
14 –– Batterie Seeheim
15 –– Revolution
16 –– Heimkehr
Die Flasche und mit ihr auf Reisen
Die Flasche
Erster Akt
Zweiter Akt
Dritter Akt
Mit der »Flasche« auf Reisen –– (Ein Tagebuch von 1932)
Premiere in Hannover
Zwangsurlaub und drei Tage Kassel
Gotha, Liebenstein, Salzungen, Eisenach
Bad Kissingen
Koblenz und Abstecher
Vier Tage Darmstadt
Pforzheim
Baseler Leckerli
Zürich, leider nur ein Tag Zürich
München
Nürnberg
Würzburg
Wieder in Kissingen, Plauen abgesagt
4 Tage Bad Elster
Praha-Peux
In Teplitz ausgespielt
Flugzeuggedanken
Flugzeuggedanken
Einsamer Spazierflug
Versöhnung
Fallschirmsprung meiner Begleiterin
Ein Freund erzählt mir
Bär aus dem Käfig entkommen
Helfen
Frühling
Flugzeug am Winterhimmel
Der Sänger
Gedanken an Wedekind
Freunde, die wir nie erlebten
An der alten Elster
Fliegerleute
Dreiste Blicke
Streit
Wie machen wir uns gegenseitig das Leben leichter?
An Alfred Schloßhauer
Kindergebetchen
An ein startendes Flugzeug
Stalltüren
Dickhäuter
Museumsschweigen
Madonnengesichter
Klein-Dummdeifi
Zimmermädchen
Fernflug
Stammtisch Individueller
Aus der Vogelkunde
Raketenwagen auf der Avus
Rakete ins Erdfern
Giraffen im Zoo
Müder Juniabend
Freiballonfahrt mit Autoverfolgung
Zwischen Lipp und Kelchesrand
Über meinen gestrigen Traum
Flugpost-Liebesgabe
Kuttel Daddeldu über Nobile
Begrüßung eines soeben Gelandeten
Manila
Trostworte an einen Luftkranken
Schlechter Tag
Frucht-Zucht-Frucht
Deutsche Sommernacht
Rheinkähne
Spielen Kinder doch...
Die Freude an Komödie
Im Flughafen Oberwiesenfeld
Freundschaft (*Erster Teil*)
Freundschaft (*Zweiter Teil*)
Entomologische Liebe
Sonntagspublikum vor Bühnen
An die Masse
Hundstagsgespräch
Der Mann, der...
Offener Antrag auf der Straße
Drei Tage Tirol
Aus der Kundenkunde
Geld allein
Die Fliege im Flugzeug
An einen Glasmaler
Schöne Frauen mit schönen Katzen
Bürger, den ich meine
Und glaubte doch es überwunden
Du und die Nacht
Gruß an Junkers
Blues
Mein Wannenbad
Humorvolle Spinner
Wohlgemeint an Biedermann
Chemnitzer Bußtag 1928
Trennung von einer Sächsin
Platzmusik in Stuttgart
An meine Herberge in Stuttgart
Der letzte Tag vergangnen Jahrs
Silvester
Lebhafte Winterstraße
Stille Winterstraße
Winterflug 1929
Leben wie Karneval
Faschingsvollmond
Entschuldigungsbrief
Preisaufgaben
Abermals in Zwickau
Brief auf Hotelpapier
Königsberg in Preußen
Asta Nielsen weiht einen Pokal
Arbeit
Gespräch mit einem Blasierten
Fluidum
Abgesehen von der Profitlüge
Zu dir
Sehnsucht nach Berlin
Großplatztauben
Eine Zuschauerin im Flughafen
Natur
Schroffer Abbruch
Rückkehr zweier Thüringer aus England
Meine alte Schiffsuhr
Nach der Trennung. Lichterfelde
Enttäuschter Badegast
Leere Nacht
Ein ängstlich Einsteigenden
An einen Geschäftsfreund
Schläge
Hymnüs’chen
An meinen Zigarettenrauch
Das scheue Wort
Der große Christoph
Spielball
Ein ehemaliger Matrose fliegt
Neidisches über einen Klo-Mann
Seehund zum Robbenjäger
Kauderwelcher Bettlerdank
Der Unfall
Morsche Fäden
Köln –– Brüssel –– London
7. August 1929
Gruß ins Blaue
Wer hat gewonnen?
Kinder-Verwirr-Buch
Kleine Lügen
Babies
Kind, spiele!
Beinchen
Schlängelchen
Nie bist du ohne Nebendir
Die Guh gibt Milch und stammt aus Leipzig
Unter Wasser Bläschen machen
Kinder, spielt mit einer Zwirnsrolle!
Das Hexenkind
Den Unterschied bei Mann und Frau
Emanuel Pips
Arm Kräutchen
Ernster Rat an Kinder
Kinder, ihr müßt euch mehr zutrauen!
Bist du schon auf der Sonne gewesen?
Kindersand
Kinder weinen
An Berliner Kinder
Silvester bei den Kannibalen
Geplapper an Grosspapa
Die neuen Fernen
Doch ihre Sterne kannst du nicht verschieben
Rätselhaftes Ostermärchen
Vom andern aus lerne die Welt begreifen
Die Schnupftabaksdose
Die Schnupftabaksdose
Die Ameisen
War einmal ein Schwefelholz
Nein, schimpfte die Ringelnatter
Es war ein Brikett, ein großes Genie
Sie faule, verbummelte Schlampe
Das Schlüsselloch
Es trafen sich von ungefähr
Der Pflasterstein
Ruhe ist viel wert
Der Ohrwurm mochte die Taube nicht leiden
Es lebte an diskretem Orte
Die Badewanne prahlte sehr
Es waren einmal zwei Gummischuh
Es bildete sich ein Gemisch
Lackschuh sprach zum Wasserstiebel
Ein Taschenkrebs und ein Känguruh
Frau Teemaschine sang auf dem Feuer
Rezept
Man stirbt hier vor Langeweile
Es war einmal ein Kragenknopf
Die Nacht erstarb. Und der Tag erwachte
An einem Teiche
Im dunklen Erdteil Afrika
Der Mensch braucht –– ohne sich zu sputen
Tante Qualle und der Elefant
Ein Schutzmann wurde plötzlich krank
Es war ein Stückchen Fromage de brie
Ein Pinsel mit sehr talentvollen Borsten
Ein Lied, das der berühmte Philosoph Haeckel vor sich hinsang
Ein Nagel saß in einem Stück Holz
Der Spiegel, der Kamm
Es war eine gelbe Zitrone
Das Nadelkissen bildete sich ein
Es war einmal ein Kannibale
Ein bettelarmer, braver Mann
Ein kühnes Roßhaar erklärte den andern
Es war einmal ein schlimmer Husten
Ein Kehlkopf litt an Migräne
Errare humanum est
Kalte, falsche, rücksichtslose
Die Nacht war kalt und sternenklar
Sie haben sich gestern schrecklich betragen
»Oh«, rief ein Glas Burgunder
Es war ein Stahlknopf irgendwo
An der Zehe gleich vorn
Mein Leben bis zum Kriege –– Autobiographie
Frühestes
An der Alten Elster
Unsere Spiele daheim
Unsere Dienstmädchen
Des Jahres Feste
In der Volksschule
Gymnasium
Meine Onkels
Auf der Presse
Mein Schiffsjungentagebuch
Stellungslos
Auf der »Florida«
»Das Abenteuer um Wilberforce« –– I. Teil
Seefahrten
Einjährig-Freiwilliger
Kaufmannslehrling und Kommis
»Das Abenteuer um Wilberforce« –– Schluß
München und Buchhalter
Hausdichter im Simplizissimus
Tabakhaus zum Hausdichter
Einflußreiche neue Freunde
Halswigshof
Bilderlingshof
Klein-Oels
Der Rote Münchhausen
Eisenach und Lauenstein
München vor dem Kriege
Ein jeder lebt’s
Die wilde Miß vom Ohio
Das Gute
Zwieback hat sich amüsiert
Auf der Straße ohne Häuser
Vergebens
Sie steht doch still
Gepolsterte Kutscher und Rettiche
Durch das Schlüsselloch eines Lebens
Der tätowierte Apion
Das –– mit dem »blinden Passagier«
Das Grau und das Rot
Phantasie
Geheimes Kinder-Spiel-Buch
Abzähl-Reime
Maikäfermalen
Himmelsklöße
Das Bergmannspiel
Schlacht mit richtigen Bomben
Das Doktor-Knochensplitter-Spiel
Afrikanisches Duell
Eine Erfindung machen
Sich interessant machen
Volkslied
Übergewicht
Spuk mit Rümmel mit Kum
Die Rakete und der Kater
Tante Qualle und der Elefant
Ein Tischbein hing
Ein niedliches Eichhörnchen
Es war ein faules Krokodil
»Ruhe ist viel wert«
So fand ich gestern Nachmittag
Nun sieh mal an! Ei ei!
Es lebte an diskretem Orte
Es war eine gelbe Zitrone
Ein kühnes Roßhaar erklärte den andern
Es war einmal ein schlimmer Husten
Meine Tante, Frau Bebatte
Kasperle-Verse
Kasperle
Schönste Frau
Schutzmann
Lehrer
Tippelmax
Dienstmädchen Kloßblond
Teufel
Doktor Mysteriös
Alte König
Prinzessin Knöllchen
Dienstmann Kümmelhärchen
Riesenkrokodil
Der Tod
Matrose Ringelnatz
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Gesammelte Werke bei Null Papier
Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke
Franz Kafka - Gesammelte Werke
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke
Georg Büchner - Gesammelte Werke
Joseph Roth - Gesammelte Werke
Mark Twain - Gesammelte Werke
Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke
Rudyard Kipling - Gesammelte Werke
Rilke - Gesammelte Werke
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Joachim Ringelnatz
Joachim Ringelnatz wird 1883 als jüngstes von drei Geschwistern in Wurzen bei Leipzig geboren. Seine Eltern sind beide künstlerisch tätig. Die Schulzeit ist schwer für Ringelnatz: Er sieht in seinen Lehrern »respektfordernde Dunkelmenschen« und wird von Mitschülern für sein Aussehen gehänselt. Er flüchtet sich in Trotz, Ungehorsam und erste Versuche als Autor.
Als er sich in einem jugendlichen Überschwang den Arm tätowieren lässt, fliegt er vom Gymnasium. Die Privatschule, auf der er danach landet, verlässt er mit der Anmerkung im Zeugnis, der Absolvent sei »ein Schulrüpel ersten Ranges«.
Ringelnatz will Seemann werden, aber auch auf See wird er Beleidigungen und Spott ausgesetzt. Seine Erfahrungen sind ernüchternd. Zurück in Hamburg schlägt er sich mit mehr als dreißig verschiedenen Gelegenheitsjobs durch. So wechseln in den nächsten Jahren Armut, Betteln und gelegentliche Heuern auf Schiffen einander ab. In dieser zeit wird Ringelnatz schwer alkoholabhängig.
Der Jungautor passt nicht in ein geregeltes Leben, kurze Phasen der Bürgerlichkeit wechseln sich ab mit Ausschweifungen, Vagabundentum und Konflikten mit der Obrigkeit –– seinem Vater eingeschlossen.
Ein entscheidendes Ereignis im Leben Joachim Ringelnatz’ ist 1909 der Beginn seiner Auftritte in der Münchner Künstlerkneipe Simplicissimus. Rasch wird er dort zum festen Mitglied des Ensembles um Carl Georg von Maassen, Erich Mühsam und Frank Wedekind. Aber selbst dort fühlt er sich wenig anerkannt und am Rande stehend, verdient er doch für seine Auftritte wenig mehr als ein, zwei Bier.
Wieder aus Geldnot eröffnet Ringelnatz in München einen Tabakladen, scheitert aber auch dort - natürlich grandios. Parallel veröffentlicht er weiterhin unter verschiedenen Pseudonymen Geschichten, Gedichte und einen ersten Roman (»Was ein Schiffsjungen-Tagebuch erzählt«; in dieser Sammlung unter dem Titel »Mein Schiffsjungentagebuch« veröffentlicht).
Weiter mittel- und ziellos, ein Vagabund, von Gelegenheitsjobs zu Gelegenheitsjobs tingelnd, u. a. als Privatlehrer, Wahrsagerin (sic!) und Bibliothekar, meldet sich Ringelnatz zu Beginn des Ersten Weltkriegs freiwillig zur Marine. Anfänglich von der bei vielen intellektuellen Deutschen bekannten Kriegsromantik getrieben, weicht seine Begeisterung schnell einer Ernüchterung, als er erkennt, dass selbst der Kommiss nichts für ihn übrig hat und ihm jede Möglichkeit der Beförderung oder gar Behauptung im Kriege vorenthält. Er beendet den Krieg als wenig beschäftigter Kommandant eines Minensuchbootes.
Es folgt ein entbehrungsreiches erstes Nachkriegsjahr voller Kälte und Hunger, zudem erblindet er durch die Spätfolgen einer Schlägerei auf einem Auge. Im Dezember 1919 verfasst er die ersten Gedichte unter dem Pseudonym Joachim Ringelnatz. Die wahre Bedeutung des Namens ist weiterhin umstritten.
1920 heiratet Ringelnatz die fünfzehn Jahre jüngere Lehrerin Leonharda Pieper, beide ziehen als Schwarzmieter in eine Münchner Wohnung; das Gedicht »Angstgebet in Wohnungsnot« zeugt von diesen Erfahrungen. Ab da arbeitet er bereits als reisender Vortragskünstler. Ringelnatz, der stets im Matrosenanzug auftritt, wird schnell bekannt. 1927 schafft er es sogar in den Rundfunk. Im selben Jahr erscheinen auch seine beiden erfolgreichsten Gedichtsammlungen: »Kuttel Daddeldu oder das schlüpfrige Leid« und »Turngedichte«.
Trotz dieser ersten, noch kleinen Erfolge leidet das zeitlebens kinderlose Paar weiter Not, Ringelnatz muss weiterhin auf Reisen gehen, trotz seiner angeschlagenen Gesundheit und aufkeimender Unlust. 1932 geht er als Schauspieler in seinem eigenen Stück »Die Flasche« mit einem Ensemble des Stadttheaters Nordhausen auf Gastspielreise durch Deutschland.
1933 erteilen die Nazis Ringelnatz Auftrittsverbot. Die meisten seiner Bücher werden beschlagnahmt oder verbrannt. Seine Malerei gehört jetzt zur entarteten Kunst. Ringelnatz und seine Frau verarmen noch mehr, weil die Bühnenauftritte die Haupteinnahmequelle gewesen sind. Erste Symptome der Tuberkulose treten auf. Nach einem längeren Aufenthalt im Sanatorium, der von Freunden finanziert wird, und aus dem er sich später selbst entlässt, stirbt Ringelnatz am 17. November in seiner Berliner Wohnung.
Lyrik
Turngedichte
(Text der erweiterten Auflage von 1923)
1923 by Kurt Wolff Verlag A.-G., München.
Zum Aufstellen der Geräte
(Ein Muster)
So unterwegs in einem schönen Hechtsprung Erblickte er das Licht der Welt, das Leben, Und hat –– obwohl er damals doch noch recht jung –– Sich doch sofort in Hilfsstellung begeben. Den Kniesturz übend und manch andre Tugend, Verging ihm eine turnerische Jugend Im Wachen teils und teils im Traum Und Freitagnachmittags am Schwebebaum. Vorturner wurde er und Löwenbändiger, Seemann und Schornsteinfeger, Akrobat Und schließlich turnerischer Sachverständiger Im transsibirischen Artistenrat. Er las die Morgenzeitung stets im Handstand, Vom Hang der Freiheit sprach sein roter Schlips. Er glich –– wie er im Turnsaal an der Wand stand –– Dem allbekannten Herkules aus Gips. Inhaber aller silbernen Pokale, Erwarb er sich den Franziskanerpreis Und im August in Halle an der Saale Die Jahnkokarde mit dem Lorbeerreis. Ein zarter Kern in einer rauhen Schale. Er hat sich mit einem Salto mortale Aus dem Leben Über ein Felsengeländer Hinwegbegeben.
Turnermarsch
(Melodie: Leise flehen meine Lieder)
Schlagt die Pauken und Trompeten, Turner in die Bahn! Turnersprache laßt uns reden. Vivat Vater Felix Dahn! Laßt uns im Gleichschritt aufmarschieren, Ein stolzes Regiment. Laß die Fanfaren tremulieren! Faltet die Fahnen ent! Die harte Brust dem Wetter darzubieten, Reißt die germanische Lodenjoppe auf! Kommet zu Hauf! Wir wollen uns im friedlichen Wettkampf üben. Braust drei Hepp-hepps und drei Hurras Um die deutschen Eichenbäume! Trinkt auf das Wohl der deutschen Frauen ein Glas, Daß es das ganze Vaterland durchschäume. Heil! Umschlingt euch mit Herz und Hand, Ihr Brüder aus Nord-, Süd- und Mitteldeutschland! Daß einst um eure Urne Eine gleiche Generation turne.
Freiübungen
(Grundstellung)
Wenn eine Frau in uns Begierden weckt Und diese Frau hat schon ihr Herz vergeben, Dann (Arme vorwärts streckt!) Dann ist es ratsam, daß man sich versteckt. Denn später (langsam auf den Fersen heben!) Denn später wird uns ein Gefühl umschweben, Das von Familiensinn und guten Eltern zeugt. (Arme –– beugt!) Denn was die Frau an einem Manne reizt, (Hüften fest –– Beine spreizt! –– Grundstellung) Ist Ehrbarkeit. Nur die hat wahren Wert, Auch auf die Dauer (Ganze Abteilung, kehrt!). Das ist von beiden Teilen der begehrtste, Von dem man sagt: (Rumpfbeuge) Das ist der allerwertste.
Kniebeuge
Kniee –– beugt! Wir Menschen sind Narren. Sterbliche Eltern haben uns einst gezeugt. Sterbliche Wesen werden uns später verscharren. Schäbige Götter, wer seid ihr? und wo? Warum lasset ihr uns nicht länger so Menschlich verharren? Was ist denn Leben? Ein ewiges Zusichnehmen und Vonsichgeben. –– Schmach euch, ihr Götter, daß ihr so schlecht uns versorgt, Daß ihr uns Geist und Würde und schöne Gestalt nur borgt. Eure Schöpfung ist Plunder, Das Werk sodomitischer Nachtung. Ich blicke mit tiefster Verachtung Auf euch hinunter. Und redet mir nicht länger von Gnade und Milde! Hier sitze ich; forme Menschen nach meinem Bilde. Wehe euch Göttern, wenn ihr uns drüben erweckt! Beine streckt!
Zum Bockspringen
(Nach einer Fabel Ae-sops)
Wie war die Geschichte mit Bobs Wauwau? Ich erinnere mich nicht ganz genau, Ob dieser Hund Bobs –– Eins, zwei, drei –– hops! –– Ob dieser Hund ein Rebhuhn gebar? Auf welcher Seite er schwanger war, Und inwiefern und ob’s –– Eins, zwei, drei –– hops! –– Ein Dackel war, der das Rebhuhn erzeugte, Und ob er das arme Geflügel dann säugte. –– Ich glaube, der Dackel war ein Mops. –– –– Eins, zwei, drei –– hops! –– Jedenfalls fraß er zu jedermanns Ärger Nur Wickelgamaschen und Königsberger, Auch Danziger Klops. –– Eins, zwei, drei –– hops! –– Ein seltsamer Mops war Bobs Wauwau. –– Eins, zwei, drei –– hops! –– au! au!
Wettlauf
Publikum ungeduldig scharrt –– Scharren lassen –– hier Start –– Taschentuch? keins –– Schweiß –– heiß –– zum Beweis des Nichtaufgeregtseins: Billett Spucke kneten. Achtung: eins! Nicht mehr Zeit auszutreten –– Was? Rauchen verbeten? –– Sie da, der Dritte, weiter zurücktreten –– Soo! –– Endlich Musik –– Der bekannte Augenblick, wo –– wenn der Trikot nur nicht so spannte –– Schweinerei –– Wäre fatal –– Achtung: Zwei! Teufel nochmal! Heiliger Joseph, steh mir bei! Achtung: Drei! Tapelti, tapelti, tapelti Mut! Gut! Kopf senken! Arme vom Leib! Frieda denken! Herrliches Weib! Schade, daß Mund stinkt! Das war sie! –– lacht –– winkt –– Oh, oh! Oh, oh! Mein Trikot! Vorne gespalten. Taschentuch vorhalten –– Jetzt Quark! Nur laufen! 10 000 Mark –– Wochenlang saufen –– Wenn’s glückt –– Schulden bezahlen –– Tante verrückt –– Meyers prahlen –– Sieger gratuliert –– Photographiert –– Händedruck –– Tun als ob schnuppe –– Wändeschmuck –– Lorbeersuppe –– Zeitungsreklame –– Filmaufnahme –– Frieda seidenes Kleid –– Otto platzt Neid –– Engelmann –– Wut –– Anton –– Pump –– Aushalten! Mut! Weg da! Lump! –– Einer von beiden –– Weg abschneiden –– Puff! Was bild’t sich –– Uff! Gilt nich! Feste druff! Gar nicht kümmern! Schädel zertrümmern! Zuchthaus –– Flucht –– Haus –– Schande –– Tante –– Sterben –– Beerben –– Unsinn! Was Quatsch! Quatsch! Teufel noch mal! Laternenpfahl. Mehr links, ach! ach! Stopp! Frieda! Halt! Krach! Kladderadatsch! Knätsch daun! au! aus! Ohhhhh! –– Publikum Applaus.
Klimmzug
Das ist ein Symbol für das Leben. Immer aufwärts, himmelan streben! Feste zieh! Nicht nachgeben! Stelle dir vor: Dort oben winken Schnäpse und Schinken. Trachte sie zu erreichen, die Schnäpse. Spanne die Muskeln, die Bizepse. Achte ver die Beschwerden. Nicht einschlafen. Nicht müde werden! Du mußt in Gedanken wähnen: Du hörtest unter dir einen Schlund gähnen. In dem Schlund sind Igel und Wölfe versammelt. Die freuen sich auf den Menschen, der oben bammelt. Zu! Zu! Tu nicht überlegen. Immer weiter, herrlichen Zielen entgegen. Sollte dich ein Floh am Po kneifen, Nicht mit beiden Händen zugleich danach greifen. Nicht so ruckweis hin und her schlenkern; Das paßt nicht für ein Volk von Turnern und Denkern. Klimme wacker, Alter Knacker! Klimme, klimb Zum Olymp! Höher hinauf! Glückauf! Kragen total durchweicht. Äh –– äh –– äh –– endlich erreicht. Das Unbeschreibliche zieht uns hinan, Der ewigweibliche Turnvater Jahn.
Felgeaufschwung
Die wir im Felgeaufschwung uns befinden, Schwer wie das Eisen, das der Ristgriff faßt, Und wurde uns der eigne Leib zur Last. Und langsam sehen wir den Tag entschwinden. Ein abgerissenes Sichvorwärtsschwingen –– Ein seelenloses Steigen über nichts. –– Von Leiden spricht das Zucken des Gesichts. Nur in der Ferne tönt ein Vesperklingen. Nun sinkt das Haupt herab, und wie zum Schwören Hebt sich der Füße zages Doppelspiel. Und abermals erlahmt die Kraft am Ziel, Um wieder sich von neuem zu betören. Und werden doch den toten • überwinden, Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist weich, Sitzwellend einst, dem Wellensittich gleich, So werden wir uns droben wiederfinden.
Während der Riesenwelle
Seht ihr mich? Und spürt ihr nicht den Wind, Den ich mache? Ja, das ist gefährlich! Aber mir, dem alten Seemann, sind Riesenwellen eben unentbehrlich. Käme mir jetzt einer in die Speichen (Wär’ es auch ein Riese aus Granit), Würde er doch damit nur erreichen, Daß ich ihn in dünne Scheiben schnitt. Aber nicht die Herstellung von Scheiben Denk ich mir als Lebenszweck. O nein! Eine Sägemühle möcht’ ich treiben, Möcht’ ein Schwungrad für Dynamo sein. Wenn ich plötzlich jetzt die Hände strecke (Und ich habe ähnliches im Sinn), Ja dann –– splittert augenblicks die Decke, Und der Wellenriese –– ist dahin.
Am Barren
(Alla donna tedesca)
Deutsche Frau, dich ruft der Barrn, Denn dies trauliche Geländer Fördert nicht nur Hirn und Harn, Sondern auch die Muskelbänder, Unterleib und Oberlippe. Sollst, das Hüftgelenk zu stählen, Dich im Knickstütz ihm vermählen. Deutsches Weib, komm: Kippe, Kippe! Deutsche Frau, nun laß dich wieder Ellengriffs im Schwimmhang nieder. So, nun Hackenschluß! Und schwinge! Schwinge! Hurtig rum den Leib! O, es gibt noch wundervolle Dinge. Rolle vorwärts! Rolle! Rolle rückwärts, deutsches Weib! Deutsche Jungfrau, weg das Armband! In die Hose! Aus dem Rocke! Aus dem Streckstütz in den Armstand, Nun die Flanke. Sehr gut! Danke! Deutsches Mädchen –– Hocke, Hocke! Mußt dich keck emanzipieren Und mit kindlichem »Ätsch-Ätsche« Über Männer triumphieren, Mußt wie Bombe und Kartätsche Deine Kräfte demonstrieren. Deutsches Mädchen –– Grätsche! Grätsche!
Kniehang
Ich wollte, ich wär’ eine Fledermaus, Eine ganz verluschte, verlauste, Dann hing ich mich früh in ein Warenhaus Und flederte nachts und mauste, Daß es Herrn Silberstein grauste. Denn Meterflaus, Fliedermus, Fledermaus –– (Es geht nicht mehr; mein Verstand läuft aus.)
Am Hängetau
Das Hängetau ist lang und steil. Jedoch die Übung an dem Seil Ist heilsam und veredelt. Dieweil du kletterst, wächst das Tau Dir hintenraus und wedelt À la Wauwau. Marie, die unten nach dir blickt, Kommt mit der Quaste in Konflikt. Ich wette um ein Faß Gelee: Drei Meter über der Erden Erfaßt dich plötzlich die Idee, Du möchtest Seemann werden. Der Kletterschluß mißlingt dir freilich. Er klingt auch häßlich papageilich. Schon dieserhalb und um so mehr Schwankst du verzweifelt hin und her Als atemloser Pendel. Und jäh umgibt dich in der Luft Ein unartikulierter Duft Sehr abseits von Lawendel. Und dann erreichst du ganz verzagt Den Balken unter Pusten, Und weil Marie von unten fragt, Und weil die Stimme dir versagt, So fängst du an zu husten. Die Dame fragt, ob schwindelfrei Und schüttelt die Manilla. Du mimst voll Angst und Heuchelei Den schwärmenden Gorilla. Doch weil allmählich Zeit vergeht Und nirgends eine Leiter steht, Entschließt du dich voll Grausen Und präsentierst dein Hinterteil Und angelst lange nach dem Seil Und läßt dich plötzlich sausen. Du plumpst der Dame auf die Brust Und tust, als tätst du das bewußt, Und blähst dich wie ein Segel. Und nickst ein heiteres Allheil! Und lachst und fühlst dich doch derweil Teils Burschenschaft, teils Flegel. Kein Mädchen, nicht einmal die Braut, Sieht gerne Hände ohne Haut.
Rundlauf
Heran in die Tiefe, seitab in die Höh –– Auf der Reise im Kreise gewiegt. Die Mädels, die Buben, Madame und Monsieur, Das baumelt und taumelt und fliegt. Es schweben die Röcke wie Glocken dahin, Und ein viel tätowierter Gesell, Der fiedelt und sieht nur die Klöppel darin, Und er spielt, und er fühlt Karussell. Ein strudelnder Drall im ätherischen Bad, Vor dem selbst der König sich bückt. O Leben im Winkel von 50 Grad, Du lachst uns und machst uns verrückt.
Zum Keulenschwingen
Die Merowinger sind weit verzweigt. Es lebte ein Merowinger, Den die Geschichte uns leider verschweigt, Ein wackerer Keulenschwinger. Mit beiden Händen und Leidenschaft Schwang er die Keulen, die schönen. Er schwang sie mit barbarischer Kraft Unter leisem teutonischen Stöhnen. Er teilte die Lüfte und teilte vorbei Mit seiner gewuchtigen Keule. Er schlug seiner Mutter die Backe entzwei, Erschlug seine Kinder und Gäule. Erschlug mit übernatürlicher Kraft Des Königs wieherndes Vollblut. Da wurde er aber fortgeschafft In eine Zelle für Tollwut. Man nahm ihm die Keule, er konnte nicht mehr Sie schwingen in sausenden Kurven. Die Zelle ward still und nahezu leer, Man hörte nur Schritte schlurfen. Doch eines Tages dröhnte es dumpf. Der Wächter tat sich beeilen. Da sah er einen niedrigen Rumpf Mit seinen leibeigenen Keulen Die Wände der Zelle verbeulen. Da fing der Mann an zu heulen.
Das Turngedicht am Pferd
(Schon den Römern bekannt)
Es lebte an der Mündung der Dobrudscha Ein Roll- und Bier- und Leichenwagenkutscher. Der riß lebendigem Getier –– o Graus! –– Mit kaltem Blut die Pferdeschwänze aus. Hopla! Jedoch verscherzte er mit solchen Streichen Sich den Verkehr mit Roll und Bier und Leichen Und frönte nun dem Trunk, auch nebenbei Der Kunst, speziell der Pferdeschlächterei. Hopla! Man traf ihn manchmal unter Viadukten Mit Pferdeköpfen, die noch lebhaft zuckten, Und fragte man dann nach dem Preis pro Pfund, Dann brüllte er und hatte Schaum vorm Mund: »Hopla!« Doch abermals aus dem Beruf gestoßen, Ergab er sich dem Schicksal aller Großen Und wurde –– solches traf sich eben gut –– Pedell an einem Turninstitut. Hopla! Schon im Begriff, sein Leben umzuwandeln, Besoff er sich und stürzte über Hanteln. Er wußte selber nicht, wie weit, wie tief; Jedoch er fragte gar nicht, sondern schlief. ...la... Punkt Mitternacht bemerkte der Betäubte, Daß sich sein Haar mit leisem Knirschen sträubte. Er wachte auf und sah im bleichen Glanz Ein Pferd, ein Pferd, ganz ohne Haupt und Schwanz. ...pla! Nun reckte sich das abenteuerliche Gespenst und wuchs ins Ungeheuerliche. Drei Meter mochte es gewachsen sein, Da hielt es inne, schnappte plötzlich ein. Hopla! Und nun, wohl in Ermangelung von Äpfeln, Begann es Sägemehl aus sich zu tröpfeln. »Mensch«, rief es, »der du Tiere quälen kannst, Auf! Springe über meinen Lederwanst. Hopla!« Er sprang bereits, wie ihn die Formel bannte, Er sprang und fiel, erhob sich wieder, rannte Und sprang und rannte, sprang und sprang und sprang, Wohl stunden-, tage-, wochen-, jahrelang. Hopla! Hopla! Hopla! Hopla! Bis plötzlich unter ihm das Pferd zerkrachte. Da brach er auch zusammen, und erwachte. Indem er schwur, nie wieder nachts zu picheln, Bemerkte er, gereizt durch fremdes Sticheln, Daß ihn, der doch sich täglich glatt rasierte, Ein langer Zwickelbart aus Roßhaar zierte. Ho!
Bumerang
War einmal ein Bumerang; War ein Weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, Aber kam nicht mehr zurück. Publikum –– noch stundenlang –– Wartete auf Bumerang.
Fußball
(nebst Abart und Ausartung)
Der Fußballwahn ist eine Krank- Heit, aber selten, Gott sei Dank. Ich kenne wen, der litt akut An Fußballwahn und Fußballwut. Sowie er einen Gegenstand In Kugelform und ähnlich fand, So trat er zu und stieß mit Kraft Ihn in die bunte Nachbarschaft. Ob es ein Schwalbennest, ein Tiegel, Ein Käse, Globus oder Igel, Ein Krug, ein Schmuckwerk am Altar, Ein Kegelball, ein Kissen war, Und wem der Gegenstand gehörte, Das war etwas, was ihn nicht störte. Bald trieb er eine Schweineblase, Bald steife Hüte durch die Straße. Dann wieder mit geübtem Schwung Stieß er den Fuß in Pferdedung. Mit Schwamm und Seife trieb er Sport. Die Lampenkuppel brach sofort. Das Nachtgeschirr flog zielbewußt Der Tante Berta an die Brust. Kein Abwehrmittel wollte nützen, Nicht Stacheldraht in Stiefelspitzen, Noch Puffer außen angebracht. Er siegte immer, 0 zu 8. Und übte weiter frisch, fromm, frei Mit Totenkopf und Straußenei. Erschreckt durch seine wilden Stöße, Gab man ihm nie Kartoffelklöße. Selbst vor dem Podex und den Brüsten Der Frau ergriff ihn ein Gelüsten, Was er jedoch als Mann von Stand Aus Höflichkeit meist überwand. Dagegen gab ein Schwartenmagen Dem Fleischer Anlaß zum Verklagen. Was beim Gemüsemarkt geschah, Kommt einer Schlacht bei Leipzig nah. Da schwirrten Äpfel, Apfelsinen Durch Publikum wie wilde Bienen. Da sah man Blutorangen, Zwetschen An blassen Wangen sich zerquetschen. Das Eigelb überzog die Leiber, Ein Fischkorb platzte zwischen Weiber. Kartoffeln spritzten und Zitronen. Man duckte sich vor den Melonen. Dem Krautkopf folgten Kürbisschüsse. Dann donnerten die Kokosnüsse. Genug! Als alles dies getan, Griff unser Held zum Größenwahn. Schon schäkernd mit der U-Bootsmine Besann er sich auf die Lawine. Doch als pompöser Fußballstößer Fand er die Erde noch viel größer. Er rang mit mancherlei Problemen. Zunächst: Wie soll man Anlauf nehmen? Dann schiffte er von dem Balkon Sich ein in einem Luftballon. Und blieb von da an in der Luft, Verschollen. Hat sich selbst verpufft. –– Ich warne euch, ihr Brüder Jahns, Vor dem Gebrauch des Fußballwahns!
Der Athlet
Mein Name ist Murxis, der Kraftmensch genannt. Meine Nahrung ist Goulasch vom Elefant In einer Sauce des Stärkemehles. Meine Heimat ist das Zentrum Südwales, Upsala! Ich wurde durch einen Kaiserschnitt Geboren, mit Hilfe von Dynamit. Daß ich noch lebte, war reines Glück. Von meiner Mutter blieb wenig zurück. 20 kg mit dem kleinen Finger. Man baute um mich eine Art von Dock. Mit Strebestützen im 16. Stock Eines Wolkenkratzers von Rockefeller. Das Stockwerk brach, man fand mich im Keller Mit verschränkten Armen. Ich war in allen Städten der Welt Als Muster von Herkules ausgestellt. Wer das bezweifelt –– 5 Groschen ––, der fordre An der Kasse die Wachskabinettsordre. Ich nenne mich selbst den Venus von Milo. Bruttogewicht: 200 Kilo! Es haben mich Königinnen betastet. Ich habe einmal drei Wochen gefastet Und unternehme auch heute noch Schritte Zu meiner Entlastung. Und deshalb bitte Ich die Herrschaften um ein kleines Douceur.
Boxkampf
Bums! –– Kock, Canada: –– Bums! Käsow aus Moskau: Puff! puff! Kock der Canadier: –– Plumps! Richtet sich abermals uff. Ob dann der Käsow den Kock haut, Oder ob er das vollzieht, Ob es im Bauchstoß, im Knock-out Sprich –– »nock«, wie bei Butternockerlsuppe Oder von seitwärts geschieht –– Kurz: Es verlaufen die heit’ren Stunden wie Kinderpipi. Sparen wir daher die weit’ren Termini technici. Und es endet zuletzt Reizvoll, wie es beginnt: Kock wird tödlich verletzt. Käsow aber gewinnt. Leiche von Kock wird bedeckt. Saal wird langsam geräumt. Käsow bespült sich mit Sekt. Leiche aus Canada träumt: Boxkampf –– Boxer –– Boxen –– Boxel –– Boxkalf –– Boxtrott –– Boxtail –– Boxbeutel.
Ringkampf
Gibson (sehr nervig), Australien, Schulze, Berlin (ziemlich groß). Beißen und Genitalien Kratzen verboten. –– Nun los! Ob sie wohl seelisch sehr leiden? Gibson ist blaß und auch Schulz. Warum fühlen die beiden Wechselnd einander den Puls? Ängstlich hustet jetzt Gibson. Darauf schluckt Schulze Cachou. Gibson will Schulzen jetzt stipsen. Ha! Nun greifen sie zu. Packen sich an, auf, hinter, neben, in, Über, unter, vor und zwischen, Statt, auch längs, zufolge, trotz Stehen auf die Frage wessen. Doch ist hier nicht zu vergessen, Daß bei diesen letzten drei Auch der Dativ richtig sei. (Pfeife des Schiedsrichters.) Wo sind die Beine von Schulze? Wem gehört denn das Knie? Wirr wie lebendige Sülze Mengt sich die Anatomie. Ist das ein Kopf aus Australien? Oder Gesäß aus Berlin? Jeder versucht Repressalien, Jeder läßt keinen entfliehn. Hat sich der Schiedsmann bemeistert, Lange parteilos zu sein; Aber nun brüllt er begeistert: »Schulze, stell ihm ein Bein! Zwinge den Mann mit den Nerven Nieder nach Sitte und Jus. Kannst du dich über ihn werfen Just wie im Koi, dann tu’s!«
Zum Schwimmen
(Die Brüder)
Plumps! Nun liegst du endlich drin, Nun hat es wirklich nicht mehr Sinn, Noch länger den Denker und Dichter zu mimen. Sonst gibt’s mal was mit dem ledernen Riemen! Lacht mal den Onkel aus, ihr Kinder! Wißt ihr’s? Das ist der Erfinder Des drahtlosen Schwebeklistiers, Der Panslapopel, der große Mann! Wie Seidenpapier liegt die Hose an. Der Doktor phil. und der Doktor jur. –– –– Ja, pruste du nur! Wie eifrig du spuckst Und das Gespuckte noch einmal verschluckst. Du »Autor« von »Das Leben von Stosch!« –– Eine Qualle bist du, ein schleimiger Frosch, Ein wulstiger, schwulstiger, schwappliger, nasser. Und willst der Verfasser Der Biographie sein! Ziehe das Knie ein! Nach auswärts die Beine! Du Stubenhocker! Hier sind ein paar Steine Am Ufer recht locker. –– –– Sieht aus wie Blaukraut mit Sommersprossen. Na? Eins, zwei, drei –– vier, fünf, die Hände geschlossen! Und: eins, zwei, drei –– vier, fünf; noch besser, viel besser! Ich werde dir was von wegen Professor! Los: eins, zwei, drei –– vier, fünf. Du Schlumpsack, nur weiter! Wird’s? Eins, zwei, drei –– vier, fünf. Nun ’ran an die Leiter! Du ausgeschwängertes Schwielenschwein! Ein Wort –– und ich stoße dich nochmals hinein.
Zum Wegräumen der Geräte
Veterinär, gleichzeitig Veteran, Ein Mann, der 92 Jahre zählte, Daß man zuletzt ihn aus Gewohnheit wählte, Und trotzdem biegsam, schmiegsam wie ein Schwan. Das war –– trotz eines halbgelähmten Beines –– Der Ehrenvorstand unsres Turnvereines. Und wirklich nahm er’s noch im Dauerlauf Und Schleuderball mit jedem Rennpferd auf. Wettläufer sah ich –– nun Gott weiß wieviel, Doch ihrer keiner hielt wohl mit der gleichen Bescheidenheit gelassen vor dem Ziel. Denn niemand konnte ihm das Wasser reichen. Dann griff er abseits zum Pokal. Und Hei! Wie Donner klang sein Frisch-Fromm-Fröhlich-Frei. Wie sich sein Vollbart, den er gern sich wischte, Nach einem 80-cm-Sprung Mit Kokosfasern einer Matte mischte, Das bleibt mir ewig in Erinnerung. Im Springen konnte überhaupt dem Alten Zuletzt wohl keiner mehr die Stange halten. Einmal, nach dem Genuß von sehr viel Weißwein, Verstauchte er beim Spaltsitz auf dem Reck Ganz unvermutet plötzlich sich das Steißbein. Er aber wich und wankte nicht vom Fleck. Im Gegenteil, er brach, um uns zu necken, Sich noch den Sitzknorren der Sitzbeine am Becken. Er turnte gern der Jugend etwas vor Und mühte sich vor Buben oder Mädeln, Die Beine in die Ringe einzufädeln, Wobei er niemals die Geduld verlor. Dann staunte ehrfurchtsvoll solch junges Ding, Wenn er wie Christbaumschmuck im Nesthang hing. Denn was ein Nesthängchen werden will, krümmt sich beizeiten.
Laufschritt-Couplet
Wenn doch die Pferdebahn noch wär’! Da wurde bald der Kondukteur Und bald der Gaul verdroschen, Und manchmal lief man nebenher Und sparte sich den Groschen. Die Feuersbrunst ergriff mich sehr. Das Schulgebäude steht nicht mehr. Schon spielen Kinder fromm umher Mit den verkohlten Stücken. Dann räumt man auf, der Platz wird leer Und nun beginnt die Feuerwehr Allmählich anzurücken. Der Laufschritt freut beim Militär Uns über alle Maßen. Zwar drückt der Affe reichlich schwer, Ganz abgesehn von dem Gewehr, Der Blase und den Blasen, Doch außerdem: man fühlt sich sehr, Singt: »Wenn ich doch ein Vöglein wär’« Und kann sich so von ungefähr Das Mittagbrot vergasen.
Die Lumpensammlerin
Hält sie den Kopf gesenkt wie ein Ziegenbock, Ihre Gemüsenase, Ihr spitzer Höcker, ihr gestückelter Rock Haben die gleiche farblose Drecksymphonie Der Straße. Mimikry. Selbständig krabbeln ihre knöchernen Hände Die Gosse entlang zwischen Kehricht und Schlamm, Finden Billette, Nadeln und Horngegenstände, Noch einen Knopf und auch einen Kamm. Über Speichel und Rotz zittern die Finger; Hundekötel werden wie Pferdedünger Sachlich beiseitegeschoben. Lumpen, Kork, Papier und Metall werden aufgehoben, Stetig –– stopf –– in den Sack geschoben. Der Sack stinkt aus seinem verbuchteten Leib. Er hat viel spitzere Höcker. Er ist noch ziegenböcker Als jenes arg mürbe Weib. Schlürfend, schweigsam schleppt sie, schleift sie die Bürde. Wenn sie jemals niesen würde, Was wegen Verstopfung bisher nie geschah, Würde die gute Alte zerstäuben Wie gepusteter Paprika. –– Und was würde übrigbleiben? Eine Schnalle von ihrem Rock, Sieben Stecknadeln, ein Berlock, Vergoldet oder vernickelt. Vielleicht auch: Vielmals eingewickelt Und zwischen zwei fettigen Pappen: Fünfzig gültige, saubere blaue Lappen. Irgendwo würde ein Stall erbrochen, Fände man sortiert, gestapelt, gebündelt, umschnürt Lumpen, Stanniol, Strumpfenbänder und Knochen. Was hat die Hexe für ein Leben geführt? Vielleicht hat sie Lateinisch gesprochen. Vielleicht hat einst eine Zofe sie manikürt. Vielleicht ist sie vor tausend Jahren als Spulwurm Durch das Gedärm eines Marsbewohners gekrochen.
Sorge dividiert durch 2 hoch x
Grübeln und grübeln nun stundenlang –– Bing –– Bumpf –– Bang –– –– Korks jetzt! Lona, und prost! Kling! Klang! Ein Schurke ist gar kein Feind. Hoch steht überm zeitlichen Raffinement Die ewige Regel: Daß immer mal wieder die Sonne scheint. Liebstes, armes, verquollenes Kind, So wie wir beide im Augenblick so sind, Scheint uns die Sonne noch immer recht anständig lind. Ihn macht sie frösteln oder sie kocht ihn jetzt heiß. Bleiben wir aber so! Sein wir nie schadenfroh! Ist auch die Sache sehr unangenehm –– Jedes w soll schwinden im Schweiß, Oder –– nein, vor allem und außerdem –– –– Na du weißt –– –– Und ich weiß –– ––
Stimme auf einer steilen Treppe
Drei Söhne hab’ ich bei die Ulanen verloren, Mein Mann fiel aus dem dritten Stock. Aber –– es wird lustig weitergeboren! Ich habe nur noch den einen, den Umstandsrock. Macht es mir nach: Werdet schwanger, ihr Weiber! Alle Weiber müssen schwanger sein. Dann springen die Männer vor eure geschwollenen Leiber Links und rechts beiseite und sind ganz klein. Aller Anfang ist schwer. Pfeift auf die Fehlgeburten und Mißgeburten. –– Wenn nicht immer mal wieder zwei Menschen hurten, Blieben zuletzt die Wirtshäuser leer, Gab’s keine Soldaten mehr. Die Schweinerei ist nun doch einmal Sitte und Brauch. Gott hat uns Weiber zu Schöpferinnen gesalbt. Schiebt also trotzig euren geladenen Bauch Über die Friedhöfe hin. –– Und kalbt!
Chansonette
War ein echter Prinz und hat Warzen im Bett. Und kniete vor jeder Schleife. Vaters Leiche lag auf dem Bügelbrett Und roch nach Genever und Seife. Wenn der Pfaffe unter meine Röcke schielt, Sagt die Alte, werd’ ich Geld bekommen. Meinem Bruder, der so schön die Flöte spielt, Haben Sie die Nieren rausgenommen. Glaubst du noch an Gott? und spielst du Lotterie? Meine Schwester kommt im Juli nieder. Doch der Kerl ist ein gemeines Vieh. Schenk mir zwanzig Mark; du kriegst sie wieder. Außerdem: ich brauche ein Korsett, Und ein Nadelchen mit blauen Steinen. In ein Kloster möcht ich. Oder bei’s Ballett. Manchmal muß ich ganz von selber weinen.
Das Geschwätz in der Bedürfnisanstalt in der Schellingstraße
Heute wurde Geld eingesammelt, Wo ich angestellt bin, in dem Büro, Für die Frau von jemand, der sich erhängte. Eine Büchse ging rum. Und jeder schenkte. Drei Mark; das ist bei uns immer so. Es braucht niemand zu wissen, wodran ich bin. Ich habe das Geld meiner Mutter gestohlen. Ich habe noch gestern acht Mark für Kohlen Bezahlt. Und die Alte stumpft doch bloß so hin. Und bei ihrer Schwindsucht und sowieso Kann es ja doch nicht mehr lange währen. Ich kann auch nicht ewig fünf Menschen ernähren Bei der Arbeit in dem Büro. Ich möchte mal wieder eine Muhsik hören; Das stimmt einen wieder mal froh.
Worte eines durchfallkranken Stellungslosen in einen Waschkübel gesprochen
Bloß weil ich nicht aus Preußen gebürtig. Wo hab’ ich nur den Impfschein verloren? Das lange Warten auf den Korridoren, Das ist so un-, so unwürdig. Wären wenigstens meine Haare geschoren. Und den Durchfall habe ich auch. Das geht mitten im Gespräch plötzlich eiskalt aus dem Bauch. Als mich Miß Hedwin erkannte und rief, Die hab’ ich vor Jahren, in Genf, einmal –– versetzt. Nun sind meine Absätze schief. Und sie trug ein Reitkleid und fütterte Kücken. Aber ich darf mich nicht bücken. Denn meine –– ach mein ganzes Herz ist zerfetzt. Ob ich gespeist habe? Ob mir die Hecke gefiele? Ja ich habe –– gespeist. –– (In Genf! Und zuletzt, vor drei Tagen, Semmel mit Senf) Und mich können alle Hecken Am Asche ––. Vergessen sei Genf, vergessen die ganze Schweiz! Dürfte ich nur noch einmal in Seifhennersdorf oder Zeitz Steine klopfen. Ach! –– ich möchte jenem verdammten Stellenvermittlungsbeamten Siebzehn Legitimationspapiere meines Großvaters mütterlicherseits In den Rachen stopfen! Auch hat mich vorübergehend durchzuckt: Ich wollte sterben nach einer grellen Raketentat. Ich habe Lysol und einen Drillbohrer verschluckt. Ich sandte ein Kuvert an den Hamburger Senat; In das Kuvert hatte ich kräftig gespuckt. Aber niemand glaubt an den Dreck. Nun ist meine Seife weg; Irgend jemand stöbert in meinen Taschen. –– Ich kann mir doch nicht Das Gesicht Mit einem Bouillonwürfel waschen. Nun warte ich auf gigantisches Weltgeschehn. Wenn’s mich –– zusammen mit den andern –– zerfleischt, Wenn das Sterben der anderen, Glücklichen mich umkreischt, –– Dann –– Dann will ich mir eine Zigarette drehn!
Nachtgalle
Weil meine beiden Beine Erfolglos müde sind, Und weil ich gerade einsam bin, Wie ein hausierendes Streichholzkind, Setz ich mich in die Anlagen hin Und weine. Nun hab ich lange geweint. Es wird schon Nacht; und mir scheint, Der liebe Gott sei beschäftigt. Und das Leben ist –– alles, was es nur gibt: Wahn, Krautsalat, Kampf oder Seife. Ich erhebe mich leidlich gekräftigt. Ich weiß eine Zeitungsfrau, die mich liebt. Und ich pfeife. Ein querendes Auto tutet. –– Nicht Gold noch Stein waren echt An dem Ring, den ich gestern gefunden. –– Die nächtliche Straße blutet Aus tausend Wunden. Und das ist so recht.
Wenn ich allein bin
Wenn ich allein bin, werden meine Ohren lang, Meine, meine Pulse horchen bang Auf queres Kreischen, sterbenden Gesang Und all die Stimmen scheeler Leere. Wenn ich allein bin, leck ich meine Träne. Wenn ich allein bin, bohrt sich meine Schere, Die Nagelschere in die Zähne; Sielt höhnisch träge sich herum die Zeit. –– Der Tropfen hängt. –– Der Zeiger steht. –– Einmal des Monats steigt ein Postpaket Aufrührerisch in meine Einsamkeit. So sendet aus Meran die Tante Liese Mir tausend fromme, aufmerksame Grüße; Ein’ jeden einzeln sauber einpapiert, Mit Schleifchen und mit Fichtengrün garniert, Vierblätterklee und anderm Blumenschmuck –– Ich aber rupfe das Gemüse Heraus mit einem scharfen Ruck, Zerknülle flüchtig überfühlend Den Alles-Gute-Wünsche-Brief Und fische giftig tauchend, wühlend, Aus all den Knittern und Rosetten Das einzige, was positiv: Zwei Mark für Zigaretten. Die Bilder meiner Stube hängen schief. In meiner Stube dünsten kalte Betten. Und meine Hoffart kuscht sich. Wie ein Falter Sich ängstlich einzwängt in die Borkenrinde. Wenn ich allein bin, dreht mein Federhalter Schwarzbraunen Honig aus dem Ohrgewinde. Bin ich allein: Starb, wie ein Hund verreckt, Hat mich ein fremdes Weib mit ihren Schleiern Aus Mitleid oder Ekel zugedeckt. Doch durch die Maschen seh ich Feste feiern, Die mich vergaßen über junger Lust. –– Ich reiße auseinander meine Brust Und lasse steigen all die Vögel, die Ich eingekerkert, grausam dort gefangen, Ein Leben lang gefangenhielt, und nie Besaß. Und die mir niemals sangen. Wenn ich allein bin, pups ich lauten Wind. Und bete laut. Und bin ein uralt Kind. Wenn ich ––
Das Geseires einer Aftermieterin
Meine Stellung hatte ich verloren, Weil ich meinem Chef zu häßlich bin. Und nun habe ich ein Mädchen geboren, Wo keinen Vater hat, und kein Kinn. Als mein Vormund sich erhängte, Besaß ich noch das Kreppdischingewand, Was ich später der Anni schenkte. Die war Masseuse in Helgoland. Aber der bin ich nun böse. Denn die ließ mich im Stich. Und die ist gar keine Masseuse, Sondern geht auf den ––. Mir ist nichts nachzusagen. Ich habe mit einem Zahnarzt verkehrt. Der hat mich auf Händen getragen. Doch ich habe mir selber mein Glück zerstört. Das war im Englischen Garten. Da gab mir’s der Teufel ein, Daß ich –– um auf Gustav zu warten –– In der Nase bohrte, ich Schwein. Gustav hat alles gesehn. Er sagte: das sei kein Benehmen. Was hilft es nun, mich zu schämen. Ich möchte manchmal ins Wasser gehn.
Gewitter
Oben in den Wolken krachte der Donner. Am Ufer des Indischen Ozeans balzte ein Kind. Würde der Mond noch monder, die Sonne noch sonner, So würden die Menschen vielleicht noch drehlicher, als sie schon sind. Tausend Menschen lachten und weinten; Sechs von dem Tausend wußten, warum; Zwei von den sechsen aber meinten Von sich selber, sie seien eigentlich dumm. Breite Straße filmte mir vorbei, Links und rechts mit Lichtern und Reflexen Fechtend und mit Worten und Geschrei. Helle Nacht ergoß sich brausend. Und ich grüßte ehrfurchtsvoll die zwei, Und ich beugte staunend mich den sechsen, Kniete, echt und bettelnd, vor dem Tausend. Vor dem Grand Hotel zu den Drei Mohren Kreiste jämmerlich ein Hund und schiß. Nebenbei, von irgendwem verloren, Lag ein künstliches Gebiß. Doch ich räusperte und spie, Und ich rotzte, Bis ich einer weichen Phantasie Würdig trotzte. Und zur gleichen Zeit mag ein Kommis (Elegante Kleidung –– sauber –– Schaf) Auf dem Teppich heiß gestammelt haben, Einer, der vom lieben Gott was wollte, Was das Hauptbuch und den nächsten Tag betraf; Dachten andere an Schützengraben. Denn der Donner grollte.
Der Zahnfleischkranke
Was geht mich der Frühling, was geht mich dein dummes Gesicht, Dein Leben an. Aber nur weine nicht. Geh, Mädchen! Geh! Geh! Mir tun meine Zähne, Deine Knietschträne tut noch mehr weh. Eine entzündete Wurzelhaut Kennt keine Braut, Noch Kunst noch Konstabler. Wer mir jetzt eins in die Fresse haut, Oder ein Kinnladenschuß Wären immerhin diskutabler. Sterben jetzt, wäre Genuß. Siehst du den gelben Schaum? Das Fleisch ist ganz weich. Selbst wenn ich schliefe, Blähen versäumte Präservative Sich Luftschiffen gleich In meinen Traum. Stochern muß ich; gib eine Gabel! Was sagt du? Halt deine –– Schnabel!!
Aus dem Tagebuch eines Bettlers
Ich klingelte. Ich bettelte um Brot. Um alte Sachen. Ich beschrieb anschaulich die Not. Ich kann so eine jämmerliche Miene machen. Meine Familie sei teils hungrig, teils tot. Nur ein kleines, hartes, verschimmeltes Restchen Brot, Womit ich eigentlich Geld meinte. Der Herr verneinte. Ich versuchte diverse Gebärden. Ich kann so urplötzlich ganz mager werden. Ich taumelte krank. Ich –– stank. Da wurde ich gepackt. Fünf Minuten später war ich nackt. In einer Wanne im Bad Bei dreißig Grad. Ich weinte. –– Ich wußte: Hier half kein Beteuern. Man fing an, meine Kruste Herunterzuscheuern. Dieser Herr war ein Schelm. Ich wurde auf die Straße gestoßen. Ich fand mich in schwarzen Hosen, Lackschuhen, Frack und Tropenhelm. Ich fand kein Geld. –– Mir wurde bang, Ich fand nur ein Trambahn-Abonnement. Und ich ging auf die Reise, Fuhr mit der Sechzehn stundenlang Immer im Kreise. Was halfen die noblen Sachen? Ich bettelte. Probeweise. Ich kann so eine kummervolle Miene machen. Aber die Leute begannen zu lachen Und die Haltestelle zu verpassen. Ich sann auf einen Schlager. Ich wurde urplötzlich ganz mager. Ich wurde gewaltsam aus der Trambahn heruntergelassen. Da waren die Anlagen und Gassen Auf einmal ganz traurig und fremd. Als ich aus dem Pfandhause kam, Trug ich nur noch Hose, Barfuß und Hemd. Ich mußte mir einen Anzug leih’n. Ich ging mit der Gräfin Mabelle, Die eigentlich eine Büfettmamsell Ist und gesucht wird, in ein Hotel. Wir speisten: Hirschbraten mit Knickebein. Wir sangen zu zwei’n: »Wer hat uns getraut ––...« Und zuletzt, ganz laut: »Wohlauf noch getrunken, den funkelnden Wein ...«
Von einem, dem alles danebenging
Ich war aus dem Kriege entlassen, Da ging ich einst weinend bei Nacht, Weinend durch die Gassen. Denn ich hatte in die Hosen gemacht. Und ich habe nur die eine Und niemanden, wo sie reine Macht oder mich verlacht. Und ich war mit meiner Wirtin der Quer. Und ich irrte die ganze Nacht umher, Innerlich alles voll Sorgen. Und sie hätten vielleicht mich am Morgen Als Leiche herausgefischt. Aber weil doch der Morgen Alles Leid trocknet und alle Tränen verwischt ––
Allerdings
Ernst Rowohlt Verlag K.-G. a. A., Berlin W 35
Ginster gewidmet
Ich habe dich so lieb
Ich habe dich so lieb! Ich würde dir ohne Bedenken Eine Kachel aus meinem Ofen Schenken. Ich habe dir nichts getan. Nun ist mir traurig zu Mut. An den Hängen der Eisenbahn Leuchtet der Ginster so gut. Vorbei –– verjährt –– Doch nimmer vergessen. Ich reise. Alles, was lange währt, Ist leise. Die Zeit entstellt Alle Lebewesen. Ein Hund bellt. Er kann nicht lesen. Er kann nicht schreiben. Wir können nicht bleiben. Ich lache. Die Löcher sind die Hauptsache An einem Sieb. Ich habe dich so lieb.
Alte Winkelmauer
Alte Mauer, die ich oft benässe, Weil’s dort dunkel ist. Himmlisches Gefunkel ist In deiner Blässe. Pilz und Feuchtigkeiten Und der Wetterschliff der Zeiten Gaben deiner Haut Wogende Gesichter, Die nur ein Dichter Oder ein Künstler Oder Nureiner schaut. »Können wir uns wehren?« Fragt’s aus dir mild. Ach, kein Buch, kein Bild Wird mich so belehren. Was ich an dir schaute, Etwas davon blieb Immer. Nie vertraute Mauer, dich hab’ ich lieb. Weil du gar nicht predigst. Weil du nichts erledigst. Weil du gar nicht willst sein. Weil mir deine Flecken Ahnungen erwecken. Du, eines Schattens Schein. Nichts davon wissen Die, die sonst hier pissen, Doch mir winkt es: Komm! Seit ich dich gefunden, Macht mich für Sekunden Meine Notdurft an dir fromm.
Nach dem Gewitter
Der Blitz hat mich getroffen. Mein stählerner, linker Manschettenknopf Ist weggeschmolzen, und in meinem Kopf Summt es, als wäre ich besoffen. Der Doktor Berninger äußerte sich Darüber sehr ungezogen: Das mit dem Summen wär’ typisch für mich, Das mit dem Blitz wär’ erlogen.
Alter Mann spricht junges Mädchen an
Guten Tag! –– Wie du dich bemühst, Keine Antwort auszusprechen. »Guten Tag« in die Luft gegrüßt, Ist das wohl ein Sittlichkeitsverbrechen? Jage mich nicht fort. Ich will dich nicht verjagen. Nun werde ich jedes weitere Wort Zu meinem Spazierstock sagen: Sprich mich nicht an und sieh mich nicht, Du Schlankes. Ich hatte auch einmal ein so blankes, Junges Gesicht. Wie viele hatten, Was du noch hast. Schenke mir nur deinen Schatten Für eine kurze Rast.
Ritter Sockenburg
Wie du zärtlich deine Wäsche in den Wind Hängst, liebes Kind Vis à vis, Diesen Anblick zu genießen, Geh ich, welken Efeu zu begießen. Aber mich bemerkst du nie. Deine vogelfernen, wundergroßen Kinderaugen, ach erkennen sie Meiner Sehnsucht süße Phantasie, Jetzt ein Wind zu sein in deinen Hosen ––? Kein Gesang, kein Pfeifen kann dich locken. Und die Sehnsucht läßt mir keine Ruh. Ha! Ich hänge Wäsche auf, wie du! Was ich finde. Socken, Herrensocken; Alles andre hat die Waschanstalt. Socken, hohle Junggesellenfüße Wedeln dir im Winde wunde Grüße. Es ist kalt auf dem Balkon, sehr kalt. Und die Mädchenhöschen wurden trocken, Mit dem Winter kam die Faschingszeit. Aber drüben, am Balkon, verschneit, Eisverhärtet, hingen hundert Socken. Ihr Besitzer lebte fern im Norden Und war homosexuell geworden.
Umweg
Ging ein Herz durchs Hirn Güte suchen, Fand sie nicht, doch hörte da durchs Ohr Zwei Matrosen landbegeistert fluchen, Und das kam ihm so recht rührend vor. Ist das Herz dann durch die Nase krochen. Eine Rose hat das Herz gestochen, Hat das Herz verkannt. In der Luft hat was wie angebrannt Schlecht gerochen. Und das Wasser schmeckte nach Verrat. Leise schlich das Herz zurück, Schlich sich durch die Hand zur Tat, Hämmerte. Und da dämmerte Ihm das Glück.
Schenken
Schenke groß oder klein, Aber immer gediegen. Wenn die Bedachten Die Gaben wiegen, Sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei. Schenke dabei Was in dir wohnt An Meinung, Geschmack und Humor, So daß die eigene Freude zuvor Dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist ohne List. Sei eingedenk, Daß dein Geschenk Du selber bist.
Der wilde Mann von Feldafing
Er schien zum Kriegsmann geboren. Er trug nach allen Seiten hin Bart. Selbst seine Beine waren behaart Und steckten in Stiefeln mit Sporen. Und trutzig über der Schulter hing Ihm ein gewichtig Gewehr. Mit gerunzelter Stirne ging Er auf dem Bahnhof von Feldafing Hin und her. Und stehend, stolz und schulterbreit Fuhr er dann zwei Stationen weit. Die Kinder bestaunten ihn sehr. Doch ehe noch ein Tag verging, Schritt er schon wieder durch Feldafing Mit einem Rucksack schwer. Doch weil es so stark regnete, Daß niemand ihm begegnete, Ärgerte er sich sehr. Als er durch seinen Garten schritt, Sang dort ein Vögelchen Kiwitt, Da griff er zum Gewehr: Puff!!! Ein kurzes Röchelchen –– Ein kleines Löchelchen –– Dann eine Katze –– und etwas später: Ein kleines Knöchelchen Und eine Feder. –– Der wilde Mann von Feldafing.
Marschierende Krieger
Vor mir her schritt Infanterie, Eine ganze Kompanie Kräftiger Soldaten. Stramm im Takte traten Sie den Sand, Schritten achtlos über einen Kleinen Käfer, den ich fand. Ich blieb stehen, Um ihn zu besehen, Und weil’s hinter jenem Militär Stark nach Schweiß und Leder roch. Da: –– Der Käfer kroch Plötzlich fort, als ob er lebend wär. Doch ich konstatierte noch: Nur zwei Steinchen an zwei Seiten retteten –– Gleichsam wie als Felsenwände –– diesen –– Gleichsam zwischen ihnen eingebetteten –– Käfer vorm Zertrampeltwerden durch die Riesen. Große Riesen –– kleine Tiere –– Und ich lief, die Wandersohlen, Die so stanken, einzuholen, Weil ich gar zu gern im Takt marschiere. Und ich hustete und spuckte Staub und mußte viermal niesen. Und ich schluckte. Und ich duckte Mich vor Felsenwänden und vor Riesen.
Blindschl
Ich hatte einmal eine Liebschaft mit Einer Blindschleiche angefangen; Wir sind ein Stück Leben zusammen gegangen Im ungleichen Schritt und Tritt. Die Sache war ziemlich sentimental. In einem feudalen Thüringer Tal Fand ich –– nein glaubte zu finden –– einmal Den ledernen Handgriff einer Damenhandtasche. Es war aber keiner. Ich nannte sie »Blindschl«. Sie nannte mich Nach wenigen Tagen schon »Eicherich« Und dann, denn sie war sehr gelehrig, Verständlicher abgekürzt »Erich«. Allmittags haben gemeinsam wir Am gleichen Tische gegessen, Sie Regenwürmer mit zwei Tropfen Bier, Ich totere Delikatessen. Sie opferte mir ihren zierlichen Schwanz. Ich lehrte sie überwinden Und Knoten schlagen und Spitzentanz, Schluckdegen und Selbstbinder binden. Sie war so appetitlich und nett. Sie schlief Nacht über in meinem Bett Als wie ein kühlender Schmuckreif am Hals, Metallisch und doch so schön weichlich. Und wenn ihr wirklich was schlimmstenfalls Passierte, so war es nie reichlich. Kein Sexuelles und keine Dressur. Ich war ihr ein Freund und ein Lehrer, Was keiner von meinen Bekannten erfuhr; Wer mich besuchte, der sah sie nur Auf meinem Schreibtisch steif neben der Uhr Als bronzenen Briefbeschwerer. Und Jahre vergingen. Dann schlief ich einmal Mit Blindschl und träumte im Betti (Jetzt werde ich wieder sentimental) Gerade, ich äße Spaghetti. Da kam es, daß irgendwas aus mir pfiff. Mag sein, daß es fürchterlich krachte. Fest steht, daß Blindschl erwachte Und –– sie, die sonst niemals nachts muckte –– Wild züngelte, daß ich nach ihr griff Und sie, noch träumend, verschluckte. Es gleich zu sagen: Sie ging nicht tot. Sie ist mir wieder entwichen, Ist in die Wälder geschlichen Und sucht dort einsam ihr tägliches Brot. Vorbei! Es wäre –– ich bin doch nicht blind –– Vergebens, ihr nachzuschleichen. Weil ihre Wege zu dunkel sind. Weil wir einander nicht gleichen.
Schlummerlied
Will du auf Töpfchen? Fühlst du ein Dürstchen? Oder ein Würstchen? Senke dein Köpfchen. Draußen die schwarze, kalte Nacht ist böse und fremd. Deine Hände falte. Der liebe Gott küßt dein Hemd. Gute Ruh! Ich bin da, Deine Mutter, Mama; Müde wie du. Nichts mehr sagen –– Nicht fragen –– Nichts wissen –– Augen zu. Horch in dein Kissen: Es atmet wie du.
Angstgebet in Wohnungsnot
(1923)
Ach, lieber Gott, gib, daß sie nicht Uns aus der Wohnung jagen. Was soll ich ihr denn noch sagen –– Meiner Frau –– in ihr verheultes Gesicht!? Ich ringe meine Hände. Weil ich keinen Ausweg fände, Wenn’s eines Tags so wirklich wär: Bett, Kleider, Bücher, mein Sekretär, –– Daß das auf der Straße stände. Sollt ich’s versetzen, verkaufen? Ist all doch nötigstes Gerät. Wir würden, einmal, die Not versaufen, Und dann: wer weiß, was ich tät. Ich hänge so an dem Bilde, Das noch von meiner Großmama stammt. Gott, gieße doch etwas Milde Über das steinerne Wohnungsamt. Wie meine Frau die Nacht durchweint, Das barmt durch all meine Träume. Gott, laß uns die lieben zwei Räume Mit der Sonne, die vormittags hinein scheint.
Antwort auf einen Brief des Malers Oskar Coester
Ein Wort auf das, was du gesprochen. Stütz guten Kopf in gute Hand Und laß dein Herz ans Weinglas pochen: Heimat ist kein begrenztes Land. Auch wo man Muttersprache spricht, Ist Heimat nicht. Mich deucht, es will auch nichts besagen, Ob einer seine Heimat kennt. Denn Lüge ist, was auf Befragen Das Heimweh uns als Heimat nennt. Ein schmutzig Loch kann rührend sich verkneifen, Und höchste Würde kann zur Blase reifen. Stich fest in das Humorische! Heimat? Wir alle finden keine, Oder –– und allerhöchstens –– eine Improvisatorische. Es kommt auch gar nicht darauf an. –– –– Ich danke dir für den Vergleich Mit einem braven Reitersmann. Man tue möglichst, was man kann. Coester, du bist von Gott aus reich. Schäum aus, was du zu schenken hast; Das Letzte wäre dir noch Last. Und warte frech, doch fromm auf Leiden. Denn du wächst neben dem Jahrhundert. Du bist der größre von uns beiden. Ich habe dich so oft bewundert. –– Wie kläglich ist es zu beneiden. –– Du wurdest leider mir von fern Noch lieber, als du warst im Nahen. Nun, da wir lange uns nicht sahen, Bild ich mir ein: Du hast mich gern. Ach bitte komme bald zurück Mit offnem, unverwitzeltem Vertraun. Ich wünsche dir fürs neue Jahr viel Glück, Eine Frau (zur Hochzeit mich einladend) Und andre große Nebenfraun Und was du sonstens wichtig brauchst. Daß du nie anders, als wie badend, Auch für Minuten nur untertauchst.
Mensch und Tier
Wenn ich die Gesichter rings studiere, Frage ich mich oft verzagt: Wieviel Menschen gibt’s und wieviel Tiere? –– Und dann hab’ ich –– unter uns gesagt –– Äußerst dumm gefragt. Denn die Frage intressiert doch bloß Länderweis statistische Büros, Und auch diese würden sich sehr quälen, Um zum Beispiel Läuse nachzuzählen. Dummer Mensch spricht oft vom dummen Vieh, Doch zum Glück versteht das Vieh ihn nie. In dem neuen Korridor von Polen Gaben sich zwei Pferde einen Kuß, Und die Folge war ein dünnes Fohlen, Welches stundenlang Immer anders, als man dachte, sprang. Wenn es auch in Polen Sehr viel Läuse gibt, –– –– Aber wer ein solches Fohlen Sieht und dann nicht liebt, Bleibe mir gestohlen.
Seepferdchen
Als ich noch ein Seepferdchen war, Im vorigen Leben, Wie war das wonnig, wunderbar Unter Wasser zu schweben. In den träumenden Fluten Wogte, wie Güte, das Haar Der zierlichsten aller Seestuten, Die meine Geliebte war. Wir senkten uns still oder stiegen, Tanzten harmonisch um einand, Ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand, Wie Wolken sich in Wolken wiegen. Sie spielte manchmal graziöses Entfliehn, Auf daß ich ihr folge, sie hasche, Und legte mir einmal im Ansichziehn Eierchen in die Tasche. Sie blickte traurig und stellte sich froh, Schnappte nach einem Wasserfloh, Und ringelte sich An einem Stengelchen fest und sprach so: Ich liebe dich! Du wieherst nicht, du äpfelst nicht, Du trägst ein farbloses Panzerkleid Und hast ein bekümmertes altes Gesicht, Als wüßtest du um kommendes Leid. Seestütchen! Schnörkelchen! Ringelnaß! Wann war wohl das? Und wer bedauert wohl später meine restlichen Knochen? Es ist beinahe so, daß ich weine –– Lollo hat das vertrocknete, kleine Schmerzverkrümmte Seepferd zerbrochen.
Hilflose Tiere
Wenn ein Hund kotzt, soll man keinen Augenblick Ihn dann stören, Soll man auf ihn hören. Töne sind Bruchstücke von Musik. Ob geräuschvoll oder leise, Massig oder klein bei klein –– Kann es doch die schönste Speise, Kann es beispielsweise Hammelkeule in Madeira sein. Auch das Dichten ist ein Vonsichgeben. Eisen bricht. Und alles geht vorbei, Auch die Wolke und das Leben. Und ein einz’ger Koch verdirbt den ganzen Brei. Mag sich also keiner überheben, Der auf Menschtum und Gesundheit protzt. Wenn ein Hündchen kotzt –– Öffentlich genau so wie zu Hause –– Sollst du mit ihm leiden, Maulkorb ihm durchschneiden; Denn sonst wirkt der Korb wie eine Brause. Will das Rührende dir häßlich scheinen, Denke: Großes spiegelt sich im Kleinen. Wirst dich doch der eignen Übelkeit Niemals schämen. Gönne Tieren wenigstens die Zeit, Widerwärtiges zurückzunehmen. Oder laß das ruhig liegen. Weil Roheit niemals Glück bringt oder Segen. Jeder soll vor seiner Türe fegen. Und die Stiefelsohle ist kein Körperteil.
Ballade
Tief im Innersten von Sachsen überfielen eines Abends zwei Halbwüchsige Knorpel von Schweinshaxen Eine Bulldogge aus der Walachei. Sie umzingelten den alten Hund. Hinterlistig wollten sie das matte Tier, das keine Zähne mehr im Mund Und auch keine Haare darauf hatte, An den Augen treffen, hinterher Ihm die Zunge schlitzen und durch Zwicken Seinen Gaumen reizen und noch mehr, Um zuletzt ihn plötzlich zu ersticken. Wollten so. Jedoch es kam nicht so. Denn die Dogge, ohne sich zu wehren, Zog den Schwanz ein, heulte laut und floh Und begann sofort sich zu vermehren. Und die neuen jungen Hunde knurrten Schon am selben Tag, als man sie warf, Hatten spitze Zähne, und sie wurden Ganz speziell auf Haxenknochen scharf. Und die Enkelhunde bissen später Jede Haxe ohne Unterschied. Und so rächt die Sünde sich der Väter Bis ins tausendste und letzte Glied.
Meditation
Wolleball hieß ein kleiner Hund, Über den ein jeder lachte, Weil er keine Beine hatte und So viel süße Schweinereien machte. Warum ist man überall geniert? Warum darf man nicht die Wahrheit sagen? Warum reden Menschen so geziert, Wenn sie ein Bein übers andre schlagen? Um dies überschätzte homo sum Werd’ ich täglich wirrer und bezechter. Ach, die Schlechtigkeit ist gar zu dumm, Doch die Dummheit ist noch zehnmal schlechter. Hat der Wolleball von seinem Herrn Nichts gewußt, nur Launen mitempfunden, Hatte der ihn andrerseits sehr gern Und verstand im Grunde nichts von Hunden. Er ist tot, auf den ich solches dichte. Mir ist Wurscht, wo sein Gebein jetzt ruht. Aber die Pointe der Geschichte Muß ich sagen: er war herzensgut. Und sein Wolleball war gut. Er grollte





























