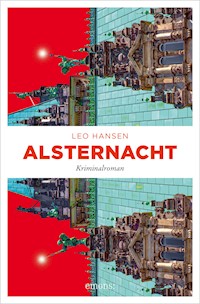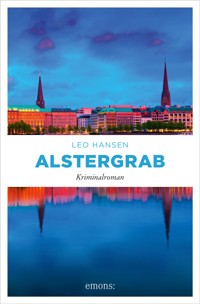Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Elias Hopp und Janne Bakken
- Sprache: Deutsch
Ein packender Kriminalroman mit psychologischem Tiefgang. Hamburg wird von einer brutalen Mordserie erschüttert. Privatermittler Dr. Elias Hopp, Ex-Soldatin Janne Bakken und LKA-Profiler Zillinski arbeiten zusammen, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Der Schluss liegt nahe, dass ein Psychopath sein Unwesen treibt. Doch um das perfide Spiel tatsächlich zu durchschauen, müssen die drei ihr ganzes Können aufbringen. Eine Informantin aus der Szene der »Neuen Rechten« bringt die Ermittler auf eine heiße Spur. Viel Zeit bleibt ihnen allerdings nicht, denn unter der Oberfläche ziehen gefährliche Gegner ihre Fäden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leo Hansen, Jahrgang 1954, arbeitete fünfzehn Jahre bei den Landesmedienanstalten in Hamburg und Thüringen. Anschließend unterrichtete er Medienpädagogik, Psychologie/Pädagogik und Politik und veröffentlichte zahlreiche medienpädagogische Fachartikel. Er hat drei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau in Neustadt in Holstein an der Ostsee.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: pixabay.com/Peter H
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-087-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Meinen Kindern
Heute haßt man modern. Die Angst ist die Flamme unserer Zeit und die wird fleißig geschürt. Sie verbrennen dich mit ihrer Zunge und ihrer Ignoranz.
Prolog
Alfred Rabenhorst war Chef eines großen Mischkonzerns und eine einflussreiche Persönlichkeit in der deutschen Wirtschaft. Und er hatte Geld. Basis seines Reichtums war die Kaltblütigkeit seines Vaters Bruno gewesen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte der sich das Geschäft und Gutshaus eines Juden unter den Nagel gerissen. Gerüchte besagten, dass Bruno Rabenhorst ihn selbst umgebracht haben soll.
Alfred Rabenhorst hatte nicht nur das Geschäft seines Vaters übernommen, sondern auch dessen Kaltblütigkeit und rechte Gesinnung. Er hatte aus dem Bekleidungsgeschäft einen Konzern mit vielen Tochterfirmen geformt und regelmäßig informelle Treffen mit Rechten aus ganz Europa auf seinem Landgut Groß-Bockenfurt in Ostholstein organisiert.
Alfred Rabenhorst schaute aus dem großen Fenster des Salons. Der Schnee, der zum Jahreswechsel gefallen war, zierte die Äste der großen Stieleiche, die den Mittelpunkt des Parks bildete. Diese deutsche Eiche war schon von den Germanen verehrt worden, als Symbol für Treue und Standhaftigkeit, für Zähigkeit und Beständigkeit.
Er seufzte, ging zur Barvitrine und schenkte sich einen Camus XO Borderies ein, einen Cognac, der den Namen verdiente. »Werte und Tugenden, die unser Land mehr benötigt als je zuvor«, murmelte er und trank das Glas in einem Zug leer. »Es wird Zeit, dass sich etwas ändert.«
Es klopfte an der Tür, und sein Housekeeper trat ein. »Die meisten unserer Gäste sind angekommen und halten sich im Lesesaal auf. Nur Frau Dr. Haferkamp fehlt noch.«
»Danke, Helmut«, sagte Rabenhorst, ohne sich umzudrehen. In der Ferne sah er einen Wagen auf das Gut zusteuern. Vermutlich ein Porsche 911, mit dem sie gleich durch das Torhaus auf das Grundstück fahren würde. Er wusste, dass Doris Haferkamp eine Schwäche für schnelle Autos hatte. Dass sie zu spät kam, war Kalkül. Sie brauchte ihren Auftritt. Auch wegen dieser Selbstsicherheit gepaart mit einer gewissen Überheblichkeit hatte er ihr damals die Leitung des »Instituts für Neues Denken« angeboten.
Alfred Rabenhorst betrat den Lesesaal. Die Gäste waren alle versammelt und bedienten sich an den Canapés und Getränken. Gerd Meierhuber und Franz Butenkopf, die beiden Vertreter der Neonaziszene, standen abseits und betrachteten etwas skeptisch die weiteren Gäste. Es waren die beiden Verleger Peter Lothringer und Arno Paterna sowie Dr. Reiner Stuhr, ehemaliger Professor für Staatsrecht. Sie gehörten zum Kreis der »Neuen Rechten«, zu dem im weitesten Sinne auch Dr. Doris Haferkamp vom »Institut für Neues Denken« zählte.
Klaus Freiherr von Laden, Vertreter der größten Reichsbürgergruppe, lehnte an einem Regal mit antiquarischen Büchern und hielt die deutsche Ausgabe der »Protokolle der Weisen von Zion« von Gottfried zur Beek in der Hand. Ebenfalls dabei waren die Publizistin Mathilda Jankowski und Karl Immen, Chef eines großen Onlineversandes. Sie standen der Identitären Bewegung nahe und hielten sich für die hippen »Neuen Rechten«.
Rabenhorst rückte seine Cartier-Goldrandbrille zurecht und wandte sich lächelnd an seine Gäste. »Meine Damen, meine Herren, ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Die Welt ist im Umbruch, Deutschland gerät zunehmend aus den Fugen, und es gibt nur eine Bewegung, die das aufhalten und neue Perspektiven bieten kann. Ich denke, in diesem Punkt sind wir uns alle einig. Worüber wir sprechen müssen, ist, wie wir die Bewegung aufstellen, um unsere Ziele zu erreichen.«
Er bat die Gäste, Platz zu nehmen, klatschte in die Hände, und Helmut servierte den Anwesenden ein Glas Champagner. Alfred Rabenhorst erhob sein Glas. »Meine Lieben, ich bin sicher, wir werden eine anregende Unterhaltung führen! Und wir sollten uns keinen Maulkorb verpassen, sondern, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, frei Schnauze sprechen.«
Und dann begann eine Diskussion darüber, welche Ideologie, Organisation und Strategie entwickelt werden müsste, um eine neue Ordnung in Deutschland zu schaffen. Konsens bestand in der Einschätzung, dass in vielen europäischen Ländern und eben auch in Deutschland rechte Strömungen Zulauf hatten. Damit war es mit der Einigkeit aber auch schon vorbei.
Als Erster ergriff Paterna das Wort. »Ich sage Ihnen, mit Parteipolitik werden wir nie eine grundlegende Veränderung erreichen. FPÖ, Front National –«
»Die heißen jetzt ›Rassemblement National‹.«
Für diese Korrektur erntete Professor Stuhr einen bösen Blick von Paterna, der fortfuhr: »Schweizerische Volkspartei, AfD – sie hängen doch alle einem bürgerlichen, rechtspopulistischen Konservatismus nach.«
»Und haben sich an das bestehende System angepasst«, ergänzte Lothringer verächtlich.
»Wir müssen den Kampf um die kulturelle Hegemonie im Meinungsdiskurs gewinnen, um einen geistigen Wandel zu bewirken.«
»Der muss nämlich einem politischen Wandel vorausgehen.«
»Was die beiden meinen«, schaltete sich Professor Stuhr ein, »ist eine nationale Kulturrevolution.«
»Vielen Dank für die Belehrung, Herr Professor«, sagte Doris Haferkamp spöttisch. »Ich frage mich nur, wer euch zuhören soll.«
»Euer gestelztes Gequatsche geht mir auf den Keks.« Meierhuber platzte der Kragen. »Ich bin hier nicht hergekommen, um mir eine Vorlesung anzuhören.«
»Die zudem auch völlig unsinnig ist.« Butenkopf war sein Ärger anzuhören. »Wir brauchen keine nationale Kulturrevolution, was wir brauchen, ist wieder ein Nationalsozialismus.«
»Und wie der geht, wissen wir ja«, pflichtete Meierhuber ihm bei und hob die rechte Hand zum Hitlergruß.
»Mensch, Meierhuber, Opas Faschismus ist tot«, sagte Mathilda Jankowski kopfschüttelnd.
»Opas Faschismus mag tot sein«, schaltete sich jetzt Klaus Freiherr von Laden in die Diskussion ein, »aber eins muss ich mal klarstellen. Das Deutsche Reich existiert nach wie vor, die Regierung Dönitz ist nie zurückgetreten.« Von Laden nippte an seinem Champagner. »Es muss darum gehen, die Handlungsfähigkeit des ›Deutschen Reiches‹ wiederherzustellen und das deutsche Volk aus der Knechtschaft der jüdischen Weltverschwörung zu befreien.«
»Mit euren plumpen Sprüchen und treudeutschem Aussehen lässt sich ja noch nicht mal ein Hund hinterm Ofen hervorlocken.« Karl Immen sah mitleidig zu den beiden Neonazis.
»Na ja, erfolgreich seid ihr Identitären ja auch nicht gerade.« Wieder eine Bemerkung voller Spott von Doris Haferkamp. »Ihr kriegt ja noch nicht mal euer Patrioten-Tinder ans Laufen.«
Alfred Rabenhorst hatte den Schlagabtausch mit vornehmer Zurückhaltung verfolgt, sah sich nun aber genötigt, vermittelnd einzugreifen. Das hatte immerhin den Erfolg, dass die Diskussion weniger aggressiv geführt wurde. Inhaltlich taten sich aber nach wie vor viele Gräben auf.
Interessanterweise, und das war Rabenhorst nicht entgangen, hatte sich Doris Haferkamp zwar an der Diskussion mit klugen Fragen und Bemerkungen beteiligt, doch inhaltlich hatte sie sich nicht geäußert. In ihren wenigen Beiträgen ging es immer um Struktur und Strategie. Das gefiel Alfred Rabenhorst.
Beim Abschied begleitete er sie zu ihrem Porsche. »Das ist ein schickes Auto.« Er schaute es sich genauer an. »Baujahr 2015.«
»Ich bin ein Porsche-Fan«, antwortete sie freundlich. »Das Vorgängerauto war ein Porsche 911Targa von 1996.«
»Mit großem Panoramadach?«
»Ja, einer der ersten seiner Art. Ist mir leider gestohlen worden«, sagte Doris Haferkamp wehmütig.
»Kommen Sie mit, Doris. Ich darf Sie doch so nennen?«, fragte Rabenhorst charmant. »Ich habe da was für Sie.« Er ging mit ihr zu seiner Garage, die in einer der Scheunen untergebracht war. Dort stand, von einer Plane verdeckt, ein Fahrzeug mit sportlicher Silhouette. Rabenhorst machte Licht und entfernte die Plane.
»Das glaub ich ja nicht!«, entfuhr es Haferkamp.
»Doch, ein Ur-Targa mit Mini-Stoffverdeck und Kunststoffscheibe«, sagte Alfred Rabenhorst voller Stolz. »Ich dachte, wir könnten gemeinsam die zweite Jungfernfahrt dieses kleinen Flitzers begehen.« Rabenhorst schmunzelte. »Auch wenn das Wetter nicht ganz passend ist.«
Das ließ sich Doris Haferkamp nicht zweimal sagen, und so drehte sie mit Rabenhorst eine Runde durch die Holsteinische Schweiz. Nach zwei Stunden kehrten sie wieder auf den Hof von Gut Groß-Bockenfurt zurück.
»Ein großartiger Wagen, Alfred«, schwärmte Doris Haferkamp.
»Wie für Sie geschaffen«, antwortete Rabenhorst. »Sie können jederzeit damit fahren, liebe Doris.«
»Sehr großzügig, im Moment gibt es aber Wichtigeres zu tun.«
»Stimmt, aber es gibt ja eine Zeit danach.«
Wenig später saßen sie wieder im Salon. Helmut servierte Tee und Gebäck, und Rabenhorst kam gleich zur Sache. »Unser Austausch auf unserer kleinen Ausfahrt über das Treffen war sehr belebend.« Er trank einen Schluck Tee. »Ich glaube auch, dass es keine Grundlage für eine Zusammenarbeit mit diesen Leuten geben kann.«
Doris Haferkamp biss in einen der dänischen Knuspertaler. »Köstlich.« Dann schaute sie Rabenhorst an. »Vor allem die Reichsbürger sind eine unüberschaubare Melange aus irren Spinnern, die entweder eigene Königreiche gründen, den Fortbestand des ›Deutschen Reiches‹ propagieren oder die BRD als Privatgesellschaft sehen, und Gewaltbereiten, die Waffen und Munition horten, um sich gegen die Polizei oder andere Vollstreckungsbeamte zu wehren.«
»Diese Heterogenität macht sie vor allem unberechenbar«, fügte Rabenhorst hinzu.
»Und allen ist gemeinsam, dass sie nur eine Ideologie, aber weder eine schlagkräftige Organisation noch eine überzeugende Strategie besitzen.«
»Zudem sind sie sich teilweise spinnefeind.« Er steckte sich ein Zigarillo an. »Sie haben recht, Doris. Das sind nicht die Richtigen für eine neue Ordnung. Sie ziehen aus ihrer Überzeugung die falschen Schlussfolgerungen.«
»Weiß Gott sind sie nicht die, die wir brauchen. Um eine nationale Neugestaltung zu organisieren, braucht es notwendigerweise große Transformationen. Doch dafür sind die alten Konzepte nicht geeignet.« Haferkamp legte die Handflächen aufeinander und fuhr eindringlich fort. »Ziel ist, nicht das Bestehende zu bewahren, sondern zu überwinden. Das geht nur mit einer radikalen Umkehr. Nur so lässt sich eine neue Ordnung ohne Multis, aber mit autoritärer Führung schaffen.«
Rabenhorst zog an seinem Zigarillo, lehnte sich zurück und sagte feierlich: »Denn im Streben nach Pluralität und Individualität hat sich die Menschheit selbst verloren. Die Globalisierung ist unser nationaler Untergang.« Rabenhorst blickte sie an. »Und irgendwann werden wir von den Chinesen regiert.«
»Um das zu stoppen, braucht es ein spektakuläres Zeichen. Ein Fanal.« Haferkamps Gesicht glühte. Und dann berichtete sie von ihrem Plan.
»Die Idee für die Aktion, die sie andeuten, ist in der Tat spektakulär«, sagte Rabenhorst anerkennend. »Doch in der Umsetzung sicher komplex.«
»Etwas Einfaches wäre wirkungslos.« Doris verzog den Mund. »Die möglichen Ziele werden mit Bedacht ausgewählt. Sowohl in Bezug auf die Wirkung als auch auf die Vorbereitungen.«
»Und wie sieht der Zeitrahmen aus?«, fragte Rabenhorst.
»Es wird Ende Mai passieren.«
Rabenhorst griff in seine Jackettasche, holte einen Zettel heraus und gab ihn Doris Haferkamp. »Sie hatten mich um zwei Namen gebeten. Ich habe Ihnen drei aufgeschrieben. Die ersten beiden können«, er suchte nach den richtigen Worten, »Ihnen helfen, Ihre Auslagen zu decken.« Ein Lächeln umspielte seine Lippen.
»Verstehe.«
Dann fuhr er mit ernstem Gesichtsausdruck fort. »Der letzte Name ist ein nützlicher Kontakt im Landeskriminalamt. Er erwartet Ihren Anruf. Aber das hat noch Zeit.« Rabenhorst räusperte sich. »Ich habe ein kleines, aber feines Mahl für heute Abend vorbereiten lassen. Ich würde mich freuen, wenn Sie bleiben würden, Doris.« Er breitete seine Arme aus. »Hier ist genügend Platz«, sagte er mit einem hintergründigen Gesichtsausruck.
Doris Haferkamp war sichtlich irritiert. »Das ist, äh, sehr freundlich, Alfred. Aber ich habe schon eine Verabredung und«, sie überlegte kurz, »unsere freundschaftliche Beziehung reicht mir.«
Rabenhorst entglitten für einen Moment die Gesichtszüge, seine buschigen Augenbrauen zuckten, dann hatte er sich wieder im Griff. »Schade.« Er drückte sein Zigarillo aus. »Zeigen Sie uns, dass sie mit Ihrer Einrichtung die Speerspitze einer Revolution sein können. Beweisen Sie es, Doris. Dann setzen wir in Gang, was wir schon seit langer Zeit vorbereiten, und schaffen ein neues Land.«
Rabenhorst stand am Fenster seines Salons und sah Doris Haferkamp hinterher. Was bildete die sich bloß ein?, dachte er. Ihn so abzuservieren, hatte bisher noch niemand gewagt. Er spürte, wie die Wut in ihm aufstieg. »Nicht mit mir, nicht mit mir«, murmelte er.
Aber erst einmal musste sie ihren Job erledigen. Rabenhorst schenkte sich einen weiteren Cognac ein und trank einen Schluck. Dann ging er zu seinem Gemälde von Emil Nolde, das er vor ein paar Jahren auf einer Aktion erstanden hatte. »Sturzwelle unter violettem Himmel« hieß das Aquarell. Er liebte es, nicht nur weil Nolde ein Gesinnungsgenosse gewesen war, sondern ihn der dramatische Farbenteppich faszinierte. Er nahm den Rahmen von der Wand, und dahinter erschien ein kleiner Safe, den er öffnete. Er holte ein abhörsicheres Handy heraus und schrieb eine verschlüsselte Sammel-SMS:
»Sie macht es. Der Countdown läuft.« Der Rat war informiert.
1
Max war auf dem Weg zum Lindenhof, dem Vereinsheim von Fortuna Langenhorn. Einige Mitglieder seiner Kampfsportgruppe Spider, bei der er seit zwei Monaten trainierte, hatten ihn zu einem Treffen eingeladen. Wer sonst noch teilnahm, war ihm unbekannt. Auf den Treffen, so hatten sie ihm beim letzten Training erzählt, würde über gesellschaftliche Themen diskutiert und im Anschluss Bier getrunken. Und da er erst seit Kurzem in Hamburg lebte und sein soziales Leben noch sehr eingeschränkt war, hatte Max sich entschlossen, an dem Treffen teilzunehmen. Vielleicht würde er dort neue Leute kennenlernen. Leute, mit denen er wie in Dortmund Randale machen konnte. Dort hatte er bei einem rechten Kampfsportlabel gearbeitet, und nach der Arbeit waren sie auf die Jagd gegangen: nach Ausländern und reichen Kapitalisten, die das kranke System in Deutschland repräsentierten. Gleichzeitig konnte er bei diesen Aktionen seine dunkle Seite ausleben. In ihm brodelte eine unbändige Wut, die regelmäßig ein Ventil finden musste.
Inzwischen konnte er den Lindenhof sehen. Ein altes reetgedecktes Fachwerkhaus, das den Krieg und die Sanierungswut des Hamburger Senats überlebt hatte. Das Sonnenlicht ließ ihn für einen Moment in seiner ganzen Pracht erscheinen, doch dann beendeten dicke graue Wolken das Schauspiel. Sekunden später begann es zu regnen. Aprilwetter von seiner besten Seite. Max sah gerade, wie ein VW Beetle vor dem Haus hielt und zwei junge Frauen aus dem Auto stiegen. Sie spannten einen großen Regenschirm auf, unter den sie sich drängten und so lachend zum Eingang des Lindenhofs liefen. Dabei verlor eine der Frauen ihren Schal. Max lief zum Eingang und hob ihn auf. Ein betörender Duft stieg auf, und er hielt sich den Schal an die Nase.
»Und, gefällt dir mein Parfüm?«
Max schaute ertappt auf und hielt der jungen Frau, die plötzlich vor ihm stand, verlegen den Schal hin. »Du hast ihn gerade verloren, und, äh, ich …«, stammelte er.
»Ich bin Sigi«, entgegnete sie, nahm den Schal und strahlte ihn an. »Und du bist?«
»Max. Ein paar Jungs von Spider haben mich eingeladen.«
»Ah, hab von dir gehört.« Und als sie seinen fragenden Blick sah, fuhr sie fort: »Wir reden miteinander.«
Es waren ungefähr fünfzig Leute anwesend, die an den u-förmig ausgerichteten Tischen Platz genommen hatten. Die meisten waren zwischen Mitte zwanzig und fünfzig Jahren. Neben den zwei Frauen, die Max schon gesehen hatte, waren noch weitere fünf Frauen im Publikum. Sigi und ihre Freundin saßen ihm gegenüber, und Sigi winkte ihm zu. Ihre lockigen schwarzen Haare hatte sie zu einem langen Zopf gebunden, ihre Lippen waren rot geschminkt. Er schätzte sie auf Ende zwanzig.
Ihre Freundin, die neben ihr saß, hatte kurze, strubbelige blonde Haare und trug eine schwarze Lederjacke. Sie wirkte sehr jugendlich, war aber sicher ein paar Jahre älter als Sigi. Er ließ seinen Blick weiterschweifen und erblickte noch drei Jungs, die wie Punks aussahen. Der Rest der Anwesenden machte eher einen biederen Eindruck, jedenfalls nicht weiter auffällig. Auch seine Kumpels aus der Kampfsportgruppe hatten sich in Schale geschmissen. Hemd, ordentliche Hose und Sneakers. Einzig zwei der Frauen fielen mit ihrem Äußeren aus dem Rahmen. Die ältere von beiden wegen der teuer aussehenden Kleidung, die andere wegen ihres roten Pagenkopfes, einer grünen Jacke und der dunklen Hornbrille. Max schätzte den Pagenkopf auf Mitte dreißig.
Plötzlich wurde es still, und ein spindeldürrer alter Mann mit weißen Haaren trat an das Rednerpult. »Liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Und ich verspreche euch, ihr werdet es nicht bereuen. Nicht nur, weil wir im Anschluss noch eine kleine Feier vorbereitet haben, mit leckerem Essen und –«
»Ordentlichem Bier«, rief Sigi dazwischen und erntete dafür einige Lacher.
»Die junge Frau denkt wieder nur an das eine«, bemerkte der Redner trocken. Dann fuhr er streng und belehrend fort. »Aber bevor du dein Bier trinkst, solltest du den Ausführungen der Rednerin des ›Instituts für Neues Denken‹ gut zuhören. Jetzt begrüßt bitte Dr. Doris Haferkamp.«
Verhaltener Applaus füllte den Saal, als Frau Haferkamp ans Rednerpult trat. Sie war eine der Frauen, die Max aufgefallen waren. Roter Blazer, darunter eine weiße Rüschenbluse, Perlenkette und dezent geschminkt. Die dunklen Haare waren zu einem Dutt gebunden. Eine reifere, attraktive Frau.
»Liebe Freundinnen und Freunde.« Sie blickte freundlich in die Runde. »Ich will euch nicht allzu lange von einem guten Bier abhalten. Umso mehr Zeit haben wir anschließend bei dem geselligen Beisammensein für einen Plausch.«
Sie räusperte sich und hielt ein paar Blätter in die Höhe. »Zwanzig Seiten, die mir mein Sekretär als Rede vorbereitet hat.« Sie blickte lächelnd in die Runde. »Keine Angst, die benötige ich aber nicht. Ich will euch stattdessen eine Geschichte erzählen.«
Doris Haferkamp legte die Papiere zur Seite. »Herr Kröppelin hat mich vorgestellt als Mitglied des ›Instituts für Neues Denken‹. Das ist richtig. Ich bin dort seit zwei Jahren Vorstandsvorsitzende. Und nur so viel: Neues Denken heißt, das Alte hinter sich zu lassen, das Bestehende aufzubrechen, die Zukunft zu gestalten. Nicht alles dem Globalisierungswahn zu opfern. Nun zu meiner Geschichte.«
Max irritierte, dass Doris Haferkamp ihn immer wieder anschaute. Er schloss die Augen und hörte aus der Ferne ihren Worten zu. Von zweien, die auszogen, um die Welt kennenzulernen, aber nur Ungerechtigkeit und Chaos erlebten. Auf dem Land, wo Bauern nicht mehr von ihren angebauten Produkten leben konnten. In Dörfern, wo Fremde besser wohnten als die Einheimischen. In Städten, wo wieder eine babylonische Sprachverwirrung herrschte. Und so ging es weiter.
Als Applaus aufbrandete, schreckte Max zusammen und öffnete die Augen. Er blickte zu Sigi, die an den Ausführungen nicht besonders interessiert zu sein schien. Er sah, wie sie sich zu ihrer Nachbarin beugte und ihr etwas ins Ohr flüsterte. Dann blickten beide zu ihm herüber und kicherten. Max wurde rot, hatte er geschlafen? Aus Verlegenheit blickte er wieder zu Doris Haferkamp, die gerade ihr apokalyptisches Märchen mit dem Selbstmord ihrer beiden Abenteurer beendete.
»Jugend ist ein Privileg«, hörte er sie sagen, »aber Jugend hat auch Verantwortung. Deshalb müssen wir, müsst ihr kämpfen und dürft nicht den Kopf in den Sand stecken.« Jetzt blickte sie wieder zu ihm. »Wir brauchen starke, junge Männer«, dann ließ sie ihren Blick effektvoll über die Zuhörer schweifen, »und selbstverständlich auch junge Frauen, die nicht vor dem Fremden, dem Überflüssigen, dem Wertlosen, das uns bedroht, fliehen oder gar aus Verzweiflung, so wie meine beiden Protagonisten aus der Geschichte, den Freitod wählen. Ihr müsst ausziehen, um der Welt das Fürchten zu lehren, wenn der Tag gekommen ist. Und ich verspreche euch. Ihr seid nicht alleine. Ich danke euch für das Zuhören und freue mich, gleich mit euch einen netten Abend zu verbringen.«
Wieder brandete Applaus auf. Max musste zugeben, dass er die Überlegungen, die Doris Haferkamp ausgeführt hatte, gar nicht so schlecht fand. Es gab so viele Sozialschmarotzer, die dem Staat nur Geld kosteten. Dazu gehörten natürlich auch die vielen Asylbewerber. Außerdem empfand er sich als Globalisierungsopfer. Er hatte keinen vernünftigen Job und bekam eine Scheißbezahlung. Aber das hätte man auch in weniger Sätzen sagen können. Er konnte noch nie gut zuhören. Einer der Gründe, warum er sein Studium nach zwei Semestern geschmissen hatte. Plötzlich spürte er eine Hand auf seiner Schulter. Die Frau mit dem Pagenkopf stand hinter ihm.
»Ich bin Veronica, die Assistentin von Frau Dr. Haferkamp. Sie möchte dich zu einem Bier einladen.«
Max starrte sie verblüfft an. »Mich?«
»Ja.« Sie lächelte vielsagend. »Gleich am Tresen.«
Hatte er doch recht gehabt. Sie hatte ihn angeschaut. Nicht nur ein Mal. Er stand auf und ging langsam Richtung Tresen. Er suchte Sigi, konnte sie aber nicht finden. Stattdessen lief er in die Arme von Klaus aus der Kampfsportgruppe.
»Mann, das war doch ein geiler Vortrag, oder?« Klaus sah ihn grinsend an. »Und dann hat sie auch noch super Möpse.«
»Ja, sie hat viele gute Dinge gesagt.«
»Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir der Welt das Fürchten lehren.« Klaus schlug ihm kumpelhaft seine Hand auf die Schulter. »Wir sehen uns«, sagte er.
Max schaute ihm hinterher und sah, wie er Richtung Büfett ging. Dort entdeckte er auch Doris Haferkamp, die ein Stück Käse aß und an einem Sektglas nippte. Sie war gerade mit den beiden jungen Frauen, die er zu Beginn getroffen hatte, im Gespräch. Wobei es mehr ein Monolog zu sein schien. Haferkamp redete eindringlich auf die beiden ein, und sie zeigten ihr Interesse durch eifriges Kopfnicken. Einige Male schienen sie zu ihm herüberzugucken.
Haferkamp beendete ihren Monolog, drückte Sigi das Sektglas in die Hand und machte sich auf den Weg zum Tresen. Max bahnte sich ebenfalls seinen Weg durch die Menschenmenge und kam fast gleichzeitig mit ihr dort an. Sie war einen Kopf kleiner als er, aber mit ihren hohen Absätzen glich sie den Größenunterschied fast aus.
»Hallo«, sagte sie freundlich. »Du bist Max, habe ich gehört.«
Max nickte verlegen.
Sie reichte ihm die Hand. »Ich bin Doris.« Dann bestellte sie zwei Bier. »Wie hat dir meine Rede gefallen?«
»Ich fand gut, dass Sie, äh, ich meine, dass du keine langweilige Rede gehalten, sondern eine Geschichte, ein Märchen erzählt hast.«
Sie prostete ihm zu und nahm einen Schluck vom Bier. »Man kann so besser zuhören. Auch mit geschlossenen Augen«, fügte sie verschmitzt hinzu.
»Ja, und so war ich nicht so abgelenkt«, erklärte Max verunsichert. »Ist die Welt um uns herum tatsächlich so schlecht?«
»Vieles droht verloren zu gehen, wenn wir nicht aufpassen.«
»Und wann kommt der Tag, den du angekündigt hast?«
»Du hast wirklich aufmerksam zugehört.« Doris Haferkamp nahm seine Hand. »Leute wie dich brauchen wir. Leute, die handeln, die zum richtigen Zeitpunkt für das Neue kämpfen.« Sie sah ihm in die Augen und sagte verschwörerisch: »Und kämpfen kannst du ja.« Sie fuhr ihm mit einer Hand durch seine blonden Locken. »Gerade die Jugend hat ein Recht auf eine Zukunft, in der sie einen Platz hat.«
Max war irritiert. War er Doris schon einmal begegnet?
Doris Haferkamp griff in ihre Handtasche und holte eine Visitenkarte hervor. »Hier, ruf mich an. Oder«, sie zwinkerte verschwörerisch mit einem Auge, »komm einfach vorbei, und ich erzähle dir von dem Tag.« Sie drückte Max die Karte in die Hand. »Ich glaube, du wirst erwartet.« Max drehte sich um und sah Sigi und ihre Freundin. Als er sich wieder Doris Haferkamp zuwenden wollte, war sie schon verschwunden.
Doris Haferkamp ließ sich von ihrer Assistentin ins Elysée-Hotel an der Rothenbaumchausee fahren, wo sie zurzeit wohnte. Dort war sie mit Winfried und Lasse verabredet, die ihr schon früher einige gute Dienste geleistet hatten. Nach dem Treffen im Januar auf Gut Groß-Bockenfurt war sie an die beiden herangetreten. Sie waren absolut zuverlässig und vertrauenswürdig und somit ihre Stützen bei der Vorbereitung für den Anschlag.
Winfried war Reserveoffizier und Sprengstoffexperte, Lasse war Logistik- und Organisationsexperte. Haferkamp hatte ihm vor Jahren eine Zusatzqualifikation in der Schweiz finanziert, mit der er einen lukrativen Job bei der Hamburger Hafen und Logistik AG im Containercontrolling bekommen hatte. Winfried hatte sie aus seinem seelischen Loch nach seiner Militärzeit herausgeholfen. Beides zahlte sich nun aus.
Doris Haferkamp war überzeugt, dass die beiden Männer die richtigen waren, um ein spektakuläres Szenario zu planen und umzusetzen. Etwas, das die Tatkraft und Fähigkeiten des ›Instituts‹ unter Beweis stellen würde. Sie waren gut ausgebildet, hatten die richtigen Verbindungen und eine Menge Erfahrungen. Und sie hatte sich nicht getäuscht. Ihr Vorschlag, zwei Ziele parallel anzugreifen, war einfach genial. Das würde für große Verwirrung bei der Polizei sorgen. Jetzt war sie gespannt über den Stand der Vorbereitungen. Haferkamp nippte an ihrem Gin Tonic und lächelte vor sich hin. Wenige Minuten später betraten die beiden die leere Lobby und setzten sich zu ihr in die dunkelgraue Sitzgruppe, die zwischen zwei marmorierten Säulen stand.
»Winfried, dein Bart ist in dem Maße gewachsen, wie die Haare auf Lasses Kopf kürzer geworden sind«, begrüßte Haferkamp die beiden amüsiert.
»Gefallen wir dir nicht?«, fragte Winfried und tat beleidigt.
»Es würde euch sowieso nicht stören.«
»Stimmt«, erwiderte Lasse.
»Was habt ihr inzwischen erreicht?«
Winfried holte ein Tablet hervor, gab ein paar Befehle ein und öffnete eine Datei. Dann gab er es Doris Haferkamp. »Das Zeug habe ich jetzt geordert. Nicht billig, aber gut.«
»Wird es rechtzeitig vor Ort sein?«
Winfried nickte. »Ich habe sicherheitshalber mehrere Bestellungen vorgenommen.«
Haferkamp gab das Tablet zurück. Winfried löschte die Datei und öffnete eine weitere. »Und hier«, er zeigte ihr ein Foto, »dieses Schmuckstück ist für den Big Shot.«
Doris blickte auf das Foto. »Sieht beeindruckend aus.«
»War schwer zu bekommen.«
»Also teuer.«
Winfried nickte. »Hast du die richtigen Leute für die Aufgaben rekrutiert?«
»Den Letzten habe ich heute getroffen. Ich lasse ihn schon seit über einem Jahr beobachten. Das erste Mal habe ich ihn beim ›Kampf der Nibelungen‹ 2018 in Ostritz gesehen. Das war beeindruckend. Und das Schmuckstück«, Doris nickte anerkennend, »wird die richtige Person zieren. Auch sie kenne ich seit Jahren und habe ihr mehr als einmal in einer schwierigen Lebensphase geholfen.«
Jetzt nahm Lasse das Tablet in die Hand. Auch er öffnete eine Datei und zeigte Doris einige Fotos. »Wie gefallen sie dir?«
»Lkw haben mich noch nie interessiert.«
»Das sind keine Lkw«, sagte Lasse, »das werden Granaten sein.«
Winfried haute sich auf die Schenkel. »Schönes Wortspiel.«
Doris Haferkamp war irritiert. »Ich verstehe nicht, was –«
»Ich erkläre es dir«, unterbrach Lasse sie. Eine Viertelstunde später löschte auch er die Dateien und steckte das Tablet wieder ein. »Damit sollte die Fanalwirkung perfekt sein«, sagte er zufrieden.
»Sollen wir dich irgendwo hinfahren?«, fragte Winfried. Die beiden Männer standen auf.
Doris Haferkamp schüttelte den Kopf. »Ich esse hier noch.« Sie sah den beiden hinterher. Der Tag des Anschlags, davon war sie überzeugt, würde in der Geschichte als Wendepunkt einer fehlgeleiteten Welt eingehen. Sie stand auf und steuerte ihr Zimmer an. Sie musste sich noch umziehen, bevor sie sich ins Restaurant begab.
2
Janne Bakken lag im Bett und dachte an ihre Großmutter. Mitte März war sie zu ihrer Beerdigung nach Norwegen gefahren. Ihr Tod war nicht überraschend gekommen, dennoch war Janne tief getroffen. Im Februar hatte sie noch ein paar wunderbare Tage mit ihr in Bergen verbringen können, ihrer beider Heimatstadt zwischen dem Hardanger- und Sognefjord. Jetzt war sie nicht mehr auf dieser Welt. Doch zwei ihrer Sätze würden Janne immer im Gedächtnis bleiben: »Die Kälte habe ich mein Leben lang ausgehalten, meinen Schmerz nicht.« Dazu ihre Ermutigung. »Lass dir nie etwas gefallen und lass kein Unrecht zu.«
Vor allem das nahm sie sich zu Herzen, nicht nur als Privatdetektivin. Denn das war sie seit Anfang des Jahres. Sie hatte sich bei Dr. Elias Hopp beworben, Journalist, Rechercheur und Privatermittler. Und jetzt war sie seine Partnerin. Zu verdanken hatte sie das Elias’ Jugendfreund, dem LKA-Profiler Heiner Zillinski, der von allen nur Zille genannt wurde. Der hatte ihm dringend zu einer personellen Verstärkung geraten, weil seine Fälle immer gefährlicher wurden. Und als Ex-Elitesoldatin war Janne mit Gefahrensituationen vertraut.
Dass sie bei ihrem ersten gemeinsamen Fall ihre Kampferfahrung so häufig würde einsetzen müssen, hätte sie allerdings nicht gedacht. Doch die Ritualmordserie, die Anfang des Jahres Hamburg erschütterte, hatte es in sich gehabt. Elias Hopp und sie hatten bei der Aufklärung die Sonderkommission des LKA unterstützt, der auch Zillinski angehörte. Die Zusammenarbeit mit der Soko war sehr erfolgreich, aber eben auch voller Gefahren gewesen. Das war ihr noch einmal deutlich geworden, als sie Elias’ Buch über die Ritualmorde gelesen hatte.
Bei diesem Fall hatte sie sich mit Anna Radke vom LKA angefreundet, die dort als IT-Forensikerin tätig war. Heute waren sie zum Brunch verabredet. Anna hatte Lachs und Matjestatar mitgebracht und Janne nach dem Rezept ihrer norwegischen Großmutter Waffeln gebacken.
»Ist Zille wieder im Lande?«, fragte Janne mit vollem Mund.
»Ja, ich habe ihn im Präsidium in Kriminalhauptkommissar Pöppelmanns Büro getroffen. Zille hat die Abschlusssitzung der Soko Ritualmorde mit seinen Geschichten von seinem Japan-Besuch aufgelockert.«
Janne lachte. »Das kann ich mir lebhaft vorstellen.«
Anna aß gerade ihre zweite Waffel mit Preiselbeeren und Sahne, als plötzlich eine krächzende Stimme zu hören war. »Ahoi, Käpt’n, noch ’n Rum. Ahoi, Käpt’n, noch ’n Rum.«
»Hast du deinen Papagei mitgebracht?«, fragte Janne verwirrt.
»Nein, das ist mein neues Diensthandy. Abhörsicher.« Anna rannte in den Flur zu ihrem Rucksack und kam nach einer Minute wieder zurück. »Das war die IT-Abteilung. Hackerangriff. Ich soll sofort ins Präsidium kommen.« Anna hielt nachdenklich ihr Handy hoch. »Das Telefonat war übrigens von Störgeräuschen durchsetzt.«
Nachdem Anna fort war, stellte Janne die Lebensmittel in den Kühlschrank und beschloss, zum Sport zu gehen. Sie zog sich um und schaute in den Spiegel. Mit ihren tiefblauen Augen betrachtete sie ihre neuen Sportklamotten. Sie sahen gut aus und waren gleichzeitig bequem. Sie machte ein paar Dehnübungen, nahm dann ihre Sporttasche mit der Wechselkleidung und begab sich auf den Weg zum Dojo.
Erst vor ein paar Tagen hatte sie den ersten WingTsun-Meistergrad erlangt. Dieser Kampfsport war eine wunderbare Ergänzung ihrer bisherigen Nahkampfausbildung, vor allem, weil sie damit ihre taktilen Reflexe ausbauen und so besser die Absichten ihres Gegners erspüren konnte. Allerdings blieben diese Fähigkeiten nur bei konstantem Training erhalten. Also suchte Janne zweimal die Woche das Dojo in der Erichstraße auf.
Malte Sandvik stand am Fenster seiner Dachgeschosswohnung in der Lange Straße auf St. Pauli, die er vor zehn Tagen für ein halbes Jahr inklusive abgewohnten Mobiliars angemietet hatte. Das spielte jedoch keine Rolle. Wichtig war allein, dass er die gegenüberliegenden Wohnungen gut beobachten konnte, wobei ihn aber nur eine Wohnung tatsächlich interessierte. Die von Janne Bakken.
Vor zwei Monaten wäre er bei seiner Flucht fast in der Ostsee krepiert. Hätte er noch zehn Minuten länger in dem vier Grad kalten Wasser getrieben, er wäre den sicheren Kältetod gestorben. Für alle anderen war er das auch. Ersoffen. Sandvik grinste. Er war ein zäher Bursche und hatte Glück im Unglück gehabt. Erst die Fischer, die ihn trotz Nebel gefunden und halb erfroren aus dem Wasser gezogen hatten. Dann die kleine Ambulanz auf Læsø, wo ein syrischer Flüchtling diensthabender Arzt war und ihn aufgepäppelt hatte. Inklusive der Amputation zweier Finger an der linken Hand.
Zum Dank hatte er seinem Helfer dann das Geld geklaut und war abgehauen. Er blickte auf seinen linken Arm. Die beiden fehlenden Finger waren kein Problem. Was ihn weit mehr störte, war die Unbeweglichkeit des Arms. Trotz des fast zweimonatigen harten Trainings konnte er ihn nach wie vor nur eingeschränkt benutzen. Was schon einem Wunder gleichkomme, wie die Ärzte ihm immer wieder bescheinigt hatten. Aber der Hass auf Janne Bakken, die ihn vor all seinen Untergebenen im norwegischen Militärcamp bloßgestellt hatte, war so groß, dass er all seinen Willen aufgebracht hatte, um wieder fit zu werden. Denn das musste er sein, wenn er sich mit dieser Elitesoldatin der Jegertroppen anlegen wollte.
Als er sie nach seiner Flucht in Kopperby in ihrem Wochenendhaus an der Schlei gefunden hatte, war er noch zu geschwächt gewesen, um sich mit ihr anzulegen. Er hatte zunächst überlegt, sie einfach zu erschießen. In Kopperby hatte er freies Schussfeld. Doch er gönnte ihr keinen schnellen, schmerzfreien Tod. Schon gar nicht, nachdem sie ihm eine Falle gestellt und ihn ein zweites Mal besiegt hatte. Er wollte sie leiden sehen. Doch dafür, und in seinem Innersten wusste er es, brauchte er mit seinem Handicap auch ein wenig Glück. Immerhin hatte er einen unschätzbaren Vorteil. Er war tot.
Sandvik bemerkte Bewegungen in der gegenüberliegenden Wohnung und blickte durch das Fernglas. Die dünnen Vorhänge verbargen nicht viel, und da sowohl das Schlaf- als auch das Wohnzimmer zur Straße hin lagen, hatte er genügend Einblicke. Zudem hatte er die Wohnung verwanzt und mit Kameras ausgestattet, weshalb er auch alles hörte und aus der Nähe sah. Sandvik wusste, dass sie häufig Besuch von einer Anna bekam, die beim LKA arbeitete. Er hatte gehofft, sie beim Sex beobachten zu können, doch offenbar war die Frau nur eine gute Freundin. Jetzt sah er, wie Janne sich eilig umzog. Er schaute auf seine Uhr. Es war halb zehn, und der Kleidung nach zu urteilen wollte sie Sport machen. Sandvik beschloss, sie auf ihrem Weg zu begleiten.
Vor der Haustür scannte Janne erst einmal die Lage. Zwar drohte ihr von Sandviks Leuten keine Gefahr mehr, schließlich konnte der vom Ostseegrund keine Befehle mehr erteilen. Doch seit dem Überfall vor einigen Monaten, als ihr zwei Männer in ihrer Wohnung aufgelauert hatten, war Janne vorsichtig geworden. Sie konnte nichts Auffälliges feststellen, lief Richtung Hein-Köllisch-Platz und von dort in die Silbersacktwiete. An der Piccadilly Bar, einer der bekanntesten Hamburger Gaybars, bog sie rechts ab, dann links in die Friedrichstraße. Das war zwar ein Umweg, doch Janne hatte plötzlich das Gefühl, jemand verfolge sie.
Sie blickte sich um und sah drei Gestalten, die mehr oder weniger gerade gingen. Das war auf dem Kiez nicht ungewöhnlich, schließlich gab es hier genügend Kneipen, die Tag und Nacht geöffnet hatten, so wie die Hans-Albers-Klause. Sie verlangsamte ihr Tempo, um es an der Chikago Bar wieder anzuziehen. Sie bog in die Gerhardstraße ein und meinte aus den Augenwinkeln wahrzunehmen, wie jemand ebenfalls eher lief als ging. Kurz entschlossen verschwand sie in einem Hauseingang und beobachtete die Straße. Doch auch nach zwei Minuten lief niemand an ihr vorbei. Sie trat aus dem Hauseingang hinaus und sah nur zwei Männer, die in bester Laune aus der Eckkneipe an der Herbertstraße kamen.
Hatte sie sich geirrt? Ihr Gefühl hatte sie allerdings noch nie getäuscht. Nachdenklich legte sie die letzten Meter zum Dojo zurück.
3
Mittags wachte Max mit einem dicken Kopf in Sigis Zwei-Zimmer-Wohnung auf. Als sein Blick auf die Kornflasche fiel, war ihm auch klar, warum ihm der Schädel brummte. Neben ihm machte sich Leni, Sigis Freundin, bemerkbar. Sie schlug die Augen auf und blinzelte ihn an.
»Du hast ganz schön lange durchgehalten«, sagte sie anerkennend.
»Man tut, was man kann.«
Leni setzte sich auf und schaute ihm in die Augen. »Wusstest du, dass du im Schlaf redest?«
Max bekam einen Schreck und machte ein fragendes Gesicht. »Nein, was habe ich denn erzählt?«
»Verworrenes Zeug. Scheintote mit weißen Haaren und so ’n Kram.«
Jetzt war auch Sigi wach, schlug die Bettdecke zurück und strich mit einer Hand über die Narbe auf seiner Brust. »Wer ist dafür verantwortlich?«
Max schwieg einen Moment, hielt Sigis Hand fest, sodass sie auf der Narbe liegen blieb. Dann blickte er sie an. »Eine Familienangelegenheit.«
Sigi spürte, wie die Narbe wärmer wurde. »Erzähl.«
Max ließ Sigis Hand los und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Als Kind bin ich von meinem Großvater misshandelt worden. Ich war ihm nicht hart genug. Wenn ich mich verletzt hatte und weinte, schlug er noch einmal extra zu.«
»Arschloch«, sagte Leni.
»Und deine Mutter?«, fragte Sigi.
»Die war nie da, und wenn, hatte sie immer widerliche Kerle bei sich.«
»Woher hast du die Narbe?«
»Eines Tages hatte mein Großvater Freunde eingeladen, alles alte Säcke wie er.«
»Weißhaarig?«
»Die meisten.« Max schluckte. »Meine Mutter war mal wieder unterwegs, während ich im Garten gespielt hab. Dabei bin ich in einen Stacheldrahtzaun gefallen –«
Leni schüttelte den Kopf. »Du hast geheult, und er hat wieder zugeschlagen. Stimmt’s?«
»Wenn nur er es gewesen wäre. Mein Großvater war ein grausamer Mann, dem es richtig Spaß machte, mich leiden zu sehen. Daher forderte er auch seine Kumpane auf, mich zu schlagen, ›damit das Weichei vielleicht doch irgendwann ein Mann wird‹.«
»Und haben sie?« Sigi schaute ihm in die Augen.
»Alle.« Max ballte die Fäuste. »Zum Schluss hat mein Großvater mir das T-Shirt ausgezogen, mich mit dem Oberkörper zwei-, dreimal heftig gegen den Stacheldraht gedrückt. Damit ich lernte, Schmerzen zu ertragen.«
Sigi und Leni schwiegen betroffen.
Max lachte hämisch. Sein Gesichtsausdruck bekam etwas Diabolisches. »Drei Jahre später habe ich dafür gesorgt, dass er einen tödlichen Unfall hatte.«
Sigi zog ihre Hand von der Narbe weg und stand auf. Als sie auf ihrem Handy die Uhrzeit sah, fluchte sie laut. »Scheiße, wir müssen in vierzig Minuten im ›Institut‹ sein. Katzenwäsche, Notschminken und dann ab.«
Auch Leni sprang auf. »Doris hasst es, wenn man zu spät kommt.« Dann schnappte sie sich ihre Klamotten und verschwand mit Sigi im Badezimmer.
Max zuckte mit den Schultern und nahm sich das letzte Stück kalte Pizza. Das Frühstück hatte er sich anders vorgestellt. Dann zog er sich an und blickte fasziniert auf Sigis Wanddekoration. An einer Wand hingen Plakate von Kickboxern. Thai-Kämpfer in Pose und im Kampf. Ein Plakat zog seine Aufmerksamkeit besonders auf sich. Auf schwarzem Untergrund war in gelber und weißer Schrift zu lesen: »Kickboxing is my therapy«. Die andere Wand war voll mit Plakaten und Fotos von Schusswaffen. Auf einem war Sigi mit einem Gewehr im Anschlag zu sehen.
»Sigi ist eine Waffennärrin und schießt verdammt gut.« Leni war wieder aus dem Bad gekommen. Sie zielte mit Zeigefinger und Daumen auf Max. »One shot, one kill.«
»Das trifft exakt für den Typ auf dem anderen Plakat zu.« Sigi kam geschminkt, aber nackt aus dem Badezimmer gelaufen. »Das ist ein kanadischer Scharfschütze, der hat einen IS-Kämpfer aus dreitausendvierhundertfünfzig Metern getroffen. Weltrekord.« Sie suchte in einem Schrank nach frischen Klamotten. »Das Irre ist, dass zwischen Schuss und Treffer weniger als zehn Sekunden lagen. Mit so einem Gewehr würde ich auch gerne mal schießen.«
»Wo hast du das eigentlich gelernt?«, fragte Max neugierig.
»Mein Vater hat mich schon als Kind mit auf den Schießstand genommen. Er meinte, es sei überlebenswichtig, schießen zu lernen.«
Max stand immer noch staunend vor den Plakaten. »Ist das schwer?«
»Man braucht schon viel Übung«, sagte Sigi. »Deshalb bin ich auch zur Bundeswehr gegangen.« Sie war inzwischen angezogen. »Kannst ja mal auf einen Schießstand mitkommen.« Sie nahm den Autoschlüssel vom Tisch. »Wir müssen los.«
Sie schafften es tatsächlich, rechtzeitig bei den Stadthöfen zu sein. Max staunte nicht schlecht, als er den Luxustempel zwischen Neuem Wall und der Stadthausbrücke sah. Hier sollte irgendwo das »Institut für Neues Denken« seine Räume haben.
»Der Eingang ist Stadthausbrücke 8«, sagte Leni. »Beim letzten Bogen führt ein Gang in den Innenhof. Da müssen wir rein.«
Im Gang kamen sie an einer Gedenktafel vorbei. Max blieb stehen und las.
»Wir gehen schon mal hoch«, rief Sigi, die schon ein paar Schritte voraus war. »Aber trödle nicht zu lange.«
Max verdrehte die Augen und wandte sich dann der Tafel zu. Er las, dass in der Nazizeit hier früher die Gestapo, die Hamburger Polizeiführung und die Kriminalpolizei die politische Überwachung der Bevölkerung und die Verfolgung von Minderheiten organisiert hatten. Und dass in den Kellerräumen gefoltert worden war. Krass, dachte Max.
Ein paar Minuten später stand er vor den Räumlichkeiten des »Instituts« im dritten Stock. Er wollte gerade auf die Klingel drücken, als Veronica auftauchte und ihm die Tür öffnete.
»Hallo, Max.«
»Kannst du hellsehen?«
»Ja, mit technischer Unterstützung«, sagte sie lächelnd und zeigte auf eine kleine Kamera an der Decke im Treppenhaus. »Von denen gibt es hier einige.«
»Von den Kameras oder diesem Tier unter der Kamera?«, fragte Max scherzhaft.
»Sowohl als auch«, antwortete Veronica und fügte hinzu: »Das Tier ist eine Skulptur und stellt einen Ziegenbock dar.« Dann bat sie Max ins »Institut«. »In dieser Etage haben nur Doris und ich unsere Büros«, sagte Veronica, als sie Max’ fragenden Gesichtsausdruck sah. »Außerdem gibt es zwei Besprechungsräume und eine Küche. Die Redaktion unserer Zeitschrift, Kröppelins Büro, Seminarräume und Lenis Schnittraum befinden sich im zweiten Stock.«
»Ganz schön groß.« Max klang beeindruckt. »Ist Leni häufig hier?«
»Immer, wenn sie aktuelle Videos für das ›Institut‹ schneidet und bearbeitet. Außerdem übernachtet sie hier manchmal in einem Gästezimmer.« Veronica harkte sich bei ihm unter. »Komm, ich bring dich zu Doris.«
»Gibt es keine Besprechung mit den anderen?«
»Später.«
Sie betraten einen Raum mit hohen Decken und großen Fenstern, durch die das Tageslicht ungehindert in den Raum strömen konnte. An den Wänden hingen Landschaftsbilder und Porträts von Menschen, die Max nicht kannte. Eine großzügige Sitzgruppe stand vor einem rustikalen, in Weiß gehaltenen Kamin, in dem Feuer loderte.
»Sieht echtem Feuer täuschend ähnlich«, sagte Veronica, »findest du nicht?«
Max nickte. »Allerdings.«
»Setz dich, Doris –«
»– kommt später«, war eine Fistelstimme zu hören. Kröppelin betrat den Raum. »Hallo, Max, ich soll dir mitteilen, dass Frau Dr. Haferkamp noch ein Telefonat führen muss und Veronica dir die Wartezeit mit ein paar Informationen zu diesem Gebäude verkürzen soll. Ich könnte Veronica dabei unterstützen.«
»Sehr nett, Herr Kröppelin. Ist aber nicht nötig«, sagte Veronica bestimmt. Beleidigt drehte er sich um und verließ den Raum. »Wenn er einmal anfängt zu reden, hört er nicht wieder auf.« Sie setzte sich in einen Sessel, und Max machte es sich auf einer Couch bequem.
»Doris legt großen Wert darauf«, Veronica räusperte sich, »dass jeder, der sich in diesen Räumen aufhält, auch die Geschichte dieses Gebäudes kennt.«
»Ich habe schon die Gedenktafel gelesen.«
»Das ist gut. Dann weißt du ja schon das Wesentliche.« Veronica schmunzelte. »Allerdings gibt es das Stadthaus schon seit 1814 und ist als Erweiterung des Görtz-Palais am Neuen Wall gebaut worden. Es war immer Sitz einer Behörde. Stadtverwaltung, Polizei, Gestapo-Hauptquartier. Nach dem Krieg zog die Baubehörde hier ein, und erst 2008 wurde es privatisiert und in einen Konsumtempel umgebaut.«
»Das ist ja eine richtige Geschichtsstunde für Max.« Doris Haferkamp betrat gut gelaunt den Raum. »Aber ich glaube, er hat jetzt genug gehört.« Dann wandte sie sich an Veronica. »Wir sehen uns gleich im Konferenzraum.«
Nachdem Veronica den Raum verlassen hatte, setzte sich Doris zu Max auf die Couch. »Ich bin froh, dass du hier bist.« Sie nahm seine Hand. »Ich habe viel Gutes über dich gehört.«
Max runzelte die Stirn.
»Aus der Kampfsportgruppe und«, Doris Haferkamp blickte ihn vielsagend an, »von Sigi und Leni.« Sie holte zwei Gläser und eine Karaffe mit Wasser. »Wir sind eine Gruppe von Menschen, die Großes planen, etwas, das eine echte Zeitenwende bedeutet. Du erinnerst dich an meine kleine Geschichte?«
Max nickte.
»Was hast du dir gemerkt?«
»Wir sollen ausziehen und der Welt das Fürchten lehren.«
»Und du bist auserwählt, uns dabei zu unterstützen.«
»Und wie?«
»Ich habe dich kämpfen sehen, beim ›Kampf der Nibelungen‹ 2018.«
Max wurde bleich. Bei dem Turnier war er völlig ausgerastet und hatte einen seiner Gegner nur deshalb nicht totgeschlagen, weil er von drei Leuten daran gehindert worden war.
Doris fuhr fort: »Seit dieser Zeit lasse ich dich beobachten, weil ich immer auf der Suche nach neuen Mitstreitern bin, die sich erfolgreich zur Wehr setzen können. Ich weiß daher auch, warum du Dortmund verlassen hast.«
Max erschauderte. Dort hatte er im Streit einen älteren Kameraden, der immer alles besser wusste, krankenhausreif geprügelt.
Doris Haferkamp legte Max eine Hand aufs Knie. »So viel Kraft, so viel Mut.« Ihre Augen leuchteten. »Und dann diese Wut.« Jetzt kam sie ihm ganz nahe. Ihr Mund war neben seinem Ohr. »Ich kann dich verstehen. Wer so viel Wut in sich trägt, muss sie irgendwo lassen.« Max spürte ihre Lippen. »Ich kann dir helfen, diese Wut für etwas Großes zu nutzen«, flüsterte sie. Ihre beiden Hände umfassten seinen Kopf, sie sahen sich in die Augen. »Willst du das?«
Max war unfähig, etwas zu sagen. Er war verwirrt, erfreut und vor allem erregt. Er kannte seine dunkle Seite, die immer wieder aus ihm herausbrach. Doris war die Erste, die darin auch etwas Positives sah. Er hatte das Gefühl anzukommen. Endlich bekam er ein Angebot, das auch zu ihm passte. Mit Mühe und Not kam ihm ein leises »Ja« über die Lippen.
Doris Haferkamp hielt noch einen Moment seinen Kopf, hauchte ihm einen Kuss auf die Lippen. Dann stand sie auf und ging zum Kamin. »Alle, die du gleich sehen wirst, vertrauen einander, stehen füreinander ein und haben keine Geheimnisse voreinander. Wir treffen uns im Besprechungsraum eins. Geh schon einmal vor, es ist der Raum mit der blauen Tür.«
Auf dem Weg dorthin gingen Max viele Gedanken durch den Kopf. Doris hatte ihm also schon lange hinterherspioniert. Kannte sie auch Details aus seiner Kindheit? Er hatte nicht die geringste Ahnung, und das verunsicherte ihn. Gleichzeitig war er geschmeichelt, dass er gebraucht wurde. Man ihn akzeptierte, so wie er wirklich war. Das hatte er bisher noch nie erlebt in seinem Leben. Er würde zu einer auserwählten Gruppe gehören. Eine Gruppe, die etwas verändern wollte und ein großes Ziel hatte. In seinem Leben hatte er sich bisher nur ein Ziel gesetzt. Und das Ziel hatte er erfolgreich erreicht.
Die Tür zum Besprechungszimmer war nur angelehnt, und so ging Max hinein. Dort saßen Leni und Sigi sowie zwei Männer, die er nicht kannte, schon am Tisch. Max sah, wie der Mann mit dem Stoppelhaarschnitt ein paar Zettel in seiner Aktentasche verschwinden ließ und die beiden Frauen fragte: »Alles so weit klar?«
Sigi und Leni nickten. Dann blickte er zu Max. »Ich bin Lasse, und neben mir, der mit dem Vollbart, das ist Winfried.«
In dem Moment betraten Doris Haferkamp und Veronica den Raum. Letztere hatte einen kleinen Karton dabei, den sie auf einen Tisch stellte. »Wie gut, ihr habt euch schon vorgestellt«, sagte Doris. »Dann können wir ja gleich loslegen.« Sie setzte sich und schenkte sich ein Glas Wasser ein. »Ihr seid eine besondere Einheit, die Vorhut einer Bewegung, und werdet mit eurer Aktion den Grundstein für die nationale Neugestaltung dieses Landes legen. An diesem Tag wird die Welt sehen, wozu wir in der Lage sind. Und jeder Einzelne von euch trägt mit seinen Fähigkeiten dazu bei.«
»Und was geschieht nach der Aktion?«, fragte Max.
»Dann werden Mechanismen in Gang gesetzt, die diesen Staat verändern werden.«
»Von wem?«
»Von einem großen Netzwerk, das schon seit einiger Zeit auf diesen Moment hingearbeitet hat«, antwortete Haferkamp.
»Und wie groß ist das Netzwerk?«, wollte Sigi wissen.
»Viele stehen hinter uns, auch in wichtigen Positionen. Aber sie müssen anonym bleiben, damit sie im entscheidenden Moment aktiv werden können.«
»Meinst du das Hannibal-Netzwerk?«
Doris schüttelte den Kopf. »Nein, das ist ja bekannt. Und zwar nicht nur dir, Leni, sondern auch dem Verfassungsschutz, dem Bundeskriminalamt und den Medien. In diesem Netzwerk sind viele testosterongesteuerte Männer, meist Reserveoffiziere, Elitesoldaten oder Polizisten, die ihre Gewaltphantasien in Chats oder bei Facebook in die Welt hinausposaunt haben und so in der Regel entdeckt wurden.« Doris blickte streng in die Runde. »Auf die können wir uns nicht verlassen.«
»Wer weiß von uns?«, fragte Leni.
»Von euch als Gruppe nur Veronica und alle anderen hier Anwesenden.« Haferkamp fuhr mit ernstem Gesichtsausdruck fort. »Alles, was wir hier besprechen, unterliegt der absoluten Geheimhaltung. Ihr existiert nur als Schatten, die ausschließlich von mir ihre Anweisungen erhalten. Und ihr werdet nur von mir oder Veronica kontaktiert.« Veronica griff in den Karton und legte fünf Handys auf den Tisch. »Abhörsicher.«
»Das heißt, unsere eigenen Handys werden vernichtet?«, fragte Leni wehmütig.
»So ist es.« Veronica nickte ernst. »Ab sofort nutzt ihr keine Social-Media-Kanäle mehr.«
»Haben wir untereinander Kontakt?«, fragte Sigi.
Doris zögerte mit der Antwort. »Nur wenn es nötig sein sollte.« Doris Haferkamp stand auf. »Kann ich mich auf euch verlassen?« Sie blickte allen nacheinander in die Augen, und wie auf Kommando standen sie alle auch auf.
»Ja«, kam aus ihren Mündern, »das kannst du.«
Doris nickte. »Es soll euer Schaden nicht sein.« Sie machte eine kurze Pause. »Eins noch. Ihr müsst als Einheit funktionieren und euch gegenseitig blind vertrauen. Lasse und Winfried werden die Aktion leiten. Sigi und Leni haben ihre Informationen schon erhalten. Max instruiere ich gleich. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen, und verhaltet euch bitte unauffällig – absolut unauffällig.« Dann wandte sie sich an Max. »Komm, wir gehen in mein Büro.«
Eine halbe Stunde später stand Max vor dem Stadtpalais. Er dachte über das nach, was Doris Haferkamp ihm erläutert und aufgetragen hatte. Es waren heikle Aufgaben. Aber er wollte dabei sein. Und das Unglaubliche war, dass sie zu ihm passten. Er konnte sein Glück kaum fassen. Er steckte die Hände in die Hosentaschen und ging Richtung S-Bahn.
Er war auf Höhe des Bleichenfleets, als er einen lauten Pfiff hörte. Er schaute sich um und entdeckte auf der gegenüberliegenden Seite Sigi und Leni. Sie lehnten lässig am Brückengeländer und winkten ihm zu. Max überquerte die Straße. »Toll, dass ihr gewartet habt.«
»Und«, Leni sah ihn auffordernd an, »hast du deine Aufgaben erhalten?«
Max kam ins Stottern. »Äh …«
»Du musst nicht antworten«, kam Sigi ihm zu Hilfe.
»War ein Scherz«, sagte Leni leicht genervt. »Wir müssen unsere Aufgaben alle für uns behalten.«
»Was machen wir jetzt?«, fragte Max.
»Das, was nötig ist.«
»Also heute Nacht bei mir.« Sigi hakte sich bei Max und Leni unter.
Doris stand am Fenster ihres Büros und sah den jungen Leuten hinterher. Sie hatte vor zwei Tagen mit ihrem Informanten beim LKA gesprochen, der in der Abteilung Staatsschutz tätig war. Was sie erfahren hatte, war weniger erfreulich. Er hatte sie darauf hingewiesen, dass in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren zunehmend Spitzel in rechte Organisationen eingeschleust worden waren. Sie müsste davon ausgehen, dass auch das »Institut« davon betroffen sei.
Sie wusste, dass das »Institut« vom Staatsschutz beobachtet wurde, aber dass ein Spitzel bei ihr eingeschleust worden wäre, konnte sie sich nicht vorstellen. Alle engen Mitarbeiter waren sorgfältig überprüft worden, insbesondere alle am Projekt beteiligten. Für Lasse und Winfried legte sie ihre Hand ins Feuer. Wenn, kamen nur die anderen in Frage, obwohl Doris auch den Gedanken absurd fand. Leni und Sigi kannte sie seit Jahren, Max war das gesamte letzte Jahr beobachtet worden, Veronica war in einem rechtsnationalen Umfeld aufgewachsen und hatte zudem einen ausgezeichneten Leumund in der Szene. Aber es stand zu viel auf dem Spiel.
Mit der Überprüfung hatte sie Winfried und Lasse beauftragt. Auch würde es keine Treffen mehr im »Institut« geben, stattdessen würden alle weiteren Kontakte kurzfristig und an verschiedenen Orten stattfinden. Oder über die abhörsicheren Handys. Sie musste selbst das kleinste Risiko ausschließen.
4
»Hallo, Kleine, wie wär’s mit uns beiden?« Janne schlug die Augen auf und blickte sich irritiert um.
»Ahoi, Käpt’n.«
Dann hatte sie Blacky, Annas Graupapagei, entdeckt. Sie saß auf einem Regal gegenüber dem Bett und blickte frech zu ihr herüber. Janne gähnte. An Blackys anzügliche Sprüche hatte sie sich noch nicht gewöhnt. Sie sprang aus dem Bett, den ganzen Vormittag hatte sie verschlafen. Janne ging in die Küche und fand einen gedeckten Tisch vor. In der Mitte des Frühstückstellers lag eine Lakritzschnecke. Annas Laster. So einen Service war sie nicht gewohnt. Sie schenkte sich einen Kaffee ein und schmierte sich ein Brötchen. Die Schnecke würde sie später verzehren.
Nachdem Janne erfahren hatte, dass die Störgeräusche in Annas Handy nur in ihrer Wohnung auftraten, war sie bei Anna eingezogen, was sonst nur noch Elias und Zille wussten. Und natürlich Miroslav Eschenbrosch, ihr ehemaliger Chef bei der Personenschützerfirma Rock und ihr Cleaner, der ihr in kniffligen Situationen immer wieder half. Wie jetzt. Seine Leute untersuchten ihre Wohnung nach Wanzen. Irgendjemand schien etwas von ihr zu wollen. In ihrer Paranoia dachte sie sofort an Malte Sandvik. Doch der war für tot erklärt worden, wenn auch nie jemand seine Leiche gefunden hatte.
Sie beschloss, zu ihrer Beruhigung mit Zilles Freundin, Britta Timmermann vom BKA, zu sprechen. Sie hatte schließlich damals veranlasst, Sandvik an die Norweger auszuliefern. Nur kam er nie in Norwegen an, weil seine Bewacher es nicht verhindern konnten, dass er in die eiskalte Ostsee gesprungen war. Eigentlich ein sicherer Tod. Aber Sandvik war zäh. Außerdem würde sie Kontakt zu ihrer Freundin Liv Hauge aufnehmen, mit der sie gemeinsam die Ausbildung bei den Jegertroppen absolviert hatte und die in Kontakt mit Leuten vom norwegischen Geheimdienst stand. Vielleicht wussten die etwas.