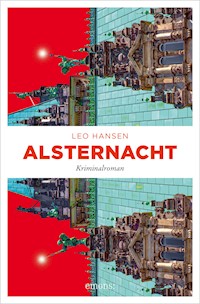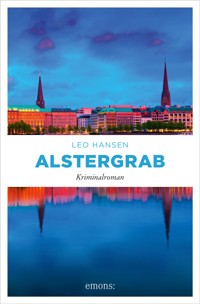
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Elias Hopp und Janne Bakken
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Kriminalroman mit psychologischer Tiefe – düster, komplex und beängstigend aktuell. In Hamburg tagt ein Wissenschaftskongress zu revolutionären Technologien, doch verstörende Verbrechen überschatten die Veranstaltung: Forscher werden gefoltert und ermordet, andere entführt. Das Ermittlertrio Dr. Elias Hopp, Janne Bakken und LKA-Profiler Zillinski macht sich auf Spurensuche und taucht tief in die Welt eines apokalyptischen Zukunftsszenarios ein. Die Zeit drängt – denn nicht nur das Leben der Geiseln steht auf dem Spiel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leo Hansen, Jahrgang 1954, arbeitete fünfzehn Jahre bei den Landesmedienanstalten in Hamburg und Thüringen. Anschließend unterrichtete er Medienpädagogik, Psychologie/Pädagogik und Politik und veröffentlichte zahlreiche medienpädagogische Fachartikel. Er hat drei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau in Hamburg.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/YAY Media AS/Alamy/Alamy Stock Photos
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-198-0
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Meinen Enkeln Johan, Klara, Helen
Unglück macht Menschen, Wohlstand macht Ungeheuer.
Victor Hugo (1802–1885)
1
Die Apple Watch vibrierte an seinem Handgelenk. Der neunzehnjährige Finn Tiberius schaute auf das Display und sah, dass Professor Santino ihm eine Nachricht geschickt hatte. »Muss den Termin leider verschieben. Melde mich wieder.«
Das war Finn gar nicht so unrecht. Er war ohne Frühstück aufgebrochen, weil er wieder mal verschlafen hatte. Nun konnte er das Frühstück nachholen. Er schrieb eine Nachricht mit fast gleichlautendem Text an das Institut für Biochemie und Molekularbiologie, wo das Treffen stattfinden sollte. Dann lehnte er sich entspannt im Sitz der S-Bahn zurück. In zwanzig Minuten würde er am Bahnhof Dammtor ankommen und dann in Ruhe zu McDonald’s gehen.
Er schloss die Augen, und sofort kamen ihm Bilder von der »International Competition for Young Natural Scientists«, die vor sechs Wochen in Glasgow stattgefunden hatte, in den Sinn. Wenn er ehrlich war, hatte er damit gerechnet, einen Preis zu erhalten. Seine Forschungsergebnisse zur Nutzung künstlicher Photosynthese für die Energiegewinnung waren einfach großartig. Obwohl es also keine echte Überraschung war, hatte er sich total gefreut, und es war ein erhabenes Gefühl gewesen, auf der Bühne zu stehen. Vom Preisgeld einmal abgesehen. Und dass er zusätzlich zum Hamburger Zukunftskongress eingeladen wurde, war eine besondere Ehre.
Zudem waren die Tage mit all den anderen jungen Forschern sehr abwechslungsreich und die Abende unterhaltsam gewesen. Er hatte viele interessante Menschen kennengelernt, mit denen er sich angeregt unterhalten konnte, aber auch einige Dummschwätzer. Beeindruckt war er auch von den vielen Journalisten, die in dem SEC, dem Scottish Event Campus, wie Fliegen um die jungen Wissenschaftler herumschwirrten und sich für deren Forschungsergebnisse interessierten.
Auch er hatte als einer der Gewinner große Aufmerksamkeit erfahren. Es waren vor allem eine deutsche Journalistin von Scinexx und ein englischer Kollege vom New Scientist, beides renommierte Wissenschaftsmagazine, die ihm Löcher in den Bauch gefragt hatten. Sie wollten nicht nur alles über seine Forschungsergebnisse wissen, sondern hatten auch viele Fragen zu seinem persönlichen Umfeld gestellt. Gerade für ein jüngeres Publikum sei dies besonders interessant, hatte ihm die deutsche Journalistin versichert, deren Name ihm partout nicht mehr einfiel, obwohl er so ungewöhnlich war. Das alles war jetzt vier Wochen her.
Finn öffnete die Augen und schaute aus dem Fenster. Die Sonne schien, es war ein schöner Herbsttag. Der Engländer mit der Brille hieß Ben, fiel ihm ein, und die Deutsche hatte einen Doktortitel. Er überlegte. Schwarze lockige Haare, braune Augen und pinkfarbene Sneaker, daran konnte er sich erinnern. Aber der Name? Das ließ ihm jetzt keine Ruhe. Er kramte in seinem Rucksack herum und holte eine verknitterte Visitenkarte heraus. Dr. Kiriaki Blumenfeld. Finn lächelte. Wie konnte er diesen Namen vergessen? Er schloss wieder die Augen und sah sie vor sich. Kiki. Man durfte sie auf keinen Fall Kiriaki nennen. Das klinge wie Kikeriki. Damit hätten die Kinder in der Grundschule sie aufgezogen.
Ben, der Engländer, hatte vollmundig versprochen, seinen Artikel schon in wenigen Wochen in der November-Ausgabe des New Scientist zu veröffentlichen, und Kiki würde dann Anfang des folgenden Jahres für das deutsche Publikum nachlegen. Erfahren hatte er das beim gemeinsamen Abendessen in der Horseshoe Bar in der Drury Street, dem berühmtesten Pub in Glasgow mit der längsten Hufeisentheke in Großbritannien. Dahin hatte Ben ihn und Kiki eingeladen, um bei einem guten Steak und noch besserem Guinness exklusiv über seine Forschungsarbeiten zu sprechen. Das Steak hatte Finn genossen, und auch das Camden Hells Lager hatte ihm super geschmeckt. Auf ein zweites hatte er aber verzichtet.
Sein Großvater hatte ihn vor genau solchen Situationen gewarnt. »Sei auf der Hut«, hörte er ihn sagen, als sie seine Präsentation für Glasgow vorbereiteten. »Geschniegelte und gegelte Wirtschaftsmanager sowie freundlich daherkommende Journalisten werden dich um den Finger wickeln wollen, um Informationen zu erhalten, die du lieber für dich behalten solltest.« Dann hatte er aus seiner Schublade eine Apple Watch geholt und sie ihm überreicht. »Zur Belohnung und als Erinnerung an meine Worte.« Die Warnung hatte er sich zu Herzen genommen und sich auch nicht von Kikis bezauberndstem Lächeln und Bens Versprechungen irgendwelche Informationen herauslocken lassen, die über das hinausgingen, was er in der Präsentation gezeigt hatte. Vielleicht hatte er etwas viel von seinem Privatleben preisgegeben, aber das war ja weder geheim noch besonders aufregend. Eigentlich nur Alltagsroutine.
»Next station Central Station, please exit here …« Die sonore Lautsprecherstimme riss Finn aus seinen Gedanken. Er öffnete die Augen und sah sich einen Moment verwirrt um. War er eingenickt? Die Bahn war voll geworden. Wo all die Leute nur herkamen? Dann glaubte er seinen Augen nicht zu trauen. War das an der Tür nicht Kiki? Die schwarzen Locken, das Lächeln, dann öffneten sich die Türen, und die Menschenmassen quetschten sich auf den Bahnsteig. Finn sprang auf, schnappte sich seinen Rucksack und hetzte hinterher. Er blickte sich um, aber von den schwarzen Locken war nichts mehr zu sehen. Einen Moment war er enttäuscht. Doch warum sollte es auch Kiki gewesen sein, schließlich gab es noch mehr Frauen mit schwarzen lockigen Haaren. Er hatte seine Erinnerungsbilder wohl ins Reale projiziert. Kiki war schließlich eine gut aussehende Frau. Von ihr konnte man schon mal träumen, dachte er. Dann stieg er in den nächsten Zug, der ihn zum Bahnhof Dammtor bringen sollte.
Sammy, ein alter Klassenkamerad, der schon seit zwei Jahren bei McDonald’s im Bahnhof jobbte, stand auch an diesem Mittwoch hinter dem Tresen an der zweiten Kasse. Finn stellte sich an und bemerkte, wie Sammy die Augen verdrehte, weil die beiden Kids vor ihm ihre Cents einzeln aus der Tasche kramten, um zwei Hamburger zu bezahlen. Als er Finn sah, hielt er lässig sein Handgelenk hoch.
»Bin jetzt auch am Start.« Stolz zeigte er seine Apple Watch.
»Gediegen, Sammy.«
Die beiden tauschten ihre dazugehörigen Nummern aus.
»Und sonst? Was geht?«
Finn zuckte mit den Schultern. »Verschlafen.«
»Also wie immer?«
»Jap.«
Sammy bestellte in der Küche das Rührei mit Bacon und betätigte den Knopf an der Maschine für den Kakao. »Glasgow?«
»Voll die Krönungsmesse.«
Sammy drehte sich um und stellte den Kakao auf ein Tablett. »Das ist ja nice.«
»Ja, war echt abgefahren, aber es haben auch viele den Dicken markiert«, sagte Finn lachend.
Sammy holte das Rührei. »Und, wirste jetzt berühmt?«
»Keine Ahnung, aber why not?« Er bezahlte, zeigte auf die Watch und nahm das Tablett. »Gönn dir was, Sammy.«
»Kein Thema.«
Finn ging zu einem Tisch am Fenster mit Blick auf die Baustelle am Dag-Hammarskjöld-Platz, stellte das Tablett ab und den Rucksack auf den Boden. Von hier aus konnte er den Eingangsbereich gut überblicken. Er trank einen Schluck Kakao und machte sich über das Rührei her. Er musste wieder an Kiki denken. Vielleicht hatte er in der Bahn doch keine Gespenster gesehen.
Bevor er sich weiteren Überlegungen hingeben konnte, kam ein Typ mit schwarzer Hornbrille, Stoppelhaarschnitt und Schnauzbart durch die Eingangstür. Er blickte sich um und ging dann direkt auf Finn zu. Finn war irritiert. Kenn ich den?, überlegte er.
»Lange nicht gesehen, good boy.«
Finn schnappte nach Luft und verschluckte sich fast an einem Stück Schinken. War das etwa Ben, der englische Journalist aus Glasgow?
»Nun schluck erst mal richtig runter«, sagte Ben auf Deutsch, aber mit einem britischen Akzent. »Habe ich dich so erschreckt?«, feixte er und setzte sich neben Finn, der den letzten Rest seines Burgers runterwürgte.
»Was heißt erschreckt? Überrascht. Bist ja kaum wiederzuerkennen.«
»Ist in England der letzte Schrei.«
»Ist Kiki auch hier?«
Ben überhörte die Frage. »Ich benötige noch ein paar Informationen zu deinen Forschungsergebnissen. Mit dem allgemeinen Kram, den du uns in Glasgow erzählt hast, kann ich wenig anfangen.«
»Mehr gibt es nicht zu erzählen.«
»Don’t be daft.« Bens Ton wurde schärfer. »Ich will wissen, ob man die Energie, die du aus der künstlichen Photosynthese gewinnst, schon nutzen kann.«
»Alter, ich bin Wissenschaftler und kein Ingenieur. Back dir ein Eis, dir erzähl ich nichts.«
»Mir vielleicht nicht, aber Kiki. Und ich habe ein gutes Argument, damit du jetzt mit mir kommst.« Ben ließ eine Hand in seine Jackentasche gleiten, und kurze Zeit später spürte Finn einen Druck in den Rippen. Ben grinste. »Die macht auch plopp, wenn ich will. Also beweg deinen Hintern und komm mit.«
Finn schluckte. »Kann ich vorher noch mal aufs Klo?«
»Ich komm mit.« Ben nickte Richtung Toiletten. »Und mach keinen Unsinn.«
Finn stand auf, und Ben folgte dicht hinter ihm. Sie mussten den langen Weg am Verkaufstresen vorbei. Sammy winkte ihnen zu. In der Toilette ging Finn sofort auf die Kabinen zu.
»Ich muss da hinein. Willst du da etwa auch mitkommen?«
Ben verzog angewidert das Gesicht. »Gib mir dein mobile.«
Finn zögerte demonstrativ, dann tat er wie befohlen. »Aber pass gut darauf auf«, sagte er und verschwand in der Kabine.
Er setzte sich auf den Toilettendeckel und überlegte, was er tun könnte. Um Hilfe rufen? Wahrscheinlich zu gefährlich. Sammy eine Nachricht von Watch zu Watch schicken und ihn bitten, Hilfe zu holen?
»Finn, wenn du in dreißig Sekunden nicht draußen bist, kletter ich rein«, zischte Ben in diesem Moment.
»Reg dich ab, du Arsch«, polterte Finn zurück. »Komme gleich.« Er würde abhauen. Es zumindest versuchen. Er öffnete die Walkie-Talkie-App auf der Uhr, scrollte durch das Adressbuch und lud Sammy ein. Der nahm die Einladung glücklicherweise sofort an, und Finn murmelte in die Uhr: »Komme gleich mit dem bebrillten Typen am Tresen vorbei. Lenk ihn ab.«
In dem Moment, als Finn Sammys Antwort lauschen wollte, hämmerte Ben gegen die Tür. »Komm raus, du Clown.«
Finn stellte die Uhr sofort aus, drückte die Spülung und verließ die Toilette. Er hatte keine Ahnung, ob Sammy irgendetwas verstanden hatte. Er musste es darauf ankommen lassen. Ben ging wieder dicht hinter ihm, als sie die Toiletten verließen und das Restaurant betraten. Finn spürte die Pistole in seinem Rücken, und Ben schubste ihn Richtung Ausgang. »Du gehst jetzt schnell, aber ruhig.«
»Musst du so dicht hinter mir hergehen?«, rief Finn laut.
Ben verstärkte den Druck und blaffte: »Shut up!«
2
Professor Santino war ein sehr umtriebiger Mensch. Der gebürtige Spanier war zum einen ein sehr renommierter Biochemiker, der seit vier Jahren am Karlsruher Institut für Technologie tätig und Leibniz-Preisträger war. Zum anderen war er auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. In seinem Spezialgebiet, der funktionellen molekularen Systeme, hatte er mehrere Patente angemeldet. Mit diesen hatte er seine erfolgreichen Firmen Santi und Unialta gegründet, die aus steuerlichen Gründen in Spanien zugelassen waren. Letztes Jahr war er sogar zum Unternehmer Spaniens gekürt worden.
Er hätte sich längst zur Ruhe setzen und sich auf seinen Lorbeeren ausruhen können, doch ein solches Szenario war mit seinem Charakter nicht zu vereinbaren. Citius, altius, fortius, er hielt es mit dem olympischen Motto. Das bedeutete für ihn, weiterzumachen und immer erfolgreicher zu werden. Und das bezog er sowohl auf seine geschäftlichen wie auch auf seine wissenschaftlichen Aktivitäten. Das letzte Jahr war allerdings für seine Ansprüche nicht gut genug verlaufen. Einige wichtige Aufträge hatte er nicht bekommen, und, das ärgerte ihn besonders, es stockte bei seinen Forschungen im Bereich der künstlichen Photosynthese.
Ein Lichtblick war lediglich, dass er zufällig auf die Arbeiten eines jungen Forschers aus Hamburg gestoßen war, die sich ebenfalls mit der Energiegewinnung aus der künstlichen Photosynthese beschäftigten und ihm sehr vielversprechend erschienen. Also hatte er seine Assistentin gebeten, Kontakt mit ihm aufzunehmen, was sich jedoch als unerwartet schwierig herausstellte. Auch als er ihn persönlich kontaktiert hatte, war der junge Mann, Finn Tiberius, zunächst sehr zurückhaltend in Hinblick auf den Austausch von Forschungsergebnissen gewesen. Aber nach dessen Erfolg beim internationalen Wettbewerb für junge Naturwissenschaftler in Glasgow hatte er ihn doch überzeugen können, dass ein Austausch auch für ihn von Nutzen sein könnte, gerade wenn es um die praktische Anwendung seiner Ergebnisse ging.
Heute sollte es nun zu einem ersten Treffen mit dem jungen Wissenschaftler kommen. Doch als Santino sich vor etwa einer Stunde auf den Weg von seinem Hotel im Schanzenpark zur Universität machen wollte, hatte es an seiner Zimmertür geklopft. Ein Mitarbeiter des Hotels stand vor der Tür und hatte ihm einen Briefumschlag überreicht. Das Schreiben war eine Einladung von Dick Mighty, CEO von CHEBIOS Motormobile, einem Subunternehmen von CHEBIOSINT.CO. Soweit Santino wusste, war dieses Unternehmen inzwischen das drittgrößte unabhängige Petrochemie-Unternehmen der Welt.
Sehr geehrter Professor Santino, ich habe gestern Abend Ihren Vortrag zu alternativen Antrieben auf dem Mobilitätsgipfel in der DUB-Akademie gehört und war begeistert. Nun möchte ich Sie unbedingt persönlich kennenlernen und für unser neues Mobilprojekt gewinnen. Ich weiß, das klingt wie ein Überfall, aber wenn Sie meiner spontanen Einladung folgen, würde ich mich freuen. Mein Fahrer wird Sie abholen. I hope we see each other.
Santino war euphorisiert. Eine Zusammenarbeit mit CHEBIOS würde das Jahr doch noch in ein Erfolgsjahr verwandeln. Und deshalb hatte er den Termin mit Finn Tiberius verschoben. Er blickte auf seine Uhr. Der Fahrer musste bald im Hotel sein. Bevor er ins Foyer ging, schrieb er noch schnell eine Nachricht an seine Frau. »Treffe mich mit CEO von CHEBIOS. Fantástico. Muchos besos.« Santino steckte das Handy zufrieden in die Innentasche seines Sakkos. Dabei fiel ihm ein Fleck auf dem Ärmel auf. Er zog ein neues an, band sich noch schnell eine Krawatte um und schaute dann in den Spiegel. Gut sah er aus.
An der Rezeption gab er seinen Zimmerschlüssel ab. »Könnten Sie mein Sakko in die Reinigung bringen lassen? Es liegt auf dem Bett.«
»Gerne, wird erledigt, Herr Professor.« Die junge Frau hinterm Tresen lächelte ihn an. »Der Herr dort an der Säule bei der Wendeltreppe wartet schon auf Sie.«
Santino nickte und ging schnellen Schrittes auf den Herrn im schwarzen Anzug und mit adrett gescheiteltem Haar zu. Der führte ihn zu einer großen BMW-Limousine und öffnete ihm die Tür. Santino nahm auf dem Rücksitz Platz und machte es sich bequem.
Finn hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, als Sammys Organ durch das Restaurant dröhnte. »Eh, du stoppelhaariges Hasenhirn, kannst du mal die Tür der Pisseria zumachen?«
Verwirrt drehte sich Ben zu Sammy um und löste leicht den Druck auf Finns Rippen. In dem Moment schubste Finn ihn zur Seite. Ben kam ins Straucheln, Finn verschwand durch die Tür und stand in der Bahnhofshalle. Dann lief er los. Als er bei Starbucks um die Ecke bog, sah er aus den Augenwinkeln, dass Ben gerade McDonald’s verließ. Er sprintete auf den Dag-Hammarskjöld-Platz, stieß einige Passanten zur Seite und quetschte sich zwischen zwei schwarzen Autos hindurch, die dreist vor dem Ausgang standen. Wütend schlug er auf eine Motorhaube und entschied sich dann, Richtung Radisson zu laufen.
Die Treppenstufen zum Hotel nahm Finn mit wenigen Sprüngen. Er lief hinter dem Hotel Richtung Kongresshallen und sah Ben schon auf den Treppen. Verdammt schnell, dachte Finn. Er hoffte dennoch, dass er als geübter Parkour-Läufer dem Engländer gegenüber im Vorteil sein würde. Er kletterte auf ein Gerüst, das vor dem Bistro stand, und zog sich von dort auf einen herausstehenden Fenstersims hoch. Auf dem lief er bis zu einer Plattform, hinter der einige Konferenzräume lagen. Dort stand eine Leiter, über die er den höher gelegenen Laubengang erreichte. Die nächste Wand, die er überwinden musste, war hoch. Finn rannte mit maximaler Geschwindigkeit und sprang seitlich mit dem rechten Fuß auf die niedrigere Außenmauer, stieß sich kraftvoll ab, riss die Arme hoch und drehte sich gleichzeitig Richtung Zielmauer. So bekam er das obere Ende der Mauer zu fassen und konnte sich hochziehen. Jetzt stand er auf einem Sonnendeck. Von seiner Stirn tropfte der Schweiß. Finn atmete ein paarmal tief durch und hielt Ausschau nach Ben. Der erreichte gerade über die Leiter den Laubengang. Finn ärgerte sich, dass er die Leiter nicht umgestoßen hatte, das hätte ihm einen gewissen Vorsprung verschafft.
Er sah sich um und entdeckte zwei Männer in Overalls, die durch eine Tür gerade das Sonnendeck betraten. Er ging lässig auf die beiden zu. »Geht’s hier aufs Dach?«, fragte er sie beiläufig. Und als diese nickten, quetschte er sich blitzschnell durch die zufallende Tür, verbarrikadierte sie mit herumliegenden Holzpaletten und verschwand im Inneren des Gebäudes. Er landete tatsächlich in einem Treppenhaus und lief nach oben.
Sie fuhren am Heiligengeistfeld vorbei, weiter über die Ludwig-Erhard-Straße Richtung Osten. Erst als der Wagen durch Hammerbrook fuhr, wunderte sich Santino etwas und fragte den Fahrer, wo er denn Mister Mighty treffen würde.
»Mister Mighty ist Engländer. Er liebt skurrile Treffpunkte.« Sie überquerten zwei Kanäle und bogen dann auf eine Schnellstraße ein. Nach drei Kilometern verließen sie die Schnellstraße, überquerten die Bille auf der Gelben Brücke und waren dann auf dem Billbrookdeich. Jetzt befanden sie sich im Billbrooker Industriegebiet, dessen Bebauung sich mit alter Backsteinarchitektur und quadratisch-praktischen Zweckbauten abwechselte. An einigen Stellen konnte man zwischen den Gebäuden einen Blick auf die Bille, Hamburgs unbekannten Fluss, werfen. Nach fünfhundert Metern bog das Auto links auf das ehemalige Werksgelände einer Maschinenfabrik ab und fuhr nun, vorbei an dem teilweise abgerissenen Hauptgebäude, zielsicher zu einer heruntergekommenen Halle. Hier hielt der BMW.
»Warten Sie einen Moment«, sagte der Fahrer beim Aussteigen.
Santino schaute ihm hinterher und sah ihn in der Halle verschwinden. Verunsichert ließ er sich wieder ins Polster fallen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam der Fahrer in Begleitung eines grimmig aussehenden Mannes mit Vollbart und Sonnenbrille zurück. Dieser zerrte ihn unsanft aus dem Auto, und gemeinsam führten die beiden ihn in die Halle, in der es nach altem Öl und abgestandenem Wasser roch. Santino sah alte, verrostete Rohrleitungen, die die Halle durchzogen. Aus undichten Stellen tropfte es in Pfützen, die mit einem Ölfilm überzogen waren. Jedes Mal, wenn ein Tropfen in eine Pfütze fiel, kam der Ölfilm in Bewegung und zeichnete wundersame Farbmuster auf die Wasseroberfläche. Santino wusste um die komplizierten Wechselwirkungen zwischen fallendem Tropfen und ruhendem Wasser. Ein faszinierender Vorgang.
»Bleiben Sie stehen«, sagte plötzlich einer seiner Begleiter und riss ihn jäh aus den Gedanken, die ihn für einen Moment seine missliche Lage hatten vergessen lassen. »Und verschränken Sie die Arme hinter dem Rücken.«
Santino tat wie ihm befohlen und spürte, wie die Handgelenke mit einem Kabelbinder zusammengebunden wurden.
»Wann kommt der Engländer?«, fragte der Fahrer den anderen Mann.
»Später. Du kannst fahren.«
Der Fahrer nickte.
Der Mann mit der Sonnenbrille schubste Santino ans Ende der Halle. »Dann suchen wir uns mal ein gemütliches Plätzchen.«
Santino blickte über seine Schulter und beobachtete, wie der Fahrer die Halle verließ. Diese Ausfahrt wird kein gutes Ende nehmen, dachte er.
Finn hatte Glück, die Tür, die auf das Dach führte, war nicht verschlossen. Oben angekommen verriet ihm ein Blick zurück, dass Ben gerade mit den beiden Männern in den Overalls sprach. Ihre Blicke trafen sich, und Finn konnte sehen, wie Ben mit Zeigefinger und Daumen eine Pistole formte und auf ihn zielte.
Finn zeigte Ben den Stinkefinger und lief weiter. Das erste Hindernis, eine Klimaanlage, überwand er seitlich im Scherensprung. Dann versperrte ihm ein quer über das Dach verlaufendes Backsteinhäuschen den Weg. Er nahm Anlauf, sprang mit dem rechten Fuß an die Wand, stieß sich ab und schwang gleichzeitig die Arme nach oben. So hatte er genügend Kraft, um den linken Fuß wie beim Laufen vor den rechten zu setzen, sich wiederum abzudrücken, mit den Händen die obere Wandkante zu ergreifen und sich mit Schwung auf das Dach zu ziehen. Das alles geschah in einer einzigen Bewegung und in wenigen Sekunden. Falls Ben noch hinter ihm her war, musste er diesen Jump erst mal schaffen.
Finn lief drei Schritte über das Dach, sprang zwei Meter auf die darunterliegende Fläche und rollte seitlich über die Schulter ab, um wieder auf den Füßen zu landen. Inzwischen war er auf dem Parkhaus des Hotels angekommen, das am Ende eingerüstet war. Finn kletterte außen am Gerüst herunter, überquerte die kleine Zulieferstraße und erreichte schließlich den Rosengarten von Planten un Blomen, dem alten Botanischen Garten. Er schaute sich um, aber von Ben war nichts mehr zu sehen.
Beunruhigt war er dennoch. Sollte er entführt werden? Erst jetzt bemerkte er, dass er seinen Rucksack bei McDonald’s hatte liegen lassen. »Scheiße!«, fluchte Finn. Er überlegte, was zu tun war. Er versuchte, mit seiner Apple Watch Kontakt zu Sammy, zwei weiteren Freunden und seiner Schwester aufzunehmen, aber es kam keine Verbindung zustande. Also ganz analog Kontakt herstellen. Über die Rentzelstraße war es nicht weit bis zum Abaton Bistro. Dort konnte er telefonieren.
Er machte sich auf den Weg. Nach zehn Minuten überquerte er die Grindelallee. Er ging an der Pappnase vorbei, einem Geschäft, das die Herzen von Artisten und Jongleuren höherschlagen ließ. Von Weitem konnte er schon die Aufsteller erkennen, auf dem das Bistro einige seiner französischen Spezialitäten anpries. Finn beschleunigte seine Schritte, doch bevor er das Bistro erreichen konnte, hielt ein schwarzer Mercedes mit getönten Scheiben neben ihm. Das hintere Seitenfenster glitt sanft nach unten, und eine gepflegte Hand mit schwarz lackierten Fingernägeln winkte ihn zu sich.
»Steig ein, Finn.«
Finn war irritiert, zögerte und rannte dann los. Weit kam er aber nicht. Ein blonder Hüne tauchte plötzlich wie aus dem Nichts vor ihm auf und packte ihn am Arm. »Nun mal langsam, Junge.« Er schaute Finn ernst an. »Wir wollen dir nur helfen.« Dann brachte er ihn zum Auto, öffnete die Wagentür und schob ihn auf den Rücksitz neben die Frau. Jetzt erst konnte Finn sich die Frau richtig ansehen. Er schätzte sie auf Mitte dreißig, die Haare so schwarz wie ihr Nagellack und zu einem Pferdeschwanz gebunden. Das war nicht Kiki.
»Schön, dass du eingestiegen bist«, sagte sie mit einem süffisanten Unterton in der Stimme und blickte ihn an. »Ich scann dich eben mal ab.«
Sie holte ein kleines Gerät aus ihrer Tasche, das Ähnlichkeiten mit einem Funkgerät hatte, schaltete es ein, und sofort war ein schnelles Ticken zu hören. Dann begann sie, Finn von unten nach oben abzuscannen. Beim Kragen seiner Jacke angekommen, verwandelte sich das Ticken in ein Heulen. Zufrieden stellte sie das Gerät aus. Mit der Hand tastete sie nun Finns Kragen ab, holte einen winzig kleinen Peilsender hervor und warf ihn aus dem Fenster. Dann wandte sie sich an den Fahrer. »Fahr los.«
»Wer bist du? Und was wollt ihr von mir?«, fragte Finn ängstlich.
»Abwarten.« Die Frau nahm ihr Handy und wählte eine Nummer. »Er wurde verfolgt. Wir mussten ihn einkassieren.« Sie schwieg eine Weile, nickte dann und gab Finn das Handy. »Da will dich jemand sprechen.«
Überrascht nahm er das Handy. »Ja?« Seine Augen wurden groß. »Okay, ich hör zu.« Nach zwei Minuten war das Gespräch beendet. Die Frau reichte Finn eine Trinkflasche, und wenig später war er eingeschlafen.
Ben hob keuchend den kleinen Peilsender auf und sah dem schwarzen Mercedes frustriert hinterher. Eine schmale Hand legte sich auf seine Schulter. »Das hast du versaut.«
Er drehte sich um und starrte in die funkelnden Augen seiner Partnerin. »Aber ich habe wenigstens seinen Laptop.« Er hielt stolz Finns Rucksack hoch. Als er Kikis abschätzigen Blick sah, ergänzte er: »Ich habe ihn mir gegriffen, bevor ich ihm hinterhergelaufen bin.«
Kiki nahm den Rucksack. »Du glaubst doch nicht im Ernst, dass auf dem Laptop irgendwas Verwertbares gespeichert ist. So blöd könntest nur du sein.« Sie drehte sich um und holte ein Handy aus ihrer Manteltasche. »Er ist uns vor der Nase weggeschnappt worden. In einem Mercedes GLESUV.« Kiki nannte das Kennzeichen, dann schaute sie betreten zu Boden. Offenbar wurde sie gerade am anderen Ende der Leitung zusammengefaltet. »Nein, ist uns vorher nicht aufgefallen. Ja, ich weiß, wie wichtig die Informationen sind«, sagte Kiki kleinlaut. »Den haben wir. Ben kümmert sich um ihn. Nein, wir vermasseln es nicht noch mal.« Sie beendete das Gespräch und blaffte Ben an: »Nun fahr nach Billbrook und kümmere dich um den Professor. Und du hast gehört –«
»Ja, ja, ich versaue es schon nicht.«
3
Der Trauerzug bewegte sich langsam über die schlammigen Wege des Friedhofs. Gleichförmig liefen die Menschen hinter dem Sarg her. Gebeugte Köpfe, hängende Schultern, die Last des Verlustes und des Unfassbaren wog schwer. Menschen in Schwarz bildeten das letzte Geleit. Alte Schul- und Studienfreunde, ehemalige Kollegen aus den Verlagen, LKA-Mitarbeiter, Schutzpolizisten, einige in Uniform. Neben dem Sarg die Lebensgefährtin, neue und alte Freunde. Und mit allen ging der Schmerz.
Der Trauerzug ließ die Friedhofskapelle hinter sich. Die teilweise prächtigen Gräber ehemaliger Hamburger Kaufleute, die den Wegesrand säumten, nahm kaum einer der Trauergäste wahr. Der wolkenverhangene Himmel und der einsetzende Regen drückten die ohnehin düstere Stimmung. Schirme wurden aufgespannt und ließen die Menschen zusammenrücken. Die Spitze des Zuges erreichte das vorbereitete Grab, und der Transportwagen machte halt.
Nachdem sich die Trauernden um das Grab versammelt hatten, stellte sich LKA-Profiler Heiner Zillinski, Freund und langjähriger Weggefährte des Verstorbenen, neben den Sarg. Er räusperte sich, schloss für einen Moment die Augen. Er atmete tief durch, bevor er die Augen wieder öffnete. »Der Verlust eines geliebten und nahestehenden Menschen bringt uns aus dem Gleichgewicht, lässt uns torkeln, taumeln, fallen. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber alle müssen einen ähnlichen Weg beschreiten, um ihr Gleichgewicht wiederherzustellen. Diesen Weg bezeichnet man als Trauer.« Zillinski hielt einen Moment inne und sagte dann mit brüchiger Stimme: »Also trauern wir.« Er trat zur Seite, und jetzt konnte man die Inschrift auf dem Grabstein lesen:
»Ängstigt euch nicht vor dem Tod, denn seine Bitterkeit liegt in der Furcht vor ihm.«SokratesDr. Elias Hopp1970–2019
Janne schreckte hoch und saß kerzengerade im Bett. Es war fünf Uhr morgens. Sie war schweißgebadet, und ihr Herz raste. Wieder dieser Traum. Und so realistisch. Was war nur los mit ihr? Was ging in ihr vor? Elias lebte. War wohlauf und quicklebendig. Sicher, der Anschlag vor drei Monaten hätte auch anders enden können. Hatte er aber nicht. Nachdem Elias’ Auto vor seinem Haus explodiert war, waren sie und Zille sofort vor die Haustür gestürmt und fanden einen völlig demolierten Wagen sowie einen verletzten Personenschützer vor. Nur Elias war nirgends zu sehen gewesen. Im ersten Moment hatten sie das Schlimmste befürchtet. Entweder lag er schwer verletzt oder tot irgendwo auf dem Grundstück, oder er war in dem schwarzen SUV, der nach der Explosion am Grundstück vorbeifuhr, entführt worden. Doch nichts davon traf zu. Nach fünf Minuten hatten Zille und sie Elias hinter einer Buchsbaumhecke gefunden. Er hatte einen Schock und ein paar Schürfwunden erlitten und konnte sich an nichts erinnern.
Janne stand auf. Sie wusste, dass sie nicht wieder einschlafen würde. Also ging sie unter die Dusche und machte anschließend zur Beruhigung ein paar Yoga-Übungen. Nach dreißig Minuten intensiver Meditation trank sie ein Glas warmes Wasser mit Zitrone und Ingwer. Dann bereitete sie sich einen Masala Chai und setzte sich mit dem dampfenden Becher an den kleinen Küchentisch.
Es war jetzt drei Monate her, dass sie bei Elias aus- und wieder in ihre Wohnung eingezogen war. Nach dem Vorfall vor Elias’ Haus war der Personenschutz von Miroslav Eschenbroschs Sicherheitsfirma ROCK verstärkt worden. Ihr Ex-Chef hatte ihnen bei beiden letzten Fällen geholfen. Der letzte Fall hatte sie viel Kraft gekostet und psychisch auch stark belastet. Glücklicherweise war Liv, ihre Freundin aus Norwegen, für vier Wochen zu Besuch gekommen und hatte sie mit ihrer fröhlichen Art wieder aufgebaut. Als Liv nach Norwegen zurückfuhr, hatte Janne sich gestärkt und ausgeruht gefühlt. Und der Zustand hatte angehalten – bis vor drei Wochen die Alpträume anfingen. Sollte sie die nicht bald in den Griff bekommen, würde sie Kontakt zu ihrem tibetanischen Lehrer Acharya Lama Sonam Nawang aufnehmen, der ihr schon in so mancher seelisch schwierigen Situationen geholfen hatte.
Janne trank ihren Tee aus und beschloss, die Zeit bis zum Treffen heute Abend im Dojo zu verbringen.
4
LKA-Profiler Heiner Zillinski, der von allen Freunden nur Zille genannt wurde, saß in seiner ehemaligen Stammkneipe »Eichenkrone« in Hamburg-Eimsbüttel. Hier hatte er gemeinsam mit seinem Freund Elias Hopp als Oberstufenschüler mindestens genauso viel Zeit verbracht wie in der nahe gelegenen Schule. Heute hieß die Kneipe »Marder« und hatte immer noch den urigen Charme von damals. Seit dem letzten großen Fall im Frühjahr war er wieder häufiger hier. Gemeinsam mit Elias Hopp, der seit ein paar Jahren als Privatermittler arbeitete, und dessen junger Kollegin Janne Bakken hatte er mit Unterstützung des BKA ein rechtsradikales Netzwerk zerschlagen. Den Anschlag auf zwei Hamburger Containerterminals und die damit verbundene gigantische Zerstörung hatten sie leider nicht verhindern können, aber immerhin war das Gelände rechtzeitig evakuiert worden, sodass nur wenige Menschen ihr Leben verloren hatten.
Die letzten Wogen des Falls hatten sich erst vor ein paar Wochen geglättet. Der Terminalbetrieb lief immer noch schleppend, und es war nicht abzusehen, wann die Stadt und die Terminalbetreiber wieder schwarze Zahlen schreiben würden. Die Schuld an dem Desaster wurde dem Verfassungsschutz zugeschrieben, schließlich hatte er weder das rechtsradikale Netzwerk, das für den Anschlag verantwortlich war, im Blick gehabt, noch waren ihm die Waffenkäufe aufgefallen. Bei dem letzten Punkt musste allerdings auch das BKA Versäumnisse eingestehen. Dem BKA und dem Hamburger LKA wurde aber zugutegehalten, dass sie Schlimmeres verhindert und das Netzwerk zerschlagen hatten.
Die Bedienung brachte Zille ein Bier. Er nahm einen Schluck und warf einen Blick auf die Speisekarte. Wenig später betrat Janne die Kneipe. Sie blieb an der Tür stehen und ließ ihren Blick über die Tische schweifen. Als sie Zille entdeckte, nahm sie ihre weinrote Ballonmütze ab, und ihre ebenso kurzen wie zerzausten dunklen Haare kamen zum Vorschein. Sie ging auf Zille zu und setzte sich zu ihm an den Tisch. »Nette Location.«
»Sieht fast noch so aus wie früher.«
»Ist das ein Gütekriterium?«, fragte Janne ironisch.
»Das Bier schmeckt.« Zille leerte sein Glas.
»Wo ist Elias?«
»Kommt später. Bringt Maja zum Flughafen. Sie muss wieder nach Wien.« Zille strich sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht. »Du siehst müde aus, Janne.«
»Hab schlecht geschlafen.«
»Hattest du wieder diesen Alptraum?« Zilles Stimme klang besorgt.
»Seit einer Woche fast jede Nacht. Der letzte Traum war besonders schrecklich. Alle sind im Trauerzug mitgelaufen.« Janne stockte. »Nur ich war nicht dabei.«
»Hast du dich denn in den vorherigen Träumen gesehen?«
Janne überlegte. »Ich weiß nicht, ob ich mich immer an alles erinnere, wenn ich aufwache. Aber diesmal war ich definitiv nicht dabei.«
»Und das empfindest du als furchtbar?«
»Ja, ich schäme mich dafür.«
»Du schämst dich dafür, dass du in einem Traum nicht auf der Beerdigung eines Freundes warst, der gar nicht tot ist?«
Janne zuckte mit den Achseln. »Warum träume ich diesen Alptraum so oft?«
»Ich vermute, dass du dir Vorwürfe machst, den Anschlag auf Elias nicht verhindert zu haben.«
»Und dabei bin ich doch extra in sein Haus eingezogen, um ihn zu beschützen.«
»Stimmt. Aber es gab ja auch noch die Personenschützer, die rund um die Uhr auf Elias achten sollten. Und zum Zeitpunkt des Anschlags war ich auch noch bei Elias.« Zille nahm Jannes Hand. »Du denkst, du hast versagt, empfindest große Schuld und malst dir den schlimmsten aller Fälle aus. Den Tod des zu Beschützenden. Und dieses Schuldgefühl blockiert dein Trauern. Folgerichtig hast du dich nicht im Trauerzug gesehen.«
Janne drückte Zilles Hand, und ein paar Tränen kullerten über ihre Wangen.
»Doch du hast weder für den Anschlag, noch hättest du für seine möglichen schlimmeren Folgen Schuld auf dich geladen. Und schon gar nicht eine alleinige, denn wir waren zu dritt, die zum Zeitpunkt des Anschlags in Elias’ Nähe waren, der übrigens auch seinen Anteil hatte. Er hat sich unvorsichtigerweise von uns entfernt.«
»Lässt sich Schuld denn überhaupt teilen?«, fragte Janne mit brüchiger Stimme.
»Aber sicher. Schuldverarbeitung funktioniert am besten im sozialen Kontext. Wir sollten also gemeinsam noch einmal über den Vorfall und über unser individuelles Verhalten reden.«
Janne lächelte. »Ja, das sollten wir. Und jetzt will ich auch ein Bier.«
»Am besten bestellst du gleich zwei«, tönte eine Stimme hinter ihr.
Janne drehte sich um. Elias war endlich da.
Sie stand auf, umarmte ihn freudestrahlend und ging Richtung Tresen.
»Das nenne ich mal eine tolle Begrüßung«, sagte Elias gut gelaunt. Dann klopfte er Zille auf die Schulter und setzte sich. »Du hast mich so noch nie begrüßt.«
»Ich musste dich auch noch nie beerdigen.«
»Hat sie wieder …?«
Zille nickte. »Gibt es bei dir was Neues?«
»Du meinst, in Bezug auf den Tod meines Stiefvaters?« Elias räusperte sich. »Solange Maja, von der ich dich übrigens grüßen soll, in Hamburg war, habe ich mich nicht weiter darum gekümmert, außer mir ein paar weitere Hintergrundinformationen über die damalige Situation in Äthiopien anzulesen.«
»Und?«
»Ich muss mit dem BND reden.«
»Gemäß dem Motto: ›Keep your friends close, but your enemies closer.‹«
Elias blickte Zille fragend an.
»Aus ›Der Pate‹. Teil zwei.«
»Ich habe herausbekommen, dass es neben dem damaligen Agenten Dachhuhn und meinem Vater noch jemand Drittes im Umfeld des Anschlags von Mek’ele gegeben hat. Er hatte den Namen Dirk Kaffa, bestimmt ein Deckname.«
»Weil er ständig Kaffee getrunken hat«, bemerkte Zille.
»Kaffee?« Janne kam mit einem Tablett und drei Bieren zurück an den Tisch. »Ich dachte, ihr wolltet Bier.«
»Hast alles richtig gemacht. Wenn uns die Aufträge ausgehen, könntest du hier arbeiten.« Elias hob das Glas und prostete den beiden zu.
»Davor kann ich dich erst einmal bewahren, Janne.« Zille stellte sein Bierglas mit Schwung auf den Tisch. »Ich habe einen neuen Job für euch.«
5
»In Bergedorf war ich bisher noch nie.« Janne sah Elias schelmisch an. »Gibt es dort auch Berge, so wie in Harburg?«, fragte sie.
»Nein, dafür haben sie ein Schloss«, antwortete Elias. »Mit Schlossgraben und Schlossgarten.«
»Wow. Wohnt die Familie des gefährdeten jungen Mannes im Schloss?«
Elias lachte. »Es ist jetzt ein Museum. Früher war es ein Verwaltungsgebäude.«
»Schade, ich liebe Schlösser. Ich wollte als Kind immer Prinzessin werden.«
»Was hat dich daran gehindert?«
»Meine Großmutter hat mir erzählt, dass sich Prinzessinnen nicht immer mit Jungs prügeln können.« Janne drückte auf die Hupe und zeigte einem Autofahrer den Stinkefinger.
»An der Kreuzung musst du links abbiegen.«
»Stattdessen hat sie mir geraten, zum Militär zu gehen.«
»Eine weise Frau.«
»Wie konnte Zille Finn Tiberius eigentlich vor der Entführung retten?«
»Finns Großvater hat vor einiger Zeit um Personenschutz für seinen Enkel gebeten. Die Eltern sind mit Zille befreundet, und Finn ist sein Patenkind.«
Bevor Janne weitere Fragen stellen konnte, waren sie an ihrem Ziel angelangt. Kaum hatten Elias und Janne das Grundstück betreten, kam ein mittelgroßer Hund auf die beiden zugelaufen. Elias blieb stehen, und Janne bemerkte seine Unsicherheit.
»Das ist ein Labrador Retriever, die sind auch zu Fremden freundlich.« Janne kniete sich hin, der Hund kam auf sie zu und beschnupperte sie. »Sie sind gute Rettungs- und Spürhunde, aber miserable Wachhunde.«
»Kennst du dich aus mit Hunden?«, fragte Elias.
»Bei den Jegertroppen hatten wir Huskys. Und ich durfte einen Monat lang mit der dänischen SIRIUS-Schlittenpatrouille trainieren.« Janne streichelte den Hund im Nacken.
»Luna!«, schallte es über das Grundstück, und der Hund machte auf der Stelle kehrt. Janne und Elias folgten ihm und sahen, wie Luna auf eine blonde Frau Mitte vierzig zulief, die im Eingang einer zweistöckigen Dreißiger-Jahre-Altbauvilla stand. Auffällig war ein moderner Anbau an der Ostseite des Hauses.
»Hallo«, begrüßte die Frau sie und reichte Janne und Elias die Hand. »Johanna Tiberius. Sie sind sicherlich Herr Hopp, und Sie sind?«
»Janne Bakken.«
»Meine Partnerin«, ergänzte Elias.
Durch den Windfang betraten sie eine große Diele, von der aus eine Treppe ins obere Stockwerk führte. Im nächsten Moment rutschte ein ungefähr fünfzehnjähriger Teenager gekonnt das Treppengeländer herunter.
»Lucy, du sollst doch das Geländer nicht herunterrutschen.«
Aber Lucy hatte nur ein Grinsen für ihre Mutter übrig. »Kommt, wir gehen ins Wohnzimmer, da gibt es leckere Kekse.«
Johanna Tiberius blickte zu Janne und Elias und zuckte mit den Achseln. »Folgen Sie mir.«
Das Wohnzimmer imponierte nicht nur durch seine Größe, sondern auch wegen der Einrichtung. Die bodentiefen Fenster, die fast die ganze Breite der zur Terrasse gerichteten Seite des Raumes einnahmen, ließen das Licht den Raum fluten. An den Wänden hingen großflächige Schwarz-Weiß-Fotografien des Fotografen Willy Ronis, die Motive der Provence zeigten. Ein puristisches weißes Sideboard mit schwarzen Metallfüßen strahlte so viel Understatement aus, dass man es fast übersehen konnte. Ganz das Gegenteil war der in einer Ecke stehende ausladende Ohrensessel mit seinem Blümchenmuster, offenbar ein altes Erbstück, auf dem ein älterer Herr saß. Mitten im Raum präsentierte sich eine graue Sitzlandschaft mit einem raffinierten Modulsystem. Es gab keine klassischen Couchecken, sondern Ecken mit spitzen und stumpfen Winkeln. Lucy lümmelte sich auf der Récamiere, die ins Sofasystem integriert war.
»Meine Tochter Lucy haben Sie ja schon kennengelernt. Im Sessel sitzt mein Vater, Professor Weichbolt.« Johanna Tiberius ging auf ihn zu. »Kapé, setz dich doch zu uns, sonst verstehst du wieder nichts.«
»Willst du damit sagen, dass ich schwerhörig bin?«, erwiderte dieser grätzig, ließ sich aber von seiner Tochter aus dem Sessel helfen.
»Nein, aber für ein Gespräch ist es doch besser, wenn man näher beisammensitzt.«
»Dann sag das doch gleich«, grantelte der Alte weiter. Gemeinsam kamen sie zur Couch, und Professor Weichbolt hob seine Hand zum Gruß.
In diesem Moment kam ein etwa fünfundfünfzigjähriger Mann mit angegrauten, längeren Haaren ins Zimmer. Er balancierte ein Tablett mit einer Wasserkaraffe und Gläsern, das er auf einen Beistelltisch platzierte. Dann wandte er sich seinen Besuchern zu. »Schön, dass Sie kommen konnten. Ich bin Arne Tiberius, Finns Vater. Nehmen Sie doch Platz.«
Janne und Elias setzten sich in die beiden Cocktailsessel, die neben dem Beistelltisch standen.
Elias holte die Unterlagen heraus, die Zille ihm gegeben hatte, dann räusperte er sich. »Herr Zillinski hat Sie ja bereits informiert, dass Finn in ein Safehouse des LKA gebracht worden ist.«
»Weil er offensichtlich entführt werden sollte«, sagte Arne Tiberius und füllte die Gläser mit Wasser.
»Wie lange muss Finn denn dort bleiben?«, fragte Lucy betroffen.
»Das wissen wir nicht«, erwiderte Elias Hopp.
»Und wer macht jetzt meine Mathe-Hausaufgaben?«
»Warum sollte denn jemand Finn entführen?« Johanna Tiberius war den Tränen nahe.
»Liegt doch auf der Hand«, mischte sich jetzt der Großvater ins Gespräch ein. »Finn ist ein genialer Wissenschaftler, trotz seiner jungen Jahre. Er hat eine Möglichkeit gefunden, künstliche Photosynthese zur Energiegewinnung zu nutzen, und zwar im großen Stil.«
»Jetzt übertreibst du aber, Kapé.«
»Na, du als Pathologin musst es ja wissen.«
»Psychologin.« Johanna Tiberius schaute zu Janne und Elias und bemerkte leise: »Manchmal ist er ein bisschen vergesslich.«
»Er hat für seine wissenschaftliche Arbeit auf dieser Competition für junge Naturwissenschaftler in Glasgow einen Preis erhalten, der immerhin mit zehntausend Euro dotiert war«, warf Arne Tiberius ein, »und er ist zum ›Zukunftskongress für wissenschaftliche und technologische Innovationen‹ hier in Hamburg eigeladen worden.«
»Eben. Die halbe Wissenschaftswelt kennt ihn mittlerweile, und immer mehr Leute und Organisationen gieren nach einem Zugriff auf seine Forschungsergebnisse.« Kapé schnäuzte sich die Nase. »Deshalb habe ich Zille gebeten, ein Auge auf Finn zu werfen.«
»Du warst das?« Johanna Tiberius schaute ihren Vater erstaunt an. »Und warum hast du uns nichts davon erzählt?«
»War eine reine Vorsichtsmaßnahme. Und ich wollte euch nicht beunruhigen«, entgegnete er. »Im Übrigen war das ja wohl eine kluge Entscheidung, sonst wäre der Entführungsversuch erst gar nicht bemerkt worden.«
»Das ist richtig.« Elias übergab dem Ehepaar Tiberius den Bericht der Personenschützer. »Hier können Sie das, was wir bisher wissen, nachlesen.«
»Es ist aber nicht viel«, sagte Janne. »Die Personenschützer haben nämlich die Gefahr erst bemerkt, als Finn offensichtlich vor jemandem davongerannt ist.«
»Haben sie denn wenigstens gesehen, wer Finn verfolgt hat?« Arne Tiberius war aufgestanden und lief unruhig im Raum hin und her.
»Nein, leider nicht, und deshalb benötigen wir von Ihnen einige Informationen über Finn.«
»Wir werden versuchen herauszufinden, wer hinter Finn her ist.« Elias lächelte Lucy aufmunternd zu. »Und wenn wir das wissen, dann kann Finn auch wieder deine Hausaufgaben machen.«
2017 – April
»Du musst den Schmerz ertragen und Qualen erleiden können, einen eisernen Willen haben und nie zurückschauen, sondern immer weitergehen. Nur dann wirst du in dieser unwirklichen Welt überleben.« Diese Worte seines Vaters hatte er nie vergessen. Und gerade beim Marathonlaufen hörte er sie. Gleichgültig ob die Sonne schien, es regnete oder schneite. Er trotzte allen Widrigkeiten und spürte seine Kraft, Ausdauer und Widerstandsfähigkeit, aber auch seine Leidensfähigkeit in jeder Sekunde. Und das war bis heute so. Er lief immer weiter, es gab kein Zurück. Er suchte diese Herausforderung dreimal im Jahr, und wenn er zu Hause ankam, spürte er trotz aller Erschöpfung eine unbändige Energie.
Philipp Vahrenheide, ein steinreicher Hamburger Unternehmer, war ein bekannter und angesehener Mäzen der naturwissenschaftlichen Forschung. Er unterstützte mit seiner Stiftung Projekte mit besonderer Innovationskraft, insbesondere in den Bereichen Zukunftstechnologien. Gleichzeitig lag ihm aber auch die Förderung junger, talentierter Naturwissenschaftler am Herzen. Zudem liebte er sein klassizistisches Anwesen in Hamburg-Blankenese.
Besonders stolz war er auf seinen Rückzugs- und Schutzraum, den er unter der Grünfläche vor dem Haus hatte anlegen lassen. Von dem Kellerraum unter dem Haupteingang hatte er direkten Zugang zur ersten Ebene. Der Hauptgang führte in eine Rotunde mit einem gewölbeartigen Kuppeldach. Von dort zweigten drei weitere Gänge jeweils in eine andere Himmelsrichtung ab. Zwei dieser Gänge lagen hinter beweglichen Wänden, die als solche nicht zu erkennen waren. Sie dienten als Fluchtwege, die am westlichen und östlichen Ende des Grundstücks endeten. Der dritte Gang führte in einen größeren, rechteckigen Raum, von dem es in eine Bar und drei luxuriös eingerichtete Zimmer ging. Eine blaue Tür verbarg ein Treppenhaus, über das man in eine zweite, tiefer gelegene Ebene gelangte, die als Schutzraum vor größeren Katastrophen geplant war. Dort waren jetzt schon Vorräte für zwei Monate eingelagert. Die Räume selbst mussten allerdings noch entsprechend ausgebaut werden. Mit dieser Anlage hatte er einen Rückzugs-, aber auch einen Schutzraum für sich geschaffen, der seine Paranoia vor einer Katastrophe ein wenig abschwächte.
Inzwischen war die Rotunde zu Vahrenheides Lieblingsaufenthaltsort geworden. Hierhin zog er sich nach seinen Marathonläufen, aber auch zum Nachdenken und Meditieren zurück. Hier konnte er selbst entscheiden, ob er mit der Außenwelt kommunizieren wollte. Jetzt saß er vor dem Kamin, der der Rotunde Wärme spendete, goss sich einen Martell Chanteloup, seinen Lieblingscognac ein, hielt das Glas gegen das Licht und blickte versonnen auf den karamelligen, bernsteinfarbenen Braunton seines Getränks. Er lächelte still in sich hinein, dann nahm er einen Schluck und genoss die intensive Fruchtigkeit.
Bis jetzt war sein Leben gut verlaufen. Seine Unternehmen warfen seit Jahren hohe Gewinne ab und expandierten unentwegt. Doch seit einiger Zeit trieb ihn eine diffuse Angst um. Wie lange noch konnte er seinen Wohlstand halten und genießen? Nicht, dass er sich um seine Unternehmen sorgte. Es waren die apokalyptischen Ängste vor »dem Ereignis«, das alles verändern könnte. Weshalb er sich selbst die Frage gestellt hatte, wie eine unterirdische Anlage beschaffen sein müsste, um auch vor »dem Ereignis« geschützt zu sein. Nach und nach hatte daraufhin die Idee für ein neues Projekt in seinem Kopf Gestalt angenommen, das er »chosen few« getauft hatte.
Dieses Projekt wollte er, wie es dessen Name schon sagte, mit nur wenigen Auserwählten auf den Weg bringen. Keine Politiker, keine Kleriker, keine Militärs. Das waren für ihn Intriganten, Egozentriker, Narzissten oder Dummköpfe. Manche auch von allem ein bisschen. Und irgendeiner tanzte immer aus der Reihe. Das Risiko wollte und konnte er nicht eingehen. Er wollte nur seinesgleichen um sich haben. Menschen mit sehr viel Geld, die ebenso wie er ihr Überleben um jeden Preis sichern wollten. Diese Welt hatte nämlich ein Problem. Und zwar ein großes. Nur für wenige würde es einen Ausweg geben. Doch zuvor mussten noch viele offene Fragen beantwortet werden. Vahrenheide stand auf, warf ein Holzscheit ins Feuer und goss sich einen weiteren Cognac ein. Morgen Vormittag würde er einige Anrufe tätigen, um den Startschuss für das Projekt »chosen few« zu geben.
Drei Monate später saßen drei Männer und zwei Frauen um den großen Tisch in Vahrenheides unterirdischer Rotunde und warteten auf einen weiteren Gast. Sie hatten den führenden Zukunftsforscher und Wissenschaftsjournalisten Ferdinand Peakock zu einem intensiven Meinungsaustausch eingeladen.
6
Kriminalhauptkommissar Pöppelmann saß seit sieben Uhr dreißig in seinem Büro und hatte es sich an seinem Schreibtisch bequem gemacht. Vor ihm stand eine Tasse dampfenden Kaffees aus seiner neuen Kaffeemaschine, daneben ein Teller mit einem Franzbrötchen. Er hatte Freya, die vor einem Monat bei ihm eingezogen war, versprochen, weniger Süßkram zu essen. Und so hatte er sich nur ein Franzbrötchen zum Bürofrühstück gekauft. Eine immerhin fünfzigprozentige Reduzierung des Zuckerkonsums. Darauf kann ich stolz sein, dachte Pöppelmann und biss genüsslich in das Franzbrötchen.
Weniger stolz sein konnte er auf die Unordnung in seinem Büro. Das Regal an der gegenüberliegenden Wand quoll über vor Akten, sodass sich inzwischen weitere vor dem Regal stapelten. Pöppelmann wusste, dass er dieses Chaos beseitigen musste, wenn er Ende Dezember in den Ruhestand gehen wollte. Sonst würde Schepanski, sein Chef, ihn nicht vor dem 31. Dezember, seinem offiziell letzten Arbeitstag, gehen lassen, trotz seiner zwölf Tage Urlaub und der vielen Überstunden.
Pöppelmann trank missmutig einen Schluck Kaffee. Er musste sich etwas einfallen lassen. Doch bevor er Pläne schmieden konnte, klingelte sein Telefon. Fünf Minuten später war er mit Anna Radke, die sich nach der Entführung durch den rechtsradikalen Ex-Soldaten Winfried Brause seit vier Wochen wieder im Dienst befand und jetzt endgültig in seine Abteilung versetzt worden war, in seinem alten Käfer unterwegs zum Billbrookdeich. Dort war man bei Abrissarbeiten auf dem Gelände einer Maschinenfabrik in einer alten Lagerhalle auf eine Leiche gestoßen. Die Fahrt zum Tatort war abenteuerlich. Der alte Käfer war nach dem Crash vor ein paar Monaten im Containerhafen nur notdürftig repariert worden. Einen Austausch der Scheibenwischer hatte Pöppelmann nicht vornehmen lassen. Und so kam es, dass sie dem Septemberregen nicht viel entgegensetzen konnten.
»Siehst du eigentlich was?«, fragte Anna ängstlich.
»Ein wenig.«
»Und das reicht?«
»Werden wir sehen. Aber ich bin ganz optimistisch.«
»Sehr beruhigend.« Kurze Zeit später konnte Anna sich entspannen. Der Regen ließ nach, und als sie im Billbrooker Industriegebiet ankamen, hatten sich die Regenwolken ganz verzogen.
Die Schutzpolizisten waren schon vor Ort und hatten den Tatort großzügig abgesperrt. Pöppelmann schaute sich nach deren Chef um. »Warum habt ihr so weiträumig abgesperrt? Das Gelände um die Halle herum ist doch von der Abrissbirne und den Schaufelbaggern bereits völlig verwüstet worden. Wer soll da Spuren vernichten?«
»Wie man es auch macht, ist es verkehrt«, bekam Pöppelmann zur Antwort. »Die Spurensicherung haben wir schon informiert.«
»Immerhin.« Pöppelmann zog eine Augenbraue hoch und zeigte zur Halle, wo Anna Radke gerade versuchte, ungefähr zehn Leute aus dem Eingang zu bugsieren. »Aber leider habt ihr den Zugang zur Halle, in der die Leiche liegt, nicht abgesperrt, das war ziemlich dämlich.« Pöppelmann schüttelte den Kopf und ging zu Anna. »Sind jetzt alle draußen?«
»Ja, nur der Typ, der die Leiche gefunden hat, wartet noch hinter der Tür.« Anna schluckte. »Die Leiche sieht übel aus.«
»Ich habe die Rechtsmedizinerin –«
»Freya Jensen?«
»– schon informiert«, sagte Pöppelmann nickend. »Und sag der Schutzpolizei, dass sie die Personalien der Leute, die hier gearbeitet haben, aufnehmen soll.« Dann betrat Pöppelmann die Halle und ging auf einen bleich aussehenden Mann zu.
»Können wir uns nicht draußen unterhalten?«, fragte der Mann mit schwacher Stimme.
»Später«, antwortete Pöppelmann, »erst müssen Sie mir zeigen, wie Sie die Leiche gefunden haben.«
»Muss das sein? Ich kann es Ihnen auch beschreiben.«
»Wie heißen Sie?«
»Hans Claußen.«
Pöppelmann reichte Claußen Überzieher für die Schuhe und zog selbst welche an. »Sie gehen vor, Herr Claußen.«
»Wenn es sein muss.«
»Machen Sie bitte alles ganz genauso, als Sie die Halle betreten und die Leiche gefunden haben. Nur fassen Sie nichts an.«
Hans Claußen stöhnte auf. »Als ich die Halle betrat, habe ich mich umgeschaut. Mir ist sofort der Stuhl ganz hinten aufgefallen, auf dem jemand saß.«
»Und was haben Sie gemacht?«
»Gerufen.«
»Bitte.«
»Bitte was?«
»Rufen Sie.«
»Hallo, ist da wer?«
»Das haben Sie gerufen?«
»Ja.«
»Aber Sie haben doch gesehen, dass dort jemand sitzt.«
»Ja, sicher. Aber er hat sich nicht bewegt.«
»Sie haben sofort erkannt, dass es ein Mann war?«
»Nein, nur angenommen.«
»Haben Sie eine Antwort erhalten?«
Hans Claußen blickte den Kommissar irritiert an. »Nein, dann bin ich langsam auf den Stuhl zugegangen.«
Pöppelmann machte eine Handbewegung, und Claußen setzte sich langsam in Bewegung. Er ging exakt unter den alten Rohrleitungen her, die an der Decke verliefen und aus denen vereinzelte Tropfen fielen, sodass sich kleinere Pfützen auf dem Betonboden gebildet hatten. Diesen wich er aus und blieb nach etwa einer Minute vor dem Stuhl mit der Leiche stehen. Inzwischen war Anna nachgekommen und stand hinter den beiden Männern.
»Haben Sie etwas angefasst?«, fragte Pöppelmann.
»Ich habe ihn leicht an der rechten Schulter berührt«, sagte Claußen verlegen. »Ich wollte wissen, ob er noch lebt.«
»Und?«
»Ich habe dann die Polizei angerufen und allen Arbeitern auf dem Gelände Bescheid gegeben.«
»Das heißt, Sie haben die Halle zunächst verlassen und sind dann wieder mit Ihren Leuten zurückgekommen.«
Claußen nickte.
»Und dann haben sich alle die Leiche angeguckt, stimmt’s?«
Claußen nickte erneut. »Aber als die Polizei kam, sind wir alle zurück zum Ausgang.«
»Und wieso waren Sie eben alle wieder in der Halle?«
»Wir mussten ja auf Sie warten, und dann hat es auch noch angefangen zu regnen.«
»Jetzt gehen Sie zu meinen Kollegen vor der Halle«, sagte Pöppelmann genervt. »Die nehmen Ihre Personalien auf. Und dann fahren Sie nach Hause. Gearbeitet wird hier heute nicht mehr.«
Anna schaute Hans Claußen hinterher. »Er und seine Kollegen haben bestimmt einen Schock fürs Leben.«
Pöppelmann schüttelte ratlos den Kopf. »Selbst schuld. Keiner hat sie gezwungen, die Leiche aus der Nähe zu betrachten.«
»Und für die Spurensicherung ist es auch nicht optimal«, bemerkte Anna.
Pöppelmann umkreiste den Stuhl. »Fällt dir etwas auf?«
»Er hat keine Schuhe an, und die Fußnägel an den großen Zehen fehlen.«
»Sind ihm bestimmt nicht ausgefallen«, sagte Pöppelmann sarkastisch. Er zeigte auf die Finger. »An der rechten Hand sind ihm drei gebrochen worden und an der linken der Daumen.«
»Er wurde eindeutig gefoltert.«
»Am Hinterkopf habe ich bei meinem Rundgang eine heftige Wunde gesehen, die ihm wahrscheinlich mit einem harten Gegenstand zugefügt wurde. Die Frage ist, woran er gestorben ist.«
»Und wann.«
Pöppelmann kniete sich vor die Leiche. »Ist wohl schon ein paar Tage her. An seinen Füßen haben ein paar Ratten geknabbert, und das Blut an seinem Hinterkopf ist bereits getrocknet.« Er betrachtete den Toten genauer. »Ich denke, zur Todeszeit wird Freya uns Genaueres sagen können. Vermutlich werden die kleinen Tierchen auf der Leiche ihr dabei helfen.« Dann streifte er sich Handschuhe über und fingerte einen Kugelschreiber aus seiner Manteltasche. Mit dem schob er die Sakkotaschen des Toten ein wenig auseinander. »Was haben wir denn hier?«, brabbelte er vor sich hin.
»Hast du was gefunden?«, fragte Anna.
»Da ist eine Streichholzschachtel.« Er griff mit der linken Hand in die Tasche des Sakkos, holte sie vorsichtig heraus und gab sie Anna.
»›Hotel am Wasserturm‹«, las sie vor.
Pöppelmann richtete sich ächzend wieder auf. »In dem Hotel schauen wir später vorbei. Vielleicht war unser Toter dort ja Gast.«
Anna steckte die Streichholzschachtel in einen Asservatenbeutel. »Weißt du, wo das Hotel ist?«, fragte sie.
»Im Sternschanzenpark.« Pöppelmann wischte sich den Schmutz von seiner Hose.
Im selben Moment betrat Freya Jensen gemeinsam mit den Kriminaltechnikern der Spurensicherung die Halle. »Am besten geht ihr beiden Hübschen uns mal aus dem Weg, bevor ihr auch die letzten Spuren vernichtet.«
»Sehe ich auch so«, sagte Carmen Martinez, die seit einem halben Jahr bei der Spurensicherung arbeitete und zurzeit ihren kranken Chef vertrat. »Ich verschaffe mir mal einen Überblick, und dann besprechen wir das weitere Vorgehen.«
»Wir räumen gerne den Platz für euch«, sagte Anna. »Der Anblick der Leiche ist nicht wirklich schön.«
»Zudem«, Pöppelmann machte ein ernstes Gesicht, »je eher ihr mit eurer Arbeit beginnt, umso schneller werden wir hoffentlich die Ergebnisse erhalten.«
»Sieht dir ähnlich, dass du gleich Druck aufbauen musst, Herr Kriminalhauptkommissar.« Freya tätschelte ihm die Wange. »Aber dann wirst du mich heute Nacht nicht zu sehen bekommen.«
»Für die Verbrechensaufklärung nehme ich auch große Opfer in Kauf, meine Liebe. Außerdem«, fügte Pöppelmann ironisch hinzu, »muss ich meiner jungen Kollegin die effektivste Kommunikationsstrategie mit euren Abteilungen beibringen.«
Carmen Martinez war bei ihrem Rundgang beim Toten angekommen und betrachtete ihn eine Weile. »Ich kenne ihn.«
Pöppelmann, der sich gerade entfernen wollte, drehte sich um. »Du kennst den Toten?«, fragte er überrascht.
»Nicht persönlich. Wenn ich mich nicht irre, ist das Professor Santino. War letztes Jahr Unternehmer des Jahres in Spanien. Gab große Zeitungsberichte über ihn.«
Zwei Stunden später standen Pöppelmann und Anna an der Rezeption des Hotels, das sich im ehemals größten Wasserturm Europas befand. Pöppelmann winkte einen Mitarbeiter herbei und wies sich aus. »Kennen Sie einen Professor Santino?«
Der Mitarbeiter nickte. »Ja. Er ist seit einigen Tagen Gast bei uns.«
»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«
»Vor drei Tagen. Da ist er von einem Fahrer abgeholt worden.«
»Und seitdem ist er Ihnen nicht mehr über den Weg gelaufen?«, fragte Anna überrascht.
»Ich stehe nicht immer an der Rezeption, und wenn ich mit Gästen spreche, bekomme ich auch nicht alles mit, was in der Lobby sonst noch geschieht.«
»Aber dass er am Dienstag abgeholt wurde, schon?«
»Ja, und zwar deshalb, weil Dienstagvormittag ein Brief für Professor Santino abgegeben wurde.«
»Und?«, fragte Pöppelmann ungeduldig.
»Ein Page hat ihm den Brief auf sein Zimmer gebracht, eine halbe Stunde später hat er dann das Hotel mit dem Fahrer, der auf ihn an der gegenüberliegenden Säule wartete, verlassen. Und nein«, der Mitarbeiter klang jetzt genervt, »ich habe den Fahrer nicht gekannt.«
»Ich auch nicht.« Eine junge Frau kam mit einem Sakko in der Hand aus einem der hinteren Räume an den Rezeptionstresen. »Aber bevor der Professor mit dem Fahrer verschwand, hat er dieses Sakko hier zum Reinigen abgegeben.« Sie legte ein Handy auf den Tresen. »Das hat er im Sakko vergessen.«
»Interessant.« Pöppelmann nahm das Handy in die Hand und gab es Anna. »Kannst du es knacken?«
»Denke schon, aber nicht sofort.« Anna wandte sich an die Mitarbeiterin. »Waren Sie nicht überrascht, dass Herr Santino das Sakko nicht abgeholt oder nach dem Handy gefragt hat?«
»Doch. Aber wir informieren normalerweise die Polizei erst, wenn ein Gast mehr als drei Tage verschwunden ist.« Sie stockte und wirkte verlegen. »Sie wissen ja, in Hamburg kann man leicht –«
»Ich weiß. Ich schicke später noch einen Kollegen vorbei, der Ihre Aussagen aufnimmt und dem Sie dann bitte Professor Santinos Anmeldung aushändigen«, sagte Pöppelmann.
»Ist dem Professor etwas passiert?«
»Jetzt würden wir gern sein Zimmer sehen.«
Als Anna Radke und Pöppelmann das Zimmer betraten, sahen sie sich an.
»Hier wird nicht mehr viel zu holen sein«, seufzte Pöppelmann. »Alles aufgeräumt und sauber gemacht.«
»In einem Vier-Sterne-Hotel kann man das auch erwarten«, erwiderte Anna.
»Wir werden uns dennoch umsehen und dann die Kollegen von der Kriminaltechnik vorbeischicken.«
»Müsste es nicht umgekehrt geschehen?«, fragte Anna. Doch als sie Pöppelmanns Gesichtsausdruck sah, machte sie sich auf den Weg ins Bad. Pöppelmann ging Richtung Schreibtisch. Auch dort war alles akkurat geordnet. Papiere, Broschüren und Bücher lagen alle parallel zu den seitlichen Schreibtischkannten. Nur in der Mitte lag ein Brief, der nicht ins Muster passte. Pöppelmann zog sich Handschuhe an und studierte den Text. Es handelte sich um die Einladung, wahrscheinlich aus dem Brief, von dem der Rezeptionist gesprochen hatte. Er legte sie zurück und fotografierte den Schreibtisch als Ganzes.
»Im Bad ist nichts Auffälliges zu sehen.« Anna gesellte sich zu Pöppelmann. »Das ist eher ein Fall für die Spurensicherung.«
»Ist mir ein Rätsel, wie man so arbeiten kann«, sagte Pöppelmann und zeigte auf den Schreibtisch. »So eine Ordnung ist doch nicht normal. Da geht doch jede Kreativität flöten.«
Anna lachte. »Hat aber den Vorteil, dass man seine Sachen leichter wiederfinden kann.«
»Vielleicht.« Pöppelmann verscheuchte eine Mücke auf seiner Glatze. »Wir blättern mal die Stapel durch. Du auf der rechten, ich auf der linken Seite.«
»Wonach suchen wir?«
Pöppelmann zuckte mit den Achseln.
Nach zehn Minuten waren Anna und Pöppelmann mit der Sichtung der Unterlagen fertig.
»Bei mir lagen entweder Fachartikel oder die Zusagen von verschiedenen Wissenschaftlern für das Halten von Vorträgen auf einem Zukunftskongress«, berichtete Anna.
»War bei mir ähnlich«, sagte Pöppelmann. »Und ich habe eine Liste mit den Namen der Referenten für diesen Zukunftskongress gefunden, der übrigens in ein paar Tagen hier in Hamburg stattfinden soll.«
»Und welche Rolle sollte Santino bei dem Kongress spielen?«
»Er sollte ihn leiten.« Pöppelmann dachte nach. »Wir fotografieren die Liste der Teilnehmer ab, den Rest muss die Spurensicherung auswerten.«
7
Dr. Kiriaki Blumenfeld, genannt Kiki, und Ben Taylor waren sich in Glasgow auf der Competition für junge Naturwissenschaftler zum ersten Mal begegnet. Was Ben vorher getrieben hatte, wusste sie nicht. Sie hatten erst spät festgestellt, dass sie beide vom Veranstalter beauftragt worden waren, sich jeweils näher mit den Gewinnern zu beschäftigen. Da endeten ihre Gemeinsamkeiten aber auch schon, denn sie konnten sich von Anfang an nicht leiden.
Deshalb war es, zumindest aus Kikis Sicht, umso ärgerlicher, dass sie in Hamburg erneut zusammenarbeiten sollten. Ihr Auftrag lautete diesmal, Finn Tiberius unauffällig, schnell und ohne Gewalt zu entführen. Kikis Idee, Finn zu verführen und dann zu betäuben, stieß bei Ben nicht auf Zustimmung. Er hielt das für zu risikoreich. Was, wenn sie überhaupt nicht Finns Typ wäre? Kiki fand diesen Einwand an den Haaren herbeigezogen. Sie war sich sicher, dass Ben ihr nicht das Vergnügen gönnte. Stattdessen schlug Ben eine klassische Entführung vor. Pistole in den Rücken, rein ins Auto, betäuben und dann los. Das würde immer funktionieren. Er habe genug Erfahrung mit solchen Aktionen.
Und so beobachteten sie zwei Wochen lang Finn Tiberius’ Tagesablauf und einigten sich schließlich darauf, dass Ben ihm bei einem seiner regelmäßigen Frühstücke bei McDonald’s im Dammtor-Bahnhof auflauern und ihn von dort mit sanfter Gewalt auf den Dag-Hammarskjöld-Platz lotsen sollte, wo Kiki in einem Auto auf die beiden warten würde. Das war nun krachend gescheitert. Finn war zwar entführt worden, aber nicht von ihnen. Ihnen blieben nur sein wertloser Laptop und eine Beule in der Motorhaube ihres Wagens. Und deshalb hatten sie jetzt zwei neue Aufträge an der Backe. Sie sollten Finn Tiberius finden und sich auch noch um einen weiteren Wissenschaftler kümmern.
Kiki war auf dem Weg zu Ben. Sie hatte sich für heute Morgen um neun Uhr mit ihm verabredet, um ihr weiteres Vorgehen zu besprechen. Sie betrat die Lobby seines Hotels, das in unmittelbarer Nähe zur Reeperbahn lag. Typisch, dachte Kiki, so kann Ben abends leicht seinen zweifelhaften Vergnügungen nachgehen. Als sie sein Zimmer im zweiten Stock betrat, traf sie fast der Schlag. Überall lagen seine Klamotten und Kartons mit Pizzaresten herum, die zusammen mit einigen angebrochenen Gin- und Whiskeyflaschen sowie Bens Ausdünstungen einen widerlich penetranten Geruch im Zimmer verströmten.
»Hier bleibe ich keinen Moment länger«, begrüßte Kiki ihren Partner wütend. »Zieh dir etwas Frisches an. Wir treffen uns dann in der Lobby und suchen uns einen anderen Ort für unsere Unterhaltung.«
Auf der Busfahrt über die Reeperbahn zählte Ben alle Etablissements auf, die er seit ihrem Aufenthalt in Hamburg besucht hatte. Kiki hörte ihm nicht zu, sie fand seine Vorliebe für Sadomasopraktiken abstoßend, wenngleich sich seine Lust, anderen Schmerz zuzufügen, bei den Verhören als nützlich erwiesen hatte. Sie stiegen an der U-Bahn-Haltestelle St. Pauli aus und betraten bei der Millerntorwache die Wallanlagen.
»Willst du jetzt mit mir spazieren gehen?«, fragte Ben genervt.
»So wie du stinkst, hält man es mit dir keine Minute in einem geschlossenen Raum aus. Außerdem«, fuhr Kiki süffisant fort, »kannst du auch mal etwas anderes besichtigen als nur Puffs und üble Spelunken.«
»Fick dich.«
»Dieses kleine Haus«, Kiki zeigte auf die Millerntorwache, »ist ein altes Stadttor. Nur durch dieses konnte man Hamburg früher betreten.«
»Willst du mich jetzt mit History-Scheiß zutexten?«
Kiki schaute Ben abschätzig an. »Solche Typen wie dich hätte man früher sicher nicht in die Stadt gelassen.«
»Früher war eben nicht alles besser«, nuschelte Ben.
Sie gingen eine Weile schweigend durch die Wallanlagen und passierten die Rückseite des Museums für Hamburgische Geschichte.