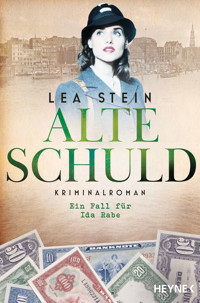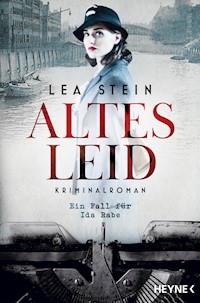
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Ida-Rabe-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Tote im Wald, ein brutaler Täter – und eine neue Polizistin auf St. Pauli
Hamburg, 1947. Nach nur wenigen Wochen Ausbildung tritt Ida Rabe ihre erste Stelle als Polizistin an. Mitten auf St. Pauli, in der Davidwache, soll sie die neu gegründete Weibliche Polizei verstärken. Und schon bald bekommt sie viel zu tun: Im nachkriegszerbombten Hamburg trifft man das Elend an jeder Ecke – in Form von Bettlern, Prostituierten und stehlenden Kindern. Als eine Frau im Umland tot aufgefunden wird, grausam verstümmelt und mit aufgeschnittenem Unterleib, scheint sich niemand besonders für den Fall zu interessieren. Doch Ida, deren eigene dunkle Vergangenheit mit der Unterwelt Hamburgs verschlungen ist, macht sich auf die Suche nach dem Täter. Bald ist klar: In Hamburg geht ein Monster um. Und um es zu fassen, muss Ida ihm gefährlich nahe kommen ...
Der erste Fall für Ida Rabe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Ida Rabes erster Tag in der Davidwache mitten auf der Reeperbahn könnte gar nicht chaotischer beginnen. Erst wird sie vom Polizeimeister in die Schranken gewiesen, der überhaupt nicht begeistert ist von den Frauen, die neuerdings die Weibliche Polizei bilden und in seiner Wache ein eigenes Büro im Keller bezogen haben. Dann gerät sie mit ihrer Kollegin Heide Brasch aneinander. Und schließlich muss sie feststellen, dass sie ihren Aufgaben – Protokolle führen, Abschriften tätigen – gar nicht nachkommen kann, da das Papier in diesen Nachkriegsjahren knapp ist. Zeit, mit der Situation zu hadern, bleibt Ida allerdings nicht, denn ihr neues Dasein als Schutzpolizistin nimmt plötzlich Fahrt auf. Sie stößt auf eine grausame Serie an Vergewaltigungen, für die sich die männlichen Polizisten nicht sonderlich zu interessieren scheinen, dann wird eine Frauenleiche übel zugerichtet im Hamburger Umland gefunden. Gegen den Willen ihres Vorgesetzten und mit Unterstützung des Gerichtsmediziners Ares Konstantinos begibt sich Ida auf die Suche nach dem Täter. Dabei folgt sie einer Spur, die in die zwielichtigen Ecken des nachkriegsgebeutelten Hamburg und in ein düsteres Kapitel der deutschen Geschichte führt – und direkt zu Idas eigener Vergangenheit.
Lea Stein erzählt lebendig und atmosphärisch vom Deutschland unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, von der Entstehung der Weiblichen Polizei – und von einem Kriminalfall, der so packend ist, dass man beim Lesen den Atem anhält.
Die Autorin
Lea Stein ist das Pseudonym der Autorin und Journalistin Kerstin Sgonina, die bereits mehrere Romane veröffentlichte. Als sie mit 18 nach Hamburg zog, verliebte sie sich sofort in die Stadt. Nach dem Abitur schlug sie sich auf der Reeperbahn als Türsteherin und Barfrau durch. Heute lebt sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Brandenburg. »Altes Leid« ist ihr erster Kriminalroman und der Auftakt der Reihe um Polizistin Ida Rabe.
LEA STEIN
ALTES LEID
Ein Fall für Ida Rabe
Kriminalroman
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Gefördert durch ein Stipendium von
Originalausgabe 01/2023
Copyright © 2023 by Lea Stein
Copyright © 2023 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: zero-media.net unter Verwendung von Richard Jenkins Photography; Vintage Germany/Wilhelm Dreesen; FinePic®, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-28271-4V004
www.heyne.de
Vierlande, am Stadtrand von Hamburg
Frühjahr 1947
Ich klettere den Hügel hinauf – oder was sich in einer platten Gegend wie dieser Hügel schimpft – und bleib stehen. Eine blasse, einsame Landschaft dehnt sich vor mir aus. Lauter Felder, die weiß vom Frost sind, darüber ein grauer Himmel. Bergab liegt ein reetgedecktes Gehöft, kleine Ansammlungen von abgesägten Bäumen dahinter. Kein Lebewesen ist zu sehen, nicht einmal eine Krähe.
Bloß eine halbe Stunde Zugfahrt vom geschäftigen Hauptbahnhof entfernt gibt es nur Leere. Zwischen dem Schutt und der Asche in der Stadt herrscht wenigstens Leben. Das Einzige, was auf dem Land zu hören ist, ist mein Atem. Zischen, wenn ich die Luft einsauge, und ein leises Schnauben, wenn ich ausatme. Wolken bilden sich vor meinem Gesicht.
Am liebsten würde ich mich hinlegen, gleich hier aufs Feld. Ich will die Augen schließen und vergessen, meinen Namen, meine Vergangenheit, meine Trauer, die sich so tief in mein Fleisch gefressen hat, dass sie schon Teil meines Körpers geworden ist. Die Erinnerung sitzt überall in mir. In meiner Haut, meinem Haar, meinen Wimpern, die vor langer Zeit, in einem anderen Leben, einmal schön genannt worden sind.
Aber ich gehe weiter, die Arme um meinen Körper geschlungen. Bei jeder Bewegung kann ich die Knochen fühlen, die durch den Mantel in meine Fingerkuppen bohren. Vornübergebeugt stemme ich mich der Kälte entgegen und denke an früher, obwohl ich genau das nicht will. Denke an den Sommer, der so warm und feucht war, als wenn man in einen Sumpf steigt. An die Freude, die ich empfunden habe in unserem Versteck.
Ich beiße die Zähne so fest zusammen, dass ein lautes Knirschen zu hören ist, hole Luft und schlittere den schmalen Pfad hinunter, reiße mir den Mantelstoff an den Dornbüschen auf. Ich verfluche das Land, auf dem ich gehe. Im Osten ist es im Winter schön, auch im Frühjahr, sogar wenn die Kälte nicht weggehen will. Staubzuckerweiße Felder gibt’s da und einen eisblauen Himmel. Selbst wenn man nichts zu essen hat, kann man sich sattsehen. Aber hier! Es hat geschneit in diesem Winter, die ganze Stadt ist unter Weiß versunken. Doch das Weiß wurde schnell grau, dann braun, keiner hat mehr was zwischen die Zähne gekriegt, es gab keinen Strom, dunkel war es, unendlich dunkel und eiskalt. Und die Leute heulten und schrien und hauten sich gegenseitig die Köppe ein. Und immer noch geht der verdammte Frost nicht weg. In der Stadt schlingern die Menschen die glatten Straßen runter, die dürren Arme ausgestreckt, an denen das bisschen, was sie an Stoff auftreiben konnten, herumschlackert. Mit Gesichtern, die nur noch aus Augen, eingefallenen Wangen und rissigen Lippen bestehen. Wie tot sehen sie aus.
Was soll man da anderes denken als: selbst schuld.
Als ich näher komme, rieche ich den Stall. Ich bleibe stehen und atme mit zusammengekniffenen Augen tief ein. Eine Sehnsucht rührt sich in mir, und mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Seit Monaten tue ich nichts anderes, als mich hier auf dem Land rund um Hamburg herumzutreiben. Von einem Hof zum nächsten schleppe ich mich. So häufig habe ich den Geruch von Kuh und Milch gerochen. Heute aber …
Ich vertreibe die Erinnerung und balle wütend die Hände zu Fäusten. Den ganzen Tag bin ich schon in diesem verflixten Landstrich unterwegs und habe rein gar nichts in den Taschen. Niemand will was rausrücken für jemanden wie mich, dürr und armselig, wie ich aussehe. Nicht mal eine Handvoll käferzerfressene Kartoffeln oder ein halbes Dutzend schimmelige Rüben. Seit dem Krieg weiß ich: Die Leute sind böse, sie sind gierig, und keiner erinnert sich an das, was er nicht erinnern will, schon gar nicht, dass er vielleicht mal ein Mensch gewesen ist. Und dann kommt eine wie ich, die nix zum Tauschen hat. Die nur betteln kann. Abschaum.
Ich brauche ja nur ein bisschen, eine Kleinigkeit, die mich wärmen kann. Schnaps. Einen Löffel guter Brühe. Sogar den fadenscheinigen Schleim, den die Leute Milchsuppe nennen, würde ich mit Freuden nehmen. Und deshalb habe ich alle Warnungen in den Wind geschlagen, was hätte ich auch sonst tun sollen?
»Aber der Wüstling!«, hatten sie im Bunker gesagt.
Wer soll das schon sein?, hätte ich am liebsten entgegnet. Der Krieg hat aus uns allen Wüstlinge gemacht.
Und wenn es diesen Kerl, von dem in Hamburg alle reden, wirklich gibt, treibt er sich eher im Wald herum als in einem Bauernhaus, so viel ist sicher. Da und auf den frostharten Feldwegen bekommt man die Frauen schneller zu fassen, da nutzt alles Schreien nichts.
Ich habe keine Angst. Um Angst zu spüren, muss man was zu verlieren haben. Ich habe nur Madlena, und sie ist in Sicherheit. Ansonsten gibt’s für mich schon lange Zeit nichts Wertvolles mehr.
Eine Biegung noch, an den abgeholzten Birken und einem struppigen Weißdornstrauch vorbei, dann werde ich sehen, ob der Bauer was rausrückt. So lange hat man sie verachtet, doch jetzt sind die Landwirte die neuen Könige, vor denen die Leute in der Stadt auf die Knie fallen. Könige mit einer Mistgabel statt einem Zepter in der Hand. Mistkerle, einer wie der andere, doch was bleibt mir anderes übrig, als um Almosen zu betteln?
»He!«, höre ich eine Stimme, die mich ruckartig den Kopf hochreißen lässt. Ich habe nicht aufgepasst, dabei bin ich sonst doch so wachsam. Mein Herz pocht schnell gegen meine Rippen. Hinter mir Schritte, das Knirschen von Schuhen auf dem gefrorenen Boden. Langsam drehe ich mich um. Ich will was sagen, aber das einzige Geräusch, das ich von mir geben kann, ist ein raues Krächzen.
1Davidwache, Hamburg-Sankt Pauli
Donnerstag, 1. Mai 1947, 7:04 Uhr
Ida Rabe musste achtgeben, nicht den Anschluss an Polizeimeister Hildesund zu verlieren, der in irrwitzigem Tempo vor ihr hereilte. Der lang gezogene Flur der Davidwache war in einem schlammigen Braun gestrichen; einer Farbe, schoss es Ida durch den Kopf, von der sich weder Dreck noch Blut sichtbar abheben würde. Die abgetretenen Bohlen rochen nach Essig, in der Luft hing der Rauch von orientalischen Zigaretten. Nordland-Tabak, tippte Ida. So tief sie konnte, sog sie den herben Geruch ein. Zwar mochte sie amerikanische Zigaretten lieber, aber man war ja nicht wählerisch heutzutage.
»Fräulein Rabe?« Polizeimeister Hildesund hatte innegehalten und wandte sich ihr mit hochgezogenen Augenbrauen zu. »Gibt es ein Problem?«
»Nein«, sagte sie und stellte erst jetzt fest, dass sie stehen geblieben war. Aus dem Wachraum drang eine aufgeregte Frauenstimme, die Idas Interesse geweckt hatte.
»… seit zehn Tagen nicht mehr … Herr Wachtmeister, das ist doch beängstigend. Ich war gestern schon hier, und …«
Zwischendurch ein beruhigendes Brummen. »’türlich, ’türlich, wir kümmern uns drum, junge Frau.«
»Fräulein Rabe?«, wiederholte Polizeimeister Hildesund nun mit einem Lächeln, das so unecht wirkte, als sei es aufgemalt. »Brauchen Sie schon ein Päuschen?«
»Ganz und gar nicht«, sagte sie und schüttelte das Gefühl der Beklemmung ab, das der verzweifelte Tonfall der Frau in ihr ausgelöst hatte. »Ich kann es nur immer noch nicht fassen, dass ich es geschafft habe.«
»Ja, jetzt ist es überstanden«, erwiderte er in gönnerhaftem Ton. »Und wir, die uns in den letzten Jahren nichts haben zuschulden kommen lassen, haben es geschafft.«
Verwundert hob sie die Brauen. Dann lachte sie. Ihr perlendes, dunkles Lachen ließ Polizeimeister Hildesund verwirrt die Lippen kräuseln. Mit seinem schütteren Haar und den tiefen Falten, die sein Gesicht durchzogen, wirkte er älter als sechzig, doch das konnte täuschen. Der Krieg hatte alle frühzeitig altern lassen. Er war ein hutzeliger Mann, der nichts lieber zu tun schien, als rasch von A nach B zu gelangen.
»Nein, ich meine, ich kann es nicht fassen, hier zu sein. Als Polizistin.«
»Ah.« Er kniff die Augen zusammen. Sein Blick, mit dem er sie nun musterte, war plötzlich hart. »Sie sollten sich nicht zu sehr daran gewöhnen. Die Zeiten könnten sich schneller ändern, als Sie vermuten.«
»Und dann?«, sagte Ida lauter als beabsichtigt. »Was passiert Ihrer Meinung nach, wenn sich die Zeiten ändern, Polizeimeister Hildesund?«
»Wenn die Briten weg sind, ist es auch mit den Damen in Uniform vorbei, das kann ich Ihnen versprechen. Frauen bei der Polizei …«, er sah aus, als habe er etwas Fauliges im Mund. »Das mag funktionieren, solange die Männer in Kriegsgefangenschaft sind. Aber wenn sie erst wieder zurück sind, wenn wieder Ruhe und Ordnung herrscht und alles beim Alten ist, dann wird es in allerlei Haushalten ein gewaltiges Donnerwetter geben.« Er setzte eine selbstzufriedene Miene auf. »Doch bilden Sie sich ruhig für eine Weile ein, hier auf Verbrecherjagd gehen zu können. Bald ziehen wir andere Saiten auf. Dann heißt es: zurück in Ihren Wirkungskreis, Beste, ins traute Heim zu Kindern und Kochtöpfen. Und lassen Sie uns hoffen, dass Ihnen Ihre Anmut bis dahin nicht restlos verloren gegangen ist.«
Die Augenbrauen hochgezogen, starrte Ida mit ihren 1,82 Metern auf ihn hinab. Am liebsten hätte sie ihn dermaßen zusammengestaucht, dass er nicht mehr in der Lage war, seinen Namen zu buchstabieren. Doch erstens war heute ihr erster Arbeitstag, und zweitens war sie drei Minuten zu spät auf der Wache angekommen. Ihre neue Kollegin wartete bestimmt schon auf sie. In eineinhalb Stunden würde außerdem Miss Watson anrauschen, wie sie ihr bei ihrem letzten Gespräch mitgeteilt hatte. Wollte Ida dann tatsächlich noch hier stehen und mit Polizeimeister Hildesund streiten? Ihre britische Vorgesetzte, so viel war sicher, wäre darüber not amused.
»Zwei weibliche Polizisten auf Dutzende männliche macht noch keine feindliche Übernahme«, sagte Ida daher nur spitz. »Falls Sie fürchten, wir Damen würden hier das Ruder übernehmen und Ihre traute Skatrunde stören, kann ich Sie beruhigen. Wir bleiben für uns, Sie für sich.«
Finster starrte Hildesund sie an. Schließlich nickte er knapp, die Lippen fest aufeinandergepresst, und machte eine mehr oder weniger einladende Geste. »Bitte. Den Flur hinab und dann die Treppe runter. Ihre Kollegin und Sie sitzen unten.«
»Im Keller?« Wieder klang ihre Stimme verärgerter, als sie beabsichtigt hatte.
Die gespielte Freundlichkeit troff nahezu aus Hildesunds Gesicht. »Ganz recht. Ein hübscher Ort, an dem Sie niemand hört. Da können Sie in Ruhe den lieben langen Tag sabbeln. Ich hoffe nur, Sie stören sich nicht an den Verwahrzellen, die sind nämlich auch da unten.«
Zornig sah Ida ihn an, dann ließ sie ihn ohne ein weiteres Wort stehen.
Während sie auf die Kellertreppe zuging, versuchte sie einen Blick in jedes offene Büro zu werfen. Ihr erster Eindruck: Es gab nur wenige Beamte auf sehr viel Raum. Ihr zweiter: Augenscheinlich hatte hier niemand je eine Frau wie sie gesehen, die trotz ihrer Größe nicht die Schultern hoch- und den Kopf einzog. Anders konnte sie sich nicht erklären, wieso sie wie ein regenbogenbuntes Zirkuspferd beglotzt wurde. Aber sie war vorgewarnt worden. Die meisten Polizisten waren wie Hildesund. Sie hassten die neuen Kolleginnen vom ersten Augenblick an und waren der Ansicht, jede Frau mit einer Stelle bei der Polizei nahm einem Mann eine weg. Und dann gab es noch diejenigen, die nichts gegen weibliche Polizistinnen hatten, solange diese sich anfassen ließen. »Immer hübsch mit dem Rücken zur Wand«, hatte eine Ausbilderin Ida geraten. »Am Hinterteil haben Sie leider keine Augen.«
Aus diesem Grund hatte sich Ida heute Morgen extraviel Mühe gegeben, so neutral wie möglich auszusehen. Sie hatte sich das dunkle Haar aus der Stirn gebürstet und zu einem Zopf gebunden, dicke, für die frühlingshaften Temperaturen viel zu warme Wollstrümpfe angezogen und den Rock so weit wie möglich nach unten gezuppelt und einen Schal über ihre blaue Uniformjacke geschlungen. Selbstverständlich fehlte auch die Anstecknadel mit der Aufschrift »Polizei« nicht. Besonders stolz war sie auf ihre faltenfreie Bluse. Das war wichtig, fand Ida. Ein zerknautschtes Oberteil konnte ganz falsche Assoziationen bei ihren Kollegen auslösen, Männer kamen ja gern auf die verrücktesten Ideen, Polizisten keinesfalls ausgenommen.
»Plätteisen?«, hatte ihre Vermieterin am Abend zuvor entgeistert gefragt. »Woher soll ich denn so was kriegen?«
Eine ähnliche Gegenfrage stellten auch alle anderen Hausbewohner, bei denen Ida klingelte. Drei Tage zuvor hatte sie nach langer Suche ein halbes Zimmer zur Miete gefunden, in der Margaretenstraße in Eimsbüttel. Das Haus war klein, zum Glück aber kaum von Bomben getroffen worden, und die Miete günstig.
Ein Stockwerk über ihrem, bei einem Herrn, der sich als Heinrich Schmidt vorstellte, wurde sie endlich fündig.
»Oh, da kann ich Ihnen helfen, schönes Fräulein.« Seine Augen in dem massigen, krank wirkenden Gesicht hatten schwarz wie Murmeln geglänzt. »Schieben Sie das gute Stück mal rüber.«
Zögerlich hatte sie die Bluse in seine Hand gedrückt, mit der er in der Wohnung verschwand. Von ihrem Platz an der Tür aus konnte sie in seinen winzigen Flur sehen, der auf der einen Seite mit vergilbten Papierstapeln gefüllt war und auf der anderen mit Regalen, auf denen sicher ein Dutzend Püppchen saßen. Beim Anblick der toten Knopfaugen, die in die Leere starrten, lief Ida ein Schauer über den Rücken. Was für ein seltsamer Kerl.
Wasserplätschern war zu hören. Dann ein lang gezogenes »Aaaaah«. Was tat er nur mit ihrer Bluse? Beklommen trat Ida von einem Fuß auf den anderen. Als ihr Nachbar endlich zurückkehrte, hielt er zu ihrer Erleichterung die Bluse in den Händen, die zwar ziemlich nass, aber in der Tat glatt und faltenfrei war. »Bitte sehr, reizendes Kind. Ich hoffe, Sie haben noch Zeit, sie über den Ofen zu hängen.«
»Wie haben Sie das gemacht?«
Vor Stolz hatte er gestrahlt und mit einer fließenden Handbewegung von den Zehenspitzen bis zu seinem Kopf gedeutet. »Mich draufgelegt. Gestatten, Heinrich Schmidt, lebendes Plätteisen.«
Die Stiegen, die aus dem Erdgeschoss der Davidwache nach unten führten, waren schmal und nur schummrig beleuchtet. Durch ihr hohes Tempo kam sie zweimal ins Rutschen. Sie musste dafür sorgen, dass eine bessere Beleuchtung installiert wurde. Und ein Treppengeländer, andernfalls war es zu gefährlich.
Am Fuß der Treppe sah sich Ida um. Ein langer Flur lag vor ihr, an beiden Seiten reihten sich die schweren Metalltüren der Verwahrungszellen aneinander, allesamt verschlossen. In einem hatte Polizeimeister Hildesund recht gehabt: Es war verdammt ruhig hier unten. Nicht mal aus den Zellen drangen Geräusche. Das immerhin hatte gewisse Vorteile. Und noch etwas erschien Ida vorteilhaft an der Kellerlage: Während Tag und Nacht Betrunkene, Diebe und Ruhestörer von der Reeperbahn und aus der ganzen Stadt im Polizeigriff durch den Wachraum geführt wurden, war Idas Klientel ein ganz anderes: Die Weibliche Polizei war für Frauen, Kinder und weibliche Jugendliche zuständig. Und diese wollte Ida gern so weit wie nur irgend möglich von den Schlägern und Saufbolden fernhalten.
Ein Kellerbüro war also vielleicht doch nicht so schlecht, dachte sie, während sie den lang gezogenen, schmalen Gang entlangging. Und wenn es ihr gelänge, den widerlichen muffigen Geruch, die feuchte Kälte und die vielen Spinnweben an der niedrigen Decke loszuwerden, ließ es sich hier sogar aushalten.
Am Ende des Flurs, der mit jedem Schritt dunkler geworden war, blieb sie vor einer weiteren Tür stehen. Sie war nur angelehnt, und aus einem Spalt fiel ein schmaler Lichtstrahl.
Ida klopfte an und trat, als eine leise Stimme »Herein« rief, ein.
Eine nackte Glühbirne baumelte von der Decke und spendete dämmriges Licht. Neben der Tür stand ein monströser Schrank, an der Wand links davon ein wackliger Schreibtisch mit einer Schreibmaschine, davor ein abgenutzter Holzstuhl. Darüber konnte man knapp unterhalb der Decke hinter einem schmalen vergitterten Fenster hin und wieder einen Damenschuh oder ein Männerhosenbein vorbeihasten sehen. Ein weiterer Tisch befand sich mitten im Raum, daran saß, mit dem Rücken zur Wand, eine junge Frau mit hängenden Schultern, die mit fragendem Blick den Kopf hob. In dem niedrigen, leeren Raum wirkte Idas Kollegin wie ein verlorenes Kind. Verstärkt wurde der Eindruck noch durch die weit aufgerissenen hellblauen Augen, mit denen sie zu Ida aufsah, und dem schüchternen Lächeln. Ihr blondes Haar glänzte wie mit hundert Strichen gebürstet.
»Hallo«, sagte Ida. »Ida Rabe.«
Die junge Frau sprang auf und warf dabei beinahe ihren Stuhl um. »Oh, hoppla.« Sie grinste verlegen. »Guten Tag. Ich bin Heide Brasch. Schön, Sie kennenzulernen.«
In Idas Kopf begann es zu rattern. Brasch … Der Name kam ihr bekannt vor. Hatte ihre neue Kollegin nicht zu der anderen Ausbildungsgruppe gehört, die im Nachbartrakt der Altonaer Kaserne untergebracht gewesen war, in der auch Ida die vergangenen Wochen verbracht hatte? Viel war Ida von der jungen Frau nicht in Erinnerung geblieben. Dass sie etwa im selben Alter war wie Ida, Mitte zwanzig. Und dass man ihr nicht trauen konnte. Zumindest hatte man sich das hinter vorgehaltener Hand in der Kaserne zugewispert, in der Männer und Frauen zu Polizisten ausgebildet wurden. Für Ida und alle anderen eine vollkommen neue Erfahrung: zusammen mit Herren im Klassenzimmer zu sitzen und zu pauken.
Eine junge Kollegin hatte schon in der ersten Woche ihre Sachen packen müssen, weil sie mit einem der Herren geflirtet hatte. Keine große Sache eigentlich. Doch jemand hatte der Aufseherin davon berichtet. Und dieser Jemand, so wurde gemunkelt, war Heide Brasch gewesen.
»Sind Sie von den Kollegen gebührend empfangen worden?« Brasch behielt ihr schüchtern wirkendes Lächeln bei, was nicht recht zu ihrem gestelzten Ton passen wollte. »Mit Frauen wird bei der Polizei ja nicht gerade höflich umgegangen. Das weiß ich, weil …«, sie senkte den Blick, »… na ja, ich bin quasi in der Truppe groß geworden.«
Nun erinnerte sich Ida, was in der Kaserne noch über Heide Brasch geredet worden war: dass ihr Vater, Oberkommissar Brasch, 1933 aus dem Dienst entfernt und nach Kriegsende von den Briten mit offenen Armen empfangen worden war. Die Militärregierung wollte eine Polizei nach dem Vorbild im eigenen Land schaffen. Eine große Auswahl bot sich den Besatzern nicht, als es darum ging, innerhalb der Polizei Männer zu finden, die nicht im Nationalsozialismus Karriere gemacht hatten. Die Briten mussten bei null anfangen und standen, so hatte es Ida gehört, letztendlich vor der Entscheidung, erfahrene Beamte mit brauner Vergangenheit einzustellen oder Unbescholtene, die das Handwerk von der Pike auf lernen mussten.
Wie es sich in dieser Hinsicht wohl mit Polizeimeister Hildesund verhielt?, schoss es Ida durch den Kopf. Sie musterte ihre neue Kollegin prüfend. »Ihr Vater ist also eine Art Held.«
Braschs Lächeln verrutschte etwas, dann hob sie abwehrend die Hand. »Das kann ich nicht beurteilen. Aber schließen Sie von ihm bitte nicht auf mich.«
Was sie damit wohl meinte?
»Ist das mein Schreibtisch?«, fragte Ida, um das Thema zu wechseln. Sie zeigte auf die Holzplatte links von sich, die auf immerhin drei krummen Beinen stand. Die hintere Ecke war so an die Wand gelehnt, dass die Konstruktion hoffentlich stabil genug war, um nicht beim ersten Windhauch zusammenzubrechen. Wobei es einen Windhauch in einem Raum, der nur über ein winziges Fenster verfügte, wahrscheinlich nicht gab.
Heide Brasch nickte. Sie saß immer noch etwas verloren an ihrem Platz und ließ die Schultern hängen.
Ida schälte sich aus ihrer Uniformjacke, sah sich vergeblich nach einer Garderobe um und legte das Kleidungsstück schließlich über ihre Stuhllehne. Wie der Tisch sah auch der Stuhl aus: als breche er beim bloßen Ansehen auseinander, doch er knurrte nur verärgert darüber, dass jemand mit einer derart stattlichen Größe wie Ida auf ihm Platz nahm.
»Fräulein Brasch?« Um ihre Kollegin anzusehen, musste Ida ihre Beine wieder unter der Tischplatte hervorschälen und sich um 90 Grad drehen. »Hat uns Polizeimeister Hildesund bereits Arbeit zugeteilt, mit der wir schon mal anfangen können, bis Miss Watson eintrifft?«
»Nun«, sagte Brasch und blickte Ida aus ihren großen Augen unsicher an. »Neben Streifengängen, vor allem über den Schwarzen Markt, und Dienst am Tresen im Wachraum gibt es noch dieses Buch, wie mir der Polizeimeister erklärte«, sie deutete auf einen sicher zwanzig Zentimeter dicken Leineneinband, der auf ihrem Schreibtisch lag und zwischen dem vergilbtes Papier hervorquoll. »Es gibt zwei davon, eines ist immer oben in Gebrauch. Wenn ich mich nicht täusche, sollen wir die neusten Meldungen übertragen. Mit der Schreibmaschine.«
»Aha«, sagte Ida, holte sich das Buch, das um die fünf Kilogramm schwer sein musste, und legte es behutsam auf dem Tisch ab, der zwar ins Schwanken geriet, dem Gewicht glücklicherweise aber standhielt. Während sie in dem Wälzer blätterte, senkte sich Stille über den Raum.
»Was steht darin?«, erkundigte sich nach einer Weile ihre Kollegin.
Verwundert darüber, dass sich Heide Brasch bislang offenbar nicht die Mühe gemacht hatte, selbst einen Blick in den einzigen interessanten Gegenstand im ganzen Raum zu werfen, wandte sich Ida zu ihr um. Sie hatte schon eine spitze Bemerkung auf der Zunge, doch als sie die putzige Himmelfahrtsnase und die treuen, hellblauen Augen sah, schluckte sie den Kommentar hinunter.
»Anzeigen der vergangenen Wochen«, erklärte Ida und drehte sich wieder zur Wand. »Jedenfalls ein Teil davon. Hier gibt es immer wieder größere Lücken.«
Es dauerte ein wenig, bis sie vier verschiedene Handschriften ausgemacht und einigermaßen entziffert hatte. Das Papier war eng beschrieben. Eine der Schriftführerinnen war mit Sicherheit weiblich, Ida erkannte es an den sich kringelnden i-Tüpfelchen. Wie Brasch erwähnt hatte, gehörte es also allem Anschein nach auch zu den Aufgaben der Weiblichen Schutzpolizei, am Tresen zu stehen und die Anzeigen aufzunehmen.
Die meisten behandelten kleinere Straftaten wie Diebstähle. Schuhe, Besteck und Zigaretten, all jenes eben, das sich auf dem Schwarzen Markt gegen Nahrung und Lebensmittelkarten eintauschen ließ. Der nächstgelegene befand sich unweit der Davidwache in der Talstraße, keine drei Minuten zu Fuß entfernt. Aber auch auf ihrem Weg zur Arbeit kam Ida an einem vorbei, der gerade erst nahe dem Neuen Pferdemarkt entstanden war.
Auch ein paar Raubdelikte waren in dem Buch vermerkt. Ida fiel auf, dass es vor allem Frauen waren, die in den letzten Monaten angegriffen worden waren. Und dass, wenn sie die Notizen richtig verstand, kein einziger der Fälle aufgeklärt worden war.
Eng beschriebene Zeilen mit Daten, Namen, kurze Notizen zu den Überfällen. Plötzlich stutzte Ida. »Merkwürdig …«
Sie drehte sich zu Heide Brasch um, die die ganze Zeit stumm an ihrem Tisch gesessen und vor sich hin gestarrt hatte, und wuchtete das Buch auf den Tisch ihrer Kollegin. Verwirrt blickte Heide von Idas Gesicht zu dem Buch und wieder zurück. »Wie bitte?«
»Hier.« Ida deutete auf seltsame Krakel, die neben mehreren Anzeigen zu finden waren. »Sehen Sie? Dieses Gekritzel? Das taucht bei mehreren verschwundenen Gegenständen auf. Hier: Hanne Kischkat, silberner Anhänger, Kleeblatt. Eintrag vom achten April. Daneben in winziger Schrift irgendwas wie Tränen. Oder thronen? Zwei Zeilen weiter unten, dieselbe Schrift, derselbe Wachtmeister also. Als gestohlen gemeldetes Armkettchen, vergoldet. Daneben wieder kaum zu lesen: Anzeigende wirkte …«
»Sorbisch?«, bemühte sich Brasch die kleinen, nach links gelehnten Buchstaben zu entziffern.
»Wie sollte man sorbisch wirken können?«
Brasch legte den Kopf schief. »Dahinter steht noch ein Wort. Wenn wir das entziffern, erklärt sich vielleicht …« Sie zuckte mit den Schultern und schloss wieder den Mund.
»Ich verstehe nicht, wie wir dieses Geschmiere abtippen sollen, wenn wir nicht mal die Schrift lesen können«, brummelte Ida. Erneut blätterte sie weiter, dann ganz nach vorne. »Ha!« Sie tippte auf die Kürzel der Wachhabenden, die auf der Eingangsseite mit vollen Namen genannt waren. »Immerhin wissen wir, wie der Mann mit der Krakelschrift heißt: Johann Meyerlich.«
»Polizeimeisteranwärter Meyerlich kenne ich!«, rief Brasch erfreut. »Er war eben hier. Ein sehr netter junger Mann.«
Netter hoffentlich, dachte Ida, als Hildesund. Sie sah sich im Raum um und trat schließlich an den großen Schrank, der an der Wand rechts zum Eingang stand. Sie riss an der Tür, sprang jedoch erschrocken wieder zurück, als das monströse Möbel ein Stück nach vorn kippte.
»Man hat uns hier wirklich nur mit dem Allerbesten ausgestattet, das auf den unzerbombten Dachböden dieser Stadt zu finden war«, schimpfte sie. »Wissen Sie zufällig, ob ich da drin Papier finde?«
»Papier? Nein. Polizeimeister Hildesund sagte, es gäbe hier kein Papier.«
»Ach.« Ida verzog das Gesicht. »Und wie sollen wir dann dieses Anzeigenbuch abtippen? Wir können hier doch nicht arbeiten, wenn wir kein Papier haben!«
Brasch sah sie ängstlich an und zuckte mit den Schultern.
»Ich dachte«, begann sie leise, »wir bekommen vielleicht noch etwas von Polizeimeister Hildesund.«
Das hielt Ida für unwahrscheinlich. »Wir werden ja sehen.« Etwas behutsamer versuchte sie erneut, den Schrank zu öffnen. Sicherheitshalber lehnte sie sich mit der Schulter gegen das Ungetüm. Knarzend bewegte sich die Tür einen Spalt, dann noch einen. Die Fächer darin waren so gut wie leer. Nur in den unteren beiden erspähte Ida etwas. Rasch ging sie in die Hocke und begann in den Fächern zu wühlen. Sie nieste, als ihr eine Wolke aus Kampfergeruch und Staub entgegenkam.
»Und?«, fragte Brasch.
»Kein Papier. Aber ich brauche etwas, um mir Lesezeichen zu basteln. Sonst stehe ich ewig und drei Tage bei dem Kollegen oben und versuche, die entsprechenden Stellen wiederzufinden.«
Neben Kisten, die mit JUGENDFÜRSORGE, SITTENDELIKTEund VERMISSTEPERSONEN, A – F, G – L, M – Q und R – Z beschriftet und randvoll mit Akten waren, einer dicken Staubschicht und ein paar Mäusekötteln entdeckte Ida nur das 30 Kilogramm schwere Exemplar einer Urania. Die Schreibmaschine sah aus, als sei sie hundert Jahre alt, und war vermutlich schon in den Dreißigern durch die moderneren Olympia Progress ersetzt worden, die auf Idas und Heide Braschs Schreibtischen standen. Ohne Papier konnte Ida jedoch weder mit dem einen noch mit dem anderen Modell etwas anfangen. Sie beugte sich weiter vor. Nicht einmal ein benutzter Briefumschlag lag in den Fächern herum.
»Dann muss es eben so gehen.«
*
Nach der knappen Stunde im Keller fühlte sie sich bei ihrem Ausflug nach oben, als tauche sie aus den Tiefen des Meeres auf. Die Augen zusammengekniffen, sah sich Ida im Erdgeschoss um, klopfte schließlich an den Türrahmen des erstbesten Büros und erkundigte sich nach Polizeimeisteranwärter Johann Meyerlich. Zwei Türen weiter vorn, war die Antwort.
Dort klopfte sie erneut. Ein heller Schopf hob sich, und ein verwirrtes Lächeln glitt dem jungen Mann über das Gesicht.
»Wollen Sie eine Anzeige aufgeben? Ich fürchte, da sind Sie bei mir falsch.«
Ida blickte an sich herab. Sie trug Uniform. War es so schwer, sie als Polizistin zu erkennen?
»Oh«, sagte er dann, »ich hab gar nicht … ’tschuldigung, ich habe nicht nachgedacht. Meyerlich, Johann. Moin!«
Er war aufgesprungen und ging mit großen, ungelenken Schritten auf sie zu. Etwas zu dicht für ihren Geschmack machte er vor ihr halt, sein Gesicht ein einziges Strahlen. Wie konnte man solche Pausbacken haben?, fragte sie sich. Noch dazu nach einem Winter, in dem bestenfalls der Bürgermeister der Hansestadt genug zwischen die Zähne bekommen hatte und vielleicht noch der Stadtkommandant? Für alle anderen war das Magenknurren vom Aufwachen bis zum Schlafengehen ein ständiger Begleiter. Für die jedenfalls, die das Glück gehabt hatten, den Krieg zu überleben.
»Ida Rabe.«
»Sehr erfreut.« Er schüttelte ihre Hand schwungvoll, und Ida drückte ein bisschen fester zu, als sie es normalerweise tat. Es war immer gut, nicht nur mit ihrer Größe Eindruck zu machen. Sollte Meyerlich doch rumerzählen, sie habe den Händedruck eines Preisboxers.
»Sie verewigen sich gern in dem Wälzer am Tresen, stimmt’s?«
Baff sah er sie an. Ida fragte sich, ob sie das Buch doch lieber mitgeschleppt hätte. Sonderlich helle wirkte der Kollege nicht; es wäre sicher einfacher, ihm Blatt für Blatt zu zeigen.
»Sie nehmen Anzeigen auf?«, fragte sie so langsam und geduldig, wie es ihr möglich erschien.
»O ja, sicher, vorne am Tresen schon, ne? Aber … Wieso fragen Sie? Hab ich etwa was falsch gemacht?« Immer noch strahlte er, als sei er nie in angenehmerer Gesellschaft gewesen. Sehr irritierend, fand Ida.
»Wir sollen diese Meldungen abtippen. Was ohne Papier schon schwer genug ist. Und ich kann manche Einträge gar nicht entziffern. Als ich mir die Anzeigen der vergangenen Wochen angesehen habe, fiel mir auf …«
Sie hörte im Gang rasche Schritte, blickte zur Tür, konnte jedoch nicht ausmachen, wer dort im Halbdunkel vorüberlief.
»Dabei habe ich festgestellt«, nahm sie den Faden wieder auf, »dass ein Polizeimeister Meyerlich …«
»Polizeimeisteranwärter«, korrigierte Meyerlich und strich sich verlegen über den ordentlich gezogenen Scheitel.
»Gut, Polizeimeisteranwärter Meyerlich. Sie haben immer wieder etwas neben die Meldungen notiert. Dummerweise kann ich diese Notizen nicht lesen. Oder zumindest nur halb.« Als sie der pausbäckige junge Mann immer noch wortlos anstarrte, straffte Ida ungeduldig die Schultern und konnte sich einen herablassenden Ton nur schwer verkneifen. »Würden Sie mir verraten, was Sie als so unwichtig erachtet haben, dass Sie es derart unleserlich aufgeschrieben haben, während es Ihnen zugleich aber als substanziell genug erschien, es überhaupt zu Papier zu bringen?«
Perplex sah er sie an.
»Sie mögen Worte«, sagte er schließlich, statt auf ihre Frage zu antworten, und wirkte so froh wie ein Kind an Weihnachten.
»Ich …«
»Ich hingegen liebe Bilder. Das Kino, genauer gesagt.«
»Ach«, sagte sie, und es klang exakt so gelangweilt, wie sie es beabsichtigt hatte. Ungeachtet dessen redete Meyerlich weiter.
»Kennen Sie Frank Capra, den Regisseur?«
»Nein.«
»Es geschah in einer Nacht?«
»Wovon sprechen Sie, bitte?«
»Sie sind Claudette Colbert und ich Cary Grant!«
»Ich nehme an, die beiden werden im Film ein Paar?«
»Ja«, sagte er und nickte erfreut. Doch dann dämmerte ihm, dass Ida seine Begeisterung nicht teilte. Schlagartig fiel sein Grinsen in sich zusammen. »O Schiete. Jetzt hab ich was Falsches gesagt. Das passiert mir ständig.« Er kniff die Lippen zusammen, und eine feine Röte zeigte sich auf seinen Wangen. »Mir fiel der Film bloß ein, weil die Dame so wortgewandt ist, Cary Grant aber …«
»Was, bitte, Herr Meyerlich, haben Sie an den Rand geschrieben neben ›kleeblattförmiger Silberanhänger‹ oder wie auch immer das Ding aussah? Sie wissen schon, die Dame, die vor drei Wochen ihr Armkettchen als gestohlen gemeldet hat.«
»Ich weiß es nicht mehr genau. Mit Worten hab ich’s nicht so. Aber was ich noch weiß, ist, dass mir die junge Frau, die die Meldung aufgab, irgendwie … na ja, seltsam vorkam. Verschreckt, verstehen Sie? Und ängstlich. Klar, so ’ne Kette ist schwer was wert heutzutage, aber die arme Deern hat den Eindruck gemacht, als sei, ich weiß nicht … Als wäre bei dem Überfall im Umland noch mehr passiert. Auch bei ein paar anderen hatte ich das Gefühl.«
»Im Umland?«
»Na, bei den Hamsterfahrten.« Er hatte die Stimme gesenkt und sah Ida verschwörerisch an. »Nicht, dass das eine zugibt, was ja auch ein Wunder wäre. Ist schließlich verboten, ne? Aber das kann sich selbst ein Döskopp denken. Was hätten die da draußen sonst zu suchen gehabt? Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass die Frauen mir nicht die ganze Geschichte erzählt haben. Aber obwohl ich nachgefragt habe, haben sie nicht mehr sagen wollen. Ich hab das für mich dann am Rand notiert, um später noch mal draufgucken zu können.«
Nachdenklich sah Ida ihn an. »Und haben Sie später noch einmal draufgeguckt?«
Er schüttelte den Kopf. »Wollte ich, aber Polizeimeister Hildesund hat abgewunken. Wie soll das gehen, hat er gesagt, wenn wir zehn Polizisten auf dem Revier sind und sich die Leute im Umkreis von hundert Metern täglich die Köppe einschlagen? Wenn die Briten uns im Nacken sitzen, sodass wir jeden Vor- und Nachmittag auf dem Schwarzen Markt Streife gehen müssen? Wenn es heißt, wir müssen die Leute bei den Hungerdemonstrationen in Schach halten und niemanden in die Nähe der eleganten Gegenden lassen, schon gar nicht vor die britischen Klubs? Da stehste dir vor dem Vier Jahreszeiten die Beine in den Bauch, damit die Herren gemütlich Portwein trinken können, während anderswo einer abgestochen wird. Es bleibt doch überhaupt keine Zeit, sich auf die Suche nach einem silbernen Kleeblatt zu machen, verstehen Sie?«
Ida spürte, dass Meyerlich Polizeimeister Hildesunds Begründungen selbst nicht ganz glaubte, sagte aber nur: »Ich verstehe. Danke noch einmal.«
»Ist Fräulein Brasch eigentlich noch da?«
»Ja«, sagte Ida nach einem Moment des Erstaunens.
»Ich komme mit runter, Fräulein Rabe. Nur um sicherzustellen, dass Sie …«
»Nicht die Treppe hinunterfallen?«, fragte sie verärgert.
Doch er war schon mit großen Schritten im Flur verschwunden. Auf dem Weg nach unten kam er wieder auf seinen Lieblingsfilm zu sprechen, doch Ida hörte nicht richtig zu. Was war es wohl, was die Frauen Johann Meyerlich verschwiegen hatten?
Als sie die Tür zum Büro öffnete, fiel ihr Blick als Erstes auf eine in sich zusammengesunkene Kollegin Brasch, die nur mit Mühe ihre Tränen wegblinzelte. Erst dann bemerkte Ida Miss Watson, Superintendent Watson, die mit verschränkten Armen und zusammengepressten Lippen vor Idas Schreibtisch stand. Miss Watson war klein und zierlich und hatte hellgraue Augen, die mit giftigen Pfeilen um sich zu schießen schienen, sobald sie der Zorn ergriff. Wenn sie sprach – klar, bedacht, mit kaum wahrnehmbarem englischem Akzent –, lag eine solche Schärfe in ihrem Ton, dass niemand Widerworte wagte.
Ida nahm Haltung an, wie sie es auf dem zugigen Kasernenhof in Altona gelernt hatte.
»Das nutzt Ihnen jetzt auch nichts mehr«, lautete Miss Watsons Kommentar. Sie musterte Polizeimeisteranwärter Meyerlich, der sicher bitter bereute, Ida nach unten begleitet zu haben. Gewiss hatte es sich auf dem Revier herumgesprochen, wie Miss Watsons Spitzname lautete: Der Hai. Ihrer kleinen, blitzenden Zähne wegen, doch auch weil sie so gern auf die Jagd nach inkompetenten Kollegen ging und dabei selten erfolglos war. Zwei Jahre verzichtete Großbritannien nun schon auf diese hochdekorierte Polizistin, und Ida vermutete, dass der Tag ihrer Abreise in London trotz ihrer Fähigkeiten jedes Jahr mit einem Festakt begangen wurde.
»Ich habe mich schon bei Fräulein Brasch erkundigt und tue es noch einmal«, sagte Miss Watson kühl. Brasch, stellte Ida fest, klang bei Miss Watson wie »brush«, Bürste. »Wieso sind Sie hier und nicht dort, wohin ich Sie beordert habe?«
Ida warf ihrer Kollegin einen fragenden Blick zu, doch Brasch starrte auf die Tischplatte. Sie sah bemitleidenswert aus. Wieso ließ sie sich so einschüchtern? Nicht einmal Miss Watson würde es wagen, die Tochter eines hoch angesehenen Oberkommissars am ersten Tag zu entlassen. Ganz anders sah es bei Ida aus. Sie war die Tochter eines Amrumer Bauern und hatte ihre Jugend mit Krabbenpulen und Streifzügen am Strand verbracht.
»Wohin haben Sie uns beordert?«, erkundigte sie sich, erleichtert über ihren gefassten Ton, auch wenn sie innerlich zu brodeln begann. Etwas war schiefgegangen, gründlich, und das war nicht gut.
Kalt wies Miss Watson Polizeimeisteranwärter Meyerlich an, sie allein zu lassen, was dieser nur allzu gern tat, und donnerte los: »Ich honoriere harte Arbeit, ebenso honoriere ich, wenn jemand etwas lernen will. Das scheint bei Ihnen immerhin der Fall zu sein, wenn stimmt, was mir Fräulein Brasch erzählt hat.«
Erneut sah Ida zu ihrer Kollegin, doch diese schien sich vorgenommen zu haben, nie wieder den Kopf zu heben.
»Was ich absolut nicht honoriere, ist, wenn Sie genau das tun, was uns Frauen so gern vorgeworfen wird. Dafür gibt es ein sehr unschönes Wort, dabei gefällt mir die deutsche Sprache sonst ausnehmend gut. Möchten Sie wissen, von welchem Wort ich spreche?«
»Ja, Ma’am.«
»Sabbeln!«, spuckte ihre Vorgesetzte aus. »Es heißt, die jungen Polizistinnen würden nichts anderes tun als sabbeln, tagein, tagaus, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen.« Der Blick, mit dem sie Ida bedachte, fühlte sich an, als wollte Miss Watson sie an die Wand nageln. »Schlimm genug, dass Fräulein Brasch und Sie nicht zur verabredeten Zeit am verabredeten Ort aufgetaucht sind! Dann komme ich auf die Davidwache, und was höre ich, als ich den Flur entlanglaufe? Sie! Sie, wie Sie im Büro von Polizeimeisteranwärter Meyerlich stehen und sabbeln!«
Ida runzelte die Stirn. Gesabbelt hatte einzig Meyerlich. Sie wollte sich verteidigen, war aber klug genug, es nicht zu tun.
»Ich bitte um Entschuldigung«, sagte sie stattdessen. »Wo hätten wir denn heute Morgen sein sollen? Sie sagten doch …«
»Versuchen Sie ja nicht, sich herauszureden! Polizeimeister Hildesund hat Sie bei Ihrer Ankunft in der Wache heute um sieben Uhr darüber informiert, dass nicht ich Sie hier treffe, sondern Sie sich unverzüglich beim Heiligengeistfeld einzufinden haben! Er hat es mir selbst bestätigt!«
»Wir wussten nicht …«, versuchte es Ida noch einmal, doch Miss Watson sprach einfach weiter.
»Wie Ihnen sicher bewusst ist, findet heute die Maifeier statt. Ungewöhnlich viele Menschen werden sich in Planten un Blomen versammeln. Mr. Rutz von der AFL wird sprechen … Sie wissen, was die American Federation of Labour ist, oder soll ich es Ihnen übersetzen?«
»Nicht nötig«, sagte Ida. Dieser elende Hildesund. Aber was nützte es, wenn sie den Kerl am liebsten am Schlafittchen packen und kräftig schütteln würde? Es war schlicht unmöglich, ihn zur Rede zu stellen. Er war Polizeimeister, sie Schutzpolizistin. Und das nicht mehr lange, wenn sie gleich an ihrem ersten Tag alles vergeigte.
»Sie brauchen uns also bei der Maifeier?«
»Das tue ich nicht, nein«, lautete Miss Watsons eisige Antwort. »Aber da Ihre Kolleginnen am Karl-Muck-Platz dafür eingeteilt sind, benötige ich Sie in einer anderen Angelegenheit. Nun kommen Sie. Oder haben Sie Besseres zu tun?«
Mit einem Seitenblick auf den dicken Wälzer auf ihrem Schreibtisch verneinte Ida leise. Dann warf sie sich in ihre Schutzpolizistinnen-Montur: dunkelblaue Mütze auf den Kopf, Merkheft in der einen Hand, die Trillerpfeife in der anderen. Eine Taschenlampe steckte in der Tasche ihrer Uniformjacke.
Miss Watson musterte sie und nickte einigermaßen beifällig. »Dann los, Ladys.«
*
Der Himmel über der Reeperbahn war von einem tiefen Grau. Unbewegt hingen die Wolken über den Häuserskeletten. Die Straße war wie leer gefegt; kein Passant mit Regenschirm oder tief ins Gesicht gezogenem Hut hastete vorüber. Außer der Polizei, der Militärregierung und dem Personal in Krankenhäusern arbeitete an diesem ersten Mai kaum jemand.
Immer noch verärgert über Hildesund, ließ Ida den Blick schweifen. Trostlos beschrieb die Umgebung wohl am besten. Die fensterlosen Ruinen rechts und links des Millerntorplatzes wirkten vor dem stahlgrauen Himmel bedrückend. Dieser Anblick hatte nichts mit der Fantasiewelt aus Idas Kindheit zu tun: Städte voller Menschen, Häuser vollgestopft mit Gesichtern und Stimmen, wie große Puppenstuben, in deren Zimmer sie bequem hineinsehen konnte. Nach so einem Ort hatte sie sich damals gesehnt, während sie in der Hängematte schaukelte, um sie herum nichts als die karge, einsame Weite Amrums. Und in einer der Stuben, so hatte sie es sich ausgemalt, lebte ihre Lieblingsfamilie: ein Vater mit dunklem Schnurrbart, eine Mutter, die so freundlich wie großherzig war, und eine Tochter, die genau so aussah wie sie selbst.
In der Realität aber war es nicht so einfach, in die Wohnungen zu blicken. Erkennen konnte sie immerhin, dass in einem Raum, in dessen zersprengten Fenstern Laken flatterten, eine Frau Pflanzenblätter zum Trocknen aufhängte. Um Kaffee daraus zu machen, nahm Ida an, oder Zigaretten Marke AEG. Aus eigenem Garten. Wenngleich Garten maßlos übertrieben war – die Leute beackerten alles, worauf auch nur eine Handvoll Erde lag. Oder sie fuhren ins Umland, um das wenige, das ihnen geblieben war, gegen etwas Essbares einzutauschen: ihren Schmuck zum Beispiel. Ida musste an die Raubüberfälle und Meyerlichs krakelige Notizen denken. Wer bestahl Frauen, die bereit waren, ihr letztes Hemd gegen eine Handvoll Kartoffeln einzutauschen? Und was war es, das ihnen solche Angst machte?
»Fräulein Rabe!«, rief Miss Watson, die mit Heide Brasch sicher zwanzig Meter Vorsprung hatte.
»Ich komme schon.«
Kurz darauf weitete sich über dem Heiligengeistfeld der Himmel. Unsicher, von wo aus die Züge der Gewerkschaften starten würden, um sich auf der Festwiese des Parks Planten un Blomen zu versammeln, sah sich Ida nach ersten Gruppen aufgebrachter Arbeiter um, konnte jedoch niemanden entdecken. Stattdessen schoben sich ihr die beiden Bunker ins Blickfeld, die in den Kriegsjahren in Nullkommanichts errichtet worden waren. Der größere löste in ihr ein Gefühl der Beklommenheit aus. Das Ungetüm beherbergte Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten und ausgebombte Hamburger. Erst vor Kurzem hatte auch ein Revuetheater im Bunker eröffnet. In großen Lettern stand Scala über dem separaten Eingang. Wieder einmal wunderte sich Ida über diese seltsame Mischung aus Elend und Vergnügen. Sie hielt inne, um zu sehen, wohin Miss Watson ging, und schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass ihre Vorgesetzte am Bunker vorbeigehen und ein anderes Ziel ansteuern möge. Doch mit ihren beherzten Schritten marschierte Miss Watson direkt auf den Eingang des Betonklotzes zu.
Idas Herz klopfte schneller. All die Wochen und Monate, in denen sie im Bunker ein und aus gegangen war … Im Nachhinein kam es ihr vor, als liege dieses alte Leben Jahrhunderte zurück, als sei sie, Ida Rabe, damals eine ganz andere gewesen.
Schließlich stand sie neben Brasch und Miss Watson vor der Pforte des grauen Baus und bemühte sich um eine desinteressierte Miene. Tatsächlich bekam sie kaum Luft vor Angst. Sie ahnte nun, was diese »andere Angelegenheit« war, von der Miss Watson zuvor gesprochen hatte. Sie sollten die Flüchtlingslager durchkämmen und die Papiere der Bewohner kontrollieren. Eigentlich eine Routineaufgabe, die jedes Mitglied der Weiblichen Polizei hin und wieder erledigen musste. Aber Ida hatte gehofft, dass es noch eine Weile dauern würde, bis sie dran war, zumal es einen Tiefbunker an der Reeperbahn gab, für dessen Kontrollgänge die Beamten der Davidwache verantwortlich waren.
Was, wenn jemand da drin sie erkannte? Miss Watson würde Taten sehen wollen. Mit der Taschenlampe in die Kabuffs leuchten, mit herrischer Stimme die Leute befragen. Der ganze elende Kram. Würde es nicht unweigerlich zu einer Situation kommen, in der jemand sagte: »Ida, du bist zurück?«
Und was, wenn die Bunkerkönigin da war? Marlise, die angeblich immer noch nach Ida suchte …
»Ich hoffe, Sie sind nicht zimperlich«, sagte Miss Watson, bevor sie die schwere Pforte aufschob. Vor Nervosität krampfte sich Idas Magen zusammen. Aber sie hatte ja gewusst, was auf sie zukam, als sie sich für die Polizeiausbildung gemeldet hatte. Also Augen zu und durch. Tief zog sie die Mütze ins Gesicht und folgte Miss Watson die Treppe hinauf, die sich spiralförmig emporwand. Ihre Vorgesetzte gab die Order, oben mit der Kontrolle der Personalien zu beginnen und sich, Stockwerk um Stockwerk, nach unten zu arbeiten, hoffentlich, wie sie säuerlich bemerkte, bevor ihnen der Sauerstoff ausging.
Von der Wendeltreppe bis zur schrankdicken Tür waren es exakt dreizehn Schritte. Dann standen sie in dem riesigen dunklen Raum, der von seinen Bewohnern als »Grotte« bezeichnet wurde. Eiskalt war es darin und zugleich tropisch feucht. Aus eigener Erfahrung wusste Ida, dass sich die Atemluft hier rasch in Schlieren verwandelte, die dann langsam an den Betonwänden hinabsickerten und sich auf dem Boden sammelten, was gefährlich werden konnte, wenn man zu schnell unterwegs war. Auch der Geruch, der ihr beim Eintreten in die Nase stieg, war ihr vertraut. Scharf und süß roch es in der Grotte, ein Gestank, der Ida schon immer an jene Tage auf dem Bauernhof ihrer Eltern erinnert hatte, wenn im Obstkeller die Früchte zu gären begannen und die Ratten regelmäßig auf ein Festmahl hereinschneiten, dank der Fallen jedoch nicht wieder herauskamen.
Mit eingeschalteten Taschenlampen betraten sie den Gang, der von allen die »Wolldeckenallee« genannt wurde. Denn die Leute hatten an den Seiten alle möglichen Stoffe auf Wäscheleinen aufgehängt – einen zerschlissenen Mantel, ein Hand-, manchmal auch nur ein Geschirrtuch. Hauptsache, man konnte sich eine Ahnung von Privatsphäre verschaffen.
Miss Watson blieb, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, alle paar Schritte stehen, schlug den Vorhangersatz um und steckte den Kopf ins Innere des Kabuffs.
»Kennkarte!«
Brasch und Ida folgten ihr zögerlich. Sie sahen sich nicht an, während sie sich Seite an Seite durch den schmalen Gang arbeiteten.
»Hildesund hat mir nichts gesagt. Ihnen etwa?«, flüsterte Ida.
Mit angespannter Miene schüttelte ihre Kollegin den Kopf. Man könnte meinen, sie habe so viel Angst davor aufzufliegen wie Ida, aber die hübsche junge Frau hatte mit Sicherheit nicht zwei Jahre in dieser Umgebung gelebt. Erneut fragte sich Ida, wie Heide Brasch nur auf die Idee gekommen war, zur Polizei zu gehen. Sie machte den Eindruck, als würde sie sich am liebsten verstecken.
Der Vorsicht halber ließ sich Ida ein Stück zurückfallen und spitzte die Ohren, um vertraute Stimmen auszumachen. Welche Erklärung könnte sie Miss Watson liefern, falls jemand bei ihrem Anblick freudestrahlend die Arme ausbreitete? Sollte sie das Blaue vom Himmel lügen oder die Wahrheit elegant umschiffen wie bei ihrem Bewerbungsgespräch? Dass sie einige Zeit selbst im Bunker gelebt hatte, hatte sie natürlich verschwiegen. Ebenso das, was sie in dieser Zeit getan hatte. Tun musste.
»Fräulein Rabe«, sagte Heide Brasch, die an einer Ecke auf sie gewartet hatte, leise, aber in drängendem Ton.
»Ja?«, gab Ida, abrupt aus ihren Gedanken gerissen, zurück.
»Da starrt Sie jemand an.«
Brasch deutete nach links, wo eine schmale Gestalt im Halbdunkel stand. Miss Watson war schon mindestens fünf Kabuffs weiter. Wie ein leichtes Brennen spürte Ida den Blick des Mannes auf sich, spürte, wie ihr die Hitze in den Nacken stieg, wie der Uniformkragen plötzlich zu jucken begann. Mit einem Mal wurde ihr von der schlechten Luft übel, von der schweren, fauligen Süße darin, dem Schweiß, dem Blut, dem Elend.
Werner sagte nichts. Er griff auch nicht nach ihrem Arm, als sie an ihm vorüberging und ihm einen warnenden Blick zuwarf.
»Wer war das?«
»Niemand«, sagte Ida mit rauer Stimme, nun bemüht, Miss Watson einzuholen. Brasch hielt Schritt mit ihr und bedachte sie mit einem nachdenklichen Blick.
»Ich hoffe, Ihnen ist nun klar, wie unsere Aufgabe hier aussieht«, sagte Miss Watson, als sie das Ende der ersten Allee erreicht hatten. »Fräulein Rabe, trauen Sie sich zu, allein vorzugehen?«
»Natürlich«, sagte Ida wie aus der Pistole geschossen. Erst jetzt bemerkte sie, dass ihre Schultern schmerzten, so sehr hatte sie sie angespannt.
Miss Watson nickte.
»Wir teilen uns auf. Brasch, Sie folgen mir. Rabe, nach links.«
Erleichtert nickte Ida. Nachdem ihre Kolleginnen im Dunkeln verschwunden waren, begann Ida Ecke um Ecke zu kontrollieren. Bislang hatte nur Werner sie erkannt. Aber auch wenn ein paar ihrer ehemaligen Nachbarn offenbar eine andere Bleibe gefunden und neuen Obdachlosen Platz gemacht hatten, streifte ihr Blick immer wieder wohlbekannte Gesichter. Während sie Vorhang um Vorhang zur Seite zog und sich die Kennkarten zeigen ließ, sagte Ida nur das Nötigste und hielt den Kopf gesenkt, die Mütze tief in die Stirn gezogen. Zum ersten Mal war ihr die Angst, die wie ein Schleier über dem Raum lag, willkommen. Sie hielt die Leute davon ab, ihr in die Augen zu sehen.
»Rabe, hier rüber«, erklang plötzlich Miss Watsons bellende Stimme.
Ida gab der alten Frau, die sie gerade kontrollierte, deren Papiere zurück, ließ den Tischdeckchen-Vorhang zurückfallen, eilte den Gang hinunter, bog rechts ab und schloss zu ihrer Vorgesetzten auf.
In dem kleinen Abteil, das mit zerschlissenen Handtüchern von den umliegenden abgegrenzt war, sah es ebenso erbärmlich aus wie in den übrigen. Wie sollte man auch putzen, wenn man kaum die eigene Hand vor Augen sah? Sie leuchtete über Miss Watsons Schuhe, folgte mit dem Lichtstrahl ein paar Glasscherben, die über den Betonboden verteilt waren, und erfasste das Bett, das aus Klötzen unterschiedlicher Breite und Höhe sowie einer Strohmatratze bestand.
»Darunter«, sagte Miss Watson, »ist etwas. Finden Sie heraus, worum es sich handelt. Ihre Kollegin sieht im Dunkeln leider nichts.«
Aus den Augenwinkeln glaubte Ida zu erkennen, dass Brasch tiefrot anlief. Sie ging in die Hocke, konnte allerdings kaum etwas erkennen. Als sie mit der Taschenlampe direkt unters Bett leuchtete, ertönte ein zischender Laut. Es klang wie ein Fauchen.
»Was ist das?«, wollte Miss Watson wissen.
»Ein Kind, nehme ich an.«
»Kein Tier?«
»Das bezweifle ich. Es ist zu groß.«
Zudem würde kein Tier, das sich hierherverirrte, länger als zwei Stunden überleben, dachte Ida, behielt dieses Wissen aber für sich. Einmal hatte sie streng schmeckendes Fuchsfleisch probiert und dachte nicht gern an diese Erfahrung zurück.
Auf den Knien kroch sie näher an die Matratze heran, die nach Urin und Schweiß roch, und bemühte sich, nicht direkt unter das Bett zu leuchten. Sie sah zwei große dunkle Augen, wirres, dunkles Haar, ein kurzes, mageres Ärmchen. Als sie die Hand ausstreckte, erklang erneut eine Art Fauchen.
»Tststs«, machte Ida, als spreche sie mit einem verängstigten Tier. »Tststs, komm her, Kleines.«
Da das Kind sich jedoch nicht rührte, bewegte sich Ida vorsichtig, Zentimeter um Zentimeter, so nahe heran, bis sie selbst beinahe unter dem Bett lag. Dann kniff sie die Augen zusammen und leuchtete sich mit der Taschenlampe ins Gesicht. Sie hoffte, dass sich das Kind weniger fürchtete, wenn es erkennen konnte, wen es vor sich hatte.
»Und jetzt?«, ließ sich Miss Watson vernehmen, während Ida langsam wieder zurückkroch.
»Ich hoffe, es kommt von allein. Wenn nicht, muss ich es herausziehen, fürchte ich.«
Miss Watson betrachtete sie nachdenklich. Schließlich nickte sie und verließ wortlos die kleine Kammer.
»Kommen Sie«, hörte Ida sie zu Brasch sagen. »Lassen wir Fräulein Rabe ihr Glück versuchen.«
Still saß Ida da. Ein behagliches Gefühl breitete sich in ihr aus, so irrwitzig das auch sein mochte. Hatte sie nicht alles darangesetzt, dieser Umgebung zu entfliehen? War nie zurückgekommen, wohl wissend, dass der Bunker noch nicht fertig mit ihr war …
Irgendwo sang jemand leise den Schlager Ich will nicht wissen, wer du bist. Ich will aber wissen, wer du bist, dachte Ida. Die Taschenlampe lag so auf dem Boden, dass sie ihren Schatten gegen die Lumpen, die die Rückwand der Kammer bildeten, warf. Ein Trockenblumenstrauß baumelte daran, mit filigranen hellen Köpfchen, die allerdings kaum Frische in die Kammer brachten. Auf dem Boden stand in einem schnörkellosen Holzrahmen ein Marienbild. Zwei eher klägliche Versuche, dem Kabuff eine heimelige Note zu verleihen. Ida guckte nicht noch einmal unter das Bett. Sie wusste auch so, dass das Kind sie ganz genau in Augenschein nahm.
»Hallo«, flüsterte sie und streckte die Hand aus. Dabei wandte sie den Blick zur Seite, als interessiere sie sich nicht im Mindesten für das Kleine. Tiere, die keinen direkten Blickkontakt mochten, Hunde, Katzen, Schweine und Ziegen, konnten ihre Neugier kaum in Schach halten, wenn sie jemand so lockte. Sie mussten nachprüfen, ob sich nichts Essbares darin verbarg. Und falls nicht, gab es ja immer noch das Salz, das man von der Haut schlecken konnte …
Das Kind aber fiel nicht darauf herein. Es sah wohl, dass die Hand leer war. Wenn sich nur nicht irgendein Dummkopf die Regel ausgedacht hätte, dass Polizistinnen keine Handtaschen tragen durften! Es wirke unprofessionell. Das mochte sogar stimmen, aber wo bitte sollte man all das hineinstecken, was in Situationen wie diesen hilfreich sein könnte? Süßigkeiten oder ein kleines Spielzeug? Andererseits hatte Ida für derlei Kostbarkeiten ohnehin kein Geld.
Sie wollte die Hand gerade wieder wegnehmen, als sie ein schabendes Geräusch hörte. Ein Ächzen folgte. Dann sah Ida einen Arm, eine Schulter und einen Schopf. Nachtschwarzes Haar, zu zwei Zöpfen geflochten, die sich allmählich auflösten. Das Mädchen trug ein dünnes, dunkelblaues Matrosenkleid, das schon einige Jahre auf dem Buckel haben musste. An den Wangen klebte Schmutz. Wie alt mochte sie sein?
Eine Weile kniete sie da und guckte Ida an. Dann krabbelte sie ein Stück näher, verharrte, kam erneut näher, bis ihre Stirn Idas Hand berührte. Mit der Nase stupste sie zaghaft hinein, zog sich aber gleich wieder scheu zurück.
»Wo ist deine Mama?«, fragte Ida leise.
Das Mädchen gab ein maunzendes Geräusch von sich und begann, sich die Hände zu lecken. Ida betrachtete sie ruhig.
Da wurde der Vorhang unsanft zur Seite gerissen. Ida schreckte hoch, und in einer einzigen fließenden Bewegung war die Kleine wieder unter dem Bett verschwunden.
»Wo stehen wir?«, erkundigte sich Miss Watson.
Gut, dass es hier dunkel war, dachte Ida, so war ihre wütende Miene nicht zu erkennen. Wieso hatte Miss Watson ihr nicht ein paar Minuten länger Zeit geben können?
»Weit bin ich nicht gekommen. Immerhin weiß ich jetzt, dass es sich um ein Mädchen handelt. Sie ist eben unter dem Bett hervorgekommen, jetzt allerdings …«
Miss Watson runzelte die Stirn. »Dann sehen Sie zu, dass Sie sie wieder darunter hervorbekommen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«
»Gut«, sagte Ida. »Ich …«
Doch ihre Vorgesetzte war schon wieder verschwunden.
Ida stand auf, sagte laut in den leeren Raum, sie komme gleich zurück, und zupfte an dem nächstgelegenen Vorhang. Als sie mit der Taschenlampe ins Innere leuchtete, blickte ein hagerer kleiner Mann sie erschrocken an.
»Kennen Sie das Kind nebenan?«
Zaghaft hob er die Schultern.
»Wissen Sie, wo die Mutter ist?«
Er schüttelte den Kopf.
Ida probierte es bei fünf weiteren Nachbarn, hatte dort jedoch ebenfalls kein Glück. Kurz überlegte sie, Werner zu fragen, doch dass er ihr jetzt noch helfen würde, hielt sie für unwahrscheinlich. Zu viel war passiert, seit sie Seite an Seite durch die Nächte von Sankt Pauli gezogen waren …
Sie kehrte zu dem dürren Herrn zurück.
»Haben Sie etwas Essbares?«
Wieder schüttelte er den Kopf.
»Können Sie denn wenigstens laut schreien?«, fragte sie.
Zögernd nickte er.
»Dann stellen Sie sich in den Gang und passen auf das kleine Mädchen auf. Wenn sie abdüst, möchte ich, dass Sie nach der Polizei rufen. Verstehen Sie mich?«
Er nickte.
»Falls die Kleine weg ist, wenn ich wiederkomme, landen Sie in der Zelle.«
Daraufhin marschierte sie, den Strahl ihrer Taschenlampe nach vorn gerichtet, die Wolldeckenallee entlang auf die schwere Tür zum Treppenhaus zu, bog davor scharf rechts ab, ging erneut ein paar Meter, folgte einem weiteren Knick und leuchtete am Ende des Gangs eine rosa-weiß karierte Fahne an. Natürlich war es keine Fahne, sondern ein altes Tischtuch, aber Marlise nannte sie gern die »Frauenflagge«.
Ida schnalzte mit der Zunge. Keine Reaktion.
»Marlise?«
»Ich glaub’s nicht!«, erklang von innen eine heisere Stimme.
Mit einem angestrengten Lächeln, das ihre Furcht überspielen sollte, zog Ida das Tischtuch beiseite und betrat Marlises Reich. Es war sauber, sauberer als das Büro der Weiblichen Polizei oder Idas Zimmer in der Margaretenstraße. Bei ihr könne man vom Fußboden essen, hatte Marlise immer gesagt und hinterhergesetzt: Wenn du das Essen selbst mitbringst.
Das etwa drei mal vier Meter große Viereck, das sie als ihren Palast bezeichnete, wurde von dem schummrigen Licht einer Petroleumlampe erhellt. Auf dem Steinboden lag ein ausgefranster Teppich, dessen orientalisches Muster längst verblichen war, die Wände, wenn man sie so nennen wollte, bestanden aus bordeauxroten Samtvorhängen, die Marlises Reich eine geheimnisvolle Aura verliehen. Während es im Rest des Bunkers nach Schmutz und Schweiß roch, hingen hier der Rauch von Nelkenzigaretten und der Duft von Marlises Lieblingsparfum in der Luft. Shocking hieß es. Wie oft hatte ihr die Bunkerkönigin den einem Frauentorso nachempfundenen Flakon gezeigt und stolz behauptet, sie habe dafür Modell gestanden? Was natürlich ausgemachter Unsinn war.
Mit übereinandergeschlagenen Beinen und den Kopf kokett schräg gelegt, saß Marlise auf ihrem Bett, das aus einem Stahlgestell, Federn und einer echten Matratze bestand.
»Ida Rabe, wie sie leibt und lebt«, konstatierte sie in spöttischem Ton. Ihre Augen funkelten. »Nie und nimmer hätt ich gedacht, dich noch mal zu Gesicht zu bekommen. Hast dich ja fein versteckt. Selbst ich hatte Schwierigkeiten, dich aufzustöbern, und ich bekomm sonst alles zurück, was mir fehlt.«
Ida erwiderte nichts darauf. Schweigend betrachtete sie Marlise mit ihren großen, weit auseinanderstehenden schwarzen Augen und dem sinnlichen Mund. Früher hatte sie ihn am liebsten in einem geheimnisvollen Violett angemalt. Jetzt waren die Lippen rot, doch die Farbe war verschmiert und verteilte sich in den Fältchen rundherum. Wahrscheinlich benutzte sie Rote-Bete-Saft als Schminke.
Dennoch fühlte sich Ida, als wären die zurückliegenden anderthalb Jahre nie vergangen. Als stünde sie immer noch im Dienst der selbst ernannten Bunkerkönigin, sei ihr zu allem Rede und Antwort schuldig.
»Ach, nun guck nich so ernst, Liebchen.« Marlises Stimme klang nun etwas freundlicher. »Komm, setz dich zu mir.« Sie klopfte auf die Matratze neben sich und strich sich kokett eine Strähne aus dem Gesicht.
Es gab Dinge, die dieser Frau heilig waren. Ihr hüfthoher Spiegel etwa, in dem sie sich gern, auf dem Bett sitzend, bewunderte. Das Teegeschirr aus echtem Meißener Porzellan, das sie unbewacht lassen konnte, wenn sie draußen zu tun hatte – so viel Macht hatte diese Frau im Bunker. Am liebsten aber war ihr einst Ida gewesen, das jedenfalls hatte sie behauptet. Und dann war Ida verschwunden …
Erneut strich sich Marlise eine Strähne aus dem Gesicht. Ihr Schopf war unten blond und oben braun, zu grauem Haar, versicherte sie gern, neigte sie nicht. Zu Kriegszeiten hatte sie es das letzte Mal gefärbt, seither wuchs es und wuchs es, und Marlise weigerte sich, auch nur eine Spitze abzuschneiden. »Wusstest du, dass im Haar einer Hexe böse Geister leben?«, hatte die Bunkerkönigin mal erklärt und spielerisch ein paar Strähnen angehoben. »Na, was denkst du, wie viele Teufelchen sind wohl hier schon versteckt?«
Vor langer Zeit musste sie eine Schönheit gewesen sein: Ihre Nase schmal und herrschaftlich, ihre Augen unter den mit Vaseline zum Glänzen gebrachten Wimpern blickten tragisch drein. Doch selbst wenn sie weniger hungern musste als alle anderen: Auch an ihr waren die Elendsjahre nicht spurlos vorübergegangen, ihre Haut sah blass und ungesund aus, sie war schmaler geworden, und richtige Schminke konnte sie sich augenscheinlich ebenfalls nicht mehr leisten. Jedes Unglück lässt dich einen Hauch weniger schillern, so hatte sie es einmal ausgedrückt.
Dennoch konnte man mit Fug und Recht behaupten, dass ihr schwierige Zeiten das Leben erleichterten. Wenn diese Stadt irgendwann einmal zu ihrer alten Ordnung zurückfände, wäre Marlise wohl geliefert. Wer würde ihr die Eier abkaufen, die wundersam frisch waren, die Dosen eingelegtes Würzfleisch, die Kippen? Und wer würde teuer für die Informationen bezahlen, deretwegen Ida nun hier stand?
»Unsere Ida«, sagte sie und schüttelte tadelnd den Kopf. »Mit Mützchen und in schmucker Bluse. Dass du mal zu den Halunken in Uniform rüberwandern würdest, hätt ich nicht gedacht. Und ich bin quasi Hellseherin.« Sie lachte heiser. »Aber nu lass dich drücken, Mädchen. Und dann nimm dieses scheußliche Ding von deinem Kopf. Ich bekomm ja das Gefühl, ich muss Papiere und Schmiergeld zücken.«
Rasch trat Ida zurück, doch Marlise war behände. Schon stand sie vor ihr und schloss sie in die Arme. Für einen winzigen, scheußlichen Augenblick fühlte sich Ida geborgen. Dann machte sie sich unsanft los und sah aus den Augenwinkeln Marlises eiskalten, harten Blick, den die Bunkerkönigin schon wieder mit einem Lidschlag kaschierte.
»Das Kind«, sagte Ida, »das glaubt, eine Katze zu sein, woher kommt es?«
Marlises nachtschwarze Augen funkelten. »Ah, dein Verstand hat mir gefehlt. Die Leute hier fragen das dümmste Zeug. Wieso die Lütte nicht spricht. Dabei spricht sie doch! Sie faucht eben, was will man von einem Katzenvieh anderes erwarten? Aber woher sie kommt? Keinen blassen Schimmer.«
»Und die Mutter?«
»Was weiß ich.«
»Aber es gibt eine Mutter?«
»Ich denke schon, ja.«
»Und wo ist sie?«, fragte Ida und konnte sich nur schwer zurückhalten, Marlise zu schütteln.
»Woher soll ich das wissen? Treibt sich halt rum, was soll man auch sonst machen, wenn’s keine Arbeit gibt und nix zu fressen?«
»Wie heißt sie?«