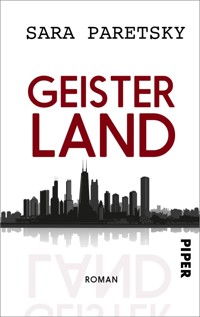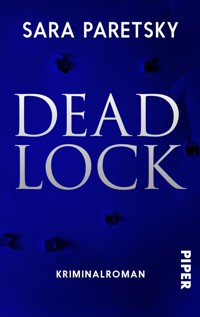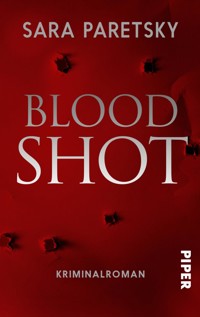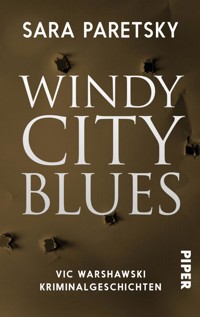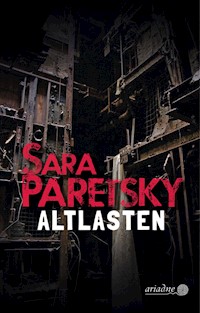
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
August Veriden, Trainer und Filmemacher, ist weg. Abgetaucht, weil ein Einbruch auf sein Konto geht? Oder ist diese Behauptung rassistische Willkür? V. I. Warshawski folgt einer Fährte nach Kansas, in eine ganz normale College-Kleinstadt. Aber der Dreck am Stecken gewisser Leute hier ist von besonderer Art. Und möglicherweise sogar ansteckend. »Altlasten ist das allerbeste Buch in einer der wichtigsten Serien unseres Genres überhaupt, pures Gold und einsame Spitze. Paretsky ist ein Genie, und sie scheut sich nicht, immer noch ein bisschen tiefer zu graben.« Lee Child »Die Detektivin außerhalb ihrer Komfortzone: Hier zeigt sich die präzise soziale Gewärtigkeit, die wir von Paretsky kennen, einer engagierten Aktivistin, deren Gewissen alles durchdringt, was sie verfasst. Sie schreibt kraftvoll, sie kritisiert scharf, und sie verficht ihren Anspruch mit berechtigtem Stolz.« The New York Times »In Kleinstädten bleiben Hass und Vorurteil haften, prägen die Erinnerungen der Menschen. Wo immer Vic gräbt, fördert sie Unrat zutage, aber nichts davon führt sie zu dem, was sie sucht. Dann tauchen die Leichen auf … Ein grandioses Buch, das ohne Pause verschlungen gehört.« The Globe and Mail
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
E-Book-Ausgabe: © Argument Verlag 2020
Glashüttenstraße 28, 20357 Hamburg
Telefon 040/4018000 – Fax 040/40180020
www.argument.de
Alle Rechte vorbehalten
Titel der amerikanischen Originalausgabe
Fallout
© 2017 by Sara Paretsky
Published by Arrangement with SARA AND TWO C-DOGS INC.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Printausgabe: © Argument Verlag 2020
Lektorat & Satz: Iris Konopik
Umschlag: Martin Grundmann
Umschlagmotiv: © Missile Silo Home, fotolia.com
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: April 2020
ISBN 978-3-95988-167-8
Über das Buch
August Veriden, Trainer und Filmemacher, ist weg. Abgetaucht, weil ein Einbruch auf sein Konto geht? Oder ist diese Behauptung rassistische Willkür? V. I. Warshawski folgt einer Fährte nach Kansas, in eine ganz normale College-Kleinstadt. Aber der Dreck am Stecken gewisser Leute hier ist von besonderer Art. Und möglicherweise sogar ansteckend.
Großmeisterin Sara Paretsky demonstriert die gewaltige Erzählkraft der Kriminalliteratur in diesem elegant geplotteten Hardboiled-Roman mit Privatdetektivin Vic Warshawski, die hier einmal mehr an ihre Grenzen gerät.
»Altlasten ist das allerbeste Buch in einer der wichtigsten Serien unseres Genres überhaupt, pures Gold und einsame Spitze. Paretsky ist ein Genie, und sie scheut sich nicht, immer noch ein bisschen tiefer zu graben.« Lee Child
»Die Detektivin außerhalb ihrer Komfortzone: Hier zeigt sich die präzise soziale Gewärtigkeit, die wir von Paretsky kennen, einer engagierten Aktivistin, deren Gewissen alles durchdringt, was sie verfasst. Sie schreibt kraftvoll, sie kritisiert scharf, und sie verficht ihren Anspruch mit berechtigtem Stolz.« The New York Times
»In Kleinstädten bleiben Hass und Vorurteil haften, prägen die Erinnerungen der Menschen. Wo immer Vic gräbt, fördert sie Unrat zutage, aber nichts davon führt sie zu dem, was sie sucht. Dann tauchen die Leichen auf … Ein grandioses Buch, das ohne Pause verschlungen gehört.« The Globe and Mail
Über die Autorin
Sara Paretsky, 1947 in Kansas geboren, ist eine der renommiertesten Krimiautorinnen weltweit. Sie studierte Politikwissenschaft, war in Chicagos Elendsvierteln als Sozialarbeiterin tätig, promovierte in Ökonomie und Geschichte, arbeitete eine Dekade im Marketing und begann Anfang der 1980er Jahre mit dem Projekt, den Detektivroman mit starken Frauen zu bevölkern. In der Geschichte der feministischen Genre-Eroberung, die den Hardboiled-Krimi aus dem reinen Macho-Terrain herausholte und zur Erzählung über die ganze Welt machte, gehört Paretsky zu den wichtigsten Vorreiterinnen: Ihre Krimis um Privatdetektivin Vic Warshawski wurden Weltbestseller, mit zahllosen Preisen geehrt und in über 30 Ländern verlegt. Sara Paretsky gehört zu den Gründerinnen des internationalen Netzwerks Sisters in Crime
Sara Paretsky
Altlasten
Kriminalroman
Deutsch von Laudan & Szelinski
Inhaltsverzeichnis
Für Sue Bowker mit Dank für vieles,
Vorbemerkung von Else Laudan
Als Krimi-Aficionada und als Verlegerin liebe und bewundere ich die große Meisterin Paretsky für ihr gewaltiges Lebenswerk – das nicht weniger als die feministische Erschließung eines populären Genres umfasst –, aber vor allem für die phänomenale Eleganz, mit der sie vielschichtige, hochrelevante Plots zu entfalten versteht. Klassische kriminalliterarische Handwerkskunst gießt komplexe Zusammenhänge in mitreißende Spannungserzählung – und es ist alles so wahr.
V. I. Warshawski fährt nach Kansas, ins Herkunftsland ihrer Schöpferin, um dort einem aggressiven Klüngel aus mächtigen Interessen gegenüberzustehen. Die fremde Detektivin eckt an, stört das eingefahrene Alltagsgetriebe. Mit ihrem klaren moralischen Kompass agiert sie als wandelndes Misstrauensvotum gegen Hierarchien, gegen die heiligen Kühe des amerikanischen Imperiums: Wirtschaft, Wissenschaft, Militär … Eine sehr gefährliche Rolle.
Sara Paretsky blickt tief in soziale Zusammenhänge hinein und erzählt mit coolem Realismus und Respekt vor den Menschen, sie packt Widersprüche an und schickt ihre Ermittlerin auf eine verzweigte Spurensuche in den verschwiegenen Winkeln lokaler Geschichte. Dieser Roman entstand kurz vor Trumps Amtsantritt. Er sondiert den Ballast, den unaufgearbeitete und verdrängte politische Geschichte einem Ort, einer Gegend auferlegt: die Altlasten.
Diese Autorin schreibt aus einer liebevollen und doch anti-illusionären Haltung heraus, sie zelebriert nicht nur das packende Geschichtenerzählen und schenkt uns eine handfeste Heldin, sie huldigt dem selbständigen kritischen Denken und feiert jeden Versuch, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das ist Nahrung für meine Seele, während sich mein Verstand an der cleveren Grazie dieses packenden Schmökers erfreut. Es kann gar nicht genug solche Bücher geben.
Else Laudan
1 Hanswurst
»Die Polizei spricht von einem Drogendelikt, Ma’am. Die denken, August hat gedealt.« Angela Creedy sprach so leise, dass ich mich vorbeugen musste, um sie zu verstehen.
»Das ist so eine bêtise, eine … Dummheit, Blödsinn.« Bernadine Fouchard stampfte empört mit dem Fuß auf.
»Bernie, du kleiner Vulkan, das mag ja sein, aber ich hab keine Ahnung, worüber und von wem ihr redet. Könnt ihr mal mit dem Anfang anfangen?«
Angela starrte auf ihre verkrampften Hände, das Gesicht hölzern vor Sorge, aber dies entlockte ihr ein kurzes Lächeln. »Du bist ein kleiner Vulkan, Bernie. Die Sache ist die, Ma’am, August ist verschwunden, und als dann eingebrochen wurde –«
»Mussten sie es wem anhängen«, unterbrach Bernie. »Und da er schwarz ist –«
Angela legte Bernie eine Hand über den Mund. »August ist mein Cousin, Ma’am. Ich kenn ihn nicht besonders gut – ich bin aus Shreveport, und er ist in Chicago aufgewachsen. Unsere Familie hat’s nicht so mit Jahrestreffen. Ich hatte ihn nicht mehr gesehen, seit er acht oder neun war und mit seiner Mutter zu Besuch kam. Aber ich hab Kontakt aufgenommen, als ich hierherzog, und da stellt sich raus, dass er sich als Filmemacher versucht, aber sein Brotjob ist Trainer. Er macht auch Partyvideos – Hochzeiten, Kindergeburtstage, solche Sachen. Also genau die ideale Mischung.«
Der Singsang des Südens in ihrer leisen Stimme machte es mir nicht ganz leicht, sie zu verstehen. »Ideal wofür?«, fragte ich.
Bernie warf die Hände in die Luft. »Na, um uns beim Training zu helfen und uns dabei zu filmen, naturellement, damit wir sehen, was wir verbessern müssen!«
Bernadine Fouchard, Eishockey-Nachwuchstalent: Ihr Vater war der beste Freund meines Cousins Boom-Boom gewesen. Er hatte Boom-Boom gebeten, Bernies Pate zu sein. Und da sie jetzt an der Northwestern in Chicago studierte, hatte ich sie gewissermaßen geerbt. »Angela ist also auch Sportlerin?«, fragte ich.
»Siehst du das denn nicht? Sie ist doch … wie eine Giraffe. Sie spielt Basketball, und zwar sehr gut.«
Angela warf ihr einen genervten Blick zu. »Also Bernie und ich, wir sind beide Erstsemester, wir müssen uns schwer ins Zeug legen, bevor wir fest ins Team kommen, darum haben wir uns beim Six-Points-Studio angemeldet, denn da arbeitet mein Cousin, und es ist nicht weit vom Campus.«
»Und vorgestern Nacht wurde im Studio eingebrochen«, warf Bernie ein, »da hat die Polizei erst an einen Halloween-Streich gedacht, aber dann heute sagten sie auf einmal, es muss August gewesen sein, das ist so ein scandale. Also hab ich Angela von dir erzählt und wir haben überlegt, dass du genau die Richtige bist, um zu beweisen, dass er das niemals getan hat.« Bernie schenkte mir ein strahlendes Lächeln, als wäre sie die Queen, die mir einen wichtigen Orden verlieh.
Ich fühlte mich eher, als ob mir das Pferd der Queen in den Bauch trat. »Was sagt denn August selbst dazu?«
»Der ist verschwunden«, sagte Bernie. »Er ist bestimmt untergetaucht –«
»Bernie, du springst hin und her wie ein Känguruvulkan!« Angela hob angespannt die Stimme. »Die Managerin meint, August hat ihr Bescheid gesagt, dass er eine Woche weg ist, aber nicht wohin, nur dass es um ein privates Projekt geht. Er ist Honorarkraft und nicht angestellt, also hat er keinen Urlaubsanspruch – er nimmt sich unbezahlt frei, wenn er mal wegwill.«
»Er hat euch nichts erzählt?«, fragte ich.
Angela schüttelte den Kopf. »Wir stehen uns nicht so nah, Ma’am. Ich meine, ich mag ihn, aber Sie wissen doch, wie es ist, wenn man am College spielt – Bernie hat erzählt, Sie waren im Basketballteam der University of Chicago – du trainierst, du lernst, du quetschst deine Kurse dazwischen. Für Mädchen ist ein Sportstipendium was anderes als bei den Jungs, wir brauchen den Abschluss, wir müssen unsere Kurse ernst nehmen. Nicht, dass mich das stört – ich liebe jedes meiner Fächer –, aber für Familie bleibt da keine Zeit. Und August ist sowieso zurückhaltend. Er hat mich noch nie zu sich eingeladen.«
»Haben Sie seine Telefonnummer?«
Angela nickte. »Er geht nicht ran, reagiert nicht auf SMS. Keine aktuellen Posts bei Facebook oder Twitter.«
»Die Polizei muss doch mehr als das haben«, wandte ich ein. »Nicht nur, dass niemand weiß, wo dein Cousin steckt.«
Angela pulte an einem Nagelhäutchen. »Also, es war wohl kein richtiger Einbruch. Jemand hat alle Türen aufgeschlossen, und August ist die einzige Person mit Schlüssel, die sie nicht finden können.«
»Wie lange ist er schon unerreichbar?«, kam ich der nächsten Tirade von Bernie zuvor.
Angela zog eine Schulter hoch. »Nicht mal das kann ich Ihnen sagen, Ma’am. Ich weiß ja erst seit heute, dass er vermisst wird, und auch nur, weil die Polizei bei mir war, um zu fragen, ob ich weiß, wo er sein kann.«
Ich stand auf, um mehr Licht zu machen. Die einzigen Fenster in dem Lagerhaus, das ich als Büro nutze, sind breite Schlitze direkt unter der viereinhalb Meter hohen Decke. Ich habe den Raum mit Steh- und Wandlampen gespickt, und an einem Novembertag um fünf brauche ich sie alle, um die Düsternis zu brechen.
Keine der beiden schaffte es, mir die Geschichte geradlinig zu erzählen, aber es lief darauf hinaus, dass bei dem Einbruch im Sportstudio Six-Points der Arzneischrank geplündert worden war. Das Studio wurde von sehr vielen Fitnessversessenen frequentiert, von Wochenendkriegern bis zu professionellen Teams, dazu jede Menge Studierende. Es gab dort offenbar einen Bereitschaftsarzt, der Medikamente verschreiben konnte. Weder Angela noch Bernie wusste, was in dem geplünderten Schrank gewesen war.
»Wir nehmen so was nicht«, fauchte Bernie, als ich danach fragte. »Woher sollen wir das wissen?«
Ich seufzte. »Du hättest die Polizei danach fragen können. Oder sie dich. Six-Points muss rezeptpflichtige Mittel dagehabt haben, sonst würden sich die Cops kaum darum scheren.«
»Davon haben sie nichts gesagt.« Angela sprach wieder zu ihren Händen. »Sie haben mich gefragt, wie gut ich August kenne und ob ich weiß, ob er Drogen nimmt, Drogen verkauft – all solche Sachen. Ich hab natürlich nein gesagt.«
»Obwohl du ihn gar nicht gut kennst?«, hakte ich nach.
Da sah sie auf, ihre Augen blitzten. »Ich weiß, wenn jemand auf Drogen ist. Ma’am. Es stimmt, dass ich ihn nicht gut kenne – ich war noch klein, als er zu Besuch war –, aber er hatte eine Spielzeugfarm dabei, die ich ständig verwüstet habe. Abends brachte er seine Tiere ins Bett, erst alle Lämmchen, dann die Kühe, und der Hund durfte beim Farmer im Bett schlafen. So ein Junge stiehlt doch keine Drogen.«
Ich verkniff mir die Anmerkung, dass jeder Dealer mal ein Kleinkind war, das Spielzeug mochte.
Bernie nickte energisch. »Darum musst du August für uns finden. Und schnell, vor der Polizei, sonst sperren die ihn weg und ignorieren die Wahrheit.«
»Die da lautet?«
»Na, dass jemand anders diesen Einbruch gemacht hat, diese Sabotage.« Aufgebracht von meiner Begriffsstutzigkeit warf sie die Arme hoch.
»Das kann sich zu einer großen Ermittlung auswachsen, Bernie. Man muss überall Fingerabdrücke nehmen, mit allen reden, die da arbeiten, und mit der Kundschaft auch. Die Polizei hat Personal und technische Mittel für so was. Ich dagegen hab weder die Ausrüstung noch die Leute, um einen Tatort auszuwerten, selbst wenn die Cops von Evanston mich machen ließen.«
»Aber Vic! Du kannst doch wenigstens ein paar Gespräche führen. Wenn du erst anfängst, Fragen zu stellen, dann winden sie sich und sagen lauter Sachen, die sie erst verheimlichen wollten. Ich weiß, dass du das kannst – ich hab’s schon erlebt. Vielleicht steckt sogar die Studio-Managerin dahinter und will es August anhängen.«
Ich öffnete ein paarmal den Mund und schloss ihn wieder. Ob es die Schmeichelei war oder das Flehen in beiden Gesichtern, ich schrieb mir die Adresse von Six-Points auf, den Namen der Managerin, Augusts Adresse. Als ich Angela nach Augusts Mutter fragte, sagte sie, »Tantchen Jacquelyn« sei vor sechs Jahren gestorben. »Ich glaub ehrlich gesagt nicht, dass er Familie in Chicago hat. Nicht von meiner Seite jedenfalls. Sein Daddy ist vor Jahren im Irak gefallen. Wenn er sonst noch Verwandte hier hat, weiß ich nichts von ihnen.«
Natürlich wusste sie auch nichts über Freunde oder Geliebte oder ob er Schulden hatte. Wenigstens konnte sie seinen Nachnamen beisteuern – Veriden. Obwohl klar war, dass keine der beiden sich mein Honorar leisten konnte, hörte ich mich sagen, ich würde morgen im Studio anrufen und ein paar Fragen stellen.
Bernie sprang auf und fiel mir um den Hals. »Vic, ich wusste, du sagst ja! Ich wusste, wir können auf dich zählen.«
Ich dachte an Sam Spade, wie er zu Brigid O’Shaughnessy sagt, er werde sich für sie nicht zum Hanswurst machen. Warum war ich nicht so hart wie Sam?
2 Fit fürs Leben
Am nächsten Tag hatte ich im Loop einen Termin mit einem Klienten meiner Lieblingssorte, die Rechnungen pünktlich bezahlt und klare überschaubare Fragen hat, daher schaffte ich es erst am späten Nachmittag zum Six-Points-Studio. Entsprechend hatte ich schon ein Dutzend SMS von Bernie, die Ergebnisse forderte, noch ehe ich überhaupt nach Norden aufbrach.
Ich hatte mich telefonisch mit der Managerin Denise LaPorte verabredet und auch die Polizei von Evanston informiert, dass ich an dem Fall dran war. Der zuständige Detective klang nicht, als stünde der Einbruch auf seiner Prioritätenliste. Niemand getötet oder verletzt, der Sachschaden begrenzt.
»Wenn Sie diesen Kerl suchen wollen – wie heißt er noch? August Veriden? – bitte, tun Sie sich keinen Zwang an. Sagen Sie einfach Bescheid, falls Sie ihn finden.«
»Sie sehen ihn als den Einbrecher?«
»Wir würden jedenfalls gern mit ihm reden. Er ist der einzige Angestellte mit Schlüssel, den wir nicht lokalisieren können, also haben wir ihn zur Fahndung ausgeschrieben.«
Ich fragte, was für Drogen fehlten. Und pfiff lautlos durch die Zähne, der Arzneischrank des Studios bot einen ansehnlichen Cocktail – Oxy, Toradol, Vicodin sowie allerlei Zeug, von dem ich noch nie gehört hatte. »Waren das Mengen, für die sich ein Einbruch lohnt?«
Der Detective schnaubte höhnisch. »Haben Sie je einen Junkie erlebt, PI? Der Straßenwert ist denen doch schnurz. Wie leicht da ranzukommen ist – na, das sehen Sie ja, wenn Sie hinkommen. Ist nicht gerade Fort Knox.«
Angemessen gedämpft versprach ich mich zu melden, falls ich was Hilfreiches aufspürte. Wir hegten da beide keine großen Erwartungen.
Als ich zum Six-Points-Studio: Fit fürs Leben kam, war es kurz nach fünf. Das Gebäude war ein gigantisches Lagerhaus. Ein Schild am Eingang warb mit einem Schwimmbecken im Olympiaformat, einem Dutzend Basketballfelder, Yogaräumen, Krafträumen, fünf Restaurants sowie einem separaten Spa-Flügel. Das Schild drängte mich, Mitglied und fit fürs Leben zu werden. Sonderpreise für Studierende. Daneben ein Zettel: 30% Nachlass für jeden, der heute noch beitrat. Es musste nach dem Einbruch einen Haufen Kündigungen gegeben haben.
Das Schild erklärte auch die ›six points‹: Benutz deinen Kopf und dein Herz, um deine vier Gliedmaßen zur Fitness zu treiben.
Eine Kamera überwachte den Haupteingang, aber das Auge war mit einem Stück Kaugummi zugeklebt. Drinnen diskutierte ein Sicherheitsmann vom Format eines Footballspielers mit einer Frau, die Zutritt zum Spindraum verlangte, und zwar sofort! Er sah mich humorlos an und verlangte meine Mitgliedskarte und einen Ausweis mit Lichtbild.
»Waren Sie zur Zeit des Einbruchs hier?«, fragte ich, während die Frau schimpfte, ich könnte mich hier nicht einfach vordrängeln, als ob der Laden mir gehörte.
»Und Sie stellen hier solche Fragen, weil …?«, fragte der Wachmann.
»Weil ich Ermittlerin bin und den Auftrag habe, bei der Untersuchung zu helfen. Denise LaPorte erwartet mich.«
Der Wachmann sah drein, als würde er mich gern packen und in zwei Teile brechen, nur um seinen Frust abzureagieren, aber dann packte er stattdessen das Telefon und holte sich die Genehmigung, mich reinzulassen. »Den Flur lang bis zur hinteren Treppe und rauf in den zweiten Stock. Leicht zu finden – gehen Sie einfach dem Krach nach.«
»Und waren Sie nun zur Zeit des Einbruchs hier?«
»Was für eine Arschlochfrage ist das denn? Natürlich nicht. Wir haben von Mitternacht bis fünf Uhr morgens zu – da ist es passiert.«
Als ich ging, hatten sich zu der wütenden Frau ein paar Männer gesellt, die ebenfalls Forderungen stellten.
Ich kam an Umkleideräumen vorbei. Polizeiliches Absperrband hatte kreuzweise vor den Türen geklebt, aber jemand hatte es runtergerissen.
Kennen Sie die Aufnahmen, die das Fernsehen so gern nach Tornados oder Erdbeben zeigt, wenn Häuser und Möbel über die Landschaft verteilt sind? Genau das sah ich, als ich über die zerrissenen Bänder trat: In der Frauenumkleide war jeder einzelne Spind aufgebrochen. Sporttaschen und Rucksäcke ausgekippt. BHs, Tampons, Wasserflaschen, Badeanzüge, Bonbonpapier, Make-up – alles über Bänke und Boden verstreut. Fingerabdruckpulver hatte sich auf den Kleidungsstücken niedergelassen, sodass sie aussahen wie müde Überbleibsel eines Staubsturms.
Ich trat den Rückzug an und spähte in die Männerumkleide. Die Verwüstung war genauso fürchterlich, nur ohne Make-up. Niemand, der nach Drogen suchte, hätte die Spindräume geplündert. Wobei, ernsthaft Süchtige mochten vielleicht auf Wertsachen oder elektronisches Gerät aus gewesen sein. Konnte eine Person das alles ohne Hilfe in fünf Stunden geschafft haben? Die Verwüstung vielleicht, aber hier waren Hunderte von Spinden geknackt worden. Das sah nach Teamarbeit aus.
Ich machte ein paar Fotos und strebte weiter zur Hintertreppe. Auf dem Weg nach oben verstand ich, was der Wachmann mit ›dem Krach nachgehen‹ gemeint hatte. Das Büro der Managerin war ein kleiner Raum, und er barst vor schreienden Leuten. Ein Mann in einem lila Wildcat-Sweatshirt hämmerte mit der Faust auf den Schreibtisch und verlangte eine Rückerstattung, zwei Frauen schrien etwas von gestohlen, eine dritte wedelte heulend vor Wut mit einer silbernen Sporttasche, aus der das zerrissene Futter heraushing. »Zweihundertfünfundzwanzig Dollar! Das ist ein Stella McCartney-Original. Werden Sie mich entschädigen oder nicht?«
»Ziehen Sie eine Nummer«, fauchte LaPorte mich an, als ich mich zu ihrem Schreibtisch durchquetschte. »Ich kann mich nur mit einer Person zur Zeit befassen.«
»Ich bin V. I. Warshawski, die Ermittlerin – wir haben vorhin telefoniert. Sagen Sie mir, wann ich wiederkommen soll.«
LaPorte presste die Handflächen auf ihre Augen. »Es gibt keinen guten Zeitpunkt. Ich wüsste nicht wann. Das kann den ganzen Abend so weitergehen.«
»Verdammt richtig«, sagte der Mann. »Es geht so lange weiter, bis Sie uns sagen, wie Sie für den Schaden aufkommen.«
Ich stieg auf den Schreibtisch, und es wurde still im Raum. Ich starrte auf die Menge runter. »Hat die Polizei das Absperrband entfernt oder wart das ihr Helden?«
Es gab Gegrummel und dann einen neuen Ausbruch von der Stella McCartney-Tasche, dass ich nicht drum herumkäme, ihr Eigentum zu ersetzen.
Ich versuchte meinen Gesichtsausdruck zu einer Mischung aus Besorgnis und Mitleid anstelle von Verärgerung und Ungeduld zu glätten. »Also wenn Sie das Band abgerissen haben, gibt es keine Möglichkeit mehr zu beweisen, dass Ihr Eigentum von den Vandalen beschädigt wurde, die in die Umkleide eingebrochen sind. Six-Points schätzt Sie als Mitglieder und wünscht keine Rechtsstreitigkeiten, aber die Versicherung wird sich stur stellen, da sich nicht feststellen lässt, ob Sie nicht kaputte Sachen von draußen reingebracht haben, um aus dem Desaster hier Vorteil zu ziehen. Sie können keinen Polizeibericht vorlegen – was Sie müssen, wenn Sie klagen wollen –, weil Sie am Tatort herumgepfuscht haben. Frische Abdrücke über dem Puder sind ja leicht zuzuordnen.«
Die Leute im Raum schienen ein wenig zu schrumpfen, als wehte ein frostiger Wind hindurch, bis auf die Stella McCartney-Frau. Sie war zu aufgeregt für Logik, aber ein Mann, den ich nicht bemerkt hatte – denn er war still gewesen –, nahm ihren Arm und steuerte sie sanft zur Tür hinaus. Der Rest der unglücklichen Sportskanonen folgte ihnen.
Denise LaPorte sackte schwer auf ihren Bürostuhl. Sie war jung, wahrscheinlich Anfang dreißig, und an einem normalen Tag vermutlich eine Pracht – ihre lederbraunen Arme gute Werbung für die Fitnesstrainer des Studios, dazu honigfarbenes Haar, das von Hand zu färben und schimmernd zu halten sicher Stunden dauerte. Heute hatte ihre Haut die Farbe von Kleister und sie graue Ringe unter den Augen. »Das ist das erste Mal, dass es in diesem Raum still ist, seit ich heute Mittag gekommen bin. Ist das wahr, was Sie über die Versicherung gesagt haben?«
Ich sprang vom Tisch und schloss die Tür. »Ich weiß nicht, wie kulant Ihr Management und Ihre Versicherung mit der Klientel umspringen wollen. Aber Versicherungsgesellschaften sind sogar bei Eisenbahnunglücken Trittbrettfahrer gewöhnt.«
Sie sah mich verständnislos an.
»Wenn ein Zug entgleist, kommen mehr Unfallanzeigen rein, als Passagiere im Zug waren. Ihr Versicherungsträger wird wohl nicht für die kaputten Sachen zahlen, mit denen die Leute hier wedeln, aber vielleicht möchte das Studio das übernehmen, als Geste guten Willens. Die Klagen können leicht zum Albtraum werden, also delegieren Sie das Problem zu Ihrem eigenen Schutz direkt an die Rechtsabteilung.«
LaPorte rang sich ein wackliges Lächeln ab. »Danke. Das ist der erste gute Ratschlag, den ich seit drei Tagen bekommen habe.
»Sie sind schwer gebeutelt«, sagte ich, »aber ich muss Sie trotzdem zu August Veriden befragen.«
LaPorte schüttelte den Kopf. »Ich kann Ihnen nicht viel erzählen. Er ist ein ruhiger Typ, ein qualifizierter Trainer – er hat einen Abschluss von der Loyola, die sehr gute Trainerlizenzen vergibt, und er hat unsere Standards immer erfüllt oder übertroffen.«
Ich blinzelte. »Das klingt jetzt irgendwie nach Online-Bewerbungszeugnis.«
Sie errötete. »Ich habe mir seine Personalakte eingeprägt, als ich heute Morgen mit der Polizei und mit der Firmenleitung sprach. Manche Trainer plaudern gern, sodass ich weiß, mit wem sie ausgehen, oder ihre Zahnarztsorgen kenne oder was auch immer, aber August redet wenig. Alle – ich wollte gerade sagen, mögen ihn, aber vielleicht passt respektieren besser. Wir wissen alle, sein Traum ist, Filmemacher zu werden, und er übernimmt private Aufträge für die Leute hier – Hochzeiten, Abschlussfeiern, so was. Ich selbst habe nie mit ihm zusammengearbeitet, ich kann nicht mal sagen, wie gut seine Videos sind.«
»Gibt es in seiner Personalakte persönliche Angaben? Lebenspartner? Nächste Verwandte?«
LaPorte schüttelte wieder den Kopf. »Als die Cops mit ihm reden wollten und er nicht ans Telefon ging, habe ich danach gesucht, aber er hat nur eine Cousine eingetragen, eine Erstsemester-Studentin an der Northwestern.«
Ich zog eine Grimasse. »Sie hat mich beauftragt, ihn zu finden. Sie kennt sonst keine Verwandten.«
LaPorte verschränkte ihre Hände auf der Schreibtischplatte und sah mich ernst an. »Ich weiß, seine Cousine und ihre Freundin, die kleine Eishockeyspielerin –«
»Bernadine Fouchard«, ergänzte ich.
»Die beiden denken, ich hätte der Polizei seinen Namen genannt, weil er schwarz ist, aber mal im Ernst, allein drei der anderen Trainer sind schwarz, einer von ihnen aus Kenia. Hier arbeiten achtundsiebzig Leute, von Pförtnern über Gruppentrainer bis zu Personal Trainern und therapeutischen Masseuren, mit mir sind wir sieben Leute im Management. August ist der Einzige, den wir nicht ausfindig machen können. Ich will ihn nicht anschwärzen, aber das wirkt einfach verdächtig.«
»Wie lange ist es her, dass Sie ihn zuletzt gesehen haben?«, fragte ich.
Sie verzog das Gesicht. »Heut Morgen musste ich noch in meinem Computer nachsehen, aber inzwischen weiß ich es auswendig. Er hat sich vor zehn Tagen abgemeldet, meinte, er bräuchte etwas Auszeit für ein privates Projekt. Das ist alles, was wir hier wissen.«
Ich verdaute das. Wenn er vorgehabt hatte, einzubrechen und die Pharmaka zu klauen, hatte er sich ganz schön Zeit gelassen. »Sie beschäftigen auch einen Arzt, richtig?«
»Oh – Sie denken an den Arzneimittelschrank. Wir haben zwei Ärzte, die die von unseren PTs und Fitnesstrainern begleiteten Rehas und Therapien überwachen, aber sie sind nicht hier angestellt.«
Ich fragte, ob ich den Medizinschrank sehen könnte. Sie stand bereitwillig auf – ich hatte sie vor der Meute gerettet, sie wollte behilflich sein. Als sie die Tür aufmachte, scherzte sie sogar, sie hätte jetzt gern eine Verkleidung.
Im Flur versuchten ein paar Leute sie abzufangen, aber sie verkündete, ich sei Ermittlerin, und sie müsse mir einen Teil des Tatorts zeigen.
Die Tür zum Behandlungszimmer stand offen, war aber ebenfalls mit Absperrbandkreuzen blockiert, diesmal intakt. Ich duckte mich darunter hindurch, um mir den Arzneischrank anzusehen.
»Sollten Sie das wirklich tun?« LaPorte spähte nervös den Flur entlang.
»Ich fasse nichts an«, versicherte ich ihr.
Das Zimmer enthielt einen Schreibtisch und zwei Untersuchungspritschen. Alle Schubladen – im Schreibtisch, unter den Liegen und in den Schränken an der Wand – standen offen. Manche waren von grober Hand auf den Boden entleert, Gummihandschuhe, Tupfer, Reagenzgläser lagen überall im Raum verstreut. Ich pirschte auf Zehenspitzen durch das Gerümpel zum Medikamentenschrank an der Rückwand, der ebenfalls offen stand, und ging in die Hocke, um mit meiner Taschenlampe das Schloss zu beleuchten. Es war nicht aufgebrochen, aber ob jemand einen Schlüssel gehabt oder geschickt mit Picks hantiert hatte, konnte ich nicht sagen.
Die deckenhohen Borde hatten alles von Stützbändern bis zu Plastikboxen mit sortierten Arzneien enthalten. Ich beleuchtete die Etiketten – rezeptfreie Schmerzmittel und eine aufsehenerregende Kollektion verschreibungspflichtiger Substanzen. Rollen elastischer Binden waren abgewickelt und quollen in dehnbaren Spiralen über die Kanten der Borde wie Nester fleischfarbener Vipern.
Ich gesellte mich wieder zu LaPorte in den Flur. »Haben die Trainer Zugang zu den pharmazeutischen Beständen?«
»Nur die Ärzte und der Pfleger, der Bereitschaft hat. Was glauben Sie, was hier vorgeht?« LaPorte zog nervös an ihren glatten Haaren.
»Ich glaube, dass Ihre Ärzte die Kunden ernstlich übermedikamentieren.«
Ihr stand der Mund offen. »Was hat das mit dem Einbruch zu tun?«
»Kann ich nicht sagen. Das müsste sich die Polizei näher ansehen – die haben Leute und können alle befragen, die die Ärzte behandelt haben, oder nachtragende Exmitglieder, oder Eltern, die finden, ihre Kinder sind geschädigt worden. Vielleicht haben die Ärzte auch gar nichts damit zu tun – vielleicht waren es Junkies, die sich an einem Vorrat bedient haben, wo man leicht rankommt. Sie haben achtundsiebzig Angestellte mit Schlüsseln, das bedeutet –«
»Nein, nur achtzehn Leute haben Schlüssel. August hat einen, weil er einmal pro Woche aufmacht – wie alle Trainer, weil sie turnusmäßig die Fünfuhrschicht übernehmen. Und dann noch ich und die anderen –«
»Achtzehn sind eine Menge Schlüssel«, unterbrach ich. »Leicht weiterzugeben, selbst wenn sie sich nicht einfach nachmachen lassen. Aber solange der Schlüssel zur Eingangstür nicht auch zum Arzneischrank passt, votiere ich gegen die Junkievariante. Wer voll drauf ist oder am Runterkommen und nach einem Schuss jiepert, stemmt Schlösser eher auf, als sie raffiniert zu knacken.«
»Was soll ich tun?« LaPortes Stimme kippte vor Überforderung.
»Holen Sie sich von der Polizei eine Freigabe für die Umkleiden. Fotografieren Sie alles, damit Sie Beweise für Ihre Versicherung haben, dann bestellen Sie ein Putzteam. Die Polizei wirkt nicht besonders eifrig, da niemand verletzt wurde, selbst die Verwüstung ist kein dramatisches Eigentumsdelikt. Ich glaube kaum, dass die sich querstellen. Schade, dass Sie nicht wissen, wo August ist – er könnte das alles prima auf Video aufnehmen.«
3 Dekonstruktion eines Filmemachers
Als ich mit Denise LaPorte im Six-Points durch war, war ich zu müde für alles außer nach Hause fahren und in der Badewanne kollabieren. Ich hörte die Pings, die eingehende Textnachrichten anzeigten, aber für eine halbe Stunde lag ich komatös im Bad und rührte mich nur, um heißes Wasser nachzulassen, wenn die Wanne abkühlte.
Schließlich brachten mich die Hunde, die ich mir mit meinem Nachbarn von unten teile, wieder auf die Beine. Sie kratzten winselnd an der Badezimmertür. Mr. Contreras ist über neunzig, und auch wenn er nie zugeben würde, dass er nicht mehr die Kraft hat, mit Mitch und Peppy lange Runden zu drehen, musste er sie in meine Wohnung gelassen haben, als kleinen Hinweis, dass sie Auslauf brauchten.
»Okay, Kinder, schon gut«, murmelte ich beim Abtrocknen. Ich zog Jeans und ein dickes Sweatshirt über, Laufschuhe, leinte die Hunde an und nahm sie mit zu einer schnellen Joggingrunde im nahen Park.
Die Tennisplätze waren leer, aber strahlend beleuchtet, falls irgendein Enthusiast an einem kalten Herbstabend Lust auf ein Spiel bekam. Während die Hunde Bälle um den Platz jagten und Dampf abließen, checkte ich meine Textnachrichten. Fünf waren von Bernie, die unbedingt Neues über August erfahren wollte. Sie war in etwa so taktvoll wie Mitch und genauso beharrlich, kratzte und winselte an meiner In-Box.
Ich probierte Augusts Telefonnummer – ich hatte sie in meine Kurzwahlliste eingegeben und es über den Tag immer mal wieder versucht. Wie zuvor bekam ich auch diesmal eine blecherne Stimme, die erklärte, dass er nicht erreichbar und seine Mailbox voll war.
Die Polizei ist nicht besonders interessiert, textete ich an Bernie und Angela. Sieht aus, als hätte der Einbruch nichts mit August zu tun, aber es wäre trotzdem gut, wenn er auftaucht.
Natürlich rief Bernie sofort an und Angela eine halbe Stunde später. Ich vertröstete beide auf den nächsten Tag, wenn ich bei seiner Wohnung gewesen war. »Ich versuche Freunde oder Nachbarn zu finden, mit denen er geredet hat.«
Ich zog mich um, Seidenhemd und Wollcape, und ging ins Golden Glow, die Bar, in der ich in letzter Zeit viel zu oft herumsaß. Ich brauchte die Wärme von Sal Bartheles Tiffanylampen und die Weichheit ihres Whiskys, aber mehr noch ihre bissige Freundschaft.
Am nächsten Morgen kam ich zu spät zu Augusts Wohnung. Mein einziger Trost war, dass ich sogar dann zu spät gekommen wäre, wenn ich mich gestern Abend noch aufgemacht hätte.
August bewohnte ein Einzimmerapartment an der Buckingham in einem Gebäude mit Innenhof, sechs Eingänge, drei Stockwerke, kein Portier. Ich klingelte, wartete eine Minute, drückte gut dreißig Sekunden auf die Klingel, wartete wieder, aber auch auf ein drittes Klingeln kam keine Reaktion.
Es gab einen semi-ansässigen Hausmeister – er wohnte im Erdgeschoss des Flügels gegenüber, aber er betreute auch noch ein anderes Haus um die Ecke. Ich wusste das, weil ich dank meines überragenden Spürsinns die Notiz am Außentor bemerkt hatte, die verriet, wo Jorge Baros zu finden war, wenn er sich nicht im Gebäude aufhielt.
Ich rief die Handynummer auf dem Zettel an und erklärte, ich sei Ermittlerin und hätte Fragen zu August Veriden. Baros steckte mitten in einer Klempnerkrise.
»Ich bin sehr besorgt wegen Mr. Veriden«, sagte er, »aber hier läuft Wasser durch zwei Stockwerke. Warten Sie auf mich, ich komme so schnell, wie ich eben kann.«
Ich setzte mich auf die Betonstufe vor dem Eingang. Ich beantwortete E-Mails und Textnachrichten, stand aber schnell auf, als in Augusts Treppenhaus ein junger Mann erschien. Er war Mitte zwanzig, dunkles Haar hing glatt über seine Stirn und ein loser Schlips am Kragen eines königsblauen Hemdes. Mit einer Hand aß er einen Bagel, hielt in der anderen einen Campingbecher, hatte eine Aktentasche unter den Kaffeearm geklemmt und versuchte mit der Bagelhand die Tür zu öffnen.
Ich hielt sie ihm auf. »Ich bin Ermittlerin und suche August Veriden. Kennen Sie ihn?«
Er schluckte, versuchte zu sprechen, musste etwas Kaffee nachschütten und sagte dann mit belegter Stimme: »Nicht direkt.«
»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«
»Kann das warten? Ich komm zu spät zur Arbeit.«
»Tja, genau wie August. Er war seit über einer Woche nicht da. Wir versuchen ihn zu finden.«
»Sie und an die zwanzig andere.«
»Wie das?«
Er verputzte vollends seinen Bagel, leckte sich Frischkäse von den Fingern und nahm die Aktentasche in die Bagelhand. »Er wohnt über mir, ich kann es hören, wenn jemand da ist. Er ist ein netter Typ, aber ein Einzelgänger. In den letzten paar Tagen hatte er mehr Besuch als das ganze Haus zusammen. Jetzt muss ich aber los.«
Er eilte die Straße runter, der Schlips flatterte über seine Schulter.
Ich rannte hinterher. »Ich bring Sie bis zu Ihrer Bahn oder zum Auto oder was immer. Es ist wichtig. Von welchen Tagen reden wir hier? Gestern Abend? Vorgestern?«
An der Ecke Broadway blieb er stehen und hob den Arm nach einem Taxi. Wie von Zauberhand tauchte prompt eins auf, was ihn so weit beruhigte, dass er einen Augenblick innehielt, die Hand an der offenen Wagentür. »Ich dachte mir schon, das könnte was Ernstes sein. Ich hab zu – ähm, zu der anderen Person in meiner Wohnung gesagt, wir hätten die Polizei rufen sollen, bloß kann man sich ja nicht über die Partys anderer Leute beschweren, sonst drehen sie nächstes Mal den Spieß um, und August ist normalerweise der leiseste Mensch auf Erden.«
»Aber wann war das?« Ich versuchte nicht zu kreischen. »Gestern Abend? Am Abend davor?«
Er dachte kurz nach. »Drei Tage her. Gestern war ich arbeiten, aber ein Typ bei uns im Haus meinte, die Cops wären da gewesen.«
Er stieg ins Taxi und zog auf meine Frage nach dem Namen des Typs, der ihm von der Polizei erzählt hatte, die Tür zu.
Ich rannte zurück zur Buckingham. Jorge Baros war noch nicht eingetroffen. Als ich wieder anrief, sagte er, er sei immer noch landunter, würde aber so schnell wie möglich kommen.
Nach dem Prinzip, mehr mitschleppen als nötig ist besser als fluchen, weil das entscheidende Werkzeug fehlt, hatte ich meine Picks dabei. Mit der Haustür brauchte ich mich nicht abzumühen – ich hatte sie am Einschnappen gehindert, als sie hinter dem Bagelesser zufiel –, und Augusts Wohnungstür erwies sich als erschreckend durchlässig, weil sie gar nicht verschlossen war.
Bis vor drei Tagen war seine Wohnung wahrscheinlich hübsch gewesen, spärlich möbliert mit wenigen guten Stücken, soweit ich das noch ausmachen konnte unter umgestürzten Pflanzen, CDs und DVDs und aus dem Holzschrank gefegtem Geschirr.
Die Verwüstung fühlte sich an wie eine Schockwelle. Angelas Beschreibung ihres Cousins: der kleine Junge, der sorgsam seine Farmtiere zur Nacht bettet. Nicht schön, gar nicht schön.
Ich stieg auf Zehenspitzen durch das Chaos, um in die Kochnische zu spähen. Die gewalttätigen Hände hatten Reis und Pasta auf der Arbeitsplatte ausgekippt. Ameisen durchsuchten auf dem Boden gelandete Lebensmittel.
In der kleinen Schlafkammer war die Matratze zerschlitzt, das Bettzeug lag zusammengeknüllt im Türrahmen. Terrassentüren führten vom Bett auf einen schmalen Balkon, wo umgestülpte Töpfe mit noch ganz kleinen Sonnenblumen und Tomaten lagen. Die Blumen lebten noch, zehrten von der Erde, die rings um sie gelandet war, aber die Tomaten schwächelten.
Ich suchte nach jeder Art von Hinweis, wohin oder wann August aufgebrochen war. Ich knipste mit meinem Telefon Nahaufnahmen von einzelnen Segmenten der Zerstörung sowie das Gesamtchaos. Ich fing im Schlafzimmer an, dann kam der Balkon dran, dann das Wohnzimmer.
Als ich ein paar hundert Aufnahmen hatte, kehrte ich ins Schlafzimmer zurück und entfaltete das Bettzeug über der aufgeschlitzten Matratze. Keine Blutflecken, auch nicht auf dem Boden oder an Möbeln. Nicht, dass ich immer Luminol und eine UV-Lampe bei mir hätte, aber hier war niemand Subtiles am Werk gewesen, so wenig wie in Evanston.
Laut Bernie und Angela wollte August Filme machen. Ich sah keine Kameras oder Laptops, aber das musste nichts heißen, die Einbrecher konnten sie entwendet haben, August konnte damit unterwegs sein, sogar die Cops konnten sie eingesackt haben, der Bagelesser meinte ja, sie seien gestern vorbeigekommen.
Ich sah mich um. War die Polizei wirklich hier gewesen? Kein Absperrband, nichts vom verräterischen silbrigen Staub einer Fingerabdrucksuche.
Ich ging in die Hocke. Es musste hier doch irgendwas geben, womit ich etwas anfangen konnte. August besaß neben CDs und DVDs auch Bücher. Es schien unangebracht, mich ums Verfälschen von Spuren zu sorgen, aber ich wollte ungern selbst Fingerabdrücke hinterlassen. Mit dem Ärmel über der Hand hob ich Bücher an und schüttelte sie, um zu sehen, ob nützliche Notizen herausrutschten, dann schloss ich sie und stellte sie zurück ins Regal. Er hatte eine solide Sammlung schwarzer Schriftsteller/innen: James Baldwin, Lorraine Hansberry, Malcolm X, Ta-Nehisi Coates, Angela Davis …
Mein Handy klingelte. Ich sprang auf, hoffte auf den Hausmeister, aber es war nur Bernie. Ich schickte sie auf die Voicemail, aber ihr Anruf erinnerte mich daran, nachzusehen, ob August altmodisch genug für einen Festnetzanschluss und einen Anrufbeantworter war.
Ich fand keine Anschlüsse oder rausgerissenen Kabel: Wie in seiner Generation üblich, erledigte er wohl alles via Sendemast. Dann entdeckte ich ein Skizzenbuch. Ich berührte es nicht mit den Händen, hob aber einige Seiten mit einem Küchenmesser an. Es schien eine Art Künstlertagebuch zu sein, in dem August Ideen für Geschichten notiert und Entwürfe für Sets gezeichnet hatte.
In einer der offenen Küchenschubladen stieß ich auf eine Mülltüte und schob das Skizzenbuch hinein. Ich nahm auch ein paar unbeschriftete DVDs mit in der Hoffnung, sie könnten Augusts eigene Videos enthalten. Vielleicht hatte er etwas Gefährliches gefilmt, und die Täter waren deshalb hinter ihm her, erst im Studio, dann in seiner Wohnung. Vielleicht waren es auch aufregende Mitschnitte von Hochzeiten und Bar-Mizwas. Die konnte ich auf Bernie und Angela abwälzen – dann hatten sie was zu tun, statt mich zu nerven.
Als ich einen letzten Rundgang machte, hielt ich inne und sah mir die gerahmten überdimensionalen Filmposter an den Wänden genauer an. Oscar Micheaux nahm mit einem Plakat von Within Our Gates den Ehrenplatz überm Bett ein. Ihm gegenüber hing Ousmane Sembènes Black Girl. Ich kniff die Augen zusammen, um durch die spiegelnde Glasoberfläche das Papier zu betrachten – die Plakate sahen nach Originalen aus, aber neben Luminol fehlte mir auch die Ausrüstung zur Papieranalyse. Und die Kompetenz.
Kasi Lemmons und Gordon Parks hingen im Wohnzimmer. Gegenüber der Wohnungstür prangte Emerald Ferring in Pride of Place. Ihr Porträt mit reservierter Miene nahm fast das ganze Poster ein, dazu gab es seitlich ein kleines Bild von ihr in Gefängniskleidung, wohl aus einer Szene des Films. Das Plakat unterschied sich von den anderen: Es war signiert. August, ich glaube an dich. Glaub an dich selbst! hatte sie in kleinen Schönschrift-Buchstaben geschrieben und dann ihren Namen mit einem Abschwung, der den ganzen unteren Bildrand füllte. Ich hatte noch nie von Emerald Ferring oder Pride of Place gehört, aber das hieß gar nichts, ich bin keine Expertin für populäre Kultur wie Alan Banks oder John Rebus.
Die verwüstete Wohnung untergrub mein Selbstvertrauen: kein Luminol, keine Papieranalyse, keine Ahnung von populärer Kultur. Es musste doch was geben, worin ich gut war.
Jorge Baros, der Hausmeister, kam, als ich aus dem Gebäude trat. Er war ein großer magerer Mann mit dem edlen Gesicht eines afghanischen Windhunds. Unpassenderweise folgte ihm ein kleiner weißer Terrier, der an meinen Hosenbeinen schnüffelte, sich aber auf ein Handzeichen von Baros hinsetzte.
Der Hausmeister wusste von der Verwüstung in Augusts Wohnung – er war es, der die Polizei angerufen hatte. »Und zwar gestern. Warum kommt erst heute eine Ermittlerin?«
»Ich bin Privatermittlerin, nicht von der Polizei.«
»Ah, privat. Jemand hat Sie beauftragt, dieses Verbrechen aufzuklären?«
»Jemand hat mich gebeten, August Veriden zu suchen. Von dem Einbruch wusste ich nichts, bis ich herkam. Es sieht nicht so aus, als hätte die Polizei gestern viel unternommen.«
Baros spuckte aus. »Die Polizei hat gar nichts unternommen. Die wollten nur wissen, ob Mr. Veriden oft Streit mit seinen Liebschaften hat. Ich habe gesagt, er ist immer sehr leise, überhaupt kein Typ, der laut wird. Und immer sehr ordentlich. Wenn ich in seine Wohnung komme – das tue ich nur, wenn es ein Problem gibt, ich spioniere nicht, glauben Sie mir, aber manchmal muss ich einen Heizkörper entlüften oder einen Kühlschrank reparieren –, ist immer alles picobello aufgeräumt. Die Blumen – da bricht mir das Herz. Er liebt seine Blumen, sie bringen Freude in seine Wohnung. Er weiß, dass es meiner Frau nicht gut geht, und hat mir schon oft Blumen für sie gebracht. Was ist mit ihm passiert? Man hat ihm doch nichts angetan, oder?«
Ich breitete die Arme aus, die internationale Geste für keine Ahnung. »Am Abend vor Halloween gab es einen Einbruch mit Vandalismus in dem großen Sportstudio in Evanston, wo er arbeitet. Die Polizei verdächtigt ihn des Arzneimitteldiebstahls, aber seine Wohnung sieht aus, als hätte jemand was gesucht.«
»Er würde keine Drogen stehlen. Er ist hundert Prozent redlich.« Baros sprach das h betont hart, wie meine Mutter es getan hatte – die leichte Unsicherheit romanischsprachiger Menschen, wann es im Englischen weggelassen und wann gehaucht wird.
»Er ist vor etwa zehn Tagen verschwunden, und niemand weiß wohin«, sagte ich. »Hat er eine Beziehung oder Freunde im Haus oder in der Nachbarschaft, mit denen er reden würde?«
Baros schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht alles über die Mieter – es sind sechsunddreißig Wohnungen hier. Aber wir, meine Frau und ich, wohnen gegenüber, also sehen wir seinen Eingang häufiger als andere, und meine Frau, sie sorgt sich um August, dass er zu einsam ist. Er ist so höflich, so gutherzig, einer der wenigen, die wissen, dass sie Strahlentherapie bekommt. Er hat sich ein paarmal für uns um Rosquilla gekümmert.« Er zeigte auf den kleinen Terrier, der beim Klang seines Namens einmal bellte.
»Kann ich mit Ihrer Frau reden? Vielleicht hat August ihr etwas anvertraut.«
Baros’ Frau war bei der Arbeit, trotz ihrer Krebstherapie, aber er versprach, sie zu fragen und mich anzurufen.
»Sie haben nicht gesehen, wer da eingebrochen ist, oder?«, fragte ich.
»Wir sind um zehn im Bett, also ist es später passiert. Als ich die Zerstörung in Mr. Veridens Wohnung gesehen habe, habe ich den Eigentümern gemeldet, dass sie bessere Schlösser einbauen müssen, Kameras, eine Alarmanlage, aber das kommt zu spät, um Mr. Veriden zu schützen.«
Ich schüttelte ihm die Hand und überließ ihn dieser melancholischen Betrachtung. Sein Handy klingelte, als ich ging, und er rief mir nach, ich solle warten – es war seine Frau, sie hatte Mittagspause.
Er sprach Spanisch, erklärte, dass una detective nach Señor Veriden fragte. Danach verlor ich den Faden, verstand nur noch das »Sí, sí, sí«, das er ab und an einwarf.
Als er auflegte, schüttelte Baros traurig den Kopf. »Sie wusste nichts davon, dass er weg wollte. Er ist so ein netter junger Mann. Wir möchten uns nicht vorstellen, dass ihm etwas zugestoßen ist.«
4 Schuss ins Blaue
Obwohl ich August nicht kannte, wollte ich auch nicht, dass ihm etwas zugestoßen war. In seine Wohnung war ich teils gegangen, um Bernie zu beruhigen, und teils, weil mich das, was ich im Sportstudio vorgefunden hatte, verblüffte.
Jetzt allerdings war ich nicht bloß verblüfft, sondern ernstlich besorgt. In Romanen gibt es dieses Klischee vom unauffälligen Serienmörder oder Drogenhändler, der sich still abseits hält: So ein netter Junge, so aufmerksam gegenüber meiner Frau, man würde nie darauf kommen, dass er ein Dutzend Leute zersägt und verbuddelt hat. Wir hätten nie gedacht, dass er der Kopf eines Kartells ist. Im Roman wäre August genau so jemand – ruhig, achtsam, nach außen ordentlich, innerlich ein rasender Psychopath. Da dies das wirkliche Leben war oder zumindest so nah dran, wie ich dem kommen konnte, fand ich diese Version extrem abwegig. Sagen wir ruhig weltfremd.
Ein kalter Nieselregen setzte ein und zwang mich, die letzte Viertelmeile nach Hause zu rennen – Parkplätze waren in Augusts Viertel dermaßen rar, dass ich die zwei Meilen von meiner Wohnung lieber gelaufen war. Nichts klärt den Kopf so gründlich wie körperliches Unbehagen. Als ich trockene Sachen am Leib und mir einen Espresso gemacht hatte, rief ich einen Detective an, den ich im Sechsten Bezirk kannte.
Terry Finchley und ich haben eine lange Vorgeschichte. Wir respektieren einander sehr und trauen einander nicht ganz. Bei ihm ist das der generelle Cop-Vorbehalt gegen Privatermittlerinnen, noch verschärft durch seine enge Freundschaft mit einem Cop, mit dem ich mal was hatte: Terry findet, ich habe mich Conrad Rawlings gegenüber schlecht benommen, denn Conrad wurde angeschossen, als er bei einem meiner Fälle mitmischte. Trotzdem war Terry einer der wenigen ranghohen Polizisten, denen ich vertraute. Er war außerdem Afroamerikaner und hatte vielleicht etwas Einfühlungsvermögen für Augusts Situation.
Ich hinterließ eine Kurzfassung der Sachlage auf seiner Mailbox. »Momentan behandeln deine Kollegen in Evanston das ohne Priorität, aber ich möchte August nicht im Fadenkreuz sehen, wenn sie plötzlich finden, dass es doch wichtig ist. Ich fänd’s gut, wenn die Spurensicherung die Trümmer in Augusts Bude pudern und die Ergebnisse mit denen vom Sportstudio-Einbruch in Evanston abgleichen würde.«
Inzwischen waren die Hunde die Treppe raufgekommen, hocherfreut, mich mitten am Tag zurückzuhaben. Ich tätschelte sie abwesend. Ich brauchte jemanden, der August besser kannte als Bernie und Angela. Ich hatte ihn durch meine Spezialsuchmaschinen laufen lassen – die verschafften mir Zugriff auf Justiz- und Finanzdaten, den Leute wie ich eigentlich nicht haben sollten. Aber weder LifeStory noch DataMonitor lieferten wesentlich mehr, als Angela berichtet hatte. August hatte an der Jesuiten-Uni Loyola Sport und Film studiert, er arbeitete auf Stundenbasis für Six-Points, er war Waise, sein Vater im Golfkrieg gefallen, und seine einzige Verwandtschaft war Angelas Familie unten in Louisiana. Sein Bankkonto war bescheiden. Aber hier: Vor zwölf Tagen hatte er einen Barscheck über viertausend Dollar eingelöst.
Ich pfiff leise. Auch wenn man damit nicht mehr so weit kam wie früher, war das ein hübsches Bündel Bargeld. Keinerlei Hinweis, wo es herkam. Vielleicht war ihm eine spektakuläre Videoaufnahme von einer heiklen Trapezmuskelstellung gelungen.
Beide Suchmaschinen erwähnten Augusts Filmarbeiten und seine Webseite ›SpectralVision‹ mit dem Slogan: Filmen heißt Ideen drehen, bis ihr Geist sich erweist. Ich klickte auf den Link und fand Clips von einigen seiner Arbeiten – Hochzeiten, oft von schwulen oder lesbischen Paaren, Erstkommunionen und Bar-Mizwas, dazu Ausflüge in den künstlerischen Kurzfilm, wie er heute beliebt ist, mit ominösen Erscheinungen und Leuten auf der Flucht vor gesichtslosen Schrecken, zu grauenhaft, um sie ins Bild zu setzen. Nichts dabei, was nach einem Viertausend-Dollar-Scheck aussah.
Sein Publicity-Foto war eine arrangierte Aufnahme, auf der er sich in einer Reihe von Spiegeln anstarrte. Sie zeigte ihn im klassischen Jungfilmer-Outfit: schwarzer Rollkragen, schwarze Lederjacke, Bluejeans. Sein Gesicht war rund, mit vollen Wangen und tiefliegenden ernsten Augen. Ich kopierte das Foto in meine Bildergalerie.
»August, ich glaube an dich«, hatte Emerald Ferring ihm auf sein Poster geschrieben. Ich befragte mein Smartphone, was es über Ferring oder Pride of Place wusste. Der Spielfilm war von 1967, von Jarvis Nilsson, einem schwarzen Regisseur, von dem ich auch noch nie gehört hatte. Pride of Place war nur in einer Handvoll Programmkinos in Harlem, Bronzeville und anderen schwarzen Vierteln gelaufen, bevor er in der Versenkung verschwand.
Ich scrollte mich durch die Zusammenfassung des Plots. Ferring spielte eine junge Frau, aufgewachsen in einer wohlhabenden schwarzen Enklave in Cape Cod. Es ist 1964, der Sommer der Freiheit, und sie ist eine Erstsemesterstudentin in Vassar, die gegen den Willen ihrer Eltern als Aktivistin nach Mississippi geht. Bei einem Bürgerrechtsprotest wird sie verhaftet. Ihre Eltern stellen die Kaution und versuchen sie nach Hause zu holen, aber sie besteht darauf, mit den anderen Gefangenen in Haft zu bleiben. Nach der Entlassung lernt sie einen armen Farmpächter kennen und wird Zeugin seiner Ermordung durch den Klan. Am Ende des Films verlässt sie Vassar nach einer hitzigen Auseinandersetzung mit ihren Eltern und dem Collegepräsidenten und geht wieder nach Mississippi, um eine Freedom School mit aufzubauen.
Wikipedia hatte über Ferring nicht viel zu bieten. Auch meine gebührenpflichtigen Suchmaschinen nicht, aber sie verrieten mir, dass sie 1944 in Fort Riley in Kansas geboren war. Wie sie Nilsson kennengelernt hatte, blieb lückenhaft, aber sie hatte nach Pride of Place noch zwei Filme mit ihm gedreht, die ebenfalls nach wenigen Aufführungen von der Bildfläche verschwanden.
Ihr heutiger Wohnsitz war Chicago, wo sie sich im Zuge der Dreharbeiten an Lakeview niedergelassen hatte, einer Serie, die nach einem kaum verhohlenen Abklatsch von The Jeffersons klang. Der Titelsong hieß »Moving On Up to the North Side«. Ich fragte mich, wie viele Rechtsstreitigkeiten das wohl nach sich gezogen hatte.
Ferring hatte August mit einer persönlichen Widmung bedacht, vielleicht hatte er ihr auch seine Träume und Pläne anvertrauen dürfen. Vielleicht hatte er ihr sogar erzählt, wo er hinwollte. Es war ein Schuss ins Blaue, aber ich hatte gerade keine besseren Ziele zur Hand.
Ferring wohnte in der Ninety-sixth Street im Stadtteil Washington Heights, ein paar Blocks entfernt von der Kirche, in die Barrack ging, als er noch State Senator war.
Mein Terminplan war bis zum Nachmittag leer, dann musste ich vor Gericht, um in einem Betrugsfall auszusagen, es ging um eine Lagerhausmasche, die ich hatte aufdecken helfen. Ich konnte runter zur Ninety-sixth Street fahren und es dann noch zum Gerichtstermin schaffen, wenn ich zuerst ins Büro raste und mir die Fallakten holte. Schnell schlüpfte ich in meine Gerichtssaal-Kluft, einen streng geschnittenen Anzug aus ultrafeiner Wolle, aber als ich Schlüssel und Laptop in der Aktentasche verstaute, musste ich an das reservierte, erhabene Gesicht auf Augusts Plakat denken. Das Bild mochte fast fünfzig Jahre alt sein, aber Ms. Ferring sah mir nicht aus wie eine Person, bei der eine x-beliebige Detektivin unangemeldet hereinschneien konnte.
Meine Datenbanken hatten Ferrings ungelistete Rufnummer ausgegraben. Ein Mann mit einer tiefen, sanften Stimme meldete sich nach dem fünften Klingeln. Als ich mich vorstellte und fragte, ob ich Ms. Ferring sprechen könnte, wurde die tiefe Stimme kalt. »Was verkaufen Sie?«
»Nichts«, sagte ich. »Ich bin Privatermittlerin –«
Er legte auf. Ein Sohn? Ein Butler, dessen Job es war, Ferrings Privatsphäre zu schützen?
Ich versuchte es noch mal. Diesmal landete ich direkt auf dem Anrufbeantworter. Nur Ansage, keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Ich knirschte mit den Zähnen. Wenn die Götter des Verkehrs auch nur das kleinste bisschen Anstand hatten, konnte ich eine Stunde mit Ms. Ferring oder ihrem Wachhund verbringen und immer noch pünktlich vor Gericht erscheinen. Ich vergewisserte mich, dass das Schminkzeug in der Aktentasche war, fuhr schnell die Akte holen und schaffte die fünfzehn Meilen bis zu Ferrings Wohnort in atemberaubenden siebenundvierzig Minuten. Geschwindigkeitsrekord für diese Tageszeit.
Ferring wohnte in einer Straße mit kleinen Häusern und ordentlichen Gärten. Die Bäume warfen ihre Blätter ab, doch die meisten Leute hier hatten ihre Rasen geharkt. Halloween-Dekoration ließ hier und da Geisterfinger von den Büschen tropfen, Ferrings Eingang war wie der ihrer Nachbarn mit Chrysanthemen in Töpfen gesäumt. Ihr Haus war ein bisschen größer als die anderen in der Siedlung, aber nicht protzig.
Niemand kam an die Tür, überhaupt fühlte sich das Haus hinter den blickdichten Gardinen leer an. Leere Häuser wirken irgendwie abgewandt, als ob sie sich von der Welt zurückziehen, wenn keine Leute drin sind.
Auf der anderen Straßenseite näherte sich eine ältere Frau mit einem Dackel. Der Hund verbellte ein Eichhörnchen, das ihn von einem Baum herab verspottete, aber die Frau starrte mich mit offener Neugier an. Weiße Frau in schwarzem Viertel, was hatte ich hier zu suchen?
Ich ging rüber und stellte mich vor. »Ich hoffte, mit Ms. Ferring sprechen zu können. Sie wissen nicht zufällig, ob sie bald zurück ist, oder?«
Die Frau kräuselte die Lippen. »Wollen Sie ihr was verkaufen, vielleicht sandigen Zement für ihre Auffahrt?«
»Sind hier so viele Trickbetrüger unterwegs?«, fragte ich. Ein nervtötender Teil des modernen Lebens: falsche Klinkenputzer, die sich an ältere Leute heranmachen. Das erklärte womöglich auch die Kälte des jungen Mannes, der sich an Ferrings Telefon gemeldet hatte.
»Und Sie gehören wohl nicht dazu.« Ihr Mund verzog sich noch spöttischer.
»Ich bin Privatermittlerin.« Ich gab ihr eine meiner Karten. »Ein junger Mann, ein Möchtegern-Filmemacher, ist verschwunden. Er ist ein Einzelgänger ohne Familie, und ich kann niemanden auftreiben, der weiß, wo er ist. Ich weiß, dass er einen guten Eindruck auf Ms. Ferring gemacht hat, und ich hoffe, er hat ihr erzählt, wo er hinwollte.«
»Hat dieser junge Filmemacher auch einen Namen?«
Ich zog mein Handy und zeigte ihr Augusts Bild. »August Veriden.«
»Und was, glauben Sie, will er von Ms. Ferring? Sie ausnehmen?« Der geringschätzige Flunsch ihrer Lippen verstärkte sich.
Erst legte der Kerl mit der tiefen Stimme einfach auf, und jetzt das. So langsam fragte ich mich, ob August sich in Ferrings Haus versteckte und die Nachbarschaft ihn vor Amtsträgern beschirmte, oder auch nur vor einer aufdringlichen Weißen. Aber dazu müsste er wohl in etwas verwickelt sein, was vor den Einbrüchen im Studio und in seiner Wohnung lag.
Der Hund knurrte und winselte, zerrte an der Leine, während das Eichhörnchen tschack-tschack-tschack-Geräusche von sich gab: Ich bin hier oben, und du kannst mir gar nichts. Meine Sympathien waren auf Seiten des Hundes.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich kann Ihnen nicht mehr sagen als das: Ich bin beauftragt, ihn zu suchen, und ich finde niemanden, der ihn kennt. Mit Ms. Ferring zu reden ist meine letzte Hoffnung. Ist sie krank oder nicht in der Stadt, dass sie nicht ans Telefon geht?«
»Haben wir nicht ein Recht auf Privatsphäre, wo niemand zudringliche Fragen stellt?«, rief die Frau indigniert.
»Ach, so klingt das für Sie? Ich habe kein Interesse an Ms. Ferrings Tun und Lassen, aber dem jungen August Veriden könnte ein Verbrechen angehängt werden, das er meiner Meinung nach nicht begangen hat. Die Polizei hat ihn zur Fahndung ausgeschrieben, jeder kann ihn anschwärzen. Ich würde ihn gern zuerst finden. Wenn Sie mir nicht helfen können, drücke ich jede Klingel in der ganzen Straße. Irgendwer wird mir schon was erzählen.«
Die Frau sah auf ihren Hund hinab, zog an seiner Leine, blaffte »Poppy« an, still zu sein. Poppy grinste zu ihr hoch und kläffte weiter.
»Sie reden am besten mit Troy«, sagte sie zu mir, die Lippen grimmig zusammengepresst, weil sie sich hatte weichklopfen lassen. »Troy Hempel.« Sie zeigte auf das Haus neben Ferrings. »Er ist schon als Kind für Ms. Ferring einkaufen gegangen, er ist ihre Vertrauensperson, mit Vollmacht und allem. Er ist jetzt bei der Arbeit – nur seine Mutter ist zu Hause. Er ist Computerspezialist bei einer Bank in der Innenstadt.«
5 Designerbier
Troy Hempel kam eine halbe Stunde zu spät ins Golden Glow, aber das störte mich gar nicht. Es war ein langer Tag gewesen. Ich war froh über die Chance, mal abzuschalten, einen kleinen Whisky zu schlürfen und mit Sal zu plaudern. Sie stupste mich an, als Hempel hereinkam – als gute Barfrau hatte sie auch mitten in einer Anekdote über den 103. Geburtstag ihrer Großmutter den ganzen Raum im Blick.
Gesicht und Körper meines eigenen Computerspezialisten sind rund und weich wie bei einer Putte, jedenfalls wirkt er wie jemand, dessen einziges Training der Gang vom Schreibtisch zur Kaffeemaschine und zurück ist. Troy Hempel sah aus, als könnte er ukrainische Hacker in seine Suppe bröseln wie Cracker. Sein dünner marineblauer Pullover spannte sich über Schultermuskeln, die Sal veranlassten, mir einen boshaft-schlüpfrigen Blick zuzuwerfen.
»Wird das Jakes Konkurrent? Die Muskeln hat er aber nicht vom Bassspielen.«
Jake Thibaut, mein Gefährte. Glaube ich. Auf jeden Fall Bassist und derzeit mit seinem Alte-Musik-Ensemble in der Schweiz.
Ich verpasste Sal einen Schattenboxhieb und stand auf, um Hempel zu begrüßen. Aufgespürt hatte ich ihn beim Warten im Flur des Gerichts, bevor man mich als Zeugin in den Saal rief. Gerichtstermine laufen nie verlässlich nach Stundenplan. Das ist kein Problem für Anwälte und Richter, die fürs Dortsein bezahlt werden, aber für Zeuginnen wie mich ist es weniger lustig.
Immerhin hatte ich es während einer Stunde Füßeschaukeln geschafft, Hempels Telefonnummern auszumachen, sowohl die seines Handys als auch die seines Büros im Fort Dearborn Trust. Statt mich stotternd am Telefon zu erklären, simste ich ihm einen Text. Ich formulierte sorgfältig, schrieb von Hand vor: Ich wollte sachlich knapp Infos liefern, die ihn überzeugten, sich mit mir zu treffen, ohne Unterstellungen dazu, warum Ferrings Nachbarin dermaßen zugeknöpft tat – oder warum Hempel einfach aufgelegt hatte, falls das heute Morgen an Ferrings Apparat er gewesen war. Mein förmlich gespreizter Ton erwies sich als zielführend: Hempels Antwort klang nicht begeistert, aber er war einverstanden, mich um sechs im Glow zu treffen.
Nachdem das geregelt war, rangelte das Gericht immer noch um die Zulässigkeit meiner Aussage. Außerdem hatte ich drei neue Nachrichten von Bernie. Nichts Neues, schrieb ich zurück. Ich melde mich, wenn ich was hab, also hör bitte auf, nach meinen Hacken zu schnappen.
Auf Netflix fand ich alle drei Spielfilme, die Jarvis Nilsson mit Emerald Ferring gedreht hatte. Ich streamte Pride of Place. Ferring gab eine inbrünstige Aktivistin, aber die Dialoge waren plump.
Der Gerichtsdiener rief mich schließlich um vier Uhr auf, gerade als Ferring mit ihrem Säugling am Grab des Farmpächters saß. Sie hielt ihren Eltern einen bewegenden Vortrag, dass eines Tages ein Junge wie er Präsident sein würde, aber bis dahin »bleibt noch viel zu tun, Mutter. Ich kann im Tod so wenig von Eltons Seite weichen, wie ich es im Leben getan hätte.«
Ja! Einsatz der Nationalhymne.
Eine halbe Stunde später vertagte sich das Gericht, meine Aussage war immer noch unvollständig. Ich nahm die L nach Norden, tauschte die Gerichtsklamotten gegen Laufzeug, um den Hunden einen schnellen Ausflug zu verschaffen, dann stieg ich in saubere Jeans, warf ein bronzefarbenes Wolljackett über und marschierte wieder mal zum Golden Glow. So langsam kam ich mir vor wie Peter Sellers, der in einem Film sechs Rollen spielt und von einem Kostüm ins andere springt. Ich war etwas spät dran, hatte aber immer noch gut zwanzig Minuten Vorsprung vor Hempel.
Als ich Sal erzählte, mit wem ich verabredet war und warum, packte sie meine Schulter mit eiserner Hand und drückte mich auf einen Barhocker. »Emerald Ferring?«, sagte sie. »Du kommst an Emerald Ferring ran?«
»Du kennst sie?« Ich löste ihre Finger aus meiner Schulter.
»Ich hab mir schon immer alles angesehen, wo sie dabei war, sogar diesen lausigen Abklatsch von The Jeffersons. Sie war solch ein Vorbild für mich – wenn du dich mit ihr triffst, dann tu das gefälligst hier.«
»Das hängt alles von ihrem Beschützer ab«, sagte ich. »Vorausgesetzt, er taucht auf. Es freut dich sicher zu hören, dass ihre Nachbarn ihre Privatsphäre hüten, als wär sie die heimliche Chefin der CIA.«
Sal bombardierte mich mit Fragen – über die Nachbarn, Ferrings Haus, wie August Veriden sich Ferrings Vertrauen erschlichen hatte.
»Du klingst ja wie ein verknalltes Schulmädchen«, knurrte ich.
Sal nickte. »Wenn es um Emerald Ferring geht, bin ich ein verknalltes Schulmädchen.«
Ich erwähnte nicht, dass ich bis heute noch nie von Ferring gehört hatte: Das könnte eine schwer zu überbrückende Kluft erzeugen. Stattdessen zeigte ich ihr Troy Hempels Eintrag auf LinkedIn, und wir wetteten darum, was er trinken würde. »Bourbon«, tippte ich. »Er ist jung, er ist hip, er will zeigen, wie geschmeidig er ist.«
»Ach Schätzchen, du kannst genauso gut gleich blechen. Jung, hip – Bier, und zwar ein hiesiges.«
Etwa zehn Minuten später kam Hempel herein. Er hatte den stoischen Gesichtsausdruck eines diskreten Butlers, aber seine Augen weiteten sich leicht, als er Sals berühmten Tresen sah, ein Hufeisen aus Mahagoni, und die Tiffanylampen, die Sals Versicherungskosten in Höhen treiben, die ich kaum ermessen kann, selbst wenn ich Finger und Zehen zu Hilfe nehme.
»Ich arbeite nur fünf Blocks entfernt und hatte keine Ahnung, dass dieser Laden existiert. Wie lange gibt es ihn schon?«, fragte er.
»Seit Sie Ihre ersten Zähne bekamen.« Sal ließ ihr Tausendwattlächeln aufblitzen, um den Worten den Stachel zu nehmen. »Was kann ich Ihnen Gutes tun?«
Er wollte Bier, und Sal grinste dreckig. Hempel fragte nach etwas namens Hophazardly. Ich nahm an, er wollte Sal herausfordern, weil sie sich über seine Jugend lustig gemacht hatte, aber sie rief ihrer Chefbarkeeperin Erica etwas zu, und die stieg gemächlich in den Keller und kam mit einem Kasten zurück, den sie unter den Tresen schob.
Sal hatte mir einen Tisch in der hintersten Ecke reserviert, weit weg von den Fernsehern, die auf einem Bildschirm Nachrichten und auf dem anderen das Spiel der Bulls zeigten.
»Okay«, sagte Hempel. »Jetzt erklären Sie mal, was Sie von Ms. Emerald wollen.«