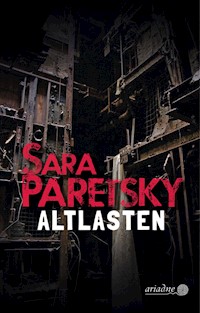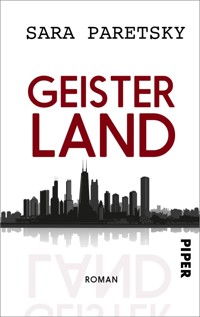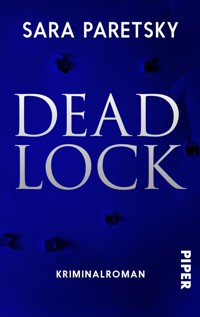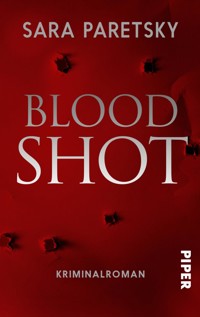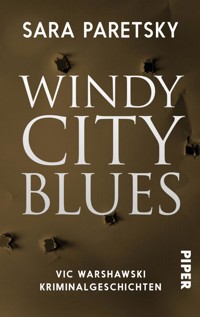17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Privatdetektivin V.I. Warshawski schiebt Nachtschichten zur Bewachung einer kleinen Synagoge. Dann stößt sie am Ufer des Lake Michigan zwischen Klippen und Betonblöcken auf eine bewusstlose 15-Jährige. Keine Papiere, kein Hinweis, wer sie ist. Auf der Suche nach Indizien gerät die Detektivin ins Visier eines gefährlichen Widersachers … "Entsorgt" zeigt ein von Pandemie und Trump’scher Politik gebeuteltes Chicago: überfüllte Krankenhäuser, überlastete Pflegekräfte. Dazu ein Sumpf aus Korruption und Profitgier. Wer hier nicht die Ellbogen ausfährt, wird entsorgt, das gilt besonders für ältere Menschen. Kann Warshawski dagegen ein Zeichen setzen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Privatdetektivin V.I. Warshawski schiebt Nachtschichten zur Bewachung einer kleinen Synagoge in Chicago. Dann stößt sie am Ufer des Lake Michigan zwischen Klippen und Betonblöcken auf eine bewusstlose 15-Jährige. Keine Papiere, kein Hinweis, wer sie ist. Auf der Suche nach Indizien gerät die Detektivin ins Visier eines gefährlichen Widersachers …
Entsorgt zeigt ein von Pandemie und Trump’scher Politik gebeuteltes Chicago: überfüllte Krankenhäuser, überlastete Pflegekräfte. Dazu ein Sumpf aus Korruption und Profitgier. Wer hier nicht die Ellbogen ausfährt, wird entsorgt, das gilt besonders für ältere Menschen. Kann Warshawski dagegen ein Zeichen setzen?
»Die bekannteste Privatdetektivin der Kriminalliteratur: Paretsky verknüpft ihre Erzählstränge mit unnachahmlicher Eleganz, die Spannung lässt nie nach.« Krimibestenliste
Über die Autorin
Sara Paretsky, eine der renommiertesten Krimiautorinnen weltweit, studierte Politikwissenschaft, war in Chicagos Elendsvierteln als Sozialarbeiterin tätig, promovierte in Ökonomie und Geschichte, arbeitete eine Dekade im Marketing und begann Anfang der 1980er Jahre, den Detektivroman mit starken Frauen zu bevölkern. In der Geschichte der feministischen Genre-Eroberung, die den Hardboiled-Krimi aus dem Macho-Terrain herausholte und zur Erzählung über die ganze Welt machte, gehört Paretsky zu den wichtigsten Vorreiterinnen: Ihre Krimis um Privatdetektivin Vic Warshawski wurden Weltbestseller, mit zahllosen Preisen geehrt und in 30 Ländern verlegt. Sara Paretsky gehört zu den Gründerinnen des internationalen Netzwerks Sisters in Crime
Sara Paretsky
Entsorgt
Kriminalroman
Deutsch von Else Laudan
Für die Gemeinschaft Lesender und Schreibender, die mich und einander in der Krise der Pandemie
»Und was ist die Hölle? Können Sie mir das auch sagen?«
»Eine bitterkalte Grube, wo Dämonen in Gestalt von Pflegebürokratie und Versicherungsgesellschaften Menschen foltern, die medizinische Versorgung benötigen.«
»Und möchten Sie wohl in diese Grube stürzen und dort für ewig gefoltert werden?«
»Nein, Sir.«
»Was müssen Sie tun, um das zu vermeiden?«
Ich überlegte mir meine Antwort sorgfältig, und doch war gewiss viel gegen sie einzuwenden: »Ich muss immer bei guter Gesundheit bleiben.«
Jane Eyre,
Vorbemerkung von Else Laudan
Kurz vorm Teenageralter hab ich gute Krimis entdeckt, Chandler und so. Rasant, düster, widerborstig, aber auch episch. Krimi at its best. Eine jahrelange Liebe. Und dann kam Paretsky. Alles, was am Detektivroman je magnetisch und prickelnd war, hatten die V. I. Warshawski-Krimis – und gingen noch weiter, fand ich, denn erstens ist Vic kein einsamer Wolf mit überlegenem oder zynischem Männerblick auf die Verhältnisse, zweitens sind ihre Fälle, Anliegen und Th emen immer fast schmerzhaft aktuell, relevant, gegenwärtig. Und drittens vertritt diese spezielle Hardboiled- Detektivin zwar ganz klar die schnelle, coole, mit fl apsigem Humor angereicherte Erzählperspektive, die mir am Genre so gefällt, aber sie steht dabei auch für den Impuls, das Richtige tun und die Wahrheit rauskriegen zu wollen, was zu bewirken in dieser unvernünft igen und ungerechten, allzu oft korrupten, gewaltvollen Welt. Kein Drüberstehen, kein Wegsehen, sondern illusionsloses Unter-die-Lupe-Nehmen mit Herz und Verstand. Für Vic Warshawski nämlich geht es ums Ganze, sehr konkret, und sie nimmt mich mit in diese Haltung. Wie bei einem mitreißenden Film ist das Lesen dieser Krimis ein Ritt, ein Abenteuer, eine Queste. Und doch bleiben sie immer fest in der Wirklichkeit verankert, denn bei Sara Paretsky hat noch das allerkleinste Detail einen sauber recherchierten realen Hintergrund, ist jedes Verbrechen eines, das tatsächlich geschieht. So dass ich vom Buch aufb licke und sehe: Das gibt es alles. Überall. Und es braucht Detektivinnen, die sich nicht ins Bockshorn jagen lassen. Voilà, hier kommt sie wieder.
1 Das Mädchen in den Klippen
Es war Mitch, der das Mädchen fand. Ich hatte an einem Friedhof zwischen Chicago und Evanston gehalten, um ihm und Peppy etwas Auslauf zu gönnen, und er lief mir weg. Ich rannte hinterher, aber ich hatte die Hunde zu lange im Auto gelassen. Er legte es drauf an, wollte mir zeigen, dass ich ihm gar nichts zu sagen hatte. Autos fuhren Schlangenlinien, hupten, Bremsen kreischten, als er unvermittelt schräg über die Sheridan Road flitzte und den felsigen Abhang hinunter zum See verschwand.
Irgendwie hielt ich Peppys Leine fest, als sie ihm nachsetzen wollte. Wir schafften es über die Straße, ohne plattgefahren zu werden, rannten aber um Haaresbreite einen Radfahrer über den Haufen.
Besorgt spähte ich das felsige Steilufer hinab, versuchte Mitch zu entdecken, doch er war außer Sicht. Er hatte seine Leine um, wenn sie irgendwo hängenblieb, drohte ihm Beinbruch oder Schlimmeres; es gab so viele Spalten zwischen den Felsen und den Betonblöcken, die die Stadt hier abgeladen hatte. Ich rief nach ihm, lauschte auf Bellen oder Winseln, aber vor mir brandete krachend der See gegen die Klippen und hinter mir auf der Sheridan Road dröhnten die Autos.
Peppy zerrte, wollte Mitch folgen. Ich löste ihre Leine, sollte sie ihn für mich finden. Sie schlitterte und sprang die nassen Felsen hinab bis zu einer Stelle etwa vier Meter tiefer.
Ein kräftiger Frühlingswind warf Brecher ans Ufer und schleuderte Gischt in die Höhe, die meine Beine durchnässte, während ich mich rückwärts hinabließ, an die Felsen geklammert, um nicht abzurutschen.
Als ich Peppy endlich erreichte, bellte sie Mitchs Hintern an. Sein Kopf steckte bis zu den Schultern zwischen zwei Betonblöcken. Ich schob die Hündin beiseite und zog Mitch heraus. Mit Mühe zwängte ich mich vor ihn, steckte den Kopf in die schmale Lücke. Er jaulte laut, schnappte sogar nach meinen Knöcheln, weil er unbedingt wieder hineinwollte.
Ich leuchtete mit der Handylampe in die Öffnung, erwartete ein verwesendes totes Tier zu sehen, aber es war ein Mädchen. Sehr jung, ein dünnes T-Shirt ließ kleine Brüste ahnen, kein Lebenszeichen. Ich schob mich weiter rein, legte ihr die Finger an den Hals, spürte einen schwachen Puls.
Ich zog mich zurück. Mitch sprang sofort wieder vor, und Peppy zwängte sich neben ihn. Ich drückte die Notrufnummer, bekam aber hier unten kein Signal. Keine Chance, die Hunde die Felsen hoch zu kriegen – nicht, solange sie eine Mission hatten und ich auf rutschigen Sohlen unterwegs war. Ich ließ sie da, kraxelte wieder hoch bis zum Straßenrand und rief 911.
Fast augenblicklich tauchte ein Streifenwagen auf. Der Fahrer stieg aus und verlangte meinen Ausweis.
»Da unten steckt ein Mädchen in den Felsen. Sie braucht Hilfe – ich schaff das nicht –«
»Ich habe eine Meldung über eine Frau mit Hunden. Sie dürfen sie nicht ohne Leine rumlaufen lassen. Zeigen Sie Ihren Ausweis.«
»Bitte! Hören Sie mir doch zu! Da unten sitzt ein Mädchen fest. Ich bin raufgeklettert, um Hilfe zu holen. Sie braucht sofort ein Noteinsatzteam mit Seilen und Trage!«
Er presste die Lippen zusammen und bellte in seinen Kragenfunk, dass er einem möglichen Notfall nachging. Dann trat er an die Absperrung zwischen Straße und Felsen, packte meinen Arm, schaute nach unten und sah Mitchs Schwanz. Peppy war die Kleinere, sie musste sich vor ihn gezwängt haben.
»Ist das da Ihr Hund?«
»Das Mädchen ist kaum noch am Leben«, sagte ich hektisch. »Bitte! Wenn Sie da runterklettern, sehen Sie es selbst.«
Widerstrebend beäugte er die Felsen, bis ihn sein Telefon rettete. Er wechselte ein paar Sätze, dann wandte er sich an mich. »Jemand aus dem Hochhaus da hat Anzeige erstattet.« Er ruckte mit dem Kopf in Richtung eines Gebäudes auf der anderen Straßenseite. »Es hieß, eine Frau führt Hunde hier die Klippen runter. Das waren dann wohl Sie. Können Sie die Hunde rufen, damit sie hochkommen?«
»Sie wollen das Mädchen nicht alleinlassen, und ich hab nicht die Kraft, sie die Felsen raufzuschleppen.«
Er spähte nochmals über den Rand, beriet sich wieder mit seinem Kragenfunk. »Wir mobilisieren ein Rettungsteam, aber wenn das ein Falschalarm ist, zählt das als mittelschwere Straftat.«
»Kein Falschalarm«, sagte ich schmallippig. »Wie lange brauchen die?«
»Fünfzehn, zwanzig Minuten. Gehen Sie runter und leinen Sie die Hunde an. Sie dürfen sie im Park nicht frei laufen lassen.«
Erneut hangelte ich mich die Klippen hinab. Klinkte die Leinen wieder am Geschirr der Hunde ein und schaffte es, sie um eine Spalte im nächsten Felsen zu schlingen, so dass ich nach dem Mädchen sehen konnte. Der Puls an ihrem Hals pochte schwach und unregelmäßig.
Ihr Gesicht hatte noch das Weiche der Kindheit. Mir schien, da waren frische Striemen auf den Wangen, aber sie war zu verdreckt, um das sicher zu sagen. Ich hatte meine nagelneue Jacke an, knallrotes Oxford-Leinen, nicht billig, aber ich legte sie ihr über und stopfte die Ärmel hinter ihre Schultern.
»Schon gut, Liebes«, murmelte ich. »Hilfe kommt gleich. Halt durch. Wir bringen dich ins Warme und in Sicherheit.«
Rasch machte ich ein paar Fotos. Als der Blitz auf ihr Gesicht fiel, öffneten sich flatternd ihre Lider. »Nagyi?«, fragte sie. Dann wiederholte sie es mit einem kleinen Seufzen – »Nagyi«, diesmal klang es erleichtert – und schloss die Augen wieder.
Mein Handylicht zeigte Löcher in ihren Jeans, die Ränder versengt. Verursacht durch Feuer, nicht durch eine Schere. Eiter sickerte aus den Wunden. Eine extreme Form von Selbstverstümmelung oder eine abscheuliche Art Folter. So oder so, sie brauchte dringend ärztliche Versorgung.
Mitch und Peppy kratzten hektisch an meinen Beinen. Ich schlüpfte raus und ließ sie hinein. Vielleicht nicht hygienisch, aber sie würden sie wärmer halten, als ich es konnte.
Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis das Rettungsteam eintraf. Sie warfen Seile aus und sprangen zu uns runter. Zogen die Hunde raus und drückten mir die Leinen in die Hand. Es kostete mich meine ganze Kraft, die beiden auf Abstand zu halten.
»Sie hat Verbrennungen an den Beinen«, warnte ich das Rettungsteam. »Möglicherweise auch im Gesicht.«
Das Team arbeitete fix. Sie installierten einen Seilschlitten, zogen das Mädchen raus, wickelten sie in Decken und schnallten sie an Schultern und Hüften fest.
»Sie lebt noch, oder?«, fragte ich.
»Gerade eben so.« Die Person an der Trage blickte nicht auf. »War gut, dass Sie mit Ihren Kötern vorbeigekommen sind.« Sie und ihr Kollege zupften an den Seilen, um dem Team oben mitzuteilen, dass sie hochkamen.
Die Hunde drehten schier durch, als die Crew das Mädchen abtransportierte. Sie bellten und zerrten wie wild, wollten unbedingt zu ihr. Ich ging auf alle viere und umklammerte die Leinen – nicht dass Mitch und Peppy noch über die Barriere zwischen Felsen und Straße sprangen und sich in den Verkehr stürzten, um zu dem Mädchen zu kommen. Ich hielt sie fest, bis über uns die Sirene ertönte und anzeigte, dass der Rettungswagen losfuhr.
Als wir schließlich raufkamen, schlotterten mir die Knie, und meine Handflächen waren wund. Ich lehnte mich an einen Baum, um zu Atem zu kommen. Jetzt, wo die Rettung geglückt war, spürte ich die Kälte. Meine Sachen waren feucht von der Gischt, und ich wünschte, ich hätte mir noch meine Jacke geschnappt, bevor das Rettungsteam das Mädchen in Decken wickelte.
Der Cop, der zuerst eingetroffen war, war noch da und leitete den Verkehr um eine Reihe Ü-Wagen herum. Natürlich. Die Nachrichtenredaktionen hören den Polizeifunk ab und sind gleich zur Stelle, immer heiß auf frisches Blut.
Beth Blacksin von Global Entertainment war auch da. »Vic! Als ich über den Rand geguckt habe, war ich sicher, Sie sind das da unten, Sie und Ihre Hunde. Was ist passiert, Vic? Was können Sie uns über das Mädchen sagen, das man heraufgeholt hat? War sie wirklich in einer Höhle? Wir wollten unsere GlobalCam einsetzen, aber die ist gegen die Felsen geprallt.«
»GlobalCam?«, echote ich.
»Unsere Kameradrohne. Kostet ein Vermögen. Man wird versuchen, sie zu bergen.«
»Was, das Rettungsteam soll sich für Sie abseilen?«
»Nein, wir haben ein paar Taucher.«
»Extra angestellt, um verirrte Drohnen zu bergen?«, fragte ich.
»Ach, Vic, Sie nehmen immer alles so wörtlich. Ein paar Jungs von der Technik machen Sporttauchen. Die kümmern sich drum. Hoffe ich – ich war nicht direkt befugt für den Einsatz, aber es hätte so tolle Aufnahmen gegeben.«
Ich verkniff mir eine bissige Entgegnung. Ich war nass bis auf die Knochen, meine Klamotten voller Dreck und schleimigem Zeug von den Felsen, am rechten Schuh löste sich die Sohle, und mein Auto war mindestens eine Meile weit weg. Für eine Mitfahrgelegenheit im Global-News-Van würde ich brav spielen. Beth war einverstanden, wenn ich ihr ein Interview gab. Wir machten es, während uns der Wind die Haare ins Gesicht peitschte und die Kamera tolle Aufnahmen von Wellen und Gischt einfing. Und von den Hunden, die laut jaulten.
»Die meisten in Chicago kennen V. I. Warshawski als die Detektivin, zu der man geht, wenn das Leben oder das Gesetz gefährliche Klippen bereithalten. Heute hat sie eine Person aufgespürt, die buchstäblich in den Klippen feststeckte. V. I., eben durften wir zusehen, wie das Rettungsteam der Chicagoer Polizei auf einer Trage ein junges Mädchen heraufgehievt hat. Wir haben erfahren, dass sie wahrscheinlich in allerletzter Sekunde gerettet wurde – dank Ihnen. Verraten Sie uns, wie Sie auf sie gestoßen sind – niemand, der bei Trost ist, würde doch freiwillig in diesen Felsen herumklettern.«
Ich erzählte von Mitchs und Peppys heroischem Einsatz, wobei ich unterschlug, dass Mitch nur durch meinen Kontrollverlust zum Helden geworden war.
»Und kennen Sie das Mädchen?«
»Ich hab sie nie zuvor gesehen«, sagte ich. »Das Rettungsteam sagt, sie ist am Leben, gerade eben so. Bestimmt sind ihre Eltern krank vor Sorge. Habt ihr eine Aufnahme von ihrem Gesicht, die ihr auf eure Website stellen könnt?«
Der Kameramann gab mir ein Daumen-hoch-Zeichen. Beth ließ ihn noch ein paar Takes von Mitch und Peppy machen, dazu Extramaterial vom See und den Felsen, dann wurden die Heldenhunde im Van mit der Aufschrift Global Mobal verstaut, und die Crew fuhr uns nach Evanston zu meinem Wagen.
Ich erwähnte Beth gegenüber weder die Brandlöcher in den Jeans noch das fremde Wort, das das Mädchen gesagt hatte. Ich sagte nicht, dass ich keine Spur von Nahrung oder Wasser gesehen hatte. Und ich ließ auch die mir wichtigste Frage weg: Hatte das Mädchen dort Zuflucht gesucht, oder war sie in die Felsen hinabgeklettert, um zu sterben?
2 Keine gute Tat bleibt ungestraft
Die letzten Nächte hatte ich im Auto Wache geschoben, vor einer kleinen Synagoge in West Rogers Park. Heute gab es im Kontext von Pessach einen speziellen Gottesdienst, und die Handvoll älterer Leute, die noch zur Gemeinde Shamar Hashomayim gehörten, fürchteten um ihre Sicherheit. Auf mich gekommen waren sie über Lotty Herschel – sie hatte Patientinnen in der kleinen Gemeinde. Immer mal wieder verschandelte irgendwer die Synagoge, und an großen Feiertagen waren Synagogen auf der ganzen Welt besonders gefährdet.
Die Nachbarschaft von Shamar Hashomayim machte sie noch exponierter. Auf der einen Seite lag ein ungenutztes Grundstück mit Ruinen eines Fundaments, gutes Versteck für mögliche Vandalen. Mehr Sorgen allerdings bereitete mir die baufällige Bruchbude auf der Westseite. Ich war ziemlich sicher, dass da drin Meth gekocht oder Fentanyl verschnitten wurde. Ich hatte die Hunde mitgebracht und das Gelände mehrmals abgesucht, doch alles, was wir aufscheuchten, waren Ratten, die große Sorte, stark und fett von all dem Müll, den Chicagos Bevölkerung zuvorkommend in unseren Straßen und Parks für sie hinterlegt.
Ein paar alte Männer der Gemeinde waren auch in der schlimmsten Phase der Pandemie weiter zum Gebet zusammengekommen. Sie waren so wenige, dass sie in den kleinen Räumen des Gebäudes mühelos Abstand halten konnten. Jetzt, da sie geimpft waren, kam an diesem Morgen die ganze Riege – achtzehn statt der sechs oder sieben, die im Winter dabeigeblieben waren.
Um halb zehn herrschte auf der Straße ordentlich Betrieb, und ich fand meine Anwesenheit entbehrlich. Ich hatte mittags einen Termin in der Innenstadt mit einer lukrativen neuen Klientin, vorher wollte ich noch bei Ilona Pariente vorbeischauen, damit sie wusste, dass ihrem Mann nichts zugestoßen war.
Mrs. Pariente war die Patientin von Lotty, die mich mit der Synagoge verbandelt hatte. Zum Gottesdienst ging sie nicht: Es war ein orthodoxes Bethaus, was bedeutete, dass die Frauen Treppen steigen mussten, um auf ihre Galerie zu gelangen, und Mrs. Parientes Beine machten es nicht mehr so gut. Es fiel ihr schon schwer, aus dem dritten Stock des schäbigen Wohnhauses, in dem sie und ihr Mann lebten, runter auf die Straße zu kommen. Ich brachte oft Einkäufe mit, um ihr das Treppensteigen zu ersparen.
Sie servierte mir Kaffee, stark, wie ihn meine Mutter gemacht hatte. Wir sprachen Italienisch miteinander, was uns beiden Vergnügen bereitete. Auch dadurch fühlte ich mich meiner Mutter nahe. Donna Ilona war aus Rom, aber sie kannte Gabriellas Heimatort Pitigliano.
»Und Sie holen Emilio am Ende des Tages ab?«
Ich versicherte ihr, dass ich um sechs Uhr vor der Synagoge warten würde.
»Und dann essen Sie mit uns?«
Ich sagte zu, schlug aber eine zweite Tasse Kaffee aus. Ich musste vor meinem Termin noch die Hunde ausführen. Nach sechs Stunden im Auto mit kurzen Patrouillepausen waren sie zapplig. Der Park in der Nähe der Synagoge war voll mit Kleinkindern. Ich fuhr ans Seeufer, wo ein riesiger Friedhof, größer als die Stadtparks, Chicago von Evanston trennt. Seine östliche Grenze ist die Sheridan Road. Der Michigansee liegt gleich dahinter. Ich parkte am westlichen Eingang. Und dann ging mir Mitch durch die Lappen.
Meine Entscheidung, ihnen Auslauf auf dem Friedhof zu verschaffen, führte dazu, dass wir einem Mädchen das Leben retteten, also war es wohl was Gutes. Es kostete mich allerdings eine neue Klientin. Als ich spätnachmittags anrief, um zu erklären, warum ich den Termin verpasst hatte, wollte sie keinen neuen mehr machen. Zudem büßte ich ein teures Kleidungsstück ein, die Jacke, in die ich das Mädchen gewickelt hatte. Ich unterdrückte ein Aufflackern von Verdruss. Eine Jacke konnte ich mir immer kaufen – vorausgesetzt, ich bezahlte vorher ein paar ausstehende Rechnungen –, aber wie oft bekam man Gelegenheit, ein Teenagerleben zu retten?
Bis der Global-Van die Hunde und mich beim Auto abgesetzt hatte und ich heimfuhr, war der Nachmittag schon weit vorangeschritten. Mr. Contreras, der ältere Nachbar, der die Hunde mit mir teilt und mein Leben beaufsichtigt, hatte uns bereits in den Nachrichten gesehen.
»Dolle Sache, wie du da die Felsen runter bist. Hattest du das Mädchen denn gesehen?«
»Es war alles Mitchs Verdienst«, versicherte ich ihm.
Er war entzückt von Mitchs Heldenerzählung und taute ihm zu Ehren gleich mal ein Steak auf. Ich ging nach oben, meine zerrissenen und verdreckten Sachen ausziehen, und sah mir den Bericht auf dem Laptop an.
Global gab uns volle drei Minuten – das ist im Fernsehen eine Ewigkeit – und brachte ein Standbild des geretteten Mädchens mit der Bitte, wer sie erkannte, möge sich melden. Ihr Gesicht in Nahaufnahme war mit Schmutz bedeckt, die Haut stellenweise aufgeschürft. Schwer zu identifizieren, es sei denn, jemand kannte sie gut und wusste, dass sie vermisst wurde. Der Global-Clip endete mit dem Kommentar eines Oberarztes am Beth Israel, interviewt an einem Corona-gerechten Ort draußen vor dem Krankenhaus. Er wiederholte bloß, dass sie bewusstlos und noch nicht identifiziert war, und wer sie kannte, möge sich bei der Polizei oder bei der Krankenhausverwaltung melden.
Im Beth Israel hatte meine Freundin Lotty Herschel die Privilegien einer Chirurgin, und ihr Partner Max Loewenthal war leitender Direktor. Sie müssten mir sagen können, wie es dem Mädchen ging und ob das Aufnahmeteam einen Ausweis bei ihr gefunden hatte.
Meine Eskapade hatte mich ausgelaugt, zumal ich durch die Nachtwächterinnentätigkeit zu wenig Schlaf bekam. Ich wollte mich bloß zwanzig Minuten hinlegen, doch als ich wach wurde, war es nach fünf. Hastig zog ich mich an und fuhr wieder zu Shamar Hashomayim, um Mr. Pariente abzuholen. Er und die anderen Männer standen noch ein Weilchen auf dem Gehweg, tratschten und wünschten einander gesegnetes Pessach. Sie trugen allesamt Masken, genau wie ich. Die Leute waren nervös, auch wenn wir inzwischen geimpft waren. Zu diesem Zeitpunkt der Pandemie kannte jede von uns Menschen, die der Krankheit zum Opfer gefallen waren.
Die Parientes wohnten kaum eine halbe Meile entfernt von der Synagoge, aber der Himmel dunkelte schon, und ein gebrechlicher Greis abends allein auf dem Heimweg war eine wandelnde Zielscheibe für Gelichter, das alten Leuten nachstellt. Als wir ankamen, stieg er langsam und schwer keuchend die drei Stockwerke hoch, meinen stützenden Arm lehnte er ab.
Wir aßen am Küchentisch. Donna Ilona und ich taten unser Bestes, dem Mahl eine festliche Stimmung zu geben: Wir tranken süßen Wein, aßen mit Oliven und Tomaten gebackenen Fisch, dazu meinen Spinat mit Rosinen, und zum Abschluss Mascarpone mit Honig, Mandeln und Preiselbeeren. Aber über uns hing eine Schwere, die von der schwindenden Gemeinde der Synagoge, der Last der Pandemie und der zunehmenden Gebrechlichkeit der Parientes herrührte. Zusätzlich zu meinen Besorgungen kauften auch Lotty und ihre Oberschwester Jewel Kim sporadisch Lebensmittel für sie ein. Doch trotz solcher Hausbesuche waren Sorgen um die Zukunft unausweichlich.
»Wir ziehen nicht weg«, sagte Mr. Pariente. »Das habe ich klargestellt, und Ilona auch. Wir sterben hier, wo wir all die Jahre gelebt haben. Man weiß doch, was in Pflegeheimen los ist. Selbst wenn sie einen nicht mit Corona infizieren, stirbt man an Einsamkeit und Wundliegen.« Die wörtliche Übersetzung des italienischen Begriffs war ›Wunde durch Daliegen wie tot‹, als wäre der Körper schon aufgebahrt.
Donna Ilona nickte zustimmend. »Wie Estella Calabro, als ihr Mann starb. Sie gehörten zur Synagoge, und als er tot war, überredete ihr Sohn sie, in so ein Heim für betreutes Wohnen zu ziehen. Betreutes Sterben wäre passender. Sie hatte eine Eigentumswohnung in einem der schönen Häuser weiter oben in unserer Straße. Wir sind hier ja bloß Mieter, aber ihr Mann hat ein Pelzgeschäft gehabt. Dann brach Estellas Gesundheit weg. Sie musste denen ihr Zuhause abtreten, um weiter Pflege zu bekommen. Aber in Wirklichkeit wurde sie gar nicht gepflegt und starb, kurz bevor Corona ausbrach.«
»Das reicht, Ilona«, sagte Emilio. »An einem Festtag suhlt man sich nicht in traurigen Geschichten.« Er machte den kleinen Fernseher an, der auf dem Küchentresen stand, es lief der Nachrichtenkanal von Global. Nach ein paar Minuten öden Politikergeschwafels kam meine Eskapade dran.
»Victoria! Das sind ja Sie!«, rief Donna Ilona. »Sieh sie dir an, Emilio! Die reinste Bergziege, wie sie in diesen Felsen herumspringt.«
Die Stimmung in der Küche hellte sich auf. Ich spülte das Geschirr, ließ das Ereignis für sie noch mal Revue passieren und schuf Zuversicht: Wenn ich ein Kind vor dem See retten konnte, war ich bestimmt auch mächtig genug, den Tempel Shamar Hashomayim zu beschützen.
Beim Abschied legte mir Emilio die Hände auf den Kopf und sagte, wie er es immer tat: »Alles Gute, carissima.« Auch ich fühlte mich leichter, als ich heimfuhr.
Am nächsten Morgen erwachte ich mit begeisterten Textnachrichten von Peter Sansen. Auch er hatte den Bericht gesehen und rief durch, als ich mich anzog, voll des Lobes. Peter war Archäologe und hatte mit einem Team phönizische Ruinen an der Küste Spaniens erforscht, als das Virus ausbrach und er festsaß. Später flaute die Pandemie in Europa etwas ab und stieg in den USA heftig an, so kamen wir überein, dass er besser dortblieb. Dann, nach einem schlimmen Winter voller Krankheit und Aufruhr, wurden die Staaten weniger gebeutelt, Europa dafür umso mehr. Wie so viele Menschen strandeten wir im Dilemma widersprüchlicher Quarantänebestimmungen und Reisebeschränkungen. Peter erwog, zu Besuch nach Hause zu kommen, aber er hatte im vergangenen Jahr schon zu viel Zeit im Lockdown verbracht. Als die Beschränkungen für seine Ausgrabungsstätte gelockert wurden, blieb er in Spanien.
Jetzt wollte Peter Einzelheiten über meine Rettungsaktion hören. »Erinnert mich an unsere erste Begegnung«, sagte er schließlich. »Ich musste dich kopfüber aus dem Fenster halten, während du an der Hauswand eine Spider-Woman-Nummer hingelegt hast. Es stört mich, dass du ohne meine Hilfestellung da rumkraxelst – da fühle ich mich überflüssig. Häng dich nicht zu weit raus, wenn ich nicht da bin, um deine Füße festzuhalten.«
»Mir geht’s ziemlich ähnlich«, sagte ich. »Steig du nicht in Löcher, die so tief sind, dass du nicht mehr rauskommst.«
Wir verabschiedeten uns mit Luftküssen und -umarmungen und dem Versprechen, in zwei Tagen wieder zu telefonieren, aber das Gespräch war nur halb erfüllend. Intimität ist schwierig, wenn man das Gegenüber nicht vor sich hat und anfassen kann, sondern bloß ein Bild auf dem Display anstarrt.
»Ich bin ganz zufrieden mit meinem Leben, wie es ist«, verkündete ich laut. »Stimmt schon, ich hab steife Glieder und blaue Flecken und mein Liebster ist dreitausend Meilen weit weg, aber ich bewirke doch was in der Welt, und das ist viel wichtiger als körperliches oder emotionales Wohlbefinden.«
Peppy, die bei mir im Bett genächtigt hatte, gab ein anzügliches Prusten von sich und schlief weiter.
Ich zog ein komplettes Trainingsprogramm durch – Dehnübungen, Gewichte, Kniebeugen, schwitzte die Unzufriedenheit und Steifheit aus. Ehe ich ins Büro fuhr, rief ich Max Loewenthals Assistentin im Beth Israel an. Cynthia Dijkstra war hocherfreut, von mir zu hören. »Alle hier haben Sie im Fernsehen gesehen, Vic! Unglaublich, wie Sie das Mädchen gerettet haben.«
Ich persiflierte den Marlboro-Mann – ach wo, Ma’am, mach bloß meinen Job – und fragte, ob sie schon einen Namen hatten oder ob sie noch Jane Doe war – Amtssprache für eine unidentifizierte weibliche Person. Cynthia zufolge hatte sich bei der Notaufnahme nichts in ihren Taschen gefunden, und das Mädchen hatte noch nicht gesprochen.
»Sie war im Schock, als sie eingeliefert wurde, nicht ansprechbar, synkopisch steht im Krankenbericht. Sie muss rehydriert werden und hat Brandwunden an Waden und Oberschenkeln, aber sie haben keine Kopfverletzungen entdeckt, nichts, was ihren Zustand erklärt. Hat sie irgendwas gesagt, als Sie bei ihr waren?«
»Ein Wort«, sagte ich. »Sie kam kurz zu Bewusstsein, als mein Kamerablitz losging. Da sagte sie etwas, das klang wie Nagyi. Ich nehme an, das ist ein Name und sie hat mich für eine Person gehalten, die sie kennt.«
Cynthia und ich mutmaßten, wie sich das buchstabierte. Sie wollte es an den behandelnden Arzt weitergeben und in die Meldung an die Polizei aufnehmen.
»Gibt’s eine Schätzung, wie alt sie ist?«
Cynthia konsultierte den Krankenbericht. »Wahrscheinlich um die fünfzehn.«
»Warum wurde sie zu euch gebracht?«, fragte ich. »Es gibt doch eine Klinik in Evanston, nur ein paar Blocks von da, wo ich sie gefunden habe.«
»Genau deshalb steht das Beth Israel ständig am Rand des Ruins«, sagte Cynthia. »Die Klinik in Evanston und noch zwei Chicagoer Krankenhäuser, die näher dran wären, haben ihre Notaufnahme auf Bypass geschaltet, um sich solche Fälle vom Hals zu halten. Wenn wir so arbeiten würden, hätte der Rettungswagen das arme Mädchen durch die Stadt karren können, bis sie beim Transport stirbt, womit das Problem dann gelöst wäre. Max würde nie zulassen, dass das Beth Israel so vorgeht – ein Segen. Und ein Segen, dass er es schafft, unsere begüterten Mäzene bei der Stange zu halten.«
»Das macht dieser britische Akzent«, sagte ich. Max hatte sein Englisch als jugendlicher Flüchtling in London gelernt. »Die Leute finden, er klingt wie Richard Burton, da können sie nicht widerstehen und zücken das Scheckbuch.« Cynthia lachte und wir legten auf.
Ich entschied, dass die Hunde und ich gestern genug Bewegung gehabt hatten und heute Morgen keinen großen Auslauf brauchten, und fuhr ins Büro, wo auch meine Mitmieterin gerade eintrudelte, die Bildhauerin Tessa Reynolds. Sie gestaltet riesige Metallobjekte für Geschäftseinrichtungen und Auftragsarbeiten für Skulpturenparks. Tessa ist eine Schwarze Frau. Eine der wenigen positiven Auswirkungen der Krawalle letztes Jahr: Schwarze Kunstschaffende rückten derzeit mehr ins Rampenlicht. Tessa hatte international einen Namen, aber in den Staaten war sie nicht sehr bekannt. Da sie nicht in den pazifischen Raum reisen konnte, wo ihre Arbeit am meisten gefragt war, half die neue Anerkennung zu Hause sehr.
Auch sie hatte meine fünfzehn Sekunden Ruhm gesehen und fragte, ob es was Neues über das Mädchen gab. Ich erzählte ihr, was ich von Cynthia erfahren hatte. »Ich fühl mich verantwortlich, weil ich sie gerettet hab«, sagte ich. »Aber tun kann ich nichts, nur hoffen, dass sie eine Familie hat, der an ihr liegt.«
»Du hast Zweifel?«
»Sie hat Verbrennungen. Es gibt Dutzende Möglichkeiten. Vielleicht ist ihre Familie im Feuer umgekommen und sie steht unter Schock – das würde erklären, warum sich niemand meldet. Aber ein Kind mit Brandwunden an den Beinen, vielleicht auch im Gesicht – das ist eher keine schöne Geschichte.«
Tessa nickte nüchtern. Ihre Mutter war Anwältin für Familienrecht, vertraut mit den meisten der Gräuel, die Menschen Kindern zufügen. »Oder sie ist abgehauen und hunderte Meilen entfernt von allen, die sie vermissen.« Sie streckte die Hand aus, um meine Schulter zu drücken, zog sie aber rasch zurück. Eine von vielen Coronafolgen: Wann würde es wieder ungefährlich sein, einander sorglos zu berühren?
3 Das Brennen spüren
Ich war im Rückstand mit dem Auftrag eines meiner wichtigsten Klienten, es ging um einen Drogenring in seinem Werk in Peoria. Ich fing an, dafür einen Aktionsplan zu machen, frickelte dann noch an ein paar anderen Fällen herum, aber es lief nicht. Ich hatte ein Bild vor Augen, ein an die Tretmühle geschirrter Esel, der endlos im Kreis zuckelte und Mais oder sonst was mahlen musste. War ich das, die immer wieder dieselben öden Aufträge für die gleiche Klientel ableistete?
Meine übliche Bewältigungsstrategie ist Bewegung, aber ich fühlte mich zu schlapp für einen langen Lauf. Singen, meine zweite Option. Ich würde heimfahren und Gesangsübungen machen. Das hatte ich seit Monaten nicht getan.
Ich hatte gerade meine Backup-Laufwerke aktualisiert und wollte schon das Licht ausmachen, da klingelte es an der Tür. Ich spähte auf den Monitor. Polizei. Genauer gesagt eine Sergeantin, die ich kannte, Lenora Pizzello, plus ein Uniformierter als Verstärkung, wohl falls ich etwas so Strafbares sagte, dass sie Zeugen brauchte. Ich setzte meine Maske auf und drückte den Türöffner.
»Sergeant! Das ist ja unglaublich aufregend. Sie haben mich noch nie besucht. Und Ihr Freund ist –?«
»Officer Howard. Rudy Howard.«
»Kommen Sie rein, Officer, Sergeant, ich bring Ihnen Kaffee, Tee, Gin – was immer Sie um diese Zeit trinken.«
»Das ist kein Freundschaftsbesuch, Warshawski. Wir sind hier, um Ihre Aussage zu Protokoll zu nehmen.«
Ich hatte sie schon den Flur entlang in mein Büro führen wollen, doch jetzt hielt ich inne, die Tür zur Straße noch halb offen. »Ich weiß nicht, was für eine Aussage Sie sich von mir erhoffen, Sergeant, aber ich hab auch keinen Schimmer, worum es hier geht. Sie fangen besser ganz von vorn an und erklären mir, was Sie wollen.«
»Die Jane Doe, die Sie gestern in den Klippen fanden. Sie sind vom Tatort verschwunden, bevor jemand mit Ihnen sprechen konnte.«
»Wie falsch Sie liegen. Ich hab lang und breit mit Beth Blacksin gesprochen, Menschen im ganzen Land konnten mich hören. Sogar in Spanien, vermutlich auch in Australien und Japan.«
Pizzello drehte sich zu Howard um. »So, dafür hat man Sie mitgeschickt. Damit Sie lernen, wie man sich bei manchen Mitgliedern der Öffentlichkeit beherrschen muss, wobei die hier auch noch stolz drauf ist, eine krasse Nervensäge zu sein. Warshawski, wir brauchen Einzelheiten, die uns helfen, Angehörige ausfindig zu machen.«
»Im Ernst, Sergeant, Nervensäge oder nicht, ich weiß weniger als die Ärztinnen, die sie im Beth Israel behandeln. Ich hab vielleicht zwei Minuten mit ihr verbracht, und sie war fast die ganze Zeit bewusstlos.«
Pizzello spähte über meine Schulter. »Gibt es hier irgendwo einen Stuhl? Es ist schwer für Officer Howard, sich im Stehen Notizen zu machen.«
Ich seufzte demonstrativ, führte sie aber in mein Büro. Tessa Reynolds rüstete sich gerade zum Aufbruch. Beim Anblick der Polizei zog sie fragend die Brauen hoch. »Egal was du getan hast, Vic, ich bin auf deiner Seite. Schick mir eine Nachricht, wenn Mutter dich auf Kaution rausholen soll.«
Ich gab ihr ein Daumen-hoch-Zeichen, aber Pizzello war angefressen. »Officer Howard ist seit sechs Wochen von der Akademie runter. Und muss hier schon erleben, wie nett man als Diener und Beschützer der Öffentlichkeit behandelt wird.«
Darauf fielen mir viele mögliche Antworten ein, aber ich behielt sie für mich. Derzeit waren alle bis zum Zerreißen angespannt – da war es wenig hilfreich, Öl ins Feuer zu gießen.
In meinem Büro verlangte Pizzello eine genaue Beschreibung der Höhle, in der ich das Mädchen gefunden hatte.
»Es war keine Höhle, bloß eine Lücke zwischen zwei von diesen großen Platten«, sagte ich. »Sie kennen doch diese Seeufer-Absperrungen. Da kippen sie Betonbruch von Abrissbaustellen zwischen die Felsen, die der See angeschwemmt hat. Das Mädchen hockte zwischen zwei Betonplatten, die sich so gesetzt haben, dass unten ein Spalt von gut einem halben Meter entstanden ist. Sie hat sich da wohl verkrochen, ehe sie das Bewusstsein verlor.«
»Kann jemand sie dort hingeschafft haben?«, fragte Pizzello.
»Nicht ausgeschlossen, aber auch nicht sehr wahrscheinlich. Jemand Kräftiges könnte das an sich leicht bewerkstelligen, aber nicht gerade dort – die Steine sind glitschig, und wenn man nicht ins felsige Wasser stürzen will, braucht man Seile, Sicherungen, vielleicht auch Partner. Die Leute in den Apartments ringsum haben die Stelle gut im Blick. Ich hatte schon fast eine Anzeige am Hals, bevor das Rettungsteam eintraf, weil jemand mich und die Hunde gemeldet hat. Man müsste es also im Dunkeln tun, was die Fähigkeiten eines SEAL-Teams erfordert.«
»Also jemand mit SEAL-Team-Fähigkeiten könnte vom Wasser aus hinkommen.«
Ich starrte sie an. »Was soll das, Sergeant? Meinen Sie, sie hat einen Schmugglerring geleitet? Ein unternehmungslustiges Kartell segelt den Mississippi hoch, dann den Illinois River und in den See hinein, statt einfach am Fluss zu entladen, lädt dort die Fracht ab samt einer jugendlichen Taucherin mit Brandwunden an den Beinen –«
»Schon gut«, schnauzte Pizzello. »Ich hab’s kapiert. Was war in der Höhle zu sehen – in der Lücke?«
»Schleim. Dreck. Sie hat kein Feuer gemacht. Egal wie sie in diese Spalte gekommen ist, die Verbrennungen hatte sie vorher schon.«
»War da kein USB-Stick? Kein Handy oder sonst ein Gerät?«
»Pizzello, was läuft denn hier? Was wissen Sie über diese junge Frau, was Sie mir nicht sagen wollen? Sie muss bei der Polizei einschlägig bekannt sein, wenn Sie vermuten, dass sie sicherzustellende Datenträger bei sich hatte.«
Pizzello rutschte unbehaglich auf ihrem Stuhl herum, strich sich die Haare hinter die Ohren. Es war eine nervöse Handbewegung, die sie häufig machte, aber jetzt verfing sich ihr feines Haar in der Schnur ihrer Maske, und sie musste die Brille abnehmen, um alles zu entwirren. Schließlich murmelte sie, dass sie nur alle Möglichkeiten durchging, sonst nichts.
Rudy Howard, der brav mitgeschrieben hatte, starrte vor sich hin, als wäre er ganz woanders oder wünschte zumindest, er wäre es.
»Wir haben ihr Bild auf die bundesweite Fahndungsliste gesetzt. Hoffentlich kommt was rein. Und Sie, Warshawski«, ihre Stimme wurde fester, »wenn Sie irgendwas hören, sagen Sie es mir.«
»Sie werden als eine der Ersten informiert«, versprach ich. »Natürlich hat Mitch ein Anrecht darauf, es noch vorher zu erfahren.«
»Mitch?« Sie setzte sich gespannt auf.
»Mein Hund. Er hat sie ja schließlich gefunden.«
Hätte sie keine Maske getragen, sie hätte mich vielleicht angespuckt. So stand sie bloß auf, ihr Rücken so steif, dass ich sie hätte auf die Seite legen und als Bügelbrett verwenden können. »Eins noch, Warshawski.« Sie blieb im Türrahmen stehen. »Sie haben gesagt, sie war fast die ganze Zeit bewusstlos. Was ist mit der Nanosekunde, in der sie wach war?«
Ich grinste hinter meiner Maske, was sie nicht sehen konnte. »Gut aufgepasst. Sie hat nur ein Wort gesagt, hörte sich an wie Nagyi. So wie sie es sagte, klang es wie der Name einer Person, die sie kannte. Und der sie vertraute – mein Gesicht wirkte tröstlich auf sie, nicht bedrohlich.«
»Da ist sie aber weit und breit die Einzige.«
»Ach, Sergeant, Sie treffen doch immer bloß die Übeltäter, die ich euch zur Festnahme zuführe. Meinen Nächsten und Liebsten spende ich regelmäßig Trost und Behagen.«
»Gehört sie denn zu Ihren Nächsten und Liebsten? Haben Sie sie erkannt, so wie sie anscheinend Sie erkannt hat?«
»Lassen Sie’s gut sein, Pizzello. Ich kann mich nicht verplappern, weil es nichts auszuplaudern gibt. Ich hab sie noch nie gesehen. Ich nehme an, ihr Gesicht geht durchs Internet, hat aber keine Familienmitglieder auf den Plan gerufen, sonst wäre das längst durchgesickert.«
Officer Howard räusperte sich und nahm Anlauf, um Pizzello aus der Sackgasse zu retten, in die sie sich manövriert hatte. »Ich frag mich, ob sie vielleicht durchgebrannt ist, Ma’am, und ob sie deshalb in Chicago niemand identifizieren kann.«
Pizzello nickte. »Möglich wär’s. Und es kann dauern, bis Leute von anderswo auf die Idee kommen, ein Teenager in Chicago könnte ihr vermisstes Kind sein. Bis dann, Warshawski.«
Ich brachte sie noch an die Tür, um sicher zu sein, dass sie wirklich ging. Das Intermezzo mit ihr hatte die Zeit verbraucht, die ich für Stimmübungen vorgesehen hatte. Da ich am Morgen nicht mit den Hunden gelaufen war, musste ich ihnen heute Abend Bewegung verschaffen. Trotzdem setzte ich mich noch mal hin und fuhr den Computer wieder hoch.
Irgendwas an dem Mädchen in den Klippen hatte bei der Polizei Alarmglocken zum Klingen gebracht. Ich öffnete die Fotos, die ich gestern Nachmittag zwischen den Felsen gemacht hatte.
Viele Polizeibehörden nutzen Software zur Gesichtserkennung, auch die in Chicago. Gewisse Dienstleister melken die sozialen Medien, sammeln ohne unser Wissen unsere Fotos ein und füttern damit Datenbanken, welche Strafverfolgungsinstanzen zum Ausmachen von Personen einsetzen, die sie als Bedrohung einstufen, meistens Demonstrierende oder Eingewanderte.
Ich hatte Beth Blacksin von Global meine Handybilder nicht zur Verfügung gestellt, aber ihre Crew wie auch alle anderen Medien der Stadt hatten das Mädchen fotografiert, als sie von den Klippen in den Rettungswagen verbracht wurde. Von den Fotos her waren Alter und Ethnie schwer zu schätzen. Unter Dreck und getrocknetem Blut wirkte ihre Haut eher dunkel, ihr Haar dick und lockig. Sie mochte Afroamerikanerin sein oder Latina oder Orientalin.
Falls sie Überlebende eines ungewöhnlichen Verbrechens war, sollte es irgendwo eine Akte dazu geben. Aber Gewalttaten hatten sich dieses Jahr dermaßen gehäuft, landesweit und auf lokaler Ebene, dass niemand mehr einen Überblick hatte. Und jugendlichen Opfern häuslicher Gewalt blieben nicht viele Möglichkeiten, das zu melden.
Wegen der Brandwunden an den Beinen forschte ich online nach Hausbränden in den letzten ein, zwei Wochen, bei denen die Familie eine Tochter verloren hatte. Mit Blick auf Officer Howards These, das Mädchen könnte eine Ausreißerin sein, dehnte ich den Radius auf hundert Meilen rings um die Stadt aus. Es hatte in einigen Wohnungen und Häusern Vorfälle mit Feuer gegeben, aber niemand schien nach meiner Jane Doe zu suchen. Ich gab auf und fuhr heim zu meinen Hunden.
4 Hassbriefe
Am nächsten Morgen rief Mrs. Pariente an, während ich in einer Zoom-Konferenz mit Klienten war. Ich sah, wie der Anruf reinkam, ließ aber die Mailbox rangehen. Zehn Minuten später versuchte sie es erneut, dann rief Lotty Herschel an.
Sowie die Sitzung endete, rief ich zurück, Mrs. Pariente zuerst. »Donna Ilona – was ist los?«
»Die scola – die Fenster – genau wie in Rom!« Sie war so aufgelöst, dass ich fünf Minuten brauchte, um ihr die Geschichte zu entlocken. Emilio war um acht zur Synagoge gegangen, um sich mit den anderen Männern zum täglichen Gebet zu treffen. Als er hinkam, war der Eingang voller Graffiti und die Fensterscheiben eingeworfen.
Donna Ilona war ein kleines Mädchen gewesen, da löste Mussolinis ›Manifest der rassistischen Wissenschaftler‹ auf den Straßen Roms eine Gewaltwelle gegen Juden und jüdische Geschäfte aus. Sie erinnerte sich deutlich an die Scherben vor dem Schuhgeschäft ihrer Großeltern, den Geruch der Angst an ihren Eltern und Tanten und Onkeln. Es fiel ihr schwer, in klaren Sätzen zu sprechen.
Ich sagte meinen nächsten Termin ab und fuhr zu Shamar Hashomayim. Emilio Pariente hockte mit mehreren schwer erschütterten Männern auf einer Bank am Bordstein. Emilio stand mühsam auf, als er mich sah, und zeigte wortlos auf die Synagoge. Der Bau war ein kleiner viereckiger Kasten aus dem tonhaltigen Lake Calumet-Backstein, der im Alter zartrosa wird. Jetzt war die Front mit hässlichen antisemitischen Parolen und Symbolen verunstaltet. Das runde Fenster über der Doppeltür war zerbrochen.
Ich sprach die alten Männer sanft an: Hatten sie die Polizei gerufen? Nein. Während sie besorgt zusahen, rief ich an und machte Meldung. Von einem der Gruppe erfuhr ich den Namen der Versicherungsgesellschaft der Synagoge und rief auch dort an.
Als zwei Streifenwagen mit Lightshow in die Straße bogen, verdrückten sich die Männer in die Schatten. Wie Ilona und Emilio hatten viele Mitglieder von Shamar Hashomayim aus ihrer Kindheit in Europa grauenhafte Erinnerungen an die Polizei. Nur einer der Ältesten blieb bei Emilio und mir. Er stellte sich als Istvan Reito vor. Anwalt, sagte er, jetzt weitgehend im Ruhestand, aber er versuchte, der Shamar Hashomayim bei kleinen Rechtsfragen behilflich zu sein.
Drei Officer stiegen aus, aus dem ersten Wagen nur ein Fahrer, aus dem zweiten zwei Mann. Der Beifahrer war Rudy Howard, der gestern Nachmittag Sergeant Pizzello begleitet hatte. Heute lernte er wohl, wie man mit Bürgermeldungen umging.
Reito berichtete, was die Männer wussten, was praktisch nichts war bis auf den sichtbaren Schaden am Gebäude. Sie waren zu schockiert gewesen, um reinzugehen. Nun zückte Don Emilio den Schlüssel, und alle traten ein.
Trotz allen Kummers war es unerwünscht, dass eine Frau weiter ins Heiligtum vordrang. Ich blieb in der Eingangshalle stehen, während die Cops – alles Männer – die Innenräume überprüfen gingen. Inzwischen fing ich an, die Scherben des zerbrochenen Fensters einzusammeln. Und stieß auf ein Projektil. Ich rief den ranghöchsten Officer herbei, der die Kugel in einen Beweismittelbeutel steckte und müde den Kopf schüttelte.
»Kann sein, wir kriegen die Vandalen, finden die Waffe, aus der das hier kam – aber wissen Sie, wir stecken bis zum Arsch in Mord und Totschlag und bewaffnetem was weiß ich. Ich sag’s ungern, aber …« Er ließ den Satz in der Luft hängen. Sie hatten keine Ressourcen für Ermittlungen zur Verschandelung eines Gebäudes, selbst wenn es ein Andachtsort war. Ich fing keinen Streit an, sagte nur, ich würde die Augen offen halten und mich melden, wenn ich was mitbekam.
»Sie sind eine Tochter?«, fragte der andere Officer. Er hatte mich mit Emilio Italienisch sprechen gehört.
»Freundin der Familie. Es gab früher schon hier und da Vorfälle, aber ein Schuss auf ein Fenster – das ist schon beängstigend. Sie melden das doch als Hassverbrechen, oder?«
»Das entscheidet der Staatsanwalt, nicht wir«, sagte der Officer.
»Aber Sie stellen es als Hassverbrechen dar, richtig?«
Er kratzte sich an der Nase. »Yeah, denke schon. Eine Liebestat war’s jedenfalls nicht.«
»Gab es noch andere Vorfälle in der Gegend?«, fragte ich.
Die beiden älteren Officer gingen es durch: Vor wenigen Wochen war ein koreanisches Möbelhaus verunstaltet worden, kurz darauf ein japanisches Restaurant. Beide lagen nur ein paar Querstraßen weiter, in den Schmierereien ging es um Corona, sie sollten sich aus Amerika verziehen, solange sie noch gehen konnten.
»Morddrohungen? Ich hoffe, die Polizei nimmt das ernst. Wir wollen hier in Chicago kein Attentat wie in Squirrel Hill oder Charleston. Von daher wäre es weise, dieser Sache gründlich nachzugehen.«
Der ältere Officer machte ein finsteres Gesicht. »Machen Sie bei meinem Vorgesetzten bezahlte Überstunden klar, und wir arbeiten die ganze Nacht dran.«
»Sie berichten Sergeant Pizzello davon, versteht sich«, sagte ich zu dem Neuling, aber der war bereits auf der Hut; statt sich auf die nervige Schnüfflerin einzulassen, trat er hinter den älteren Mann.
Als die Polizei abzog, bot ich an, die Mitglieder der Synagoge nach Hause zu fahren, doch sie wollten lieber zu Fuß gehen. Sie verschlossen die Doppeltür, probierten die Klinke und wankten langsam davon, wobei sie sich gegenseitig stützten.
Ich schoss ein paar Dutzend Fotos von dem angerichteten Schaden, denn ich wollte die Fenster unverzüglich mit Brettern verschließen. Ums Saubermachen und um neue Fensterscheiben sollte sich der Sachbearbeiter der Versicherung kümmern.
Ich lief zu Fuß zu den Parientes für den Fall, dass Emilio auf dem Heimweg die Kräfte verlassen hatten. Obwohl ich noch geknipst hatte, holte ich ihn einen Block vor dem Ziel ein. Ich wartete, bis er sich von seinen Freunden verabschiedet hatte, dann stiegen wir langsam die Treppe hoch.
Donna Ilona saß da und weinte bitterlich. Sie hatte die Versicherungspolice für die Synagoge nicht verlängert. »Sie ist abgelaufen, als die Pandemie so schlimm war, und ich habe es aus den Augen verloren. Wie konnte ich nur so leichtsinnig und dumm sein?«
Ich beruhigte sie, so gut es ging, und versprach, Lotty und ich würden für Reinigung und Reparatur aufkommen.
Lotty rief an, als ich noch dort war, und bestätigte mich. Sie würde Mrs. Coltrain, ihre Klinikleiterin, die Synagoge neu versichern lassen und alles Nötige zur Restaurierung beisteuern. Nachdem sie kurz mit Donna Ilona gesprochen hatte, lud Lotty mich ein – oder war es mehr ein Befehl? –, zum Abendessen zu kommen.
Anschließend schirrte ich mich an die Tretmühle und trabte im Kreis herum, verfasste Gutachten über Stellenbewerbungen für zwei meiner Stammklienten. Dann lief ich mit den Hunden, zog einen Strickpulli und eine schicke Hose an und ging die zwei Meilen zu Lotty zu Fuß.
Der Portier begrüßte mich heiter. »Wie geht’s Ihnen, Ms. Warshawski?«
»Sie kennen das doch, Mr. Garretson. Es ist ein guter Tag, wenn es bei kleinen Katastrophen bleibt – lieber Kakerlaken im Keller als Ratten in der Küche.«
Er lachte zustimmend, meldete mich bei Lotty an und rief den Aufzug für mich. »Im Fahrstuhl gibt es Desinfektionsmittel. Benutzen Sie es, bevor Sie die Knöpfe berühren.«
Ich benutzte das Desinfektionsmittel und wünschte, ich könnte es auch in mein aufgewühltes Hirn schütten oder vielleicht die Außenwelt damit übergießen.
Es war noch neu und nur dem Impfstoff zu verdanken, dass Max und ich mit Lotty am Tisch sitzen konnten. In der schlimmsten Phase der Pandemie hatte ich, sofern ich Lotty überhaupt besuchte, auf dem Balkon vor ihrem Wohnzimmer gestanden. Wir blökten durch unsere Masken, während ich in der Winterluft bibberte.
Lotty trinkt nicht, außer einem gelegentlichen Schnaps als Arznei, aber Max besitzt einen stattlichen Weinkeller. Er hatte einen Brunello rausgeholt, einen italienischen Roten, den ich liebe, mir aber nicht oft leisten kann. Lotty machte es Sorgen, wie der Anschlag auf die Synagoge den Parientes zusetzte. Sie wollte, dass ich die Vandalen aufzuspüren versuchte.
»Lotty, das ist eine unmögliche Aufgabe. Vielleicht sogar unmöglich für die Cops, aber für mich erst recht.«
»Du übernimmst doch oft Fälle, die die Polizei nicht bewältigen kann oder will«, wandte sie ein.
»Ich kann natürlich ein paar Fragen stellen, ob jemand auf der Straße was gesehen hat, und ich werde Überwachungskameras anbringen, falls sie wiederkommen, aber ich habe weder die Mittel noch die Zeit für so ein Projekt.«
»Soweit ich weiß, hast du auch unbezahlte Arbeit geleistet, als du uns im Beth Israel einen geheimnisvollen Neuzugang beschert hast«, sagte Max schnell, bevor Lotty mich weiter bedrängen konnte.
»Ein sehr geheimnisvoller Neuzugang und ein gar nicht geheimnisvolles Memo von der Finanzabteilung«, sagte Lotty, »eine Mahnung, dass das Krankenhaus tief in den roten Zahlen steckt und wir es uns nicht leisten können, als Wohlfahrtsmüllhalde von Chicago zu fungieren.«
Max wand sich. »Na, ganz so hat er es nicht ausgedrückt, Lottchen.«
»Ich erhalte jeden Monat ein Memo von Ludwig Kavanaugh über das Verhältnis von Versicherten zu Unversicherten bei meinen Patientinnen. Warum hast du den Vorstand jemanden einstellen lassen, der so viel Ehrgeiz dareinsetzt, die Patientinnenversorgung zu untergraben?«
»Lotty, bitte. Du weißt, dass uns das Geld ausgeht. Wenn wir die Finanzen nicht in den Griff kriegen, müssen wir entweder zumachen oder uns einem Klinikverbund anschließen, der unseren Patientenumgang noch viel strenger reglementieren würde. Kavanaugh hat die Finanzlage im St. Helena’s sanieren geholfen. Außerdem weiß er, dass du der Klinik Prestige einbringst, was bedeutet, dass du zahlende Patienten anziehst. Er ist ein Fan von dir, kein Feind.«
»Habt ihr noch irgendwas über das Mädchen herausgefunden?«, fragte ich, bevor Lotty zum Gegenschlag ausholte. Ich hatte diese Debatten schon oft erlebt, und sie endeten immer gleich: Lotty warf Max vor, er stelle Profit über Patienteninteressen, dann stand Max auf, verbeugte sich übertrieben förmlich und ließ mich mit der wutschäumenden Lotty allein.
»Sie ist nicht unsere einzige Jane Doe«, sagte Max, »aber die andere ist eine Obdachlose mit fortgeschrittenen Leberschäden und interessiert die Medien nicht. Erzähl von deiner Jane Doe.«
»Irgendwas ist mit ihr, was die Cops mächtig fuchst«, sagte ich. »Ich frag mich, ob sie ihre Identität kennen.« Ich berichtete Max und Lotty von Sergeant Pizzellos Besuch. »War die Polizei schon auf der Intensivstation?«
Er nahm sein Telefon und versandte eine Textnachricht. Binnen einer Minute kam ein Rückruf, und er zog sich kurz in die Küche zurück.
»Sie ist jetzt bei Bewusstsein«, sagte er, als er wieder reinkam. »Sie haben sie nicht mehr auf der Intensivstation, da sie selbständig Flüssigkeit zu sich nehmen kann und die Verbrennungen an den Beinen nicht so schlimm sind wie befürchtet. Sie isst ein bisschen, aber sie spricht nicht. Sie haben es mit Spanisch und Arabisch versucht, da sie auf Englisch nicht reagiert.«
Ich wiederholte das Wort, das sie bei meinem Anblick gesagt hatte. »Ich dachte, das ist vielleicht ein Name.«
Max stellte sein Weinglas ab. »Nagyi? So? Ja, das könnte auch ein Name sein, aber die Mutter meiner Mutter kam aus Nové Zámky, als es noch zu Ungarn gehörte. Meine Mutter sprach Deutsch wie die meisten Menschen in dieser Gegend vor dem Krieg, aber meine Großmutter ließ sich von mir gern Nagyi nennen.> Ungarisch für Großmama.«
»Dass sie ein ungarischer Flüchtling ist, kann ich mir nicht vorstellen«, warf Lotty ein. »Selbst wenn man in die USA einreisen könnte, kommt doch heutzutage niemand mehr aus Mitteleuropa hierher. Wer ein besseres Leben sucht, geht nach Deutschland.«
»Vielleicht ist sie aus der einzigen ungarischen Familie, die das Memo über Deutschland nicht erhalten hat«, zog Max sie auf. »Jedenfalls können wir es nicht wissen. Ich spreche die Sprache nicht, bloß ein paar Worte, die meiner Großmutter Freude machten, aber wir müssen doch im Krankenhaus jemanden haben, der Ungarisch kann. Ich gebe morgen früh eine Mitteilung ans Personal raus. Natürlich kann es auch ein Name sein, afrikanisch oder asiatisch oder sonst was – wir wissen ja nichts über das Mädchen.«
»Hat die Person, mit der du eben gesprochen hast, etwas von Polizeipräsenz gesagt?«, fragte ich.
»Du meinst ungewöhnliche Präsenz, ja? Wir haben immer eine Einheit in der Notaufnahme, weißt du. In diesem Fall, da das Mädchen minderjährig ist, versuchen sie Angehörige oder einen Vormund zu finden. Und bisher ohne Erfolg.«
»Was passiert mit ihr, wenn sie geheilt ist, aber nicht spricht und ihre Familie nicht aufzufinden ist?«, fragte ich.
»Dann rufen wir das Jugendamt an, die nehmen sie in Obhut. Vielleicht bringt man sie in einem therapeutischen Umfeld unter, wo sie ihr Gedächtnis und ihre Sprache wiedererlangen kann, die ihr das Trauma genommen hat, aber wir sind ein Krankenhaus. Wir können sie nicht länger pflegen, wenn sie ohne medizinische Hilfe auskommt. Was jetzt nur noch einen, höchstens zwei Tage dauern dürfte, da sie bereits selbständig isst.«
Lotty hatte sich beruhigt und lenkte das Gespräch in neutrale Bahnen. Sie und Max sahen sich neuerdings virtuelle Aufführungen eines experimentellen Theaters in Berlin an. Das gefiel ihnen besser, als sie gedacht hatten, ebenso wie die Gelegenheit, gesprochenes Deutsch zu hören.
Als ich ging, fiel mir Max’ zweite Jane Doe ein, die leberkranke Obdachlose. »Was wird mit ihr?«
Max zog eine Grimasse. »Nichts Gutes. Sie muss ins Pflegeheim, und die Qualität der Pflege – man mag gar nicht dran denken. Aber auch hier gilt, wir können sie nur begrenzt dabehalten. Bei all den Bestimmungen, wer die Kosten trägt und was sie umfassen, haben wir wenig Mitspracherecht. Nur Empfehlungsrecht, und das nutzen wir nach Kräften –«
»Lass das nicht Ludwig Kavanaugh hören«, sagte Lotty scharf, »sonst musst du dir bald einen anderen Job suchen.«
Max nahm ihre Hand und küsste sie. »Wäre nicht das Schlimmste, in meinem Alter in den Ruhestand gezwungen zu werden. Ich bin ja kein Chirurg, ich brauche das Krankenhaus nicht, um mich nützlich zu fühlen. Oder wichtig.«
Ich verzog mich schleunigst zum Fahrstuhl, bevor Lotty ihm Kontra gab. Früher hatten die beiden sich nie gezankt, doch in letzter Zeit war das Teil jedes Abends mit den beiden. Corona und die desaströse politische Lage zermürbten alle, sogar Max und Lotty.
5 Auf der Flucht
Am Morgen kam ein besorgter Anruf von Mrs. Pariente, deren Mann zur Synagoge aufgebrochen war. »Was, wenn diese Unholde wiederkommen und mehr Schaden anrichten? Können Sie nicht nachts über unsere scola wachen, so wie an großen Feiertagen?«
»Donna Ilona, ich wünschte, es ginge, aber das kann ich nicht.« Die Angst in ihrer Stimme tat mir weh. »Ich bringe ein paar Überwachungskameras an; wenn sich jemand am Gebäude zu schaffen macht, weckt mich ein Alarmsignal, und ich kann die Polizei hinschicken.«
Sie schwieg einen Moment und antwortete dann mit Würde, dass sie das verstand und sehr zu schätzen wusste, was ich für sie und Emilio tat.
Ich ging wieder an die Arbeit. Vor Mrs. Parientes Anruf hatte mich mein Buchhaltungsbüro kontaktiert und an die Außenstände bei meinem Anwalt erinnert, derzeit im sechsstelligen Bereich, sowie an die Schulden beim Forensiklabor, die knapp auf Platz zwei rangierten. Die Arbeit von Detekteien zählt als systemrelevant. Ich hatte während des Lockdowns tätig bleiben können, doch der wirtschaftliche Abschwung hieß auch, dass meine Klientel weniger Aufträge outsourcte als früher. Ich konnte es mir nicht leisten, Abgabetermine zu verschleppen. Ich setzte mich wieder an die Aufgabe, eine diskrete Lösung für das Drogenproblem im Werk meines Brötchengeber-Klienten zu suchen, aber Mrs. Parientes Ängste gingen mir nicht aus dem Sinn.
Wenigstens um die Kameras könnte ich mich schon mal kümmern. Ich würde sie so programmieren, dass sie Meldungen an mein Handy schickten. Ich stand in der Rapelec-Filiale an der Milwaukee, als Max’ Assistentin Cynthia Dijkstra anrief.
»Vic, also das Mädchen, das Sie am See gerettet haben? Sie ist verschwunden.«
»Verschwunden?«
»Beim Schichtwechsel um sieben lag sie noch in ihrem Bett, aber als die Kollegin von der Brandverletztenstation zum Verbandswechsel kam, war sie nicht da. Das war um neun. Die Schwester ist noch zweimal wiedergekommen, dachte, sie sei vielleicht auf dem Klo, aber sie ist weg.«
Jetzt war es elf Uhr dreißig. Meine Jane Doe war seit über zwei Stunden verschwunden. »Hat irgendwer sie besucht? Vielleicht hat jemand sie abgeholt, bevor die Fachfrau für Verbrennungen kam.«
»Sie wissen ja, wie es hier tagsüber zugeht – wir sind unterbesetzt, zugleich ist immer viel los. Besuch soll eigentlich keinen Zutritt zu Patientenzimmern haben, aber es kann sein, dass sie abgeholt wurde. Nur müsste man dazu ihre Zimmernummer kennen. Der Informationsschalter kann sich natürlich nicht an jede Anfrage erinnern, aber Ihre Jane Doe haben alle auf dem Schirm. Die Stationsleitung sagt, ein Cop war bei ihr, zusammen mit einem unserer Hausmeister. Max meinte, das Mädchen könnte Ungarin sein, deshalb habe ich einen Aushang gemacht, und da hat sich dieser Mann gemeldet, er ist schon kurz vor der Rente, aber als Kind kam er aus Ungarn. Jedenfalls hat der Cop versucht, mit ihr zu reden, und Jan Kadar, der Hausmeister, sagt, er hat die Fragen übersetzt, so gut er konnte, aber das Mädchen hat auf keine der beiden Sprachen reagiert. Ich glaube nicht, dass sie mit irgendwem auf der Station gesprochen hat. Vic, sie ist geschwächt. Wenn sie auf eigene Faust losgezogen ist, kann sie nicht weit kommen. Wir haben ihr Verschwinden natürlich der Polizei gemeldet, aber – Sie wissen wenigstens, wie sie aussieht – hätten Sie Zeit?«
»Ich seh mich in der Gegend um«, sagte ich, »aber eure beste Chance ist die Polizei. Mit einer Vermisstenmeldung an alle Streifen dürften sie sie am ehesten finden.«
»Mit Ihrer Beteiligung wäre mir wohler.«
Na klar, so bin ich. Zwischen eins und zwei spüre ich Vermisste auf, noch vor drei rücke ich Vandalen auf den Pelz und kläre bis zum Abend noch ein paar Routinemorde auf. Immer wenn Wonder Woman mich kommen sieht, faltet sie ihr Cape zusammen und gönnt sich Urlaub in Themyscira.
Ich brachte den Kauf der Kameras über die Bühne, nutzte noch den Büroservice von Rapelec und machte ein paar Dutzend Farbausdrucke der deutlichsten meiner Fotos von Jane Doe. Dann fuhr ich zu Hause vorbei, um Mitch von Mr. Contreras abzuholen. Das Mädchen war so zierlich und klein, dass ich sie leicht übersehen konnte, wenn sie in irgendeiner Gasse zusammengebrochen war, aber Mitch würde sie wittern.
Mr. Contreras wollte sich partout an der Suche beteiligen. Ein Tag auf den Beinen mit Stöbern in Gassen und Müllcontainern ist keine gute Übung für einen Mann über neunzig, nicht mal, wenn er so fit ist wie mein Nachbar. Ich ließ ihn missmutig zurück. Er macht sich gern nützlich und fühlte sich von mir zum Alteisen verbannt.
Im Krankenhaus rief Cynthia Dijkstra den Mann in Max’ Büro, der Ungarisch sprach. Er kam, sehr nervös: Er war sicher, dass ein Tadel auf ihn wartete. Cynthia machte uns miteinander bekannt.
»Ehrlich, Cynthia, ich hab nix gesagt, was dem Mädelchen Angst einjagen könnte.« Egal mit welcher Sprache er aufgewachsen war, Kadars Aussprache und Grammatik klangen nach hundert Prozent Chicago.
»Niemand wirft Ihnen was vor, Jan, aber wir engagieren Ms. Warshawski dafür, nach ihr zu suchen. Alles, was Sie uns sagen, könnte helfen, sie zu finden.«
Engagieren? Dann war dies ein bezahlter Auftrag? Wie erfreulich – ich war von ehrenamtlich ausgegangen, zum Dank für die häufige kostenlose Behandlung, die ich im Beth Israel im Laufe der Jahre bekommen hatte.
»Das Timing scheint mir arg rasant«, sagte ich zu Cynthia. »Sie geben eine Suchmeldung für eine ungarisch sprechende Person raus und – wann? eine halbe Stunde später? – nimmt ein Cop Mr. Kadar mit zu ihr? Haben Sie das koordiniert?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wer hat Sie angefordert, Jan?«
»Das war keiner von der Stammtruppe, die bei uns im Pausenraum rumhängt.« Er warf einen Seitenblick auf Cynthia: Nahm sie Anstoß daran, dass Hausmeister und Cops sich im Pausenraum trafen, statt auf Posten zu sein? Aber sie reagierte nicht. »Ich wurde angepiept, sollte zur Notaufnahme kommen. Sie wissen schon, Cynthia, wo die Cops ihr kleines Büro haben, und ein Typ meinte, ob ich der aus Ungarn wär und mit ihm zu der Kleinen gehen könnte.«
»Seinen Namen wissen Sie nicht mehr?«, fragte ich.
»Wie gesagt, ich kannte ihn nicht, ich wusste auch nicht, dass ich drauf achten sollte. Ich hatte meinem Chef ja gesagt, er soll Cynthia meinen Namen geben, als wir den Aushang sahen.«
»Sie beide sind also zusammen in ihr Zimmer gegangen. War sie wach?«
»Sie lag im Bett, das war so halb hochgekurbelt. Der Fernseher lief, aber ich glaub nicht, dass sie was geguckt hat. Also geht der Polizist hin und rüttelt sie an der Schulter. Nicht doll, nur um ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Erst redet er Englisch mit ihr, und sie starrt weiter zur Decke. Dann will er, dass ich übersetze. Ich spreche nicht so gut, wissen Sie, ich verstehe mehr, als ich sagen kann, aber das war einfach: Wie heißt sie, woher hat sie die Brandwunden, hat sie irgendwelche Papiere oder Handys oder Computergeräte, womit man rausfinden könnte, wo sie wohnt. Und sie starrt bloß an die Decke.«
»Wurde ein Hörtest gemacht?«, fragte ich Cynthia.
Cynthia gab die Frage per Textnachricht weiter. Während wir auf Antwort warteten, fragte ich Kadar, wie lange sie in dem Zimmer geblieben waren.
»So lang hat es gar nicht gedauert, oder? Ein halbes Dutzend Fragen auf Englisch und dann auf Ungarisch? Sagen wir fünf, vielleicht zehn Minuten. Jedenfalls nicht länger, denn da kam eine Nachricht von meinem Chef, jemand hatte sich erbrochen, und ich musste schnell den Modus wechseln – vom UN-Dolmetscher zum Hausmeister.« Er grinste unsicher in der Hoffnung, wir würden mit ihm lachen.
Ich rang mir ein Schmunzeln ab. »War sonst noch wer mit Ihnen da drin? Eine von den Pflegekräften oder von der Brandverletztenstation?«
»Junge, Junge, ich stecke in Schwierigkeiten, oder? Vielleicht sollte ich meinen Gewerkschaftsvertreter holen.«
Cynthia sah ihn erstaunt an. »Warum denn, Jan? Ich meine, es ist natürlich Ihr gutes Recht, aber ich glaube nicht, dass Vic Ihnen irgendwas anhängen will.«
»Sie sind gegangen, aber der Cop ist geblieben, ja?«, fragte ich. »Es wäre gut zu wissen, was er gesagt oder getan hat, als er mit ihr allein war.«
Kadar kratzte sich an den Armen, als ob das Gespräch ihm Juckreiz bereitete. »Da war noch das Mädel im anderen Bett, aber der Cop hat sie gleich aus dem Raum geschickt. Sie war ziemlich frisch operiert und brauchte ganz schön lange, auch wegen dem Tropf und allem, aber sie ist raus auf den Gang. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, ehrlich. Und jetzt muss ich los, bin eh schon überfällig.« Er hatte es so eilig, dass er beim Hinausgehen Cynthias Papierkorb umstieß. »’tschuldigung«, murmelte er, stellte ihn auf und tat die Papiere wieder hinein.
»Was war denn da los?«, staunte Cynthia, als die Tür hinter ihm zufiel.