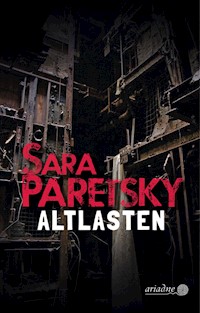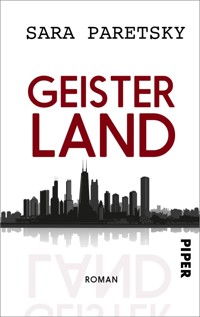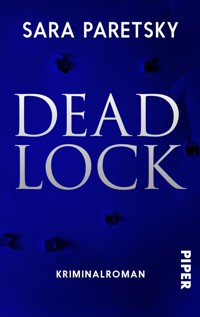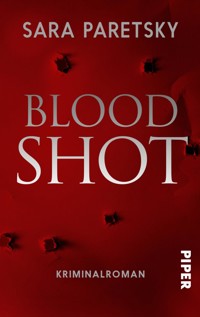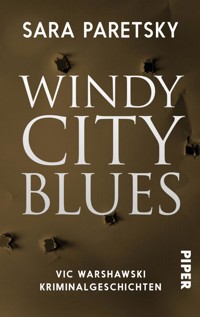6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der siebte Fall für Vic Warshawski - in einem ebenso frechen wie atemberaubenden Alleingang tritt Vic einer bornierten und geldgierigen Männerwelt ans Schienbein Die Chicagoer Privatdetektivin Vic Warshawski schlägt sich diesmal mit besonders üblen Gaunern herum: Sie bringen alte Menschen um ihre Ersparnisse und führen dubiose Finanzmanipulationen mit Pensionsfonds durch. Und mitten in diesem Sumpf krimineller Machenschaften steckt Vics Ex-Mann Dick, Rechtsanwalt in einer der besten Kanzleien der Stadt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Dietlind Kaiser
ISBN: 978-3-492-98377-8
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2018
© 1992 Sara Paretsky
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Guardian Angel«
© Delacorte Press, New York 1992
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1993, 1998
Covergestaltung: Favoritbüro München
Covermotiv: Freedom Master/shutterstock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Sex und die alleinstehende Frau
Abendgarderobe erwünscht
Schlacht am Büfett
Rye auf Eiern
Bloß ein Lynchmob aus der Nachbarschaft
Notruf
Ein neuer Klient
Lösch deine Sorgen
Rohdiamant
Abendfrieden
Eine Hundsgemeinheit
Krankenbesuch
Sohnesliebe
Auf Luthers Spuren
Mach Platz, Sisyphus
Showdown in der Leichenhalle
Noch ein toter Fisch in Chicago
Kein Kronjuwel
Der verlorene Sohn
Legales Unternehmen
Wie man eine Freundin den Wölfen vorwirft
Wache am Bett
Gelähmt von der Technik
Die Arbeiten des Herkules
Wie bei Sherlock Holmes
Schlechte Mädchen kommen spät nach Hause
Flucht durch den Hinterausgang
Mustergültiges Unternehmen?
Drinks mit den reichen Müßiggängern
Notquartier
Kletterpartie
Auf der Schaukel
Erinnerungen an ein mitternächtliches Bad
Der starke Arm des Gesetzes
Kater nach einer arbeitsreichen Nacht
Das Vermächtnis
Huhn für Mr. Contreras
Exmann wieder auf dem Posten
Nachehelicher Krach
Endlich gefunden
Eine neue Banker-Rasse
Attacke auf den vierten Stand
Starkstrommarketing
Letzter Besuch
Ein neuer Beruf winkt
Neue Klamotten – aber nicht aus der Boutique
Kurzschluß im System
Noch einmal davongekommen
Wenn das Spitzenmanagement spricht …
Der heilige Stevenson und der Laster
Gerechte Strafe für die Schuldigen?
Lose Fäden verknüpfen
Subterranean Homesick Blues
Weit weg von zu Hause
Dank
Widmung
Für Matt und Eve(das heißt, für Eva Maria, die Prinzessin)
»Tritt leise auf, du trittst auf ihre Träume.«
W. B. Yeats
Sex und die alleinstehende Frau
Heiße Küsse bedeckten mein Gesicht, zerrten mich aus dem Tiefschlaf an den Rand des Bewußtseins. Ich stöhnte und rutschte tiefer unter die Decke, in der Hoffnung, in den Brunnen der Träume zurückzusinken. Meiner Bettgenossin war nicht nach Schlaf zumute; sie wühlte unter der Decke und nötigte mir weitere Zärtlichkeiten auf.
Als ich mir ein Kissen über den Kopf zog, wimmerte sie erbärmlich. Jetzt war ich richtig wach, rollte mich herum und schaute sie böse an. »Es ist noch nicht mal halb sechs. Völlig ausgeschlossen, daß du aufstehen willst.«
Sie blieb unbeeindruckt, sowohl von meinen Worten als auch von meinen Versuchen, sie von meiner Brust abzuschütteln, sondern schaute mich durchdringend an, die braunen Augen weit offen, den Mund leicht geteilt, so daß die rosa Zungenspitze zu sehen war.
Ich bleckte die Zähne. Sie leckte mir eifrig die Nase. Ich setzte mich auf und schob ihren Kopf von meinem Gesicht weg. »Daß du deine Küsse so wahllos verteilt hast, hat dich überhaupt erst in diese Patsche gebracht.«
Überglücklich, weil ich wach war, plumpste Peppy vom Bett und ging zur Tür. Sie drehte sich um, wollte sehen, ob ich nachkam, und jaulte leise in ihrer Ungeduld. Ich zog aus dem Kleiderhaufen neben dem Bett ein Sweatshirt und Shorts und stapfte auf schlafschweren Beinen zur Hintertür. Ich fummelte am Dreifachschloß herum. Inzwischen jaulte Peppy ernsthaft, aber es gelang ihr, sich zu beherrschen, bis ich die Tür auf hatte. Adel verpflichtet, nehme ich an.
Ich schaute ihr nach, als sie die drei Treppen hinunterlief. Die Trächtigkeit hatte ihre Flanken aufgebläht und sie langsamer gemacht, aber sie schaffte es zu ihrer Stelle am Hintertor, ehe sie sich erleichterte. Als sie fertig war, machte sie nicht die übliche Runde durch den Hof, um Katzen und andere Räuber zu vertreiben. Statt dessen watschelte sie zur Treppe zurück. Sie blieb vor der Tür im Erdgeschoß stehen und bellte laut.
Schön. Sollte Mr. Contreras sie nehmen. Er war mein Nachbar im Erdgeschoß, Mitbesitzer der Hündin und allein verantwortlich für ihren Zustand. Eigentlich nicht ganz allein – das war das Werk eines schwarzen Labradors vier Türen weiter gewesen.
Peppy war in jener Woche, in der ich auf der Spur einer Industriesabotage die Stadt verließ, läufig geworden. Ich beauftragte einen Freund, einen Möbelpacker mit Muskeln aus Stahl, sie zweimal am Tag auszuführen – diesmal an einer kurzen Leine. Als ich Mr. Contreras sagte, Tim Streeter werde von nun an kommen, war er tief verletzt, wenn auch leider nicht sprachlos. Peppy sei ein wohlerzogener Hund, der komme, wenn er gerufen werde, sie brauche keine Leine; und überhaupt, was bildete ich mir denn ein, Leute damit zu beauftragen, Peppy auszuführen? Wenn er nicht wäre, hätte sich niemand um sie gekümmert, wo ich doch von vierundzwanzig Stunden zwanzig nicht da sei. Ich verreiste doch, nicht wahr? Ein weiteres Beispiel dafür, wie ich das Tier vernachlässigte. Und davon abgesehen, sei er rüstiger als neunzig Prozent der jungen Schwachköpfe, die ich anschleppte.
Weil ich es eilig hatte, hörte ich mir nicht den ganzen Sermon an, pflichtete ihm nur bei, er sei für siebenundsiebzig in hervorragender Form, bat ihn aber, mir in dieser Frage meinen Willen zu lassen. Nur zehn Tage später erfuhr ich, daß Mr. Contreras Tim die Tür gewiesen hatte. Das Ergebnis war zwar katastrophal, aber ganz und gar vorauszusehen.
Der alte Mann begrüßte mich mit kummervoller Miene, als ich über das Wochenende aus Kankakee zurückkam. »Ich weiß einfach nicht, wie das passieren konnte, Engelchen. Sie ist immer so brav, kommt, wenn sie gerufen wird, und dieses Mal reißt sie sich einfach los und rennt die Straße entlang. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, großer Gott, hab ich gedacht, was ist, wenn sie überfahren wird, wenn sie sich verläuft oder gestohlen wird, Sie wissen schon, dauernd liest man was über diese fahrenden Labore, die Hunde auf der Straße oder auf dem Hof klauen, man sieht seinen Hund nie wieder und weiß nicht, was ihm passiert ist. Ich war so erleichtert, als ich sie eingeholt habe – du meine Güte, ich hätte gar nicht gewußt, was ich sagen soll, damit Sie verstehen –«
Ich raunzte ihn ohne Mitgefühl an: »Und was wollen Sie mir wegen dieser Geschichte erzählen? Sie haben nicht gewollt, daß sie sterilisiert wird, aber Sie haben sie nicht unter Kontrolle, wenn sie läufig ist. Wenn Sie nicht so dickköpfig wären, hätten Sie das zugegeben und Tim erlaubt, sie auszuführen. Eins kann ich Ihnen sagen: Ich habe nicht vor, meine Zeit damit zu verbringen, daß ich für ihren verdammten Nachwuchs ein liebevolles Zuhause suche.«
Das führte zu einem Wutausbruch seinerseits. Er ging in seine Wohnung zurück und knallte zornig die Tür zu. Ich ging ihm den ganzen Samstag lang aus dem Weg, aber ich wußte, daß wir uns versöhnen mußten, ehe ich die Stadt wieder verließ – ich konnte ihn nicht allein mit einem Wurf junger Hunde sitzenlassen. Außerdem bin ich schon zu alt, um an meinem Groll Freude zu haben. Am Sonntag morgen ging ich hinunter, um gut Wetter zu machen. Ich blieb sogar bis Montag zu Hause, damit wir gemeinsam zum Tierarzt gehen konnten.
Wir brachten den Hund verärgert in die Praxis – wie ein schlecht harmonierendes Elternpaar seinen mißratenen Teenager. Der Tierarzt heiterte mich ungeheuer auf, indem er mir sagte, Golden Retriever könnten bis zu zwölf Welpen bekommen.
»Aber weil es ihr erster Wurf ist, werden es vermutlich nicht ganz so viele«, fügte er fröhlich lachend hinzu.
Ich merkte, daß Mr. Contreras von der Aussicht auf zwölf kleine schwarzgoldene Fellbälle begeistert war. Auf dem Rückweg nach Kankakee fuhr ich hundertdreißig und zögerte danach meinen Auftrag so lange wie möglich hinaus.
Das war vor zwei Monaten gewesen. Inzwischen hatte ich mich mehr oder weniger mit Peppys Schicksal abgefunden und war sehr erleichtert darüber, daß sie ihr Nest im Erdgeschoß baute. Mr. Contreras maulte wegen der Zeitungen, die sie an ihrem Lieblingsplatz hinter seiner Couch zerfetzte, aber ich wußte auch, daß er zutiefst verletzt gewesen wäre, wenn sie beschlossen hätte, meine Wohnung zu ihrem Bau zu machen.
Derart kurz vor dem Termin ihrer Niederkunft verbrachte sie fast die ganze Zeit bei ihm. Nur gestern war Mr. Contreras zu einem Herrenabend seiner alten Clique ins Las Vegas gegangen. Er war seit einem halben Jahr an der Planung beteiligt gewesen und hätte ungern gefehlt. Dennoch rief er mich zweimal an, um sich zu vergewissern, daß Peppy noch keine Wehen hatte, und ein drittes Mal gegen Mitternacht, um herauszubekommen, ob ich mir auch die Telefonnummer ihres Spielkasinos aufgeschrieben habe. Es lag an diesem dritten Anruf, daß ich Schadenfreude empfand, als Peppy versuchte, ihn vor sechs zu wecken.
Die Junisonne war strahlend, aber die Luft am frühen Morgen war immer noch so kühl, daß mir die nackten Füße auf dem Verandaboden zu kalt wurden. Ich ging wieder hinein, ohne darauf zu warten, daß der alte Mann aufstand. Ich hörte immer noch Peppys gedämpftes Gebell, als ich mir die Shorts von den Beinen trat und wieder ins Bett stolperte. Mein bloßes Bein rutschte über einen feuchten Fleck auf dem Laken. Blut. Meins konnte es nicht sein, also war es das der Hündin.
Ich zog mir die Shorts wieder über und wählte die Nummer von Mr. Contreras. Gerade hatte ich Kniestrümpfe und Joggingschuhe an, als er sich meldete – mit einer so heiseren Stimme, daß ich ihn kaum erkannte.
»Ihr Jungs müßt ja gestern nacht toll gefeiert haben«, sagte ich munter. »Aber stehen Sie jetzt mal besser auf und stellen sich dem Tag – im Nu werden Sie wieder Großvater.«
»Wer ist denn dran?« krächzte er. »Wenn das ein Witz sein soll, muß ich Ihnen sagen, daß man um diese Tageszeit keine Leute anruft, und –«
»Ich bin’s«, unterbrach ich ihn. »V. I. Warshawski. Ihre Nachbarin aus dem zweiten Stock, wissen Sie noch? Hören Sie, Ihr Hündchen Peppy bellt sich seit zehn Minuten vor Ihrer Tür die Seele aus dem Leib. Ich glaub, sie will rein und ein paar Welpen kriegen.«
»Oh. Oh. Sie sind’s, Engelchen. Was soll das mit dem Hund? Peppy bellt vor meiner Hintertür. Wie lange haben Sie sie draußen gelassen? Sie sollte nicht da herumbellen, so kurz vor der Niederkunft – sie könnte sich erkälten, wissen Sie.«
Ich verkniff mir mehrere sarkastische Bemerkungen. »Gerade eben habe ich ein paar Blutflecken in meinem Bett entdeckt. Vielleicht ist sie kurz davor zu werfen. Ich komme gleich hinunter und helfe Ihnen dabei, daß alles seine Ordnung hat.«
Mr. Contreras fing nun an, mich mit komplizierten Bekleidungsvorschriften zu bombardieren. Mir kam das alles so lächerlich vor, daß ich ohne große Förmlichkeiten auflegte und wieder hinausging.
Der Tierarzt hatte betont, Peppy brauche beim Werfen keinerlei Hilfe. Falls wir uns während ihrer Wehen einmischten oder schon die erstgeborenen Welpen aufhöben, könnte sie so große Angst bekommen, daß sie mit dem Rest nicht allein fertig werde. Ich verließ mich nicht darauf, daß Mr. Contreras sich in der Aufregung des Augenblicks daran erinnern würde.
Der alte Mann schloß eben hinter sich die Türe, als ich auf dem Treppenabsatz ankam. Durch das Glasfenster bedachte er mich mit einem gequälten Blick und verschwand für kurze Zeit. Als er die Tür schließlich aufmachte, hielt er mir ein altes Arbeitshemd hin.
»Ziehen Sie das über, bevor Sie reinkommen.«
Ich wies das Hemd zurück. »Ich habe ein altes Sweatshirt an; es macht mir keine Sorgen, was das möglicherweise abkriegt.«
»Und ich mache mir keine Sorgen über Ihre blöde Garderobe. Mir liegt was dran, was Sie drunter anhaben. Oder nicht drunter anhaben.«
Ich starrte ihn verblüfft an. »Seit wann muß ich einen BH anziehen, wenn ich nach dem Hund schaue?«
Sein ledriges Gesicht nahm eine stumpfe Scharlachfarbe an. Der bloße Gedanke an weibliche Unterwäsche ist ihm peinlich, ganz davon zu schweigen, wenn sie beim Namen genannt wird.
»Es ist doch nicht wegen dem Hund«, sagte er erregt. »Ich wollte es Ihnen ja schon am Telefon sagen, aber Sie haben einfach aufgelegt. Ich weiß, wie gern Sie im Haus herummarschieren, und mir macht das nichts aus, solange Sie sich halbwegs bedeckt halten, was Sie im allgemeinen ja tun, aber das geht nicht allen so. Das ist nun mal so.«
»Glauben Sie, dem Hund macht das was aus?« Meine Stimme wurde um einige Grade lauter. »Wer zum Teufel – oh. Sie haben gestern nacht jemanden aus der Spielhölle mit nach Hause gebracht. So, so. War ein flotter Abend, was?« Normalerweise hätte ich mich über das Privatleben eines anderen Menschen nicht so vulgär geäußert, aber ich hatte das Gefühl, dem alten Mann für die Schnüffelei, die er in den letzten drei Jahren wegen meiner männlichen Besucher angestellt hatte, die eine oder andere süffisante Bemerkung schuldig zu sein.
Er wurde mahagonibraun. »Ist nicht so, wie Sie meinen, Engelchen. Überhaupt nicht. Es ist bloß ein alter Kumpel von mir. Mitch Kruger. Der hat wirklich einiges durchgemacht, seit er und ich im Ruhestand sind, und jetzt hat er einen Tritt in den Hintern bekommen, deshalb hat er sich gestern nacht an meiner Schulter ausgeweint. Natürlich – hab ich ihm gesagt – müßte er sich keine Sorgen wegen seiner Miete machen, wenn er sie nicht versaufen würde. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Es geht darum, daß er einfach die Hände nicht stillhalten kann, wenn Sie wissen, was ich meine.«
»Ich weiß genau, was Sie meinen«, sagte ich. »Und ich verspreche Ihnen, falls meine Reize den Kerl in Wallung bringen, bremse ich ihn, ohne ihm den Arm zu brechen – mit Rücksicht auf Ihre Freundschaft und sein Alter. Jetzt tun Sie mal das Hemd weg und lassen mich nachschauen, wie es Ihrer Königlichen Hundheit geht.«
Er war nicht begeistert, aber er ließ mich maulend in die Wohnung. Wie meine bestand auch seine aus vier nach dem Güterwagenprinzip angeordneten Räumen. Von der Küche kam man ins Eßzimmer, dann auf einen kleinen Flur, der zum Schlafzimmer, zum Bad und zum Wohnzimmer führte.
Mitch Kruger schnarchte laut auf der Wohnzimmercouch, mit weit offenem Mund unter der Knollennase. Ein Arm hing herunter, so daß seine Fingerspitzen den Boden berührten. Die obersten borstigen grauen Brusthaare schauten unter der Decke hervor.
Ich ignorierte ihn, so gut ich konnte, ging neben dem Sofa in die Hocke, im Schatten seiner übelriechenden Socken, und schaute nach hinten. Peppy lag auf der Seite, inmitten eines Zeitungshaufens. Sie hatte den größten Teil der letzten Tage damit verbracht, die Zeitungen zu zerfetzen und auf dem Deckenstapel, den Mr. Contreras für sie gefaltet hatte, ein Nest zu bauen. Als sie mich sah, wandte sie den Kopf ab, klopfte aber einmal schwach mit dem Schwanz, um mir zu zeigen, daß sie mir nichts übelnahm.
Ich kam wieder auf die Beine. »Ich nehme an, ihr fehlt nichts. Ich gehe nach oben und koche Kaffee. Ich bin bald wieder da. Denken Sie aber daran, daß Sie Peppy in Ruhe lassen müssen – Sie dürfen nicht zu ihr, um sie zu streicheln oder so.«
»Sie brauchen mir nicht zu sagen, wie ich den Hund behandeln soll«, schmollte der alte Mann. »Ich hab den Tierarzt bestimmt genausogut verstanden wie Sie, sogar besser, denn ich war mit ihr noch mal zu einer Nachuntersuchung bei ihm, als Sie Gott weiß wo waren.«
Ich grinste ihn an. »Stimmt. Kapiert. Aber ich weiß auch nicht, was sie von dem Geschnarche Ihres Kumpels hält – mir würde das den Appetit verderben.«
»Sie frißt doch gar nicht«, fing er an, aber dann ging ihm ein Licht auf. »Oh. Hab verstanden. Ja, ich bring ihn ins Schlafzimmer. Aber ich will nicht, daß Sie zuschauen, während ich das mache.«
Ich verzog das Gesicht. »Darauf kann ich verzichten.« Ich hatte nicht das Gefühl, ich könne den Anblick dessen verkraften, was unterhalb der schmierigen Brusthaarfransen liegen mochte.
Als ich wieder in meiner Wohnung war, fühlte ich mich plötzlich zu müde zum Kaffeekochen, ganz zu schweigen davon, Mr. Contreras die Ängste des werdenden Vaters zu nehmen. Ich zog das blutige Laken vom Bett, trat mir die Laufschuhe von den Füßen und legte mich hin.
Es war fast neun, als ich wieder aufwachte. Bis auf das Gezwitscher der Vögel, die erpicht darauf waren, Peppy bei der Mutterschaft Gesellschaft zu leisten, war die Welt jenseits meiner Wände still, eine der seltenen Aufwallungen des Schweigens, die dem Stadtbewohner ein Gefühl des Friedens vermitteln. Ich genoß es, bis kreischende Bremsen und wütendes Hupen den Bann brachen. Zorniges Geschrei – wieder einmal ein Zusammenstoß auf der Racine Avenue.
Ich stand auf und ging in die Küche, um Kaffee zu kochen. Als ich vor fünf Jahren hierherzog, war das ein ruhiges Arbeiterviertel gewesen – was hieß, daß ich es mir leisten konnte. Jetzt war es von der Sanierungswelle erfaßt worden. Während sich die Wohnungspreise verdreifachten, vervierfachte sich der Verkehr, weil adrette Läden aus dem Boden sprangen, um die anspruchsvollen Gelüste der Schickeria zu befriedigen. Ich hoffte bloß, ein BMW sei gerammt worden, nicht mein geliebter Pontiac.
Ich ließ mein Fitneßprogramm ausfallen – heute morgen hatte ich ohnehin keine Zeit zum Laufen. Gewissenhaft legte ich einen BH an, zog mir wieder die abgeschnittenen Jeans und das Sweatshirt über und kehrte auf die Entbindungsstation zurück.
Mr. Contreras war schneller an der Tür, als ich erwartet hatte. Bei seinem besorgten Gesicht fragte ich mich, ob ich nicht gleich Autoschlüssel und Führerschein holen sollte.
»Peppy hat gar nichts gemacht, Engelchen. Ich weiß einfach nicht – ich hab beim Tierarzt angerufen, aber der Doktor kommt samstags erst um zehn, und sie haben mir gesagt, es ist kein Notfall, da dürfen sie mir seine Privatnummer nicht geben. Meinen Sie nicht, Sie sollten dort anrufen und rauskriegen, ob Sie die dazu zwingen können?«
Ich grinste heimlich. Was für ein Zugeständnis, wenn der alte Mann meinte, das sei eine Lage, mit der ich besser zurechtkäme als er. »Ich will sie erst mal anschauen.«
Als wir durch das Eßzimmer in den Flur gingen, hörte ich durch die Schlafzimmertür Krugers Schnarchen.
»War es schwierig, ihn zu verlegen?« Falls sich die Hündin gestört fühlte, war sie vielleicht zu aufgeregt für einen unkomplizierten Wurf.
»Ich habe immer nur an die Prinzessin gedacht, falls Sie das meinen. Ich will keine Kritik von Ihnen hören; das hilft mir im Augenblick auch nicht.«
Ich schluckte herunter, was mir auf der Zunge lag, und folgte ihm ins Wohnzimmer. Die Hündin lag fast noch genauso da wie vorhin, als ich nach oben gegangen war, aber nun sah ich eine dunkle Lache, die sich um ihren Schwanz herum ausbreitete. Ich hoffte, das sei ein gutes Zeichen. Peppy sah, daß ich sie beobachtete, zeigte aber keine Regung. Sie zog nun den Kopf ein und fing an, sich zu lecken.
War alles in Ordnung? Es war schön und gut, einem zu erzählen, man solle sich nicht einmischen, aber was war, wenn wir sie verbluten ließen, weil wir nicht merkten, daß sie in Gefahr war?
»Was meinen Sie?« In Mr. Contreras’ ängstlich gestellter Frage spiegelten sich meine Sorgen.
»Ich glaube, ich weiß gar nichts darüber, wie man Welpen zur Welt bringt. Jetzt ist es zwanzig vor zehn. Warten wir, bis der Tierarzt in die Praxis kommt – ich hole auf alle Fälle die Autoschlüssel.«
Wir hatten eben beschlossen, Peppy ein Lager im Auto zu machen, um sie sicher in die Tierklinik zu bringen, als der erste Welpe herauskam – glatt wie Seide. Peppy stürzte sich sofort darauf, leckte das Junge ab und legte es mit Hilfe ihrer Schnauze und Vorderpfoten neben sich. Es war elf, als das nächste auftauchte, aber dann kamen sie in etwa halbstündigen Abständen. Ich fragte mich, ob sie die Prophezeiung des Tierarztes erfüllen und ein Dutzend bekommen würde. Aber gegen drei Uhr, als sich das achte kleine Geschöpf an eine Zitze drängte, beschloß sie aufzuhören.
Ich streckte mich und ging in die Küche, wo ich Mr. Contreras dabei zuschaute, wie er für Peppy einen großen Napf mit Trockenfutter, verrührten Eiern und Vitaminen zurechtmachte. Er ging so völlig in dieser Tätigkeit auf, daß er auf keine meiner Fragen reagierte, weder nach seinem Abend im Las Vegas noch nach Mitch Kruger.
Ich fühlte mich hier überflüssig. Freundinnen von mir spielten am Montrose-Hafen Softball und veranstalteten ein Picknick, und ich hatte schon halb zugesagt. Ich machte die Riegel an der Hintertür auf.
»Was ist denn, Engelchen? Wollen Sie irgendwohin?« Mr. Contreras machte beim Umrühren eine kurze Pause. »Gehen Sie nur. Sie können sicher sein, daß ich mich erstklassig um unsere Prinzessin kümmere. Acht!« – Er strahlte vor sich hin – »Acht, und sie hat es gemacht wie ein Weltmeister. Wer hätte das gedacht!«
Als ich die Hintertür zumachte, gab der alte Mann grausige Geräusche von sich. Ich war schon halb in meiner Wohnung, ehe es mir dämmerte: er sang. Ich glaube, es war das Lied »Wunderschön ist dieser Morgen«.
Abendgarderobe erwünscht
»Du bist also Geburtshelferin geworden?« zog Lotty Herschel mich auf. »Ich war immer der Meinung, du brauchst noch einen Brotberuf mit etwas sichereren Einnahmen. Aber Geburtshilfe würde ich dir heutzutage nicht empfehlen: die Versicherung würde dich ruinieren.«
Ich schnippte mit dem Daumennagel nach ihr. »Du willst bloß nicht, daß ich dir auf deinem Gebiet Konkurrenz mache. Frau erreicht in ihrem Beruf Spitzenstellung und kann es nicht ertragen, daß die Jüngeren in ihre Fußtapfen treten.«
Max Loewenthal schaute mich über den Tisch hinweg stirnrunzelnd an. Das war ausgesprochen ungerecht von mir gewesen: Lotty gehörte zu den führenden Perinatologen der Stadt und hatte immer eine Hand frei, die sie jüngeren Frauen reichte. Auch Männern.
»Was ist mit dem Vater?« wechselte Max’ Sohn Michael schnell das Thema. »Weißt du, wer es ist? Und kannst du ihn dazu bringen, Unterhalt zu zahlen?«
»Eine gute Frage«, sagte Lotty. »Wenn deine Peppy so ist wie die Teenagermütter, die ich zu sehen bekomme, wirst du aus dem Vater nicht viele Hundekuchen herausholen. Aber vielleicht springt sein Besitzer ein?«
»Das bezweifle ich. Der Vater ist ein schwarzer Labrador, der ein paar Türen weiter in unserer Straße wohnt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß Mrs. Frizell mir hilft, acht Welpen großzuziehen. Sie hat selber fünf Hunde, und ich habe keine Ahnung, woher sie das Geld für das Futter nimmt.«
Mrs. Frizell gehörte zu den Leuten, die sturen Widerstand gegen die Veredelung meiner Straße leisteten. Sie war über achtzig und der Typ der alten Frau, vor dem ich als Kind Angst gehabt hatte. Die dünnen grauen Haarbüschel standen ihr wie ein ungekämmter Koboldschopf vom Kopf ab. Sie lief im Sommer wie im Winter in derselben Kombination aus verschossenen Baumwollkleidern und formlosen Pullovern herum.
Obwohl ihr Haus dringend einen Anstrich gebraucht hätte, war es noch einigermaßen stabil. Vordertreppe und Dach waren in dem Jahr, in dem ich in meine Eigentumswohnung eingezogen war, erneuert worden. Sonst hatte ich nie gesehen, daß an dem Haus gearbeitet wurde, und ich nahm vage an, sie habe irgendwo Nachwuchs, der sich um die dringendsten Probleme kümmere. Ihr Garten fiel offenbar nicht unter diese Rubrik. Niemand mähte je den verwilderten, mit Unkraut durchwucherten Rasen, und Mrs. Frizell schienen die Büchsen und Zigarettenschachteln, die Leute über den Zaun warfen, nicht zu stören.
Der Garten war ein Stein des Anstoßes für den Ausschuß zur Verschönerung der Gegend oder wie auch immer die Aufsteiger unter meinen Nachbarn sich nannten. Für die Hunde hatten sie auch nicht viel übrig. Nur der Labrador war reinrassig; die anderen vier waren Mischlinge, die in der Größe von einem riesigen, wollweißen Tier, das wie der Filmhund Benji aussah, zu etwas rangierten, das man für einen wandelnden grauen Muff hätte halten können. Normalerweise waren die Hunde im Garten eingesperrt, bis auf zweimal am Tag, wenn Mrs. Frizell sie mit verhedderten Leinen ausführte. Aber vor allem der Labrador kam und ging, wie es ihm paßte. Er war über den anderthalb Meter hohen Zaun gesprungen, um Peppy zu besteigen und vermutlich auch andere Hündinnen. Nur wollte Mrs. Frizell das den wütenden Besuchern nicht glauben, die das behaupteten. »Er war den ganzen Tag im Garten«, blaffte sie. Und mit Hilfe der Telepathie, die manche Hunde mit ihren Besitzern verbindet, tauchte er jedesmal, wenn sie die Tür aufmachte, wie durch ein Wunder im Garten auf.
»Klingt wie ein Problem für das Gesundheitsamt«, sagte Lotty forsch. »Eine alte Frau, allein mit fünf Hunden? Ich ertrage noch nicht einmal den Gedanken an den Gestank.«
»Ja«, stimmte ich halbherzig zu.
Lotty bot Michael und seiner Begleiterin, der israelischen Komponistin Or’ Nivitsky, Nachtisch an. Michael, der in London lebte, war ein paar Tage in Chicago, um mit dem Chicago Symphony Orchestra ein Konzert zu geben. Heute bestritt er im Auditorium einen Kammermusikabend zugunsten von Chicago Settlement, einem Hilfswerk für Flüchtlinge. Max’ Frau Theresz, die vor neun Jahren gestorben war, hatte das Wohlfahrtsprojekt mit viel Hingabe gefördert. Michael hatte das heutige Konzert ihr gewidmet. Or’ spielte in dem Kammerkonzert, das sie zum Gedächtnis an Theresz Loewenthal geschrieben hatte, die Oboe.
Sie wollte keinen Nachtisch. »Premierenfieber. Und außerdem muß ich mich umziehen.« Michael war schon superelegant im Frack, aber Or’ hatte ihre Konzertrobe noch nicht an – »dann kann ich das Essen besser genießen«, hatte sie in ihrem präzisen britischen Englisch gesagt.
Als Lotty bald darauf hinauseilte, um Or’ beim Ankleiden zu helfen, ging Michael das Auto holen. Ich räumte den Tisch ab und setzte Kaffeewasser auf, mit den Gedanken mehr bei Mrs. Frizell als bei Or’s Premiere.
Ein Anwalt in der Nachbarschaft wollte sie gerichtlich dazu zwingen, die Hunde abzuschaffen. Er war bei uns gewesen, hatte versucht, Unterstützung zusammenzutrommeln. Mein Haus war geteilter Meinung – Vinnie, der sture Bankmensch im Erdgeschoß, hatte mit Freuden unterschrieben, ebenso die Koreaner im ersten Stock; sie fürchteten, ihre drei Kinder könnten gebissen werden. Nur Mr. Contreras, Berit Gabrielsen und ich wehrten uns entschieden gegen den Plan. Zwar wünschte ich mir, Mrs. Frizell würde den Labrador kastrieren lassen; eine Bedrohung waren die Hunde aber nicht. Bloß eine Belästigung.
»Machst du dir Sorgen wegen der Welpen?« Max trat hinter mich, während ich gedankenverloren vor der Spüle stand.
»Nein, eigentlich nicht. Sie sind ja sowieso bei Mr. Contreras, so daß ich sie nicht auf dem Hals habe. Ich finde es scheußlich, wenn ich mich dabei ertappe, daß ich über sie genauso ins Säuseln gerate wie er, denn es wird noch ein Alptraum, sie zum Impfen zu schleppen und so weiter. Und dann – ein Zuhause für sie finden, und diejenigen, die wir nicht weggeben können, stubenrein machen – aber sie sind hinreißend.«
»Wenn du willst, bringe ich einen Hinweis in der Krankenhauszeitung«, bot Max an. Er war der Geschäftsführer vom Beth Israel, dem Krankenhaus, in das Lotty ihre perinatalen Patientinnen schickte.
Or’ schwebte in die Küche, prächtig anzusehen in weichem, kohlenschwarzen Crêpe de Chine, der an ihrem Körper klebte wie Ruß. Sie küßte Max auf die Wange und reichte mir die Hand.
»Schön, daß ich Sie kennengelernt habe, Victoria. Ich hoffe, wir sehen uns nach dem Konzert.«
»Viel Glück«, sagte ich. »Ich bin sehr gespannt auf Ihr neues Stück.«
»Ich bin mir sicher, daß du beeindruckt sein wirst, Victoria«, sagte Max. »Ich habe die ganze Woche lang die Proben gehört.« Michael und Or’ hatten bei ihm in Evanston gewohnt.
»Ja, du bist ein Engel, Max, daß du unsere Flucherei und unsere Gekreisch sechs Tage lang ausgehalten hast. Bis nachher.«
Es war erst sechs; das Konzert fing um acht an. Wir drei aßen pochierte Birnen und Mandelcreme und ließen uns beim Kaffeetrinken in Lottys hellem, karg möblierten Wohnzimmer Zeit.
»Ich hoffe, Or’ hat sich was Genießbares ausgedacht«, sagte Lotty. »Vic und ich waren dabei, als das Kammerensemble für moderne Musik ein Oktett und ein Trio von ihr spielte. Wir sind beide mit Kopfschmerzen nach Hause gegangen.«
»Ich habe das Konzert noch nicht am Stück gehört, aber ich glaube, es wird euch gefallen. Sie hat sich bei ihrer Arbeit – wie nur wenige Israelis – mit der Vergangenheit beschäftigt.« Max schaute auf die Uhr. »Ich muß wohl auch Premierenfieber haben, aber ich möchte gern zeitig los.«
Ich fuhr. Kein vernünftiger Mensch hätte sich von Lotty chauffieren lassen. Max begnügte sich mit dem kleinen Rücksitz, den der Trans Am zu bieten hatte. Er beugte sich nach vorn und unterhielt sich über die Lehne hinweg mit Lotty. Als wir aber auf dem Lake Shore Drive waren, konnte ich sie wegen des Motorengeräusches nicht mehr hören.
Erst an der Ampel zwischen dem Inner Drive und der Congress Street bekam ich Bruchstücke ihres Gespräches mit. Lotty regte sich über Carol Alvarado auf, ihre Krankenschwester und rechte Hand in der Praxis. Max war anderer Meinung.
Die Ampel sprang um, ehe ich mitbekam, wo das Problem lag. Ich fuhr die Congress Street entlang, auf Louis Sullivans Meisterwerk zu. Lotty ruckte mit dem Kopf weg von Max und tadelte mich scharf wegen der Geschwindigkeit, mit der ich in die kurve gegangen war. Ich schaute Max im Rückspiegel an; er machte eine verkniffene Miene. Ich hoffte, die beiden planten zur Feier des Abends keinen Riesenkrach. Und überhaupt, warum sollten sie sich schon wegen Carol streiten?
In dem Halbkreis, der die Congress Street mit der Michigan Avenue verbindet, gerieten wir in einen Stau. Autos, die zur Tiefgarage auf der Südseite wollten, kamen nicht an denen vorbei, die versuchten, vor dem Theatereingang zu halten. Zwei Polizisten dirigierten verzweifelt den Verkehr, verscheuchten pfeifend Leute, die vor dem Auditorium an den Straßenrand fahren wollten.
Ich hielt am Straßenrand. »Ich laß euch hier raus und fahre zum Parkhaus.«
Max gab mir meine Eintrittskarte, bevor er sich vom Rücksitz zwängte. Obwohl ich eine Decke darauf gelegt hatte, um Peppys Spuren zu verwischen, sah ich, daß an seinem Smokingjackett rotgoldene Haare klebten, als er ausstieg. Verlegen warf ich einen verstohlenen Blick auf Lottys maßgeschneidertes, korallenrotes Abendkleid. Auch daran hingen ein paar Haare. Ich konnte nur hoffen, daß ihre Verstimmung sie ablenken würde.
Ich wendete scharf, ignorierte ein empörtes Pfeifen und schlängelte mich mit dem Trans Am durch die Monroe Street. Die Garage auf der Nordseite war nur achthundert Meter vom Auditorium entfernt, aber ich trug einen langen Rock und hohe Absätze, nicht die ideale Joggingkleidung. Ich schlüpfte neben Lotty in die Loge, die Michael uns besorgt hatte, als die Saalbeleuchtung ausging.
Michael, der im Frack streng und unnahbar wirkte, kam auf die Bühne. Er eröffnete den Abend mit den Don-Quichote-Variationen von Strauß. Das Theater war voll – Chicago Settlement war aus irgendeinem Grund ein schickes Wohltätigkeitsprojekt geworden. Es war kein Publikum von Musikliebhabern. Es wurde viel geflüstert und in den Pausen zwischen den Variationen geklatscht. Michael machte ein finsteres Gesicht, wenn er aus der Konzentration gerissen wurde. Einmal wiederholte er die letzten dreizehn Takte eines Satzes, wurde aber wieder unterbrochen. Daraufhin machte er eine wütende, wegwerfende Geste und spielte die letzten beiden Variationen, ohne auch nur nach Luft zu schnappen. Das Publikum applaudierte höflich, wenn auch nicht begeistert. Michael verbeugte sich nicht einmal, ging nur schnell von der Bühne.
Die nächste Darbietung stieß auf ein größeres Echo: der Kinderchor von Chicago Settlement sang fünf Volkslieder. Der Chor war für rigorose Proben bekannt, und die Kinder sangen mit wunderschöner Klarheit, aber was das Publikum mitriß, war ihr Aussehen. Ein PR-Genie hatte die Idee gehabt, Folklorekleidung verkaufe sich besser als Chorgewänder, deshalb schimmerten bunte afghanische Dashiki- und Samtjacken neben den bestickten weißen Kleidern der Mädchen aus El Salvador. Das Publikum brüllte nach einer Zugabe und applaudierte stehend den Solisten – einem äthiopischen Jungen und einem iranischen Mädchen.
Während der Pause ließ ich Max und Lotty in der Loge sitzen und schlenderte ins Foyer, um die Kostüme der Gönner zu bewundern – diese Herrschaften waren noch farbenprächtiger ausstaffiert als die Kinder. Wenn Lotty und Max sich selbst überlassen wurden, legten sie ihre Meinungsverschiedenheiten vielleicht bei. Lottys heftige Art läßt in allen ihren Freundschaften die Funken sprühen. Ich wollte nicht mitbekommen, was auch immer sie mit Carol am Kochen haben mochte.
Auf dem Weg aus der Loge verfing ich mich mit dem Absatz im Rocksaum. Ich war es nicht gewöhnt, mich in Abendkleidung zu bewegen. Ich vergaß ständig, kürzere Schritte zu machen; alle paar Meter mußte ich stehenbleiben und den Absatz aus den zarten Fäden ziehen.
Ich hatte den Rock vor dreizehn Jahren für eine Weihnachtsfeier der Anwaltskanzlei meines Mannes gekauft. Die reine schwarze Wolle, schwer mit Silber durchwirkt, ließ sich nicht mit Or’s maßgeschneiderter Robe vergleichen, aber der Rock war mein elegantestes Stück. Mit einem schwarzen Seidentop und den Diamanttropfen von meiner Mutter ergab er eine passende Konzertaufmachung. Allerdings fehlte ihm das theatralische Flair der Kleiderkombinationen, die ich im Foyer sah.
Besonders faszinierte mich ein bronzefarbenes Satinkleid, dessen Oberteil einem römischen Brustpanzer ähnelte und überdies noch bis zur Taille geschlitzt war. Ich versuchte dahinterzukommen, wie es die Trägerin schaffte, daß ihre Brüste nicht in der Mitte heraushingen. Vielleicht mit Leim oder Klebeband.
Als die Klingel das Ende der Pause ankündigte, kam die Frau im Brustpanzer auf mich zu. Ich dachte gerade, daß clas Diamantenhalsband offenbar die Gelegenheit für jemanden mit Donald Trumps Vorstellungen von weiblicher Aufmachung war, seinen Reichtum zur Schau zu stellen, als sich mein Absatz wieder in meinem Rock verfing. Ich drehte mich um und wollte mich befreien, als ein Mann in weißem Smokingjackett vom anderen Ende des Foyers auf uns zustürzte.
»Teri! Wo hast du denn gesteckt? Ich wollte dich mit ein paar Leuten bekannt machen.«
Der helle, gebieterische Bariton mit der schwachen Unterströmung von Gereiztheit erschreckte mich so sehr, daß ich das Gleichgewicht verlor und einer weiteren mit Diamanten überzogenen Frau in den Weg fiel. Als sie die Pfennigabsätze von meiner Schulter gelöst hatte und wir frostige Entschuldigungen ausgetauscht hatten, waren Teri und ihr Begleiter im Saal verschwunden.
Ich kannte die Männerstimme: vierundzwanzig Monate lang war ich jeden Morgen davon aufgewacht – sechs Monate voller schön quälender Erotik, während wir das Jurastudium abschlössen und uns auf das Examen vorbereiteten, und achtzehn Monate reiner Quälerei, nachdem wir geheiratet hatten. Es war, als hätte ich ihn herbeschworen, weil ich meinen besten Aufzug aus jener seltsamen Zeit trug.
Er hieß Richard Yarborough, war Partner bei Crawford, Mead, Wilton und Dunwhittie, einer der größten Kanzleien von Chicago. Nicht bloß ein Partner, sondern ein wichtiger Aufreißer in einer Kanzlei, zu deren Mandanten zwei ehemalige Gouverneure und die Leiter der meisten Firmen in Chicago gehörten, die das Magazin Fortune zu den fünfhundert erfolgreichsten amerikanischen Unternehmen zählt.
Diese Tatsachen waren mir nur bekannt, weil Dick sie beim Frühstück mit der Ehrfurcht eines Domführers herunterbetete, der Reliquienschreine vorführt. Beim Abendessen hätte er das vielleicht auch getan, aber ich war nicht bereit, bis Mitternacht mit dem Essen auf ihn zu warten.
Das war in Kürze, warum wir uns getrennt hatten – die Macht und das Geld, das er scheffelte, machten nicht genug Eindruck auf mich, und außerdem erwartete er auch noch, daß ich nach meinem Jurastudium alles hinschmiß und eine japanische Ehefrau wurde. Schon vor unserer Trennung war Dick klargeworden, daß eine Ehefrau ein wichtiger Bestandteil des männlichen Portefeuilles war und daß er eine Frau mit mehr Einfluß hätte heiraten sollen, als ihn die Tochter eines Streifenpolizisten und einer italienischen Einwanderin hatte. Es machte zwar nichts aus, daß meine Mutter Italienerin war, aber ihn störte der Makel des Einwanderertums, der an mir klebte. Das brachte er deutlich zum Ausdruck, indem er Einladungen von Peter Felitti auf sein Anwesen in Oak Brook immer dann annahm, wenn ich samstags im Frauengericht Dienst tat – »ich habe dich entschuldigt, Vic, und außerdem glaube ich sowieso nicht, daß du die Garderobe für ein Wochenende hast, wie es die Felittis planen.«
Neun Monate, nachdem unsere Scheidung rechtsgültig geworden war, heirateten er und Teri Felitti in einer Orgie aus weißer Spitze und Brautjungfern. Die Finanzkraft von Teris Vater sorgte dafür, daß die Hochzeitsfeierlichkeiten in der Presse groß herausgebracht wurden – und ich konnte nicht widerstehen, ich las alle Einzelheiten. Daher wußte ich, daß Teri damals erst neunzehn gewesen war, neun Jahre jünger als Dick. Er war letztes Jahr vierzig geworden; ich fragte mich, ob ihm Teri mit zweiunddreißig nicht allmählich zu alt aussah.
Ich hatte sie nie zuvor gesehen, aber nun konnte ich verstehen, warum Dick glaubte, sie sei ein besseres Schmuckstück für Crawford, Mead, als ich es gewesen war. Erstens lag sie nicht auf dem Boden, als die Platzanweiser damit anfingen, die Saaltüren zu schließen, zweitens mußte sie nicht sprinten, den schmutzigen Saum gerafft, damit sie den Platzanweisern zuvorkam.
Schlacht am Büfett
Ich sackte in die Loge, als Michael eben wieder mit Or’ auf die Bühne kam. Lotty hörte mich keuchen und wandte sich mir zu, mit hochgezogenen Augenbrauen. »Mußt du denn in der Pause unbedingt einen Marathonlauf machen, Vic?« murmelte sie unter der Deckung des höflichen Beifalls.
Ich machte eine wegwerfende Geste. »Zu kompliziert, als daß ich das jetzt erklären könnte. Dick ist hier, mein alter Kumpel Dick.«
»Und das hat deinen Puls so zum Rasen gebracht?« Ihre ätzende Ironie ließ mich rot anlaufen, aber ehe mir eine bissige Replik einfiel, begann Michael mit seiner Ansprache.
In ein paar schlichten Sätzen erklärte er, was seine Familie den Bürgern Londons schulde, weil sie sie aufgenommen hatten, als Europa zu einem Höllenschlund geworden war, in dem sie nicht überleben konnten. »Und ich bin stolz darauf, daß ich in Chicago aufgewachsen bin, wo die Herzen der Menschen sich ebenfalls rühren lassen, um denen zu helfen, die – aus Gründen der Rasse, der Stammeszugehörigkeit oder der Religion – in ihren Heimatländern nicht mehr leben können. Heute abend spielen wir für Sie die Uraufführung von Or’ Nivitskys Konzert für Oboe und Cello mit dem Titel Der wandernde Jude, dem Gedächtnis von Theresz Kocsis Loewenthal gewidmet. Theresz hat Chicago Settlement leidenschaftlich unterstützt; sie wäre sehr bewegt, wenn sie sehen könnte, wie Sie dieses wichtige Wohltätigkeitsprojekt fördern.«
Es war eine einstudierte Rede, schnell und wegen der Kälte des Publikums ohne Wärme gehalten. Michael verbeugte sich leicht, erst in Richtung unserer Loge, dann vor Or’. Die beiden setzten sich. Michael stimmte das Cello, dann schaute er Or’ an. Auf ihr Nicken hin fingen sie an zu spielen.
Max hatte recht. Das Konzert hatte keinerlei Ähnlichkeit mit der atonalen Kakophonie von Or’s Kammermusik. Die Komponistin hatte auf die Volksmusik des jüdischen Osteuropa zurückgegriffen, um diese Themen zu finden. Die Musik, seit fünf Jahrzehnten vergessen, wurde auf aufregende Weise wieder lebendig, als Cello und Oboe sich zögerlich einander annäherten. Ein paar durchdringende Augenblicke lang schienen sie sich in einem gemessenen Wechselspiel zu finden. Die Harmonie riß unvermittelt ab, als aus der Antiphon Feindseligkeit wurde. Die Instrumente bekämpften sich so heftig, daß ich Schweiß auf den Schläfen spürte. Sie stiegen zu einer wahnsinnigen Klimax an und verstummten dann. Selbst dieses unmusikalische Publikum hielt den Atem an, als beide auf diesem Höhepunkt eine Pause machten. Dann jagte das Cello die Oboe ins Entsetzen, und danach kam ein grauenhafter Friede, die Ruhe des Todes. Ich packte Lottys Hand, unternahm keinen Versuch, meine Tränen zu unterdrücken. Wir konnten beide nicht in den Beifall einstimmen.
Michael und Or’ verbeugten sich kurz und verschwanden von der Bühne. Obwohl das Klatschen eine Weile andauerte, fehlte der Reaktion der vitale Funke, der gezeigt hätte, daß das Publikum begriffen hatte. Die Musiker kamen nicht zurück, sondern schickten den Kinderchor auf die Bühne, der zum Abschluß des Konzerts Lieder sang.
Wie Lotty war auch Max erschüttert vom Konzert seines Sohnes. Ich bot an, sofort das Auto zu holen, aber sie wollten noch zum Empfang bleiben.
»Weil es Theresz zu Ehren ist, würde es merkwürdig aussehen, wenn Max nicht dabei wäre, wo Michael noch dazu sein Sohn ist«, sagte Lotty. »Aber wenn du gehen willst, Vic, können wir ein Taxi nach Hause nehmen.«
»Unsinn«, sagte ich. »Ich behalte euch im Auge – gebt mir ein Zeichen, wenn ihr gehen wollt.«
»Aber vielleicht siehst du Dick wieder – bist du der Aufregung gewachsen?« Lotty gab sich große Mühe, mit Sarkasmus ihre Betroffenheit zu überspielen.
Ich küßte sie auf die Wange. »Ich komm schon zurecht.«
Das war das letzte, was ich für längere Zeit von ihr zu sehen bekam. Das Konzert war kaum zu Ende, als sich eine Menschenmenge in die Treppenhäuser ergoß. Max, Lotty und ich verloren uns im Gewühl. Statt mich durch die Massen zu schieben, um die beiden einzuholen, versuchte ich sie von der Galerie aus ausfindig zu machen. Es war hoffnungslos: Max überragt Lottys einszweiundfünfzig nur um eine Handbreit. Ich verlor sie innerhalb von Sekunden aus den Augen.
Während der zweiten Konzerthälfte hatten Partylieferanten im Foyer ihre Sachen aufgebaut. Vier Tische, angeordnet zu einem riesigen Rechteck, waren mit schwindelerregenden Essensmengen vollgepackt: zu Bergen aufgetürmte Shrimps, riesige Schalen mit Erdbeeren, Kuchen, Brötchen, Salate, plattenweise rohe Austern. In der Mitte der beiden Längsseiten schwangen Männer mit weißen Mützen die Tranchiermesser über riesige Rinderkeulen und Schinken.
Die Leute stürzten sich auf den Festschmaus, der in Nu verschwand. Im ersten Ansturm auf den Shrimpsberg sah ich Teris bronzefarbenen Brustpanzer. Sie hielt sich in Dicks Kielwasser, während er sich mit dem Eifer eines Menschen, der befürchtet, um seinen gerechten Anteil betrogen zu werden, über die Shrimps hermachte. Dabei unterhielt er sich ernsthaft mit zwei Männern im Abendanzug, die über die Austern herfielen. Als sie sich langsam dem Rinderbraten in der Mitte näherten, skandierten sie ihr Gespräch, indem sie Oliven aufspießten, Krabbenkuchen, Chicoree, alles, was auf ihrem Weg lag. Teri hoppelte hinterher, offenbar im Gespräch mit einer Frau in einem blauen, dicht mit Staubperlen besetzten Kleid.
»Ich komme mir vor wie Pharao, der die Heuschrecken schwärmen sieht«, sagte eine vertraute Stimme hinter mir.
Ich drehte mich um und sah Freeman Carter – den Alibistrafverteidiger bei Crawford, Mead. Ich grinste und legte die Hand auf den feinen Baumwollstoff seines Jacketts. Unsere Bekanntschaft reichte in die Zeit zurück, in der ich bei den gesellschaftlichen Anlässen der Kanzlei noch hinter Dick hergehoppelt war. Freeman war der einzige Partner, der sich je mit dem weiblichen Anhang unterhielt, ohne sich anmerken zu lassen, er tue uns damit einen Riesengefallen; deshalb wandte ich mich mit meinen juristischen Fragen an ihn, wenn ich das Gefühl hatte, das System wolle mich durch die Mangel drehen.
»Was hast du denn hier verloren?« wollte ich wissen. »Ich hab nicht damit gerechnet, Bekannte zu treffen.«
»Liebe zur Musik.« Freeman lächelte grimmig. »Und was ist mit dir? Du bist der letzte Mensch, nach dem ich mich bei einer Veranstaltung für hundertfünfzig Mäuse umschauen würde.«
»Liebe zur Musik«, äffte ich ihn ernst nach. »Der Cellist ist der Sohn eines Freundes – muß leider sagen, daß ich hier schmarotze, nichts für die gute Sache tue.«
»Weißt du, Crawford, Mead scheint an Chicago Settlement einen Narren gefressen zu haben. Allen Partnern ist nahegelegt worden, pro Nase fünf Karten zu kaufen. Ich hab gedacht, es ist kollegial, wenn ich mitmache – als freundliche Abschiedsgeste für die Kanzlei.«
»Du gehst? Wann? Und was hast du vor?«
Freeman schaute vorsichtig über die Schulter. »Ich hab’s ihnen noch nicht gesagt, also behalt’s für dich. Es wird Zeit, daß ich eine eigene Kanzlei aufmache. Strafrecht ist bei Crawford nie besonders wichtig gewesen – ich weiß seit Jahren, daß ich die Verbindung lösen müßte –, aber es gibt in einer großen Kanzlei so viele Vorteile, daß ich einfach dabeigeblieben bin. Jetzt wächst die Kanzlei so schnell und entfernt sich so weit von der Arbeit, die ich für wichtig halte, daß es an der Zeit ist, auszusteigen. Ich sag dir – und allen meinen Mandanten – offiziell Bescheid, sobald ich mich selbständig gemacht habe.«
Ein paar Grüppchen von Leuten, die das Gedrängel unten mieden, standen plaudernd herum. Freeman schaute immer wieder zu ihnen hinüber, um sich zu vergewissern, daß sie nicht mithörten, und wechselte schließlich unvermittelt das Thema.
»Hier steckt irgendwo meine Tochter mit ihrem Freund. Ich weiß nicht, ob ich die beiden je wieder zu Gesicht kriege.«
»Ja, mit dem Paar, mit dem ich gekommen bin, geht’s mir genauso. Die beiden sind nicht besonders groß – wenn ich mich ins Getümmel stürze, finde ich sie nie im Leben. Ich hab mich übrigens schon gefragt, warum Dick hier ist. Eigentlich hätte ich gedacht, Flüchtlinge stehen auf seiner Liste ganz unten, so etwa in der Nähe von Frauen mit AIDS. Aber wenn die Kanzlei sich für Chicago Settlement stark macht, führt er natürlich den Jubelchor an.«
Freeman lächelte. »Dazu sage ich nichts, Warshawski. Schließlich sind er und ich immer noch Partner.«
»Er ist doch nicht etwa derjenige, der die Aufträge anschleppt, die dir nicht gefallen, oder?«
»Kling bloß nicht so hoffnungsvoll. Dick hat eine Menge dazu beigetragen, Crawford, Mead anzukurbeln.« Er hob die Hand. »Ich weiß, du haßt die Art von Recht, die er praktiziert. Ich weiß, du fährst liebend gern eine Schrottmühle und hast für seine deutschen Sportwagen nur Hohn und Spott übrig –«
»Ich fahre keine Schrottmühle mehr«, sagte ich mit Würde. »Ich habe einen 89er Trans Am, dessen Karosserie immer noch glänzt, obwohl ich ihn auf der Straße parken muß statt in einer Nobelgarage für sechs Autos.«
»Ob du’s glaubst oder nicht, es gibt Tage, da fragt sich Dick, ob er einen Fehler gemacht hat und ob du nicht das Richtige tust.«
»Ich weiß, gesoffen hast du nichts, weil ich nichts riechen kann – du mußt dir also was in die Nase gezogen haben.«
Freeman lächelte. »Oft kommt das nicht vor. Aber der Kerl hatte immerhin mal soviel Verstand, dich zu heiraten.«
»Komm mir bloß nicht auf die sentimentale Tour, Freeman. Oder glaubst du, es gibt Tage, an denen ich mich frage, ob nicht er derjenige ist, der das Richtige tut? Wie viele Frauen sind jetzt Partner bei Crawford? Drei, stimmt’s, von insgesamt neunundachtzig? Es gibt Tage, da wünsche ich mir, ich hätte Dicks Geld, aber es kommt nie vor, daß ich mir wünsche, das durchgemacht zu haben, was eine Frau tun muß, um in einer Kanzlei wie eurer Erfolg zu haben.«
Freeman lächelte versöhnlich und schob meine Hand unter seinen Arm. »Ich bin nicht hergekommen, um meine streitlustigste Mandantin zu vergraulen. Komm, heilige Johanna. Ich mache dir den Weg zur Bar frei und hole dir ein Glas Champagner.«
In der kurzen Zeit, in der wir uns unterhalten hatten, waren die Shrimpsberge verschwunden, und fast alle Erdbeeren waren fort. Die Rinderkeulen schienen noch standzuhalten. Ich musterte die Menge, als wir die Treppe hinuntergingen, konnte aber weder Lotty noch Max ausmachen. Teris bronzefarbenes Kleid war auch verschwunden.
Ich versuchte, in Freemans Nähe zu bleiben, doch als wir ins Erdgeschoß kamen, erwies sich das als schwierig. Jemand drängelte sich zwischen uns, und ich verlor seinen Arm. Danach folgte ich in Schlangenlinien den kurzgeschnittenen goldenen Haaren in seinem Nacken durch das Geschiebe, aber eine Frau in rosa Satin mit herunterhängenden Schmetterlingsflügeln brauchte jede Menge Platz, und Freeman war plötzlich verschwunden.
Eine Weile ließ ich mich mit dem Strom treiben. Der Lärm war stark, hallte von den Marmorsäulen und vom Marmorboden wider. Er füllte meinen Kopf mit einem weißen Rauschen. Es wurde mir unmöglich, mich auf ein Ziel zu konzentrieren, zum Beispiel nach Lotty zu suchen; meine ganze Energie mußte herhalten, mein Gehirn vor dem Anprall des Lärms zu schützen. Es war ausgeschlossen, daß jemand in dieser Löwengrube ein Gespräch führen konnte – jeder brüllte, weil es Spaß machte, zu dem Krawall beizutragen.
Einmal stieß mich das Gedränge in die Nähe der Büfetttische. Die Männer hinter den Fleischtheken standen ausdruckslos auf ihrer kleinen Insel, rührten nur beim Tranchieren und Vorlegen die Hände. Die Shrimps waren weg, genau wie alle warmen Speisen. Außer dem Fleisch – jetzt fast bis auf die Knochen abgesäbelt – waren nur noch die durchwühlten Salate übrig.
Ich tauchte wieder in die Flut und kämpfte mich durch die Strömung. Geschickte Ellbogenarbeit brachte mich zu den Säulen zwischen den Saaltüren und dem Foyer. Dort wurde die Menge dünner; Menschen, die sich unterhalten wollten, konnten die Köpfe so nahe zusammenstecken, daß sie sich hörten. Michael und Or’ bildeten eine Gruppe mit sechs Leuten, die ernste Gesichter machten. Ich ging wortlos vorbei, für den Fall, daß es sich um wichtige Gönner handelte, und entkam in den Saal.
Dick stand direkt hinter der Tür zu meiner Rechten und sprach mit einem Mann um die Sechzig. Obwohl ich wußte, daß er hier war, setzte mein Herzschlag für einen Moment aus. Keine romantische Begeisterung, nur ein Schreck – etwa so, wie wenn man auf glattem Boden den Halt verliert. Dick wirkte auch erschrocken – er brach einen flüssigen Satz mitten im Wort ab und starrte mich mit offenem Mund an.
»Hi, Dick«, sagte ich schwach, »ich hatte ja keine Ahnung, daß du ein Cello-Fan bist.«
»Was hast du denn hier verloren?« wollte er wissen.
»Ich soll den Saal fegen. In letzter Zeit muß ich jede Arbeit nehmen, die ich kriegen kann.«
Der Mann um die Sechzig sah mich mit unverhohlener Ungeduld an. Ihm war gleich, wer ich war oder was ich machte, wenn ich nur schnell verschwand. Auch den Kinderchor beachtete er nicht; von der Verantwortung befreit, engelhaft auszusehen, jagten sich die Kinder durch die Sitzreihen, kreischten wild und bewarfen sich mit Brötchen und Kuchenstücken.
»Schön, ich bin mitten im Gespräch, fang also auf der anderen Seite an.« Dick hatte durchaus Sinn für Humor, wenn es nicht auf seine Kosten ging.
»Mauschelgeschäfte?« Ich versuchte, demütige Bewunderung in meine Stimme zu legen. »Vielleicht könnte ich dir zuschauen und ein paar Tips abstauben, damit ich zum Kloscheuern befördert werde.«
Dicks sauber rasierte Wangen liefen rot an. Er war schon im Begriff, eine kurze Beleidigung auszuspucken, machte aber ein Auflachen daraus. »Wie lange ist es her – dreizehn Jahre? vierzehn? –, und du weißt immer noch, wie du mich blitzschnell auf die Palme bringen kannst.«
Er packte mich an der Schulter und schob mich auf seinen Gesprächspartner zu. »Das ist Victoria Warshawski. Sie und ich haben beim Jurastudium den Riesenfehler gemacht, uns einzubilden, daß wir uns liebten. Teris und meine Kinder werden erst fünf Jahre lang arbeiten müssen, ehe ich ihnen erlaube, ans Heiraten auch nur zu denken. Vic, das ist Peter Felliti, der Vorstandsvorsitzende von Amalgamated Portage.«
Felitti hielt mir widerwillig die Hand hin – weil ich die Vorgängerin seiner Tochter war? Oder weil er nicht wollte, daß ich bei Finanzgesprächen auf hoher Ebene störte? Er wandte sich Dick zu: »Ich kann mich nicht an die Einzelheiten der Scheidungsvereinbarung erinnern. Hast du seit damals für deine Sünden zahlen müssen, Yarborough?«
Ich quetschte Felittis Finger so kräftig, daß er zusammenzuckte. »Nicht die Spur. Dick hat sich mit meinen Unterhaltszahlungen bei Crawford, Mead eingekauft. Aber jetzt, wo er auf eigenen Füßen steht, will ich das Gericht dazu bewegen, sie zu streichen.«
Dick verzog das Gesicht. »Muß das sein, Vic? Ich schwöre mit Freuden, daß du mich nie auch nur um zehn Cent gebeten hast. Sie ist Anwältin«, fügte er für Felitti hinzu, »arbeitet aber als Detektivin.«
Er wandte sich wieder mir zu und sagte quengelig. »Bist du jetzt zufrieden? Können Pete und ich unser Gespräch beenden?«
Ich löste mich mit soviel Anmut wie möglich von Dicks Arm und von dem Gespräch, als Teri hereinkam, die Frau in perlenbesetztem blauen Satin im Schlepptau.
»Da seid ihr ja«, sagte die Frau in Blau fröhlich. »Harmon Lessner möchte unbedingt mit euch beiden reden. Ihr könnt euch jetzt nicht einfach davonschleichen und Geschäfte besprechen.«
Teri beäugte mich gründlich, versuchte sich schlüssig zu werden, ob ich eine Geschäftsbekanntschaft oder eine sexuelle Rivalin war. Champagner hatte für einen rosigen Hauch unter ihrer Teintgrundierung gesorgt, aber obwohl es spät geworden war, ihr Make-up war immer noch perfekt: der Lidschatten auf den Augendeckeln, wo er hingehörte, statt über das Gesicht zu laufen; ihr Lippenstift, ein gedämpfter Bronzeton, eine Nuance schwächer als der ihres Kleides, frisch und schimmernd. Das kastanienbraune Haar, zu einem komplizierten Knoten geflochten, sah aus, als käme sie eben vom Friseur. Kein Gekräusel, keine offenen Strähnen im Nacken verdarben die Wirkung.
Derart spät am Abend wußte ich, ohne in den Spiegel zu schauen, daß mein Lippenstift fort und das bißchen Form, in das ich meine kurzen Locken gebracht hatte, schon lange verschwunden war. Ich hätte mir gern gesagt, meine Persönlichkeit sei interessanter, aber Dick interessierte sich nicht für Frauen mit Persönlichkeit. Am liebsten hätte ich Teri gesagt, sie brauche sich keine Sorgen zu machen, sie sehe blendend aus und werde deshalb die Oberhand behalten, aber ich winkte allen vier andeutungsweise zu und ging wortlos zur Tür auf der anderen Seite.
Als ich Lotty schließlich fand, war es nach Mitternacht. Sie war allein, fröstelte in einer Ecke des Außenfoyers, hatte die Arme um sich gelegt.
»Wo ist Max?« fragte ich scharf und zog Lotty an mich. »Du mußt nach Hause, mußt ins Bett. Ich suche ihn und hole das Auto.«
»Er ist mit Or’ und Michael gegangen. Du weißt doch, daß sie bei ihm wohnen. Mir fehlt nichts, wirklich, Vic. Es sind bloß die Erinnerungen, die das Konzert aufgewühlt hat. Ich komme mit zum Auto. Die frische Luft wird mir guttun.«
»Hast du dich mit Max gestritten?« Ich hatte nicht fragen wollen, aber die Worte kamen unvermittelt heraus.
Lotty verzog das Gesicht. »Max glaubt, daß ich Carol schlecht behandle. Und vielleicht stimmt das.«
Ich lotste sie durch die Drehtür. »Was ist mit ihr?«
»Das hast du nicht gewußt? Sie hat gekündigt. Aber das macht mir nichts aus. Na ja, natürlich macht es mir etwas aus – wir arbeiten seit acht Jahren zusammen. Sie wird mir fehlen, aber ich würde sie nie daran hindern, die Stelle zu wechseln, etwas Neues auszuprobieren. Es geht darum, warum sie gekündigt hat. Es treibt mich zum Wahnsinn, wie sie sich von dieser Familie beherrschen läßt – und jetzt behauptet Max, ich habe kein Mitgefühl. Ich bitte dich!«
Auf der Heimfahrt sprach sie über das Konzert und über die bissigen Bemerkungen, die Theresz über die Versammlung aus unmusikalischen Parvenüs bei ihrem Gedächtniskonzert gemacht hätte. Erst als ich vor ihrer Tür hielt, erlaubte sie mir, das Gespräch wieder auf Carol zu bringen.
»Was sie vorhat? Das weißt du nicht? Sie will zu Hause bleiben und irgendeinen verfluchten Vetter ihrer morbiden Mutter pflegen. Er hat AIDS, und Carol meint, es ist ihre Pflicht, sich um ihn zu kümmern.«
Sie schlug die Autotür zu und wirbelte ins Haus. Ich spürte, wie mir die kalten Finger der Depression über die Schultern krochen. Arme Carol. Arme Lotty. Und arme Vic: ich wollte nicht zwischen die beiden geraten. Ich wartete, bis in Lottys Wohnzimmer das Licht anging, und brachte den Trans Am wieder auf Touren.
Rye auf Eiern
In dieser Nacht schlief ich schlecht. Der Gedanke an Lotty, die in der Dunkelheit fröstelnd an ihre toten Angehörigen dachte, brachte die Alpträume über die tödliche Krankheit meiner Mutter zurück. Ich näherte mich durch das Gewirr aus Schläuchen und Geräten Gabriellas Bett und sah auf den Kissen Lottys Gesicht. Sie starrte mich mit leerem Blick an, drehte sich dann weg. Ich kam mir vor wie in Gaze gewickelt, konnte mich nicht rühren, konnte nicht sprechen. Als mich die Türklingel ins Bewußtsein zurückholte, war das Aufwachen eine Erleichterung.
Ich hatte im Schlaf geweint. Die Tränen verklebten mir die Lider, und ich wankte zur Tür, als die Klingel wieder schrillte. Es war die Klingel an der Wohnungstür. Ich sah nicht so deutlich, daß ich die Person auf der anderen Seite des Spions hätte erkennen können.
»Wer ist da?« rief ich heiser durch die Tür.
Ich legte das Ohr an den Rahmen. Erst verstand ich nur sinnloses Gebrabbel, aber schließlich begriff ich, daß es Mr. Contreras war.
Ich zog die Riegel auf und machte die Tür einen Spalt weit auf. »Moment«, krächzte ich, »ich muß mir was anziehen.«
»Tut mir leid, daß ich Sie wecke, Engelchen, ich meine, es ist halb zehn, und normalerweise sind Sie dann schon auf, aber Sie müssen spät nach Hause gekommen sein, und natürlich bin ich früh zu Bett gegangen, weil ich so erledigt war, nachdem ich ›Ihrer Hoheit‹ beigestanden –«
Ich schlug die Tür zu und stapfte ins Bad. Ich ließ mir unter der Dusche Zeit. Wenn mit Peppy etwas nicht in Ordnung gewesen wäre, hätte er es gleich gesagt. Das war zweifellos nur eine Bagatelle: ein Welpe wollte nicht saugen, oder Peppy hatte die Eier mit Speck verschmäht, die der alte Mann ihr angeboten hatte.
Ehe ich hinunterging, kochte ich mir eine Tasse starken Kaffee und trank ihn in großen, brühendheißen Schlucken. Danach fühlte ich mich weder ausgeruht noch erfrischt, aber wenigstens schaffte ich die Treppe.
Mr. Contreras schoß heraus, als ich bei ihm klingelte. »Oh, da sind Sie. Ich hab schon geglaubt, Sie sind wieder ins Bett gegangen, und wollte nicht stören. Ich hab gedacht, weil Sie doch gestern abend mit der Frau Doktor aus waren, wird es nicht so spät, aber Sie müssen noch jemand getroffen haben.«
Sein dauerndes Herumgestocher in meinem Liebesleben brachte mich manchmal zum Schreien. Der Schlafmangel machte mich besonders gereizt.
»Könnten Sie bloß einmal, als nobler Versuch, so tun, als ob mein Privatleben meine Privatsache wäre? Sagen Sie mir, wie es Peppy geht und warum Sie mich unbedingt wecken mußten.«
Er hob versöhnlich die Hände. »Nicht nötig, daß Sie mir die Fiedel auf dem Haupt zerschlagen, Engelchen. Ich weiß, daß Sie ein Privatleben haben. Deshalb hab ich ja bis halb zehn gewartet. Aber ich wollte unbedingt mit Ihnen reden, bevor Sie den ganzen Tag lang weg sind. Seien Sie nicht sauer.«
»Okay, ich bin nicht sauer.« Ich versuchte, die Stimme ruhig zu halten. »Sagen Sie mir, wie sich Ihre Königliche Hundheit fühlt. Und wie geht es den Kleinen?«
»Alles in Ordnung. Die Prinzessin ist ein Champion, aber das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Wollen Sie sie sehen? Sie haben doch saubere Hände, oder?«
»Ich habe mich eben von Kopf bis Fuß abgeschrubbt, und die Jeans sind frisch gewaschen«, sagte ich ernst.
Mr. Contreras ließ mich in sein Wohnzimmer. Peppy lag immer noch hinter dem Sofa, aber der alte Mann hatte ihr Nest gesäubert, ihr einen frischen Stapel weicher Tücher gegeben, auf dem sie liegen konnte. Die acht Fellkugeln wanden sich an ihren Zitzen und jaulten leise, wenn einer von der Gier des anderen vertrieben wurde. Peppy schaute mich an und klopfte mit dem Schwanz, um mir zu zeigen, daß wir immer noch Freunde waren, aber ihre ganze Aufmerksamkeit galt ihren Kleinen, die noch zu blind und hilflos waren, als daß sie ohne ihre Hilfe hätten überleben können.
»Hin und wieder steht sie auf, damit sie raus kann, aber immer nur dreißig Sekunden lang, dann ist sie wieder auf dem Posten. Was für ein Champion. Mann, oh, Mann.« Mr. Contreras schmatzte mit den Lippen. »Natürlich geb ich ihr regelmäßig Futter, genau, wie’s der Tierarzt gesagt hat, Sie brauchen sich also wirklich keine Sorgen wegen ihr zu machen.«
»Mach ich mir auch nicht.« Ich ging vorsichtig neben der Kinderstube in die Knie und langte langsam hinter die Couch, ließ Peppy Zeit zum Knurren, falls sie das wollte. Sie schaute mißtrauisch zu, als ich ihre Jungen streichelte. Ich hätte gern eins hochgehoben – ihre winzigen Körper hätten gerade in meine Handfläche gepaßt –, aber ich wollte Peppy nicht erschrecken. Sie wirkte erleichtert, als ich aufstand.
»Und wo brennt’s denn dann?« fragte ich. »Hat Ihr alter Kumpel Claras Silber geklaut, oder was ist los?« Mr. Contreras’ tote Frau hatte ein Leuchterpaar und einen silbernen Salzstreuer hinterlassen, die er niemals benützte, aber er brachte es auch nicht übers Herz, sie seiner Tochter zu vermachen.
»Nein, so was nicht. Aber ich möchte, daß Sie mit ihm reden. Er hat was auf dem Herzen, das er zur Mördergrube macht. Ich hab nicht die Zeit, rauszukriegen, was er vorhat. Außerdem ist es nicht gut für die Prinzessin, wenn er dauernd vor ihren Jungen säuft und dann die ganze Nacht lang auf der Couch schnarcht, wie er’s nun mal macht, direkt über ihrem Kopf. Ich muß ihn heute noch hier rausschaffen.«
»Mein Freund, ich kann ihn nicht zu den Anonymen Alkoholikern schleppen.«
»Darum habe ich Sie auch gar nicht gebeten. Herr und Heiland, Sie sind ja schneller mit Schlußfolgerungen bei der Hand als ein Floh, der sich auf einen Hund stürzt.«
»Warum sagen Sie mir dann nicht endlich, worin das Problem besteht, statt auf den Busch zu klopfen – wenn man Ihnen zuhört, ist das wie das Gesurr eines Moskitos, der eine Stunde lang herumschwirrt, während man sich fragt, wo er landen wird.«