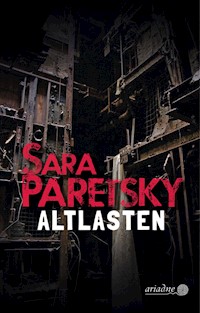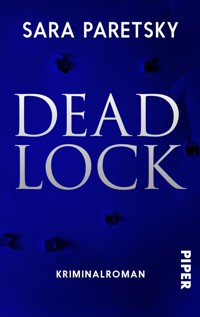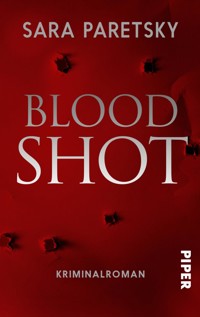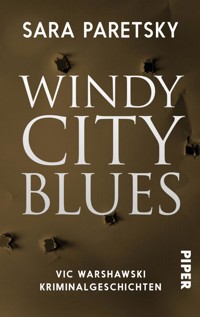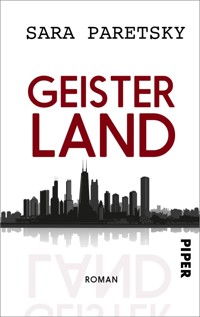
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Facettenreich erzählt Sara Paretsky von den Machtstrukturen der amerikanischen Gesellschaft, gegen die ihre eigenwilligen Frauenfiguren mutig und respektlos aufbegehren Mara und Harriet sind die Enkelinnen des berühmten Neurochirurgen Dr. Stonds. Mara ist das schwarze Schaf der Familie. Sie spürt, dass sie anders ist als ihre erfolgreiche Schwester, eine Rechtsanwältin. Im Kampf einer Obdachlosen gegen die Manager eines Luxushotels stehen die Schwestern auf verschiedenen Seiten, bis sie beide von der dunklen Vergangenheit ihrer Familie eingeholt werden. »Sara Paretsky verbindet Spannung mit farbigen Schilderungen der Großstadt Chicago. Die Geschichte der Tochter aus gutem Haus und der Obdachlosen verleiht diesem Kriminalroman vor dem Hintergrund eines Familiendramas ungewohnte und unterhaltsame Aspekte« Norddeutscher Rundfunk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Sonja Hauser
ISBN: 978-3-492-98383-9
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2018
© 1998 Sara Paretsky
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Ghostcountry«
© Delacorte Press, New York 1998
Published by arrangement with Sara and Two C-Dogs Inc.
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1998
Covergestaltung: Favoritbüro München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Die Diva wärmt sich auf
Die Hölle
Das häßliche Entlein
Die Frau an der Wand
Performance hinter den Kulissen
Hagar’s House
Open-air-Klinik
Unsanftes Erwachen
Bibelstunde
Ausgezählt
Nach dem Aufruhr
Waschen Sie Ihre Hände in Blut
Beschwörung der Göttin
Barballaden
Ins kalte Wasser geworfen
Verloren im Raum
Blitz und Donner vom Großen Weißen Chef
Die Vorhölle
Die Eiskönigin in der Unterwelt
Die Eiskönigin kommt ins Schleudern
Die heilige Becca erschlägt einen Drachen
Endlich frei?
Die vaterlose Waise
Die Zelte werden abgebrochen
Die Vergangenheit wird ausgegraben
Sintflut
Starr
Flucht aus der Klapsmühle
Die große Schwester läßt los
Ein Abend in der Oper
Ein Opfer für die Jungfrau
Geschwüre, Skorbut und Aussatz
Der Laufbursche des Großen Weißen Chefs
Noch einmal in den Kampf, Freunde
Die Klagemauer
Eine Opernaufführung
Prinzessin in Schwierigkeiten
Rummel an der Garage
Wunder
Zeig uns deine Möpse, Schätzchen
Die Truppen sammeln sich
Palastrevolte
Unter dem zunehmenden Mond
Auf der Flucht
Die Anwältin als Bittstellerin
Ketzer in der Kirche
Traubensaft zu Wein
Die Diva in Gefahr
Mutter der Metzen
Mord in der Kirche
Und die Wand stürzte ein
Der Tapferste der Trojaner
Extravorstellung im Krankenhaus
Das Gesicht im Spiegel
Eine Dame verschwindet
Beisetzungsriten
Der Schwan
Danksagung
Widmung
Für Enheduannaund alle vermißten Poeten
Die Diva wärmt sich auf
Irgendwo in der Ferne brummte ein Cello. Sie versuchte mit aller Macht, sich zu erinnern, was das bedeutete: ein wütender Mensch, der kam, um ihr weh zu tun. Sie bemühte sich, auf die Beine zu kommen, aber sie hatte das Gefühl, irgend etwas ziehe sie nach unten. Vielleicht hatte auch jemand Gewichte an ihren Beinen befestigt, als sie vor der Madonna kniete. Das Cello wurde lauter, und sie geriet in Panik. Sie kämpfte mit ihrem Nachthemd, das sich um ihre Taille bauschte. Dann sah sie den Mann, der sich über sie beugte, das Gesicht rot-schwarz vor Zorn.
»Nein, bringen Sie mich nicht um! Ich war’s nicht, es war jemand anders! Die haben Gewichte an meinen Beinen befestigt!« Sie hörte sich selbst lachen, völlig nackt unter seinem Blick, und ihre Stimme hallte von Decke und Wänden wider. »Schauen Sie: Ich verberge nichts!«
»Verdammtes Miststück!« zischte er. »Ich wünschte, ich könnte dich umbringen!«
Er packte ein Kissen und drückte es ihr aufs Gesicht. Jemand anders packte ihre Arme und Beine, mit denen sie wild um sich schlug, wickelte sie in Laken und band sie fest um ihren Körper. Sie hustete, würgte, betete um Luft, und plötzlich war sie wach.
Sie tastete ihren Hals ab. Die Muskeln waren so angespannt, daß ihr diese Berührung weh tat. Sie erinnerte sich jetzt nicht mehr an den Traum und auch nicht an die Vorfälle der vergangenen Nacht, aber ein unheilverkündender Schatten lag über ihrem Bewußtsein. Sie streckte die Hand nach ihrem Morgenrock aus, doch ihre Finger griffen ins Leere. Angst schnürte ihr die Kehle zu: Sie lag in einem Doppelbett, nicht ihrem eigenen Himmelbett, und sie hatte sich schlafen gelegt – oder hatte jemand anders sie ins Bett gebracht? –, ohne sich auszuziehen. Ihre Seidenbluse hatte sich nach oben geschoben, als sie schlief, und formte jetzt einen unbequemen Wulst um ihre Taille.
Sie schlug die Decke zurück und sprang auf, viel zu schnell: Das Zimmer begann sich zu drehen, und ihre bestrumpften Füße rutschten auf den Dielen weg. Ihr Magen rebellierte. Gerade noch rechtzeitig fand sie einen Papierkorb. Sie hatte in den letzten Stunden nicht viel gegessen; aus ihrem Magen kam nur saure grüne Flüssigkeit.
Kniend suchte sie auf dem Nachttischchen nach Papiertüchern. Dann fiel ihr Blick auf einen Radiowecker. Ein Uhr. Konnte das stimmen? Die Jalousien waren heruntergelassen, aber an den Rändern drang Sonnenlicht herein. Also konnte es nicht ein Uhr morgens sein – aber was tat sie am hellichten Tag in einem fremden Bett? Es sei denn, die Uhr ging nicht richtig.
Sie war in La Bohème gewesen. Möglicherweise ist es ganz amüsant zu sehen, was eine kleine Truppe daraus macht, hatte sie gedacht. Deshalb also trug sie ihren Rock aus schwarzer Shantungseide. Sie erinnerte sich noch daran, sich angezogen zu haben, und wenn sie sich sehr konzentrierte, sogar daran, daß sie zusammen mit ihrem Begleiter einen Drink genommen hatte, bevor sie sich auf den Weg machten. Das war so gegen sechs gewesen. Sie waren in einem Restaurant gewesen; der Kellner war ziemlich unhöflich zu ihr; aber von der Aufführung wußte sie nichts mehr. Vielleicht hatten sie sie gar nicht besucht. Wie hatte ihr Begleiter überhaupt geheißen? Ein Bewunderer – von denen gab es zu viele, als daß sie sich an jeden einzelnen erinnerte. Dieser Mann hatte ihr in den letzten sechs Wochen sogar seine Wohnung zur Verfügung gestellt, aber er trank beim Abendessen oft so viel, daß er im Theater einschlief.
Neben dem Radiowecker befand sich ein Familienfoto – Becca, verkleidet als Esther für eine Aufführung der Sonntagsschule, dunkle, borstige Korkenzieherlocken umrahmten ihr Gesicht, und Harry, der sie anschmachtete. Becca war das genaue Ebenbild von Harry mit ihrem runden Gesicht und den Grübchen in den Wangen – aber sie war hübsch, und Harry sah aus wie ein Frosch. Sie selbst hatte immer Vasti, die sich gegen die sinnlosen Befehle des Königs wehrte, interessanter gefunden als die hirnlose Esther.
Also war sie in Harrys und Karens Gästezimmer – wie dumm von ihr, es nicht zu erkennen, obwohl sie es schon so lange kannte. Harry hatte sie gezwungen, Italien zu verlassen, wie immer mit einer Klage über ihre Verschwendungssucht. Wenn sie zu Hause wäre – in ihrem wirklichen Zuhause in New York, nicht in der Wohnung, in der sie die letzten Wochen verbracht hatte –, würde sie sich einen Tee und eine Masseurin kommen lassen.
Wenigstens konnte sie duschen. Sie zog ihre Strumpfhose aus und ließ sie zu Boden gleiten. Das Gästebad befand sich am anderen Ende des Flurs, also konnte sie sich nicht hier ausziehen, aber wenigstens würde sie sich ihres Büstenhalters entledigen. Er hatte sich in der Nacht nach oben verschoben und schnitt ihr nun in die Brust. Sie hatte das Gefühl, als wolle sie jemand erwürgen.
Vorne auf ihrer Bluse war ein großer Fleck. War der schon drauf gewesen, als sie sie angezogen hatte? Hoffentlich war sie nicht so ins Restaurant gegangen.
Sie hängte die Bluse um die Schultern, die Seide kühl auf ihren Brustwarzen. Vielleicht war sie lang genug, um sie als Morgenmantel verwenden zu können. Gerade als sie die Blusenzipfel bis zu ihren Oberschenkeln herunterzog, hörte sie Harry brüllen: »Will sie den ganzen Tag verschlafen? Was denkt sie eigentlich, wo sie ist? In New York, im verdammten Plaza Hotel vielleicht?«
Dann eine Frauenstimme, zu leise, als daß sie beurteilen konnte, ob sie Karen oder Becca gehörte, und wieder Harry, der brüllte: »Geh rauf und weck sie. Sie schläft seit vier, schon viel länger als ich. Ich will mit Ihrer Hoheit sprechen.«
Dann ein zaghaftes Klopfen, und Becca streckte den Kopf zur Tür herein. »Ach, du bist wach. Daddy möchte mit dir sprechen.«
Sie deutete auf ihren Hals und schüttelte den Kopf.
»Du hast die Stimme verloren?« fragte Becca und kam ganz ins Zimmer. Sie war vierzehn, die Zähne weiß hinter ihrer Spange, die Haare aber immer noch ziemlich widerspenstig. Sie trug jetzt nicht die fließende blaue Robe von Esther, sondern Pullunder, Shorts und Springerstiefel.
»Janice? Bist du wach? Wir müssen uns unterhalten!« Harrys laute Stimme ließ sie zusammenzucken.
»Sie hat die Stimme verloren!« rief Becca zurück, die offenbar ihre Freude an der Dramatik des Augenblicks hatte.
»Dann soll sie sie verdammt noch mal suchen!«
Harry stürmte ins Zimmer, doch als er ihre Brüste unter der Seidenbluse sah, wurde er rot und wandte den Blick ab. Er packte Becca und versuchte, sie aus dem Zimmer zu schieben.
Doch Becca befreite sich aus seinem Griff. »Mein Gott, Daddy, du tust gerade so, wie wenn die Leute, die ich kenne, keine Brüste hätten. Wir sehen uns nach dem Fußballspielen immer nackt. Und meinen eigenen Busen kann ich mir doch auch anschauen.«
»Red nicht so mit mir, ich bin keiner von deinen Schulkameraden.« Das kam ganz automatisch und klang nicht sonderlich überzeugend. »Janice, knöpf deine verdammte Bluse zu und kommt mit in die Küche. Wir müssen miteinander reden.«
Jemand hatte ihre Jacke und ihre Handtasche neben der Frisierkommode auf den Boden fallen lassen. Sie hob die Jacke auf, hängte sie mit großer Geste ordentlich über einen Stuhlrücken und zupfte die Ärmel zurecht, während Harry sie hilflos von hinten anfauchte. Dann suchte sie ebenso theatralisch in ihrer Handtasche nach einem Stift. HEISSER TEE schrieb sie in Großbuchstaben auf die Rückseite eines Umschlags, den sie auf der Frisierkommode fand, und dann DUSCHE. Sie reichte Becca das Kuvert und ging den Flur entlang zum Bad, wo sie die Wasserhähne aufdrehte, um Harrys Proteste zu ertränken.
Als der Wasserdampf sich im Bad ausbreitete, trat sie in die Dusche und begann die Muskeln in ihren Schultern zu kneten.
Sie hielt den Wasserstrahl in ihren Mund, so daß er ihren Hals von innen massieren konnte, gurgelte ein bißchen und wandte dann den Rücken dem Wasser zu. Sanft ließ sie ihre Zunge über die Schneidezähne rollen. Mit leisen Trillern bewegte sie sich im mittleren Bereich ihres Stimmumfangs auf und ab, kaum, daß etwas zu hören war. Als ihre Nackenmuskeln sich zu entspannen begannen, versuchte sie es mit ein paar Vokalübungen, immer noch im mittleren Bereich, doch diesmal ein bißchen lauter.
Nach ungefähr zwanzigminütigen Vokalübungen hämmerte jemand an die Badezimmertür, doch sie reagierte nicht, weil sie wußte, daß es Harry war. Sie konnte sich nicht nur denken, was er zu sagen hatte, sondern würde sich obendrein erkälten und müßte mit ihren Übungen noch einmal von vorne anfangen, wenn sie jetzt damit aufhörte. Also lockerte sie noch weitere zehn Minuten lang ihre Stimme mit Hilfe des Dampfes, bis sie glaubte, aus der Dusche steigen und ihre Übungen im Musikzimmer fortsetzen zu können.
Sorgfältig legte sie ein Handtuch um ihren Hals, bevor sie die Duschkabine verließ, und nahm es erst wieder weg, als sie sich abgetrocknet hatte. Dann kickte sie die benutzten Handtücher hinüber in Richtung des Korbes für die schmutzige Wäsche.
An der Tür hing ein Morgenmantel aus Baumwolle. Der gehörte sicher Karen, denn er hatte ein tiefrotes Blumenmuster und mehrere Schichten Spitze an den Ärmeln, aber niemand würde sie darin sehen, und das Ding war immer noch besser als ihre schmutzige Bluse.
Der Morgenmantel wurde durch ein kompliziertes System von Bändern zusammengehalten; sie versuchte, den Mantel so hoch wie möglich um ihren Hals zu schließen, um diesen vor der Luft aus der Klimaanlage zu schützen. Um sicherzugehen, nahm sie noch ein Handtuch aus dem Schrank und legte es sich um den Hals. Sie hielt ihre Seidenbluse über den Berg von feuchten Handtüchern: Karen würde doch sicher daran denken, sie reinigen zu lassen, und sie nicht einfach in die Waschmaschine stopfen, oder? Sie würde es ihr sagen, sobald sie mit ihren Übungen fertig war.
Natürlich hatte Harry kein richtiges Musikzimmer, aber im Wohnzimmer befand sich ein ziemlich schlecht gestimmtes Klavier, das Instrument aus dem Haus ihrer Eltern, das sie benutzt hatte, als sie mit dem Singen anfing. Als sie am Schlafzimmer vorbei und die Treppe hinunterging, summte sie vor sich hin. Das Geräusch hallte in ihrem Kopf wider, und das Brummen sagte ihr, daß ihr Atem mühelos floß. Becca rannte hinter ihr her und reichte ihr eine große Tasse mit lauwarmem Tee. Sie blieb nicht stehen und hörte auch nicht auf zu summen, schenkte ihr aber ein hoheitsvolles Nicken.
Vor dem Klavier ließ sie das Summen wieder zu Vokalen und dann zu Trillern werden. Nach einer halben Stunde war sie völlig verschwitzt, aber zufrieden mit ihrer Stimme. Bereits nach einer Viertelstunde hatte sie den Tee ausgetrunken und die Hand mit der Tasse ausgestreckt, damit sie wieder aufgefüllt würde. Als Becca nicht reagierte, hatte sie sich überrascht umgedreht und festgestellt, daß sie allein im Zimmer war. Früher hatte das Mädchen ihr immer gern bei ihren Übungen zugehört. Immer noch summend, war sie ins Bad gegangen und hatte die Tasse mit heißem Wasser aus dem Hahn gefüllt.
Karen hatte den Kopf aus der Küche gestreckt, als sie vorbeiging. »Ach! Würdest du bitte die Handtücher in den Wäschekorb tun, wenn du fertig bist? Ich werde erst am Dienstag waschen. Möchtest du was zu essen? Harry mußte…«
Sie hatte der nörgelnden Stimme den Rücken zugewandt, nicht sonderlich interessiert an dem, was Harry möglicherweise tun mußte, und war – immer noch summend – ins Wohnzimmer zurückgekehrt, um ihre Übungen zu Ende zu bringen. Früher hatte sie sie immer mit »Visi d’arte« aus Tosca abgeschlossen. Die Kraft ihrer Stimme, die sich schließlich bis zu jenem hohen D erhob, versetzte sie in Hochstimmung. Aber heute, das ahnte sie, würde sie die Arie nicht schaffen, und ihr Versagen vor Karen und Becca würde sie aus der Fassung bringen. Also gab sie sich mit ein paar deutschen Liedern zufrieden, die intellektuell anspruchsvoll waren, aber keine allzu hohen Anforderungen an die Stimme stellten.
Nachdem sie sich Gesicht und Brust mit dem Handtuch abgetrocknet hatte, das zuvor ihren Hals umhüllte, ließ sie es neben dem Klavier auf den Boden fallen. Die Tasse nahm sie mit in die Küche und stellte sie sogar in die Geschirrspülmaschine. Harry konnte wirklich nicht behaupten, daß sie keinerlei Rücksicht auf seine Frau nahm.
Karen war mittlerweile im Garten hinterm Haus, wo sie sich, mit ausgebleichten Shorts und Hemd bekleidet, über ihre Pflanzen beugte. Dumpfes Wummern von oben ließ darauf schließen, daß Becca im Obergeschoß einem hämmernden Baß lauschte, den die heutigen Teenager für Musik hielten. War dem Kind dieser Lärm wirklich lieber gewesen als ihre eigenen Übungen? Sie schnaubte wie ein hochgezüchtetes Rennpferd.
Gott sei Dank war Harry verschwunden. Vielleicht riefen ihn die Alteisenberge auch am Sonntag. Das bedeutete, daß sie in Ruhe Mittag essen konnte, auch wenn sich nicht viel Verführerisches in Karens Kühlschrank befand: die Überreste des sonntäglichen Familienfrühstücks, bestehend aus Bagels mit bunten Lachsquadraten, die aussahen wie Linoleumreste; ein bißchen Lammbraten; Käse, der ihren Hals wieder verschleimen würde, und Eisbergsalat. Naserümpfend nahm sie einen Bagel sowie eine Grapefruit aus dem Kühlschrank und setzte Wasser für den Kaffee auf.
Becca stapfte die hintere Treppe zur Küche herunter. »Hast du deine Stimme wieder?«
»Ja, die ist jetzt so gut, daß sie Gläser zum Schwingen bringen kann.«
Ohne die Stimme zu heben, nur mit Hilfe ihres perfekten Luftstroms, erzeugte sie einen hohen Ton, der Karens Kristallgläser in Schwingungen versetzte. Dieser Trick hatte Becca bereits als Kleinkind erfreut, und auch jetzt brachte er sie noch zum Grinsen.
»Daddy ist wütend, aber er hat beschlossen, deinetwegen nicht auf seinen Golftermin zu verzichten.«
»Harry ist von Natur aus jähzornig. Gibt’s noch einen anderen Grund?«
Becca schlang die Arme um die Knie. »Carl Benedetti hat ihn heute morgen um zwei angerufen, damit er dich aus dem Gefängnis holt.«
Ihr Magen verkrampfte sich. Aus dem Gefängnis? Mit zitternden Händen nahm sie die Tasse Kaffee und verschüttete eine ganze Menge davon auf den Tisch. Becca ging zur Spüle, um einen Schwamm zu holen, und wischte die Pfütze weg.
»Schätzchen, machen Teenager so was heutzutage? – Geschichten erfinden, um die ältere Generation zu schockieren?«
»Mom hat schon gesagt, daß du dich wahrscheinlich nicht erinnern würdest.« Becca sah sie mit ihren grünen Augen besorgt an.
»Und weswegen soll ich im Gefängnis gewesen sein? Vielleicht, weil ich mir unbefugt Zutritt zu Minskys Schrottplatz verschafft habe?« Durch das jahrelange Training gelang es ihr, ein spöttisch trillerndes Lachen hervorzubringen, obwohl ihre Hände zitterten. »Und was um Himmels willen hat Carl damit zu tun? Als ich das letzte Mal von ihm gehört habe, hat er gerade The Ghosts of Versailles an der Met zu Ende gebracht.«
»Du hast ihn angerufen. Oder besser gesagt: Jemand hat ihn angerufen, und dieser Jemand hat dann Daddy angerufen, der nach Chicago reinfahren mußte, um dich zu holen. Daddy sagt, eigentlich hätte er dich dort versauern lassen sollen, das hätte dir nur gutgetan.«
»Ach, Jan… ah, gut, daß du auf bist.« Karen war hereingekommen und wusch sich an der Spüle den Schmutz von den Händen. »Wir müssen uns unterhalten. Über heute nacht.«
»Becca hat mir so eine grausige Teenagergeschichte erzählt«, sagte sie ganz beiläufig. »Meiner Meinung nach solltest du solche kindischen Scherze nicht unterstützen. Und außerdem möchte ich nicht, daß du dich in meine Angelegenheiten einmischst.«
»Ich soll mich nicht in deine Angelegenheiten einmischen?« Karen kreischte so laut, daß Töpfe und Gläser zu wackeln begannen. »Carl Benedetti hat uns mitten in der Nacht angerufen, nachdem du ihn aus dem Bett geholt hattest. Erinnerst du dich denn nicht mehr daran? Schau mich an und grins nicht so überheblich! Du hast dich gestern in La Bohème ganz schön lächerlich gemacht. Zwei meiner Nachbarn, die noch gar nichts von der Festnahme wissen, haben mich heute schon angerufen, um mir davon zu erzählen. Du hast den ganzen ersten Akt laut mitgesummt, und dann hast du beschlossen, dem armen Mädchen, das die Chance bekommen hatte, ihr Debüt in einer Amateuraufführung zu geben, die Schau zu stehlen. Du bist aufgestanden und hast den ganzen dritten Akt ihre Partie mitgesungen. Und jetzt sitzt du hier in meiner Küche, ißt meine Sachen, nachdem du ungefähr dreißig schmutzige Handtücher im ganzen Haus verstreut hast, und tust so, als würdest du dich an nichts mehr erinnern.«
»Ich glaube nicht, daß sie sich erinnert, Mom. Das haben wir im Frühjahr gelernt, als wir in der Schule das Thema ›Alkoholismus‹ behandelt haben. Man kann so betrunken sein, daß man sich hinterher nicht mehr an das erinnert, was man getan hat, besonders wenn’s peinlich war.«
»Becca! Willst du… könnte es sein, daß du mich eine Alkoholikerin nennst?«
»Bitte!« Becca, die sie früher sehr bewundert hatte, sah sie jetzt so bekümmert an, daß sie den Blick abwenden mußte. »Es macht alles nur noch schlimmer, wenn du lügst. Dabei weiß doch jeder, daß du deswegen in Chicago bist und nicht in New York. Du brauchst dich nicht zu schämen. Schließlich kannst du nichts dafür. Es ist eine Krankheit, und wenn du nur zugeben könntest…«
Sie fegte die Teller vom Tisch und freute sich über den Lärm und die Bestürzung auf Karens und Beccas Gesicht, als sie zerbrachen. »Wenn ihr fertig seid mit euren grotesken Anschuldigungen, könntet ihr dann so gut sein, mir ein paar frische Sachen zum Anziehen zu suchen? Ich rufe dann jemanden an, der mich abholt.«
»Wenn du meinst. Aber von meinen Sachen kannst du nichts mehr haben. Als du das letzte Mal hier warst, hast du dir mein Donna-Karan-Kostüm ausgeliehen, und als du es mir dann endlich wiedergegeben hast, war es so versaut, daß sie selbst in der Reinigung nichts mehr machen konnten.« Karen atmete tief durch. »Und Harry möchte, daß du dir einen Job suchst. Er ist es leid, dich durchzufüttern.«
»Möchte er vielleicht, daß ich mit einem Laster auf dem Schrottplatz herumfahre? Na, das wäre ja ein hübscher Anblick.«
»Janice, du kannst tun, was jede andere Diva im Ruhestand auch macht: Du kannst…«
»Mein Name ist Luisa Montcrief, und ich bin nicht im Ruhestand!« Hätte sie doch die Teller nicht schon bei Beccas kindischer Bemerkung heruntergewischt – jetzt war ihre Wut echt, und sie mußte sich körperlich abreagieren. »Ich möchte diese Stadt genausogerne verlassen, wie ihr mich loswerden wollt, aber mein Manager hat es bis jetzt nicht als nötig erachtet, mir die Engagements zu verschaffen, die ich mir vorstelle.«
»Tja, dann ruf ihn an und nimm Aufträge an, die du dir nicht vorstellst.«
»Damit alle genau wie du behaupten, meine besten Tage seien vorbei? Ich glaube nicht, daß ich das möchte!«
»Selbst wenn du nicht im Ruhestand bist: Würde es dich denn umbringen, wenn du ein paar Gesangstunden gibst? Es muß doch ein paar Leute in Chicago geben, die meinen, du könntest ihnen was Interessantes übers Singen beibringen.« Karen klang nicht allzu hoffnungsvoll.
»Na schön. Ich rufe meinen Manager morgen früh an und sage ihm, daß ich allmählich ungeduldig werde.« Damit rauschte sie aus dem Zimmer, ganz die große Diva.
»Wieso hast du ihr einen Tee gemacht? Habe ich dir nicht gesagt, daß du sie nicht bedienen sollst?« Karen holte einen Besen aus der Kammer und kehrte die Scherben zusammen.
Becca nahm eine Haarsträhne in den Mund. »Die Aufmerksamkeit der Menschen fehlt ihr.«
»Aber es ist nicht deine Aufgabe, meine Liebe, ihr Dienstmädchen, ihre Zuhörerin und obendrein noch ihre Sekretärin zu spielen.«
»Sie hat die Gläser für mich zum Klingen gebracht«, sagte ihre Tochter.
»Es sieht deinem Vater ähnlich, daß er zum Golfspielen geht und mich mit ihr allein läßt«, brummte Karen. »Schließlich ist sie seine Zwillingsschwester und nicht meine. Ich habe ihn geheiratet und versprochen, in guten wie in schlechten Zeiten zu ihm zu stehen und nicht zu ihr.«
»Tja, die ›schlechten Zeiten‹, die sind eben sie für dich, Mom, das ist alles. Außerdem hat Daddy versucht, mit ihr zu reden, aber sie hat sich stundenlang im Bad eingeschlossen.«
Karen zwang sich zu einem Lächeln. »Ich weiß, Kleines, deine Tante gibt mir ein Gefühl der Hilflosigkeit, und das macht mich aggressiv.«
»Es war schön, als sie noch berühmt war«, sagte Becca. »Erinnerst du dich noch, wie wir damals zusammen mit Jackie Onassis beim Abendessen waren? Corie hat mir das nicht geglaubt – ich hab’ ihm die Fotos zeigen müssen. Du hast so stark ausgesehen in deinem roten Kleid. Und ich war wie ein kleines siebenjähriges Mastschwein mit einer grausigen Perücke.«
»Kleines, du hast wundervoll ausgesehen. Genau wie jetzt, obwohl du weißt, daß ich nicht sonderlich viel von diesen Springerstiefeln halte.«
»Warum nennst du sie Janice, obwohl du weißt, daß sie den Namen haßt und ihn schon vor Jahrzehnten hat ändern lassen?«
»Die Leute unterstützen deine Tante in ihrem Bestreben, die Wirklichkeit zu verdrängen, seit sie siebzehn ist. Da brauche ich ihr nicht auch noch zu helfen – ganz im Gegenteil. Es wird allmählich Zeit, daß sie mit der Schauspielerei aufhört und sich ihrem Alkoholproblem stellt.«
»Aber Daddy und du, ihr habt sie doch schon Janice genannt, als sie noch Engagements hatte. Janice Minsky – was für ein Name. Mit dem Namen würde ich auch kein Star sein wollen. Jemand wie ich würde allerdings auch nie ein Star. Warum habe ich nichts von ihr oder von dir, und warum bin ich nicht groß und schlank? Warum muß ich ausgerechnet wie Daddy aussehen, wie eine kleine, plumpe Kröte?«
»Na, du hast’s aber heute mit den Tieren. Zuerst sagst du, du siehst aus wie ein Mastschwein, und jetzt ist Daddy auch noch eine plumpe Kröte.« Karen ließ die Scherben scheppernd in den Mülleimer gleiten. »Der Name Minsky ist immerhin gut genug für deine Reitstunden. Wenn deine Tante es akzeptieren könnte, eine Minsky zu sein, bräuchte sie vielleicht den Gin nicht, um das zu vergessen, was sie an sich selbst nicht mag.«
Die Diva segelte, bekleidet mit ihrem verknitterten Rock aus Shantungseide, wieder herein. Karen versuchte die weiße Bluse zu ignorieren, die aus ihrem eigenen Schrank stammte. Sie hatte keine Lust, sich mit ihrer Schwägerin noch weiter über solche Dinge zu streiten.
»Ich habe meinen Chauffeurdienst angerufen. Die müßten bald jemanden schicken.«
»Hast du Geld für den Wagen?« fragte Karen, die Hände auf den Hüften.
»Keine Sorge. Ich nehme schon nichts von Beccas Collegegeld. Der Chauffeur bekommt sein Geld in der Stadt.«
Beim Anblick des blauen Rolls-Royce, der vor dem Haus vorfuhr, verschlug es Becca den Atem. Dann rannte sie nach oben, um Corie anzurufen, damit auch er sich den triumphalen Abgang ihrer Tante ansehen konnte.
Doch als die Diva in der Stadt ankam, öffnete der Mann, bei dem sie eine ganze Weile gewohnt hatte, die Tür gerade lange genug, um ihren Koffer davorzustellen. Er war nicht bereit, für den Rolls zu zahlen. Und er wollte ihr auch kein Geld dafür oder für das Hotelzimmer »leihen«, denn er wußte, daß sie eine Versagerin war. Und wenn sie das Geld so ohne weiteres von ihrem Bruder bekommen konnte, dann sollte sie es sich doch gleich von ihrem Bruder holen. Die Polizisten hatten ihn in der vergangenen Nacht zusammengeschlagen, als er versucht hatte, ihre Ehre zu retten, obwohl sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihn zum Narren gemacht hatte. Er glaubte, daß sich seine Nieren nie mehr von diesen Prügeln erholen würden. Er wollte sie nicht mehr sehen.
Sie ließ die Koffer im Flur stehen und ging zurück zum Wagen. Sie war keine Alkoholikerin, auch wenn Becca das sagte, doch die rüden Bemerkungen des Mannes weckten den Wunsch nach einem Drink in ihr, nur zur Beruhigung. Und jetzt verlangte auch noch der Fahrer Geld von ihr, und zwar auf ausgesprochen unhöfliche Weise. Sie würde ihren Manager anrufen und ihm sagen müssen, daß er diesem Chauffeurdienst keinen Auftrag mehr geben sollte. Ja, das war eigentlich eine Idee: Ihr Manager mußte ihr eine Kontonummer nennen, über die die Gebühren für den Wagen abgerechnet werden konnten. Doch ihr Adreßbüchlein war noch in einem der Koffer oben im Flur. Es war alles schrecklich kompliziert: Harry würde doch für alles bezahlen müssen. Vielleicht auch für ein Hotelzimmer. Am Morgen würde sie in New York anrufen und ihren Manager bitten, ihr die Tantiemen für ihre Plattenaufnahmen telegrafisch anzuweisen. Ihr Manager mußte jetzt auch einmal etwas für sie tun; schließlich hatte sie ihm seine Karriere aufgebaut. Sie gab dem Fahrer die Nummer von Harrys MasterCard und sagte ihm, er solle ihre Koffer holen und sie zum Ritz bringen.
Die Hölle
Die Verwaltung ist Gott, und Hanaper ist ihr Prophet. Heute vormittag haben die Sanitäter einen Mann eingeliefert, der sich vom fünfzehnten Stock des State of Illinois Building in das Atrium stürzen wollte. Er glaubte, er sei ein Huhn und könne fliegen – eine Sekretärin erwischte ihn gerade noch, als er auf dem Geländer balancierte. Es handle sich um einen Obdachlosen, der oft im State of Illinois Building unterwegs sei, sagten die Sanitäter.
Hanaper, der gerade seine Runde machte, wurde in die Notaufnahme gerufen und schleifte mich mit, weil wir gerade einen meiner Patienten gemeinsam begutachtet hatten. Die Sanitäter erzählten Hanaper, was passiert war, und sagten, sie hielten den Mann für schizophren.
H. fiel ihnen ins Wort: »Hat einer von Ihnen eine Zulassung als Mediziner? Hab’ ich mir schon gedacht. Ich bin der Leiter der psychiatrischen Abteilung im Midwest-Krankenhaus und brauche keine Sanitäter, die die Diagnosen für mich stellen.«
Der Obdachlose saß zitternd, vor sich hinmurmelnd und die Augen vor Angst verdrehend auf einer Rollbahre. Hanaper ging zu ihm. In Anwesenheit der Krankenschwestern und anderen Patienten brüllte er: »Sie wissen doch, daß Sie kein Huhn sind, oder, Mann?«
Der arme Teufel, der Angst hatte vor der Umgebung, in der er sich befand, vor den starrenden Menschen und dem weißen Mann im Arztkittel, der ihn anbrüllte, murmelte »nein«. Hanaper wandte sich an die Sanitäter und erklärte ihnen, sie sollten den Mann wieder mitnehmen, es fehle ihm nichts.
Die Sanitäter sagten, der Mann sei obdachlos. Ihrer Meinung nach sollte er nicht wieder auf die Straße, weil er nicht für sich selbst sorgen könne – er ernähre sich von den Sachen, die er in Mülltonnen finde. Und Hanaper, dem man nicht vorwerfen kann, er wäre inkonsequent, sagte, das beweise doch nur, daß er in der Lage sei, Nahrung zu finden.
Ich hatte mich die ganze Zeit im Hintergrund gehalten, war mit meiner Umgebung verschmolzen wie die Rollbahren. Aber als er das sagte, versuchte ich ihm zu widersprechen. War das der duckmäuserische, stammelnde Protest eines Arztes, der sich Sorgen um seinen Job machte? Oder nur der Widerspruch von Lilys Sohn, der immer nervös wird, wenn er sich in Gesellschaft von Autoritäten befindet?
Letztlich war das egal. H. fiel mir ins Wort: »Wenn Sie bereit sind, die finanzielle Verantwortung für diesen Mann zu übernehmen, Dr. Tammuz, können Sie so viele Diagnosen stellen, wie Sie wollen. Wenn nicht, sollten wir uns jetzt wieder den Patienten zuwenden, für deren Versorgung Sie bezahlt werden.«
Und so setzten wir unsere triste Runde fort, und ich versuchte, Krankenhausaufenthalte zu empfehlen, die zu teuer und deshalb unnötig sind, oder, noch schlimmer, langfristige Psychotherapien. Nur der leiseste Verdacht, daß ich mich länger mit einem Patienten unterhalten möchte, löst in Hanaper die Angst vor Freud aus.
Als ich in der Klinik anfing, dachte ich, ich hätte hier eine großartige Gelegenheit, die angewandte Psychotherapie zu lernen. Natürlich war Dr. Boten damals noch da. Ich wußte nicht, daß er und Hanaper sich wegen der Leitung der psychiatrischen Abteilung in den Haaren lagen – das Ergebnis allerdings stand nie in Frage, weil die Verwaltung geschlossen hinter Hanaper stand. Jetzt ist Boten nicht mehr da. Man hat ihn zum Gehen gezwungen; er muß sich wieder auf seine eigene Praxis konzentrieren. Das Krankenhaus versorgt am Mittwochnachmittag widerwillig auch ambulante Patienten. Gruppentherapien finden am Freitagabend statt; sie sind sehr beliebt – schließlich bringen sie auch viel Geld ein, weil dort der Alkoholismus überarbeiteter Geschäftsleute behandelt wird. Da war kein Platz für Patienten, die mehr als nur Prozac oder einen Schuß Haldol brauchen.
Hector, der auf einem der oberen Betten im Bereitschaftszimmer des Krankenhauses mit Hilfe einer winzigen Stablampe schrieb, um seine schlafenden Kollegen nicht zu stören, legte den Stift bei der Erinnerung an die Frustrationen des Tages weg. Er und Hanaper waren aus der Notaufnahme in die Station zurückgekehrt, wo bereits Melissa Demetrios, die leitende Ärztin, mit einer neuen Gruppe von Medizinstudenten wartete. Sie waren vor dem Zimmer einer Frau stehengeblieben, die Hector am vergangenen Nachmittag aufgenommen hatte. Ihre besorgte Tochter hatte sie hergebracht, nachdem sie ihre Mutter im Wohnzimmer angetroffen hatte, alle ihre Besitztümer vor sich aufgehäuft. Sie hatte gesagt, sie sammle Kraft für die Reise.
Hector zählte die Fakten auf und fügte dann hinzu: »Ihre Katze ist letzten Monat gestorben; das scheint sie ziemlich aus der Fassung gebracht zu haben. Möglicherweise hat der Vorfall einen bereits vorhandenen krankhaften Zustand verstärkt. Ich habe eine Generaluntersuchung angeordnet, um sicherzugehen, daß sie nicht nur an Vitamin-B-Mangel oder Schilddrüsenproblemen leidet, würde aber vorschlagen, daß wir uns noch ein paarmal mit ihr unterhalten, bevor…«
»Prozac, Tammuz. Haben Sie schon veranlaßt, daß man ihr eine Probedosis verabreicht?«
»Nicht, bevor ich ein besseres Gefühl für…«
»Prozac wird bei Patienten mit Sammeltrieb empfohlen.«
»Eigentlich leidet sie nicht unter einem Sammeltrieb, Sir. Sie macht nur diese Tonfiguren, jedenfalls nach Aussage ihrer Tochter, oder…«
»Sie schreibt alles auf kleine Zettel und sammelt sie, oder? Sieht mir sehr nach einer Zwangsneurose aus. Leute mit Zwangsneurosen reagieren gut auf Antidepressiva. Sie werden feststellen, daß zwanzig Milligramm täglich höchst effektiv sind.«
Und als Hector störrisch im Flur stehenblieb, sagte Hanaper ungeduldig: »Haben Sie sich das notiert, Tammuz?«
»Ich halte das für voreilig, Sir. Was ist, wenn sich ihr Problem als…«
»Sie können solche Entscheidungen treffen, sobald Sie für diese Station verantwortlich sind. Ich möchte, daß sie eine Dosis von zwanzig Milligramm Prozac bekommt. Stat.«
Es war typisch für Hanaper, daß er Routinefeststellungen mit medizinischem Jargon und lateinischen Ausdrücken durchsetzte. Manchmal fragte sich Tammuz, ob die Diplome, die an gut sichtbarer Stelle im Büro des Leiters der Psychiatrie hingen, gefälscht oder gestohlen waren und er das wenige, was er über Medizin wußte, aus medizinischen Fernsehsendungen gelernt hatte.
Als Tammuz daraufhin immer noch nichts auf das Krankenblatt der Frau notierte, zog Hanaper ihn zu einem vertraulichen Gespräch beiseite, sprach aber so laut, daß auch die Studenten etwas hörten. »Dr. Tammuz, wir haben die Verpflichtung, die Menschen so schnell wie möglich zu heilen. Im Gegensatz zu Ihren emotionalen Appellen besteht diese Verpflichtung nicht nur gegenüber der Institution oder unserer Verwaltung, sondern auch gegenüber den Patienten selbst. Und, Tammuz, wenn Sie die Wahl hätten zwischen einer Pille, die Ihre Probleme innerhalb von zehn Tagen löst, und einer Analyse, die ein ganzes Jahrzehnt dauern kann, würden Sie sich da nicht für die Pille entscheiden? Nein, wenn ich’s mir richtig überlege, würden Sie das nicht.«
Hanaper erzählte den Studenten mit fröhlicher Stimme von Tammuz’ Interesse für – »Vernarrtheit in«, wie er sich ausdrückte – die Psychoanalyse und dirigierte die Gruppe dann in das Zimmer der neuen Patientin, der er mit ebenso fröhlicher Stimme erklärte, Dr. Tammuz werde ihr eine Pille geben, die ihr dabei helfen würde, sich wieder so gut wie neu zu fühlen.
»Was nicht heißt, daß Ihnen seine großen schwarzen Augen nicht auch helfen könnten, oder?« Und obwohl Tammuz sich selbst dafür haßte, hatte er die Anweisung ausgeschrieben.
Die Frau, die inmitten eines Nests aus zerfetzten Papiertüchern saß, auf denen sie herumkritzelte, sagte: »Ich nehme keine Pillen. Das verbietet mir meine Religion.« Dann wandte sie sich wieder ihren Papiertüchern zu.
Tammuz konnte ein Lächeln nicht ganz unterdrücken. Zum Glück stand er hinter Hanaper. Melissa und die Studenten wurden unruhig, weil sie nicht wollten, daß der Zorn des Abteilungsleiters sie traf.
»Ich dachte, die Frau heißt Herstein.« Hanaper drehte sich zu Tammuz um. »Ist sie denn keine Jüdin?«
Die jüdische Patientin und der jüdische Arzt. »Ich weiß es nicht, Sir; da müssen Sie sie selber fragen.«
»Wieso kann die Religion es verbieten, Pillen einzunehmen, wenn man Jude ist?« fragte Hanaper einen der Studenten, nicht die Patientin selbst, über die er redete – ganz, als sei sie nicht anwesend.
»Es steht in der Mischna«, sagte Mrs. Herstein plötzlich überraschend hinter ihrer Papierbarrikade hervor. »Sie glauben, die Probleme des Lebens zu kennen, junger Mann, aber Sie täten gut daran, die Mischna zu lesen.«
Hanaper geriet ziemlich aus der Fassung, als sie ihn »junger Mann« nannte, und ließ seine Verwirrung sofort an uns aus. Melissa wurde gerügt, weil sie eine Patientin in die Langzeitabteilung aufgenommen hatte, ohne ihre Angaben zu überprüfen. Nun weigerte sich die Versicherung zu zahlen, und was sollten wir tun? Die Familie könnte Klage wegen Fahrlässigkeit einreichen, wenn sie nach der Entlassung Selbstmord begeht, was Melissa durchaus für möglich hält.
Was für eine Erleichterung, in die Nachmittagsklinik zu gehen. Wenigstens geben Leute mit Angstneurosen zu, daß sie ein Problem haben.
Am Ende seiner Schicht in der Ambulanz versuchte Hector sich aus der Klinik zu schleichen und ein bißchen am See spazierenzugehen. Er hoffte, eine halbe Stunde in der Maisonne würde ihn für die bevorstehende Nachtschicht wach machen. Melissa Demetrios hielt ihn auf, als er auf dem Weg zur hinteren Treppe war.
»Dr. Stonds möchte einen Blick auf unsere Fälle werfen«, sagte sie. »Hanaper will, daß alle Ärzte anwesend sind – dann hat er ein paar Sündenböcke, wenn Stonds in die Luft gehen sollte.«
»Stonds?« Nach sieben Monaten im Midwest-Krankenhaus wußte Hector, daß im Krankenhaus nichts ohne das Einverständnis des Neurochirurgen lief, aber er verstand nicht, warum Stonds sich für die Fälle der Psychiatrie interessierte.
»Dr. Stonds interessiert sich für alles, was das Wohlergehen des Midwest Hospital und seiner Patienten betrifft«, sagte Melissa mit gesenkter Stimme, als wolle sie Hanaper nachäffen.
Hector lachte. »Ja, aber sieht er sich alle Aufnahmen an? Wann hat er dann noch Zeit, sich mit den Gehirnen der Leute zu beschäftigen?«
»Ist es wirklich das erste Mal, daß wir, seit Sie bei uns arbeiten, ins Büro des Chefs gerufen werden?« Melissa sah sich um, um festzustellen, ob uns jemand belauschen konnte. »Stonds’ Großvater – das ist der eigentliche Dr. Stonds – war einer der Gründer dieses Krankenhauses in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Das heißt, daß die Familie immer schon großen Einfluß auf das Haus hier gehabt hat. Als Abraham – unser Dr. Stonds – als Neurochirurg hier angefangen hat, waren Neurologie und Psychiatrie noch eine Abteilung, und die jungen Ärzte lernten, wie man ›Nervenerkrankungen‹ behandelt. Und so sieht Abraham die Geisteserkrankungen heute immer noch. Irgendwie hat er die Erlaubnis der Krankenhausverwaltung erhalten, daß er sich alle Fälle in der Neurologie und der Psychiatrie ansehen kann.«
»Aha, das ist so etwas wie ein droit du seigneur«, sagte Hector. »Das paßt zur mittelalterlichen Atmosphäre dieses Krankenhauses.«
»Droit du seigneur?« wiederholte Melissa. »Ach so, Sie meinen, daß die Barone mit den Töchtern der Bauern schlafen durften. Nun, wahrscheinlich haben Sie recht. Jedenfalls führt er sich gern auf wie ein Adeliger. Er lebt in allem nur erdenklichen Prunk an der Gold Coast, in einer riesigen Wohnung in einer jener ruhigen Straßen beim Cardinal’s Palace. Im Sommer wird er Sie dorthin zum Abendessen einladen – das macht er bei allen Assistenzärzten am Ende ihres ersten Jahres. Seine ältere Enkelin ist übrigens hinreißend. Wenn es Ihnen gelingen sollte, ihr den Kopf zu verdrehen, bräuchten Sie nie mehr vor Hanaper zu kriechen.«
Hector schnaubte verächtlich. »Tja, aber dann müßte ich vor Stonds kriechen, und das wäre wahrscheinlich noch schlimmer. Oder vor seiner Enkelin, wenn sie ihm ähneln sollte. Ist sie Ärztin?«
Melissa schüttelte den Kopf. »Nein, Anwältin. Das heißt also: Das Reich der Stonds wird mit dem alten Herrn niedergehen. Es gibt allerdings auch eine schlechte Nachricht: Obwohl er siebenundsiebzig ist, sagen alle, daß er im OP noch alles mitkriegt. Und er macht nicht den Eindruck, als wolle er sich schon aus seinem Reich verabschieden.«
Melissas Piepser ging los. Sie las die Nummer auf dem Display. »Hanaper. Zeit für eine Runde Kriechen. Hector, ich weiß, daß Sie wirklich an die Psychotherapie glauben, aber versuchen Sie das heute nachmittag nicht zu erwähnen – dann wird Ihr Aufenthalt hier um einiges angenehmer.«
Ich folgte Melissa den Flur entlang, wo wir uns Hanaper und zwei weiteren Assistenzärzten auf Weg zur Chirurgie anschlössen. Ich sollte nichts von Psychotherapie erwähnen in der Diskussion über die Psychiatriepatienten – ich hätte gelacht, wenn mir nicht zum Weinen gewesen wäre. Oder umgekehrt!
Hanaper zu beobachten, wie er vor Stonds katzbuckelt, ist fast noch schlimmer, als ihm zuzusehen, wie er einen Obdachlosen wieder auf die Straße schickt. Wie alle herrschsüchtigen Menschen verhält er sich gegenüber Leuten, die in der Hierarchie über ihm stehen, unterwürfig.
Als Dienstjüngster der Anwesenden hatte ich das Vergnügen, meine Arbeit vom Großen Weißen Chef sezieren zu lassen. Hanaper brachte meine – Zitat – »Vorliebe für altmodische Methoden« zur Sprache, so daß Melissas Ratschlag sich erübrigte, weil ich meinen Glauben an nichtchemische Therapieformen erläutern mußte. Stonds ist zu sehr von seiner eigenen Größe überzeugt, als daß er sich auf Hanapers Sarkasmus bezüglich der Gesprächstherapie einlassen würde, aber nichtsdestotrotz erteilte er mir gute Ratschläge.
»Zu meiner Zeit, junger Mann, waren die Leute ganz hingerissen von Freud. Sie dachten, die Psychoanalyse würde alle psychiatrischen Probleme lösen. Aber sehen Sie sich doch mal an, in welchem Zustand sich die moderne Gesellschaft befindet. Das ist eine direkte Folge der Freizügigkeit, die dadurch gefördert wird, daß die Menschen für all ihre Probleme Ausreden finden und sich um ihre persönliche Verantwortung drücken können. Die Pharmakologie macht wesentliche Fortschritte in einigen hartnäckigen Fällen. Das Wichtigste ist, diese Leute wieder auf die Beine und an die Arbeit zu bringen.«
Ich sagte das einzig Mögliche in dieser Situation: »Ja, Sir.«
Dann brachte Hanaper, sozusagen als Abschlußscherz, die Äußerung meiner neuen Patientin über die Mischna zur Sprache. Ich hatte den Eindruck, daß Stonds beinahe in die Luft gegangen wäre. »Immer diese neurotischen Frauen mit ihren alten Texten, die glauben, etwas über das Leben zu wissen. Darüber will ich nichts mehr hören, Hanaper. Sorgen Sie dafür, daß sie das Krankenhaus verläßt. Es gibt sicher wirklich kranke Menschen, die ihr Bett gut brauchen könnten.«
Der Große Weiße Chef erhob sich, um zu gehen. Auf dem Weg nach draußen sagte er: »Ach, Hanaper, übrigens, ich möchte, daß Sie sich für mich um jemanden kümmern.« Und Hanaper zupfte an seiner Stirnlocke: Euer Wunsch ist mir Befehl, o König.
»Luisa Montcrief«, sagte der Große Weiße Chef. »Eine Diva, deren Familie sich Sorgen um sie macht. Die Familie Minsky – sie haben dreihunderttausend Dollar für das Krebsforschungszentrum gespendet, nachdem die alte Mrs. Minsky hier an einem Glioblastom gestorben ist. Wir sind der Familie etwas schuldig. Ich habe dem armen Harry Minsky gesagt, seine Schwester könne am Freitag um elf in Ihrem Büro vorbeischauen.«
Natürlich arrangierte Hanaper sofort seinen Tagesplan neu, was bedeutete, daß auch wir den unseren ändern mußten, denn Hanaper möchte, daß wir dabei sind und zusehen, wie man ein Gespräch mit einem Patienten führt. Daß wir unsere eigenen Patienten deshalb hintanstellen müssen, ist nicht wichtig. Schließlich müssen sich alle verneigen, wenn von Stonds die Rede ist, und alle müssen von seiner Pracht künden.
Das häßliche Entlein
Möglicherweise lobten im Krankenhaus alle Zungen Dr. Stonds, aber in seiner Fünfzehnzimmerwohnung an der Graham Street war das etwas anderes. Nun ja, Mrs. Ephers, die Haushälterin des Arztes (sein Schatten, sein Scharfrichter, murmelte die junge Mara), sang natürlich ein Loblied auf den Arzt. Mrs. Ephers hatte ihr ganzes Erwachsenenleben darauf verwendet, ihn nicht nur zu verehren, sondern sozusagen einen Tempel um ihn herum aufzubauen, in dem sie die Hohepriesterin war.
Und seine ältere Enkelin Harriet, eine Schönheit, ja, sie richtete ihr Leben an seinen Grundsätzen aus. Im Alter von zweiunddreißig Jahren empfing sie nun ihren gerechten Lohn; als Partnerin bei Scandon and Atter kämpfte sie für ein halbes Dutzend Mandanten, darunter auch das Hotel Pleiades. Sie beschäftigte sich mit den Klagen wütender Gäste, den Mißgeschicken der Angestellten, den Versuchen der Stadtverwaltung, sich um ihre Verantwortung für die Gehsteige vor dem Gebäude zu drücken – und das alles mit so viel Energie, daß sie tagsüber fast unsichtbar war, wie Materie am Rande des Lichts, eine durchsichtige Farbsäule, heute türkis, weil sie ein Kostüm dieser Farbe trug.
Aber die Frau und die Tochter des Arztes, nun, da konnte Mrs. Ephers nur sagen, es war letztlich ein Segen, daß die beiden im Verlauf ihres jeweiligen unangenehmen Lebens schon bald verschieden waren. Und was Mara, die jüngere Enkelin des Arztes, anbelangte – sie sah Mrs. Ephers gerade mit finsterem Gesicht über den Eßtisch hinweg an, ihr grobknochiger Körper und ihre borstigen schwarzen Haare in unschönem Kontrast zu Harriets Blässe und Zierlichkeit –, tja, da wünschte sich die Haushälterin nicht zum ersten Mal, daß sie den Arzt dazu überredet hätte, Mara zur Adoption freizugeben, als ihnen das Kind aufgedrängt worden war.
Als Mara klein war, wußte sie, daß sich das häßliche Entlein in einen wunderschönen Schwan verwandelte, daß Aschenputtel den hübschen Prinzen bekam, daß die arme, hausbackene Schwester, die geduldig am heimischen Herd wartete und sich die Beschimpfungen der Stiefmutter gefallen ließ, einer Hexe begegnen würde, die sie mit Gold überhäufte, während die Brokatroben ihrer verwöhnten älteren Schwester mit Pech überschüttet wurden.
Mara war sich sicher, daß sie eines Tages in den Spiegel schauen würde und ihre borstigen Locken sich in lange, gerade, seidenweiche Haare verwandelt hätten, so schön wie die ihrer Schwester Harriet. Natürlich wären sie immer noch schwarz und nicht gülden, aber das war in Ordnung, denn auch Schneewittchen hatte rabenschwarze Haare. Doch ihre Haut wäre nicht mehr schlammig-olivfarben, sondern rosigweiß wie die von Aschenputtel und Harriet. Dann hätte sie einen großen Kreis von Freunden und Verehrern, wie Mara die Freunde ihrer Schwester in ihrer kindlichen Märchensprache bezeichnete, und plötzlich wäre sie auch für Ballett oder Tennis begabt.
Und Harriet – nun, Mara konnte ihrer Schwester nichts Böses wünschen; Harriet wäre auch nicht auf ewig mißgestaltet, aber es würde ihr etwas sehr Schlimmes zustoßen, so daß ihr all die Male wieder einfallen würden, wo sie Mara nicht beachtet oder sie verspottet oder sie bei Großvater oder Mrs. Ephers verpetzt hatte, und es würde ihr leid tun. Dann würde Mara großzügig sein und der Hexe in ihrem Triumph sagen, daß sie ihrer Schwester vergab und sie doch bitte den bösen Zauber von ihr nehmen solle. Und Harriet wäre plötzlich wieder so schön wie vorher und hätte wieder ihre üblichen Freunde, doch sie würde auf all das verzichten und sich nur noch um Mara kümmern. Es tut mir ja so leid, würde sie sagen und einen tiefen Knicks vor ihr machen. Kannst du mir jemals verzeihen, daß ich dir so viel Pein bereitet habe?
Da erschien Mrs. Ephers in der Tür zum Zimmer der sechsjährigen Mara. Junge Frau, das Essen ist auf dem Tisch. Wie immer um diese Zeit. Du bist groß genug, um die Uhr zu lesen, eigentlich bräuchtest du nicht mich, um dich zu holen. Dein Großvater wartet auf dich. Er arbeitet den ganzen Tag schwer, um dir ein schönes Zuhause bieten zu können; da kannst du doch wenigstens pünktlich zum Essen kommen. Hast du dir die Hände gewaschen? Und hast du wenigstens versucht, dir die Haare zu bürsten? Wahrscheinlich solltest du dir dazu eine Harke aus dem Garten holen.
Mara setzte sich selbst insgeheim Ziele und dachte sich Prüfungen aus. Wenn sie eine Woche lang jeden Morgen zur Schule gehen konnte, ohne auf einen Riß im Boden zu treten; wenn es ihr gelang, Mephers zum Lächeln zu bringen; wenn sie es schaffte, drei Tage hintereinander danke zu ihr zu sagen (denn die Haushälterin ließ sich durchaus milde stimmen, zum Beispiel indem man ihr eine Tasse Tee brachte, wenn sie Großvaters Hemden bügelte – keine Wäscherei konnte ihr das gut genug machen –, oder durch einen Blumenstrauß; es sei denn, irgendeine Petze beschwerte sich, Mara habe die Blumen im Garten der Historical Society gepflückt); wenn sie in zwei Rechtschreib- oder Rechenprüfungen die volle Punktzahl erreichte und Großvater sie dafür lobte; wenn sie acht wurde… Aber nie wurden ihre Haare glatt, und auch ihre Haut wurde nicht rosigweiß. Und als sie schließlich zwei Wochen vor ihrem zwölften Geburtstag ihre erste Periode bekam und sich ihre borstigen Haare immer noch nicht veränderten, wußte sie, daß ihr Schicksal besiegelt war.
Und dann plötzlich wurde sie zum launischen Teenager. Was ist denn mit dir passiert? fragte Mrs. Ephers. Du bist immer so gut gewesen in der Schule; dein Großvater wird sich nicht gerade freuen über dein Zeugnis.
Dann kamen die langen Sitzungen mit Großvater, der sich trotz seines vollen Tagesplans Zeit nahm, Mara ungeduldig Nachhilfe zu geben. Eine quadratische Gleichung – was bedeutet das? Ich weiß, daß du die Antwort kennst, Mara; stell dich nicht dümmer, als du bist, das ist alles andere als schön.
Da draußen herrscht erbitterter Wettbewerb, und ich versuche dich darauf vorzubereiten. Weißt du, du wirst nicht immer hier leben können.
»Ich weiß«, brüllte sie dann eines Abends. »Ich weiß, daß du die Wohnung Harriet vererben wirst. Sie bekommt alles, sie hatte ja sogar ihren eigenen Vater. Du haßt mich dafür, daß ich auf die Welt gekommen bin, und jetzt willst du beweisen, daß ich nichts richtig machen kann, damit ich mich umbringe oder weglaufe und dich mit Mrs. Ephers und Harriet in deinem kleinen Himmel hier allein lasse.«
Und dann rannte sie in ihr Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu, obwohl sie wußte, daß es in dem Haushalt verpönt war, Türen zuzuschlagen.
Harriet, die sich gerade auf ihre juristische Abschlußprüfung vorbereitete, kam später noch in Maras Zimmer. »Sie sind alt. Sie wissen nicht, wie man mit einem Teenager sprechen muß.«
»Also soll ich Mitleid mit ihnen haben? Sie sagen mir die ganze Zeit, wie häßlich ich bin. Ich kann nie mit dir konkurrieren.«
»Du bist nicht häßlich. Wenn du nicht gerade finster dreinschaust, hast du ein ausdrucksstarkes, interessantes Gesicht. Das hat mir Godfrey erst neulich abend gesagt.« Godfrey Masters, Harriets damaliger Verehrer.
»Tatsächlich?« Mara hob argwöhnisch die dunklen Augenbrauen, und schon bald sah sie nicht mehr so finster drein, obwohl »ausdrucksstark« und »interessant« natürlich längst nicht so gut war wie »hübsch« und »charmant«.
Keiner der Verehrer blieb lange. Mara fragte sich, ob Harriet sie vorsätzlich vertrieb, aus Angst davor, sich in den Äther zu verflüchtigen wie ihre Mutter und Großmutter, sobald sie heiratete.
Zuerst Oma Selena, die schwanger wurde, als Großvater Stonds gerade seine ersten Jahren als Assistenzarzt hinter sich gebracht hatte. Sie hätte noch ein bißchen warten können – schließlich hatte er an einem scheußlichen Krieg teilgenommen, seinem Vaterland gedient und erst dann wieder seine Ausbildung als Arzt aufgenommen, aber im Zusammenhang mit ihr fiel einem als erstes sowieso das Wort »egoistisch« ein.
Diese Gedanken stammten von Mrs. Ephers, die Selena kannte, seit Dr. Stonds seine Braut 1942 ins Haus gebracht hatte. Auch als er Selena noch liebte, sich von ihrem quirligen Charme betören ließ, wußte er, daß sie es nie schaffen würde, den Haushalt zu führen. Also stellte er Mrs. Ephers ein, nicht so sehr, um Selena eine Last abzunehmen (man konnte sich kaum vorstellen, daß eine so maßlose Person sich mit dem Gedanken an das Wohlbefinden eines anderen belasten ließ), sondern eher, damit auch immer ein schmackhaftes Essen auf dem Tisch stand wenn er nach Hause kam, und damit er morgens und abends frisch gebügelte Hemden hatte. Denn auch im Alter von fünfundzwanzig Jahren und bis über beide Ohren verliebt legte Dr. Stonds Wert auf Ordnung im Leben.
Damals war die Mutter des Arztes noch am Leben, aber irgend etwas an Selena vertrieb sie aus ihrem eigenen Zuhause. Mrs. Ephers begriff nie so ganz, was. Hinter verschlossenen Türen wurden Worte gewechselt. Selena kam mit ihrem geheimnisvollen Lächeln heraus, und die alte Mrs. Stonds, die Augen immer noch rot vom Weinen, packte ihre Sachen – darunter auch das Familiensilber der Stonds, ein Geschenk von Prinzessin Marguerite, die so ihrem Mann ihre Dankbarkeit für die Behandlung ihres epileptischen Sohnes beweisen wollte – und zog nach Palm Springs, wo ihre verheiratete Schwester lebte.
Und dann hatte Mrs. Ephers in den zwei langen Jahren, die der Arzt im Ausland verbrachte, mit Selena zurechtkommen müssen. Vielleicht hatte Selena gehofft, Mrs. Ephers genau wie die Mutter des Arztes zu vertreiben, aber die Haushälterin gehörte nicht zu den Menschen, die Freunden den Rücken kehrten oder einen armen Mann wie den Arzt im Stich ließen. Die verträumte Selena, die sich in Anwesenheit des Arztes immer in ein Buch vertiefte, verbrachte die Kriegsjahre alles andere als träumerisch in dem Familientempel. Mrs. Ephers wußte so manches über Selena, doch sie hatte auch eine zu gute Kinderstube genossen, als daß sie sich den Mund darüber zerrissen hätte.
Der Arzt war kaum aus dem Krieg zurück, eine Auszeichnung für seinen heldenhaften Einsatz in der Ardennenoffensive an der Brust und einen Koffer voll Chanel No. 5 aus seiner Zeit in der Besatzungsarmee in der Hand, als Selena schon schwanger wurde. Mrs. Ephers erinnerte sich noch gut, wie wütend und frustriert er war, als Selena es ihm sagte. Sie war im vierten Monat, und allmählich begann man ihren Bauch zu sehen. Er war, wie gesagt, wütend, und das konnte ihm auch niemand verdenken. Ich dachte, du verwendest ein Diaphragma, brüllte er. Das habe ich verloren, antwortete Selena. Dabei hatte es die ganze Zeit unter dem Seidenmieder in ihrer Kommode gelegen, das sie ebenfalls nicht mehr trug, seit der Arzt wieder da war.
Mrs. Ephers holte das Diaphragma heraus und reichte es ihr, nachdem Dr. Stonds am nächsten Morgen gegangen war: Ich wußte nicht, daß Sie es suchen, Mrs. Stonds. Und natürlich hatte Selena nicht gewußt, was sie darauf erwidern sollte. Eigentlich hätte sie zu dem Zeitpunkt schon wissen müssen, daß es keinen Sinn hatte, Mrs. Ephers etwas vorzulügen – das mit einem bedeutungsschwangeren Blick in Richtung Mara, die häufig log, wenn sie sich selbst und ihre Situation als Waise dramatisierte.
Nun, Selena brachte ein gesundes Mädchen zur Welt und nannte es Beatrix, ohne ihren Mann zu fragen, der vorgehabt hatte, das Kind nach seiner Mutter zu nennen, stillte die Kleine ein paar Wochen lang, und eines Tages, als der Arzt vom Krankenhaus, wo er sich trotz seiner Jugend und seiner zweijährigen Abwesenheit bereits einen Namen in der Neurochirurgie gemacht hatte, nach Hause kam, stand er plötzlich mit einem Baby und ohne Frau da. Selena hatte ihm lediglich einen Zettel hinterlassen, auf dem sie ihm mitteilte, sie habe sich auf die Suche nach etwas gemacht.
All das wußte Mara, weil Mrs. Ephers es ihr ungefähr einmal pro Woche erzählt hatte, jeweils als Einführung zu einem Vortrag darüber, daß sie ihren faulen Hintern bewegen und helfen, ihre Hausaufgaben machen oder ihre Ballettstunden besuchen solle. Schließlich hatte Harriet in diesem Alter bereits den Nobelpreis für Physik gewonnen, zusammen mit Nurejew in Schwanensee getanzt und eine olympische Medaille im Reiten gewonnen – rief Mara immer, um Mrs. Ephers zu übertönen. Aber das passierte erst, als sie dreizehn oder vierzehn war, zu einer Zeit also, als ihr klar wurde, daß sie keine Chance gegen ihre Schwester hatte.
Wohin ist Oma Selena gegangen? fragte Mara Mrs. Ephers immer, als sie noch klein war. Hat meine Mama nie etwas von ihr gehört? Höre ich deswegen auch nie etwas von meiner Mama? Sie versuchte nur, ein bißchen Sicherheit in ihrer Angst davor zu finden, daß Beatrix verschwunden war, weil Mara vielleicht böse war, und zwar schon als Baby, und davor, daß Beatrix vor ihr geflohen war.
Habe ich dich gebeten, dich um anderer Leute Angelegenheiten zu kümmern? fragte Mrs. Ephers dann immer. Das Leben deiner Großmutter hat den gebührenden Abschluß gefunden, und was deine Mutter angeht – nun, je weniger man darüber sagt, desto besser.
Beatrix bedeutet »die Reisende«. In ihrem Abschiedsbrief schrieb Selena, sie hoffe, daß ihre Tochter zu einer großen Abenteurerin und Entdeckerin heranwachsen würde. Nein, der Brief existierte nicht mehr: Der Arzt wollte keine Erinnerungsstücke an diese schmerzliche Episode seines Lebens aufbewahren.
Anfangs sah es so aus, als würde Beatrix Mrs. Ephers und dem Arzt alle Ehre machen. Sie besuchte kurze Zeit die Smith School – dieselbe Schule, die auch die alte Mrs. Stonds besucht hatte –, bevor sie im Alter von neunzehn Jahren einen der Assistenzärzte ihres Vaters heiratete. Dann übernahm sie die Haushaltsführung an der North Shore, brachte Harriet zur Welt und arbeitete für das Women’s Board des Krankenhauses, ganz auf ein häusliches Leben im Dienste des Sozialen ausgerichtet.
Doch dann kam Harriets Vater gegen Ende des Vietnamkrieges bei einem Verkehrsunfall ums Leben, und Beatrix begann, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Sie driftete trotz ihres Alters in die Hippiewelt ab. Der Arzt hörte nun immer wieder unheilschwangeren Klatsch im Krankenhaus, über alkoholische Exzesse, Männer, Drogen und Rockstars. Der Arzt hätte gern an die Macht der Erziehung über die Natur geglaubt, aber offenbar floß schlechtes Blut in Beatrix’ Adern, sonst hätte sie sich nicht so über ihre wundervolle Erziehung lustig gemacht.
Großvater mußte Harriet bei sich aufnehmen, obwohl er das eigentlich nicht wollte. Das arme kleine Ding wäre ohne Nahrung und Kleidung dagestanden, wenn er ihr nicht geholfen hätte. Wirklich eine Schande, daß Beatrix sie nachts in dem großen Haus in Winnetka allein ließ, und dann der Dreck überall – die Lebensversicherung ihres Mannes hätte für eine Haushälterin ausgereicht, aber Beatrix zog es vor, das Geld mit vollen Händen auszugeben.
Dr. Stonds hatte bereits ein Kind aufgezogen. Natürlich hatte Mrs. Ephers die eigentliche Arbeit erledigt – sie wechselte die Windeln, pflegte Beatrix, als sie die Windpocken hatte, sorgte dafür, daß sie neue Schuhe für die Schule bekam und ihre Hausaufgaben ordentlich machte –, aber er hatte dafür gesorgt, daß das ganze Unternehmen in einem angemessenen Rahmen stattfand. Schließlich wollte er nicht noch ein Mädchen ohne Mutter aufziehen müssen.
Aber Harriet war zu einem entzückenden Püppchen herangewachsen, zu einem kleinen Juwel, und sie hatte sich der Juristerei zugewandt, als habe sie noch nie etwas anderes gemacht. Der Arzt war ganz vernarrt in Harriet. Genau wie Mrs. Ephers. Sie ließ es zu, daß Harriet sie »Mephers« nannte, auch wenn man sich gar nicht so leicht vorstellen konnte, daß jemand mit einer so aufrechten Haltung sich dazu herablassen konnte, einen Kosenamen anzunehmen. Harriet hatte seidige Löckchen, schrieb nur Einsen, schloß das Jurastudium ebenfalls mit der bestmöglichen Note ab, ritt, fuhr Schlittschuh und ging nur mit gesellschaftlich akzeptablen jungen Männern aus.
In der Zeit zwischen ihrem sechsten und dreizehnten Lebensjahr führten sie und ihr Großvater ein idyllisches Leben. Mrs. Ephers war ständig um sie herum, band ihnen die Schuhe, kämmte ihnen die Haare und sang morgens, mittags und abends Kirchenlieder, so jedenfalls erzählte man Mara die Geschichte. Hin und wieder ließ Beatrix sich blicken, aber Harriet weigerte sich, wie nicht anders erwartet, die teuren Geschenke ihrer Mutter anzunehmen. Schließlich wußten sie alle, woher das Geld dafür stammte, und so hieß es: Nein, danke.
Dann, als Harriet dreizehn war, tauchte plötzlich Beatrix auf, im neunten Monat schwanger. Und das nach achtzehn Monaten, in denen sie Harriet nicht ein einziges Mal angerufen hatte. Was für eine Mutter. Und Maras Vater? Wer wußte schon, wer er war. Wenn man sich allerdings die dunkle Haut und die krausen dunklen Haare des Babys ansah, mußte man das Schlimmste befürchten. Beatrix schenkte Harriet eine unerwünschte Schwester und verschwand dann, ähnlich wie ihre eigene Mutter, auf Nimmerwiedersehen.
»Drogen«, sagte Mrs. Ephers immer und bürstete dabei Maras Haare so heftig, daß ihr die Tränen in die Augen traten. »Ihr waren immer nur Drogen und Alkohol wichtig. ›Reisende‹. Ja, sie hat gern gelacht und gesagt, sie sei eine Reisende, sie sei ausgestiegen… Halt still, Kleine, wenn ich dir eine Schleife ins Haar binde, damit du hübsch aussiehst fürs Abendessen. Harriet hat keinen Muckser getan, wenn ich ihr die Haare bürstete, und dann hat sie mir einen Kuß gegeben und sich dafür bedankt, daß sie so hübsch aussieht. Und was bekomme ich von dir, außer deiner Rumzappelei und deinem Schimpfen? Wer deine Mutter war, steht jedenfalls fest. Wenn dein Großvater nicht wäre, würde ich dich als kleine Wilde rumlaufen lassen, ganz, wie du dir das vorstellst. Er arbeitet schwer, damit du hier in dieser hübschen Wohnung leben kannst, da solltest du dich auch anstrengen, deinen Teil zu tun, indem du hübsch aussiehst und nett zu ihm bist.«
Eines Nachmittags, als Mara fünfzehn war, ging sie ins Büro des Herald-Star und sah die alten Ausgaben der Zeitung durch, bis sie einen Bericht über die Hochzeit ihres Großvaters fand. Ihre Großmutter trug einen glänzenden Schleier, der ihre Schultern bedeckte und mit dem Stoff des Hochzeitskleides verschmolz. Auf dem Mikrofilm war das Foto nicht sehr scharf; Mara konnte nicht beurteilen, ob Selena blonde oder dunkle Haare gehabt hatte. Jedenfalls war sie fast so groß wie Großvater, also etwa einsachtzig, und sie lächelte, nicht verzückt, wie manche Braut auf ihrem Hochzeitsbild, sondern in sich gekehrt, als wüßte sie um ein Geheimnis, das andere erst noch zu erkunden suchten.
Mara las den kurzen Artikel drei- oder viermal und suchte nach Hinweisen auf ihre Großmutter, fand aber nichts. Selenas Vater August Vatick war Professor der Assyriologie an der University of Chicago. Die Frischvermählten wollten ihre Flitterwochen in Mexiko verbringen, und Großvater hatte vor, sich anschließend sofort wieder auf sein Medizinstudium zu konzentrieren.
Mara drehte den Film weiter, um so vielleicht noch auf andere Informationen über ihre Familie zu stoßen. Die Geburt ihrer Mutter stand in einer Augustausgabe des Jahres 1946 auf den Gesellschaftsseiten der Zeitung. Über der Spalte war ein Storch mit einer Windel im Schnabel abgebildet. Beatrix Vatick Stonds, die bei der Geburt dreitausendvierhundert Gramm gewogen hatte, war zusammen mit ihrer Mutter Selena (Mrs. Abraham Stonds) wieder zu Hause in der Graham Street, und beide waren wohlauf.
Im April 1947 berichtete die Zeitung über eine Tragödie in der Familie des bekannten Chicagoer Assyriologen August Vatick. Er war zusammen mit Frau und Tochter in einem Schneesturm im Taurusgebirge umgekommen, wo er nach den Resten eines Tempels der Göttin Gula gesucht hatte. Selenas Ehemann, der berühmte Arzt, und ihre kleine Tochter Beatrix mußten nun daheim in Chicago allein zurechtkommen.
Mara hatte das Gefühl, daß der Herald-Star die Schilderung von Großvaters Trauer über den Tod seiner Frau ein wenig übertrieb: Sie persönlich konnte sich nicht vorstellen, daß er sich aus irgendeinem Menschen genug machte, um seinetwillen Trauer zu empfinden. Vielleicht war er wie Heinrich der Erste, meinte eine Schulfreundin, und hatte sein Herz zusammen mit seiner Frau begraben. Vielleicht hatte er seit damals nicht mehr gelächelt. Aber nicht einmal eine begnadete Geschichtenerzählerin wie Mara selbst konnte sich vorstellen, daß Großvater sein Herz irgendwo anders begrub als in seiner eigenen Brust.