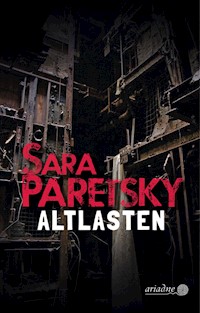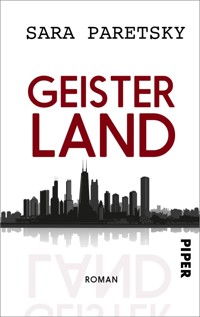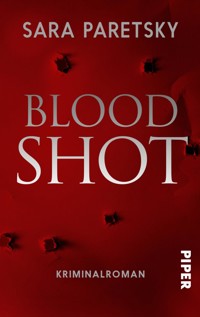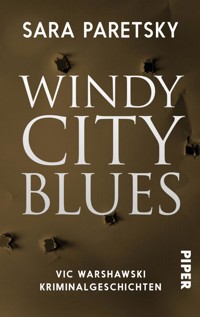6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Einfallsreich folgt Vic Warshawski in ihrem neunten Fall der Spur zu den mächtigsten Männern Chicagos und stößt dabei in ein lebensgefährliches Wespennest aus Korruption und politischen Intrigen
Warum musste die Einwanderin Nicola Aguinaldo auf so gewaltsame Weise sterben? Weshalb verschwindet ihre Leiche, bevor ein ausführlicher Obduktionsbericht erstellt werden konnte? Und aus welchen Gründen will die Chicagoer Polizei ausgerechnet Vic Warshawski die Schuld an dem Tod der jungen Frau in die Schuhe schieben? Beim Lösen ihres neuen Falls ist die charmante und scharfsinnige Privatdetektivin vor besondere Schwierigkeiten gestellt, denn ganz offensichtlich wollen einflussreiche Kreise ihre Nachforschungen unterbinden. –
»Paretsky ist eine Ausnahme unter den amerikanischen Kriminalschriftstellern, weil sie gesellschaftliche Ungerechtigkeit leidenschaftlich verurteilt.« Donna Leon, Welt am Sonntag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Sonja Hauser
ISBN: 978-3-492-98379-2
© dieser Ausgabe Piper Verlag GmbH, München 2018
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Hard Time«
© Delacorte Press, New York 1999
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2001
Covergestaltung: Favoritbüro, München
Covermotiv: Freedom Master/shutterstock
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
1 Medienzirkus
2 Die Frau auf der Straße
3 Hausbesuch
4 Auf der Suche nach einem fahrbaren Untersatz
5 Die Probleme anderer Leute
6 Signor Ferragamo, vermute ich
7 Habeas Corpus?
8 Ein Plausch am Pool
9 Kindermund tut Wahrheit kund
10 Übersetzungsschwierigkeiten
11 Sauber – jedenfalls an der Oberfläche
12 In der Höhle des Löwen
13 Samstag im Einkaufszentrum
14 Brosamen vom Tisch der Reichen
15 Familienpicknick
16 Ein Freund der Familie
17 Auf-der-Stelle-treten
18 Gefängnismauern
19 Poweressen
20 Ein Kind in Trauer
21 Unser Motto: Wir dienen und wir schützen
22 Geschöpfe der Nacht
23 Wettlauf nach O’Hare
24 Ärger für die Riesen
25 Hilfe von einem Freund?
26 Wenn du nicht schwimmen kannst, dann halt dich von den Haien fern
27 Einem Reporter auf der Spur
28 Eine gutgemeinte Warnung
29 Hilf mir, Vater, denn ich weiß nicht, was ich tue
30 Die Geschichte der Mad Virgin
31 Ein Tag auf dem Land
32 Mitternächtlicher Besuch
33 Unter Hechten
34 Ein Picknick am 4. Juli
35 Kleines Spiel auf kleinem Platz
36 Kaution? Aber warum denn?
37 Im großen Haus
38 Gefangene in Block H
39 Audienz bei Miss Ruby
40 Nähkreis
41 Fotosession
42 Langsame Fortschritte
43 Pläne
44 Von Haien umgeben
45 Auf der Flucht
46 Militante Kirche
47 Für die, die auch dienen
48 Pressekonferenz
49 Narben
Dank
Widmung
Für Miriam
Die Fußnotenkönigin, ohne Verweis,
in dem Jahr, in dem du nichts geschrieben hast.
(Ach, abgesehen von diesem Essay über Schanghai, dem über Benjamin, einem kleinen theoretischen Text.)
Revanchier dich
in dem Jahr, in dem du schreibst.
1 Medienzirkus
Lacey Dowell umklammerte ihr Kruzifix, die schneeweißen Brüste vorgereckt, während sie vor ihrem unsichtbaren Angreifer zurückwich. Einzelne rote Haarsträhnen lugten unter ihrer Haube hervor; mit ihren geschlossenen Augen und der gerunzelten Stirn schien sie die Grenze zwischen Agonie und Ekstase überschritten zu haben. Mir persönlich war das zuviel Gefühl auf einmal.
Also drehte ich mich weg, aber da war sie schon wieder, die roten Haare wirr, die Brüste immer noch vorgereckt, und nahm den Hasty Pudding Award von einer Schar Harvardianer entgegen. Ich weigerte mich, die Wand zu meiner Rechten anzusehen, wo sie, den Kopf in den Nacken geworfen, über einen Scherz des Mannes lachte, der ihr gegenüber auf einem Stuhl saß. Ich kannte und mochte den Mann, und deshalb war mir sein Gesichtsausdruck kriecherischer Jovialität peinlich. Murray Ryerson war einfach ein zu guter Journalist, um sich so zu prostituieren.
»Was ist bloß in ihn gefahren? Oder besser gesagt: Was ist nur in mich gefahren, daß ich in meiner Bar einen solchen Medienzirkus zulasse?«
Sal Barthele, die Inhaberin des Golden Glow, hatte sich zwischen der Chicagoer Schickeria, die sich in ihrem Lokal drängte, zu mir durchgezwängt. Sie war so groß – über einsachtzig –, daß sie mich sogar in dieser Menge entdecken konnte. Nach einem Blick auf ihre vertäfelten Wände, die jetzt als Projektionsflächen dienten, rümpfte sie angewidert die Nase.
»Ich weiß es auch nicht«, sagte ich. »Vielleicht will er Hollywood beweisen, was für ein cooler Insider er ist, und den Leuten zeigen, daß er eine kleine Bar kennt, von der sie noch nie was gehört haben.«
Sal schnaubte verächtlich und ließ dabei den Blick über den Raum schweifen, um eventuelle Probleme sofort zu entdecken – Gäste, die zu lange auf ihre Drinks warten mußten, oder Kellner, die nicht mehr weiterkamen. In der Menge befanden sich Berühmtheiten von den lokalen Fernsehsendern, die sich eifrig so postierten, daß ihre Kameras Lacey Dowell sofort erwischten, sollte diese jemals auftauchen. Beim Warten drückten sie sich so nahe wie möglich an wichtige Leute von den Global Studios heran. Murray selbst beschäftigte sich gerade intensiv mit einer Frau in einem Silbergazekleid. Sie hatte sehr kurze Haare, hohe Wangenknochen und einen breiten, leuchtend rot geschminkten Mund. Als hätte sie meinen Blick gespürt, drehte sie sich um, sah mich einen Moment lang an, unterbrach Murray und deutete mit dem Kopf in meine Richtung.
»Mit wem redet Murray denn da?« fragte ich Sal, aber die hatte sich bereits einem schwierigen Gast zugewandt.
Ich drängte mich durch die Menge und stieß gegen Regine Mauger, die verhutzelte Klatschkolumnistin des Herald-Star. Sie sah mich feindselig an. Da sie mich nicht kannte, konnte ich ihr auch nicht nützen.
»Könnten Sie vielleicht ein bißchen aufpassen, junge Frau?« Regine hatte sich so oft liften lassen, daß ihre Haut aussah wie über Knochen gespanntes Papier. »Ich versuche, mich mit Teddy Trant zu unterhalten!«
Das hieß, sie versuchte, ihre knochigen Schultern so nahe an Trant zu drücken, daß er sie bemerkte. Trant war bei Global Leiter der Sektion Mittlerer Westen und im Jahr zuvor, als Global den Herald-Star sowie die damit verbundenen Lokalblätter aufgekauft hatte, von Hollywood hierher geschickt worden. Niemand in Chicago hatte ihm besondere Beachtung geschenkt, bis Global eine Woche zuvor damit begonnen hatte, sein Fernsehnetz auf dem Markt zu lancieren. Global hatte den Chicagoer Channel 13 als Flaggschiff erworben und Lacey Dowell, den Star von Globals unglaublich erfolgreichem Romantik-Horrorstreifen, für die erste Sendung der Reihe »Hinter den Kulissen von Chicago« mit Gastgeber Murray Ryerson, »dem Mann, der Chicago von innen nach außen kehrt«, verpflichtet.
Global startete eine »Hinter den Kulissen«-Serie auf jedem seiner Hauptmärkte. Da Lacey, der Global-Star, aus Chicago kam, war sie genau die richtige Wahl für diese Stadt. Scharen jubelnder Teenager hatten sie genauso begeistert am Flughafen O’Hare empfangen wie wir seinerzeit die Beatles. Heute abend warteten sie vor dem Golden Glow auf sie.
Die Leute aus der Medienwelt konnten gar nicht genug bekommen von Edmund Trant. Klatschkolumnisten wie Regine Mauger berichteten darüber, welche Restaurants er besuchte oder wie seine telegene Frau ihr großes Haus in Oak Brook einrichtete. Und als man die Einladungen für die Party im Golden Glow verschickt hatte, waren alle Leute, die irgendwie mit den Chicagoer Medien zu tun hatten, ganz heiß darauf gewesen, die Karte mit dem Silberrand in ihrer Post zu finden.
Regine und die anderen Klatschkolumnisten interessierten Trant an jenem Abend nicht sonderlich: Ich erkannte den Speaker des Repräsentantenhauses vom Bundesstaat Illinois, des Illinois House, und ein paar andere Landespolitiker in der Gruppe, die um ihn herumstand, und hatte das Gefühl, daß er sich am ausführlichsten mit einem Geschäftsmann unterhielt. Regine, die nicht sonderlich erfreut darüber war, links liegengelassen zu werden, musterte intensiv den Saum ihrer schwarzen Satinhose, um mir bewußt zu machen, daß ich ihn heruntergerissen oder sonstwie beschädigt hatte. Während ich mich weiter in Richtung Bar vorarbeitete, hörte ich sie zu ihrer Kollegin von der Sun-Times sagen: »Wer ist denn diese unbeholfene Frau?«
Ich drückte mich zu der Wand hinter Sals hufeisenförmiger Mahagonitheke. Da ich in Begleitung von Mary Louise Neely und ihrem jungen Schützling Emily Messenger war, wußte ich, daß es ein langer Abend werden würde. In ihrer gegenwärtigen Euphorie würde Emily jede Bitte, vor ein Uhr morgens das Lokal zu verlassen, ignorieren. Es passierte nicht allzuoft, daß sie ihre Freundinnen neidisch machen konnte, und so war sie fest entschlossen, den Abend bis zur Neige auszukosten.
Emily war wie die meisten Teenager völlig weg von Lacey.
Als ich Mary Louise und ihr mitgeteilt hatte, daß ich zwei Gäste mitbringen und sie mich begleiten konnten, wenn sie wollten, war Emily vor Aufregung ganz blaß geworden. Sie sollte in der folgenden Woche zu einem Sommersprachkurs nach Frankreich aufbrechen, aber das war absolut langweilig im Vergleich zu der Aussicht, sich im selben Raum aufzuhalten wie Lacey Dowell.
»Die ›Mad Virgin‹ hatte sie verzückt gehaucht. »Vic, das werde ich dir nie vergessen.«
Lacey hatte diesen Spitznamen wegen ihrer Hauptrolle in einer Horrorfilm-Serie über eine mittelalterliche Frau erhalten, die offenbar bei der Verteidigung ihrer Keuschheit zu Tode gekommen war. Dann und wann tauchte sie unter den Lebenden auf, um sich an dem Mann zu rächen, der sie vergewaltigt hatte und der ebenfalls von Zeit zu Zeit wieder aufkreuzte, um junge Frauen zu bedrohen. Trotz des neofeministischen Anstrichs der Handlung segnete Lacey immer das Zeitliche, nachdem sie ihren ewigen Feind besiegt hatte, während irgendein hirnloser Held seine geistlose Geliebte in den Arm nahm, die sich zuvor neunzig Minuten lang die Seele aus dem Leib geschrien hatte. Die Filme hatten so etwas wie Kultstatus bei den Angehörigen der Generation X – ihre übertriebene Ernsthaftigkeit verwandelte sie automatisch in eine überzogene Satire auf sich selbst –, aber die eigentlichen Fans waren Emily und ihre Teenagerfreundinnen, die Laceys Frisur, die kniehohen Schuhe mit den über Kreuz geschlossenen Riemen sowie die schwarzen Oberteile mit hohem Kragen, die sie privat trug, zu ihrem Kleidungsstil erkoren hatten.
Als ich am anderen Ende der Theke angekommen war, stellte ich mich auf die Zehenspitzen, um nach Emily und Mary Louise Ausschau zu halten, aber die Menge war einfach zu dicht. Sal hatte sogar sämtliche Barhocker in den Keller getragen, damit mehr Platz für die Leute war. Ich preßte mich so eng wie möglich an die Wand, während gestreßte Kellner mit Hors d’reuvres und Flaschen vorbeihuschten.
Murray hatte sich mittlerweile zusammen mit der Frau in dem Silbergazekleid ans entgegengesetzte Ende der Theke bewegt. Er schien sie gerade mit der Geschichte zu unterhalten, wie Sal ihre hufeisenförmige Theke aus den Resten eines Herrenhauses an der Gold Coast gerettet hatte. Damals, in den Anfängen ihrer Zeit als Lokalbesitzerin, hatte sie mich und ihre Brüder dazu gebracht, über den Schutt zu klettern und das Ding herauszuhieven. Als ich sah, daß die Frau den Kopf mit einem künstlichen Lachen in den Nacken warf, war ich mir ziemlich sicher, daß Murray ihr erzählt hatte, er sei ebenfalls mit von der Partie gewesen. Irgendwie erinnerte mich das Gesicht oder auch der Schmollmund, den die Frau beim Zuhören machte, an jemanden, aber ich wußte nicht, an wen.
Sal blieb noch einmal mit einem Tablett voll Räucherlachs bei mir stehen. »Ich muß hierbleiben, bis der letzte draußen ist, aber du brauchst dich nicht rumzuquälen – los, verdrück dich nach Hause, Warshawski.«
Ich nahm etwas Räucherlachs und erklärte ihr ein wenig mürrisch, daß ich auf Mary Louise und Emily warten mußte. »Soll ich dir ein bißchen an der Theke helfen? Dann hätte ich wenigstens was zu tun.«
»Mir wär’s lieber, wenn du nach hinten gehst und die Teller spülst. Du weißt ja, daß es hier normalerweise nichts zu essen gibt, und meine kleine Spülerin weiß gar nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Soll ich dir die Flasche Black Label bringen?«
»Ich muß noch fahren. Was anderes als San Pellegrino gibt’s heute abend nicht.«
Murray gesellte sich mit seiner Begleiterin zu uns und legte den Arm um Sal. »Danke, daß du das Golden Glow zur Verfügung gestellt hast. Weißt du, ich dachte, wir sollten an einem Ort feiern, der wirklich typisch für Chicago ist.«
Dann stellte er sie seiner Begleiterin vor. »Das ist Sal Barthele. Sie sorgt mit dafür, daß Chicago sein besonderes Flair erhält. Und das ist Alexandra Fisher. Sie ist aus Chicago geflohen. V. I. Warshawski kennst du ja.«
»Ja, ich kenne Vic.« Sal wand sich aus Murrays Umarmung. »Hör auf, so anzugeben, Murray. Wir fallen nicht alle in Ohnmacht, weil du mal fünfzehn Minuten vor ’ner Kamera gesessen hast.«
Murray warf den Kopf zurück und lachte. »Das macht diese
Stadt so toll. Aber eigentlich habe ich Alex gemeint. Sie und Vic haben zusammen Jura studiert.«
»Tatsächlich?« Ich erinnerte mich nicht an den Namen.
»Ich hab’ mich ein bißchen verändert.« Auch Alex lachte und packte meine Hand mit festem Griff.
Ich drückte zurück, fest genug, um sie zu überraschen. Sie hatte die Muskeln einer Frau, die regelmäßig mit Gewichten arbeitete, und die vorstehenden Knochen eines Menschen, der sich praktisch ausschließlich von Salat ernährt. Ich hingegen hatte die Muskeln einer Straßenkämpferin von der South Side und wahrscheinlich die entsprechenden Manieren.
Ich wußte immer noch nicht, woher ich sie kannte. Die tiefrot gefärbten Haare trug sie an den Seiten kurz. Am Oberkopf hatte sie sie mit etwas Brillantineähnlichem, das aber auf jeden Fall deutlich teurer war, nach hinten gekämmt. Bevor ich sie etwas fragen konnte, trat ein junger Mann mit kragenlosem weißem Hemd zu uns und murmelte Alex etwas über »Mr. Trant« zu. Sie verabschiedete sich mit einem kurzen Winken von Murray und mir und folgte dem jungen Mann ins Zentrum der Macht. Die Klatschkolumnistin Regine Mauger, die immer noch auf ein Opfer wartete, wollte sie aufhalten, um einen Kommentar von ihr zu bekommen, aber da war Alex schon in der Menge verschwunden.
»Na, was meinst du, V. I.?« Murray holte sich die Hälfte des Räucherlachses von Sals Tablett und spülte ihn mit einem Schluck Bier hinunter.
Erst da fiel mir auf, daß er sich für sein Fernsehdebüt den Bart abrasiert hatte. Ich hatte miterlebt, wie dieser feuerrote Bart in den Jahren unserer Zusammenarbeit und auch Rivalitäten allmählich rotbraun und schließlich grau meliert geworden war, aber sein nacktes Kinn hatte ich noch nie gesehen.
Das tat mir irgendwie weh – der dumme Murray, da plusterte er sich so auf für die Medien –, also sagte ich hastig: »Ich finde, sie hat tolle Muskeln.«
»Ich meine nicht die Frau, sondern meine Sendung, Warshawski.«
Ich wandte den Blick nicht von der Mahagonitheke. »Ich finde, du räumst Lacey den gleichen Stellenwert ein wie damals Gantt-Ag oder anderen Storys, bei denen wir zusammengearbeitet haben.«
»Mein Gott, Warshawski, mußt du immer gleich so kritisch sein?«
»Ich wünsch’ dir Glück, Murray, wirklich.«
Dann betrachtete ich sein Gesicht. Das, was er in meinen Augen sah, ließ ihn den Blick abwenden. Er schenkte Sal ein weiteres übertriebenes Grinsen und nahm sie noch einmal in den Arm, bevor er sich in die Richtung in Bewegung setzte, in der seine Begleiterin sich jetzt befand. Als ich ihm nachschaute, merkte ich, daß jemand die Kamera auf uns gerichtet hatte: Er hatte Sal also fürs Fernsehen umarmt.
»Ich habe den Eindruck, Murray hat sich das Golden Glow bloß ausgesucht, damit er diesen Hollywood-Typen beweisen kann, daß er sich mit Schwarzen abgibt«, sagte Sal und sah ihm stirnrunzelnd nach.
Ich sagte nichts, aber letztlich pflichtete ich ihr bei.
»Diese Alex Fisher gehört zur juristischen Abteilung von Global«, sagte Sal, den Blick immer noch auf den Raum gerichtet. »Sie haben sie eigens von Kalifornien hier rübergeholt. Ich hab’ schon wegen der Haftungsfrage mit ihr zu tun gehabt. Stell dir vor, ich hab’ doch tatsächlich ’ne Versicherung für heute abend abschließen müssen. Und die Leute von Global haben die Kosten dafür erst übernommen, als ich ihnen erklärt habe, daß das Gesundheitsamt Fragen über das Essen hier im Golden Glow stellt und ich die Sache wahrscheinlich abblasen muß.«
»Und warum haben sie’s nicht einfach irgendwo anders gemacht?«
»Nun, weil sie für den Partyservice zahlen, aber das habe ich ihnen erst heute vormittag gesagt. In Hollywood heißt es, daß man sich’s mit Global nicht verscherzen darf, aber hier in dieser Stadt sind sie fremd.« Sie lachte und verschwand in der winzigen Küche.
So gegen Mitternacht kam an der Tür Unruhe auf. Ich hoffte, daß Lacey der Grund für diese Uruhe wäre, damit ich endlich Emily einsammeln und nach Hause fahren konnte, aber es waren nur ein paar Spieler von den Bulls, also langweilig für Emily und ihre Freundinnen. Als die Menge für die Männer Platz machte, entdeckte ich Mary Louise und Emily, die sich direkt neben dem Eingang postiert hatten, damit Emily von Lacey sofort ein Autogramm bekommen konnte, wenn diese eintraf. Emily war genauso gekleidet wie die Mad Virgin: Sie trug ein schwarzes Oberteil, eine Stretchhose sowie Schuhe mit Plateausohlen der Marke Virginwear, die Global gehörte.
Mary Louise hatte offenbar einen Deal mit einem der Sicherheitsbeamten gemacht. Sie war selbst zehn Jahre lang bei der Polizei gewesen und hatte deshalb noch Verbindungen. Jedenfalls hatte der diensthabende Beamte Emily direkt hinter die Absperrseile aus rotem Samt gesetzt, die den Eindruck vermitteln sollten, daß das Golden Glow so etwas wie einen Eingangsbereich hatte. Er hatte ihr sogar einen Barhocker organisiert. Ich war ein bißchen neidisch, denn mir taten die Beine von der stundenlangen Herumsteherei allmählich weh.
»Warten Sie auch auf Lacey?«
Als ich mich umdrehte, sah ich, daß ein Fremder mit mir sprach, ein kräftiger, ein paar Jahre jüngerer Mann als ich, mit lockigen braunen Haaren und der Andeutung eines Schnurrbarts.
»Ich bin mit dem Bräutigam befreundet«, sagte ich, »aber ich habe leider eine junge Frau dabei, die erst hier weggeht, wenn sie ein Autogramm von Lacey hat.«
»Eine Freundin des Bräutigams? Ach so, jetzt verstehe ich, das war ein Scherz«, sagte er mit einem Lächeln in den Augen. »Und ich bin mit der Braut befreundet. Zumindest sind wir im selben Haus aufgewachsen, und sie war ganz aufgeregt, als sie mir erzählt hat, daß sie nach Chicago zurückkommt.«
»Ist sie denn wirklich von hier? Wenn Schauspieler sagen, daß sie aus Chicago kommen, meinen sie damit normalerweise Winnetka oder New Trier, aber nicht die Stadt selber.«
»Doch, doch. Wir sind in Humboldt Park aufgewachsen. Bis wir zwölf waren, haben wir immer zusammengesteckt, damit die Größeren uns nicht ständig piesackten. Dann hat sie irgendwann ’ne Rolle im Fernsehen gekriegt und sofort sagenhaften Erfolg gehabt. Heute behaupten genau die gleichen Typen, die ihr früher immer im Treppenhaus aufgelauert haben, plötzlich, daß sie mal mit ihr befreundet waren, aber so leicht läßt sie sich nicht drankriegen.«
»Erinnert sie sich noch an Sie?« Eigentlich interessierte mich das nicht sonderlich, aber ein bißchen Small talk würde helfen, den Abend schneller vergehen zu lassen.
»Klar. Sie hat mir ’ne Einladung für heute abend geschickt. Aber sie will sich nicht allein mit mir treffen.« Er streckte die Hand nach einer Flasche Bier aus und schüttelte dabei den Kopf, als wolle er einen lästigen Gedanken loswerden. »Warum auch? Und mit welchem Bräutigam sind Sie befreundet? Arbeiten Sie fürs Fernsehen?«
»Nein, nein. Ich kenne bloß Murray Ryerson, das ist alles.«
»Sie arbeiten für ihn?« Er nahm einen Teller mit winzigen Sandwiches vom Tablett eines vorbeigehenden Kellners und reichte ihn mir.
Ich sage den Leuten nicht gern, daß ich Privatdetektivin bin – das ist fast so schlimm wie ein Arzt auf einer Party, denn jeder hat irgendwelche Probleme, für die er dann sofort eine Lösung erwartet. Auch dieser Abend war da keine Ausnahme. Als ich dem Mann sagte, was ich beruflich machte, meinte er, vielleicht könne ich ihm ja helfen. In seiner Fabrik hätten sich in letzter Zeit merkwürdige Dinge ereignet.
Ich unterdrückte ein Seufzen und fischte in meiner Handtasche nach einer Visitenkarte. »Rufen Sie mich an, wenn Sie sich an einem Ort, an dem ich mich voll und ganz auf Sie konzentrieren kann, mit mir darüber unterhalten wollen.«
»V. I. Warshawski? Ecke Leavitt Street und North Avenue? Das ist gar nicht weit von mir weg.«
Bevor er noch etwas sagen konnte, wurde es wieder unruhig an der Tür. Diesmal war es tatsächlich Lacey. Edmund Trant löste sich sofort von der Schar seiner Bewunderer und ging hinüber zu Lacey, um ihr die Hand zu küssen, und gleich begannen die Kameras zu surren. Murray kämpfte sich gerade rechtzeitig zu den beiden vor, um vor laufenden Kameras einen Kuß von Lacey zu bekommen. Der Polizist an der Tür begrüßte Lacey und führte sie zu Emily. Ich sah zu, wie sie
Emily umarmte, ihr ein Autogramm gab und sich dann in die Arme eines anderen Global-Schauspielers warf.
Während ich mich zu Mary Louise und Emily vordrängte, bewegte sich Lacey mitsamt ihrer Gefolgschaft in die Mitte des Raumes. Der Mann, mit dem ich mich soeben unterhalten hatte, schaffte es, sich direkt hinter den Kellner zu stellen, der ihr gerade einen Drink reichte. Ich beobachtete die beiden. Lacey begrüßte ihn voller Freude, also hatte er wahrscheinlich die Wahrheit über ihre gemeinsame Kindheit erzählt. Aber offenbar versuchte er dann, ernsthaft mit ihr über etwas zu reden, was völlig deplaziert war in einem öffentlichen Rahmen wie diesem. Trotz des gedämpften Lichts von Sals Tiffany-Lampen sah ich, daß Lacey rot wurde. Sie wandte sich mit hochmütiger Geste von dem Mann ab, und er machte den Fehler, sie an der Schulter zu packen. Der Beamte, der den Barhocker für Emily organisiert hatte, drängte sich durch die Menge zu den beiden hinüber und dirigierte ihn zur Tür. Als Mary Louise, Emily und ich das Lokal ein paar Minuten später verließen, stand der Mann auf der anderen Straßenseite und starrte zum Golden Glow herüber. Dann steckte er die Hände in die Hosentaschen und ging weg.
»Vic, du hast mir eine solche Freude gemacht«, seufzte Emily, als wir die Schlange der Lacey-Fans passierten. »Die warten jetzt schon Stunden drauf, sie zu sehen, und mich hat sie in den Arm genommen und mir ein Autogramm gegeben. Vielleicht komme ich sogar ins Fernsehen. Wenn mir vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, daß irgendwann jedes Mädchen in Chicago neidisch auf mich sein würde, hätte ich ihm nicht geglaubt. Aber jetzt ist es wahr geworden.«
2 Die Frau auf der Straße
Emily plapperte während des ganzen Weges zum Wagen aufgeregt vor sich hin und schlief dann auf dem Rücksitz erschöpft ein. Mary Louise machte es sich auf dem Beifahrersitz bequem und schlüpfte aus ihren Stöckelschuhen.
»In dem Alter bin ich die ganze Nacht aufgeblieben, um die Hochzeit von Diana und Charles anzuschauen«, sagte sie. »Emily hat Lacey wenigstens anfassen dürfen.«
Ich hatte als Teenager zum O’Hare-Flughafen hinausfahren wollen, um zusammen mit meinen Altersgenossen auf Ringo und John zu warten, aber damals war meine Mutter schwer krank gewesen, und ich wollte nicht, daß sie sich Sorgen machte, weil ich spät in der Nacht mit dem Bus und der Hochbahn in der Gegend herumfuhr. »So ein Typ wollte mit Lacey sprechen, als wir gegangen sind. Er hat gesagt, sie sind zusammen in Humboldt Park aufgewachsen. Stimmt das?«
»Freut mich, daß du mich fragst.« Im Licht der Straßenlaternen entlang des Inner Drive sah ich Mary Louises Gesicht. »Seit du uns vor zwei Wochen zu dem Abend eingeladen hast, habe ich fast nichts anderes getan, als mir Fakten über Lacey Dowells Leben einzuverleiben. Da wird’s allerhöchste Zeit, daß du auch was davon hast. Laceys eigentlicher Name ist Magdalena Lucida Dowell. Ihre Mutter war Mexikanerin, ihr Vater Ire; sie ist das einzige Kind der beiden und in Humboldt Park aufgewachsen. Sie hat die St.-Remigio-Schule besucht, bei allen Schulaufführungen mitgespielt und schließlich ein Stipendium für die Northern Illinois gekriegt. Die machen da viel Schauspiel und Theater. Vor zwölf Jahren hat sie dann ihre erste große Filmrolle bekommen, als…«
»Schon gut, schon gut. Du weißt sicher auch, was sie für ’ne Schuhgröße hat und welche Farbe sie am liebsten mag.«
»Grün, und die Schuhgröße ist vierzig. Und ihr ist das chorizo aus ihrem Viertel immer noch lieber als das ganze schicke Essen in L. A. Ha, ha. Ihr Vater ist bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen, und ihre Mutter wohnt mit ihr zusammen in einem hübschen Haus mit Meerblick in Santa Monica. Angeblich unterstützt Lacey St. Remigio finanziell. Es heißt, daß sie den Kardinal daran gehindert hat, die Schule zu schließen, indem sie die Stipendienkasse aufgestockt hat. Wenn das stimmt, ist das eine hübsche Leistung.«
»Allerdings.« Die Ampel am Lake Shore Drive schaltete auf Grün, und ich lenkte den Wagen auf die Spur, die in nördliche Richtung führte.
»Aber etliches von dem, was ich dir gerade gesagt habe, hättest du auch in Murrays Interview hören können. Hast du dir das denn nicht angeschaut?«
Ich zog eine Grimasse. »Ich glaube, die Tatsache, daß er das Interview gemacht hat, war mir so peinlich, daß ich mich nicht richtig auf das konzentriert habe, was er gesagt hat.«
»Nun geh nicht so hart mit ihm ins Gericht«, meinte Mary Louise. »Schließlich muß er auch von was leben, und du hast selber gesagt, daß die Leute von Global immer wieder seine wichtigsten Storys gestrichen haben.«
Sie hatte recht. Ich wußte, daß Murray seit der Übernahme seiner Zeitung durch Global ziemliche Schwierigkeiten gehabt hatte. Zwar hatte er weiter recherchieren dürfen, aber alle Storys, die die Leute von Global als politisch zu heikel erachteten, waren einfach nicht gedruckt worden. »Wir müssen auf die Leute hören, die uns in diesem Staat einen Gefallen tun«, hatte Murray verbittert eine Aussage seiner Vorgesetzten zitiert, als diese kurzerhand einen Artikel über das neue Frauengefängnis in Coolis kippten, an dem er monatelang gearbeitet hatte. Dann hatte er noch ein weiteres Zitat seines Herausgebers hinzugefügt: Die Amerikaner sind solide Geschichten gewöhnt. Sex, Sport und Gewalt – das sind solche soliden Sachen. Die Manipulation von Rentenfonds und die Bestechung von Beamten gehören nicht dazu. Kapiert, Murray?
Ich hatte völlig vergessen, wie gut Murray die Kunst beherrschte, alle Widernisse zu überstehen. Kaum jemand dürfte überraschter gewesen sein als ich, eine der begehrten Einladungskarten zur Global-Party im Golden Glow zu bekommen – besonders weil darauf stand, daß wir dort Murrays Debüt als Chicagos »Hinter den Kulissen«-Reporter feiern würden. Ich dachte lieber nicht darüber nach, was Murray angestellt hatte, um sich den Job zu angeln. Von sich aus würde er es mir jedenfalls nicht erzählen. Als ich bei ihm anrief, um ihn danach zu fragen, meldete sich eine Assistentin, die mir höflich versicherte, sie würde alle Nachrichten an ihn weiterleiten. Er selbst war nicht zu sprechen.
Ich wußte, daß Murray diskret die Fühler nach Reportageaufträgen auf nationaler Ebene ausgestreckt hatte. Aber er war ein paar Jahre älter als ich, und wenn man erst mal über vierzig ist, beginnen die Unternehmen einen als Belastung zu empfinden. Man ist zu teuer und kommt allmählich in ein Alter, in dem man anfängt, seine Krankenversicherung tatsächlich zu nutzen. Außerdem hatte er die gleichen Probleme, außerhalb der Stadt zu arbeiten wie ich, weil sein Insiderwissen sich ausschließlich auf Chicago bezog. Also hatte er der Realität ins Auge geblickt. War das etwa ein Verbrechen?
Um zwei Uhr morgens mitten in der Woche war nicht viel los auf dem Drive. Rechts von mir verschmolzen Himmel und See zu einem langen schwarzen Strich. Wir waren ganz allein am Rand der Welt, der lediglich vom silbrigen Licht der Straßenlaterne erhellt wurde. Ich war froh über Mary Louises Gesellschaft; sogar ihre Monologe darüber, wieviel der Babysitter fürs Aufpassen auf Emilys kleine Brüder verlangte, oder darüber, wieviel sie vor dem Sommersemester noch erledigen mußte – neben ihrer Teilzeittätigkeit für mich studierte sie Jura –, wirkten beruhigend. Ihr Jammern hielt mich davon ab, darüber nachzudenken, wie unsicher mein eigenes Leben war, was meine Ressentiments gegen Murray förderte, weil er sich dem Fernsehen verkaufte.
Ich beschleunigte auf einhundertzehn Stundenkilometer, als könnte ich so meiner Gereiztheit entkommen. Mary Louise, die nicht umsonst früher bei der Polizei gewesen war, protestierte lautstark, als wir über eine Hügelkuppe an der Montrose Avenue segelten. Ich verlangsamte artig vor unserer Ausfahrt. Der Trans Am hatte mittlerweile zehn Jahre auf dem Buckel, und das sah man ihm auch an, aber Kurven nahm er immer noch wie ein junger Hüpfer. Erst an der Ampel an der Foster Avenue war ein leichtes Röcheln des Motors zu hören.
Je weiter wir in westlicher Richtung fuhren, desto mehr war los auf den Straßen: Aus den Schatten tauchten Betrunkene auf, und auf dem Asphalt lagen Bierdosen. Die Stadt verändert ihren Charakter hier in der Gegend alle paar Häuserblocks. Mary Louise lebt in einem ruhigen Wohnviertel; gleich daneben befindet sich ein Abschnitt, in dem gerade erst ins Land gekommene russische Juden und Hindus direkt nebeneinander untergebracht sind, und daran schließt sich ein Areal an, in dem Chicagos Ärmste und Verzweifeltste vor sich hin vegetieren. Direkt am See ist Uptown am rauhesten. Am Broadway kamen wir an einem Mann vorbei, der an einen Abfallcontainer pinkelte, hinter dem gerade ein Pärchen Sex hatte.
Mary Louise sah auf den Rücksitz, um sich zu vergewissern, daß Emily immer noch schlief. »Fahr zur Balmoral Avenue und dann auf die andere Seite rüber, da ist es ruhiger.«
An einer Kreuzung stand ein Mann, der mit einem schmuddeligen Schild um Essen bettelte. Er wankte mit unsicheren Schritten zwischen den vorbeifahrenden Autos hindurch. Ich ging fast auf Schrittgeschwindigkeit herunter, bis wir an ihm vorbei waren.
Abseits des Broadway waren die meisten Straßenlaternen kaputt, die Lampen zerschmettert und nie durch neue ersetzt worden. Den Körper mitten auf der Straße sah ich erst, als ich fast schon darüberfuhr. Ich bremste abrupt und riß das Steuer nach links. Mary Louise schrie auf und packte mich am Arm. Der Trans Am schlingerte über die Straße und landete an einem Hydranten.
»Vic, tut mir leid. Ist dir was passiert? Ich hab’ gedacht, du überfährst ihn. Und Emily, mein Gott…« Sie löste den Sicherheitsgurt mit zitternden Fingern.
»Ich hab’ ihn gesehen«, sagte ich mit erstickter Stimme. »Ich hab’ gebremst. Mich am Arm zu packen, nützt da auch nicht viel.«
»Mary Lou, was ist denn los?« fragte Emily, die inzwischen aufgewacht war, mit erschreckter Stimme.
Mary Louise war bereits hinten bei ihr, während ich noch an meinem Sicherheitsgurt herumfummelte. Emily war nichts passiert; sie hatte nur Angst. Sie versicherte Mary Louise immer wieder, daß ihr nichts fehlte, und stieg schließlich aus, um es ihr zu beweisen. Mary Louise sah sich ihren Nacken und ihre Schultern genau an, während ich eine Taschenlampe aus dem Handschuhfach holte.
Nachdem Mary Louise sich vergewissert hatte, daß Emily wirklich unverletzt war, hastete sie zu der Gestalt auf der Straße. Ihre berufliche Routine war stärker als die vier Bier, die sie im Verlauf des Abends getrunken hatte. Daß sie beim
Gehen ein wenig unsicher wirkte, war eher auf den Schock zurückzuführen.
»Vic, es ist eine Frau. Sie atmet kaum noch.«
Im Licht meiner Taschenlampe sahen wir, daß die Frau noch sehr jung war. Sie hatte dunkle Haut und dichte schwarze Haare, die ihr wirr ins Gesicht hingen. Ihr Atem kam blubbernd und keuchend, als sei ihre Lunge mit Flüssigkeit gefüllt. So etwas hatte ich schon einmal gehört, als mein Vater damals an einem Lungenemphysem gestorben war, aber diese Frau hier sah viel zu jung aus für eine solche Krankheit.
Ich richtete den Strahl der Taschenlampe auf ihre Brust und wich entsetzt zurück. Die Vorderseite ihres Kleides war voller Blut. Es war durch den dünnen Stoff gedrungen, so daß er wie ein großer Verband an ihrem Körper klebte. Schmutz und Blut zogen sich in breiten Streifen über ihre Arme; ihr linker Oberarmknochen ragte aus ihrem Fleisch wie eine Stricknadel aus einem Knäuel Wolle. Vielleicht war sie, benommen von Heroin oder Wild Rose, vor ein Auto gelaufen.
»Vic, was ist los?« Emily stand jetzt zitternd neben uns.
»Schätzchen, sie ist verletzt, und wir müssen Hilfe holen. Im Kofferraum sind ein paar Handtücher. Könntest du die bitte herbringen, während ich die Sanitäter rufe?«
Das beste Mittel gegen Angst ist Aktivität. Emily ging mit knirschenden Schritten über zerbrochenes Glas zum Wagen, während ich mein Handy herausholte und die Notrufnummer wählte.
»Nimm du die Handtücher; ich kümmere mich um die Sanitäter.« Mary Louise wußte aufgrund ihrer Zeit bei der Polizei genau, welche Informationen die Leute vom Notdienst brauchten, um so schnell wie möglich zum Unfallort zu kommen. »Wir haben hier eine Verletzte. Sieht aus wie Fahrerflucht. Wir sind Ecke Balmoral Avenue und…«
Ich breitete die Handtücher über die Frau und rannte zur Straßenecke, um festzustellen, wo genau wir uns befanden. An der Glenwood Avenue, gleich östlich von der Ashland Avenue. Ein Wagen bog gerade in die Straße; ich winkte ihn weiter. Der Fahrer brüllte mir zu, daß er hier wohne, doch ich besann mich auf meinen Vater, der Verkehrspolizist gewesen war, und blaffte ihn an, die Straße sei gesperrt. Der Fahrer fluchte, versuchte aber nicht weiter, an mir vorbeizukommen. Ein paar Minuten später traf mit quietschenden Reifen ein Notarztwagen ein. Ihm folgte ein Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht.
Die Sanitäter machten sich sofort an die Arbeit. Während sie der Verletzten eine Atemmaske überstülpten und sie in den Wagen schoben, begann sich eine Menge von Schaulustigen zu versammeln: die für die Uptown so typische Mischung aus schwarzen und indianischen Gesichtern sowie Leuten aus dem Nahen Osten. Zwei Mädchen mit Kopftüchern deuteten und plapperten wild durcheinander; ein Erwachsener trat aus einem Wohnhaus, gab einer von ihnen eine Ohrfeige und zog sie beide hinein.
Ich suchte in der Hoffnung, eine Brieftasche oder irgend etwas anderes zu finden, das zur Identifizierung der Verletzten beitragen konnte, mit meiner Taschenlampe auf dem Boden herum, wurde aber schon bald von einem der Polizisten aufgehalten, der mich mit der Bemerkung, die Sichtung des Unfallortes sei Sache der Polizei, zu Mary Louise zurückführte.
Mary Louise legte schützend den Arm um Emily, während wir Fragen beantworteten. Die Beamten sahen sich mit mir zusammen den Trans Am genauer an. Der Hydrant hatte die Motorhaube aufspringen lassen und die vordere Radachse verbogen.
»Sind Sie die Fahrerin des Wagens, Ma’am?« fragte mich einer der Beamten. »Kann ich Ihren Führerschein sehen?«
Ich holte ihn aus der Tasche. Er übertrug die daraufstehenden Angaben langsam auf seinen Bericht und überprüfte schließlich, ob ich irgendwelche Verwarnungen wegen Trunkenheit am Steuer hatte. Als seine Nachforschungen negativ ausfielen, ließ er mich sehr zum Vergnügen der kichernden Schaulustigen mit kleinen Schritten auf einer geraden Linie gehen.
»Würden Sie mir bitte sagen, wie das passiert ist, Ma’am?«
Ich sah Mary Louise an, beantwortete aber dann doch selbst die Frage: kein Licht von den Straßenlaternen, Körper mitten auf der Straße, Ausweichmanöver, Kollision mit dem Hydranten.
»Und was hatten Sie überhaupt hier auf dieser Straße verloren, Ma’am?«
Normalerweise erkläre ich einem Polizisten auf eine solche Frage, daß ihn das nichts angeht, aber normalerweise habe ich auch keine Sechzehnjährige mit vor Schreck weißem Gesicht dabei. Arme Emily. Der Abend war für sie sowieso schon verdorben; da brauchte ich mich nicht auch noch mit der Polizei herumzustreiten. Also sagte ich artig, ich habe Mary Louise und Emily nach Hause bringen wollen und eine Abkürzung über die Seitenstraßen genommen. Zwar habe sich dieser Weg als der längere erwiesen, aber wenigstens habe die Verletzte so eine Chance bekommen. Eigentlich ärgerte mich nur, daß der Wagen nun Schrott war. Da bekam ich ein schlechtes Gewissen: Eine junge Frau kämpfte mit dem Tod, und ich machte mir Gedanken wegen meinem Wagen. Aber größere Reparaturen oder gar ein neues Gefährt waren in diesem Sommer in meinem Budget einfach nicht vorgesehen. Wieder einmal mußte ich an den opportunistischen Murray denken.
»Und wo waren Sie mit der jungen Frau?« hakte der Beamte mit einem skeptischen Blick nach, der verriet, daß er sich fragte, was zwei erwachsene Frauen mit einem Teenager vorhatten, mit dem sie möglicherweise nicht einmal verwandt waren.
»Wir waren zu der Party mit Lacey Dowell eingeladen«, sagte Mary Louise. »Ich bin Emilys Pflegemutter und lasse sie in ihrem Alter noch nicht allein zu solchen Veranstaltungen. Sie können Detective Finchley im First District anrufen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben – er war vier Jahre lang mein Vorgesetzter und kann Ihnen erzählen, wie Emily und ich zusammengekommen sind.«
Danach war die Situation weniger angespannt. Einer der Beamten kannte Finchley, und wenn Mary Louise eine von ihnen war, dachten sie wohl, konnte sie kaum in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Die Beamten halfen mir, den Trans Am von dem Hydranten wegzuschieben. Sie fuhren uns sogar nach Hause. Mir war das ganz recht, denn so mußte ich nicht auf den 22er Bus warten.
Als wir losfuhren, sahen uns die Schaulustigen amüsiert nach. Der Zwischenfall hatte ein für sie befriedigendes Ende gefunden: Die Polizei brachte drei weiße Frauen mit dem Streifenwagen weg.
3 Hausbesuch
Mein Vater lag im letzten Stadium seiner Krankheit auf der Straße. Er hatte sein Sauerstoffzelt am Gehsteigrand zurückgelassen und schnappte nach Luft. Bevor ich zu ihm gehen und ihm aufhelfen konnte, kam ein Streifenwagen um die Ecke und überfuhr ihn. Ihr habt ihn umgebracht, ihr habt ihn umgebracht, versuchte ich zu schreien, aber es kam kein Ton heraus. Bobby Mallory, der älteste Freund unter den Kollegen meines Vaters, stieg aus dem Wagen, sah mich ohne jedes Mitleid an und sagte: »Ich nehme dich wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses fest.«
Das Telefon riß mich aus meinem Alptraum. Ich streckte den Arm aus und murmelte »Ja?« in den Hörer.
Es war mein Nachbar von unten. Seine Stimme klang besorgt. »Tut mir leid, Schätzchen, daß ich Sie aufwecke, aber hier unten sind ein paar Polizisten, die sagen, Sie waren heute nacht in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt. Die haben wie verrückt bei Ihnen geklingelt, und die Hunde sind fast durchgedreht, da hab’ ich mal nachgesehen. Natürlich ist Mitch gleich rausgestürzt, neugierig, wie er ist, und der eine von den Polizisten hat sofort angefangen von wegen, hier in der Stadt gibt’s doch wohl ’ne Verordnung, daß man Hunde an die Leine nehmen muß, aber ich hab’ ihm gesagt, na, soviel ich weiß, gilt das nicht für zu Hause, und wer sind Sie überhaupt, warum machen Sie hier so ’nen Krach, aber da hat er seine Dienstmarke rausgezogen…«
»Hat er tatsächlich was von Fahrerflucht gesagt?« fragte ich und richtete mich verschlafen auf.
»Er hat mir seine Dienstmarke unter die Nase gehalten und nach Ihnen gefragt, aber natürlich hat er Ihren Namen nicht richtig gesagt. Was ist denn passiert, Schätzchen? Sie haben doch nicht wirklich jemanden angefahren und dann liegenlassen, oder? Ich hab’ Ihnen ja immer schon gesagt, Sie sollen mit der Karre nicht so schnell durch die Stadt flitzen, aber wenigstens stehen Sie zu Ihren Fehlern und würden nicht einfach jemanden im Graben liegenlassen. Das hab’ ich dem einen von den zweien auch gesagt, aber der hat sich aufgeführt wie Dirty Harry. Hat wohl gedacht, ich hab’ Angst vor ihm, dabei hab’ ich früher Typen verprügelt, die waren doppelt so groß wie der…«
»Wo sind sie jetzt?«
Mr. Contreras ist durchaus in der Lage, sich ein oder zwei Tage lang aufzuregen, wenn er erst mal in Fahrt ist. Er ist in Rente, aber obwohl ich weiß, daß er früher mal bei Diamond Motors an der Drehbank gearbeitet hat, kann ich ihn mir eigentlich nur mit einem Hammer in der Hand vorstellen. »Die sind unten in der Eingangshalle. Ist wahrscheinlich besser, Sie stehen auf und reden mit denen, Schätzchen, auch wenn das ziemliche Pißnelken sind, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise. Ganz anders wie der Lieutenant oder Conrad oder die anderen Polizisten, die Sie kennen.«
Es war fast schon heroisch von ihm, Conrad Rawlings im selben Atemzug mit Lieutenant Mallory zu nennen, denn Mr. Contreras war alles andere als glücklich über meine Beziehung mit Conrad gewesen. Seine übliche Eifersucht auf die Männer, mit denen ich zusammen war, hatte sich durch Conrads Hautfarbe noch verstärkt. Mr. Contreras war ziemlich froh gewesen, als Conrad meinte, die Sache mit uns funktioniere einfach nicht – allerdings nur, bis er merkte, wie wichtig mir die Geschichte gewesen war. Ich hatte eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich von der Trennung erholt hatte.
Ich legte auf und tappte zum Bad. Früher, mit dreißig, hatte für gewöhnlich eine lange Dusche genügt, um mich nach einer kurzen Nacht wieder frisch zu machen, aber jetzt, mit über vierzig, brauchte ich einfach meinen Schlaf. Ich ließ mir kaltes Wasser auf den Kopf prasseln, bis ich anfing, mit den Zähnen zu klappern. Allmählich begann sich mein Kreislauf zu regen. Allerdings floß immer noch nicht genug Blut in meinen Kopf, als daß ich mich einem Gespräch mit der Polizei gewachsen gefühlt hätte.
Während ich mich abtrocknete, hörte ich, daß sie an meiner Wohnungstür Sturm klingelten. Ich schaute durch den Spion. Es waren zwei Beamte, der eine klein und mit einem braunen Polyesteranzug, der schon ein paarmal zu oft durch den Trockner gejagt worden war, und ein großer mit einem Gesicht voller Aknenarben.
Ich öffnete die Tür bei vorgelegter Kette und streckte nur die Nase hinaus, so daß sie nicht sahen, daß ich nackt war. »Ich mache Ihnen auf, sobald ich was anhabe.«
Der Kleinere versuchte, die Tür aufzudrücken, aber ich machte sie zu, bevor er sich mit ganzer Kraft dagegenstemmen konnte, ging mit meiner Jeans in die Küche, um mich anzuziehen, und stellte den kleinen Espresso-Kocher auf die Herdplatte. Nachdem ich in meine Kleider geschlüpft war, ging ich wieder zur Tür.
Der Kleinere bleckte die winzigen Zähne, die ein bißchen an einen Hecht erinnerten. »V. I. Warshki? Polizei. Wir hätten ein paar Fragen an Sie.«
»Warshawski, nicht Warshki«, sagte ich. »Mein Nachbar hat mir schon gesagt, daß Sie von der Polizei sind, aber trotzdem hätte ich gern noch einen Dienstausweis gesehen. Dann können Sie mir erklären, warum Sie da sind.«
Der Größere holte seine Dienstmarke aus der Tasche und hielt sie mir den Bruchteil einer Sekunde vor die Nase. Ich packte sein Handgelenk, damit ich mir den Ausweis genauer ansehen konnte. »Detective Palgrave. Und Ihr Kollege heißt wie? Detective Lemour. Danke. Sie können schon mal im Wohnzimmer Platz nehmen, während ich mich fertig anziehe.«
»Äh, Ma’am«, sagte Palgrave. »Es macht uns nichts aus, wenn Sie keine Strümpfe anhaben. Wir wollen Ihnen ein paar Fragen über die Frau stellen, die Sie heute nacht gefunden haben.«
Eine Tür am unteren Ende der Treppe fiel ins Schloß. Mitch und Peppy begannen, gefolgt von Mr. Contreras, nach oben zu rennen. Die Hunde drückten sich an den beiden Beamten vorbei und begrüßten mich mit Freudengeheul, als hätten sie mich zwölf Monate nicht mehr gesehen, nicht zwölf Stunden. Lemour holte mit dem Fuß nach Mitch aus, erwischte aber nur seinen Schwanz. Ich packte beide Hunde am Halsband, bevor Schlimmeres passierte.
Als sie mich begrüßt hatten, wollten sie die Prozedur unbedingt mit Lemour wiederholen. Peggy ist sandfarben, ihr Sohn Mitch zur Hälfte schwarzer Labrador und riesig. Wie alle Golden Retriever sind die beiden unverbesserlich friedliebend, aber wenn sie einen hechelnd anspringen, können sie ziemlich wild aussehen. Jedenfalls würde unser Besucher nicht versuchen, sich an ihnen vorbei in die Wohnung zu drängen.
Mr. Contreras hatte gerade noch gesehen, wie Lemour versuchte, Mitch einen Tritt zu versetzen. »Hören Sie zu, junger Mann, es ist mir egal, ob Sie Polizist sind oder Politesse, aber diese Hunde wohnen hier und Sie nicht. Sie haben kein Recht, nach ihnen zu treten. Ich könnte Sie dem Tierschutzverein melden. Glauben Sie, Ihre Mutter und Ihre Kinder würden in der Zeitung gern was über ’nen Polizisten lesen, der Hunde mißhandelt?«
Der Beamte war nicht der erste, der sich von Mr. Contreras aus der Fassung bringen ließ. »Wir wollen mit der Lady über einen Fall von Fahrerflucht reden, der sich heute nacht ereignet hat. Nehmen Sie Ihre Hunde mit nach unten und lassen Sie uns in Ruhe.«
»Zufällig, junger Mann, gehört der Golden Retriever der Lady. Wir kümmern uns gemeinsam um die beiden. Wenn sie sie also hier bei sich haben will, soll mir das recht sein. Und wenn Sie meinen, daß sie etwas mit der Fahrerflucht zu tun hat, dann haben Sie sich geschnitten. Ich kenn’ sie jetzt seit zwölf Jahren, und die Frau würde genausowenig einen Menschen überfahren und einfach liegenlassen, wie sie ’ne Leiter nimmt und zum Mond hochklettert. Wenn da jemand versucht, Ihnen was anderes weiszumachen, hat er sich geirrt. Rufen Sie mal lieber im Revier an und lassen Sie sich die richtige Adresse und das richtige Autokennzeichen geben. Sie vergeuden hier nur Ihre eigene Zeit und die von uns allen …«
»Äh, Sir.« Palgrave versuchte schon seit ein paar Minuten, Mr. Contreras’ Redeschwall zu unterbrechen. »Wir beschuldigen sie überhaupt nicht, irgend jemanden überfahren zu haben. Wir wollen ihr nur ein paar Fragen über den Zwischenfall stellen.«
»Und warum haben Sie das nicht gleich gesagt?« fragte Mr. Contreras in erregtem Tonfall. »Ihr Freund hier hat sich aufgeführt, als hätte sie den Papst überfahren und auf der Straße verbluten lassen.«
»Wir müssen feststellen, ob diese Warshki-Frau die andere Frau angefahren hat oder nicht«, sagte Lemour.
»Warshawski«, sagte ich. »Kommen Sie doch rein und setzen Sie sich. Ich bin gleich bei Ihnen.«
Ich ging in die Küche, um den Herd abzustellen. Lemour, der offenbar Angst hatte, daß ich mich versteckte oder irgendwelche Beweisstücke verschwinden ließ, folgte mir.
»Die Maschine macht zwei Tassen Kaffee«, sagte ich. »Wollen Sie eine?«
»Nun hören Sie mal zu, Prinzessin, werden Sie ja nicht frech. Ich will jetzt ein paar Antworten von Ihnen hören.«
Ich goß mir einen Kaffee ein und sah in den Kühlschrank. Die letzten paar Tage hatte ich wegen einer Zeugenaussage im Illinois House in Springfield verbracht. Das einzige, was im Kühlschrank auch nur annähernd nach etwas Eßbarem aussah, war ein trockener Kanten Roggenbrot. Ich warf einen skeptischen Blick darauf, während Lemour hinter mir vor Wut schäumte. Ohne ihm Beachtung zu schenken, ging ich mit meinem Kaffee ins Wohnzimmer. Detective Palgrave stand ziemlich steif da, und Mr. Contreras hielt in meinem guten Sessel sitzend Mitch am Halsband zurück.
»Detective, gibt es irgendwelche Neuigkeiten über die Frau, der ich heute nacht geholfen habe?« fragte ich Palgrave.
»Man hat sie ins Beth Israel Hospital eingeliefert, aber…«
Sein Kollege fiel ihm ins Wort. »Hier stellen wir die Fragen, Warshki, und Sie antworten. Ich möchte eine vollständige Beschreibung der Begegnung, die Sie heute nacht auf der Straße hatten.«
»Ich heiße Warshawski. Möglicherweise ist es ein Hinweis auf Legasthenie, wenn Sie nicht alle Silben in einem langen Wort aussprechen können, aber dagegen hilft sogar noch im Erwachsenenalter eine Sprachtherapie.«
»Äh, Ma’am«, sagte Palgrave, »könnte ich Sie bitten, uns zu beschreiben, was heute nacht passiert ist? Wir versuchen, mehr über den Vorfall herauszufinden, und bräuchten jemanden, der uns sagen kann, was passiert ist.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß auch nichts über die Frau – sie lag einfach auf der Straße. Die Straßenbeleuchtung auf dem Abschnitt der Balmoral Avenue funktioniert nicht, also habe ich sie erst gesehen, als ich nur noch ungefähr drei Meter von ihr entfernt war. Ich habe sofort gebremst, und der Wagen ist gegen einen Hydranten geknallt, hat aber nicht die Frau erfaßt. Meine Beifahrerin, die zehn Jahre lang bei der Chicagoer Polizei gearbeitet hat, hat die Sanitäter gerufen. Wir haben gesehen, daß die Frau einen gebrochenen Arm hatte und Schwierigkeiten beim Atmen. Die Vorderseite ihres Kleides war blutig. Etwas anderes weiß ich nicht über sie. Ich weiß weder, wie sie heißt, noch, wie sie dorthin gekommen ist oder ob sie jetzt noch lebt.«
»Wieviel haben Sie gestern abend getrunken?« fragte Lemour.
»Drei Flaschen Mineralwasser.«
»Sie sind sich sicher, daß Sie sie nicht doch angefahren haben und das Ganze jetzt als gute Tat kaschieren wollen?«
»Äh, Doug, warum unterhalten wir uns nicht mit der Beifahrerin? Die könnte doch die Informationen von Ms. Warshki – Entschuldigung, Ma’am, wie war gleich noch mal der Name? Warshouski? – egal, ihre Informationen bestätigen.«
»Sie hat sich so lange Zeit gelassen, die Tür aufzumachen«, brummelte Lemour. »Die hat sicher die andere angerufen und ihr vorgebetet, was sie sagen soll.«
»Natürlich können Sie sich mit Ms. Neely unterhalten«, sagte ich. »Aber die Beamten heute nacht haben die Sache bereits vollständig aufgenommen. Sie haben mich sogar einen Alkoholtest machen lassen. Warum sehen Sie sich den Bericht nicht einfach an?«
Palgraves Gesichtsausdruck wurde starrer. »Äh, Ma’am, kann Ihre Beifahrerin die Tatsache, daß Sie den Alkoholtest gemacht haben, bezeugen? Denn nach unseren Informationen hat dieser Test nicht stattgefunden, weil Sie sich geweigert haben.«
Ich starrte ihn an. »Ich habe den Bericht unterschrieben, und in diesem Bericht stand auch die Aussage, daß ich nichts getrunken habe. Zeigen Sie ihn mir.«
Palgrave trat unruhig von einem Fuß auf den anderen und erklärte mir, sie hätten den Bericht nicht dabei. Lemour hätte mich am liebsten auf der Stelle wegen Totschlags verhaftet; er behauptete, ich versuche, mich aus der Sache herauszuwinden. Palgrave sagte ihm, er solle sich beruhigen, und fragte mich, ob Mary Louise tatsächlich zehn Jahre bei der Chicagoer Polizei gewesen war.
»Ja, das stimmt. Sie können Bobby Mallory fragen, Lieutenant Mallory vom Central District«, sagte ich. »Ich rufe ihn gern für Sie an. Oder Terry Finchley, ihren unmittelbaren Vorgesetzten.«
»Das wird nicht nötig sein, Ma’am«, sagte Palgrave. »Wir werden mit dieser Ms. Neely reden, und wenn sie den Alkoholtest bezeugen kann, reicht das wahrscheinlich. Um ganz sicher zu gehen, daß Sie die Frau nicht angefahren haben, werden wir uns auch Ihren Wagen noch ansehen.«
»Wer ist eigentlich die Frau von heute nacht?« fragte ich. »Warum ist es so wichtig, daß Sie jemanden finden, den Sie für den Unfall verantwortlich machen können?«
»Wir wollen Sie nicht dafür verantwortlich machen«, sagte Palgrave. »Sie wurde Opfer eines Unfalls, und Sie waren am Unfallort.«
»Ach was, Detective«, sagte ich. »Ich bin zufällig vorbeigekommen, nachdem jemand sie auf der Straße hat liegenlassen. Ich habe sie nicht dorthin gelegt und sie nicht angefahren. Ich habe lediglich meinen Wagen bei dem Versuch, ihr auszuweichen, zu Schrott gefahren.«
»Tja, in dem Fall wird ein Blick auf Ihren Wagen wahrscheinlich reichen, um uns letzte Sicherheit zu verschaffen«, sagte Palgrave. »Wir werden ihn abschleppen und von unseren Fachleuten untersuchen lassen. Wir setzen uns dann mit
Ihnen in Verbindung, wann Sie ihn abholen können. Wo ist er jetzt?«
»Ich konnte nicht mehr damit fahren, deshalb ist er immer noch am Unfallort. Die Adresse können Sie in dem Bericht im Polizeirevier nachlesen.«
Lemour hätte beinahe einen Tobsuchtsanfall bekommen, wenn Palgrave ihn nicht beruhigt hätte. Als sie endlich gingen, war ich ziemlich ausgelaugt. Wer war die Frau bloß, daß die Polizei einen solchen Wind machte? Aber zuerst mußte ich mich um meinen Wagen kümmern. Wenn die Beamten schon so wild darauf waren, einen Schuldigen zu finden, wollte ich sicher sein, daß der Trans Am keine kompromittierenden Spuren aufwies, wenn er ins Polizeilabor abtransportiert wurde.
Ich rief den Automechaniker an, den ich immer kontaktiere, wenn mir nichts anderes übrigbleibt. Luke Edwards gehört zu den wenigen Leuten, die noch wissen, welche Funktion ein Vergaser hat, aber er wirkt so deprimierend auf mich, daß ich mich wirklich nur im Notfall mit ihm in Verbindung setze. Er meldete sich mit seiner üblichen matten Stimme. Luke identifiziert sich so vollständig mit Motoren und Maschinen, daß es ihm schwerfällt, mit Menschen zu sprechen. Besonders angespannt ist unser Verhältnis zueinander, seit ein Sattelschlepper einen Wagen demoliert hat, den er mir geliehen hatte. Bevor ich ihm erklären konnte, was ich brauchte, sagte Luke, er wolle nichts hören, seit der Geschichte mit dem schrottreifen Impala wisse er, daß man mir kein Auto anvertrauen könne.
»Ich hab’ drei Monate gebraucht, bis alle Lager von dem Motor weich wie Butter gelaufen sind. Es wundert mich nicht, daß du den Trans Am zu Schrott gefahren hast. Du weißt einfach nicht, wie man mit ’nem Wagen umgeht.«
»Luke, bitte vergiß die Geschichte mal ’ne Minute. Ich möchte, daß ein unabhängiges Labor sich meinen Wagen ansieht und beglaubigt, daß ich damit keinen Menschen angefahren habe. Ich verlange gar nicht, daß du das selber machst. Ich möchte nur, daß du mir ein gutes Labor empfiehlst.«
»Alle wollen immer alles sofort, Warshawski. Du wirst warten müssen wie die andern auch.«
Ich mußte mich beherrschen, nicht loszubrüllen. »Luke, ich brauche ein Labor, bevor die Polizei sich meinen Wagen ansieht. Ich bin einer Frau, die auf der Straße lag, ausgewichen und gegen einen Hydranten gefahren. Und jetzt möchte sich einer von den Bullen ’ne Menge Arbeit und offizielle Ermittlungen sparen. Ich möchte ’nen offiziellen Laborbericht, den ich ihm unter die Nase halten kann, für den Fall, daß er seine Hausaufgaben nicht macht.«
»So, so, dann ist also die Polizei hinter dir her? Wird auch langsam Zeit, daß jemand was gegen deine kriminelle Fahrerei unternimmt. War nur ’n Scherz. Beruhige dich, ich helf’ dir schon. Wende dich an die Leute von den Cheviot-Labors, draußen in Hoffman Estates. Die sind ganz schön teuer, haben aber einen bombensicheren Ruf beim Gericht. Meine Freunde und ich haben die schon ein paarmal bemüht – ich kann ja für dich anrufen und ’nen Termin mit ihnen ausmachen. Sag mir, wo die Kiste steht, dann schick’ ich Freddie mit dem Abschleppwagen hin, der kann den Trans Am zu den Leuten von Cheviot bringen. Und wenn er ’nem Bullen begegnet, soll er den in deinem Namen überfahren?«
Wenn Luke witzig zu sein versucht, ist das fast noch schlimmer zu ertragen als seine Depressionen. Ich gab mir Mühe zu lachen und legte auf. Mr. Contreras, der mich mit besorgtem Blick beobachtete, erklärte mir, ich habe das Richtige getan, solle aber noch mehr unternehmen.
Was, wußte ich allerdings nicht so genau. Eigentlich blieb mir nur übrig, Mary Louise anzurufen. Sie war gerade dabei, einen von Emilys kleineren Brüdern anzuziehen, der sich lautstark dagegen wehrte. Als ihr bewußt wurde, was ich da sagte, beendete sie ihre Versuche mit dem Jungen und schenkte mir ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
»Ich kenne niemanden, der Lemour heißt, aber ich frage mal Terry«, versprach sie mir. »Ich hab’ den Bericht heute nacht genau gelesen, bevor ich ihn unterschrieben habe, und da stand drin, daß wir die arme Frau nicht angefahren haben. Daran ist nicht zu rütteln. Also sollte es keine Probleme geben. Ich sage ihnen das auch, wenn sie bei mir auftauchen. Ich muß Nathan noch schnell in den Hort bringen, aber danach rufe ich sofort Terry an.«
Terry Finchley, ihr unmittelbarer Vorgesetzter in den vier letzten Jahren, die sie bei der Polizei verbracht hatte, war mittlerweile der große Star beim Dezernat für Gewaltverbrechen. Und Mary Louise hatte bei ihrem Abschied dafür gesorgt, daß sie ihn auch später noch jederzeit anrufen konnte.
Mary Louise und ich hatten uns sogar bei einigen Fällen kennengelernt, in denen Terry Finchley und ich miteinander zu tun gehabt hatten. Ich habe ihn immer gut leiden können, aber seit die Sache zwischen Conrad und mir aus ist, gibt er sich mir gegenüber ein bißchen zurückhaltend, weil er und Conrad ziemlich eng befreundet sind. Obwohl Conrad sich von mir getrennt hat und nicht umgekehrt, ist Terry der Ansicht, daß ich seinen Freund ziemlich schäbig behandelt habe. Doch er ist ein zu aufrichtiger Mensch, um sich auch Mary Louise gegenüber distanziert zu verhalten, nur weil sie für mich arbeitet.
»Werden Sie den Lieutenant anrufen und sich beschweren?« fragte Mr. Contreras. Damit meinte er Bobby Mallory, den alten Freund meines Vaters.
»Ich glaube nicht.« Bobby würde nämlich eher mich wegen meiner Einmischung in polizeiliche Ermittlungen anblaffen als im Rogers-Park-Revier anzurufen und sich über Lemour zu beschweren. Wahrscheinlich würde er sagen, wenn ich schon unbedingt Räuber und Gendarm spielen wollte, müßte ich auch die Konsequenzen tragen, die das mit sich brachte.
4 Auf der Suche nach einem fahrbaren Untersatz
»Tja, und was wollen Sie jetzt machen, Schätzchen?« fragte Mr. Contreras.
Ich runzelte die Stirn. »Ich möchte rausfinden, wer die Frau auf der Straße ist, denn dann verstehe ich wahrscheinlich auch, warum die Beamten unbedingt einen Schuldigen für den Unfall suchen. Aber als erstes brauche ich einen Wagen. Wer weiß, wie lange es dauern wird, bis der Trans Am wieder einsatzbereit ist, wenn die Polizei ihn sich erst mal vornimmt.«
Ich rief bei meiner Versicherung an, aber die konnte mir auch nicht weiterhelfen. Der Trans Am war zehn Jahre alt; er hatte nur noch Schrottwert. Sie würde mir weder das Abschleppen noch die Reparatur noch einen Leihwagen zahlen. Ich war nicht sonderlich freundlich zu dem Vertreter, aber der erklärte mir nur, eine Versicherung für einen so alten Wagen sei sowieso Unsinn.
Ich knallte den Hörer auf die Gabel. Wieso hatte ich diesem Idioten und der Gesellschaft von Halsabschneidern, die er vertrat, bloß das schöne Geld in den Rachen geworfen? Dann setzte ich mich mit ein paar Leihwagenfirmen in Verbindung und mußte feststellen, daß ich Hunderte, ja vielleicht sogar tausend Dollar für ein Mietauto ausgeben müßte, wenn mein Trans Am ein paar Wochen lang nicht zu gebrauchen wäre.
»Vielleicht sollte ich ein paar tausend Dollar zusammenkratzen und mir einen gebrauchten Wagen kaufen, der noch so gut ist, daß ich ihn verkaufen kann, wenn der Trans Am wieder in Ordnung ist. Oder ein Motorrad, eine Harley zum Beispiel.«
»Keine Harley«, sagte Mr. Contreras. »Carmen Brioni, ein alter Freund von mir – lange vor Ihrer Zeit –, ist immer mit ’ner schönen großen Honda 650 in der Stadt rumgefahren und hat sich eingebildet, daß er noch ’n Teenager ist. Aber irgendwann hat ihn ein Sattelschlepper in der Nähe von Lockport vom Highway gedrängt. Von da an hat er kein Wort mehr gesagt und sieben Jahre lang vor sich hin vegetiert, bis der liebe Gott endlich ein Einsehen gehabt und ihn zu sich genommen hat.«
Gemeinsam sahen wir uns die Anzeigen in der Zeitung an, aber die deprimierten mich nur noch mehr: Alle auch nur einigermaßen straßentauglichen Wagen kosteten drei- bis viertausend Dollar. Und obendrein würde ich noch einen ganzen Tag brauchen, um überhaupt einen aufzutreiben.
»Warum überlassen Sie die Sache mit dem Wagen nicht mir?« fragte Mr. Contreras. »Ich hab’ den meinen damals verkauft, wie ich hierher gezogen bin, weil ich mir die Versicherung und die ganzen anderen Ausgaben dafür von meiner Rente nicht leisten konnte. Deswegen bin ich auch aus meinem alten Viertel weggezogen, als Clara gestorben ist. Die meisten von meinen Freunden haben sowieso nicht mehr in der Stadtmitte gewohnt, weil sie dort zuviel Angst hatten, also war das kein Gesichtspunkt. Und hier war ich nahe genug an der Bahn und konnte zu Fuß einkaufen gehen. Außerdem habe ich so keine Probleme mit der Parkerei. Aber ich weiß immer noch, wie ein guter Motor klingen muß. Was stellen Sie sich denn vor?«
»Einen Jaguar XJ-12«, sagte ich, ohne zu zögern. »Hier steht einer für grade mal sechsunddreißigtausend. Ein Kabrio, noch mit der alten Karosserie, bevor die Leute von Ford dran rumgefuhrwerkt haben.«
»Ist aber nicht sonderlich praktisch. So ein Jaguar hat nämlich so gut wie keinen Rücksitz. Und wo sollen dann die Hunde hin?« Er brachte mich zum Lachen, und das freute ihn so, daß er strahlte.
»Ja, genau, die Hunde«, sagte ich. »Tja, dann werde ich mir wohl eine ziemlich alte Kiste zulegen müssen. Es sei denn, ich trenne mich ganz von dem Trans Am. Aber ich kaufe nur was, wenn das wirklich eine vernünftige Alternative zum Mieten ist.«
Er ließ seinen schmutzigen Finger über die Seite gleiten und murmelte dabei mit glänzenden Augen leise die Texte vor sich hin.
Zwar hat er seine eigenen Freunde und kümmert sich um den kleinen Garten in unserem winzigen Hinterhof, aber trotzdem ist ihm sein Leben zu langweilig – deshalb mischt er sich auch immer wieder in meine Angelegenheiten ein.
Während Mr. Contreras die Anzeigen durchging, überflog ich die Nachrichten, um zu sehen, ob dort schon etwas über die Frau auf der Straße stand. Ich fand einen kleinen Artikel über Commonwealth Edisons Unfähigkeit, die Stadt ausreichend mit Strom zu versorgen, und einen über Feuersbrünste in Florida, doch den größten Raum der Titelseite nahm ein Bericht über das Fernsehdebüt von Global ein.
Murray beschrieb darin sein Interview mit Lacey Dowell. Zum erstenmal seit zehn Monaten war wieder etwas von ihm auf der Titelseite zu lesen, und zum erstenmal seit drei Monaten überhaupt wieder in der Zeitung. »Tja, offenbar hast du dir bis jetzt einfach die falschen Storys ausgesucht, Murray«, murmelte ich. Zuerst pushte die Zeitung vier Tage lang den neuen Fernsehsender von Global, dann hatte besagter Sender sein Debüt, und schließlich beschrieben sie noch in der Zeitung, was schon im Fernsehen zu sehen gewesen war. Ein hübsches Paket, ja, aber waren das auch Neuigkeiten?
Sogar Regine Maugers Kolumne war an eine deutlich sichtbare Stelle gerückt, weil sie sich darin mit der Global-Story beschäftigte. Teddy Trant strahlte gestern abend, gurrte sie, und zwar nicht nur des sanften Lichts aus Sal Bartheles Tiffany-Lampen wegen. Flankiert von Jean-Claude Poilevy, dem Speaker von Illinois House, und Lacey Dowell hat er allen Grund, sich über den Eindruck zu freuen, den er in Chicago macht.
Dann beschrieb Regine die anderen Gäste, unter ihnen auch Mitglieder der Illinois Commerce Commission, den Bürgermeister und seine Frau, die ich in der Menge der Leute überhaupt nicht gesehen hatte, sowie natürlich die Mitarbeiter der Chicagoer Fernsehstudios, die ziemlich eingeschnappt reagieren, wenn man sie nicht wahrnimmt.