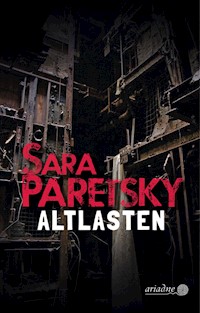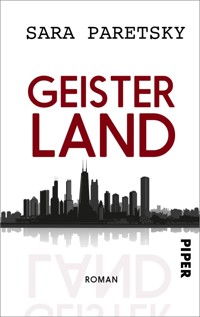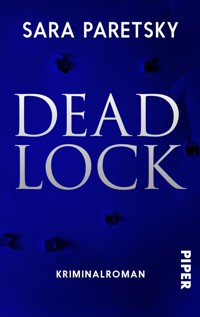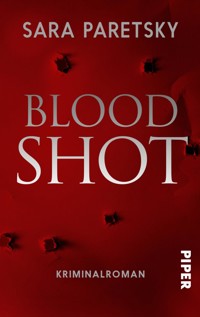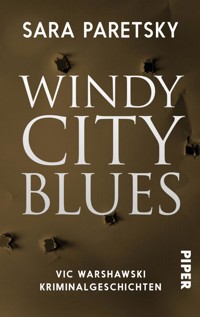6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der vierte Fall für Vic Warshawski - ihr ausgeprägtes soziales Gewissen und ihre Allergie gegen Ungerechtigkeit lassen sie nicht ruhen Notaufnahme - Vics Freundin stirbt! Kurze Zeit später wird ein Krankenhausarzt ermordet aufgefunden. Krankenhausunterlagen verschwinden auf mysteriöse Weise und vor dem Haus einer Ärztin finden seltsame Demonstrationen statt, die mit brutalen Ausschreitungen enden. Vic Warshawski muss ermitteln. Als ihr eigener Freundeskreis zunehmend in Gefahr gerät, greift Vic beherzt zur Pistole ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Annette Grube
ISBN: 978-3-492-98374-7
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2018
© 1987 Sara Paretsky
Titel der amerikanischen Originalausgabe »Bitter Medicine«; William Morrow and Company, Inc., New York 1987
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1989, 1997
Covergestaltung: Favoritbüro, München
Covermotiv: Freedom Master/shutterstock
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Jenseits von O’Hare
Kindstaufe
Der stolze Vater
Zehn-Uhr-Nachrichten
Revierbesuch
Im Archiv
In der Höhle des Löwen
Flickwerk
Polizist auf Grilltomate
Arzt in Trauer
Künstlernatur
Hausbesuch
Sturm auf die Praxis
Blinde Zerstörungswut
Begegnung im Gericht
Wer ist Rosemary Jiminez?
Die IckPiff-Akten
Bootspartie
IckPiff – und andere Akten
Familienbande
Gute Beziehungen
Öffentliches Gesundheitswesen
Bindegewebe
Müllbeseitigung
Datenschutz
Noch einmal Akten
Aktenstudium
Gewinnschwelle
Abendessen
Stimme aus dem Grab
Mitternachtsshow
Tödliche Tagung
Hund in Trauer
Voruntersuchung
Ein letzter Tag am See
Dank
Widmung
Für Kathleen
Die dumpfe Liebe Irdischer
(Da Seele an den Sinnen klebt)
Trägt Trennung nicht, denn Abschied raubt
Die Elemente, draus sie lebt.
Doch wir, durch Liebe, die so fein
Daß wir kaum wissen, was sie ist,
Vom Geist gesichert, sorgen kaum,
Ob Lippe wir und Hand vermißt.
Die Seelen, die nur eine sind,
Erleiden – geh ich fort jetzt auch –
Doch keinen Bruch; sie weiten sich,
Wie Gold gehämmert wird zu Hauch.
John Donne Abschied: Verbot zu trauern
Jenseits von O’Hare
Die Hitze und die grelle Eintönigkeit der Straße brachte alle zum Schweigen. Die Julisonne flimmerte über McDonalds, Video King, Computerland, Burger King, einer Autohandlung und dem nächsten McDonalds. Ich hatte Kopfweh vom Verkehrslärm, von der Hitze und der Eintönigkeit. Keine Ahnung, wie es Consuelo ging. Als wir aus der Praxis kamen, war sie völlig überdreht gewesen, hatte andauernd geplappert über Fabianos Job, über das Geld, über die Ausstattung für das Baby.
»Jetzt wird Mama mich zu dir ziehen lassen«, hatte sie frohlockt und sich verliebt bei Fabiano untergehakt.
Bei einem Blick in den Rückspiegel konnte ich keinerlei Anzeichen von Freude auf seinem Gesicht erkennen. Fabiano war sauer. »Eine Flasche«, nannte ihn Mrs. Alvarado, die wütend war auf Consuelo, den Liebling der Familie, der sich ausgerechnet in so einen verliebt hatte, sich von ihm hatte schwängern lassen. Und sich entschieden hatte, das Kind zu bekommen … Consuelo, die immer streng beaufsichtigt worden war (aber man konnte sie schließlich nicht jeden Tag von der Schule nach Hause bringen), stand jetzt faktisch unter Hausarrest.
Nachdem Consuelo ein für allemal klargestellt hatte, daß sie das Kind auf die Welt bringen würde, hatte Mrs. Alvarado auf einer Hochzeit bestanden (in Weiß, in der Kirche zum Heiligen Grab). Aber sie hatte, nachdem der Ehre Genüge getan war, ihre Tochter bei sich zu Hause behalten: Fabiano lebte bei seiner Mutter. Es hätte alles ziemlich absurd gewirkt, hätte Consuelos Leben nicht eine gewisse Tragik aufgewiesen. Und um ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, Mrs. Alvarado wollte weiteres Unglück vermeiden. Consuelo sollte sich nicht versklaven lassen von einem Kind und einem Mann, der nicht einmal versuchte, Arbeit zu finden.
Consuelo war vor kurzem mit der High-School fertig geworden – ein Jahr früher als üblich aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen –, aber sie hatte keine echte Begabung. Trotzdem hatte Mrs. Alvarado darauf bestanden, daß sie studieren sollte. Als Klassenbeste, Schulball-Königin, Gewinnerin zahlreicher Stipendien sollte Consuelo ihre Möglichkeiten nicht für ein Leben in Knechtschaft und Ausbeutung wegwerfen. Mrs. Alvarado wußte, worauf es im Leben ankam. Sie hatte sechs Kinder großgezogen und zeit ihres Lebens als Kellnerin in der Cafeteria einer der großen Banken gearbeitet. Ihre Tochter, so hatte sie beschlossen, sollte Ärztin oder Rechtsanwältin oder Geschäftsführerin werden und die Alvarados zu Ruhm und Reichtum führen. Dieser maleante, dieser gamberro würde ihre glorreiche Zukunft nicht zerstören.
Das alles hatte ich schon zigmal gehört. Carol Alvarado, Consuelos ältere Schwester, arbeitete als Krankenschwester bei Lotty Herschel. Sie hatte Consuelo auf Knien angefleht, doch abzutreiben. Consuelos Gesundheitszustand war nicht gut; mit vierzehn hatte man ihr eine Gebärmutterzyste entfernt, und sie war zuckerkrank. Sowohl Carol als auch Lotty hatten versucht, Consuelo beizubringen, daß sie unter diesen Umständen mit einer Risikoschwangerschaft rechnen müßte, aber Consuelo war nicht zu überzeugen gewesen. Sechzehn, zuckerkrank und schwanger – das ist kein sehr erfreulicher Zustand. Ende Juli und in einem Auto ohne Klimaanlage nahezu unerträglich. Aber Consuelo, mager und krank, war glücklich. Sie hatte einen idealen Ausweg gefunden, um dem Druck und den maßlosen Erwartungen zu entkommen, die der Rest der Familie seit ihrer Geburt auf ihr ablud.
Jeder wußte, daß Fabiano nur deshalb Arbeit suchte, weil er Angst vor Consuelos Brüdern hatte. Seine Mutter schien absolut willens, ihn auf unbegrenzte Zeit zu unterstützen. Offenbar dachte er, wenn er die Dinge nur lange genug schleifen ließe, könnte er sich irgendwann aus Consuelos Leben davonstehlen. Aber Paul, Herman und Diego waren ihm den ganzen Sommer über im Nacken gesessen. Einmal hatten sie ihn verprügelt, wie mir Carol erzählt hatte, etwas besorgt, weil Fabiano lockere Verbindungen zu einer der Straßenbanden unterhielt, aber die Prügel hatten ihn immerhin dazu gebracht, Arbeit zu suchen. Und jetzt war Fabiano an was Brandheißem. Eine Fabrik in der Nähe von Schaumburg stellte ungelernte Arbeiter ein. Carol hatte einen Freund, dessen Onkel dort Manager war; er hatte zugestimmt, Fabiano zu helfen, wenn er zu einem Vorstellungsgespräch hinauskäme.
Carol hatte mich heute morgen um acht aufgeweckt. Es war ihr furchtbar unangenehm, mich zu belästigen, aber alles hing davon ab, daß Fabiano zu diesem Gespräch erschien. Sein Auto hatte den Geist aufgegeben – »dieser Mistkerl, wahrscheinlich hat er ihn selbst kaputtgemacht, nur damit er nicht fahren muß!« –, Lotty war zu beschäftigt, Mama hatte keinen Führerschein, Diego, Paul und Herman mußten arbeiten. »V. I., ich weiß, daß es eine Zumutung ist. Aber du gehörst fast zur Familie, und ich kann keine Fremden in Consuelos Geschichten hineinziehen.«
Ich hatte die Zähne zusammengebissen. Fabiano war einer dieser halb trüben, halb arroganten Typen, mit denen ich ständig als Pflichtverteidigerin konfrontiert gewesen war. Vor acht Jahren, als ich auf Privatdetektiv umsattelte, hatte ich gehofft, sie endgültig hinter mir zu lassen. Aber die Alvarados waren immer so überaus hilfsbereit – letztes Jahr an Weihnachten opferte Carol einen ganzen Tag und kümmerte sich um mich, nachdem ich ein unfreiwilliges Bad im Michigansee genommen hatte. Nicht zu vergessen, daß Paul Alvarado auf Jill Thayers Baby aufpaßte, als sie selbst in Lebensgefahr schwebte. Ich erinnerte mich an unzählige andere Gelegenheiten, wichtige und unwichtige – mit blieb nichts anderes übrig. Ich versprach also, sie mittags von Lottys Praxis abzuholen.
Die Praxis lag so nahe am See, daß eine Brise die unerträgliche Sommerhitze linderte. Aber als wir die Schnellstraße erreichten und auf die im Nordwesten gelegenen Vororte zufuhren, schlug uns schwüle Luft entgegen. Mein kleiner Wagen hatte keine Klimaanlage, und der heiße Wind, der durch die offenen Fenster hereinblies, dämpfte sogar Consuelos Begeisterung. Im Spiegel sah sie bleich und schlapp aus. Fabiano hatte sich in die andere Ecke des Rücksitzes verzogen mit der mürrischen Begründung, daß es zu heiß sei, um nahe beieinander zu sitzen. Wir kamen zu einer Kreuzung mit der Route 58.
»Hier in der Nähe müssen wir abbiegen«, sagte ich über die Schulter. »Nach rechts oder nach links?«
»Links«, brummte Fabiano.
»Nein«, sagte Consuelo. »Nach rechts. Carol sagte, vom Highway aus nach Norden.«
»Vielleicht solltest du mit dem Manager reden«, entgegnete Fabiano wütend auf spanisch. »Du hast den Termin für das Gespräch ausgemacht, du weißt den Weg. Traust du mir zu, daß ich allein reden kann oder willst du das auch noch übernehmen?«
»Tut mir leid, Fabiano. Bitte, entschuldige. Ich kümmere mich doch nur wegen dem Baby um alles. Ich weiß, daß du damit allein fertig wirst.« Er stieß ihre ausgestreckte Hand zurück.
Wir erreichten den Osage Way. Ich bog nach Norden ab und fuhr noch ungefähr zwei Meilen. Consuelo hatte recht gehabt: die Canary and Bidwell Farbenwerke lagen an dieser Straße in einem modernen Industriegebiet. Das niedere weiße Gebäude stand auf einer Grünfläche, zu der ein künstlicher See gehörte, sogar mit Enten drauf.
Bei diesem Anblick erwachte Consuelo zu neuem Leben. »Wie hübsch. Wie angenehm wird es für dich sein, hier zu arbeiten, mit den Enten und den Bäumen draußen.«
»Wie hübsch«, stimmte Fabiano sarkastisch zu. »Nach dreißig Meilen Fahrt in der Gluthitze bin ich unheimlich geil auf die Enten.«
Ich fuhr auf den Besucherparkplatz. »Wir werden zum See gehen während deiner Unterredung. Viel Glück!« Ich legte soviel Begeisterung wie möglich in diesen Wunsch. Falls er keine Arbeit fand, bevor das Baby kam, zog sich Consuelo möglicherweise von ihm zurück, ließ sich scheiden oder die Ehe annullieren. Trotz ihrer strengen moralischen Grundsätze würde sich Mrs. Alvarado um ihr Enkelkind kümmern. Vielleicht befreite die Geburt Consuelo von ihren Ängsten und verhalf ihr zu einem neuen Leben.
Sie wollte Fabiano zum Abschied küssen, aber er wandte sich ab. Sie folgte mir den Weg hinunter zum Wasser, ihr Siebenmonatsbauch machte sie schwerfällig und langsam. Wir setzten uns in den mickrigen Schatten der jungen Bäume und beobachteten schweigend die Enten. Daran gewöhnt, von Besuchern gefüttert zu werden, schwammen sie zu uns her und schnatterten hoffnungsvoll.
»Wenn es ein Mädchen wird, müßt ihr, du und Lotty, die Taufpaten sein, V. I.«
»Charlotte Victoria? Mit diesem Namen wird es das Kind nicht leicht haben. Du solltest deine Mutter fragen, Consuelo, das würde sie versöhnlicher stimmen.«
»Versöhnlicher? Sie glaubt, ich bin schlecht und vergeude mein Leben. Carol auch. Nur Paul ist nicht so … Was denkst du, V. I.? Glaubst du auch, daß ich schlecht bin?«
»Nein, cara. Ich glaube, du hast Angst. Sie wollten dich mutterseelenallein hinaus ins Leben schicken, damit du die Lorbeeren für sie gewinnst. Das ist schwer für einen allein.«
Sie hielt meine Hand wie ein kleines Mädchen. »Also, wirst du Taufpatin?«
Mir gefiel nicht, wie sie aussah – zu blaß, mit roten Flecken im Gesicht. »Ich bin nicht in der Kirche. Der Pfarrer wird da auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Ruh dich hier ein bißchen aus, ich fahre schnell zu einer Imbißbude und hol uns was Kaltes zu trinken.«
»Ich – bitte, bleib hier, V. I. Mit ist komisch, meine Beine sind so schwer … Ich glaube, das Baby kommt.«
»Das ist unmöglich. Du bist erst am Ende des siebten Monats!« Ohne zu wissen, worauf ich achten sollte, legte ich die Hand auf ihren Bauch. Ihr Hemd war feucht, ich spürte, wie sich ihre Bauchmuskeln verkrampften. Voller Panik blickte ich mich um. Kein Mensch zu sehen. Natürlich nicht, nicht hier in dieser gottverlassenen Gegend jenseits von O’Hare. Keine Straßen, keine Leute, nur endlose Meilen von Einkaufszentren und Fastfoodläden.
Ich versuchte, meiner Panik Herr zu werden und möglichst ruhig zu sprechen. »Ich werd dich für ein paar Minuten allein lassen, Consuelo. Ich muß in das Gebäude und herausfinden, wo das nächste Krankenhaus ist. Ich komm sofort zurück. Versuch, möglichst langsam und tief durchzuatmen.« Ich drückte ihre Hand. Die riesigen braunen Augen in ihrem verzerrten Gesicht sahen mich entsetzt an, aber sie brachte ein gequältes Lächeln zustande.
Im Gebäude blieb ich einen Augenblick verwirrt stehen. Es roch leicht beißend, und von irgendwoher kam ein brummendes Geräusch, aber weit und breit war kein Auskunftsschalter zu sehen, kein Portier. Es hätte auch der Eingang zur Hölle sein können. Ich folgte dem Geräusch einen kurzen Flur entlang. Rechterhand öffnete sich ein riesiger Raum voller Fässer und voll von dichtem Dunst und schwitzenden Männern. Links entdeckte ich eine vergitterte Tür, auf der EMPFANG geschrieben stand. Dahinter saß eine Frau mittleren Alters mit ausgeblichenem Haar. Sie war nicht dick, hatte aber dieses schwammige Kinn, das ein Zeichen schlechter Ernährung und fehlender körperlicher Betätigung ist. Sie wühlte in Bergen von Papier. Es schien ein hoffnungsloser Fall.
Als ich sie ansprach, sah sie mit ärgerlichem Ausdruck auf. Ich erklärte ihr die Situation, so gut ich konnte.
»Ich muß mit Chicago telefonieren, ich muß mit ihrer Ärztin sprechen, muß herausfinden, wohin ich sie bringen kann.«
Lichtreflexe blinkten auf ihren Brillengläsern; ich konnte ihre Augen nicht sehen. »Ein schwangeres Mädchen? Draußen am See? Sie müssen sich irren!« Sie sprach mit dem typisch nasalen Tonfall des südlichen Chicago.
Ich holte tief Luft und versuchte es noch mal. »Ich habe ihren Mann hierher gefahren – er spricht gerade mit Mr. Hector Munoz. Wegen eines Jobs. Sie ist mitgekommen. Sie ist sechzehn. Sie ist schwanger, die Wehen haben eingesetzt. Ich muß ihre Ärztin anrufen, muß ein Krankenhaus finden.«
Das Doppelkinn vibrierte. »Ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe. Aber wenn Sie telefonieren wollen, kommen Sie herein, meine Liebe.«
Sie drückte auf einen Knopf neben ihrem Schreibtisch, öffnete damit die Tür, deutete auf das Telefon und wandte sich wieder ihren Papierbergen zu.
Carol Alvarado reagierte mit jener erstaunlichen Ruhe, wie sie manche Menschen in Krisensituationen an den Tag legen. Lotty war im Beth Israel beim Operieren; Carol wollte die Entbindungsstation dort anrufen und herausfinden, wohin ich ihre Schwester bringen sollte. Sie wußte, wo ich mich befand – sie hatte Hector ein paarmal besucht.
Ich stand da, der Telefonhörer feucht in meiner Hand, ich schwitzte, meine Beine zitterten, und ich mußte mich beherrschen, vor Ungeduld nicht laut herauszuschreien. Meine Freundin mit dem Doppelkinn beobachtete mich heimlich, während sie Papier hin und her schob. Als Carol wieder ans Telefon kam, hatte ich mich einigermaßen beruhigt und konnte mich auf das konzentrieren, was sie sagte.
»Es gibt ein Krankenhaus gleich in der Nähe namens Friendship V. Dr. Hatcher vom Beth Israel sagt, daß sie eine voll ausgestattete Frühgeborenenstation haben. Bring sie dorthin. Wir schicken Malcolm Tregiere hinaus, für den Fall, daß sie Hilfe brauchen. Ich versuch, Mama zu erreichen, die Praxis zu schließen und so schnell wie möglich auch rauszukommen.«
Malcolm Tregiere war Lottys Partner. Vor einem Jahr hatte Lotty widerstrebend zugestimmt, wieder halbtags in der Entbindungsstation des Beth Israel zu arbeiten, in der sie berühmt geworden war. Deswegen hatte sie sich für ihre eigene Praxis einen Partner gesucht. Malcolm Tregiere, hochqualifizierter Gynäkologe, hatte gerade seinen Facharzt in perinataler Medizin gemacht. Er teilte ihre medizinischen Ansichten und konnte wie sie sehr gut mit Menschen umgehen.
Ich fühlte mich unglaublich erleichtert, als ich auflegte und mich zu Doppelkinn umdrehte. Ja, sie wußte, wo Friendship war – Canary and Bidwell schickten alle ihre Unfälle dorthin. Zwei Meilen die Straße entlang, ein paarmal abbiegen, man konnte es nicht verfehlen.
»Können Sie dort anrufen und uns ankündigen? Sagen Sie, daß es sich um ein junges Mädchen handelt – zuckerkrank – mit Wehen.«
Jetzt, da ihr der Ernst der Lage aufgegangen war, half sie bereitwillig und rief sofort an. Ich lief zurück zu Consuelo, die unter einem Baum lag und schwer atmete. Ihre Haut war eiskalt und schweißnaß. Sie machte die Augen nicht auf und murmelte irgendwas auf spanisch. Ich verstand nicht, was sie sagte, nur, daß sie glaubte, mit ihrer Mutter zu reden.
»Ja, ich bin da, Kindchen. Du bist nicht allein. Wir werden das schon durchstehen. Komm, halt durch, mein Schatz, halt durch.«
Ich versuchte, sie aufzurichten. Es kostete mich soviel Kraft, und mein Herz schlug so rasend schnell, daß ich glaubte, ich würde ersticken. »Halt dich fest, Consuelo, halt dich fest.«
Irgendwie brachte ich sie auf die Füße. Sie halb tragend, halb stützend schleppte ich uns die knapp hundert Meter zum Auto. Ständig fürchtete ich, sie würde ohnmächtig werden. Ich glaube, sie wurde bewußtlos, kaum daß sie im Wagen war. Ich konzentrierte meine ganze Energie darauf, den richtigen Weg zu finden. Die Straße, die wir gekommen waren, weiter entlang, zweite Querstraße links, nächste rechts. Das Krankenhaus, flach wie ein gigantischer Seestern, lag vor mir. Ich fuhr gegen den Randstein neben der Notaufnahme. Doppelkinn hatte ganze Arbeit geleistet. Bis ich aus dem Auto gestiegen war, hatten geübte Hände Consuelo bereits aus dem Wagen und auf eine fahrbare Bahre gehoben.
»Sie hat Zucker«, erklärte ich. »Schwangerschaft in der achtundzwanzigsten Woche. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ihre Ärztin in Chicago schickt jemand, der den Fall kennt.«
Stahltüren öffneten sich automatisch; die Pfleger rasten einen Korridor entlang. Ich ging langsam hinterher, sah ihnen nach, bis sie der lange Flur verschluckt hatte. Wenn Consuelo durchhielt, bis Malcolm eintraf, käme alles in Ordnung.
Das sagte ich mir ständig vor, als ich in der Richtung weiterging, in die Consuelo verschwunden war. Endlich kam ich zu einem Schwesternzimmer. Zwei junge Schwestern mit steifen Hauben auf dem Kopf unterhielten sich leise und angeregt.
»Entschuldigen Sie, mein Name ist V. I. Warshawski – ich bin mit dem Notfall vor ein paar Minuten gekommen – ein schwangeres Mädchen. Mit wem kann ich darüber sprechen?«
Eine der jungen Frauen sagte, sie müsse mal bei »Nummer 108« nachsehen. Die andere griff an ihre Haube, um sich zu vergewissern, daß ihre professionelle Identität intakt war, und setzte dann ihr bestes Krankenhauslächeln auf – nichtssagend, aber bevormundend.
»Ich fürchte, bislang liegen noch keine Informationen über sie vor. Sind Sie ihre Mutter?«
Mutter? dachte ich, einen Augenblick lang wütend. Aber in den Augen dieser jungen Frauen konnte ich vermutlich schon Großmutter sein. »Nein. Ich bin eine Freundin der Familie. Ihr Arzt wird in ungefähr einer Stunde hier sein. Malcolm Tregiere, er arbeitet mit Lotty Herschel. Vielleicht wollen Sie den Leuten in der Notaufnahme Bescheid sagen?« Ich fragte mich, ob man die weltberühmte Lotty in Schaumburg kannte.
»Ich werde es ausrichten lassen, sobald eine Schwester Zeit hat. Warum nehmen Sie in der Zwischenzeit nicht im Warteraum am Ende des Flurs Platz? Wir sehen es nicht gerne, wenn Leute vor der Besuchszeit auf den Gängen rumstehen.«
Was hatte das mit meinem Wunsch zu tun, Neuigkeiten über Consuelo zu erfahren? Aber wahrscheinlich war es besser Kräfte zu sparen für einen Kampf, der sich wirklich lohnte. Ich machte kehrt und suchte den Warteraum.
Kindstaufe
Das Wartezimmer zeugte von der Sterilität, wie sie Krankenhäuser typischerweise an den Tag legen, um das Gefühl der Hilflosigkeit bei den Leuten, die auf schlechte Nachrichten warten, noch zu steigern. Billige, knallorange Plastikstühle standen ordentlich vor lachsfarbenen Wänden; Architektur-, Sport- und Frauenzeitschriften lagen verstreut auf den Stühlen und den Nierentischen aus Metall. Außer mir wartete nur eine gepflegte Frau mittleren Alters, die unablässig rauchte. Sie saß starr da und bewegte sich nur, wenn sie sich aus ihrer Tasche eine neue Zigarette holte, die sie mit einem goldenen Feuerzeug anzündete. Als Nichtraucherin hatte ich nicht mal diese Ablenkung.
Ich studierte gerade gewissenhaft jedes Wort über die Baseball-Endspiele 1985, als die Frau, mit der ich im Schwesternzimmer gesprochen hatte, auftauchte.
»Sind Sie nicht mit dem schwangeren Mädchen gekommen?« fragte sie mich.
Mir stockte der Atem. »Sie – gibt es etwas Neues?«
Sie schüttelte den Kopf und lachte verlegen. »Uns ist gerade aufgefallen, daß niemand die Papiere für sie ausgefüllt hat. Würden Sie bitte mitkommen und das nachholen?«
Sie führte mich durch endlos lange Korridore zum Aufnahmebüro an der Vorderseite des Krankenhauses. Eine flachbrüstige Frau, deren blond gefärbtes Haar dunkel nachwuchs, warf mir einen ärgerlichen Blick zu.
»Sie hätten sich bei Ihrer Ankunft sofort hier melden sollen«, zischte sie mich an.
Ich warf einen Blick auf ihr Namensschild, das doppelt so groß war wie ihre linke Brust. »Sie sollten in der Notaufnahme Zettel verteilen, auf denen steht, was man zu tun hat. Ich kann nicht Gedanken lesen, Mrs. Kirkland.«
»Ich weiß nichts über das Mädchen, ihr Alter, ihre Krankheitsgeschichte, wer im Notfall zu unterrichten ist –«
»Schenken Sie sich den Rest, ich bin ja hier. Ich habe ihren Arzt und ihre Familie benachrichtigt, und in der Zwischenzeit werde ich Ihre Fragen soweit wie möglich beantworten.«
Die Schwester, die mich hergebracht hatte, hatte offensichtlich nichts Dringendes zu tun. Sie stand an den Türrahmen gelehnt und hörte interessiert zu. Mrs. Kirkland warf ihr einen triumphierenden Blick zu.
»Wir gingen von der Annahme aus, daß sie bei Canary and Bidwell arbeitet, weil Carol Esterhazy die Notaufnahme verständigt hat. Aber als ich zurückrief, um die Krankenversicherungsnummer des Mädchens zu erfragen, erfuhr ich, daß sie gar nicht dort arbeitet. Sie ist irgendein mexikanisches Mädchen, bei dem auf dem Firmengelände die Wehen eingesetzt haben. Wir sind nicht die Heilsarmee. Wir werden das Mädchen in ein staatliches Krankenhaus bringen lassen.«
Ich zitterte vor Wut. »Haben Sie schon jemals was von der Gesetzgebung des Staates Illinois bezüglich des Gesundheitswesens gehört? Ich ja – sie schreibt vor, daß in Notfällen keiner Person Hilfe verweigert werden darf, nur weil man glaubt, daß die Person nicht zahlen kann. Damit nicht genug – jedes Krankenhaus dieses Staates ist gesetzlich verpflichtet, einer Gebärenden beizustehen. Ich bin Anwältin und gerne bereit, Ihnen den Text im Wortlaut zusammen mit einer Vorladung wegen Vernachlässigung der beruflichen Sorgfaltspflicht zukommen zu lassen, falls Mrs. Hernandez etwas geschieht, nur weil Sie ihr die Behandlung verweigern.«
»Die Ärzte warten ab, bis feststeht, ob sie in ein anderes Krankenhaus verlegt wird oder nicht«, erwiderte sie und kniff die Lippen zusammen.
»Wollen Sie damit sagen, daß sie nicht behandelt wird?« Das brachte das Faß zum Überlaufen. Ich kochte vor Wut. Am liebsten hätte ich sie gepackt und an die Wand geschmettert. »Sie bringen mich zum Direktor der Klinik! Sofort!«
Mein Zustand machte ihr angst. Oder die Androhung gesetzlicher Schritte. »Nein, nein – man kümmert sich um sie. Wirklich. Wenn sie hierbleibt, wird ihr ein anderes Bett zugewiesen. Das ist alles.«
»Sie werden die Ärzte jetzt anrufen und ihnen mitteilen, daß sie nur dann verlegt wird, wenn Dr. Tregiere es für ratsam hält. Und keinen Augenblick früher.«
»Darüber werden Sie mit Mr. Humphries sprechen müssen.« Sie stand auf mit einer entschiedenen Handbewegung, die als Einschüchterungsversuch gedacht war, aber sie sah dabei aus wie ein schlechtgelaunter Spatz, der einen Brotkrumen attackiert. Sie hüpfte einen kurzen Flur hinunter und verschwand hinter einer schweren Tür.
Der Schwester erschien das der richtige Augenblick, um zu gehen. Wer immer Mr. Humphries war, sie wollte nicht, daß er sie während der Arbeitszeit hier herumlungern sah.
Ich nahm das Formular, das Mrs. Kirkland hatte ergänzen wollen. Name, Alter, Größe, Gewicht, alles unbekannt. Bei Geschlecht hatten sie einen Tip gewagt, ebenso wie bei Bezahlung: »Mittellos«, ein Euphemismus für das treffendere Wort »arm«. Amerikaner hatten nie viel übrig für Armut, aber seit Reagan das Sagen hat, ist sie zu einem mindestens so abscheulichen Verbrechen avanciert wie Kindsmißhandlung.
Ich schrieb gerade Consuelos Daten in das Formular, als Mrs. Kirkland mit einem Mann in meinem Alter zurückkam. Sein braunes Haar war kunstvoll gefönt, jedes einzelne Haar akkurat der Länge nach angeordnet wie die dünnen Streifen in seinem Leinenanzug. In Bluejeans und T-Shirt mußte ich daneben ziemlich schlampig aussehen.
Er streckte mir eine Hand mit blaßrosa lackierten Fingernägeln entgegen. »Ich bin Alan Humphries – geschäftsführender Direktor des Krankenhauses. Mrs. Kirkland sagte mir, Sie hätten ein Problem.«
Meine Hand war klatschnaß vor Schweiß. Seine, als er sie zurückzog, auch. »Ich bin V. I. Warshawski – Freundin und Anwältin der Familie Alvarado. Mrs. Kirkland behauptet, es sei Ihnen eventuell nicht möglich, Mrs. Hernandez zu behandeln, weil Sie der Ansicht sind, daß sie als Mexikanerin nicht in der Lage sei, die Rechnung zu bezahlen.«
Humphries riß beide Hände hoch und gluckste. »Um Gottes willen! Zugegebenermaßen sind wir darauf bedacht, nicht zuviele mittellose Patienten aufzunehmen. Aber wir sind uns unserer Pflicht bewußt, gemäß dem Gesetz des Staates Illinois Notfälle dieser Art behandeln zu müssen.«
»Warum sagte dann Mrs. Kirkland, daß Sie Mrs. Hernandez in ein staatliches Krankenhaus verlegen wollen?«
»Ich bin sicher, daß hier ein Mißverständnis vorliegt. Wie ich hörte, sind Sie beide etwas in Rage geraten. Absolut verständlich – es war ein anstrengender Tag für Sie.«
»Was genau tun Sie für Mrs. Hernandez?«
Humphries lachte jungenhaft. »Ich bin Verwaltungsfachmann und kein Mediziner. Also kann ich Ihnen nicht die Einzelheiten der medizinischen Behandlung nennen. Aber wenn Sie mit Dr. Burgoyne sprechen möchten, werde ich dafür sorgen, daß er Sie im Wartezimmer aufsucht, sobald er die Intensivstation verlassen hat … Mrs. Kirkland sagte, daß der Arzt des Mädchens kommen würde. Wie ist sein Name?«
»Malcolm Tregiere. Er arbeitet bei Dr. Charlotte Herschel. Ihr Dr. Burgoyne wird von ihr gehört haben – sie gilt als Kapazität, was Geburtshilfe anbelangt.«
»Ich werde ihn über Dr. Tregieres Kommen unterrichten lassen. Jetzt konnten Sie und Mrs. Kirkland das Formular fertig ausfüllen. Wir sind darauf bedacht, unsere Akten in Ordnung zu halten.«
Ein nichtssagendes Lächeln, eine manikürte Hand, und er kehrte in sein Büro zurück.
Mrs. Kirkland und ich fügten uns, ohne unsere gegenseitige Abneigung zu verbergen.
»Ihre Mutter wird Ihnen Auskunft bezüglich der Krankenversicherung geben können«, sagte ich kalt. Ich war ziemlich sicher, daß Consuelo bei ihrer Mutter mitversichert war – die Möglichkeit, ihre Kinder mitversichern zu lassen, war ein Grund gewesen, warum Mrs. Alvarado seit zwanzig Jahren für die MealService Corporation arbeitete.
Nachdem ich das Formular unterschrieben hatte, ging ich zur Notaufnahme zurück, weil dort auch Tregiere ankommen würde. Ich parkte meinen Wagen ordnungsgemäß, ging in der heißen Julisonne auf und ab, verscheuchte Gedanken an das kühle Wasser des Michigansees und an Consuelo, die an weiß Gott wievielen Schläuchen hing, sah alle paar Minuten auf die Uhr und versuchte, Malcolm Tregiere herbeizuwünschen.
Um vier Uhr hielt ein blaßblauer Dodge quietschend neben mir. Tregiere sprang sofort aus dem Auto, Mrs. Alvarado stieg langsam auf der Beifahrerseite aus. Tregiere war Schwarzer, ein schlanker, ruhiger Mann, und er strahlte das enorme Selbstvertrauen aus, das jeder erfolgreiche Arzt braucht; allerdings ohne die übliche Arroganz, die normalerweise mit dazugehörte.
»Ich bin froh, daß du hier bist, Vic. Kannst du den Wagen für mich parken? Ich geh sofort rein.«
»Der Arzt heißt Burgoyne. Geh den Korridor geradeaus hinunter, bis du auf ein Schwesternzimmer stößt. Dort wird man dir sagen, wohin du mußt.«
Er nickte und machte sich auf den Weg. Während ich sein Auto neben meinem parkte, stand Mrs. Alvarado wartend da. Als ich wieder bei ihr war, musterte sie mich mit einem teilnahmslosen Blick aus ihren schwarzen Augen, der nahezu verächtlich wirkte. Ich wollte ihr irgend etwas, alles über Consuelo sagen, aber ihr bleiernes Schweigen verschloß mir den Mund. Wortlos ging ich neben ihr den Korridor hinunter in den abstoßend sterilen Warteraum. Die gelbe MealService Uniform spannte um ihre fülligen Hüften. Lange Zeit saß sie da, die Hände im Schoß gefaltet, die schwarzen Augen ausdruckslos.
Aber nach einer Weile brach es ihr heraus. »Was habe ich bloß falsch gemacht, Victoria? Ich wollte immer nur das Beste für das Kind. War das ein Fehler?«
Eine Frage, auf die es keine Antwort gibt. »Die Menschen treffen ihre eigenen Entscheidungen«, sagte ich hilflos. »Für unsere Mütter bleiben wir immer die kleinen Mädchen, aber irgendwann sind wir erwachsen.« Ich wollte ihr sagen, daß sie ihr Bestes getan hatte, trotzdem hatte Consuelo es nicht immer zum besten gereicht. Aber selbst wenn sie das hätte hören wollen, so war es jetzt nicht der richtige Augenblick dafür, es ihr zu sagen.
»Und warum ausgerechnet dieser entsetzliche Kerl?« jammerte sie. »Bei jedem anderen hätte ich es verstanden. So hübsch und gescheit wie sie ist, hätte sie sich wirklich einen besseren aussuchen können. Aber ausgerechnet dieser – dieser Haufen Dreck mußte es sein. Keine Schulbildung. Keine Arbeit. Gracias a dios – daß ihr Vater das nicht mehr miterleben muß.«
Ich war mir sicher, daß Consuelo sich diese Vorwürfe oft genug hatte anhören müssen – »Dein Vater würde sich im Grab umdrehen«; »Wenn er nicht schon tot wäre, würde ihn das umbringen« – ich kannte die ganze Litanei. Arme Consuelo, was für eine Last. Alles, was ich hätte sagen können, wäre für Mrs. Alvarado kein Trost gewesen.
»Kennst du diesen Schwarzen, diesen Arzt?« fragte sie plötzlich. »Ist er ein guter Arzt?«
»Ein sehr guter. Ginge ich nicht zu Lotty – Dr. Herschel –, würde ich zu ihm gehen.« Als Lotty ihre Praxis aufmachte, war sie nur esa judía – diese Jüdin – gewesen, später die Frau Doktor. Mittlerweile ging die ganze Nachbarschaft in ihre Praxis. Mit allem kamen sie zu ihr, egal ob es sich um ein erkältetes Kind oder um Probleme mit der Arbeitslosigkeit handelte. Ich vermutete, daß es Tregiere mit der Zeit genauso ergehen würde.
Es war halb sieben, als er zusammen mit einem weiteren Mann im grünen Kittel und einem Priester hereinkam. Malcolm war grau vor Erschöpfung. Er setzte sich neben Mrs. Alvarado und sah sie ernst an.
»Das ist Dr. Burgoyne, der sich um Consuelo gekümmert hat, seit sie hier ist. Wir konnten das Baby nicht retten. Wir haben getan, was möglich war, aber es war zu klein. Es konnte nicht atmen, auch künstliche Beatmung hat nichts genützt.«
Dr. Burgoyne, ein Weißer, war Mitte Dreißig. Sein dichtes schwarzes Haar war schweißverklebt. Ein Muskel neben seinem Mund zuckte, und er nahm nervös die Mütze, die er abgesetzt hatte, von einer Hand in die andere.
»Wir dachten, daß alles, was die Wehen hinauszögern könnte, Ihrer Tochter schaden würde«, sagte er leise zu Mrs. Alvarado.
Sie beachtete ihn nicht, sondern wollte nachdrücklich wissen, ob das Kind getauft worden sei.
»Man rief mich, sobald das Baby geboren war«, sagte der Priester. »Ihre Tochter hat darauf bestanden. Das Kind wurde auf den Namen Victoria Charlotte getauft.«
Mein Magen verkrampfte sich. Ein alter Aberglaube an die Verwandtschaft von Namen und Seelen ließ mich frösteln. Ich wußte, es war absurd, aber ich fühlte mich unwohl, als ob zwischen mir und dem toten Kind eine unauslöschliche Verbindung bestand, nur weil es meinen Namen trug.
Der Priester nahm Mrs. Alvarados Hand. »Ihre Tochter ist sehr tapfer, aber sie hat Angst, auch weil sie glaubt, daß Sie böse auf sie sind. Würden Sie mitkommen und ihr versichern, daß dem nicht so ist?« Mrs. Alvarado stand auf und folgte dem Priester und Tregiere. Burgoyne blieb sitzen und starrte vor sich hin. Sein schmales, ausdrucksvolles Gesicht ließ darauf schließen, daß, woran immer er dachte, es keine angenehmen Gedanken waren.
»Wie geht es ihr?« fragte ich.
Meine Stimme brachte ihn zurück in die Gegenwart. »Gehören Sie zur Familie?«
»Nein. Ich bin die Anwältin der Familie. Außerdem bin ich mit den Alvarados und mit Consuelos Ärztin, Charlotte Herschel, befreundet. Ich habe Consuelo hierhergebracht, als die Wehen plötzlich einsetzten.«
»Ich verstehe. Es geht ihr nicht gut. Ihr Blutdruck fiel so stark ab, daß ich Bedenken hatte, sie könnte sterben. Deshalb holten wir das Kind, um uns darauf konzentrieren zu können, sie zu stabilisieren. Sie ist jetzt bei Bewußtsein und ihr Zustand relativ stabil, aber trotzdem noch kritisch.«
Malcolm kam zurück. »Mrs. Alvarado möchte sie nach Chicago ins Beth Israel bringen lassen. Ich bin der Meinung, sie sollte nicht verlegt werden. Was denken Sie, Doktor?«
Burgoyne schüttelte den Kopf. »Wenn Blutwerte und Blutdruck vierundzwanzig Stunden stabil bleiben, kann man darüber reden. Aber jetzt nicht. Entschuldigen Sie bitte, ich muß noch nach einer anderen Patientin sehen.«
Mit hochgezogenen Schultern ging er hinaus. Wie immer die Krankenhausverwaltung zur Behandlung von Consuelo stand, Burgoyne hatte sich ihre Lage eindeutig zu Herzen genommen.
Malcolm dachte ebenso. »Er hat sein Bestes gegeben. Aber die Situation da oben war mehr als schwierig. Man platzt da mitten hinein und soll sofort mit Sicherheit wissen, was vorgegangen ist. Schwierig jedenfalls für mich. Ich wünschte, Lotty wäre hier.«
»Ich glaube nicht, daß sie mehr als du hätte tun können.«
»Sie hat mehr Erfahrung. Sie kennt mehr Tricks. Das macht immer einen Unterschied.« Er rieb sich müde die Augen. »Ich muß meinen Bericht diktieren, solange ich noch alles im Kopf habe … Kannst du dich um Mrs. Alvarado kümmern, bis die Familie hier ist? Ich habe heute nacht Bereitschaftsdienst und muß zurück. Lotty kommt, wenn sich Consuelos Zustand verschlechtert, ich habe mit ihr gesprochen.«
Nicht gerade glücklich stimmte ich zu. Ich wollte weg aus dem Krankenhaus, weg von dem toten Mädchen, das meinen Namen trug, von den Gerüchen und Geräuschen einer Technik, die dem Leiden der Menschen gegenüber gleichgültig ist. Aber ich konnte die Alvarados nicht im Stich lassen. Ich begleitete Malcolm bis zum Parkplatz, gab ihm seine Autoschlüssel und erklärte ihm, wo sein Wagen stand. Zum erstenmal seit Stunden fiel mir Fabiano ein. Wo war der Vater des Babys? Wie groß wäre seine Erleichterung, wenn er erführe, daß das Kind tot war, daß er sich keine Arbeit zu suchen brauchte?
Der stolze Vater
Nachdem Malcolm weggefahren war, blieb ich eine Weile am Eingang der Notaufnahme stehen. Diesem Flügel des Krankenhauses lag offenes Land gegenüber, abgesehen von einem Neubaugebiet in einer Viertelmeile Entfernung. Wenn man die Augen zusammenkniff, war es möglich sich einzubilden, man stünde in der freien Prärie. Ich blickte hinauf zum Abendhimmel. Die sommerliche Dämmerung mit ihrer angenehmen Wärme ist mir die liebste Tageszeit.
Schließlich ging ich müde den Korridor zurück zum Wartezimmer. Kurz davor kam mir Dr. Burgoyne entgegen. Er trug jetzt Straßenkleidung und ging mit gesenktem Kopf, die Hände in den Hosentaschen.
»Entschuldigen Sie«, sprach ich ihn an.
Er sah auf, starrte mich unsicher an, bis er mich wiedererkannte. »Ach ja, die Anwältin der Alvarados.«
»V. I. Warshawski. Es gibt da etwas, das ich gern wissen möchte. Mir wurde heute nachmittag gesagt, daß Consuelo hier nicht behandelt wird, weil man der Ansicht ist, sie gehöre in ein staatliches Krankenhaus. Stimmt das?«
Er war bestürzt. Auf seinem lebhaften Gesicht konnte ich beinahe die Worte »unterlassene Hilfeleistung« erscheinen sehen.
»Als sie eingeliefert wurde, hoffte ich, es würde uns gelingen, ihren Zutand zu stabilisieren, damit sie nach Chicago gebracht und von ihrem eigenen Arzt behandelt werden könnte. Es stellte sich schnell heraus, daß das nicht möglich war. Es würde mir nicht im Traum einfallen, ein bewußtloses Mädchen, das in den Wehen liegt, über ihre finanzielle Lage zu befragen.« Er lächelte gequält. »Wie ein Gerücht aus dem Operationssaal bis in die Verwaltung vordringt, wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Aber es kommt immer wieder vor. Und zum Schluß herrscht ein großes Durcheinander … Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Ich bin völlig erschlagen und muß mich ein bißchen aufmöbeln, bevor ich mich auf den Nachhauseweg mache.«
Ich sah in das Wartezimmer. Mrs. Alvarado war noch nicht wieder zurück. Ich vermutete, daß die Einladung überwiegend dem Wunsch entsprang, der Anwältin der Familie etwaige Bedenken bezüglich Fahrlässigkeit oder Behandlungsversäumnissen auszutreiben. Aber die Ereignisse hatten mich erschöpft, und die Möglichkeit, mich ein paar Minuten mit jemand anderem als den Alvarados zu unterhalten, war mir willkommen.
Das Krankenhausrestaurant war verglichen mit den schmuddeligen Cafeterias der meisten städtischen Krankenhäuser eine angenehme Überraschung. Als ich das Essen roch, wurde mir eindringlich klar, daß ich seit dem Frühstück vor zwölf Stunden nichts mehr zu mir genommen hatte. Ich aß ein halbes Brathuhn und Salat. Burgoyne begnügte sich mit einem Truthahnsandwich und Kaffee.
Er fragte mich, was ich über Consuelos Krankheitsgeschichte und die ihrer-Familie wisse, und erkundigte sich vorsichtig nach meinem Verhältnis zu den Alvarados.
»Ich kenne Dr. Herschel«, wechselte er abrupt das Thema. »Zumindest weiß ich, wer sie ist. Ich habe am Northwestern-Krankenhaus meine Assistentenzeit abgeleistet. Beth Israel ist einer der besten Orte für eine Ausbildung in Geburtshilfe. Als ich vor vier Jahren meine Assistentenzeit beendete, hätte ich dort eine Stelle in der Entbindungsstation haben können. Obwohl Dr. Herschel nur noch halbtags dort arbeitet, ist sie doch so etwas wie eine Legende.«
»Warum sind Sie nicht hingegangen?«
Er verzog das Gesicht. »Friendship eröffnete dieses Krankenhaus 1980. Im Südosten der Staaten haben sie ungefähr zwanzig Kliniken, diese hier war die erste im Mittleren Westen, und sie haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit sie ein durchschlagender Erfolg wird. Sie haben mir soviel geboten – nicht nur an Geld, sondern auch an Möglichkeiten –, daß ich nicht ablehnen konnte.«
Wir plauderten noch ein bißchen, aber nach einer Dreiviertelstunde hielt ich es für meine ungeliebte Pflicht, mich wieder um Mrs. Alvarado zu kümmern. Burgoyne begleitete mich ein Stück Wegs zum Wartezimmer und bog dann ab in Richtung Parkplatz.
Mrs. Alvarado saß reglos auf einem Stuhl. Meine Fragen nach Consuelo beantwortete sie mit dunklen Bemerkungen über göttliche Vorsehung und Gerechtigkeit. Ich bot ihr an, mit ihr ins Restaurant zu gehen, aber sie lehnte ab. Sie saß da, sagte kein Wort und wartete teilnahmslos darauf, daß ihr jemand Neuigkeiten über ihr Kind brachte. Ihre unerschütterliche Ruhe zeugte von einer Hilflosigkeit, die mir auf die Nerven ging. Von sich aus würde sie nicht zu den Schwestern gehen und sich nach Consuelo erkundigen; sie würde solange sitzen bleiben, bis man ihr eine Einladung schickte. Sie wollte nicht reden, wollte einfach nur dasitzen, eingehüllt in ihr Unglück wie in einen Pullover, den sie über ihre Cafeteria-Uniform gezogen hatte.
Zu meiner großen Erleichterung kamen um halb neun Carol und zwei ihrer Brüder. Paul, ein großer junger Mann von zweiundzwanzig Jahren, hatte ein grobschlächtiges, häßliches Gesicht, das ihn wie einen besonders brutalen Rowdy aussehen ließ. Als er noch auf die High-School ging, mußte ich ihn immer wieder aus dem Gefängnis herausholen, weil er als verdächtig aufgegriffen worden war. Nur wenn er lächelte, kam seine Intelligenz und Sanftheit zum Ausdruck. Der drei Jahre jüngere Diego war mehr wie Consuelo – klein und zierlich. Carol setzte sich sofort neben ihre Mutter und begann leise mit ihr zu sprechen, aber sehr schnell wurden beide laut.
»Was meinst du damit, daß du sie nicht mehr gesehen hast, seit Malcolm weg ist? Selbstverständlich kannst du sie sehen. Du bist ihre Mutter. Mein Gott, Mama, meinst du, du mußt warten, bis ein Arzt es dir erlaubt?« Sie schob Mrs. Alvarado aus dem Zimmer.
»Wie geht es ihr?« fragte mich Diego.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Malcolm ist erst gefahren, als er dachte, ihr Zustand sei stabil. Er hat mit Lotty gesprochen, sie kommt her, wenn es Consuelo schlechter gehen sollte.«
Paul legte einen Arm um meine Schulter. »Du bist wirklich ein guter Freund, V. I. Fahr jetzt nach Hause und ruh dich aus. Wir kümmern uns um Mama.«
In diesem Augenblick kam Carol zurück und bedankte sich ebenfalls. »Ja, Vic, fahr nach Hause. Sie liegt auf der Intensivstation. Alle zwei Stunden kann einer zu ihr hinein, und das ist natürlich Mama.«
Ich kramte in meiner Handtasche nach den Autoschlüsseln, als wir auf dem Gang lautes Geschrei hörten, das sich dem Wartezimmer näherte. Fabiano stürmte herein, gefolgt von einer Schwester. In der Tür blieb er stehen und wandte sich mit einer theatralischen Geste an die Schwester. »Ja, da ist sie, die feine Familie meiner Frau, meiner Consuelo, und hält sie vor mir versteckt.« Er stürzte sich auf mich. »Du! Du Miststück! Du bist die schlimmste von allen! Du hast dir das Ganze ausgedacht. Du und diese jüdische Ärztin!«
Paul packte ihn am Kragen. »Entschuldige dich bei Vic und dann verschwinde auf der Stelle. Deine Visage wollen wir hier nicht sehen.«
Fabiano ignorierte Pauls Arm und schrie mich weiter an. »Meine Frau wird krank. Sie stirbt fast. Und du bringst sie weg. Bringst sie weg, ohne mir auch nur ein Sterbenswörtchen zu sagen. Und ich erfahre davon erst durch Hector Munoz, nachdem ich euch stundenlang gesucht habe. Ihr wollt uns nur auseinanderbringen. Ihr meint, ihr könnt mir was vormachen! Sie ist überhaupt nicht krank! Das ist alles erstunken und erlogen! Ihr wollt uns nur auseinanderbringen.«
Er widerte mich an. »Ja natürlich, Fabiano, du machst dir furchtbare Sorgen. Es ist fast neun Uhr. Du hast sieben Stunden gebraucht, um die zwei Meilen von der Fabrik hierherzugehen. Oder bist du heulend am Straßenrand gesessen und hast gewartet, bis dich jemand mitnimmt?«
»So wie er stinkt, war er in irgendeiner Kneipe«, meinte Diego.
»Was willst du damit sagen? Was weißt du denn? Alles, was ihr wollt, ist, mich und Consuelo auseinanderzubringen. Und mir mein Kind vorenthalten.«
»Das Baby ist tot«, sagte ich. »Consuelo geht es sehr schlecht. Du kannst sie nicht sehen. Du fährst besser nach Chicago zurück und schläfst deinen Rausch aus.«
»Ja, das Baby ist tot – du hast es umgebracht. Du und deine gute Freundin Lotty. Ihr seid froh, daß es tot ist. Ihr wolltet, daß Consuelo abtreibt. Und als sie nicht wollte, habt ihr sie reingelegt und das Baby umgebracht.«
»Paul, schaff ihn raus«, forderte ihn Carol auf.
Die Schwester, die unsicher in der Tür stand, griff jetzt so energisch wie nur möglich ein. »Wenn Sie sich nicht sofort beruhigen, werden Sie alle das Krankenhaus verlassen müssen.«
Fabiano hörte nicht auf zu schreien und sich zu wehren. Ich nahm seinen linken Arm, und zusammen mit Paul zerrte ich ihn durch die Tür und den Korridor zum Haupteingang hinunter an der Aufnahme und an Alan Humphries Büro vorbei.
Fabiano brüllte weiter und warf mit Obszönitäten um sich; kein Wunder, wenn er ganz Schaumburg aufgeweckt hätte. Ein paar Leute kamen auf den Flur, um sich das Theater anzusehen. Zu meinem Erstaunen tauchte auch der höchst verärgert dreinblickende Humphries auf, von dem ich angenommen hatte, daß er sich mittlerweile auf seiner Segelyacht oder in einem Nobelrestaurant befand.
Bei meinem Anblick stutzte er. »Sie? Was geht hier vor?«
»Das ist der Vater des toten Babys. Er kommt vor Schmerz fast um«, keuchte ich.
Fabiano schrie nicht mehr. Er sah Humphries verschlagen an. »Sind Sie hier verantwortlich, Gringo?«
Humphries zog die gezupften Augenbrauen in die Höhe. »Ich bin der Verwaltungsdirektor, ja.«
»Mein Baby ist hier gestorben, Gringo. Das ist doch ’nen Haufen Geld wert, oder? Die wollen mich hier rausschaffen, weil ich meine Frau sehen will.«
»Los«, drängte ich Paul. »Raus mit dem Dreckskerl. Entschuldigen Sie die Störung, Humphries.«
Humphries winkte. »Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich verstehe. Das ist nur normal, daß er sich so aufregt. Kommen Sie mit mir, Mr. –?«
»Hernandez.« Fabiano grinste.
»Mach was du willst, Fabiano, meinetwegen sprich mit ihm. Du mußt wissen, was du tust«, warnte ich ihn.
»Genau«, pflichtete Paul bei. »Wir wollen dich hier nicht mehr sehen. Ich will dich überhaupt nie wieder sehen, Dreckskerl. Comprendes?«
»Und wie komm ich nach Chicago zurück?« empörte sich Fabiano. »Ihr müßt mich mitnehmen. Ich hab kein Auto, Mann.«
»Du kannst zu Fuß gehen«, zischte ihn Paul an. »Vielleicht haben wir Glück und ein Lastwagen überfährt dich.«