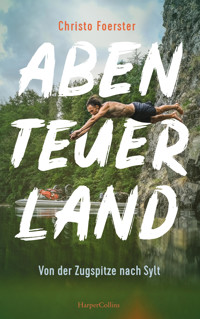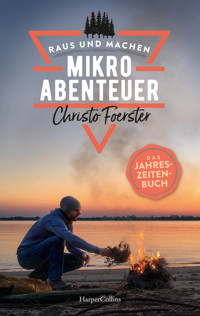17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Praktische Ideen und Tipps für mehr Draußen im Leben Warum das Draußensein uns so gut tut: Auf einer langen Outdoor-Reise erlebt Christo Foerster Momente, »in denen einfach alles gut ist«. Dieses Gefühl der Sorglosigkeit und Unbeschwertheit will er erneut erleben, ohne sich auf eine wochenlange Reise begeben zu müssen. Er will herausfinden: Was ist passiert? Warum ist das passiert? Wie kann ich das auch im Alltag erleben? Dafür unternimmt er Selbstversuche und spricht mit vielen Expert:innen. Er erklärt wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Themen Stress, menschliche Entwicklungsgeschichte, natürliche Duftstoffe in der Medizin und Erkältungen, die drinnen entstehen, nicht draußen. »Der Mann der kleinen Abenteuer« Stern
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.malik.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Am besten draußen« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Mit 26 Abbildungen
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Coverabbildung: Piola666 / iStock by GettyImages
Bildteilfotos: Christo Foerster, außer anders angegeben
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
Inhalt
1 – Was war da los?
2 – Into the light
3 – Da sein
4 – Kaltes, klares Wasser
5 – Ein anderer Alltag
6 – Willkommen im Norden
7 – Die Magie des Waldes
8 – Grüner Beton
9 – Heiliger Bimbam
10 – Die unversehrte Insel
11 – Ich sehe dich!
12 – Epilog
Anhang
Kleines Appendix für Transparenz
Weiterführende Literatur
Danksagung
Bildteil
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
»Wenn wir es nicht versuchen,
verdienen wir es nicht.«
Ethan Hawke
1Was war da los?
Ein Impulskauf, unvergessliche Momenteund der großen Reise zweiter Teil
Jonathan, der alte Fuchs. Ich hätte nicht gedacht, dass er noch einmal auftauchen würde in meinem Leben. Schon gar nicht so. Meine Frau Anja und ich kommen aus dem Schnaufen gar nicht mehr raus. Vorsichtig hieven wir das schwere Stahlgestell eine Treppenstufe nach der anderen hinunter. Mir läuft der Schweiß von der Stirn, und mein Rücken sendet gut vernehmbare Hilferufe. Es dauert knapp dreißig Minuten, bis wir das Monstrum in den Kofferraum geladen haben. Drei Kreuze und ein Halleluja.
Jonathan Goldberg kommt aus Südafrika. Er war Radfahrer, ein extremer wohlgemerkt. Nachdem er eines Nachts beim Training für dasRace Across America von einem Auto erfasst worden war, suchte er nach Möglichkeiten, jenseits der gefährlichen Straßen in die Pedale zu treten, wann immer er wollte. Und weil er nichts fand, was ihn zufriedenstellte, konstruierte er den Prototypen des schwarzen Apparats in unserem Kofferraum. Der Schriftzug »JohnnyG« ist noch gut zu erkennen, auch wenn der Lack an einigen Stellen abgeplatzt ist. Jonathan Goldberg alias JohnnyG gilt als Erfinder des stationären Rennrads. Gut fünfzig Kilogramm schwer ist das zwanzig Jahre alte Modell, das Anja und ich soeben über ein Kleinanzeigenportal erstanden und aus der Wohnung der Vorbesitzerin geschleppt haben – alleine das charakteristische Schwungrad für den gleichmäßigen Tritt wiegt fast so viel wie der Rest des Rads. Als das gute Stück neu war, finanzierte ich mir auf einem baugleichen Teil mein Studium, zumindest teilweise. »Spinning« hießen die Kurse in dem großen Kölner Fitnessstudio, bei denen ich als offizieller »JohnnyG Instructor« bis zu zwanzig Teilnehmer:innen zu rhythmischer Musik mit auf eine Trainingsrunde nahm, ohne dass wir uns von der Stelle bewegten. Eine gute Zeit, aber eine andere.
Das schwache Display des Armaturenbretts zeigt 18 Uhr, als wir den Wagen starten und uns auf den Weg nach Hause machen. Ich blicke mit Wehmut auf den helleren Bereich des Himmels im Westen. Die Sonne ist gerade untergegangen, und mir wird bewusst, dass ich vier Monate werde warten müssen, bis wieder ein Tag kommt, der so lang ist wie dieser. Heute Nacht wird die Zeit umgestellt. Morgen geht schon um 16:52 Uhr das Licht aus.
Es ist jetzt vier Wochen her, dass ich auf der Nordseeinsel Rømø im weichen Gras saß, meinen Rücken an einen der windschiefen Bäume lehnte und eine Zufriedenheit verspürte, die ich am liebsten für immer festgehalten hätte. Hinter mir lag eine bewegende Reise. Ich hatte mich vom Gipfelkreuz der Zugspitze bis hier oben aus eigener Kraft durchgeschlagen, mit meinem Stand-up-Paddleboard, so gut es ging auf dem Wasser, aber auch zu Fuß über Land. Ich hatte 53 Nächte unter freiem Himmel verbracht. Vor mir lag nur noch die Überfahrt nach Sylt, um das Ziel meiner Reise, den nördlichsten Punkt Deutschlands, zu erreichen. Ich war dankbar für alles, was war, und alles, was kommen sollte. Ich war hellwach und zur gleichen Zeit völlig tiefenentspannt. Es fühlte sich an, als wäre alles gut. Dabei fegte gerade der erste Herbststurm über die Insel. Mir war, als kämen in diesem Moment all jene zusammen, die ich auf dem Weg von der Zugspitze hierher erlebt hatte. Voller Urvertrauen legte ich mich später in meine Hängematte, die ich zwischen zwei Kiefern aufgespannt hatte, und machte die Augen zu. Am Tag darauf wehte der Wind ruhiger. Ich schaffte es, die starke Gezeitenströmung zwischen den Inseln zu queren, und konnte am Nordzipfel Sylts meine Familie in die Arme schließen. Ein großes, emotionales, unvergessliches Hallo.
Aber so schön es war, zurück zu sein, so schnell merkte ich, dass ich Zeit brauchen würde, um wieder anzukommen im Alltag. Wollte ich das überhaupt, wieder ankommen im Alltag? Galt es nicht vielmehr, dieses unbeschreiblich gute Gefühl von der einen in die andere Welt zu übertragen? Oder brauchte ich das gar nicht erst zu versuchen, weil es von vornherein zum Scheitern verurteilt war? Ich hatte schon unterwegs geahnt, dass diese Reise zwar auf Sylt ihren geografischen Endpunkt finden, aber dennoch weitergehen würde. Nicht als ewig dauernder Outdoortrip, aber als Reise zu etwas Neuem, das bleibt. Wie oft war ich nach Urlauben, Abenteuern und Auszeiten wieder in die Fänge von Erwartungen, Terminen und Verpflichtungen geraten und hatte mich mit der Aussicht auf den nächsten Ausbruch betäubt! Die Momente zwischen Zugspitze und Sylt waren zu besonders, um sie nur einzurahmen und an meine innere Fotowand zu hängen. Ich spürte, dass sie eine Art Verheißung bargen.
Auch deshalb wollte ich gerne dieses alte Johnny-G-Spinning-Bike kaufen. Es soll auf der Terrasse stehen, überdacht, aber draußen – und vielleicht setzen wir uns immer mal wieder zwischendurch drauf und strampeln ein paar Minuten an der frischen Luft. Vielleicht markiert es aber den Beginn des zweiten Teils der Reise, deren erster Teil mich längs durch Deutschland geführt hat und die jetzt in die verborgenen Ecken meines, unseres alltäglichen Lebens führt. Ein stationäres Bike als Symbol, mich zu bewegen, ohne abzuhauen.
Warum habe ich mich so gut gefühlt unterwegs? Was ist auf dieser Reise passiert, was ist anders da draußen? Und wenn ich Antworten auf diese Fragen finde: Was bedeuten sie für mich in einer Woche voller To-dos? Noch während der Fahrt nach Hause fasse ich den Entschluss, diesen Fragen in aller Gründlichkeit nachzugehen. Wie vor drei Monaten, als ich mit all meiner Ausrüstung auf der Zugspitze stand, überkommt mich eine leicht nervöse Vorfreude. Ich weiß, dass auch dieser Teil der Reise mich begeistern, überraschen und prägen wird.
Zu Hause wuchten wir das schwere Rad aus dem Kofferraum, kippen es auf die kleinen Rollen, die an der Vorderkante der Standfläche befestigt sind, und schieben es hinters Haus. Die zwei Stufen hoch zur Terrasse schaffe ich sogar allein. Ich bringe Sattel und Lenker auf die richtige Höhe und bin überzeugt, eine gute Investition getätigt zu haben – egal, ob irgendeiner von uns jemals auf dem Ding sitzen wird. Es ist bereits dunkel, aber Anja hat drinnen die gemütliche Küchenlampe angeknipst. Ich mache Pfannkuchen, die Kinder hauen sich die Teller voll Apfelmus, und irgendwo huscht Johnny G in diesem Moment ein Lächeln übers Gesicht, da bin ich mir sicher.
*
Ich möchte dich einladen, in diesem Buch mit auf die Reise zu gehen – mit mir nach Antworten und Ideen zu suchen, die unser beider Leben bereichern. Wir werden einige finden. Wir werden erstaunliche Forschungsergebnisse an die Oberfläche bringen und inspirierenden Menschen begegnen. Wir werden Orte besuchen, an denen wir noch nie waren, sowohl im Außen als auch in unserem Inneren. Und wenn wir glauben, es schon sehr weit geschafft zu haben, wird alles noch einmal anders kommen. Wir werden froh darüber sein. Am Ende dieser Reise werden wir – im übertragenen Sinne – auf der Kuppe eines Berges stehen und auf unseren Weg zurückblicken. Vieles, was jetzt noch im Ungewissen liegt, wird dann bereits ein Teil von uns geworden sein.
Diese Reise beginnt in den Tagen der Zeitumstellung nach meinem großen Deutschland-Abenteuer. Sie wird uns über Jahreswechsel und durch Jahreszeiten führen. Ich werde auf dieser Reise immer am Ende eines Kapitels einige Notizen machen. Kurze Zusammenfassungen, konkrete Tipps, weiterführende Infos und Ergänzungen oder Fragen, die ich mitnehmen möchte. Ich hoffe natürlich, dass diese Notizen auch für dich wertvoll sind. Gerne kannst du aber genauso deine eigenen machen – zum Beispiel in einem separaten Notizbuch oder einfach »zwischen den Zeilen« dieses Buches.
Was du aus diesem Buch schließlich für dich mitnimmst, kann ich weder vorhersagen noch beeinflussen. Menschen sind keine Getränkeautomaten, in die wir eine Münze werfen, die Taste unserer Wahl drücken und sicher sein können, was im Ausgabefach landet. Dieses Buch ist also keine Gebrauchsanweisung. Ob du die Erkenntnisse und Ideen, die es enthält, adaptierst, anpasst, weiterdrehst oder verwirfst, liegt in deiner persönlichen Verantwortung. Ich bin überzeugt davon, dass diese Reise uns nach vorne bringt. Eine Garantie gibt es dafür allerdings nicht.
Ich habe vor einiger Zeit mit einem Freund zusammengesessen, der ebenfalls als Autor arbeitet. »Was ist das nächste große Ding, das nächste wegweisende Modell für unsere Gesellschaft?«, fragte er mich. »Darauf«, so meinte er, »müssen wir herumdenken, um einen Bestseller zu landen.« Ich konnte auf seine Frage nur eine Antwort geben: »Keine Ahnung.« Ich ließ seine Frage noch einmal sacken und schob nach: »Ganz ehrlich: Ich will weg von diesem Gedanken, ich könnte außergewöhnliche Lösungen liefern, ich müsste ein großer Vordenker sein. Ich will suchen und von meiner Suche erzählen, mehr nicht.« Genau das tue ich in diesem Buch.
DerUS-amerikanische Naturforscher, Philosoph und Schriftsteller Edward Abbey schrieb im Jahr 1988 im Vorwort zur Neuauflage seines BuchesDesert Solitaire: »Mögen Eure Pfade verwachsen, einsam, gefährlich und voller Biegungen sein – und zur herrlichsten Aussicht führen.« Das wünsche ich uns auch.
Christo Foerster
www.christofoerster.com
2Into the light
Ein Bienennest nach dem anderen und die Kraft der Sonne
Wenn ich zurückblicke und mir die eindrücklichsten Momente ins Gedächtnis rufe, die mir das Leben bislang geschenkt hat, dann finde ich vor allem einen gemeinsamen Nenner: Ich war immer draußen. Sogar geheiratet haben Anja und ich unter freiem Himmel. Und von den ersten Tagen mit den beiden Kindern sind es nicht die Kreißsaal- oder Wickeltischmomente, die am präsentesten sind, sondern die im Park, in der Hängematte, als die kleinen Wunder auf meiner Brust schliefen und ich versuchte, ihren Atem mit meinem zu synchronisieren, während Anja nebendran wohlverdient vor sich hin döste. Die sportlichen Höhepunkte, nicht nur die Erfolge, sondern auch die besonderen Momente beim Training, in denen ich das Gefühl hatte, es würde mir alles gelingen – fanden draußen statt. Die schönsten Momente der Verliebtheit und der Intimität – draußen. Die Urlaube, Reisen, Abenteuer! Das wird kein Zufall sein und ich nicht der Einzige, dem es so geht. Zu Beginn meiner Recherchen nehme ich mir also vor, der ganz allgemeinen und erst einmal völlig offenen Frage nachzugehen: Welche Effekte hat das Draußensein, also die Natur, die frische Luft, auf den Menschen?
Unter den ersten Studien, die ich finde, ist eine im Dezember 2020 veröffentlichte aus Leipzig. Für knapp 10 000 Menschen suchten Wissenschaftler:innen dort nach einem Zusammenhang zwischen der mentalen Gesundheit und dem Baumbestand in der Umgebung ihres Wohnortes. Dabei ging es gar nicht um Wälder, sondern um einzelne Bäume an den Straßen der Stadt. Die Baumdichte wurde über aktuelle Satellitenbilder bestimmt und mit der Anzahl der Rezepte für Antidepressiva abgeglichen. Tatsächlich kam die Studie, die in der ZeitschriftNature, eine der weltweit angesehensten wissenschaftlichen Publikationen, veröffentlicht wurde, zu dem Ergebnis, dass vor allem Menschen aus der untersten sozioökonomischen Schicht mental gesünder sind, wenn sie innerhalb eines Radius von hundert Metern um ihren Wohnort eine hohe Baumdichte vorfinden. Oder mit aller akademischen Vorsicht: Die Studie lässt vermuten, dass dieser Zusammenhang besteht.[1]
Bestätigt wird er von unzähligen weiteren Untersuchungen. Ich habe das Gefühl, in ein Bienennest nach dem anderen zu stechen. Gehe ich einer Fährte nach, schwirren mir wieder zig neue Studien entgegen. Forscher:innen aus Washington haben kürzlich rund 300 Studien zur Wirkung natürlicher Umfelder auf Kinder verglichen. Wieder deutliche Zusammenhänge: Mehr Natur rund um den Wohnort und die Schule führt zu besserer Gesundheit auf mentaler und kognitiver Ebene, zu erhöhter Aufmerksamkeit und mehr körperlicher Aktivität.[2] DieUniversity of Cincinnati veröffentlichte bereits vor einigen Jahren die Studie eines internationalen Forschungsnetzwerks, die zeigt, dass Menschen, die in ihrer Kindheit viel Naturkontakt hatten, im Erwachsenenalter seltener unter depressiven Symptomen leiden.[3] Die britischeUniversity of Exeter fand heraus, dass Menschen sich subjektiv deutlich wohler und gesünder fühlen, wenn sie in der zurückliegenden Woche insgesamt mindestens 120 Minuten draußen waren. Der Effekt steigerte sich noch einmal mit der Anzahl der Minuten, pendelte sich dann ab etwa dreieinhalb Stunden gleichbleibend ein.[4] Gerade diese letzten Ergebnisse, wieder publiziert in der ZeitschriftNature, fanden in der Fachwelt auch deshalb besonderen Anklang, weil sie auf der Befragung einer großen Anzahl von Menschen – etwa 20 000 – beruhen. Und wohl auch, weil sie aussagen, dass es so viel Aufwand möglicherweise gar nicht brauche, um vom Aufenthalt in der Natur zu profitieren.
Schon in den 1970er-Jahren wurde beobachtet, dass unter Patienten, denen die Gallenblase entfernt wurde, diejenigen früher wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten, die aus ihrem Bett auf Bäume und Grünanlagen blickten. Die Patienten, vor deren Fenster nur eine Wand zu sehen war, brauchten nicht nur länger für die Genesung, sondern benötigten auch mehr Schmerzmittel[5]. In Japan wurden und werden erstaunliche Daten zur Wirkung des Waldes auf die Psyche und das Immunsystem nachgewiesen. In denUSA verschreiben etliche Ärzt:innen im Rahmen des ProgrammsParkRx mittlerweile ganz offiziell Besuche in Grünanlagen. Und mit der Bedeutung der Natur für den Menschen beschäftigen sich jenseits klassisch medizinischer Diagnosen auch Coaches, Philosoph:innen und andere Sinnsuchende.
Innerhalb weniger Stunden habe ich an die einhundert Studien und Links in einen digitalen Ordner gelegt. Mir ist klar, dass es noch viele mehr werden. Aber nicht heute. Ich saß lange genug am Rechner, und es ist schon wieder dunkel – die Zeitumstellung. Ob es auch Studien dazu gibt, wie sich das Tageslicht auf unser Wohlbefinden auswirkt? Ob ich einen wissenschaftlichen Grund dafür finde, dass ich das Licht am frühen Morgen besonders mag? Außerdem möchte ich Sophia noch anrufen. Sophia ist Wildbiologin, und ich habe mich bei der Recherche an ein Gespräch mit ihr erinnert, in dem es neben Füchsen und anderen Tieren auch um ihre persönliche mentale Gesundheit und das Draußensein ging. So spannend die ganze Wissenschaft ist, ich will mich nicht nur mit Zahlen beschäftigen und alle paar Minuten Fachbegriffe nachschlagen müssen. Ich will auch die Antworten des echten Lebens.
Sophia ging nicht mehr ran gestern Abend. Aber vielleicht ist es auch besser, die Fragen, die ich an sie habe, nicht über das Telefon zu stellen. Wenn die eindrücklichsten Momente draußen spielen, dann sollte ich dort mit ihr sprechen. Irgendwann demnächst.
Auf meinem Weg von der Zugspitze nach Sylt schlief ich 53 Nächte hintereinander draußen. Nicht im Zelt, sondern richtig draußen, in der Hängematte. Bis auf die eine Nacht, in der ich keine Möglichkeit fand, sie aufzuhängen, und mir deshalb unter dem Vordach eines Klosterhofs am Kochelsee eine Unterlage aus alten Kaffeesäcken bauen musste. Einige wenige Male richtete ich mein Lager erst nach Einbruch der Dunkelheit ein. Meist aber schaukelte ich bereits kurz nach Sonnenuntergang sanft zwischen zwei Bäumen. Wenn es morgens hell wurde, wachte ich auf. Der Tag-Nacht-Rhythmus der Natur wurde auch zu meinem. Weil es so gemütlich war im Schlafsack, blieb ich meist noch ein paar Minuten liegen, dann spritzte ich mir etwas Wasser ins Gesicht, setzte mich auf einen Stein oder Baumstamm, bereitete mein Frühstück zu und blickte mich um. Nicht eine Sekunde dachte ich in diesen Momenten an eine wissenschaftliche Aufbereitung des Phänomens Morgenlicht. Jetzt, da ich Andrew Huberman auf dem Ohr habe, staune ich nicht schlecht. Wäre ein Podcast nicht eindirektional, würde Huberman meine »Aaahs«, »Ooohs« und jede Menge weitere Laute der Zustimmung hören.
Andrew Huberman ist Professor für Neurobiologie an derStanford School of Medicine. Sein PodcastHuberman Lab, in dem er sich teils über mehrere Stunden einem speziellen gesundheitswissenschaftlichem Thema widmet, gehört zu den meistgehörten der Welt. Hubermans Lieblingsthema ist eines, zu dem er selbst einiges an Forschung beigetragen hat: das Morgenlicht. Er rät, an unbewölkten Tagen mindestens fünf bis zehn Minuten, gerne länger, in das Morgenlicht (nicht unbedingt direkt in die Sonne) zu blicken, an bewölkten Tagen mindestens fünfzehn bis dreißig Minuten, immer so früh wie möglich, also am besten, sobald Licht da ist. Falle das Licht auf die Rezeptoren im Auge, werde ein neuronaler Kreislauf aktiviert, der den Cortisolspiegel hebe und sich damit positiv auf unser Immunsystem, den Stoffwechsel und unsere Konzentrationsfähigkeit auswirke. Es geht dabei vor allem um den Zeitpunkt, denn in der Nacht etwa wäre ein höherer Cortisolspiegel nicht wünschenswert – Cortisol ist schließlich ein Stresshormon und macht wach.[6] Genau das hilft unser inneren Uhr am Morgen, sich zu eichen und einen gesunden 24-Stunden-Rhythmus zu finden, an dem sich dann unter anderem auch Hungergefühl und Körpertemperatur ausrichten. Das Faszinierende an dem System: Morgenlicht hat einen anderen Wellenlängenmix als das Nachmittags- oder Abendlicht. Deshalb empfiehlt Huberman, auch das späte natürliche Licht noch einmal auf sich wirken zu lassen. Wenn wir es am Morgen – aus welchen Gründen auch immer – nicht schaffen sollten, diene es ebenfalls als Ankerpunkt für die innere Uhr. Das ganze Spiel funktioniere auch mit Brillengläsern oder Kontaktlinsen, allerdings nicht hinter Sonnenbrillen und Fensterscheiben (die zu viele relevante Lichtwellen blocken).
Wir können die positiven Effekte aber auch schnell wieder torpedieren. Nämlich dann, wenn wir uns nach Sonnenuntergang hellem (im physikalischen Jargon »blauem«) künstlichen Licht aussetzen, um das zu tun, was wir noch zu tun haben oder eben tun wollen – und unser Gesamtsystem damit wieder völlig durcheinanderbringen.
Deshalb bieten zum Beispiel viele Smartphones mittlerweile die Möglichkeit, die Display-Farben automatisch oder auch manuell wärmer darzustellen. »Nightshift«, heißt das bei dem Modell, das ich benutze. Huberman selbst mache nach Sonnenuntergang wenn möglich nur stark gedimmtes oder rotes Licht an, versuche, das Betrachten von Bildschirmen generell zu vermeiden, und lasse das Licht komplett aus, wenn er nachts mal hochmüsse. Denn helles Licht am Abend oder in der Nacht sorge unter anderem dafür, dass die für einen guten Schlaf so wichtige Ausschüttung des Hormons Melatonin gehemmt werde.
Im Prinzip – so erscheint es mir – ist der Zusammenhang zwischen dem Tageslicht und unserem Wohlbefinden sowie unserer Leistungsfähigkeit doch völlig logisch. Die Natur hat einen so ausgeklügelten Rhythmus, dass es fast lächerlich wirkt, wissenschaftliche Studien durchzuführen, um genau das beweisen. Aber ja, wir leben meist einfach weit jenseits jedes natürlichen Rhythmus. Ihn wiederzuentdecken ist wünschenswert. Und Dinge, die wissenschaftlich nicht zu erklären sind, haben in der verkopften Ordnung unserer Welt nun mal wenig Relevanz.
Zu einem Ergebnis, das zunächst erstaunen mag, am Ende aber vielleicht ebenfalls nur der natürlichen Logik folgt, kommt auch eine schwedische Studie: Wissenschaftler:innen derKarolinska Universitätsklinik beobachteten etwa 20 000 Frauen über einen Zeitraum von zwanzig Jahren und fanden heraus, dass diejenigen, die öfter in der Sonne badeten, länger lebten. Eine echte Erklärung dafür liefert die Studie zwar nicht – dafür sei die Wirkung des Lichts auf den menschlichen Organismus im Detail noch zu unerforscht –, aber eben einen eindeutigen Zusammenhang.[7] Auch Andrew Huberman weist in seinem Podcast immer wieder darauf hin: Sich der Sonne auszusetzen, auch intensiver Sonnenstrahlung, mache nicht krank, sondern gesund, sofern man es nicht übertreibe. Einige Lichtspektren könnten sogar durch die Haut ins Gewebe bis zum Knochenmark vordringen und dort entsprechende Rezeptoren triggern, die wiederum Prozesse auslösen, welche unseren gesamten Stoffwechsel positiv regulieren. Je mehr Hautoberfläche der Sonne ausgesetzt sei, oder anders: je weniger Kleidung wir trügen – desto größer der Effekt.
Wie viel genug sei, zeige unser Körper klar an, und zwar indem die Haut irritiert reagiere oder gar »verbrenne«. Solange das nicht geschehe, würden wir uns im wahrsten Sinne des Wortes im grünen, sprich natürlichen Bereich bewegen. Mit dem Blick ins Sonnenlicht verhalte es sich ähnlich: Tue es weh, würden wir die Augen reflexartig schließen oder unseren Blick abwenden, dann sei die Sonne an diesem Tag so stark, dass wir nicht direkt in sie hineinsehen und lieber das indirekte Sonnenlicht wählen sollten.[8]
Nun gibt es zu jeder Studie auch Kritiker:innen, und gerade diejenigen, die unermüdlich vor einem erhöhten Hautkrebsrisiko warnen, wenn es um das Sonnenlicht geht, schlagen bei solchen Aussagen schnell Alarm. Was ist mit Sonnencreme? Huberman sagt, er verwende kaum welche, und verweist darauf, dass viele Produkte krebserregende Stoffe enthielten, die durch die Haut ins Blut gelangen könnten. Er räumt aber auch ein, dass Sonnencreme bei längeren Aufenthalten in der Sonne und je nach Hauttyp durchaus Sinn machen könne. Und es gibt ja durchaus Produkte auf mineralischer Basis. Dass Sonnenlicht grundsätzlich guttut, bestreitet in der Wissenschaft eigentlich niemand. In der Tat war das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken – und auch das, daran zu sterben –, in der schwedischen Studie bei den Sonnenbaderinnen erhöht. Allerdings sank die Sterblichkeit insgesamt. Sie waren weniger anfällig für andere Erkrankungen.
Ich liebe es, Sonne auf meiner Haut zu spüren. Wann immer es warm genug ist und ich mich entweder in einem vertrauten Umfeld befinde, alleine bin oder sich niemand daran stört, ziehe ich eine kurze Hose an und meinT-Shirt aus. Möglicherweise ist das frühe soziale Prägung, denn schon mein Vater hat das so gemacht (mit dem feinen Unterschied, dass er das mit dem Vermeiden von Sonnenbrand nicht so genau nahm). Aber Sonne auf der Haut fühlt sich einfach gut an. Ich erinnere mich an Sommermorgen, an denen ich als Fünft- und Sechstklässler auf dem Weg mit dem Fahrrad in die Schule für einige Minuten an einer ganz bestimmten Stelle Pause gemacht habe, weil es noch kühl war und die Sonne dort so herrlich wärmte. Hin und wieder hielt ein:e Autofahrer:in an, kurbelte die Fensterscheibe herunter und fragte, ob es mir gut ging. »Sehr gut«, antwortete ich und bedankte mich für die Nachfrage. Witzigerweise erlebte ich genau die gleiche Situation mehrfach, wenn ich mich zwischen Zugspitze und Sylt auf meinem Weg ausruhte – ob das in der Sonne oder im Schatten war. »Geht es Ihnen gut?« – »Ja, sehr, danke der Nachfrage.«
Ich trage fast nie eine Sonnenbrille. Die einzigen Ausnahmen bilden Aufenthalte in Höhenlagen oder im Schnee bei starkem Sonnenschein. Auf der achtwöchigen Deutschlandreise hatte ich nicht einmal eine dabei. Ich habe es in der Vergangenheit immer wieder mal ausprobiert, aber ich mag die Dinger nicht. Außerdem komme ich gut ohne klar. Vielleicht gefallen mir Forschungsergebnisse wie jene, die Andrew Huberman in seinem Podcast zum Thema Sonnenlicht zusammengetragen hat, auch deshalb so gut. Vielleicht sind sie aber tatsächlich auch Belege für intakte Intuition.
Wenn Tageslicht fehlt, schlägt uns das aufs Gemüt. Ich erfahre, dass Lichttherapie in der Winterzeit, wenn es morgens später hell und abends früher dunkel wird, als eine wirksame Maßnahme bei Depressionen und Müdigkeit gilt. Dass wir an diesen kurzen Tagen generell träger sind, sei eigentlich eine ganz natürliche Adaption unseres Systems an die Jahreszeit. Nur erlaube unser modernes, durchgetaktetes Leben die Konsequenzen nicht, die diese Adaption haben müsste – später aufzustehen als im Sommer, mehr Pausen zu machen, zwischendurch zu schlafen, runterzufahren wie ein Eichhörnchen zur Winterruhe. In diesen Monaten sei künstliches Tageslicht deshalb ein effektiver Trick, um unserem System hellere Tage vorzugaukeln und damit für eine erhöhte Aktivität bzw. Grundstimmung zu sorgen. In Skandinavien, wo es im Winterhalbjahr besonders lange dunkel ist, werden teilweise sogar an Bushaltestellen und Schulen Tageslichtlampen eingesetzt.
Vitamin D ist auch so ein an die Sonne gekoppeltes Thema: Unser Körper kann Vitamin D nur mithilfe der Sonne selbst produzieren. Ist die nicht da, oder zeigt sie sich zu kurz, kann es sehr sinnvoll sein, die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten mit einem Arzt oder einer Ärztin abzuklären. Was tatsächlich aber auch hilft: Die Vitamin-D-Speicher durch Aufenthalte in der Sonne auffüllen, solange sie noch ausreichend scheint. Wer im Herbst regelmäßig und ausgiebig Sonnenlicht tankt, kann oft bis Ende des Jahres gut davon zehren.[9]
Wie lange war ich da draußen unterwegs? Bis Ende September. Danach noch die Woche Dänemark-Urlaub mit der Familie und viel gedecktem Sonnenlicht im Oktober. Ein bisschen Puffer müsste ich haben. Durch die Zeitumstellung wird es jetzt zwar abends früher dunkel, aber auch morgens eine Stunde früher hell. Ab sofort geht der erste Weg meines Tages raus auf die Terrasse, wenigstens ein paar Minuten in den Himmel blicken, selbst wenn es noch dämmrig ist. Außerdem bestelle ich eine große Tageslichtlampe. Wäre doch schön, wenn auch die Kinder über den Winter morgens am Frühstückstisch nicht weiterpennen, sondern halbwegs wach in den Tag starten.
REMINDER & NOTIZEN
Vernünftig Sonne tanken // Was die Sonne alles Gutes bewirkt in uns, ist noch längst nicht hinreichend belegt. Dass sie es tut, dagegen schon. Solange wir Sonnenbrand oder einen Hitzschlag vermeiden, dürfen und sollten wir Sonne an die Haut lassen. Gerade im Herbst noch mal ordentlich auffüllen, die Sonnenspeicher (auch wegen des Vitamin D!) – der Winter ist lang.
Tageslicht in der dunklen Jahreszeit // »In echt« draußen sein ist immer das Beste. Selbst an bedeckten Wintertagen bekommen wir vor der Tür 3000 bis 5000 Lux ab. Ein gut ausgeleuchteter Indoorarbeitsplatz bietet uns deutlich weniger – 500 bis 1000 Lux. Wenn unser Alltag das »in echt« nicht oder nur unzureichend erlaubt und zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen (noch vor Sonnenaufgang) das System hochfährt bzw. die innere Uhr auf »wach« stellt, sind Tageslichtlampen eine gute Option. Goldene Regel: Morgens und tagsüber viel helles Licht, ab dem späten Nachmittag wärmeres, gedimmtes und nach 21 Uhr am besten gar kein klassisches kaltes Licht mehr, wie etwa das von (nicht angepassten) Bildschirmen.
Apropos Augen: besser sehen // Andrew Hubermans Stimme hallt noch nach in meinen Ohren, als ich mit meiner Tochter für einen Routinetermin beim Augenarzt bin. Das Erste, was der Arzt sie fragt: »Bist du viel draußen?« Natürlich hake ich sofort nach, um mehr über den Grund dieser Frage zu erfahren. »Wer viel draußen ist, trainiert das Weitsehen und wird weniger schnell kurzsichtig. Drinnen ist halt alles relativ nah dran«, erläutert der Arzt. Logisch. Eine schöne Ergänzung zu den positiven Wirkungen der Lichtspektren, die Huberman beschreibt. Und wieder ein Aha-Moment.