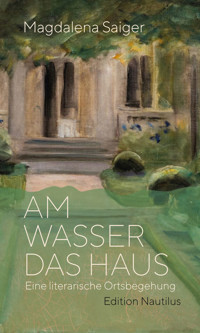
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Max Liebermann erwirbt zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Stück Baugrund am Ufer des Wannsees und entwirft gemeinsam mit seinem Freund Alfred Lichtwark Haus und Garten – ein Fluchtort vor den Pflichten eines Lebens in der Öffentlichkeit, aber auch ein Ort der Inspiration für zahlreiche Gemälde. Dass sich die Liebermann-Villa im Laufe der Zeit immer wieder verändern wird, ist der Ausgangspunkt dieses literarischen Textes, eines in flüchtigen Bildern und Szenen eingefangenen Ortspanoramas, das sich in vielfältige Gestalten und Stimmen auffächert: Nach dem Tod Liebermanns und der Zwangsveräußerung der Villa wird die großbürgerliche Sommerfrische abgelöst von strammstehenden Mitarbeiterinnen der Reichspost, die in Kriegszeiten zur Erholung ins Grüne geschickt werden. In der Nachkriegszeit wird im vormaligen Atelier der Operationssaal des Städtischen Krankenhauses eingerichtet; in den 1970er Jahren bezieht ein Unterwasser-Club das Gebäude, baut in die Diele ein Aquarium und verbringt im ehemaligen Salon bunte Abende am Bartresen. Und immer wieder folgt auf Trubel erneut Leerstand – bis schließlich ein Kulturverein den Ehrgeiz entwickelt, alles wiederherzustellen, »wie es gewesen ist«. Trotz allen Wandels bleibt dieser Ort stets wiedererkennbar; er bietet Raum für Alltagsbeiläufigkeiten, Lebenswenden und Träume, ist Ziel einsamer Spaziergänge und Bezugspunkt unruhig flackernder Erinnerungen. »Magdalena Saigers Sprache, die sich vorsichtig der Vergangenheit annähert, malt die Bilder eines Ortes, der seinerseits von Max Liebermann gemalt wird. Das ist so eindringlich wie schön.« Katrin Seddig
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MagdalenaSaiger, geboren 1985, lebt in Hamburg. Sie studierte Germanistik und Geschichte in Berlin und Madrid und promovierte an der Universität Hamburg in Geschichte. Das Manuskript ihres Debütromans Was ihr nicht seht oder Die absolute Nutzlosigkeit des Mondes wurde 2020 mit dem Hamburger Literaturpreis ausgezeichnet. Der Roman war 2023 nominiert für den Franz-Tumler-Literaturpreis, den Droste-Preis sowie für den Bloggerpreis »Das Debüt«. 2024 wurde Magdalena Saiger für ein unveröffentlichtes Romanmanuskript erneut mit dem Hamburger Literaturpreis ausgezeichnet.
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49a • D -22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de • [email protected]
Alle Rechte vorbehalten • © Edition Nautilus 2025
Erstausgabe Januar 2025
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, unter Verwendung von Max Liebermann, »Blick aus dem Nutzgarten nach Osten«, um 1919
© Max–Liebermann–Gesellschaft Berlin e. V., Foto: Oliver Ziebe, Berlin
www.majabechert.de
Porträt der Autorin Seite 2: © Philipp Schmidt
1. Auflage • ePub ISBN 978-3-96054-385-5
Inhalt
1 Zuvor
2 Verortung
3 Planungen
4 Das Wandbild
5 Das Kind
6 Abschiede / Der Maler
7 Bild: Sand, Schwere
8 Frau Schubach
9 Der Reichspostminister
10 Bild: Das Boot
11 Martha, Johanna
12 Hinüberschwimmen / Der Soldat
13 Die Tochter
14 Bild: Das erinnerte Haus
15 Der Oberarzt
16 Bild: Das Haus im Winter
17 Unterwasser
18 Bild: Zwischenzeiten
19 Die Hergelaufenen
20 Der Kulturverein
21 Bild: Feuer
22 Die Urenkelin (Katharine)
23 Bild: Sperrmüll
24 Dienstag geschlossen – Tuesday closed
25 Traumbild: Fading Out
Quellen
Für meine Eltern
1 Zuvor
Stilles Bild, belebt
Die Wasseroberfläche ein sanftes, unruhiges Tuch; der Wind hebt es leicht.
Windstille, an manchen Tagen, Sturm.
Hitzeflimmern, an manchen Tagen.
Flugsand. Nebel, der alles füllt.
Frühlingsregen, leise.
Im Schilf ein feines Knacken.
Im Schilf ein Entenpaar, das Frühjahr für Frühjahr hierherkommt, um jedes Jahr neu zu beginnen mit dem Bau eines Nests, jedes Jahr zum ersten Mal.
Durch trockene Äste bahnt sich ein kaum sichtbares Rinnsal einen Weg, wird über die Zeit zu einem kleinen, glucksenden Bach, der ein abgefallenes Blatt mitführt und im Sommer vertrocknet.
Ein einzelner Fuchs schleicht an manchen Tagen in der Dämmerung zum Wasser und lauert den Enten auf.
Ein einzelner Mensch geht an manchen Tagen hier entlang und bleibt nicht stehen.
Ein einzelner Mensch kommt an manchen Tagen hierher und fängt am Ufer einen Fisch, der kleiner ist als der vom Vorjahr.
Ein einzelner Mensch findet oberhalb des Ufers einen großen Parasol, löst ihn vorsichtig und nimmt ihn in der hohlen Hand nach Hause zum Abendbrot.
Ein einzelner Mensch steht eines Abends mit hängenden Armen am Wasser und weint.
Ein einzelner Mensch verbringt eine Nacht unter einem Baum, zieht am nächsten Morgen weiter und hinterlässt nichts als eine Stelle, an der das Gras plattgedrückt und silbrig liegt, in der Form eines schlafenden Menschen oder Tiers.
Eine Schulklasse haspelt eines Tages in ungefähren Zweierreihen vorbei und singt das Lied In einem kühlen Grunde.
Ein einzelner Mensch beschließt an einem Mittwoch mit Blick auf den See, ein Ende zu machen und es anderswo noch einmal neu zu versuchen.
Ein einzelner Mensch beschließt an einem Freitag, doch kein Ende zu machen und es noch einmal zu versuchen, trotz allem.
Im Schilf eine erste kleine Eisscholle, die ein abgefallenes Blatt umschließt und in der noch wärmenden Mittagssonne wieder freigibt.
Im Schilf ein verlassenes Nest, am Rand des Nests eine verhakte kleine Feder.
Entfernt ein Schwarm Möwen, winzig.
Das Wasser liegt steingrau und wirr.
Das Wasser liegt flirrend und rasch.
Das Wasser liegt schmiegsam und grün.
Das Wasser liegt schwarz und glatt.
Dies alles geschieht ohne Unterbrechung, ohne Zutun und Wissen, ohne Anhaltspunkte.
Ohne Ereignis.
Das Wasser hat kein Gedächtnis. Das Wasser, wie jedes Bild, das nur jetzt ist und doch uralt, genügt sich selbst.
2 Verortung
Die Insel Wannsee wird von Norden her von der Havel umschlossen. Nach Südwesten fließt der Hauptstrom über die Pfaueninsel zum Jungfernsee. Ein kleinerer Flussarm führt um den Osten der Insel zum Großen und Kleinen Wannsee und zum daran anschließenden Pohlesee. Zwischen dem Pohle- und dem Stölpchensee lag einst eine Landenge, an der die Gewässer durch Sumpfgebiet miteinander verbunden waren.
Durch die letzte Eiszeit geformt, ist das Gebiet eine Grundmoräne, die durch spätere Dünenbildung überformt wurde. Die Oberfläche ist weitgehend sandig, aber in der Umgebung von Klein-Glienicke, dessen Name aus dem slawischen Wort für »Lehm« abgeleitet ist, liegen bedeutende Tonvorkommen, die bis ins 19. Jahrhundert ausgebeutet wurden.
Ein großer Teil der Insel wird vom Düppeler Forst eingenommen.
Im Süden und Osten bildet die Insel flache Uferzonen, hier wurden Siedlungen, Äcker und Gärten angelegt. Im Westen und Norden herrschen Steilufer vor.
Die Uferlinie ist mäßig bewegt. Es gibt nur eine größere Bucht, die Moorlake. Ansonsten bilden der Große Wannsee, der Pohle- und Stölpchensee flach geschwungene Einbuchtungen. Zahlreicher sind die ins Wasser ragenden Ufervorsprünge, die, wie in Brandenburg üblich, als »Hörner« bezeichnet werden: Krughorn, Großes und Kleines Tiefhorn, Großes Kuhhorn.
Der Name des Horns anstelle der späteren Glienicker Brücke ist nicht mehr bekannt.
Bis ins 19. Jahrhundert wurde das Gebiet nach den beiden auf der Insel gelegenen Dörfern Klein-Glienicke und Stolpe als Glienickscher oder Stolpescher Werder benannt. Zu den Dörfern bestanden in den sumpfigen Landengen Dammzugänge. Da der Wasserstand der Havel noch Mitte des 19. Jahrhunderts etwa einen Meter höher lag als heute, dürften nur im Hochsommer die Dammzugänge trockenen Fußes zu passieren gewesen sein. Nach der Schneeschmelze dagegen ist nur eine Passage per Boot denkbar.
Ein erster regelrechter Brückenbau zur Insel entstand 1661–1663 an der Glienicker Enge. Erst 1791 wurde am gegenüberliegenden Ende der Insel die Friedrich-Wilhelm-Brücke, die heutige Wannseebrücke, errichtet.
Ein letztes Mal wurde die Insellage strategisch genutzt, als sich im April 1945 versprengte deutsche Truppenteile auf der Insel zusammenzogen und sämtliche Brücken zerstörten. Sie lieferten sich mit der schon bis Zehlendorf vorgedrungenen Roten Armee einen sinnlosen und verlustreichen »Endkampf«. Anschließend wurden die Brücken – zunächst als Notkonstruktionen – wieder aufgebaut. Nur die Wiedererrichtung der Enver-Pascha-Brücke steht noch aus.
3 Planungen
Szenen. 1909 bis 1914
»Wenn ich hier am Ufer stehe, so will ich durch das Haus hindurch auf den Teil des Gartens sehen können, der dahinter liegt.Vor dem Haus soll eine einfache Wiese angelegt werden, so dassich von den Zimmern aus ohne Hindernis auf den See sehen kann. Und links und rechts vom Rasen will ich gerade Wege. Das ist die Hauptsache. Noch etwas, das Zimmer, das in der Achse liegt, soll der Eßraum sein. So – und nun bauen Sie.«
Max Liebermann an den Architekten Alfred Messel
Parce qu’on revient toujours à ses premières amours.
Ein Grundstück ist noch frei.
Bestehend aus zwei Parzellen, länglich geschnitten, zum Wasser hin abfallend, eines der letzten in der Colonie, am westlichen, von Kiefernheide gesäumten Ufer des Sees, weit außerhalb der Stadt, weit genug und nah genug, um hier wirklich noch etwas anzufangen.
Es ist, was er suchte, der Maler, dem sie mit einem Mal ein Bild ums andere abkaufen, fast handwarm noch.
Das hätte ihm keiner geglaubt, dass einer, und noch dazu ein Widerborstiger wie er, sich mit dem Pinsel und seinen altbekannten, umstrittenen zehn Fingern ein Schloss erwerben kann, in gerade mal zwei Jahren. Grundstück und Haus und Gartenanlage und Einrichtung. Die eigene Scholle, 7.260 Quadratmeter im Ganzen, seine ganz private Villa d’Este, Große Seestraße 24, Colonie Alsen, benannt nach der eines Tages von irgendwem wahrgenommenen Ähnlichkeit mit der Ostseeinsel Alsen, auf welcher das preußische Heer vor einem halben Jahrhundert die Dänen siegreich zu schlagen vermochte.
Sollen sie lachen in der Akademie, sollen sie. Jetzt kommen, denkt er, erst einmal die fetten Jahre. Er malt nach eigenem Rezept, und das Geschäft will nicht aufhören zu brummen, und so muss er nun nicht länger träumen, sondern hat die Mittel, und damit die Befugnis, zu planen, und zwar auf Papier und gegen gutes, ehrliches, ermaltes Geld, kann die blitzweißen Landhäuser der Hamburger Großleute als echte Möglichkeiten betrachten, zur freien Nachahmung oder zum großzügigen Verwerfen, nicht länger als schimmernde Auswüchse einer Welt, in der er hauptsächlich auf Besuch ist und an Sonntagnachmittagen spazieren geht auf öffentlichen Uferwegen.
Ein Grundstück ist noch frei. Ein Schmuckstück.
145.000 Reichsmark, und es geht in seinen Besitz über. In seinen Besitz: Besitzer Max Liebermann, Maler, ordentlicher Professor der Königlichen Akademie der Künste, Gründer und Präsident der Berliner Secession, Max Martin Liebermann, Große Seestraße 24.
Der Maler lässt sich ein Haus bauen, lässt auf großen Bögen Papier eine Villa entstehen als Gartenplatz eines Städters, als sein Refugium – auch Residenz ist ihm als Wort nicht zu groß –, als Fluchtort vor der ewig hastenden Stadt mit ihren ewigen Stadtpflichten und der ganzen Maskerade, vor der Akademie mit ihren Allotris, der leidigen sogenannten Kulturarbeit und ihren unaufhörlichen Zänkereien, vor den Anfeindungen als Volksfremdling, den lärmenden Straßenkreuzungen, vor der gräulichen Berliner Luft, der Reklame und den bunten Gaffern, die sich bei jeder Festivität gar nicht sattsehen können an dem Rummel, der sich immer ausgerechnet vor den eigenen Fenstern breitzumachen pflegt, und damit es ein Ende hat mit den Sommern in wechselnden Hotels, in denen freilich einiges annehmlich ist und doch nichts am eigenen Platz.
Der Architekt hat einen Namen. Aber mitreden muss er einen doch lassen, damit am Ende in Stein und Holz und Ziegel das herauskommt, was er sich, halb oder ganz bewusst, vorgestellt hat seit einer gewissen Zeit, präzis und nicht übermütig, nicht capriciös, aber eben doch nach einem selbst.
Die mittige Lage des Hauses, auf der Höhe der benachbarten Hamspohnschen Villa gelegen, unterteilt das schmal geschnittene Grundstück in den Vordergarten, der einmal einen gemischten Blumen- und Nutzgarten abgeben und wo auch ein Gärtnerhaus Platz finden soll, und den seeseitigen Garten mit dem freien Blick zum Wasser.
Übermut, vielleicht, mag man seine Vorliebe nennen, von der diesseitigen, feierlichen Front des Hauses an das stattliche Nienstedten, von der jenseitigen, dem See zugewandten Seite an holländische Einfachheit erinnert sein zu wollen.
Freilich gehört die ganze Weltgutgläubigkeit seiner Person dazu, um bei seinem Alter und unter den Vorzeichen der gegenwärtigen Zeit noch zu hoffen, auch den Garten im Ganzen vollendet zu sehen.
Aber was wäre zu tun ganz ohne eine Zuversicht, und dann ist es ja am Ende doch unfruchtbar, immerzu nach rückwärts zu schauen auf bereits Gelebtes: Wie in der Kunst, so im Leben, denkt er, ist das Werdende das Interessanteste.
Werden soll, nach den eigenen Vorstellungen, ein Haus.
Ein Haus tut not, für den Schutz, den ganz greifbaren und den des Innenlebens, und damit man bei Platzregen und Sturm ein Fenster hat, hinter dem man die Kerze anzündet und sich ein Buch hernimmt.
Hinter dem Fenster jedoch braucht’s auch etwas, dem das Fenster ein Rahmen sein kann, und zu dem wohlgeordneten Innen braucht’s ein gedeihendes Außen, und deshalb will auch im Alter noch ein Garten angelegt sein.
Denn leicht sollen seine Bilder sein, leicht, bei allem der Anschauung innewohnenden Gewicht, und manche sind’s, leicht, unbeschwert, augenfällig und nach der Natur, und manche verbergen doch nicht die Furcht, ein solches Idyll könnte nicht festzuhalten sein.
Im Herbst kommt das Haus unter Dach und muss danach, gemäß polizeilicher Vorschrift, sechs Wochen stehen, ohne dass daran gearbeitet werden darf.
Im Frühjahr wird das Haus inwendig verputzt, im Mai von außen.
Im Sommer, Anfang Juli etwa, soll das Haus bezogen werden, und man wird die Ellbogen ausstrecken können, ohne anzustoßen.
Doch, das gefällt mir, sagt er, das Entwerfen.
Es ist alles noch im Beginnen, ein trüber Sonntag im November. Sie sind aus der Stadt herausgefahren und stehen nun dort, wo einmal der Garten sein soll und wo jetzt noch gewöhnliches, herbstgilbes Gras sich in groben Büscheln unter ihren ledernen Schuhen windet, der Maler und sein Berater und Freund, der einen Blick hat und ein Händchen für Proportionen und Gediegenes.
Verstehen Sie, Lichtwark, man kommt in ein Alter. Da braucht’s einen Verlass. Da will einer wissen, wie der Türriegel pfeift und wo der Brieföffner liegt und was er wiegt, auch in der Sommerfrische. Wo die Grenze ist zwischen dem eigenen Grund und dem der Nachbarn.
Wo doch meinereins, fügt er hinzu, mit der inneren Unrast ohnehin eine eigene Ehe führt, nicht wahr.
Sie schmunzeln und verstehen beide: Der Ort ist formidabel getroffen. Ein Schmuckstück, auch der Freund hat es mit einem Blick gesehen, und der Maler hat gewusst, dass er nicht zu übertreiben brauchte.
Sie gefallen sich in ihrem Dastehen und Fachsimpeln, kosten das Wissen aus um ein unausweichliches Gelingen. Tout est bien qui finit bien. Es ist freilich nicht ganz der Jänisch’sche Park und der Wannsee bei Weitem nicht die Elbe. Aber es ist doch eine Sache mit einiger Weitläufigkeit geworden, und es wird sich im Sommer genügend Schatten von alten Baumkronen und jungen Ranken finden, wo man die Modelle wird posieren lassen. Wie reizend, nicht wahr, dort zwischen den Blumen niedrig sitzend Damen in hellen Kleidern gegen das Wasser zu sehen, stellen Sie sich vor.
Der Freund hat endlich einmal die Zeit gefunden, von der Elbe herüberzukommen zu einer gemeinsamen Begehung, denn das Maß will doch an Ort und Stelle bestimmt sein, die Wirkungen und Gegenwirkungen, die Formung der Uferlinie, die Führung der Wege und des Blicks hinaus in den Dunst über dem leeren See.
Man spricht leichthin, in Gemälden, schlägt plaudernd Brücken hinüber zur Zukunft, zu Sommermorgen in Korbstühlen am Wasser, und zur Kunst, wie der Freund sie ansammelt und verwaltet und verreisen lässt drüben von Hamburg aus, gegen die Zersplitterung der Kunstwelt und zur Erneuerung der ästhetischen Erziehung der Deutschen.
Donnerwetter, was meinen Sie, was das für Frühstücke der Ruderer werden, Lichtwark, hier auf der Terrasse, da müsste man Ihren Renoir noch einmal herbitten, das wird einmal Bilder abgeben, lauter lustige Farbflecke über dem neutralen Ton von grauem Stein.
Einiges ist bereits angedacht. Der Höhenunterschied zwischen Wasser und Haus beträgt etwa zwei Meter; um den Blick von der Blumenterrasse hin zum See nicht zu hindern, soll hier, in der Mitte, nichts als eine große Rasenfläche angelegt werden. An der Seite das Birkenwäldchen allerdings soll bleiben, es flankiert ja das Ganze aufs Schönste, was meinen Sie.
Es wäre, denk’ ich, tunlich, antwortet der Freund, doch noch den ein oder anderen point de vue einzubeziehen, eine Bankanlage vielleicht oder eine Laubnische mit Vase, es sollte nicht schwer einzurichten sein, und die Vasen würden zugleich eine Art Halt und Abschluss geben, was Ihnen ja auch mit den Blumenrabatten vorschwebt. Im Grunde aber haben Sie durchaus recht: Haus und Ufer sind nun einmal die Ruhepunkte, die müssen so reich sein, wie es nötig ist, und dazwischen: ungeschmückte, schön gebildete Räume.
Ihre Stimmen verlieren sich im Schlendern und einem leichten Wind vom Wasser her, und so setzen sie im Gespräch fort, was ihnen in Briefen zu einer lieben, zeitraubenden Gewohnheit geworden ist, sprechen die Kunst durch, pflegen am losen Faden höflich ihre Wesensverwandtschaft, bestätigen einander in ihrer Bewunderung für Millet, auch wenn der sich einer persönlichen Begegnung verweigerte, weil er nach dem Großen Krieg einem Deutschen nicht die Hand reichen wollte, für Degas und Frans Hals und in ihrer Ablehnung gegenüber allen, die als Idealisten, Neo- oder Pseudo-Impressionisten, Symbolisten und sonstwelche -Isten ohne Substanz ihre neumodisch gemusterten Häute zu Markte tragen oder der alles beherrschenden Cézanne- und Van-Gogh-Epidemie verfallen sind.
Und wie kommen die Lieferanten zur Küche, ohne dass sie stören? Platz ist ja reichlich vorhanden, aber bedacht will es doch sein, nicht wahr.
Unter den vielen Bekannten, die man hat, ist der Freund wirklich ein Freund; seine Kritik ist schöpferisch, die lässt er sich gefallen. Keiner, der einem fortwährend auf die Schulter klopfen und auch sonst vertraulich tun will. Dazu einer mit einem gehörigen Rest Klassizismus im Blut und der rechten gärtnerischen Phantasie, man hat ihm etwas zu verdanken, denkt der Maler, und zu sagen hat man sich auch etwas.
In die Ecken der Rasenplätze stellen sie im Gespräch ausladende Vasen mit Blumen, Bronzefiguren, Kübel mit Lorbeer, lassen Pyramideneichen probehalber an verschiedenen Stellen wachsen, Juniperus, Taxus, Thuja, entwerfen in die Luft hinein das kontrapunktische Linienspiel unterschiedlich hoher Steinsockel, wägen ab, beschließen, verwerfen, überdenken, bauen auf und reißen ein, überspringen und vergessen die Zeit, die erdige, ungeschlachte Rupfigkeit des Geländes und dass es gehörig zieht hier draußen.
Ein paar Einfälle hätte ich unmittelbar, sagt der Freund, wie sie den Hang zum Haus wieder hinaufgehen, erlauben Sie mir einmal, laut zu denken. Der Mittelweg jedenfalls muss vom Ende des letzten Gartens bis in das Obstgelände hineinführen und hindurch bis zur Piazzetta am Wasser. Wichtig sind hier das Gitter am Wasser und die Form der Bänke. Denn: Kein Garten ohne Sitzgelegenheit! Alles in Weiß natürlich. Und: Kadenz braucht’s! Die Gärtner wissen oft nicht und sehen’s nicht, dass die einzelnen Raumteile nicht als etwas Selbständiges, sondern als eine Einheit im Raum fühlbar werden müssen, für sie ist die Aufgabe zu fein. Alle Formen müssen so groß und geschlossen bleiben wie nur möglich. Ich werde Ihnen, wenn’s recht ist, einmal eine Zeichnung der Anlage skizzieren – was man auch durch ein Modell sich anschaulich machen könnte. Nicht, dass wir etwa für die Bänke einen Platz im Grundriss auszusparen vergessen.
Je nun, beim Papiernen wird es nicht bleiben, nicht wahr. Runde Bänke, im Übrigen, vermögen die Sitzenden zu einer unterhaltlichen Einheit zusammenzufassen.
Einzig die Überschneidung des Gärtnerhäuschens mit der Straßenfassade der Villa ist, wie mir scheint, noch nicht geglückt, wären Sie so gut, einmal mit hinaufzukommen.
Freilich, hier ließe sich wohl etwas machen, was hielten Sie etwa von einer Hochhecke aus, sagen wir: Linden, sechs bis acht Bäume, die den Blick in den vorderen Garten nicht verstellten, aber die kleine Unschönheit wohl zu überspielen wüssten.
Besonderen Reiz verspricht mir indes – vielleicht erlauben Sie, dass wir noch einmal hinuntergehen – die Idee dreier Heckengärten seitab der Rasenfläche, die gleichsam als grüne Kammern die reizvollsten Einblicke gewähren und die Neugierde wecken werden auf allerlei Dahinterliegendes, denken Sie sich ein Lindenkarree, einen Rosengarten, vielleicht ein Rondeel. Es gelänge dann, den harmonischen Wechsel von Architektur und Landschaftsstil in einem Garten zu vereinen.
Aber nur kaltes Blut – Rom und ein Garten werden nicht an einem Tag erbaut. Lassen Sie sich doch aus Erfurt schon jetzt alle Staudenkataloge mit Abbildungen kommen.
Des Weiteren gilt: Probieren, guter Freund, probieren! So manches, das in der Zeichnung das akademische Gemüt beunruhigt, wirkt in der räumlichen Wirklichkeit als wohltuende Freiheit, das lässt sich auf dem Papier nicht suchen.
Zu Neujahr schickt der Freund in einem Brief die herzlichsten Wünsche für das Jahr. Die Freuden des Gartens und Hauses sind wohl die reinsten und höchsten. Die stille Freude, in seinem Garten zwischen Blumen zu wandeln. Und das, so weiter der Brief, bei noch aufsteigender Schaffenslinie.
Dazu einige Überlegungen. Wenn es jetzt noch geht, ließen sich so bald wie möglich unter den Birken rechts zahlreiche Leberblumen, Schneeglöckchen, Soldanellen und, sehr wichtig, Levkojen und andere Frühblüher auspflanzen. Dann bekäme man schon im Februar, März etwas zu sehen. Eine ganze Reihe schöner Blumen liebt gerade solche Plätze unter Bäumen und wächst sich dort überraschend anmutig zurecht: so auch der Gundermann, das Baumkraut, der Erdrauch, der Aronstab sowie die weiße Calla, die es aber feucht haben muss.
Wenn der Freund in einer lästigen Sitzung Langeweile hat, macht er seine Notizen, nimmt in Gedanken Zuflucht zu Spaziergängen am Wasser. Es zieht ihn hinüber, als wär’s sein eigener Garten, und in Berlin lesen sie dann, zu dritt über die Briefe gebeugt, was er als Material zur Überlegung herüberschickt: Ich glaub, ich hab’s.
Die Bepflanzung der drei Gärten muss bei allem Reichtum sehr einfach gehalten bleiben, sonst wird die Bewirtschaftung unnötig kostspielig.
Für die Düngung rät der Freund zu einem Waggon Blut, so er zu bekommen ist, etwa vom städtischen Schlachthof.
Der Salon de verdure im zweiten Garten braucht, bei oben offener Laube, eine Sitzgelegenheit dem Weg gegenüber, für größere Gesellschaft; Beete ringsum. In der Mitte des ersten Gartens dagegen ein freies Rund, als Platz zum Besehen und zum Plaudern für eine Gruppe Spaziergänger. An Bewegungsfreiheit darf es nicht fehlen.
Die Glycinie, das ist mir neulich noch gekommen, die nicht sehr dicht und deckend sich entwickelt, liebt die Feuchtigkeit am Wasser und könnte, entlang einer Pergola, zur Verbindung des Seepavillons mit dem Platz am Ende der Gärten hergenommen werden, gäbe sie doch mit ihren schöngefiederten Blättern und den hängenden Blütentrauben ein bezauberndes Bild ab.
Überhaupt wird auf das Ufer ein besonderes Augenmerk zu richten sein, denn jede größere Gesellschaft wird sich, sowie sie den Garten betritt, auf diesen Punkt richten wie auf ihr Ziel, von hier wird sie das Wasser beobachten, von hier die Lagerung des Hauses genießen. Das verträgt starke Akzente. Auch ist es verlockend, sich auf die niedrige Quaimauer am Wasser niederzulassen, deshalb sollte man dem Wunsch zu rasten an dieser Stelle entgegenkommen, etwa mit Holzbrettern, die sich allerdings durch die Wetter verwerfen.
Nahe der Brücke zum Pavillon ließe sich die Anlegestelle für das Boot einrichten.
Dazu kommt die Gestaltung der Mauer an der Terrasse, von der man jedes Jahr ein anders komponiertes koloristisches Prunkstück herabfallen lassen könnte. Dies Herabfallen, belehrt sie der Freund, hat dem Beranken von unten sehr viel voraus. Es erhält den wichtigen grauen Ton der Mauer als Masse gegen das Grün mit dem Gold oder Purpur, das von oben niedersinkt, und es gibt feinere und lustigere Massenverteilungen. Außerdem hat man beim Beranken immer seine Not mit dem obern Abschluss.
Schade, dass wir’s nicht mündlich verhackstücken können.
Im Februar sind sie wieder draußen, studieren mit einer Behaglichkeit, die dem noch fernen Sommer entliehen ist, die Anlage, und noch immer gibt es nichts, was sie an Haus und Gelände im Grunde zu stören vermag, nur Ansporn sind ihnen jene Stellen, an denen noch das ein oder andere zu tun bleibt und die sich schon jetzt im Gespräch umreißen und auskleiden lassen mit Ranken, die sie herabfallen sehen wie bestickte Mäntel.
Der Rest muss sich durch Erleben, Einleben und Ausleben ergeben.
Einiges immerhin lässt sich fürs Erste durch Stöcke im Terrain markieren zur behelfsmäßigen Unterstützung der Vorstellungskraft.
Vor den Fliederbüschen müsste man den Brunnen platzieren. Das gäb’ die rechte Kulisse, und ich denk mir, der Fischotter muss doch den schönsten Platz haben und darf dabei nicht zu zart wirken.
Der Maler dreht sich mit unerwartetem Schwung, ist schon voraus, eilt hinüber zu den Büschen, um die grob umrissene Silhouette des Brunnens in Pappe am genannten Ort aufzustellen, denn alles kann letztlich nur an der Wirklichkeit probiert werden.
In seinen Bewegungen vermischt sich die gemächliche Breitbeinigkeit des Akademieprofessors mit der zappelnden Freude eines Jungen, der über Tage an einem Geschenk gebastelt hat und nun vor der Übergabe die Überraschung des Beschenkten nicht erwarten kann.
Das ist gut gesehen, hier ist der Platz, ihm ist, als plätschere bereits leise das Wasser, als könne sich der schlanke, nasse Körper des Tierchens doch bewegen. Als blühe schon wieder der Flieder.
Martha wird der Brunnen gehören, den er bei Gaul in Auftrag gegeben hat, zu Weihnachten hat er ihn seiner Frau geschenkt. Freuen wird sie sich, wenn sie erst einmal hier draußen sind – Begeisterung ist schließlich keine Heringsware, und bei mancher verlorenen Hoffnung haben sie sich zumindest die Empfänglichkeit für die Freuden des Lebens bewahrt.
Von den Bedürfnissen des Gartens aus hat die Welt ein anderes Gesicht.
Gaul, hat er gesagt bei einem Treffen in der Secession letzten Herbst, jetzt noch was Privates: Ein Brunnen fehlt noch bei uns draußen, und der Stein, mit dem Sie arbeiten, ist zum Glück ein nicht einschmelzbarer Stoff, den nachts in einem Boot zu entführen sich nicht lohnt.
Nicht lange, und sie sind einig geworden, und es zeigt sich wieder: Tiere kann der Gaul, und ein Fischotter ist ein netter Kerl, mein Gott, ja, freuen soll sich die Martha.
Und dazu, Lichtwark, sagt der Maler, wie er zurückkehrt, L’Âge d’Airain von Rodin, das Eherne Zeitalter, am Ende des Birkenwegs, mit der herrlichen Silhouette gegen das Wasser. Das gibt etwas. Der zu Höherem erwachende Jüngling. Wenn nur die Figur bald kommt.
In der Tat, antwortet der Freund, die Quaimauer müsste dazu allerdings wohl um ein Weniges erhöht werden. Wie überhaupt der Rodin, wenn er einmal da ist, seine Erfordernisse an die Piazzetta stellen wird.
Es ist ja am Ende doch halb Ihr Garten, lieber Lichtwark, aber nun will ich Sie hier draußen nicht länger beanspruchen. Lassen Sie uns für einen behaglichen Abend sorgen. Und vergessen Sie anschließend nicht, die Bücher wieder mitzunehmen, sie kamen wieder einmal gerade recht, und durchsichtig schreiben können Sie ja.
Im Sommer, den 21. Juli 1910, einen Tag nach seinem dreiundsechzigsten Geburtstag, kann das Haus bezogen werden.
An den Abenden dieses Sommers steht der Maler in seinem Garten, und auch wenn der Garten an manchen Stellen erst im zaghaften Kommen ist und neben den üppigen Nachbargrundstücken seine Neuheit noch durch nackte Erdflächen verrät: Er steht doch längst mitten darin und blickt hinunter zum See, auf dem heute ein Hauch von Grün liegt, der gestern noch nicht dagewesen ist, mit Sicherheit nicht.
Die Wand des Hauses trennt nur der gröberen Ordnung halber Garten und Atelier; für ihn ist’s eines, ein Raum, in dem der Blick Platz findet und mit dem er schneller zu verwachsen glaubt als mit jedem anderen Ort bisher.
Ungehindert der Blick – man muss ihn durch einiges Grün aufhalten, sonst wird er zu weit, das ist auch nicht gut für das Auge.
Es ist getan, und es ist gelungen.
Die Frage, ob Liguster für die Heckengärten oder doch, wie Brodersen anrät, Weißbuchen, die angeblich rascher wachsen, ist noch nicht beantwortet. Käthe, das gute Kind, hat schon brieflich in Hamburg um Rat gefragt, und so wird es sich schließlich finden, nur allzu absichtsvoll soll es nicht werden, sondern soll im Gesamten so geformt sein, dass es ganz formlos und selbstverständlich wirkt.





























