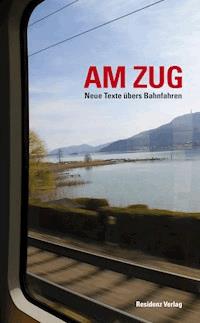
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wer schreibt, ist auch viel unterwegs: Lesereisen und Recherchen, kleine Fluchten und große Fahrten, Spurensuche und Fernweh. Manchmal geht es auch nur darum, die Welt vorbeiziehen zu lassen und sich selbst dabei fremd zu werden. "Am Zug" versammelt Texte zeitgenössischer Autoren rund um das Bahnfahren: aufregende Bahnhöfe und unfreiwillige Aufenthalte, End- und Zwischenstationen, flüchtige Begegnungen und schicksalhafte Zufälle, Schlafwagenabenteuer und Speisewagengeplänkel. Reisen bei Tag und bei Nacht stehen im Mittelpunkt eines vergnüglichen Lesebuchs, das uns von Station zu Station begleitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AM ZUG
Geschichten übers Bahnfahren
Mit Texten von Alois Brandstetter, Karl-Markus Gauß,Daniel Kehlmann, Michael Köhlmeier, Kurt Palm,Erika Pluhar, Julya Rabinowich, Peter Rosei,Eva Rossmann, Gerhard Roth, Tex Rubinowitz,Susanne Scholl, Julian Schutting, Ilija Trojanow,Anna Weidenholzer
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2014 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN eBook:978-3-7017-4482-4
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1638-8
INHALT
Karl-Markus Gauß
Bártok-Béla-Express, Ungarn
Tex Rubinowitz
Trance-Sibirische Eisenbahn
Daniel Kehlmann
Ich und Kaminski (Auszug)
Julya Rabinowich
Mein Leben in vollen Zügen und die Wandlung der Grenze
Eva Rossmann
Wer weiß
Peter Rosei
Wohin die Reise geht
Ilija Trojanow
Der Himmel über Kapiri Mposhi
Anna Weidenholzer
Franz
Susanne Scholl
Leere Worte
Alois Brandstetter
Eisenbahnglück
Erika Pluhar
Im Zug
Julian Schutting
Mein Bundesbahn-Lied
Gerhard Roth
Winterreise (Auszug)
Kurt Palm
Das Leben in vollen Zügen genießen
Karl-Markus Gauß
BÁRTOK-BÉLA-EXPRESS, UNGARN
Wenn ich von Salzburg nach Wien fahren muß und es sich irgendwie einrichten läßt, dann nehme ich den Zug, der um 10 Uhr 54, von München kommend, in Salzburg eintrifft und den Hauptbahnhof um 11 Uhr fünf verläßt. Seit einigen Jahren verfügt dieser Zug über eine in Fachjournalen gerühmte Lokomotive des modernsten Typs, und im Laufe der Jahre sind auch die Waggons bestens ausgestattet worden; aber nicht deswegen achte ich darauf, aus Salzburg um 11 Uhr fünf wegzukommen. Das Besondere dieses Zuges, der Bártok Béla heißt und dessen Namenspatron übrigens ein begeisterter Eisenbahnreisender war, ist sein Speisewagen.
Der Bártok Béla fährt zweimal täglich. Als Zug mit der Kennzeichnung EC 63 startet er in München um 9.29, um über Salzburg, Linz, St. Pölten um 14.05 in Wien anzukommen und von dort über die einst furchterregende, ihrer Bedrohlichkeit längst verlustig gegangene Grenzstation Hegyeshalom und Györ nach Budapest zu fahren, wo er um 16.59 eintrifft. Als EC 62 fährt er in der umgekehrten Richtung, startet am Bahnhof Kéleti in Budapest um 13.05 und erreicht um halb neun Uhr abends München.
Der Bártok Béla ist ein Zug der Österreichischen Bundesbahnen, aber sein Speisewagen ist ungarisches Territorium. Das bedeutet, daß man in ihm weder an einem hochcomputerisierten deutschen Imbißstand Schlange steht, noch in einer österreichischen Stehweinhalle unterwegs ist, sondern in ein ungarisches Restaurant gerät. Die Einrichtung hat den Charme einer altbürgerlichen Wirtsstube, über die weißen Tischdecken, die nach jedem Besucher wieder gewechselt werden, sind hübsch gefaltete rote Stoffservietten gelegt, und die ungarischen Kellner halten nicht nur distinguiert das Gleichgewicht, wenn der Zug sich bedenklich in eine Kurve legt, sondern wissen auch vom schwerbetrunkenen Landsmann, der sich der Heimat nur mit einem Barack nach dem anderen zu nähern wagt, bis zum Feinspitz, der ausgerechnet im Zug etwas Besonderes zu essen oder trinken wünscht, mit jedem auf ihre Weise umzugehen. Ungnädig werden sie nur, wenn man ein simples Fertiggericht bestellt, etwa Sajtáll, die gemischte Käseplatte, oder Salámifalatok, Brot mit grob gewürfelten Stücken ungarischer Salami. Dann fragen sie etwas unwirsch, ob es nicht doch das frischgemachte Szegedinergulyas, die Hortobágypalatschinken oder der Zander auf Reisplatte sein dürfe. Sie tun das nicht, weil diese Gerichte etwas teurer sind, sondern weil die achtlose Bestellung ihren Stolz verletzt, nicht anders als den eines Kellners in einem reputierlichen Speiselokal, der Hirschsteak auf der Karte hat und dessen Gäste Thunfisch aus der Dose serviert haben möchten.
Gyula Németh ist kein Freund von mir. Aber im Speisewagen des Bártok Béla haben wir uns jetzt schon so oft getroffen, daß wir einander grüßen und manches Mal an einem Tisch gesessen sind und von Salzburg bis Wien durchgeplaudert haben. Gyula Németh legt wert darauf, daß er nicht so heißt, wie ich ihn hier nenne, aber sonst alles genau stimmt, was er mir erzählt hat. Seit fünfzehn Jahren fährt er jeden Dienstag von München nach Budapest und am nächsten Tag wieder von Budapest nach München zurück. Als er nach München ging, in ein Architekturbüro, war das ein Aufbruch in eine fremde, erfolgversprechende Welt. Den Erfolg hat er nicht wirklich gefunden, und München ist weder Fremde geblieben noch Heimat geworden. So fährt er jede Woche heim, registriert, was sich dort alles ändert, um bei seiner mittlerweile von ihm geschiedenen Frau und den beiden groß gewordenen Kindern 21 Stunden zu verbringen.
Richtig nahe gekommen sind Gyula und ich uns, als der Speisewagen einmal von einer Rotte bayrischer Fußballfans gestürmt wurde, die in den Farben ihrer Mannschaft uniformiert waren und in angemessener Berauschung zu einem Europacup-Spiel nach Budapest fuhren. Sie waren in Mannschaftsstärke von zwölf Leuten, also inklusive einem Wechselspieler, angetreten, nannten die ungarischen Kellner allesamt Imre, die Frauen, die durch den Waggon gingen, eigenartigerweise »Eisen« und zeigten sich erfolgreich bemüht, das Ihre zum Ansehen Deutschlands im Ausland beizutragen. Ihr Frohsinn schloß jeden ein, der unvorsichtig genug war, den Blickkontakt mit ihnen nicht zu vermeiden, und drohte sich nur dann zu flaschenwerfender Laune zu steigern, wenn ein Gast des Speisewagens die Stirn hatte, sich trotz ihrer kumpelhaften Duzerei lieber mit seiner Zeitung, seinem Essen oder seinen Begleitern zu beschäftigen. Von Wels bis St. Pölten brachten die Leistungssportler immerhin vier Runden mit Bier und Schnaps weiter, die sie stets sofort und stets mit der Bemerkung beglichen, daß sich der liebe Imre dabei wohl um einige Euro zu seinen Gunsten verrechnet haben müsse. Die Kellner nahmen alle Frechheiten mit dem ihnen eigenen Gleichmut, was die meisten Gäste heftig bedauerten. Wir alle, die wir nicht zur Verstärkung des FC Bayern nach Budapest fuhren, fühlten uns belästigt und ärgerten uns. Alleine Gyula ärgerte sich nicht, nein, Gyula litt. Erst nach einiger Zeit begriff ich, daß er, der Ungar aus München, sich vor den ungarischen Kellnern und seinem österreichischen Gefährten für die bajuwarischen Barbaren schämte, in denen er, so fremd sie ihm waren, als Münchner aus Ungarn offenbar bereits so etwas wie seine Landsleute erkannte, für deren Benehmen er sich verantwortlich fühlte.
Von der EU hält Gyula viel und nichts zugleich. Die Europäische Union bin ich, behauptet er. Er arbeite gerne in Deutschland, verdiene ordentlich und habe, auch als ihn deutsche wie ungarische Freunde dafür gewinnen wollten, nie ernstlich daran gedacht, seine kapitalistischen Erfahrungen und geschäftlichen Verbindungen zu nutzen, um in Budapest eine eigene Firma aufzuziehen. Er sei schließlich in Deutschland auch nicht Teilhaber des Architekturbüros geworden, warum solle er jetzt mit deutschen Geldgebern zum ungarischen Geschäftsmann werden? Zu Zeiten des Kommunismus war Ungarn noch ein besonderes Land, zwar Ostblock, aber eben doch dessen liberaler Vorposten. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs habe Ungarn viel von dem Renommee eingebüßt, das freieste Land im Ostblock zu sein. »Aber Euch ist es auch nicht besser ergangen«, freut sich Gyula, »Österreich hat in der Welt auch mehr bedeutet, solange es noch an der Grenze zweier Blöcke lag.«
Gyula mag Ungarn nicht besonders, aber er wird bis ans Ende seiner Tage damit beschäftigt sein, nach Ungarn zu fahren und es nicht besonders zu mögen. Man versteht, warum ich bei jedem Gespräch mit ihm den Eindruck habe, es eigentlich mit einem österreichischen Landsmann zu tun zu haben.
Überhaupt, als er nach Deutschland gekommen war, habe er gestaunt, wie hart und diszipliniert in seiner Firma gearbeitet wurde. Mittlerweile sind die Deutschen schlampig, nachlässig, als wären sie Ungarn. In Ungarn hingegen arbeiten die Leute jetzt, als wären sie wie die Deutschen von früher: effektiv, ausdauernd, grimmig. Ja, muß ich Gyula da fragen, war es früher womöglich besser? »Nein, um Himmels willen, keineswegs! Nur, wo ist noch Deutschland und wo Ungarn?« Ich glaube, ich fahre so gerne mit Gyula, weil er ein heimatloser Melancholiker ist. Da der Westen ein wenig wie Ungarn und Ungarn ziemlich stark wie der Westen geworden ist, braucht er den Bártok Béla und diesen Speisewagen. Der ist ihm eine Art von fahrender Heimat, die es nicht mehr gibt.
Aus: Karl-Markus Gauß: Wirtshausgesprächein der Erweiterungszone
(Otto Müller Verlag, Salzburg-Wien 2005)
Tex Rubinowitz
TRANCE-SIBIRISCHE EISENBAHN
Am 24. Dezember 1984 bestieg ich mit meiner damaligen finnischen Freundin Vilma um 21 Uhr am Wiener Südbahnhof den Zug nach Moskau. Wien war wie ausgestorben, wattiert durch alle urbanen Geräusche und menschliche Widrigkeiten schluckenden Neuschnee, eine echte stille Nacht, eine gefräßige Stille, alle hatten gegessen und ihre Geschenke ausgepackt, die sie jetzt von allen Seiten betrachteten, sich freuten oder ärgerten, die Kerzen waren halb heruntergebrannt. Der leere D-Wagen brachte uns zum Bahnhof, der einsam seinen Dienst versehende Schaffner schaute immer in seinen Spiegel, wenn ich Vilma küssen wollte, sie wehrte mich ab, sagte: bitte nicht hier drinnen, meinte aber: nicht in dieser unberührten Nacht.
Am Bahnsteig wurden wir von einem Waggonschaffner empfangen, stilecht, wie ich fand, er lächelte, sein Gebiss war ganz golden, seine Uniform noch sowjetisch, also von einer militärischen nur mit kundigem Auge zu unterscheiden.
Er brachte uns zu unserem Abteil, der Zug war auch nicht viel voller, als die Straßenbahn gewesen war, ein paar Russen mit verschnürten Pappkartons, Feierlichkeit gab’s hier keine, aber es war ja auch nicht ihr Weihnachtsfest heute Nacht, das orthodoxe findet ein paar Tage später statt, der gregorianische Kalender geht etwas nach, oder unserer vor.
Der Zug fuhr an, und jetzt begann, mit nur einer Unterbrechung, eine magische Fahrt, deren Zauber nicht unbedingt im Ankommen lag, sondern sich eher auf der Strecke zwischen zwei Punkten entfaltete, die immer kleiner wurden, je konstanter und monotoner der Zustand, der Stillstand in der Bewegung wurde. Denn der Weg, den wir vor uns hatten, war lang, er ging nach Peking. Zunächst 40 Stunden nach Moskau, und dann sechs Tage nach China, Tage, die man schon nicht mehr in Stunden messen kann, so diffus werden sie im elastischen Raum.
Und dieses Erlebnis war unfassbar billig zu haben, so unwirklich wie der metaphysische Zustand, den man bei der Zugfahrt erreichen würde, nur 2000 Schilling pro Person, also irgendwas knapp über einem dreistelligen Eurobereich, dafür musste man sich aber auf einem komplizierten Weg ein chinesisches Visum besorgen, irgendwo ist ja immer ein Haken.
Weil es noch komplizierter gewesen wäre, an ein mongolisches Visum zu kommen, eine mongolische Botschaft gab’s in Wien nicht, nur in Budapest, wofür man ebenfalls ein Visum brauchte, beschlossen wir, die Route um die Mongolei herum zu nehmen, aber ein chinesisches Visum musste dennoch her, das russische Transitvisum war im Fahrkartenpreis inbegriffen, immerhin. Das Problem war dabei, dass die Chinesen gar kein Interesse hatten, Visa auszugeben, da kommen Leute mit spottbilligen Fahrkarten ins Land, geschickt von der alles kaputt subventionierenden Sowjetunion, was wollen die Touristen bei uns, was sind überhaupt Touristen, das Land ist noch gar nicht für sie vorbereitet, nur Verrückte machen Ferien in einer Volksrepublik, und nicht nur aus Stabreimgründen, ein diesbezüglicher Servicegedanke existierte jedoch noch nicht. So wurde mir gesagt, ich müsse ein Telex nach Peking schicken, vom Telegrafenamt, man diktierte einem Beamten einen englischen Text, ein Visumsansuchen, in eine merkwürdige Maschine, aus der sich dann ein Lochstreifen schlängelte, der in eine riesige Maschine eingespeist wurde, die unser Gesuch nach Peking, ja, was? Kabelte? Kaum vorstellbar, dass der Streifen durch ein Kabel, nun ja, kroch. In Peking kam dann ein ebensolcher Lochstreifen aus einer vermutlich noch viel größeren Maschine, ich stellte mir blinkende Lämpchen und schnarrende Geräusche vor, und wenn der dechiffriert war und für o.k. befunden wurde, wurde das auf dem gleichen Weg in die chinesische Botschaft in Wien geschickt und man konnte sich das Visum abholen. Nur funktionierte es nicht, jedes Mal, wenn ich in der Botschaft war, meinte man, nein, kein Lochstreifen angekommen, ich war verzweifelt, es waren nur noch wenige Tage vor der Abfahrt, kroch der Streifen so langsam, war das Kabel verstopft, was hab ich falsch gemacht? Ein zufällig anwesender Reiseleiter, der gerade für eine Gruppe einen Stapel Pässe, die mit den kompliziert zu beschaffenden Visa vollgestempelt waren, abholte, erklärte mir, dass er mein Problem kenne, der Streifen käme zwar in China an, würde aber dort ignoriert, weil er vermutlich von dem Normansuchen abweiche, er diktierte mir den Standardsatz, die Wortwahl müsse exakt so sein, Abweichungen ließen sie nicht zu, ich ließ ihn abermals nach China qua Lochstreifen kabeln, und am nächsten Tag war die Bestätigung in der Botschaft, die Pässe konnten gestempelt werden.
Und nun saßen wir also im Zug, gefangen genommen von einem freundlichen Sowjetmann mit goldenem Gebiss, endlich frei, endlich erlöst zumindest für 40 Stunden und 6 Tage, auch wenn wir nicht wussten, von was eigentlich erlöst, draußen verschwand Weihnachten in der Finsternis, alle Sorgen zurücklassend, bildeten wir uns ein, wir fahren ans Ende der Nacht.
Nur vage weiß ich noch, was wir an Gepäck mitnahmen, genau kann ich mich aber an einen kleinen, tragbaren Batterieplattenspieler erinnern und an eine Handvoll Singles, ich erinnere mich an: Eydie Gormé/ Love Me Forever, Petula Clark/ I Couldn’t Live Without Your Love, Helen Shapiro/ You Don’t Know, Jackie Trent/ Where Are You Now, Lesley Gore/ You Don’t Own Me, Bessy Banks/ Go Now, Babs Tino/ Forgive Me (For Giving You Such A Bad Time), The Ronettes/ Baby I Love You.
Wir liebten dieses Zeug, wir definierten unsere Liebe über diese bittere Mädchenmusik, letztlich waren diese Platten der Kitt, der uns zusammenhielt, einmal am Tag gab es eine kleine Disco mit unserer mobilen Jukebox im engen, überheizten Abteil, und wir fühlten uns so einzigartig und unverwundbar und unzertrennlich, wie es eben jungen, unrealistischen Verliebten eigen ist.
Was ich auch noch weiß, ist, dass wir ungefähr 5 Kilo Orangen mitnahmen, irgendwie mussten wir erfahren oder uns selbst zusammengereimt haben, dass die Kost im Zug nicht unbedingt vitaminreich sein würde, gar Skorbut drohe.
Die Strecke von Wien nach Moskau verschliefen wir hauptsächlich, allenfalls unterbrochen von einer Orange und einem kleinen, schaukelnden Tänzchen.





























